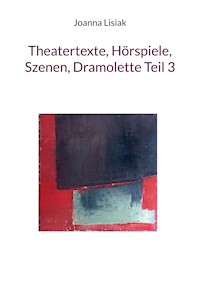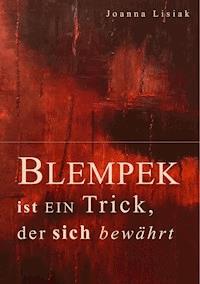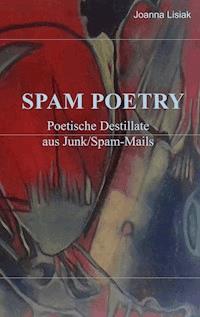Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stimmungen, innere Gespräche. Befindlichkeiten, Launen, unmethodische oder logische Gedankengänge. Die Seelenlagen mal schwankend, mal sich windend. Die Menschen beobachten, entrüsten sich, ordnen ein, klären auf, merken an, lotsen aus. Suchend, versuchend, sich zerstreuend, sich selbst auf der Spur. Gelegentlich ein erfreulicher Fund. Eine dunkle Wolke verzieht sich, eine komische Gegebenheit verschafft ein unerwartetes Lächeln. Dies, was die Moodboard Stories miteinander verbindet, was sie lose zusammenhält oder ergänzend dazwischenwirkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zu den Moodboard Stories
Dostojewski wäre neidisch gewesen
Fenster
Meine Gäste und die Steine
Nach der Vorstellung
Sie werden immer jünger
Schachspiel
Wenn er hier wäre
Das Manuskript
Entdeckung
Tagesablauf
Er, die Schöne…
Ein Tag wie eine Woche
Gesprächsfetzen
Während sie sich über die Stirn fuhr
Sein Handy
Geblümt ist es auf rotem Grund
Paket
Am Barbara-Tag
Vom Erblicken
Mit Mütze, mit Brille
Beim Friseur
Friseurbesuche
Ohne Umschweife
Eintöpfe
Tagebuch
Auf Besuch zu einem alten Mann
Marginalien
Ich war einmal ein Fan
Bonbons
Ein Tag
Fahrt ins Ungewisse
Rebeccas Hand
Die Sache mit der Brille
Die neue alte Seite
Veränderung
Wiedersehen
Spiegelbild
Der Brief
Die Geschenke
Hier könnte
Wenn man könnte
Zu den Moodboard Stories
Stimmungen, innere Gespräche. Befindlichkeiten, Launen, unmethodische oder logische Gedankengänge. Die Seelenlagen mal schwankend, mal sich windend. Die Menschen beobachten, entrüsten sich, ordnen ein, klären auf, merken an, lotsen aus. Suchend, versuchend, sich zerstreuend, sich selbst auf der Spur. Gelegentlich ein erfreulicher Fund. Eine dunkle Wolke verzieht sich, eine komische Gegebenheit verschafft ein unerwartetes Lächeln. Dies, was die Moodboard Stories miteinander verbindet, was sie lose zusammenhält oder ergänzend dazwischenwirkt.
Dostojewski wäre neidisch gewesen
Kaum hat man sich gewöhnt, will Holger zum Barbier. Radikale Maßnahmen schreibt er. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Je nachdem, in welcher Stadt er sich bewegt, ist er mit seinem neuen Bart entweder ein verschrobener Seemann oder ein Hipster. Die üppige Haarpracht im Gesicht ist für Holger ein neues Kommunikationsmittel geworden, so wie man mit einem behaarten Vierbeiner an seiner Seite auch rascher ins Gespräch mit anderen kommt als ohne. Holger ist mit dem Bart in seine gesellige Art wörtlich hineingewachsen. Am Anfang lagen die Scherze nahe, ob er etwa einen neuen Nebenjob als Weihnachtsmann habe oder ob man ihm Geld für neue Rasierklingen borgen könnte. Die Sprüche häuften sich zunächst, doch als der Bart länger und länger wurde, sprach man nicht mehr darüber. Ich war mir seit Anbeginn sicher, es musste etwas dran sein an diesem Bart. Eine Statistenrolle an der Oper, eine verlorene Wette, oder der Bart war, wahrscheinlich unbewusst, psychologisch motiviert. Das hätte ich in Ruhe und bei etwas Hochprozentigen zusammen mit Holger gerne ergründen wollen. Ich war bereit, jederzeit mit ihm darüber zu sprechen, auch am Telefon. Doch er verstand nicht, was ich meinte, als ich von einem Auslöser, einer Zäsur, einer tieferliegenden Bedeutung sprach. Über den Bart sollen wir reden? fragte er bloß erstaunt.
Ich wechselte das Thema, denn Gespräche dieser Art können rasch peinlich werden, wenn sich nicht beide auf einen verbalen Austausch einstellen wollen oder jemand den anderen von einem Thema überzeugen möchte. Holgers Bart wurde immer dichter, üppiger, aber zugleich formschöner, da jedes Haar offenbar die richtige Wuchsrichtung kannte und Holger ihn an den richtigen Stellen zu stutzen wusste. Kein zottiger Bart war das, sondern ein gepflegter. Ich gewöhnte mich trotzdem nur langsam an den Anblick. Ich versuchte durch den Bart zu Holger hindurchzusehen, als wären das zwei verschiedene Phänomene, die gesondert betrachtet werden wollten. Als wäre der Bart der Bart und Holger noch immer Holger. Doch als die Leute ihn mit Dostojewski zu vergleiche begannen, musste auch ich anerkennen wie schön und einzigartig der Bart war und wie dieser neue Übername ein Kompliment sein musste. Der Bart hat das Potenzial eine eigene Karriere zu machen, hieß es. Zunächst klang es ironisch und neckisch, doch die Wahrheit drückte durch. Man musste, ob Mann oder Frau, neidlos anerkennen, dass der Bart Holger verdammt gut zu Gesicht stand. Er solle dranbleiben. Die Bart-Figaros auschecken, vielleicht etwas auf YouTube schalten, dort Pflegetipps geben und dergleichen. Er solle sich schlau machen, nach anderen Bartträgern Ausschau halten, recherchieren, sich in einem Bartverein austauschen, sich über Barthaarprodukte erkundigen, eine Bartbewegung ins Leben rufen. Mit Bärten sei heutzutage Geld zu machen, riet ihm ein Kollege. Doch sein Bart alleine war es nicht, der alle so verzauberte. Ein Bart für sich kann auch keine Karriere alleine machen, wären da nicht noch Holgers stahlblaue Augen mit den kleinen Lachfältchen ringsum, nicht viele sind es, aber tiefe, oder seine gut gestalteten Zähne, die mitten durch den Bart aufblitzen, wenn Holger lacht. Holgers enganliegende Ohren, die gerade fleischige Nase. Dazu Holgers schnieker, so perfekter wie lässiger Haarscheitel. Sein Barbier hatte die Idee mit dem Scheitel, und seit Holger das Haar so trägt, hat er in der Tat etwas von einem gestandenen Dichter und Denker. Vielleicht auch deshalb, weil Holger so eine bewundernswert gute Haltung hat und auch seinen Kopf gerade zu halten versteht und dadurch selbstbewusst wirkt. Meine Nachbarin möchte Bärte wie Holgers Pracht auf Briefmarken sehen. Ein Freund findet, dass Portraits mit derlei Bärten in ovale Rahmen gehören, die Tapeten mit Blumenranken zieren oder die auf Beistelltische im Jugendstil platziert sind. Ich sehe Holger und seinen Bart in einem schicken Londoner Restaurant dinieren. Ich schließe subtil eingearbeiteten Glitter nicht aus. Auf jeden Fall ein Produkt wie «Brillantine», wenn er abends weggeht und die Bars und Clubs von Metropolen – Tokyo, New York, Paris – unsicher macht, was er anscheinend noch immer gerne tut. Über seine vierzig hinaus ist er nicht müde geworden auszugehen, Cocktails zu trinken, sich rhythmisch bewegende Körper anzuschauen oder selber hie und da mitzuwippen. Mit dem Bart ist das sicher eine andere Erfahrung als nackt. Darüber hätte ich gerne mit Holger gesprochen. Aber jetzt, wo er den Termin für das Vorhaben der radikalen Maßnahme plant; wozu alles nochmals aufwärmen? Ich habe heute Fjodor Michailowitsch Dostojewskis Portrait recherchiert. Sein drahtiges Geflecht, das sein Bart war, steht in keinem Vergleich zu Holgers prächtiger Fülle. Man käme nicht auf die Idee, einem solchen Bart wie dem des großen russischen Schriftstellers nachzuweinen. Bei Holger aber ist der Fall ein ganz anderer.
Fenster
In der ersten Wohnung gab es viele Fenster. Das größte führte auf den Balkon, auf dem ich gerne die Zeit mit Oma verbrachte. Wir haben dort grüne Bohnen zubereitet. Als ich älter wurde, haben wir dort gelesen und uns plaudernd die Zeit vertrieben. Die Hausfassade gegenüber war prächtig, geschmückt mit Figuren, Ornamenten und wunderschönen Fenstern. Das oberste Stockwerk hatte sogar runde und halbrunde Fenster, hinter denen ich mindestens einen Ballsaal erwartete. Ich wusste nicht, wer in diesem Haus wohnte. Es mussten edle Leute sein, die Wichtigeres zu tun hatten, als sich mir zu zeigen. Auf unserer Seite war das ganz anders. Ständig trat einer auf den Balkon hinaus, grüßte, goss die Geranien oder hängte Wäsche auf. Im Haus gegenüber soll es einmal einen Kindergarten gegeben haben, in dem sogar meine Mutter vor vielen Jahrzehnten gewesen war. Irgendwie war ich auf diese Tatsache neidisch, denn wie gerne hätte ich mal gesehen, wie sich dieses Haus und die Räume von innen präsentierten. Ich hatte eine vage dunkle Vorstellung davon, und diese hält sich in einer unbeschreiblichen Erinnerung bis heute in mir.
Wenn man aus unserer Wohnung vom Balkon herunterschaute, blickte man auf eine herrliche Baumallee und eine Straße, die so schnurgerade verlief, dass man sehr weit sehen konnte: auf der einen Seite in Richtung meines eigenen Kindergartens mit dem kleinen Park dahinter und sogar noch weiter. Auf der anderen Seite bot sich der Blick bis zum großen Spielplatz, dann weiter zur Straße, die zu den zahlreichen Krämerläden und zum Markt führte.
Die Fenster zum Hinterhof waren dunkler und kleiner als auf der sonnigen Vorderseite des Hauses. Etwas Geheimnisvolles ging von ihnen aus. Aus diesen Fenstern getraute ich mich bloß wenig hinauszuspähen, am liebsten heimlich, ohne dabei gesehen zu werden. Ich liebte es durchaus im Hinterhof zu spielen, weil es dort so stimmungsvoll war. Die Schatten fielen hier lang. Gegen den frühen Abend im Sommer wurden sie immer länger und von der Dauer her rhythmischer und kürzer. Die Sonne wanderte auf den kleinen Dächern und Mülltonnen, beschien die dunklen Ecken, bevor sie sich irgendwann ganz verzog und es Abend wurde. Man musste in diesem Hinterhof auf der Hut sein. Man spielte hier ganz anders als auf dem Spielplatz. Denn in jedem Moment konnte hier jemand vorbeikommen, einen Kartoffel- oder Abfallsack schleppend, oder mit einem kaputten, zu reparierenden Fahrrad, oder weil er durch den Hintereingang ins Haus schlich. Einmal habe ich in diesem Hof einen goldenen Ring in einer Herzform gefunden. Es war ein drahtiger Ring, als wäre er selbst gemacht worden. Es war der schönste Ring von der Welt. Ich hatte ihn ohne Zögern genommen und mit nicht wenig Stolz meiner Mutter geschenkt. Sie war sehr glücklich. Ein wenig, schien mir, waren wir beide überdreht vor Freude, als wir bemerkten, dass der Ring aus echtem Gold war. Seither suche ich Goldringe.
Im Wohnzimmer ist einmal meine Schwester auf den äußeren Fenstersims geklettert als sie noch ein Baby war. Was für ein Glück sie hatte, dass meine Oma vor Schreck nicht erstarrte und die Kleine stattdessen rasch packte und sie wieder ins Innere der Wohnung zurückholte. Ich frage mich, ob kleine Babys den Höhenunterschied schon wahrnehmen können. Ich traue meiner Schwester zu, dass sie damals trotz der wenigen Lebensmonate, die sie hatte, genau wusste, was sie tat und selbst auf sich aufgepasst hatte auf dem Fenstersims.
Unsere zweite Wohnung hatte Fenster lediglich zur einen Seite hin. Das ganze Wohngefühl war dadurch beeinflusst, so, als lebten wir dort einseitig, nur halb. Vielleicht meine ich das bloß, denn diese Wohnung war von Anbeginn lediglich ein vorübergehendes Zuhause. Wir wohnten in einem hohen schmalen Block, in dem es eigenartig roch, weil man dort – wie es damals in diesen Siedlungen üblich war - den Müll durch einen Schacht herunterwarf. Das Abfallrohr befand sich in der Nähe des Lifts und war in einem sehr Sonnen beschienenen Treppenhaus gelegen. In der Wohnung war es weniger hell. Ich schaute manchmal aus dem Fenster, aber wenn ich es öffnete und jemanden zurief, der unten stand, wurde mir ein wenig schwindelig und ich mochte dieses Gefühl nicht allzu oft haben. Im Inneren der Wohnung hatten wir ein Fenster zur Küche hin, wo man die Speisen hindurchreichen konnte. Das fand ich lustig, aber wir hielten das Fenster aus Angst vor Schaben lieber geschlossen. Diese Wohnung war sehr klein. Vielleicht deswegen, und weil ich da oftmals alleine zu Hause war, empfand ich diese Wohnung als meine eigene. Hier begann ich das Aufräumen für mich zu entdecken, so etwas wie ein Wohn- und Raumgefühl zu entwickeln und Kräfte zu mobilisieren, um selbst mit schwierigen Aufgaben klarzukommen, wie dem Zusammenlegen der für ein Kind sehr großen Bettdecken oder dem Aufklappen der Bettgestelle, um die Decken und Kissen dort zu versorgen.
Die Fenster in der dritten Wohnung öffneten sich auf zwei gegenüberliegende Seiten hin. Jeder Ausblick war schön, und besonders gelungen waren auch all die Schreinerarbeiten, die sich mein Vater ausgedacht hat. Die Holzwandverkleidung im Gang, die clevere Trennwand im Schlafzimmer meiner Eltern oder der runde feierliche Tisch, der deswegen so speziell war, weil er zu besonderen Anlässen zu einem Oval herausgezogen werden konnte. Ich erinnere mich gut an eine gelbe Haarbürste, die mein Vater aus Schweden mitgebracht hatte. Sie war so erfrischend, dass ich sie im Korridor vor den Spiegel platzierte als Einladung für jeden, der sich mit ihr bürsten wollte, wenn ihn danach gelüstete. Es genügte auch, diese gelbe Bürste beim Vorbeigehen lediglich bewundernd zur Kenntnis zu nehmen. Denn fast immer kam man an der Bürste vorbei, wenn man von einem Zimmer zum anderen wechselte. Die gelbe Bürste lag quasi im Zentrum der Wohnung.
Es war endlich die Wohnung, auf die wir schon so lange gewartet hatten: Unser Zuhause. Wir sind oft im Rohbau, über Schranken und Baustellen zur Wohnung gelangt, um dann dort alles zu kontrollieren, abzumessen und Pläne zu schmieden. Den Geruch von neuen Bauten und Baustellen mag ich deshalb bis heute. Ich machte bei diesen Abmessungsunternehmungen ja nicht mit, und auch erinnere ich mich nicht mit meiner Schwester gespielt zu haben, während meine Eltern alles besprachen und planten. Wohl habe ich die Zeit genutzt, um diesen Baustellengeruch vollumfänglich einzuatmen und ihm einen Geruchsort im Gehirn zu schaffen. Die aufgebrochene Erde, die Zementmischungen, die noch nicht getrockneten Mauern, das Gemisch des Bauschutts unter den Füßen. Düfte des Neuen, Aufregenden.
Als wir eingezogen waren, konnte ich durch das große Fenster mit dem Balkon auf den Spielplatz blicken und auf die allergrünste Wiese, die ich bisher gesehen hatte. Vielleicht, weil sie inmitten der frisch getünchten Blöcke stand und mit den Erinnerungsbildern des grauen Baus kontrastierte, die ich noch nicht abgelegt hatte. Vielleicht wusste ich auch insgeheim, dass dies ein kurzer Moment war, in dem ich diese Wiese so sah, denn bald würde ich schließlich meine Erfahrungen auf ihr machen und würde somit neue Erinnerungsbilder zu sammeln beginnen. Auch war sie so pünktlich zum Einzug da, wo es vorher nichts gab, als wäre sie ein Wunder, ein giftgrünes Spektakel.
In meinem eigenen Zimmer war ein Fenster, durch das ich gerne hinausschaute. Meine Mutter und ich beobachteten von dort den Nachbarn vom Parterre, der uns amüsierte, weil er den Tick hatte, abermals am Tag zu seinem Auto herunterzugehen, es zu inspizieren und – so schien es uns – sein Gefährt zu streicheln. Wir gaben ihm den Namen „Storch“, weil er diese spezielle Gangart hatte, die uns an einen großen, schlaksigen Vogel erinnerte.
In dieser Wohnung lebten wir zuerst zu viert, schon bald bekamen meine Schwester und ich einen kleinen Hund, der nach Stroh und Honig roch und mit dem ich alleine den naheliegenden Feldern entlang spazieren durfte, bis zum kleinen Bach und bis es mir verleidete und meine Mutter die Spaziergänge übernehmen musste. Meine kleine Schwester war zu klein, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Sie sah damals aus wie ein pausbäckiger Engel, und noch zauberhafter war sie, wenn sie in meinem Auftrag und ohne das Wissen meiner Eltern frisch gepflückte Feldblumensträusse an fremde Leute verkaufte, die gerade von der Arbeit nach Hause kamen. Wir verdienten so unser kleines heimliches Taschengeld, denn ich war wild auf all die Möglichkeiten, die sich im älteren Teil der Siedlung boten, wenn man nur etwas Kleingeld hatte. Da war beispielsweise ein Laden mit Süßigkeiten, Kleinspielzeug, Murmeln und Etuis aus China, die so sonderbar exotisch nach frischem Plastik und Ferne rochen, dass Glücksgefühle in mir hochkamen ob der eigenartigen Süße. Es war ein Laden, vor dem sich die Kinder nur so tummelten. Es gab hier allerlei bunten Krimskrams für jeden Geschmack, und für jedes Alter war etwas dabei. Ich erinnere mich auch an eine Art Café inmitten von Blocks umgeben, wo man Eis, Limonade oder Pommes bekam. Es war eine aufregende Zeit, in der ich meine Selbständigkeit weiter ausbaute und mit meinem ersten zusammenklappbaren Fahrrad unfassbar weit in der Nachbarschaft, und vor allem auch sehr schnell, vorankam.
In unserem Ferienhäuschen auf dem Land, wo wir viele Sommerwochenenden verbrachten, gab es nur wenige und kleine Fenster. Ich schaute hier nie hinaus, weil wir ohnehin nur zum Schlafen ins Häuschen gingen. Die meiste übrige Zeit spielte ich draußen im riesigen Garten oder im benachbarten Getreidefeld, in dem es manchmal quiekste, weil dort kleine Mäuse lebten. Zurückdenkend an die Zeit dort, sind mir vor allem die Autofenster geblieben, durch die ich hindurch guckte, wenn wir über Land fuhren. Eingeprägt hat sich das Rückfenster, wo wir im Auto auf meine Mutter warteten, bis sie endlich wieder aus dem Bäckerladen herauskam, mit einem frischen und meistens noch warmen Brot, das wir für das Wochenende kauften. Ich sollte den Brotlaib auf dem Rücksitz aufbewahren, doch ich konnte nicht widerstehen, nicht doch in den warm duftenden Hefeteig und in die knusprige Rinde zu beißen. Selten konnte ich mich beherrschen und nur ein einziges Mal abbeißen, was meine Mutter offiziell erlaubte. Manchmal aß ich heimlich das halbe Brot auf. Dabei war ich etwa erst sieben Jahre alt und spindeldürr.
In unserem vierten Daheim wohnten wir bei anderen und waren da nur vorübergehend zu Besuch. Auch hier gab es auf alle Seiten hin Fenster und einen Hinterhof, der aber um einiges gepflegter war als der in der Wohnung meiner Oma. Von den Hauptfenstern schaute ich fasziniert auf das bunte Treiben einer Stadtstraße, wo ein reger Autoverkehr herrschte und es sogar eine blinkende Leuchtreklame gab. Seitlich war jedoch ein Fenster, das sich sehr nah vom Haus gegenüber befand. Dort wohnte ein Mann, dessen nackten Po wir Kinder gelegentlich sahen. Meine Cousine und ich erschraken darüber sehr und mussten dennoch hysterisch herumbrüllen, wenn der Mann auftauchte und uns sodann verstecken, weil wir auf keinen Fall seine Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollten. Der Po, wohl der erste fremde Männer-Po in unserem Leben, nannten wir Pfirsich. Er war unser Geheimnis. Sagte eine von uns „Pfirsich“, kreischten wir innerlich. Wenn ich in der Wohnung alleine zu Hause war, wissend um diesen nackten fremden Pfirsich gegenüber, getraute ich mich kaum durch dieses Fenster herüberzusehen. Einzig zur Kontrolle guckte ich kurz hinüber, prüfend, ob der Mann zu Hause war, und wenn er da war, machte ich das Licht aus oder kroch unter dem Fenster hindurch, damit er mich auf keinen Fall den Raum durchqueren sehen konnte. Wenn er wirklich gewollt hätte und geschickt wäre, hätte er es theoretisch schaffen können zu uns hinüberzuklettern. Wie im Film. Das wollte ich nicht riskieren.
Auf die fünfte Wohnung hat sich die ganze Familie mit dem neuen Baby sehr gefreut. Es war ein Geschenk, dass wir die Wohnung so schnell bekommen haben und schon bald einziehen konnten. Wir wohnten in der obersten Etage in der Eckwohnung und ich fühlte mich dadurch sehr privilegiert. Gleich auf drei Seiten hin gab es Fenster, auch im Badezimmer war eins.
Vom Wohnzimmer aus bot sich ein prächtiger und weiter Blick. Bis zum großen Hauptplatz einen guten halben Kilometer entfernt, konnten wir von diesem Zimmer blicken. Auch war bestens zu erkennen, wie die beiden Tramlinien mittig zusammenkamen und sich zum Hauptplatz hin die Schienen teilten. Wir sahen linkerhand auf den Kirchenturm, dahinter war der Berg mit dem Wald zu erkennen. Seitlich gab es ein paar kleinere Läden, darüber war die Kinderbibliothek und weiter vorne der Supermarkt untergebracht. In diesem Haus gab es zuoberst eine Tanzschule mit riesigen Fenstern, und ich hatte das Glück, hier die verschiedenen Tanzklassen zu beobachten. Besonders am Abend konnte ich bestens in den hell beleuchteten Saal hineinblicken und die Tanzschritte quasi mitzählen. Gerne wäre ich einmal dort im Raum mit den Tanzenden gewesen, sei es nur schon, um zu hören, zu welcher Musik sie tanzten. Doch es war, als würde mir zu Räumen, die ich nur durch die Fenster und in Fenstern sah, der Zugang über eine Türe verwehrt. Gerade so, als gäbe es diese Türe überhaupt nicht für mich, und die Leute, die dort tanzten, waren dort, weil sie jenen speziellen Eingang kannten oder einem Geheimbund angehörten, für den ich nicht bestimmt war. Ich versagte mir, zu viele Gedanken darüber zu verlieren, da ich mitunter überzeugt war, dass diese Schule extrem teuer sein musste und nur echte, ausgebildete Tänzer dort tanzen durften. Es gab außerdem nur Erwachsene dort. Mir gefielen die vielen Spiegel, und dass davor richtige Ballettstangen angebracht waren.
In unserem großen Kinderzimmer konnte meine Schwester und ich auf die Bäckerei und den Kiosk schauen sowie auf den kleinen Weg, der zur Schule führte. Wenn ich mich da aus dem Fenster lehnte, sah ich die gerade breite Straße, auf der ich später so beglückt zunächst Fahrrad, dann Motorrad und später Auto fuhr. Aber auch der Asphalt des parallel zu dieser Straße verlaufenden Trottoirs diente mir bestens, wenn ich mit meinen Rollschuhen unterwegs war.
In der Zeit, als ich Filme über außerirdische Wesen sah und in einer Jugendzeitschrift viel über Außerirdische berichtet wurde, hatte ich Angst vor dem Fenster in unserem Kinderzimmer, vor welchem meine Schwester schlief und durch das die Außerirdischen hätten kommen und uns nachts mitnehmen können. Ich sah die Außerirdischen eine Zeit lang ziemlich deutlich vor diesem Fenster auf uns zufliegen, und manchmal sprachen sie mit mir. Wenn es zu dunkeln begann, schloss ich dieses Fenster vorsorglich.
Am anderen Fenster zur Bäckerei hin saß ich stundenlang- und es kommt mir im Nachhinein so vor, als hätte ich dies jahrelang getan. Ich setzte mich auf die warme Heizung davor und blickte hinaus. Es war ein magischer Ort. Kaum ein Tag verging, ohne, dass ich nicht dort saß. Ich beobachtete das Treiben unten und genoss zudem den großen Baum vor diesem Fenster. Als der Baum gefällt wurde, war ich sehr traurig und vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben auch ohnmächtig. Ich spürte den Drang etwas unternehmen zu wollen, auch wenn ich nicht wusste, was und wohin mit meiner kindlichen Wut. Ich verstand überhaupt nicht, warum der Baum, der so lange vor mir gelebt hatte, gehen musste. Anstelle des Baums, baute man bald eine kleine Garageneinfahrt und eine neue Treppe mit Geländer, die mir beide derart missfielen, dass ich eine Zeit lang diesen neuen Aufgang boykottierte und den kleinen Umweg weiter vorne auf mich nahm, um beispielsweise zu unserem Postfach zu gehen bei der Post gleich um die Ecke. Es stand außer Frage, dass der schöne alte Baum viel länger hätte leben müssen. Später stutzte man auch den Baum vor dem Balkon. Dann war es deutlich wärmer in der Wohnung und im Sommer mussten wir fortan regelmäßig die Jalousien herunterlassen. Ich hasste die Baumfäller und deren Chefs und fand sie allesamt sehr dumme, ignorante Leute. Als die Bäckerei gegenüber bald darauf gleich zwei weitere Bäume fällte, um einen blöden Sitzplatz zu bauen, verstand ich die Welt nicht mehr. Wie und wem konnte ich erklären, dass ein paar Stühle unter Baumschatten an Ambiente und Stil kaum überboten werden konnten und was diese Leute da unten Terrasse nannten, für mich lächerlich war.
Wenn meine Mutter einmal in der Woche abends von ihren Tanzproben nach Hause kam, machte ich es mir zur Gewohnheit, aus dem Wohnzimmerfenster nach ihr Ausschau zu halten und ebenso nach ihr zu hören. Ihre Stöckelschuhe hörte ich schon von Weitem gut, und auch ihr zügiges und bestimmtes Schritttempo war mir sehr vertraut.
Ich öffnete in diesem Zuhause die Fenster regelmäßig, um durchzulüften. Ich mochte diesen Akt, zumal dies mit dem Aufräumen einherging, das ich ja schon früh und hier besonders gern mochte. Die Fenster aufzureißen war Teil meines Aufräumrituals: ich räumte auf, solange die Fenster offen waren. Dabei ging ich Zimmer für Zimmer durch und wuselte wild in der ganzen Wohnung hin und her bis alles an seinem richtigen Platz war. Am Ende schloss ich die Fenster mit einer feierlichen Geste. Nicht minder feierlich wartete ich auf meine Mutter, um ihr dann Zimmer für Zimmer zu präsentieren und sie auf Kleinigkeiten aufmerksam machte, die ich mir ausgedacht habe: kleine Arrangements von Vasen, immer wieder aufs Neue umgestellte Nippes, Gegenstände, die ich aus Schränken hervorgeholt und andere, die ich dort stattdessen versorgt hatte. Nie sagte ich, dass ich selbst diejenige war, die alles aufgeräumt hatte, denn wir sprachen ein wenig ironisch und auch ein wenig ernst stets von den Heinzelmännchen, die hier gewirkt haben sollen.
Einmal stand ich an einem der Fenster und drohte meiner Mutter herunterzuspringen. Ich mochte nicht, wenn sie sich allzu oft mit ihrer Tanzclique verabredete und abends Dinge unternahm, bei denen wir nicht dabei sein konnten. Es gab eine Zeit, da dachte ich, mit etwa elf oder zwölf Jahren allein für die Hausregeln besorgt sein zu müssen und alles zu bestimmen. Auf meinem Schlachtplan stand außerdem Rauchentzug. In meinem Zimmer hing ein Poster mit der Aufschrift: „Nein danke, ich fahre.“ Ich freute mich schon Jahre im Voraus, diesen Satz eines Tages mit einem Lächeln sagen zu können und dabei dezent auf meine Autoschlüssel hinzuweisen. Den Anhänger für mein noch nicht vorhandenes Automobil und noch vor der ersten Fahrstunde hatte ich jedenfalls schon.
Als das Haus renoviert wurde, nutzten wir die Gelegenheit, um durch die Fenster aufs Gerüst nach draußen zu klettern, um zu den griechischen Jungs im unteren Stockwerk zu gelangen. Auch sie kamen während dieser Bauphase öfters zu uns Mädchen hinauf und erschreckten uns immer wieder aufs Neue, wenn sie urplötzlich grinsend ans Fensterglas trommelten. Die Mutter der beiden hatte die Angewohnheit aus dem Küchenfenster auf die Wiese zu spucken. Ich fand, dass die Welt in Ordnung war, wenn sie zu Hause war und möglicherweise aus einem Ritual heraus, wenn sie ebenfalls aufgeräumt oder für den Abend vorgekocht hatte, lauthals aus dem Fenster spuckte. Wahrscheinlich schaute sie sich dabei auch nach ihren Söhnen oder ihrem Mann um, auf die sie zu Hause wartete so wie ich einen Stock weiter oben meiner Familie entgegensah.
Ich mochte den Blick aus dem Küchenfenster sehr. Er führte direkt ins Grüne, auf eine hügelige Wiese, wo wir spielten. Es gab dort viele Bäume und Sträucher, sowie blickte man von hier aus bestens auf die Balkone der zwei anderen Blöcke vis-à-vis. Frau Schweizer hatte den schönsten Balkon von allen. Er war grün, gepflegt und man fand sie dort nachmittags im Halbschatten inmitten ihrer Blumen lesend und zufrieden vor. So stellte ich mir das Erwachsenensein vor: mit einem Buch in einer zwitschernden Natur, auf dem Tisch ein Stück Kuchen und dazu eine Tasse Kaffee.
In dieser Wohnung hatte meine andere kleine Schwester unsere Hauskatze aus dem Fenster geschmissen. Ich glaube, sie tat es mehrfach. Die Katze hatte es wie durch ein Wunder stets überlebt, obschon wir im dritten Stock wohnten. Nur der Kanarienvogel, den sie ebenfalls nach draußen entließ, kam irgendwann nicht mehr zurück. Sie war unser süßes Nesthäkchen, das gerne Unfug trieb. Sie war schon ziemlich frech zur Welt gekommen. Gleichzeitig war sie umwerfend charmant.
Als ich in meine erste eigene Wohnung auszog, freute ich mich besonders über die schicken Stoffjalousien und Lamellenvorhänge. Überall, wo man in meine Wohnung hätte hereinsehen können, hatte ich die Vorhänge gezogen. Ich genoss das diffuse Licht und fühlte mich auf diese Weise sehr geborgen. Vom Küchenfenster aus hatte ich mal ein Foto geschossen von einer Ente, die sich neben die Fahrräder gesellte, ansonsten schaute ich hier nie aus irgendeinem Fenster. Es war, als wohnte ich hier in meinem kleinen japanischen Teehaus.
Die erste gemeinsame Wohnung war unser Paradies, in das wir viel Liebe hineinsteckten. Es war ein altes Haus mit kleinen Zimmern und keinen allzu großen Fenstern, mit hübschen Verstrebungen im Landhausstil. Immerhin gab es in jedem Zimmer ein Fenster und für uns zwei Verliebte war es perfekt. In dieser Wohnung hatten wir zwei Zimmer extra. Zum einen war dies eine Form der Kompensation für die recht dünnen Wände, die später einer der Hauptgründe für unser Wegziehen sein würden, zum anderen war dies eine Form von räumlichem Luxus, der mich beglückte. In einem hatten wir ein Fernsehzimmer eingerichtet, das andere blieb ohne weitere Funktion. Doch gerade hier gab ich mir besonders viel Mühe, das Zimmer so geschmackvoll und harmonisch wie möglich einzurichten und meine Gäste damit zu überraschen, dass wir ein zweckfreies Zimmer hatten, das aber so schön war, dass man darob nur staunen konnte. In der Mansarde hatten wir ein weiteres Zimmer mit einem kleinen Dachfenster, durch das die Sonne brannte und man sich dort fast nur nachts aufhalten mochte. Uns störten solche Kleinigkeiten damals nicht, wir fanden alles gut und richtig. In dieser Wohnung schaute ich fast nie aus den Fenstern, sondern betrachtete sie von innen, von den von uns selbst bemalten mintgrünem Türrahmen her.
Als wir umzogen, fanden wir unsere zweite kleine Liebeshöhle, dessen Fenster direkt in eine grüne Umgebung führten und die uns fast alleine gehörte. Die Fenster erübrigten sich hier insofern, als wir hier versuchten möglichst viel Zeit im Garten zu verbringen, in der Hängematte zu schaukeln und Kräuter zu pflanzen. Der Begriff Fenster existierte hier wahrscheinlich deswegen nicht, weil wir auch im Erdgeschoss wohnten und sofort in der Gartenumgebung waren.
Die dritte gemeinsame Wohnung ließen wir uns etwas kosten. Sie lag zuoberst, war zweistöckig und wir hatten uns in das helle weiße Sonnenlicht sofort verliebt. Es gab keinen Balkon, keine Terrasse und keinen Garten. Doch das Licht war da. Hell und strahlend und positiv. Ich mochte die sprossenartigen Fenster auf Anhieb, vor allem all die, durch welche man auf die sich wie Wolken wölbenden Baumkronen in der Ferne sehen konnte. Gleich hinter den Baumwipfeln war eine Wiese, auf der ab und an lokale Pferderennen stattfanden, was mich einfach nur deshalb erfreute, weil ich dies an sich so besonders fand: Pferderennen. Wenn man hier die Fenster öffnete, war die Natur nicht weit. Im Schlafzimmer zwitscherten die Vögel frühmorgens, im großen Badezimmer konnte man das Dachfenster zum Himmel hin kippen. Regnete es, so prasselte es auf diese Fenster und aufs Dach, sodass man sich in der Wohnung wie in einer Trommel befand, auf der die Natur ihr Spiel trieb. Wir haben viele Jahre da gelebt, ohne die Natur zu vermissen, was viele nicht nachvollziehen konnten, weil sie ständig draußen sein mussten, sobald die Temperaturen angenehm wurden. Wir haben uns in dieser gemütlichen und heimeligen Atmosphäre nach innen entwickelt.
Als es nach vielen Jahren Zeit war wieder auszuziehen und die eigenen vier Wände zu gestalten, einigten wir uns rasch auf viel Licht, auf das wir nicht mehr verzichten wollten. Das gewünschte Licht bedingte Fenster und so bauten wir die Fenster möglichst großzügig. Im unteren Stock entstanden somit riesige Fenster, und was sich draußen abspielt, spielt sich unweigerlich auch drinnen ab. Ich liebe es durch diese Fenster zu blicken oder vielmehr muss ich sagen, durch die Fenster zu träumen.
Auch im oberen Stock sind die meisten Fenster recht imposant und bodentief. Man lässt den Blick nach draußen schweifen, wenn man durch die Zimmer geht, und wie zufällig gibt man sich einer kleinen Tagträumerei hin. Die Fenster sind Bilderrahmen für die Außenwelt. Rahmen, die mich mit einrahmen und beruhigend auf mich wirken. Ich bin hier sehr verbunden mit dem, was außerhalb ist, und es macht mir nichts aus, wenn mich jemand von außen sehen könnte, wie ich mich drinnen bewege oder hinausblicke.
Kein Tag vergeht, ohne, dass ich nicht fasziniert hinausschaue. Ob, um zu sehen, wie der Garten gedeiht, den wir angelegt haben, ob um zu beobachten, welche Tiere sich gerade herumtummeln, oder ob über das Lichtspektakel zu staunen. Es sind magische Fenster. Denn es geschieht zuweilen, dass mich ein Blick aus meinem Dasein entreißt und mich innert Sekunden ganz nach draußen katapultiert. Wenn ein Milan seine Kreise über dem Haus zieht, fliege ich gelegentlich auf seinen Flügeln mit.