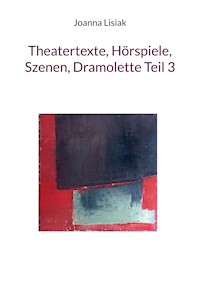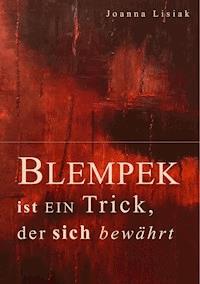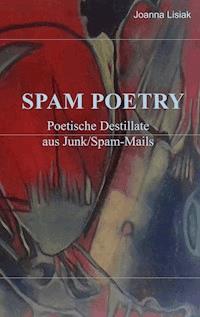Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Gibt es ein Wort für den Geruch von Wind? Oder für die kleine Traurigkeit, die einen befällt in einem Moment, den man gerne mit jemanden teilen wollte, der gerade nicht da ist? Wie bezeichnet man außerdem einen Menschen, dessen Augen leuchten, wenn er jemanden anschaut? Wir wissen, dass es Ja, Nein, Vielleicht gibt. Aber Ja ist nicht gleich Ja. Es kann ein Ja sein, das man aus Verunsicherung sagt. Es unterscheidet sich von demjenigen, das aus tiefer Überzeugung kommt. Auch wenn es auf beiden Seiten Ja heißt. Oder wie nennt man das erfrischte Körpergefühl nach einem Bad im Freien? Gibt es zudem ein Wort, das die Intensität von Kindern beschreibt? Rund tausend Wörter findet man in diesem mal witzigem, mal melancholischen, mal nachdenklichen Wörterbuch - ohne Wörter. Spielerisch geht die Autorin Joanna Lisiak auf Erkundungssuche. Sie stellt Fragen, beantwortet sie durch einen Vorschlag, eine Einladung. Es ist an der LeserIn/am Leser in diesem Buch Antworten zu finden. Weil es im weitesten Sinn nicht nur um die fehlenden Wörter geht, die vielleicht schon immer da waren oder bald sein werden, sondern weil das Buch unzählige, ungeschriebene Geschichten birgt; nämlich die derer, die darin lesen und sich darin finden mögen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 61
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aber Einweihung ist alles. «Schön ist es», sagen die Astronomen von Sternbildern; «dieses hier ist besonders schön.» Es sind Lichtpunkte, irgendwie verstreut. Auch ich habe, nach einigen Studien, irgendwelches Sternbild über die Maßen «schön» gefunden, dann aber auch – einzelne Sterne! Was aber ist ein Stern für unser äußeres Auges anderes als ein flimmernder Lichtpunkt, etwas mehr oder weniger klein, mit der Andeutung eines Farbtones? Wie kann man da von Schönheit reden – wie «Schönheit» gegenüber einem Bild, einem Mädchen, einem Antlitz gebraucht wird? Ich habe Betelgeuze angeblickt mit seltsamen Schauern: du also bist sie, selber, sie, die so gewaltig ist, mit hundertmal größerem Durchmesser als die Sonne, einer Million Mal so viel Rauminhalt, Stern der Kategorie M, mit nur dreitausend Grad Oberflächentemperatur, «rote Riesin»…: So still, rötlich, da oben, du!
Was aber ist für den, der diese paar Kenntnisse nicht hat, dieser Anblick? Was kann ihm ein Stern, gerade dieser Stern bedeuten? – Einweihung ist alles.
Ludwig Hohl
Zum Wörterbuch ohne Wörter
Was man benennen kann, kann man mit anderen teilen. Und teilt man es, wertschätzt man das Benannte gleich nochmals. Das Teilen ist Austausch und bewirkt, dass wir kommunizieren, uns, den anderen dadurch spüren, uns selbst und den anderen besser verstehen. Auf dieser Ebene sind wir mehr als die primär existierenden Wesen. Es ist ein Bedürfnis des Menschen etwas, das außerhalb von ihm ist an sich heranzuholen, es mittels der Benennung mit sich selbst zu verbinden. Die Sprache schafft Ordnung, schält Schichten heraus, vom dem, was sichtbar oder unsichtbar ist. Die Sprache ist Bindeglied, ja Kultur. Wenn wir an einem Baum vorbeigehen und dem anderen nicht sagen, dass wir den Baum als solchen sehen, wird der Baum für sich ein Baum bleiben. Sagt einer aber Baum und der andere antwortet damit, dass es eine Linde ist, dazu eine kraftvolle, formschöne, kann das Gespräch weitergehen; über den Wuchs der Äste, die halbgeöffneten Knospen, die Tiere, die in diesem Baum leben, darüber wie der Baum in der Landschaft steht. Das Gespräch kann über das Sichtbare, über das originär Vordergründige, hinausgehen. Wir können über das, was da ist, ins Wie, ins Warum hinübergehen, in die Tiefen gelangen, erkunden, was das Gefundene in uns auslöst. Wir können dabei anders zu uns selbst und zueinander finden, die Wirklichkeit bewusst wahrnehmen und sie zu anderen Wirklichkeiten formen.
Dieser Behauptung gegenüber steht die Aussage, dass die Sprache unzählige Fallstricke in sich birgt. Das ausgesprochene Wort kann zum Missverständnis führen, das innere Begreifen, das nach mehr Entfaltung ruft, zu früh verhindern. Das klare Wort vermittelt, dass etwas logisch, eindeutig ist und somit abgeschlossen, starr. Zu benennen, kann bedeuten allzu rasch zu schubladisieren, Stigmata zu schaffen. Die Bewahrung der Vieldeutigkeit kann in Gefahr geraten, wenn die Benennung zur Wahrheit erklärt wird. Das Wort vermag zum Stocken zu bringen, selbst dann, wenn es sich neutral gibt. Doch der Kultivierte fragt nach, hinterfragt, fügt hinzu, gibt seine Meinung preis, drückt seine Empfindung aus. Daher gilt es wohl hier wie sonst auch die richtige Balance zu schaffen. Nämlich das eine zuzulassen, ohne das andere auszublenden. Es geht darum wach, in Bewegung zu bleiben.
Auf "Was wäre wenn?“, das dieses Buch als Frage stellt, ergibt sich eine Unzahl an Fragen und Gedankenspielen: Möchte man lieber in einem Land leben, das in der Praxis mit siebzig, siebenhundert oder siebentausend Wörtern verfährt? Angenommen, wir sind in einem Land, das unzählig viele Wörter kennt und auslebt und darunter eben solche, deren Hauptmerkmal die Mehrdeutigkeit ist. Wie würden ein solches Vokabular-Volumen und Sprache die Menschen herausfordern und wie prägen? Wären die Perspektiven der Einzelnen instabil oder gefestigt? Wie würden wir argumentieren, wäre das Grobe von vorneweg auf einen verständlichen, kleinen Nenner heruntergebrochen? Wäre alles vager? Eindeutiger? Lägen die Qualitäten in einer bestimmten Tiefe oder müsste man vielmehr mit Abstumpfung rechnen? Würde das vordergründige Verständnis wissendes Schweigen hervorrufen? Würden wir angestachelt sein, aus dem Gröberen das Feine zu sieben, im Mikrokosmos den Makrokosmos zu suchen? Kämen Nebensächlichkeiten zutage oder könnten wir die Konzentration umso mehr auf das Wesentliche richten, je mehr Wörter wir zur Verfügung hätten und die zudem mehr aussagen würden als Baum und Ast und Knospe? Wäre die Kommunikation durch die gegebenen Konnotationen und Assoziationen, die ein einzelnes Wort einer solchen Sprachkultur hervorrufen würde, in ihrer Form gefangen oder könnte sie weiter aus ihr herauswachsen, sich fortwährend im Außerhalb nähren, sich weiterentwickeln?
Wäre das Zusammenleben der Menschen friedlicher, einfacher, komplizierter, kultivierter, bereichernder, wenn wir mehr Wörter zur Verfügung und im Gebrauch hätten; Wörter, die in ihrer Form, Bedeutung, Verwendungszweck zuweilen gebündelte Kürzestgeschichten wären? Wären die Menschen edelmütiger, könnten sie Wörter wie "gut" erweitern und nicht mehr mit "gut" sowohl den Käse, der ihnen schmeckt meinen, als auch, wenige Sätze weiter dieses "gut" für einen Menschen verwenden, der ein gutes Herz hat, ein guter Mensch ist? Mehr noch, wenn dieses "gut" jeweils kontextbezogen, angebunden an etwas durchaus Subtiles und gleichzeitig an etwas Universelles auftreten würde?
Wären die sprachlichen Unterscheidungen anregend oder schafften sie eine Effizienz, die die Menschen auseinander und nicht mehr zueinander treiben würden? Wäre die Sprache durchgreifender, effizienter, da man mit wenigen Wörtern bereits viel sagen könnte? Und was bedeutete diese Effizienz? Weniger oder mehr Gespräche? Emotionalere oder sachlichere? Was würden wir als Gesellschaft, als Individuen verlieren oder gewinnen? Wie würde sich alles verlagern über die zwischenmenschliche Sprache hinaus: in den Medien, in Büchern, im Theater oder im Film? Was verträgt ein Mensch an Kommunikation überhaupt? Oder anders gefragt: Entsprechen die Sprachen, die wir haben und wie wir sie verwenden oder eben nicht verwenden, den Menschen die sie eben sind und was sie jeweils prägt?
Ich bin keine Soziologin, keine Linguistin und es wäre vermessen, mit diesem Buch eine weitere semiotische Teildisziplin ins Leben rufen zu wollen oder eine ins Thema passende und bereits existierende zu verwässern. Aber ich arbeite mit der Sprache. Ich kommuniziere mit ihr, beobachte, was sie schafft und nicht vermag. Mir sind Einflüsse von der einen Sprache auf die andere bekannt. Auch habe ich von den Inuit gehört, die für Schnee unzählige Wörter haben. Ich kenne die Geschichte von Homer und dass er sich viele Gedanken zur Welt machte, aber scheinbar weniger wichtig war ihm beispielsweise die Farbe „blau“. Nicht etwa, weil er sie mit eigenen Augen nicht sah, diese Farbe des Himmels, des Meeres in allen Abstufungen von dunkelblau, hellblau, grünblau. Nicht, weil Homer nicht „blau“ sagen konnte. Doch es war die Zeit noch lange vor dem Farbfächer, vor der Farbenlehre, wie wir sie heute kennen. Vereinfacht gesagt: „Blau“ war damals nicht wichtig. Die Sprache hängt mit unserer Kultur eng zusammen, und was wir nicht in die Sprache hineinbringen, das existiert ohne Benennung eher unpräzise, vage, versteckt sich im Hintergrund. Oder anders ausgedrückt: Die Sprache ist ein Konstrukt, dem wir kulturell folgen. Wir sind diesem Konstrukt untertan und dieses Konstrukt formt am Ende auch uns. Mittels der Sprache haben wir die Mittel, nicht nur die Sprache selbst zu gestalten, sondern die Welt tatsächlich zu sehen. Mit oder ohne die Farbe Blau.
Ich lese Gedichte und erkenne darin Welten, die mit der meinen korrespondieren. Ich kann mit lyrischen Zeilen eines anderen Dichters meine eigene Befindlichkeit erkunden und könnte subtil