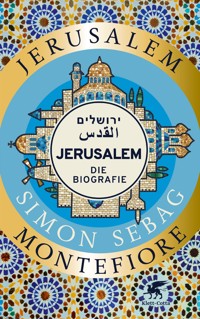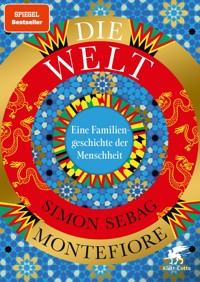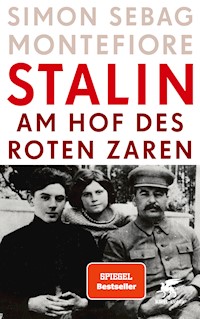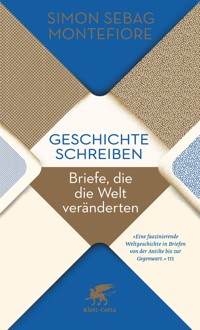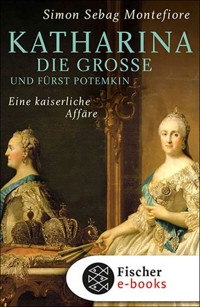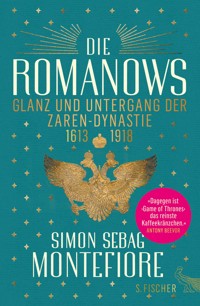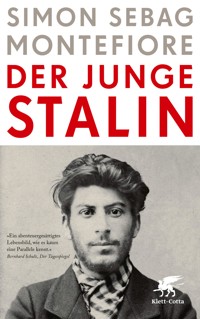
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Der Autor zeigt Stalin erstmals als Teufel und Menschen zugleich.« Markus Wehner, FAZ Mord, Terror und Intrigen: Packend und bis zur letzten Seite spannend schildert Simon Sebag Montefiore das Leben Josef Stalins und zeichnet ebenso fesselnde wie lebensnahe Porträts der wichtigsten Gefolgsleute des Tyrannen: eine einzigartige Darstellung des alltäglichen Lebens und der tödlichen Ränkespiele am Hof des Roten Zaren. In seiner fulminanten und meisterhaft geschriebenen Biographie – voller Details aus Briefen, Tagebüchern und persönlichen Gesprächen – zeigt uns Simon Sebag Montefiore einen der grausamsten Diktatoren der Weltgeschichte als Herrscher und zugleich als skrupelloses Haupt eines ganzen Hofstaates. Dabei gewährt er überraschende Einblicke in das verborgene Leben, die mörderischen Intrigen und die tödlichen Machenschaften der Mitglieder des Politbüros und ihrer Familien. Eindrucksvoll beschreibt er die Beziehungen zwischen einem Menschheitsverbrecher und einer Kamarilla, die von enthemmter Gewaltbereitschaft ebenso geprägt sind wie von kleinbürgerlich idyllischen Alltagsfreuden. Schonungslos und mit atemberaubenden Sinn für die menschlichen Abgründe enhüllt einer der großen historischen Erzähler der Gegenwart die ganze Amoralität eines totalitären Regimes, dessen Erben uns bis heute heimsuchen. »In Simon Sebag Montefiores monumentaler Studie ist Stalin nicht mehr der rätselhaft-abstrakte Diktator. Der Menschheitsverbrecher Josef Wassarinowitsch Dschugaschwili tritt dem Leser in dem faszinierenden Buch vielmehr als leibhaftige Person entgegen. [...] Eindrucksvoll beschreibt Montefiore das paranoide Nebeneinander von enthemmter Gewaltbereitschaft und kleinbürgerlich anmutendem Idyll am Hofe des roten Zaren.« Welt am Sonntag »Die neue Stalin-Biograpie: bis zur letzten Seite spannend« aspekte/ZDF »Simon Sebag Montefiore hat es geschafft, uns ein ungewöhnlich persönliches Bild vom alltäglichen Leben im Kreml zu geben. Eine packende Darstellung.« Robert Service, Oxford University
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Guide
Umschlag
Navigation
Titelseite
Impressum
Navigation
Umschlag
Impressum
INHALT
Stalins Stammbaum
Karten
EINLEITUNG
HANDELNDE PERSONEN
ANMERKUNG
Prolog: Der Bankraub
Erster Teil
1: KEKES WUNDER: SOSSO
2: DER VERRÜCKTE BESSO
3: SCHLÄGER, RINGER UND CHORKNABEN
4: EINE HINRICHTUNG IN GORI
5: DER POET UND DAS PRIESTERTUM
6: DER »JUNGE MANN MIT DEN BRENNENDEN AUGEN«
7: SCHLACHT DER SCHLAFSÄLE: SOSSO GEGEN VATER SCHWARZFLECK
8: DER WETTERFROSCH: PARTYS UND FÜRSTEN
9: STALIN GEHT IN DEN UNTERGRUND: KONSPIRAZIJA
10: »ICH ARBEITE FÜR DIE ROTHSCHILDS!« – FEUER, MASSAKER UND VERHAFTUNG IN BATUMI
Zweiter Teil
11: DER HÄFTLING
12: DER FRIERENDE GEORGIER: SIBIRISCHE VERBANNUNG
13: BOLSCHEWISTISCHE VERFÜHRERIN
14: 1905: DER KÖNIG DES BERGES
15: 1905: KÄMPFER, GASSENJUNGEN UND SCHNEIDERINNEN
16: 1905: DER BERGADLER: STALIN LERNT LENIN KENNEN
17: DER MANN IN GRAU: HEIRAT, CHAOS (UND SCHWEDEN)
18: PIRAT UND VATER
19: STALIN IN LONDON
20: KAMO RASTET AUS: DAS RÄUBER-UND-KOSAKEN-SPIEL
21: KATOS TRAGÖDIE: STALINS HERZ AUS STEIN
22: DER BOSS DER SCHWARZEN STADT: PLUTOKRATEN, SCHUTZGELDERPRESSUNG UND PIRATERIE
23: LÄUSERENNEN, MORD UND WAHNSINN – GEFÄNGNISSPIELE
24: DER »FLUSSHAHN« UND DIE ADLIGE
25: »DER MILCHMANN«: WAR STALIN EIN ZARISTISCHER AGENT?
Dritter Teil
26: ZWEI VERLORENE VERLOBTE UND EINE SCHWANGERE BÄUERIN
27: DAS ZENTRALKOMITEE UND »ZIERPÜPPCHEN«, DAS SCHULMÄDCHEN
28: »VERGESSEN SIE DEN NAMEN NICHT UND SEIEN SIE SEHR VORSICHTIG!«
29: DER ESKAPIST: KAMOS SPRUNG UND DER LETZTE BANKRAUB
30: REISEN MIT DER GEHEIMNISVOLLEN VALENTINA
31: WIEN 1913: DER WUNDERBARE GEORGIER, DER ÖSTERREICHISCHE MALER UND DER ALTE KAISER
32: DER GEHEIMPOLIZISTEN-BALL: VERRATEN IN FRAUENKLEIDUNG
Vierter Teil
33: »LIEBLING, ICH BIN IN EINER VERZWEIFELTEN LAGE«
34: 1914: EINE ARKTISCHE SEXKOMÖDIE
35: DER JÄGER
36: DER ROBINSON CRUSOE VON SIBIRIEN
37: STALINS RENTIERSCHLITTEN UND EIN SIBIRISCHER SOHN
Fünfter Teil
38: FRÜHJAHR 1917: ZAUDERNDER FÜHRER
39: SOMMER 1917: MATROSEN AUF DEN STRASSEN
40: HERBST 1917: SOSSO UND NADJA
41: WINTER 1917: DER COUNTDOWN
42: GLORREICHER OKTOBER 1917: DER VERPFUSCHTE AUFSTAND
43: MACHT: STALIN TRITT AUS DEM SCHATTEN
Epilog
EIN ALTER TYRANN – AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT
Fußnoten
Anhang
STALINS NAMEN, SPITZNAMEN, VERFASSERZEILEN UND DECKNAMEN
DANKSAGUNG
ZU DEN QUELLEN
ARCHIVE/MUSEEN
AUSWAHLBIBLIOGRAFIE
NAMENREGISTER
Informationen zum Autor
17
18
19
20
21
22
23
24
25
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
407
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
495
497
500
501
502
503
504
506
507
508
509
510
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
524
525
526
527
529
530
531
532
533
534
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
SIMON SEBAG MONTEFIORE
DER JUNGE STALIN
Aus dem Englischen von Bernd Rullkötter
Klett-Cotta
Impressum
Die deutschsprachige Ausgabe ist erstmals 2007 im S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main erschienen. Der Text der vorliegenden Ausgabe folgt der 2. Auflage der Taschenbuchausgabe im Fischer Taschenbuch Verlag 2014.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Young Stalin« im Verlag
Weidenfeld & Nicolson, London
© Simon Sebag Montefiore 2007
Für die deutsche Ausgabe
© der deutschen Übersetzung 2008
S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2023
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © Mauritius Images
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-608-98812-3
E-Book ISBN 78-3-608-12347-0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
INHALT
Umschlag
Impressum
Inhalt
Stalins Stammbaum
Karten
Einleitung
Handelnde Personen
Anmerkung
Prolog: Der Bankraub
Erster Teil
1. Kekes Wunder: Sosso
2. Der verrückte Besso
3. Schläger, Ringer und Chorknaben
4. Eine Hinrichtung in Gori
5. Der Poet und das Priestertum
6. Der »junge Mann mit den brennenden Augen«
7. Schlacht der Schlafsäle: Sosso gegen Vater Schwarzfleck
8. Der Wetterfrosch: Partys und Fürsten
9. Stalin geht in den Untergrund:
konspirazija
10. »Ich arbeite für die Rothschilds!« – Feuer, Massaker und Verhaftung in Batumi
Zweiter Teil
11. Der Häftling
12. Der frierende Georgier: Sibirische Verbannung
13. Bolschewistische Verführerin
14. 1905: Der König des Berges
15. 1905: Kämpfer, Gassenjungen und Schneiderinnen
16. 1905: Der Bergadler: Stalin lernt Lenin kennen
17. Der Mann in Grau: Heirat, Chaos (und Schweden)
18. Pirat und Vater
19. Stalin in London
20. Kamo rastet aus: Das Räuber-und-Kosaken-Spiel
21. Katos Tragödie: Stalins Herz aus Stein
22. Der Boss der Schwarzen Stadt: Plutokraten, Schutzgelderpressung und Piraterie
23. Läuserennen, Mord und Wahnsinn – Gefängnisspiele
24. Der »Flusshahn« und die Adlige
25. »Der Milchmann«: War Stalin ein zaristischer Agent?
Dritter Teil
26. Zwei verlorene Verlobte und eine schwangere Bäuerin
27. Das Zentralkomitee und »Zierpüppchen«, das Schulmädchen
28. »Vergessen Sie den Namen nicht und seien Sie sehr vorsichtig!«
29. Der Eskapist: Kamos Sprung und der letzte Bankraub
30. Reisen mit der geheimnisvollen Valentina
31. Wien 1913: Der wunderbare Georgier, der österreichische Maler und der alte Kaiser
32. Der Geheimpolizisten-Ball: Verraten in Frauenkleidung
Vierter Teil
33. »Liebling, ich bin in einer verzweifelten Lage«
34. 1914: Eine arktische Sexkomödie
35. Der Jäger
36. Der Robinson Crusoe von Sibirien
37. Stalins Rentierschlitten und ein sibirischer Sohn
Fünfter Teil
38. Frühjahr 1917: Zaudernder Führer
39. Sommer 1917: Matrosen auf den Straßen
40. Herbst 1917: Sosso und Nadja
41. Winter 1917: Der Countdown
42. Glorreicher Oktober 1917: Der verpfuschte Aufstand
43. Macht: Stalin tritt aus dem Schatten
Epilog
Ein alter Tyrann – Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Fußnoten
Anhang
Stalins Namen, Spitznamen, Verfasserzeilen und Decknamen
Danksagung
Zu den Quellen
Archive/Museen
Auswahlbiografie
Namensregister
Informationen zum Autor
Für meinen lieben Sohn Sasha
EINLEITUNG
»Alle jungen Leute sind doch gleich«, sagte Stalin. »Wozu sollte man also … über den jungen Stalin schreiben?« Doch er irrte sich, denn er war immer anders gewesen. Schon seine Jugend gestaltete sich dramatisch und ungewöhnlich abenteuerlich. Und als er im hohen Alter über die Rätsel seiner frühen Jahre nachdachte, schien sich seine Meinung zu ändern. »Es gibt keine Geheimnisse«, sinnierte er, »die nicht früher oder später allen enthüllt werden.« Für mich als Historiker, der Stalins verborgenes Leben bis zu seinem Erscheinen als führender Helfer Lenins in der neuen Sowjetregierung aufdecken will, hatte er recht, was die Geheimnisse betraf: Es ist nun möglich, viele von ihnen zu enthüllen.
Es gibt nur wenige Arbeiten über den frühen Stalin (verglichen mit zahlreichen über den jungen Hitler), aber der Grund war der, dass kaum Material vorzuliegen schien. Das ist jedoch nicht mehr der Fall. Eine Fülle neuer Unterlagen, die ein Licht auf seine Kindheit und seine Laufbahn als Revolutionär, Gangster, Dichter, angehender Priester, Ehemann und zügelloser Liebhaber wirft, der Frauen und uneheliche Kinder gnadenlos im Stich ließ, schlummerte in den nunmehr geöffneten Archiven, besonders in denen des häufig vernachlässigten Georgien.
Stalins frühes Leben mag undurchsichtig gewesen sein, doch es war nicht weniger außergewöhnlich – und noch turbulenter – als das Lenins und Trotzkis, und es rüstete (und verdarb) ihn für die Triumphe, die Tragödien und das räuberische Verhalten auf der Höhe der Macht.
Seine vorrevolutionären Leistungen und Verbrechen waren viel umfangreicher, als man geahnt hat. Zum ersten Mal lässt sich seine Rolle bei Banküberfällen, Schutzgelderpressungen und anderen Nötigungen, bei den Brandstiftungen, Piraterien und Morden – also dem politischen Banditentum – dokumentieren, die Lenin so sehr beeindruckte. Zugleich erlangte Stalin dadurch genau die Fertigkeiten, die sich im politischen Dschungel der Sowjetunion als unschätzbar wertvoll erweisen sollten. Aber man kann auch zeigen, dass er viel mehr war als ein Gangsterboss: nämlich ein politischer Organisator, Vollstrecker und Meister in der Unterwanderung der zaristischen Sicherheitsdienste. Im Gegensatz zu Sinowjew, Kamenew oder Bucharin, deren Ruf, große Politiker zu sein, sich ironischerweise auf ihre Vernichtung während des Terrors stützt, hatte er keine Angst vor physischen Gefahren. Doch er imponierte Lenin auch als unabhängiger und nachdenklicher Politiker sowie als energischer Redakteur und Journalist, der sich nie scheute, dem Älteren gegenüberzutreten und ihm zu widersprechen. Stalins Erfolg gründete sich zumindest teilweise auf seine außergewöhnliche Verbindung von Erziehung (die er dem Seminar verdankte) mit Straßengewalt. Er war, was selten ist, sowohl ein »Intelligenzler« als auch ein Mörder. Kein Wunder, dass Lenin ihn 1917 als idealen Mitstreiter in seine gewaltsame, bedrängte Revolution einspannte.
*
Dieses Buch ist das Ergebnis fast zehnjähriger Recherchen über Stalin in dreiundzwanzig Städten und neun Ländern, hauptsächlich in den erstmals zugänglichen Archiven von Moskau, Tbilissi und Batumi, aber auch in St. Petersburg, Baku, Wologda, Sibirien, Berlin, Stockholm, London, Paris, Tampere, Helsinki, Krakau, Wien und Stanford, Kalifornien.
Der junge Stalin kann für sich allein gelesen werden. Es ist eine Untersuchung von Stalins Leben vor der Macht bis zu seinem Regierungsbeitritt im Oktober 1917, während mein letztes Buch, Stalin. Am Hof des roten Zaren, ihn als Machthaber bis zu seinem Tod im März 1953 behandelt. Beides sind persönliche Berichte über den Menschen und Politiker, doch auch über sein Milieu. Ich hoffe, dass sie gemeinsam eine Einführung in das Leben des am schwersten fassbaren und faszinierendsten Giganten des zwanzigsten Jahrhunderts bilden und die Entwicklung und frühe Reife des ultimativen Politikers aufzeigen können. Welcher Mangel an Einfühlungsvermögen, hervorgebracht durch Stalins Erziehung, ermöglichte ihm, so unbekümmert zu töten, und welche Eigenschaft machte ihn andererseits so geeignet für das politische Leben? Waren der Schuhmachersohn von 1878, der idealistische Seminarist von 1898, der Bandit von 1907 und der vergessene sibirische Jäger von 1914 dazu bestimmt, zum fanatischen marxistischen Massenmörder der Dreißigerjahre und 1945 zum Eroberer von Berlin zu werden?
Meine beiden Bücher sind nicht als erschöpfende Darstellung jedes politischen, ideologischen, wirtschaftlichen, militärischen, internationalen und persönlichen Aspekts von Stalins Leben zu werten. Diese Aufgabe ist, in unterschiedlichen Epochen, bereits vorzüglich von zwei Wissenschaftlern erfüllt worden: von Robert Conquest, dem Doyen der Stalin-Geschichtsschreibung, mit seinem Buch Stalin. Der totale Wille zur Macht, und, in jüngerer Zeit, von Robert Service mit Stalin. A Biography. Ich glaube nicht, dass ich ihren breit angelegten Arbeiten etwas hinzufügen könnte.
Ich brauche mich nicht dafür zu rechtfertigen, dass meine beiden Bücher streng auf das intime und geheime, politische und persönliche Leben Stalins und des kleinen Kreises konzentriert sind, der die Sowjetunion begründen und bis in die Sechzigerjahre beherrschen sollte. Wir sind ebenso wenig frei von Ideologie wie einst die Bolschewiki, doch die neu zugänglichen Archive zeigen, dass das Wesen der Politik unter Lenin und Stalin von den Persönlichkeiten und der Patronage einer winzigen Oligarchie bestimmt wurde, genau wie unter den Romanow-Zaren – und genau wie heute in der »gelenkten Demokratie« Russlands im einundzwanzigsten Jahrhundert.
*
Stalins verlängerte Jugend ist immer und in vieler Hinsicht ein Rätsel gewesen. Vor 1917 pflegte er die Mystik des Ungewissen, spezialisierte sich jedoch auch auf die »finstere Arbeit« der Untergrundrevolution, die ihrem Charakter nach verschwiegen, brutal und unerlässlich, aber eben auch verrufen war.
Nachdem Stalin an die Macht gelangt war, brauchte er für seine Propaganda, sich als Lenins Nachfolger zu preisen, einen legitimen, heldenhaften Lebenslauf, den er wegen seiner Erfahrungen im, wie er es nannte, »schmutzigen Geschäft« der Politik nicht besaß. Darüber durfte er sich jedoch nicht auslassen, weil die Umstände entweder zu banditenhaft für einen großen, paternalistischen Staatsmann oder zu georgisch für ein russisches Oberhaupt waren. Seine Lösung war ein ungeschickter, doch umfassender Persönlichkeitskult, mit dem er die Wahrheit fingierte, zurechtbog und verschleierte. Ironischerweise war diese Selbstdarstellung so grotesk, dass sie – manchmal harmlose – Funken entfachte, die sich zu enormen Verschwörungstheorien gegen Stalin auswuchsen. Seinen politischen Gegnern – und später uns Historikern – fiel es nicht schwer zu glauben, dass alles erfunden war und er nicht sehr viel geleistet haben konnte, zumal wenige Historiker im Kaukasus, wo sich ein großer Teil seiner frühen Laufbahn abspielte, geforscht hatten. Um die Verschwörungstheorien entwickelte sich ein Anti-Kult, der so falsch war wie der Kult selbst.
Das faszinierendste Gerücht lautete: War Stalin ein Doppelagent der Geheimpolizei des Zaren? Seine eigenen berüchtigtsten Geheimpolizisten, Nikolai Jeschow und Lawrenti Berija, forschten in aller Stille nach Beweismaterial gegen Stalin, falls er sich gegen sie wenden sollte – was er bekanntlich ja auch tat. Es ist aufschlussreich, dass keiner von beiden trotz der unbegrenzten Nachforschungsmöglichkeiten des NKWD, über die sie verfügten, je einen hieb- und stichfesten Beweis fand.
Aber es gibt ein noch tiefgehenderes Rätsel: Fast jeder Historiker hat schon einmal Trotzkis Behauptung zitiert, Stalin sei 1917 eine provinzielle »Mittelmäßigkeit« gewesen, oder auch Suchanows Beschreibung des Georgiers als eines »grauen Flecks«. Die meisten Historiker schlossen sich Trotzkis Meinung an, Stalins Durchschnittlichkeit habe ihn davon abgehalten, 1905 und 1917 in die Ereignisse einzugreifen, wodurch er, mit Robert Slusser, zu dem »Mann, der die Revolution verpasste«, geworden sei.
Wenn das zutrifft, wie konnte der »Mittelmäßige« dann die Macht ergreifen, begabte Politiker wie Lenin, Bucharin und Trotzki selbst überlisten und sein Programm der Industrialisierung, seinen brutalen Krieg gegen die Bauernschaft und den abscheulichen Großen Terror entfalten? Wie wurde der »Fleck« zu jenem mörderischen, doch überaus effektiven Weltstaatsmann, der zum Aufbau und der Industrialisierung der UdSSR beitrug, der Churchill und Roosevelt übertrumpfte, Stalingrad organisierte und Hitler besiegte? Der Mittelmäßige von 1917 und der Koloss des zwanzigsten Jahrhunderts könnten, so scheint es, nicht derselbe sein. Wie also verwandelte sich der eine in den anderen?
In Wirklichkeit handelt es sich unzweifelhaft um ein und denselben Mann. Feindliche und ihm gewogene Zeugen berichten gleichermaßen, dass Stalin schon in seiner Kindheit ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sei. Wir stützen uns schon viel zu lange auf Trotzkis bis zur Unkenntlichkeit voreingenommene Darstellung. Die Wahrheit war eine andere. Trotzkis Ansicht verrät uns mehr über seine eigene Eitelkeit, seinen Snobismus und seinen Mangel an politischem Geschick als über den frühen Stalin. Deshalb besteht das erste Ziel dieser Arbeit darin, Stalins Aufstieg wahrheitsgetreu und so frei wie möglich vom Stalinkult oder den antistalinschen Verschwörungstheorien nachzuzeichnen.
Es gibt eine Tradition von Biografien, die der frühen Laufbahn großer Staatsmänner gewidmet sind. Winston Churchill schrieb über seine eigene Jugend, und es folgten zahlreiche Werke über die Anfänge seiner Karriere. Das Gleiche gilt für andere Giganten der Geschichte, etwa die beiden Präsidenten Roosevelt. Der junge Hitler liefert heute die Grundlage für eine ganze eigene Branche, doch kein Werk kommt dem hervorragenden ersten Band von Ian Kershaws Arbeit Hitler 1889–1936 nahe.
Über Stalin findet man unter Tausenden von Büchern nur zwei ernst zu nehmende Studien seiner Jahre vor 1917: das ausgezeichnete politisch-psychologische Werk Stalin as Revolutionary von Robert Tucker (1974), das lange vor dem Zugang zu den neuen Archiven entstand; und eine antistalinsche Verschwörungstheorie aus dem Kalten Krieg von Edward Ellis Smith (1967), der Stalin als zaristischen Agenten hinstellt. In Russland gibt es weitere einschlägige Titel, hauptsächlich aus dem Bereich des Sensationsjournalismus. All diese überragt jedoch Alexander Ostrowskis maßgebende, unerschöpfliche Studie Kto stojal sa spinoi Stalina? (Wer stand hinter Stalin?) (2002). Mein eigenes Buch ist allen drei verpflichtet.
Vieles Unerklärliche im sowjetischen Leben – beispielsweise der Hass auf die Bauernschaft, die Geheimniskrämerei und Paranoia, die mörderische Hexenjagd des Großen Terrors, der Vorrang der Partei vor der Familie und dem Leben selbst, der Argwohn gegenüber den eigenen Spionageergebnissen der UdSSR, der den Erfolg von Hitlers Überraschungsangriff im Jahr 1941 ermöglichte – war das Ergebnis des Wirkens im Untergrund, der konspirazija der Ochrana und der Revolutionäre sowie der kaukasischen Werte und des Stils von Stalin. Und nicht nur von Stalin.
Bis 1917 hatte Stalin viele der Personen kennengelernt, welche die Sowjetelite und seinen Hof in den Jahren seiner höchsten Macht bilden sollten. Die Gewalttätigkeit und das Stammesgefühl der Kaukasier – solcher Männer wie Stalin, Ordschonikidse und Schaumjan – spielten eine besondere Rolle für die Gestaltung der UdSSR, die mindestens genauso groß wie der Beitrag der Letten, Polen, Juden und vielleicht sogar der Russen war. Sie waren typisch für die Komiteemitglieder, die das Herz der Bolschewistischen Partei ausmachten und Stalin stets gegen Intellektuelle, Juden, Emigranten und vor allem den brillanten, hochmütigen Trotzki unterstützen würden. Solche Gestalten griffen zu der Brutalität des Bürgerkriegs (sowie zur Liquidierung der Bauernschaft und zum Terror), weil sie in denselben Straßen wie Stalin (und sogar neben ihm) aufgewachsen waren, an Bandenkriegen, Sippenrivalitäten, ethnischen Morden und Attentaten teilgenommen und dieselbe Kultur der Gewalttätigkeit verinnerlicht hatten. Mein Ansatz vermeidet einen großen Teil der Psychogeschichte, die uns ein ebenso obskures wie allzu simples Verständnis von Stalin und Hitler vermittelt hat. In diesem Buch hoffe ich zu zeigen, dass Stalin durch weit mehr als eine elende Kindheit geformt wurde, genau wie die UdSSR sich auf weit mehr als die marxistische Ideologie stützte.
Doch die Entwicklung von Stalins Charakter ist besonders wichtig, weil seine Herrschaft so persönliche Züge trug. Zudem schufen Lenin und Stalin das spezifische Sowjetsystem nach dem Vorbild ihres unbarmherzigen kleinen Kreises von Verschwörern vor der Revolution. Mehr noch, vieles an der Tragödie des Leninismus-Stalinismus ist nur dann verständlich, wenn man begreift, dass die Bolschewiki genauso verstohlen vorgingen, ob sie nun die Regierung des größten Weltreichs im Kreml stellten oder eine belanglose kleine Kabale im Hinterzimmer eines Gasthauses in Tiflis anzettelten.
Es hat den Anschein, dass das heutige Russland – dominiert durch und gewöhnt an Autokratie und Imperium, ohne starke Bürgerorganisationen, zumal nach der Zerschmetterung der Gesellschaft durch den bolschewistischen Terror – dazu bestimmt ist, noch einige Zeit von sich selbst erhöhenden Cliquen regiert zu werden. Aber in einem größeren Rahmen ist die verschwommene Welt des Terrorismus heute relevanter denn je, denn terroristische Organisationen, ob bolschewistische zu Beginn des zwanzigsten oder dschihadische zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, haben vieles gemeinsam.
1917 war Stalin seit zwölf Jahren mit Lenin und seit über zwanzig Jahren mit etlichen der anderen bekannt. Mithin ist dies keine Biografie, sondern eine Chronik ihrer Lebensweise, eine veritable Vorgeschichte der UdSSR selbst, eine Studie des unterirdischen Wurmes und der stummen Larve, bevor der stählerne Schmetterling aus ihr schlüpfte.
HANDELNDE PERSONEN
FAMILIE
Wissarion »Besso« Dschugaschwili, Schuhmacher, Vater
Jekaterina »Keke« Geladse Dschugaschwili, Mutter
STALIN, Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, »Sosso«, »Koba«
GORI
Jakow »Koba« Egnataschwili, Ringermeister von Gori, Kaufmann, möglicher Vater
Iwan »Wasso« Egnataschwili, Sohn von Jakow, lebenslang ein Freund Stalins
Alexander »Sascha« Egnataschwili, Sohn von Jakow, Höfling Stalins, »das Kaninchen«
Damjan Dawritschewy, Polizeichef von Gori und möglicher Vater
Josef Dawritschewy, Sohn von Damjan, Stalins Kindheitsfreund, politischer Bankräuber, später Pilot, Spion und Memoirenschreiber in Frankreich
Josef Iremaschwili, Kindheitsfreund in Gori und ebenfalls Seminarist
Vater Christof Tscharkwiani, Priester in Gori, Beschützer und in Tiflis, menschewistischer Memoirenschreiber möglicher Vater; sein Sohn Kote Tscharkwiani
Pjotr »Peta« Kapanadse, Gori und Seminar in Tiflis, Priester und lebenslang ein Freund
Giorgi Jelisabedaschwili, Freund aus Gori, Bolschewik Dato Gassitaschwili, Bessos Schusterlehrling
DIE SCHULMEISTER
Simon Gogtschilidse, Stalins Gesangslehrer und Mäzen an der Kirchenschule von Gori
Fürst David Abaschidse, Vater Dmitri, »Schwarzfleck«, pedantischer Priester am Seminar von Tiflis und Stalins verhasster Peiniger
DIE MÄDCHEN
Natalja »Natascha« Kirtawa,Hauswirtin und Freundin in Batumi Alwassi Talakwadse, Protegé und Freundin in Baku
Ludmilla Stal, bolschewistische Aktivistin und Freundin in Baku und St. Petersburg
Stefanja Petrowskaja, Odessaer Adlige,Verbannte, Geliebte und Verlobte in Solwytschegodsk und Baku
Pelageja »Polja« Onufrijewa, »Zierpüppchen«, als Schulmädchen Stalins Geliebte in Wologda
Serafima Choroschenina, Geliebte und Partnerin in Solwytschegodsk
Maria Kusakowa,Hauswirtin und Geliebte in Solwytschegodsk, Mutter von Konstantin
Tatjana »Tanja« Slawatinskaja, verheiratete Bolschewikin und Stalins Geliebte
Valentina Lobowa, bolschewistische Organisatorin und wahrscheinliche Geliebte
Lidija Pereprygina, dreizehnjährige Waise, die von Stalin in Turuchansk verführt wurde und zwei Kinder von ihm hatte; Verlobte
GENOSSEN, FEINDE UND RIVALEN – TIFLIS UND BAKU
Lado Kezchoweli, Priestersohn in Gori, Stalins bolschewistischer Mentor und Held
Fürst Alexander »Sascha« Zulukidse, reicher Aristokrat, Stalins bolschewistischer Mentor und Held
Micho Zchakaja,Gründer der georgischen SD (Sozialdemokraten), früher Bolschewik, Stalins Mäzen
Philip Macharadse, Bolschewik und Stalins einstiger Verbündeter
Budu »das Fass« Mdiwani, Schauspieler, bolschewistischer Terrorist und Stalins Verbündeter
Abel Jenukidse, früher Bolschewik, Freund der Allilujews, Swanidzes und Stalins
Silibistro »Silwa« Dschibladse, Ex-Seminarist, menschewistischer Aufwiegler
Lew Rosenblum »Kamenew«, vermögender Tifliser Ingenieurssohn, gemäßigter Bolschewik
Michail »Mischa« Kalinin, Bauer, Butler, früher Bolschewik in Tiflis
Suren Spandarjan, Sohn eines vermögenden armenischen Zeitungsverlegers, Bolschewik, Frauenheld, Stalins bester Freund
Stepan Schaumjan, vermögender armenischer Bolschewik, Stalins Verbündeter und Rivale
Grigori »Sergo« Ordschonikidse, verarmter Adliger, Pfleger, bolschewistischer Schläger, Stalins langjähriger Verbündeter
Sergo Kawtaradse, junger Handlanger Stalins in West-Georgien, Baku, St. Petersburg
EHEFRAUEN UND ANGEHEIRATETE VERWANDTE
Alexander »Aljoscha« Swanidse, Seminarist, Stalins Freund, früher Bolschewik und in der Folge Schwager
Alexandra »Saschiko« Swanidse, Schwester Aljoschas und Bekannte Stalins
Micheil Monosselidse, Saschikos Ehemann und bolschewistischer Verbündeter Stalins
Maria »Mariko« Swanidse, Schwester Saschikos und Aljoschas
Jekaterina »Kato« Swanidse Dschugaschwili, jüngste Familienangehörige, Stalins erste Frau und Mutter von
Jakow »Jascha« oder »Bübchen« Dschugaschwili, Stalins Sohn
Sergei Allilujew, Eisenbahnverwalter und Elektrotechniker, früher Bolschewik, Stalins Verbündeter in Tiflis, Baku und St. Petersburg
Olga Allilujewa, Ehefrau von Sergej, frühe Freundin, möglicherweise Geliebte Stalins, spätere Schwiegermutter
Pawel Allilujew, Sohn Olgas
Anna Allilujewa, Tochter Olgas
Fjodor »Fedja« Allilujew, Sohn Olgas
Nadeschda »Nadja« Allilujewa, Tochter von Sergej und Olga, Stalins zweite Frau
GANGSTER, DRAHTZIEHER UND ORGANISATOREN
Kamo, Simon »Senko« Ter-Petrossjan, Stalins Freund, Protegé, dann Bankräuber und Auftragsmörder
Kote Zinzadse, Stalins Auftragsmörder in West-Georgien und späterer Bankraubchef
Leonid Krassin, Lenins Spezialist für Bombenherstellung, Geldwäscherei, Banküberfälle und Elite-Kontakte; überwarf sich schließlich mit Lenin
Meir Wallach,»Maxim Litwinow«, bolschewistischer Waffenhändler und Geldwäscher
Andrej Wyschinski, vermögender Odessaer Apothekersohn, aufgewachsen in Baku, Stalins Vollstrecker und später Menschewik
DER TITAN DES MARXISMUS
Georgi Plechanow, Vater der russischen Sozialdemokratie
DIE BOLSCHEWIKI
Wladimir Iljitsch Uljanow, »Lenin«, »Iljitsch« für seine Vertrauten, russischer SD-Führer und Gründer der Bolschewiki
Nadeschda Krupskaja, seine Frau und Assistentin
Grigori Radomyslski, »Sinowjew«, Sohn eines jüdischen Milchmanns, Lenins Helfer in Krakau, dann Verbündeter Kamenews
Roman Malinowski, Einbrecher,Vergewaltiger und Ochrana-Spitzel, Führer der Bolschewiki in der Reichsduma
Jakow Swerdlow, jüdischer Bolschewikenführer und Stalins Zimmernachbar in der Verbannung
Lew Bronstein, »Trotzki«, Führer, Redner und Schriftsteller, unabhängiger Marxist,Vorsitzender der Menschewiki im St. Petersburger Sowjet 1905, schloss sich den Bolschewiki 1917 an
Felix Dserschinski, polnischer Adliger,Altrevolutionär, Bolschewik seit 1917
Jelena Stassowa, »Absolut« und »Selma«,Adlige, bolschewistische Aktivistin
Klimenti Woroschilow, Dreher in Lugansk, bolschewistischer Freund Stalins, Zimmernachbar in Stockholm
Wjatscheslaw Skrjabin,»Molotow«, früher Bolschewik und zusammen mit Stalin Gründer der Prawda
DIE MENSCHEWIKI
Juli Zederbaum,»Martow«, Lenins Freund und dann bitterer Feind, Gründer der Menschewiki
Noi Schordanija, Begründer der georgischen Sozialdemokratie und Führer der georgischen Menschewiki
Karlo Tschcheidse, gemäßigter Menschewik in Batumi und später in St. Petersburg
Isidor Ramischwili, menschewistischer Feind Stalins
Said Dewdariani, Freund am Seminar, dann politischer Feind und Menschewik
Noi Ramischwili, zäher menschwistischer Feind Stalins
Minadora Ordschonikidse Toroschelidse, menschewistische Bekannte Stalins und Ehefrau seines bolschewistischen Verbündeten Malakija Toroschelidse
David Sagiraschwili, georgischer Menschewik und Memoirenschreiber
Grigol Uratadse, georgischer Menschewik und Memoirenschreiber
Raschden Arsenidse, georgischer Menschewik und Memoirenschreiber
Chariton Tschawitschwili, georgischer Menschewik und Memoirenschreiber
Prolog
DER BANKRAUB
Am Mittwoch, dem 13. Juni 1907 – es war 10 Uhr 30 an einem schwülen Morgen –, vollführte ein schneidiger, schnurrbärtiger Kavalleriehauptmann in Stiefeln und Reithosen Kunststücke auf dem brodelnden, exotischen Hauptplatz von Tiflis. Er schwang einen großen Tscherkessensäbel auf dem Pferderücken und scherzte mit zwei hübschen, gut gekleideten georgischen Mädchen, die farbenprächtige Sonnenschirme rotieren ließen – während sie hin und wieder in ihren Kleidern verborgene Mauser-Pistolen berührten.
Ordinäre Burschen in grellbunten Bauernblusen und weiten Matrosenhosen warteten an den Straßenecken und hielten Revolver und Granaten versteckt. In der berüchtigten Tiliputschuri-Schenke am Platz besetzte eine Gruppe schwer bewaffneter Gangster die Kellerbar, und sie luden die Passanten fröhlich ein, mit ihnen zu trinken. Alle warteten darauf, für Josef Dschugaschwili, damals neunundzwanzig Jahre alt und später als Stalin bekannt, die erste Großtat durchzuführen, mit der er die Aufmerksamkeit der Welt wecken sollte.
Wenige außerhalb der Bande kannten den Plan, der ein kriminellterroristisches »Spektakel« für jenen Tag vorsah, doch Stalin hatte seit Monaten daran gearbeitet. Ein Mann, der in groben Zügen über den Plan Bescheid wusste, war Wladimir Lenin, der Führer der Bolschewistischen Partei,* der sich weit im Norden in einer Villa im finnischen Kuokola versteckt hielt. Wenige Tage zuvor hatte sich Lenin heimlich mit Stalin in Berlin und dann in London getroffen, um den großen Raubzug anzuordnen, obwohl ihre Sozialdemokratische Partei gerade sämtliche »Expropriationen« – so lautete der Euphemismus für Banküberfälle – verboten hatte. Doch Stalins Aktionen, seine Raubüberfälle und Morde, die stets mit sorgfältiger Detailtreue und unter größter Geheimhaltung abgewickelt wurden, hatten ihn zum »Hauptfinanzier des Bolschewistischen Zentrums« werden lassen.
Die Ereignisse jenes Tages sollten überall auf der Welt Schlagzeilen machen, Tiflis in den Grundfesten erschüttern und die ohnehin zerbröckelnde Sozialdemokratie vollends in sich bekriegende Fraktionen spalten. Jener Tag sollte sowohl Stalins Karriere festigen als sie beinahe zerstören – es war ein Wendepunkt in seinem Leben.
Auf dem Jerewan-Platz nahmen die zwanzig Räuber, die den Kern von Stalins Bande, bekannt als »der Mob«, bildeten, ihre Positionen ein, während die Beobachter durch den Golowinski-Prospekt, die elegante Hauptstraße von Tiflis, an dem weißen, italianisierten Glanz des Vizekönigspalastes vorbeispähten. Sie warteten auf das Rattern einer Postkutsche und den donnernden Galopp der sie begleitenden Kosakeneinheit. Der Kavalleriehauptmann mit dem Tscherkessensäbel machte eine halbe Drehung auf seinem Pferd, bevor er abstieg und über die modische Allee spazierte.
Sämtliche Straßenecken wurden von einem Kosaken oder einem Polizisten bewacht. Die Behörden waren bereit, denn seit Januar rechnete man mit einem kriminellen Ereignis. Die Spitzel und Agenten der Geheimpolizei des Zaren, der Ochrana, und seiner uniformierten politischen Polizei, der Gendarmerie, lieferten umfangreiche Berichte über die Machenschaften der Banden von Revolutionären und Kriminellen. Im Zwielicht dieses Untergrunds hatten sich die Welten von Banditen und Terroristen vermischt, und es war schwierig, Betrug und Wahrheit auseinanderzuhalten. Doch seit Monaten wurde über einen »Aufsehen erregenden Anschlag« – wie heutige Geheimdienstexperten es ausdrücken würden – »gemunkelt«.
An jenem strahlenden, dunstigen Morgen schien die orientalische Farbe von Tiflis (heute Tbilissi, die Hauptstadt der Republik Georgien) kaum in dieselbe Welt zu gehören wie St. Petersburg, die tausend Meilen entfernte Hauptstadt des Zaren. Die älteren Straßen, die weder mit fließendem Wasser noch mit Strom versorgt wurden, wanden sich an den Hängen des Mtazminda, des Heiligen Berges, hinauf, bis sie unvorstellbar steil wurden. Hier drängten sich schiefe, malerische Häuser, die mit Balkons überladen und von alten Reben umrankt waren. Tiflis war ein großes Dorf, in dem jeder jeden kannte.
Direkt hinter dem Militärhauptquartier, in der vornehmen Freilinskaja-Straße, einen Steinwurf vom Platz entfernt, wohnten Stalins Frau, eine hübsche, junge georgische Damenschneiderin namens Kato Swanidse, und ihr neugeborener Sohn Jakow. Es war eine echte Liebesheirat gewesen, denn trotz seiner düsteren Stimmungen verehrte er Kato, die seine revolutionäre Leidenschaft bewunderte und teilte. Während sie sich mit dem Baby auf ihrem Balkon sonnte, schickte Stalin sich an, ihr – und ganz Tiflis – einen gewaltigen Schock zu versetzen.
Dieser heimelige Ort war die Hauptstadt des Kaukasus, des wilden, gebirgigen Vizekönigreichs zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer, das dem Zaren unterstand und einen Schmelztiegel ungestümer und stolzer Völker darstellte. Der Golowinski-Prospekt erinnerte durch seine Eleganz an Paris. Weiße neoklassische Theater, ein Opernhaus im maurischen Stil, Grandhotels und die Paläste georgischer Fürsten und armenischer Ölbarone säumten die Straße, doch wenn man das Militärhauptquartier hinter sich ließ, ging der Jerewan-Platz über in ein asiatisches Sammelsurium. Exotisch gekleidete Straßenhändler boten an ihren Ständen scharf gewürzte georgische lobio-Bohnen und heißes chatschapuri-Käsebrot feil. Wasserträger, Höker, Taschendiebe und Gepäckträger belieferten oder bestahlen den Armenischen und den Persischen Basar, deren Gassen eher denen eines levantinischen Souks als einer europäischen Stadt ähnelten. Kamel- und Eselkarawanen, beladen mit Seidenstoffen und Gewürzen aus Persien und Turkestan sowie mit Obst und Weinschläuchen aus den üppigen georgischen Landgebieten, schoben sich durch die Tore der Karawanserei. Junge Kellner und Laufburschen bedienten ihre Kundschaft aus Hotel- und Tischgästen, brachten das Gepäck herein, schirrten Kamele und Esel ab – und beobachteten den Platz. Heute wissen wir aus den gerade geöffneten georgischen Archiven, dass Stalin die Karawanserei-Jungen – nach Art von Dickens’ Fagin – als vorpubertären Straßenkundschafter- und Kurierdienst benutzte. Unterdessen richteten die Obergangster in einem der riesigen Hinterzimmer der Karawanserei aufmunternde Worte an ihre bewaffneten Räuber und gingen den Plan ein letztes Mal durch. Stalin selbst war an jenem Morgen da.
Die beiden hübschen jungen Mädchen mit den wirbelnden Sonnenschirmen und den geladenen Revolvern, Pazija Goldawa und Anneta Sulakwelidse, »braunhaarig, schlank, mit schwarzen Augen, aus denen ihre Jugend leuchtete«, schlenderten über den Platz und blieben vor dem Militärhauptquartier stehen, wo sie mit russischen Offizieren, Gendarmen in flotter blauer Uniform und o-beinigen Kosaken flirteten.
Tiflis war – und ist – eine träge Stadt der Spaziergänger und Bummler, die häufig an einer der vielen Freiluftschenken Halt machen, um ein Glas Wein zu trinken. Wenn die protzigen, erregbaren Georgier irgendeinem europäischen Volk ähneln, dann den Italienern. Georgier und andere Kaukasier stolzierten laut singend in ihrer traditionellen tschocha – dem knielangen Wollmantel, der an der Brust mit Patronentaschen besetzt ist – durch die Straßen. Georgierinnen mit schwarzen Kopftüchern und Frauen russischer Offiziere in europäischer Kleidung promenierten durch die Tore der Puschkin-Gärten und kauften neben Persern und Armeniern, Tschetschenen, Abchasen und Gebirgsjuden Eis und Sorbets. Das Gewimmel von Hüten und Trachten ließ an eine Kostümparty denken.
Banden von Straßenjungen – kintos – musterten die Menge verstohlen und hielten Ausschau nach Beute. Halbwüchsige Priesterschüler in langen weißen Chorhemden wurden von ihren kirchlich gewandeten bärtigen Lehrern aus dem mit Säulen versehenen weißen Seminar über die Straße geleitet. Dort wäre Stalin neun Jahre zuvor fast zum Priester geweiht worden. Dieses unslawische, unrussische, durch und durch kaukasische Kaleidoskop von Ost und West war die Welt, die Stalin hervorgebracht hatte.
Die Mädchen Anneta und Pazija sahen auf die Uhr, trennten sich und bezogen Position an beiden Seiten des Platzes. Auf der Palaststraße unweit der plutokratischen Pracht von Fürst Sumbatows Palast trank die zwielichtige Kundschaft der notorischen Tiliputschuri-Schenke – Fürsten, Zuhälter, Spitzel und Taschendiebe – bereits georgischen Wein und armenischen Brandy.
Zu jenem Zeitpunkt besuchte David Sagiraschwili, ein weiterer Revolutionär, der Stalin und einige der Gangster kannte, einen Freund, dem ein Laden über der Schenke gehörte. Der fröhliche Räuber am Eingang, Batschua Kupraschwili, »bot mir nach georgischem Brauch sofort einen Stuhl und ein Glas Rotwein an«. David trank den Wein aus und wollte sich verabschieden, als ihm der Bewaffnete »mit ausgesuchter Höflichkeit« empfahl, in der Gaststätte zu bleiben und »noch mehr Häppchen und Wein zu probieren«. Nun begriff David, dass »Menschen ins Restaurant ein-, aber nicht wieder hinausgelassen wurden. Bewaffnete Gestalten wachten an der Tür.«
Pazija Goldawa, die Schmiere stehende schlanke Schwarzhaarige, entdeckte den auf der Allee entlanggaloppierenden Konvoi und eilte um die Ecke zu den Puschkin-Gärten, wo sie Stepko Inzkirweli, der am Tor wartete, mit ihrer Zeitung zuwinkte.
»Es geht los!«, sagte er sich.
Stepko nickte zu Anneta Sulakwelidse hinüber, die sich auf der anderen Straßenseite knapp außerhalb der Tiliputschuri-Schenke aufhielt. Sie bedeutete den Räubern am Eingang, die anderen aus der Bar herauszuwinken. »Auf ein vereinbartes Signal hin« tranken die Banditen aus, entsicherten ihre Pistolen und verteilten sich über den Platz – dünne, schwindsüchtige junge Männer, die seit Wochen kaum etwas gegessen hatten, in weiten Hosen. Einige waren Gangster, andere gewöhnliche Schurken und manche, für Georgien typisch, verarmte Fürsten aus dach- und mauerlosen Schlössern in den Provinzen. Ihre Taten mochten kriminell sein, aber sie machten sich nichts aus Geld, denn vor allem waren sie Lenin, der Partei und Stalin, ihrem Strippenzieher in Tiflis, ergeben.
»Die Aufgaben jedes Einzelnen von uns waren im Voraus geplant worden«, erinnerte sich ein drittes Mädchen der Bande, Alexandra Darachwelidse; sie war eine Freundin von Anneta, gerade neunzehn Jahre alt, doch aufgrund ihrer Beteiligung an zahlreichen Überfällen und Schießereien schon ein alter Hase.
Die Gangster beobachteten die Polizisten – die gorodowyje, im Straßenjargon als »Pharaonen« bekannt – auf dem Platz. Zwei Bewaffnete behielten die Kosaken vor dem Rathaus im Auge, die übrigen steuerten auf die Ecke der Weljaminow-Straße und des Armenischen Basars – unweit der Staatsbank – zu. Alexandra Darachwelidse beschrieb in ihren unveröffentlichten Erinnerungen, wie sie sich mit zwei Bewaffneten auf eine der Straßenecken konzentrierte.
Nun bemerkte Batschua Kupraschwili, der lässig vorgab, eine Zeitung zu lesen, in der Ferne eine Staubwolke, die von Pferdehufen aufgewirbelt wurde. Da kamen sie! Batschua rollte seine Zeitung zusammen und blieb auf der Lauer.
Der Kavalleriehauptmann mit dem blitzenden Säbel, der über den Platz spaziert war, warnte die Passanten, sich fernzuhalten, doch als niemand ihn beachtete, sprang er wieder auf sein edles Pferd. Er war kein Offizier, sondern der Inbegriff des georgischen beau sabreur: ein Geächteter, halb Ritter, halb Bandit. Es handelte sich um Kamo, den fünfundzwanzigjährigen Chef des Mobs und, wie Stalin es ausdrückte, »einen Meister der Verkleidung«, der nach Belieben als reicher Fürst oder als bäuerliche Wäscherin auftreten konnte. Seine Bewegungen waren steif, und sein halb blindes linkes Auge schielte und verdrehte sich, denn nur Wochen zuvor war eine seiner eigenen Bomben vor seinem Gesicht explodiert. Er war noch nicht davon genesen.
Kamo war »völlig fasziniert« von Stalin, der ihn zum Marxismus bekehrt hatte und mit dem zusammen er in dem 72 Kilometer entfernten Ort Gori in einer Atmosphäre der Gewalt aufgewachsen war. Obwohl ein Bankräuber von genialer Kühnheit und ein wahrer Houdini, was Gefängnisausbrüche anging, erwies er sich auch als leichtgläubiger Einfaltspinsel und neigte zu nahezu wahnsinnigen Anfällen psychopathischer Gewalt. Von ernster, gespenstischer Gelassenheit, mit leerem Blick und einem seltsamen »glanzlosen Gesicht«, brannte er darauf, seinem Herrn zu dienen, und bat Stalin häufig: »Erlaube mir, ihn für dich zu töten.« Kein noch so makaberer Horror, keine noch so mutige Extravaganz waren ihm zu viel: Später stieß er einmal seine Hand in die Brust eines Mannes und schnitt ihm das Herz heraus.
Während seines ganzen Lebens sollte Stalins gleichgültiges Charisma amoralische, unkontrollierte Psychopathen anziehen und ihm ihre treue Ergebenheit verschaffen. Kamo, der Handlanger aus seiner Jugend, und diese Gangster waren die Ersten in einer langen Reihe. »Jene jungen Männer folgten Stalin völlig selbstlos … Durch ihre Bewunderung für ihn war er in der Lage, ihnen seine eiserne Disziplin aufzuerlegen.« Kamo suchte oftmals Stalins Wohnung auf, wo er sich das Schwert von Katos Vater geborgt hatte, weil er »einen Kosakenoffizier spielen« wollte. Sogar Lenin, der mäkelige, als Adliger aufgewachsene Anwalt, war fasziniert von diesem Draufgänger, den er seinen »kaukasischen Banditen« nannte. Als alter Mann wunderte sich Stalin im Rückblick: »Kamo war ein wahrhaft verblüffender Mensch.«
»Hauptmann« Kamo wendete sein Pferd zur Allee und trabte waghalsig an dem ihm entgegenkommenden Konvoi vorbei. Sobald das Feuer eröffnet werde, prahlte er, werde die ganze Sache »in drei Minuten vorbei sein«.
Die Kosaken, jeweils zwei vor und hinter sowie einer neben den beiden Kutschen, galoppierten auf den Jerewan-Platz. Durch den Staub hindurch konnten die Gangster erkennen, dass zwei Männer im Frack – der Staatsbankkassierer Kurdjumow und der Buchhalter Golownja – sowie zwei Soldaten mit Gewehren im Anschlag in der Postkutsche saßen. Der zweite Wagen war voll von Polizisten und Soldaten. Im Donner der Hufe brauchten die Kutschen und Reiter nur Sekunden, um den Platz zu überqueren und in die Sololaki-Straße abzubiegen, wo die neue Staatsbank stand. Die Löwen- und Götterstatuen über ihrem Portal repräsentierten den zunehmenden Wohlstand des russischen Kapitalismus.*
Batschua senkte seine Zeitung, um das Signal zu geben, warf sie dann beiseite und griff nach seinen Waffen. Die Gangster zogen ihre »Äpfel« heraus: schlagkräftige Granaten, die Anneta und Alexandra in einem großen Sofa nach Tiflis geschmuggelt hatten.
Die Banditen und die Mädchen traten vor, zogen die Zünder heraus und schleuderten vier Granaten, die mit einem ohrenbetäubenden Lärm unter den Kutschen explodierten. Durch ihre teuflische Kraft wurden Pferde aufgeschlitzt und Männer in Stücke gerissen; Blut und Eingeweide bespritzten die Pflastersteine. Die Banditen griffen zu ihren Mauser- und Browning-Pistolen und eröffneten das Feuer auf die völlig ahnungslosen Kosaken und Polizisten am Platz. Diese stürzten verwundet zu Boden oder rannten in Deckung. Mehr als zehn Bomben explodierten. Zeugen dachten, sie seien aus allen Richtungen geschleudert worden, sogar von den Dächern. Später hieß es, Stalin habe die erste Bombe vom Dach der Villa des Fürsten Sumbatow geworfen.
Die Kutschen der Bank hielten an. Kreischende Passanten hasteten in Deckung. Viele glaubten an ein Erdbeben: Stürzte der Heilige Berg etwa auf die Stadt? »Niemand konnte unterscheiden, ob die schreckliche Schießerei auf das Dröhnen von Kanonen oder die Explosion von Bomben zurückzuführen war«, meldete die georgische Zeitung Issari (Pfeil). »Das Geräusch löste überall Panik aus … fast in der ganzen Stadt ergriffen Menschen die Flucht. Kutschen und Karren rasten davon …« Schornsteine waren von Gebäuden gestürzt; jede Glasscheibe bis hin zum Palast des Vizekönigs war zertrümmert.
Kato Swanidse stand in der Nähe auf ihrem Balkon und kümmerte sich mit ihren Angehörigen um Stalins Baby, »als wir urplötzlich den Lärm von Bomben hörten«, wie ihre Schwester Saschiko erzählte. »Erschrocken eilten wir ins Haus.« Draußen – unter dem gelben Rauch und in dem wüsten Chaos, zwischen den Pferdeleichen und den verstümmelten Gliedmaßen von Menschen – war aus der Sicht der Banditen etwas schiefgegangen.
Ein Pferd, das an die vordere Kutsche gespannt war, zuckte und wurde wieder lebendig. Gerade als die Gangster herbeirannten, um die Geldsäcke im hinteren Teil der Kutsche zu packen, bäumte das Pferd sich auf und flüchtete den Hügel hinunter zum Soldatenbasar. Es verschwand mit dem Geld, das Stalin seinem Parteichef Lenin für die Revolution versprochen hatte.
*
Im folgenden Jahrhundert wurde viel über Stalins Rolle an jenem Tag gemutmaßt, doch sie war nicht nachzuweisen. Aber aus den nun zugänglichen Archiven in Moskau und Tbilissi geht hervor, wie er die Operation plante und seine »Insider« innerhalb der Bank monatelang vorbereitete. Laut den unveröffentlichten Aufzeichnungen seiner Schwägerin Saschiko Swanidse, die in den georgischen Archiven verwahrt sind, gab Stalin offen zu, dass er die Aktion geleitet hatte.* Hundert Jahre nach dem Überfall ist es nun möglich, die Wahrheit aufzudecken.
Stalin schwelgte im »schmutzigen Geschäft der Politik«, im verschwörerischen Drama der Revolution. Als Diktator Sowjetrusslands sprach er vage, wenn nicht gar nostalgisch, von »Räuber-und-Kosaken«-Spielen – kasaki i rasboiniki, der russischen Version von »Räuber und Gendarm« –, aber er nannte nie Details, die seinen Ruf als Staatsmann hätten untergraben können.
Der Stalin von 1907 war ein kleiner, drahtiger, geheimnisumwitterter Mann mit vielen Decknamen. Gewöhnlich trug er ein rotes Satinhemd, einen grauen Mantel und seinen charakteristischen schwarzen Filzhut. Manchmal bevorzugte er eine traditionelle georgische tschocha, und gern warf er sich eine weite kaukasische Kapuze forsch über die Schulter. Immer unterwegs, häufig auf der Flucht, benutzte er die vielen Uniformen der zaristischen Gesellschaft als Verkleidung, und oft entzog er sich der Verfolgung, indem er Frauensachen anzog.
Er sang häufig georgische Lieder und rezitierte Gedichte, war attraktiv für Frauen, charismatisch und humorvoll, doch überaus finster – ein seltsamer Georgier mit einer nördlichen Kälte. Seine »brennenden« Augen waren honigfarben gesprenkelt, wenn er sich leutselig fühlte, und gelb, wenn er Zorn empfand. Er hatte sich noch nicht für den Schnurrbart und das kurz geschorene Haar seiner Blütezeit entschieden: Manchmal trug er einen Vollbart und lange Haare, immer noch mit der kastanienbraunen Tönung seiner Jugend, die nun dunkler wurde. Er war sommersprossig und pockennarbig, ging schnell, doch gekrümmt und hatte einen nach zahlreichen Kindheitsunfällen und -krankheiten steifen linken Arm.
Unermüdlich in seinem Tatendrang, sprudelte er über vor Ideen und Einfallsreichtum. Sein Wissensdurst und sein Drang, andere zu belehren, veranlassten ihn, fieberhaft Romane und Geschichtswerke zu lesen, doch seine Liebe zur Literatur wurde stets in den Schatten gestellt von dem Impuls, zu befehlen und zu dominieren, Feinde zu besiegen und sich für Beleidigungen zu rächen. Obwohl geduldig, ruhig und bescheiden, konnte er auch prahlerisch, aufdringlich und dünnhäutig sein, und dann löste der kleinste Funke grausame Zornesausbrüche aus.
Durchdrungen von der Ehren- und Loyalitätskultur Georgiens, war er der nüchterne Realist, der sarkastische Zyniker und der gnadenlose Halsabschneider par excellence. Er selbst hatte die bolschewistische Bankraub- und Mordorganisation geschaffen, die er aus der Ferne wie ein Mafiaboss kontrollierte. Und er pflegte eine bäuerliche Grobheit, die Genossen befremdete, doch den Vorteil hatte, seine subtilen Talente vor snobistischen Rivalen geheim zu halten.
Obwohl er eine glückliche Ehe mit Kato führte, hatte er sich für ein herzloses Wanderleben entschieden, das ihn, wie er glaubte, normaler Moral und Verantwortung enthob und sogar von der Liebe befreite. Doch während er über den Größenwahn anderer schrieb, fehlte ihm jegliche Selbsterkenntnis über seinen eigenen Machttrieb. Er genoss seine Geheimniskrämerei. Wenn er bei Freunden an die Tür klopfte und sie wissen wollten, wer dort sei, antwortete er mit vorgetäuschter Bedeutungsschwere: »Der Mann in Grau.«
Für ihn als einen der ersten Berufsrevolutionäre war der Untergrund ein natürlicher Lebensraum, durch den er sich mit katzenhafter Anmut bewegte, die schwer greifbar und höchst bedrohlich war. Als geborener Extremist und Verschwörer war der Mann in Grau ein wahrhaft Gläubiger, »ein marxistischer Fanatiker seit seiner Jugend«. Die Gewaltriten, die auf Stalins geheimem Planeten der kaukasischen Konspiration üblich waren, sollten sich später zur spezifischen Herrschaftskultur der Sowjetunion entfalten.
»Stalin hatte die Ära des bewaffneten Raubüberfalls eröffnet«, schrieb ein anderer Bankraub-Organisator, sein Freund Josef Dawritschewy aus seinem Heimatort Gori. Früher nahmen wir an, dass Stalin alle Aktionen organisierte, doch niemals persönlich an den Verbrechen teilnahm. Das könnte an jenem Tag im Jahr 1907 der Fall gewesen sein, aber heute wissen wir, dass Stalin selbst, gewöhnlich mit seiner Mauser bewaffnet, an anderen Raubüberfällen direkt beteiligt war.
Er hielt stets die Augen offen nach der spektakulärsten Beute und wusste, dass die effektivsten Banküberfälle mit Hilfe von Insidern eingefädelt werden. Bei dieser Gelegenheit hatte er sogar zwei Insider. Zuerst brachte er geduldig einen nützlichen Bankangestellten auf seine Seite, und dann war er einem Schulfreund begegnet, der zufällig für die Postabteilung der Bank arbeitete. Stalin hielt ihn sich monatelang warm, bis der Mann ihm den Tipp gab, dass am 13. Juni 1907 ein gewaltiger Betrag – vielleicht sogar eine Million Rubel – in Tiflis eintreffen werde.
Dieser entscheidende Informant enthüllte später, er habe dazu beigetragen, den kolossalen Raub zu ermöglichen, weil er ein großer Bewunderer von Stalins romantischer Poesie gewesen sei. Nur in Georgien war es möglich, dass der Dichter Stalin dem Gangster Stalin nützlich sein konnte.
*
Das durchgegangene Pferd raste mit der Kutsche und der Beute über den Platz. Einige der Gangster gerieten in Panik, doch drei von ihnen bewegten sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Batschua Kupraschwili behielt die Fassung und rannte auf das Pferd zu. Er trat so dicht an das Tier heran, dass er sein Leben riskierte, doch er warf einen weiteren »Apfel« unter den Bauch des Pferdes, worauf dessen Eingeweide herausgerissen und dessen Läufe weggesprengt wurden. Batschua selbst flog durch die Luft und landete benommen auf den Kopfsteinen.
Die Kutsche kam aus voller Fahrt zum Stehen. Batschua war außer Gefecht gesetzt, doch Datiko Tschibriaschwili sprang auf den Wagen und zerrte die Geldsäcke heraus. Mit den Säcken in der Hand schwankte er durch den Rauch zur Weljaminow-Straße. Aber die Bande war in Verwirrung geraten. Datiko konnte mit der Last der Banknoten nicht weit laufen. Er musste sie jemandem übergeben – doch wem?
Der wabernde Rauch lichtete sich und ließ ein Blutbad erkennen, das einer kleinen Schlacht gleichkam. Schreie und Schüsse erklangen weiterhin, während Blut über das Kopfsteinpflaster floss, auf dem Leichenteile verstreut waren. Kosaken und Soldaten wagten sich hervor und griffen nach ihren Waffen. Verstärkung war vom anderen Ende der Stadt unterwegs. »Sämtliche Genossen«, schrieb Batschua Kupraschwili, »wurden den Erwartungen gerecht – außer drei Männern, die schwache Nerven hatten und davonrannten.« Doch Datiko hatte einen Moment lang das Gefühl, ganz allein zu sein. Verstört hielt er inne, und der Erfolg des Plans hing an einem seidenen Faden.
*
Warf Stalin wirklich die erste Bombe vom Dach des Hauses von Fürst Sumbatow? P. A. Pawlenko, einer der gefügigen Schriftsteller des Diktators, behauptete, Stalin selbst habe die Kutsche angegriffen und sei durch einen Bombensplitter verwundet worden. Aber das ist unwahrscheinlich, denn Stalin »wahrte Distanz« zu allen anderen: nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, weil er sich stets für etwas Besonderes hielt.
In den Zwanzigerjahren behauptete Kamo laut georgischen Quellen in betrunkenem Zustand, Stalin habe sich nicht aktiv an dem Bankraub beteiligt. Dies wurde durch einen anderen fragwürdigen, der Polizei nahestehenden Gewährsmann bestätigt, der schrieb, Stalin habe sich »das grausame Blutvergießen aus dem Hof eines Herrenhauses« am Golowinski-Prospekt angesehen und »dabei eine Zigarette geraucht«. Vielleicht gehörte das »Herrenhaus« tatsächlich Fürst Sumbatow. In den Milchbars und Schenken, bei den Schuhmachern, Friseuren und Kurzwarenhändlern des Boulevards wimmelte es von Ochrana-Spitzeln. Höchstwahrscheinlich hatte sich Stalin, der Meister der Geheimhaltung, der auf überraschende Auftritte und Abgänge spezialisiert war, davongemacht, lange bevor die Schießerei begann. Der verlässlichsten Quelle zufolge befand er sich an jenem Morgen auf dem Bahnhof. Hier hielt er mühelos Kontakt zu seiner Organisation aus Trägern und Gassenjungen auf dem Jerewan-Platz. Falls diese gerissenen Burschen schlechte Nachrichten überbrachten, konnte er auf einen Zug springen und verschwinden.
*
Gerade als der Banküberfall zu scheitern drohte, raste »Hauptmann« Kamo mit seinem eigenen Wagen auf den Platz. Wie ein Cowboy in einem Western hatte er mit der einen Hand die Zügel gepackt, während er mit der anderen seine Mauser abfeuerte. Wütend über das Misslingen des Plans fluchte er aus Leibeskräften »wie ein richtiger Hauptmann«, ließ seine Kutsche immer wieder herumwirbeln und ergriff damit neuerlich Besitz von dem Platz. Dann preschte er auf Datiko zu, beugte sich hinunter und wuchtete die Beutesäcke zusammen mit einem der bewaffneten Mädchen in den Wagen. Abrupt wendete er die Kutsche und jagte zurück über die Allee, vorbei am Palast des Vizekönigs. Dort summte es wie in einem Bienenstock, denn Soldaten wurden zusammengezogen, Kosaken sattelten ihre Pferde, und Befehle, mit denen man Verstärkung anforderte, wurden abgeschickt.
Kamo bemerkte eine Polizeikutsche mit A. G. Balabanski, dem stellvertretenden Polizeichef, die in die entgegengesetzte Richtung rollte. »Das Geld ist in Sicherheit. Fahren Sie zum Platz«, rief Kamo. Balabanski hielt auf den Platz zu und wurde sich seines Fehlers erst am folgenden Tag bewusst. Er beging Selbstmord.
Kamo steuerte stracks zur Wtoraja Gontscharnaja-Straße und bog in den Hof einer Tischlerei hinter einem Haus ein, das einer alten Dame namens Barbara »Schätzchen« Botschoridse gehörte. Hier hatte Stalin im Lauf der Jahre viele Abende mit ihrem Sohn Micha verbracht, und hier hatte er den Raub geplant. Die Adresse war der Ortspolizei gut bekannt, doch die Banditen hatten mindestens einen Gendarmerie-Offizier, Hauptmann Subow, bestochen, der später wegen Korruption – und sogar wegen Mittäterschaft beim Verstecken der Beute – angeklagt wurde. Der erschöpfte Kamo übergab das Geld, zog seine Uniform aus und goss sich einen Eimer voll Wasser über den dampfenden Schädel.
*
Die Nachricht von Stalins sensationellem Coup ging wie ein Lauffeuer um die Welt. In London verkündete der Daily Mirror: »BOMBENREGEN: Revolutionäre schleudern den Tod in große Menschenmengen«: »Rund zehn Bomben, eine nach der anderen, wurden heute in das Menschengedränge auf dem Platz im Stadtzentrum geworfen. Die Bomben explodierten mit schrecklicher Kraft, viele Menschen wurden getötet …« Die Times sprach von der »BOMBEN-GEWALTTAT IN TIFLIS«; Le Temps in Paris drückte sich lakonischer aus: »KATASTROPHE!«
Tiflis war in Aufruhr. Der normalerweise leutselige Vizekönig des Kaukasus, Graf Woronzow-Daschkow, wetterte über die »Unverschämtheit der Terroristen«. Die »Verwaltung und die Armee sind mobilisiert«, schrieb Issari. »Polizei und Patrouillen haben überall in der Stadt Durchsuchungen eingeleitet. Viele wurden verhaftet …« In St. Petersburg war man empört. Sämtliche Sicherheitskräfte wurden angewiesen, das Geld und die Räuber zu finden. Man entsandte einen Spezialdetektiv mit einem Team, um die Ermittlungen zu leiten. Straßen wurden gesperrt und der Jerewan-Platz umzingelt, während Kosaken und Gendarmen die üblichen Verdächtigen zusammentrieben. Jeder Spitzel und Doppelagent wurde um Informationen angegangen, und man erhielt alle möglichen Versionen, von denen keine auf die wahren Schuldigen hinwies. Zwanzigtausend Rubel waren in der Kutsche zurückgelassen worden. Ein überlebender Kutscher, der sein Glück kaum fassen konnte, steckte weitere 9500 Rubel ein und wurde später verhaftet. Er wusste nichts über Stalins und Kamos Bande. Eine faselnde Frau gab sich als eine der Bankräuberinnen aus, erwies sich jedoch als geisteskrank.
Niemand konnte abschätzen, wie viele Räuber an dem Überfall beteiligt waren. Zeugen meinten, bis zu fünfzig Gangster hätten Bomben von den Dächern, wenn nicht gar vom Heiligen Berg, auf den Platz geschleudert. Niemand hatte gesehen, wie Kamo die Beute an sich brachte. Die Ochrana hörte Geschichten aus ganz Russland, dass der Raub entweder vom Staat selbst, von polnischen Sozialisten, von Anarchisten aus Rostow, von armenischen Daschnaken oder von den Sozialrevolutionären eingefädelt worden sei.
Keiner der Banditen wurde gefangen. Sogar Kupraschwili kam rechtzeitig zu sich, um davonzuhumpeln. In dem sich anschließenden Chaos machten sich die Räuber in alle Richtungen davon und tauchten in der Menge unter. Einer von ihnen, Elisso Lominadse, der an einer Straßenecke mit Alexandra Ausschau gehalten hatte, schlich sich in eine Lehrerkonferenz, stahl eine Lehreruniform und spazierte dann kaltblütig zurück auf den Platz, um sein Werk zu bewundern. »Alle überlebten«, sagte Alexandra Darachwelidse, als sie – mittlerweile das einzige noch lebende Mitglied der unglückseligen Bande – 1959 ihre Erinnerungen diktierte.
Fünfzig Verwundete lagen auf dem Platz, dazu die zerstückelten Leichen von drei Kosaken, den Bankangestellten und einigen unschuldigen Passanten. Die zensierten Zeitungen hielten die Zahl der Opfer niedrig, doch aus den Ochrana-Archiven geht hervor, dass ungefähr vierzig Menschen ums Leben kamen. Man richtete Verbandsplätze in nahe gelegenen Geschäften ein, und brachte vierundzwanzig Schwerverwundete ins Krankenhaus. Eine Stunde später konnte man die Trauerfahrt der gespenstischen Kutsche beobachten, welche die Toten und die Leichenteile, wie Innereien aus einem Schlachthof, den Golowinski-Prospekt hinunterfuhr.
Bei der Staatsbank war man nicht sicher, ob 250 000 oder 341 000 Rubel geraubt worden waren. Es handelte sich um eine beeindruckende Summe von rund 2,5 Millionen € nach heutigen Berechnungen, doch die tatsächliche Kaufkraft lag viel höher.
Botschoridse und seine Frau Maro, ebenfalls eine der Bankräuberinnen, nähten das Geld in eine Matratze. Die anmutige, mit einer Mauser ausgerüstete Pazija Goldawa rief dann einige Träger herbei, möglicherweise ein paar von Stalins Gassenjungen, und beaufsichtigte den Transport zu einem neuen Unterschlupf am anderen Ufer der Kura. Danach wurde die Matratze auf die Couch des Direktors im Meteorologischen Observatorium von Tiflis gelegt, wo Stalin nach seinem Austritt aus dem Seminar gewohnt und gearbeitet hatte. Es war sein letzter wirklicher Posten, bevor er sich in den konspirativen Untergrund stürzte, und überhaupt seine letzte Erwerbstätigkeit, bevor er sich im Oktober 1917 Lenins Sowjetregierung anschloss. Später gab der Direktor des Wetterzentrums zu, dass er nicht geahnt hatte, welche Reichtümer sich unter seinem Kopf verbargen.
Stalin selbst half, wie es in vielen Quellen heißt, das Bargeld im Observatorium zu verstauen. Das mag nach einer Legende klingen, aber es ist plausibel, denn wie bekannt wurde, gingen häufig gestohlene Gelder durch seine Hände, und er bewachte Satteltaschen voller Geldscheine, die aus Banküberfällen und Seeräuberei stammten und über die Berge hinweggeschafft werden mussten.
Überraschenderweise fühlte Stalin sich an jenem Abend sicher genug, um zu Kato nach Hause zurückzukehren und vor seinen Angehörigen mit der Tat zu prahlen – seine Jungs hatten es vollbracht. Er hatte allen Grund, stolz zu sein, denn das Geld war sicher in der Matratze des Meteorologen untergebracht und würde bald zu Lenin unterwegs sein. Niemand verdächtigte Stalin oder gar Kato. Man würde die Beute ins Ausland schmuggeln und einen Teil davon durch die Crédit Lyonnais Bank waschen lassen. Die Polizei von einem Dutzend Nationen sollte monatelang Jagd auf das Bargeld und die Räuber machen – vergebens.
Noch zwei Tage nach dem Raub soll sich Stalin, dem keine Verbindung zu dem Raub nachgesagt wurde, so sicher gefühlt haben, dass er sich unbekümmert in Schenken am Fluss herumtrieb – aber nicht mehr lange. Ganz plötzlich erklärte er seiner Frau, sie müssten sofort zu einem neuen Leben in Baku aufbrechen, der Ölstadt am anderen Ende des Kaukasus.
»Weiß der Teufel«, stand in der Tifliser Nowoje wremja (Neue Zeit), »wie dieser beispiellos verwegene Raub ausgeführt wurde.« Stalin hatte das perfekte Verbrechen begangen.
*
Doch der Überfall von Tiflis war, wie man bald erfuhr, weit davon entfernt, perfekt zu sein. Beinahe wäre er ihm sogar zum Verhängnis geworden. Danach ließ sich Stalin nie mehr in Tiflis oder überhaupt in Georgien nieder. Kamos Schicksal sollte einen tragischen Verlauf nehmen. Die Suche nach dem Geld – einiges davon in markierten Scheinen – sollte sich als kompliziert herausstellen, doch trotz aller erstaunlichen Wendungen war die Angelegenheit für Stalin keineswegs abgeschlossen. Der Erfolg des Raubes erwies sich für ihn fast als Unheil. Die globale Verurteilung des Überfalls wurde zu einer mächtigen Waffe gegen Lenin und Stalin persönlich.