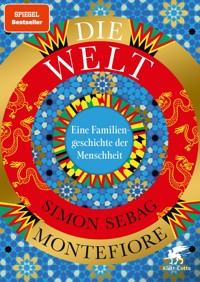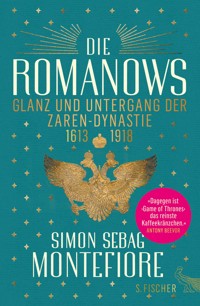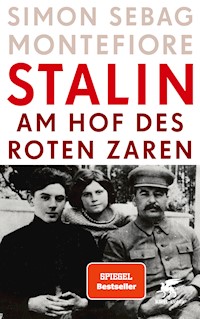
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Der Autor zeigt Stalin erstmals als Teufel und Menschen zugleich.« Markus Wehner, FAZ Mord, Terror und Intrigen: Packend und bis zur letzten Seite spannend schildert Simon Sebag Montefiore das Leben Josef Stalins und zeichnet ebenso fesselnde wie lebensnahe Porträts der wichtigsten Gefolgsleute des Tyrannen: eine einzigartige Darstellung des alltäglichen Lebens und der tödlichen Ränkespiele am Hof des Roten Zaren. In seiner fulminanten und meisterhaft geschriebenen Biographie – voller Details aus Briefen, Tagebüchern und persönlichen Gesprächen – zeigt uns Simon Sebag Montefiore einen der grausamsten Diktatoren der Weltgeschichte als Herrscher und zugleich als skrupelloses Haupt eines ganzen Hofstaates. Dabei gewährt er überraschende Einblicke in das verborgene Leben, die mörderischen Intrigen und die tödlichen Machenschaften der Mitglieder des Politbüros und ihrer Familien. Eindrucksvoll beschreibt er die Beziehungen zwischen einem Menschheitsverbrecher und einer Kamarilla, die von enthemmter Gewaltbereitschaft ebenso geprägt sind wie von kleinbürgerlich idyllischen Alltagsfreuden. Schonungslos und mit atemberaubenden Sinn für die menschlichen Abgründe enhüllt einer der großen historischen Erzähler der Gegenwart die ganze Amoralität eines totalitären Regimes, dessen Erben uns bis heute heimsuchen. »In Simon Sebag Montefiores monumentaler Studie ist Stalin nicht mehr der rätselhaft-abstrakte Diktator. Der Menschheitsverbrecher Josef Wassarinowitsch Dschugaschwili tritt dem Leser in dem faszinierenden Buch vielmehr als leibhaftige Person entgegen. [...] Eindrucksvoll beschreibt Montefiore das paranoide Nebeneinander von enthemmter Gewaltbereitschaft und kleinbürgerlich anmutendem Idyll am Hofe des roten Zaren.« Welt am Sonntag »Die neue Stalin-Biograpie: bis zur letzten Seite spannend« aspekte/ZDF »Simon Sebag Montefiore hat es geschafft, uns ein ungewöhnlich persönliches Bild vom alltäglichen Leben im Kreml zu geben. Eine packende Darstellung.« Robert Service, Oxford University
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1562
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
SIMON SEBAG MONTEFIORE
STALIN
AM HOF DES ROTEN ZAREN
Aus dem Englischen von Hans Günter Holl
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Stalin. The Court of the Red Tsar« im Verlag Weidenfeld & Nicolson, London, 2003
© 2003 by Simon Sebag Montefiore
Für die deutsche Ausgabe
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung eines Fotos von © Heritage Image Partnership Ltd / Alamy Stock Photo
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98735-5
E-Book: ISBN 978-3-608-12154-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Lily Bathsheba
INHALT
VORWORT von Prof. Dr. Jörg Baberowski
PROLOG DAS FESTESSEN VOM 8. NOVEMBER 1932
ERSTER TEIL EINE WUNDERBARE ZEIT: STALIN UND NADJA, 1917 – 1932
1. Der Georgier und das Schulmädchen
2. Die Kreml-Familie
3. Der Charmeur
4. Hungersnot und Idylle: Stalin am Wochenende
5. Ferien und die Hölle: Das Politbüro am Meer
6. Züge voller Leichen: Liebe, Tod und Hysterie
7. Stalin als Mäzen
ZWEITER TEIL LUSTIGE GESELLEN: STALIN UND KIROW, 1932 – 1934
8. Die Beisetzung
9. Der Witwer und die Seinen: Sergo, der Bolschewikenprinz
10. Verdorbener Sieg: Kirow, das Komplott und der XVII. Parteitag
11. Tod des Favoriten
DRITTER TEIL AM ABGRUND: 1934–1936
12. »Ich bin verwaist«: Der Trauerspezialist
13. Ein Geheimbund: Die Rose von Nowgorod
14. Ein Zwerg steigt auf, und ein Casanova stürzt
15. Der Zar fährt Metro
16. Pakt gegen Häftlinge: Der Schauprozess
VIERTER TEIL GEMETZEL: JESCHOW, DER GIFTZWERG, 1937 – 1938
17. Der Vollstrecker: Berias Gift und Bucharins Dosis
18. Sergo: Tod eines »vollendeten Bolschewiken«
19. Das Massaker an den Generälen: Jagodas Sturz und der Tod einer Mutter
20. Blutbad nach Quoten
21. »Brombeere« bei der Arbeit
22. Blutige Hemdsärmel: Der innere Kreis des Mordens
23. Familienleben im Terror: Die Frauen und Kinder der Magnaten
FÜNFTER TEIL SCHLACHTFEST: BERIAS AUFTRITT, 1938 – 1939
24. Stalins Damen und die Familie in Gefahr
25. Beria und das Henkersleid
26. Die Tragödie und Verruchtheit der Jeschows
27. Tod in Stalins Familie: Ein seltsamer Antrag und die Haushälterin
SECHSTER TEIL »DAS GROSSE SPIEL«: HITLER UND STALIN, 1939 – 1941
28. Die Aufteilung Europas: Molotow, Ribbentrop und Stalins Judenfrage
29. Die Ermordung der Frauen
30. Molotow-Cocktails: Der Winterkrieg und Kuliks Frau
31. Molotow trifft Hitler: Kühnheit und Ernüchterung
32. Der Countdown: 22. Juni 1941
SIEBTER TEIL KRIEG: DAS LERNENDE GENIE , 1941 – 1942
33. Hoffnung und Zusammenbruch
34. »Ich brenne vor Eifer«: Schdanow und das belagerte Leningrad
35. »Können Sie Moskau halten?«
36. Molotow in London, Mechlis auf der Krim, Chruschtschew am Ende
37. Churchills Besuch bei Stalin: Marlborough gegen Wellington
38. Stalingrad und der Kaukasus: Beria und Kaganowitsch im Krieg
ACHTER TEIL KRIEG: DAS TRIUMPHALE GENIE, 1942 – 1945
39. Der Oberste Befehlshaber von Stalingrad
40. Söhne und Töchter: Stalin und die Politbüro-Kinder im Krieg
41. Stalins Sängerwettstreit
42. Teheran: Roosevelt und Stalin
43. Der stolze Sieger: Jalta und Berlin
NEUNTER TEIL DAS GEFÄHRLICHE SPIEL DER NACHFOLGE, 1945 – 1949
44. Die Bombe
45. Beria: Potentat, Ehemann, Vater, Liebhaber, Frauenschänder, Mörder
46. Eine Nacht im Leben des Josef Wissarionowitsch: Tyrannei im Kino und bei Tisch
47. Molotows Chance: »Im Suff reden Sie nur Unsinn!«
48. Schdanow als Thronfolger und Abakumows blutiger Teppich
49. Der Niedergang Schukows und die Plünderung Europas: Die Reichselite
50. »Den haben die Zionisten dir untergeschoben!«
51. Ein einsamer, alter Mann im Urlaub
52. Zwei seltsame Todesfälle: Der jiddische Schauspieler und der designierte Nachfolger
ZEHNTER TEIL DER LAHME TIGER, 1949 – 1953
53. Die Festnahme Polina Molotowas
54. Morde und Hochzeiten: Die Leningrader Affäre
55. Mao, Stalins Geburtstag und der Koreakrieg
56. Der Knirps und das Ärztekomplott: Drauf, drauf und nochmal drauf!
57. Junge Katzen und Nilpferde: Die Vernichtung der alten Garde
58. »Ich habe ihn erledigt!«: Der Patient und seine zitternden Ärzte
Postskriptum
ANHANG
Quellenverzeichnis
Stalins Stammbaum
Die Sowjetunion unter Stalin 1929–1953
Der Sowjetische Kaukasus unter Stalin 1929–1953
Die Hauptpersonen
Danksagung
Auswahlbibliographie
Namenregister
VorwortDER STALINSCHE HOF UND DIE WURZELN DES STALINISMUS
Wozu ein Buch über Stalins Hof? Was ist über den Diktator noch zu sagen, was nicht schon tausendfach gesagt worden ist, in zahlreichen Aufsätzen, Essays und Büchern über die Gewaltherrschaft, die die Historiker Stalinismus nennen? Und warum sollen wir uns mit Stalin und seinem Hof überhaupt beschäftigen? Die Antwort ist einfach und eindeutig: Wir werden, wenn wir uns Stalin und seinen Helfern als Menschen zuwenden, die Rationalität der destruktiven Gewaltherrschaft besser als bisher verstehen. Zu zeigen, wie der individuelle Mensch als Schöpfer und Geschöpf seiner Umgebung gewesen ist, das aber ist die eigentliche Aufgabe des Historikers, denn wir wollen nicht wissen, wie die Welt ist, sondern wie sie von den historischen Menschen gesehen wurde. Allein auf diese Weise werden wir verstehen, wer Stalin und was der Stalinismus waren.
In der zurückliegenden Geschichtsschreibung über Stalin und den Stalinismus aber blieben die menschlichen Eigenschaften des Diktators und seiner Gefolgsleute eher im Verborgenen. Die Stalin-Biographien von Adam Ulam, Robert McNeal und Robert Tucker waren Erzählungen vom Leben Stalins, die wenig darüber sagten, woher dieser Mann kam und was dessen Herkunft und das Milieu, in dem er sich bewegte, über den Stalinismus zu verstehen geben.1* Wie hätte das auch geschehen können, wenn wir nicht einmal wissen, wer die Gefolgsleute waren, die sich am Hof des Diktators aufhielten: Molotow, Mikojan, Kaganowitsch, Beria, Malenkow, Schdanow und Woroschilow.
Die Historiker haben statt dessen von Strukturen gesprochen, von der Allmacht bürokratischer Apparate und Ideologien, wenn sie ihre Leser über den totalitären Charakter des bolschewistischen Regimes aufklären wollten. Im »Jahrhundert der Ideologien« (Karl-Dietrich Bracher) wurden Menschen von Apparaten regiert und als Individuen ausgelöscht. Aber wer regierte in diesen Apparaten und wie konnte es geschehen, dass der exzessive Terror mit dem Tod des Diktators zu einem Ende kam?2*
Über Stalin und seine Helfer hatten auch die so genannten Revisionisten unter den Historikern, die in den 1980er Jahren mit der Behauptung aufwarteten, der Stalinismus sei »von unten« gekommen, nichts von Belang mitzuteilen. Ihnen galten die Exzesse der Stalin-Ära als ein Resultat ungesteuerter und unkontrollierbarer Konflikte zwischen konkurrierenden Apparaten und sozialen Gruppen. In Wahrheit seien gesellschaftliche und soziale Krisen für den Ausbruch des Terrors verantwortlich gewesen. Stalin und seine Helfer hätten den Terror nicht nur nicht verursacht, sie hätten ihn nicht einmal kontrollieren können. So behauptete der amerikanische Historiker J. Arch Getty, die Parteiführung habe die Sicherheitsorgane noch 1937, im Jahr des Großen Terrors, darauf hinweisen müssen, daß Exzesse nicht erlaubt seien. Wo sie dennoch vorgekommen seien, müssten sie dem Eifer lokaler Parteisekretäre zugeschrieben werden.3* Aber man erfuhr auch von den Revisionisten nur wenig über die Personen, die sich in diesen Konflikten bewegten. Wo die einen von Ideologien und allmächtigen Apparaten sprachen, entdeckten die anderen soziale Klassen und konkurrierende Gruppen. Hier wie dort erlagen die Historiker aber vor allem den Selbstinszenierungen des Regimes, über das Leben, das sich hinter diesen monolithischen Fassaden verbarg, hatten sie uns nichts mitzuteilen. Und weil sich natürlich auch die politischen Führer in der Öffentlichkeit über die Welt stets nur im Stil der staatlichen Propaganda auszudrücken wussten, erfuhr man über sie auch nicht mehr, als dass sie im Meinungsdienst einer Ideologie standen.
Nun sind Ideologien und Lebensordnungen nicht einfach da. Es gibt weder einen »Marxismus« noch einen »Kommunismus«, der aus den Texten unvermittelt spricht. Das Bewusstsein ist kein Reflex der Ideologie, sondern ihr Produzent. Und darin, dass Menschen verschieden sind, dass sie aus verschiedenen Milieus und Kulturen stammen, nehmen die Ideen unterschiedliche Gestalt an. Karl Kautsky und Josef Stalin sprachen, wenn sie Bekenntnisse zum Marxismus abgaben, in verschiedenen Sprachen, und sie meinten Verschiedenes, wenngleich sie in den gleichen Begriffen sprachen. Aber die politischen Führer waren nicht nur Produzenten von Ideen: sie waren Männer und Liebhaber, sie pflegten Freundschaften, sie hatten eine Heimat und eine Vergangenheit, an die sie sich auf ihre Weise erinnerten, sie hassten und sie liebten, sie hatten Neurosen und sie waren Gewalttäter. Es kommt also darauf an, die Täter in ihren Lebenswelten zu beobachten und aus verschiedenen Perspektiven zu beschreiben. Es reicht nicht aus, ihre Reden und politischen Auftritte zu untersuchen oder ihre Texte zu analysieren. Wir werden die gewalttätigen Exzesse im Jahrhundert der Ideologien nicht verstehen, wenn wir nicht verstanden haben, wie Stalin und seine Gefolgsleute als Menschen gewesen sind.
Davon nun handelt das großartige Buch von Simon Sebag Montefiore, das allen Büchern, die von professionellen Historikern über den Stalinismus verfasst worden sind, allein darin überlegen ist, dass es zu erzählen weiß. Von welchem Historiker ließe sich denn sagen, seine Bücher seien schön geschrieben und würden deshalb auch gern gelesen? Aber das Buch teilt auch Neues mit. Es präsentiert Stalin und seine Paladine nicht nur als Urheber des Massenterrors und der Gewalt, sondern zeigt sie auch als lebendige Menschen, die sich über das, was sie anderen antaten, verständigen, die einander Briefe schrieben, miteinander aßen und tranken und gemeinsam den Urlaub verbrachten.
Eine solche Alltagsgeschichte des Stalinschen Hofes hätte vor zehn Jahren noch nicht erzählt werden können. Seit dem Ende der 1990er Jahre wurden die persönlichen Archive Stalins und seiner Gefolgsleute wie Kaganowitsch, Molotow, Woroschilow, Ordschonikidse, Kirow, Malenkow, Mikojan und Andrejew nach und nach für die wissenschaftliche Öffentlichkeit zugänglich. Und Sebag Montefiore hat fast alles gesehen, was man in diesen Archiven zu diesem Thema finden kann.
Von unschätzbarem Wert sind auch die Interviews, die Sebag Montefiore mit den Nachkommen der Gefolgsleute und den wenigen Überlebenden, die Stalin noch gekannt haben, führen konnte. Und natürlich die unveröffentlichten Tagebücher und Aufzeichnungen der georgischen Freunde Stalins, Tscharkwiani und Kawtaradse, die Tagebücher des Marschalls Budjonni und Maria Swanidses, die das Milieu und die Atmosphäre am Hof des Despoten in ein helles Licht tauchen.
Was nun kann man aus dem Buch über den Menschen Stalin und seinen Hof erfahren?
Sebag Montefiore porträtiert Stalin nicht nur als Politiker, sondern auch als Vater und Ehemann, als Liebhaber, als Gastgeber und Urlauber. Dabei zeigt sich, daß Stalin keineswegs paranoid war, er liebte seine Frau, seine Söhne Jakow und Wasili und seine Tochter Swetlana, er mochte die Kinder seiner Gefolgsleute, mit denen er spielte, er pflegte Freundschaften, und er konnte, wenn er gut aufgelegt war, ein liebenswürdiger und charmanter Unterhalter sein. Davon haben nicht zuletzt zahlreiche ausländische Besucher berichtet, die sich nicht erklären konnten, wie ein Mensch, der ihnen freundlich erschien, zugleich ein Mörder und Verbrecher sein konnte. Die Ehefrau Kawtaradses, eines Jugendfreundes von Stalin, erinnerte sich an einen Besuch des Diktators in ihrer Wohnung. Stalin habe sie gefragt, als er ihre weißen Haare gesehen habe, wer sie denn so schlimm gefoltert habe? Dann habe er Speisen aus einem georgischen Feinschmeckerrestaurant kommen lassen und habe georgische Lieder gesungen. Stalin habe sie und ihren Ehemann einsperren und foltern, ihren Schwager töten lassen. Und jetzt saß er in ihrer Wohnung und sang in einem »lieblichen Tenor« georgische Lieder. »Er sang so schön.«
Stalin sang nicht nur schön, er war auch ein Gewalttäter, er war misstrauisch, er litt an Verfolgungswahn, und er hatte keine Skrupel, selbst Menschen aus seiner Umgebung zu verstoßen und ermorden zu lassen. Nicht einmal die engsten Verwandten waren vor der Rachsucht und dem Misstrauen des Despoten sicher. Robert Tucker hat in seiner Stalin-Biographie davon gesprochen, der Diktator sei psychisch krank gewesen, habe unter den Schlägen des Vaters gelitten und habe Minderwertigkeitsgefühle kompensieren müssen. So aber spricht nur, wer die Welt nicht versteht, aus der Stalin kam und in der er sich bewegte.4*
Stalins Welt bestand aus Freunden und Feinden, die sich auf Gedeih und Verderb die Treue hielten. In einem politischen System, das durch persönliche Beziehungen strukturiert und durch Freundschaften stabilisiert wurde, kam es darauf an, dass die politischen Führer einander vertrauten und sich aufeinander verlassen konnten. Angesichts des Krieges, den das Regime seit dem Beginn der Kollektivierung gegen die Bevölkerung führte, gab es zur Freundschaft als Herrschaftsprinzip keine Alternative.5* Freundschaft fand ihren symbolischen Ausdruck in der Nähe zum Diktator. Am Hof Stalins erwarben die führenden Bolschewiki Prestige, wer dem Diktator nahe stand, verfügte über größere Autorität als jene, die keinen Zugang zum Hof erhielten. Sebag Montefiore beschreibt die Nähe zwischen Stalin und den Gefolgsleuten, die Tür an Tür auf dem Gelände des Kremls wohnten, miteinander aßen und feierten. Nach dem Krieg, als das Zentralkomitee und das Politbüro schon nicht mehr zu regulären Sitzungen zusammentraten, gehörte zum engsten Führungskreis, wer eingeladen wurde, mit Stalin Filme im Kremlkino anzusehen, an seiner Tafel zu speisen und mit ihm zu verreisen.
Die Nähe zum Diktator konnte aber auch tödlich sein, denn wo politische Entscheidungen von der persönlichen Loyalität der Freunde abhingen, kam es darauf an, sich der gegenseitigen Freundschaft stets neu zu versichern. Nur am Hof waren die Gefolgsleute unter der Kontrolle des Diktators, hier konnten sie gegeneinander ausgespielt, bespitzelt und überwacht werden. Stalin stellte die Gefolgsleute auf die Probe. Er ließ ihre Ehefrauen verhaften, wie es Kalinin und Molotow widerfuhr, er ließ die Brüder seiner engsten Freunde, Kaganowitsch, Ordschonikidse und Mikojan, erschießen, um herauszufinden, ob sie ihrer Freundschaft zum Diktator Freunde und Verwandte zu opfern bereit waren. Während der Kollektivierung und auf dem Höhepunkt des Großen Terrors entsandte Stalin die Gefolgsleute in die Provinz, um Bauern deportieren und scheinbar illoyale Kommunisten und ihre Gefolgschaften töten zu lassen. Stalins Arm reichte in alle Regionen der Sowjetunion, und es gab keine bürokratischen Prozeduren, die ihn an seinem Werk der Zerstörung hätten hindern können. Beklemmend sind die Briefe des Politbüromitglieds Andrei Andrejew, aus denen Sebag Montefiore zitiert. Aus Woronesch schickte er Stalin ein Telegramm, in dem er stolz verkündete: »Hier existiert kein Büro mehr. Alle Kader sind als Volksfeinde verhaftet. Jetzt weiter nach Rostow.« Während Menschen starben und die Kommunisten vor Angst vergingen, schickte Andrejew seiner Familie Ansichtskarten aus den Regionen, in denen er sein blutiges Handwerk betrieb.
Im Terror stellten die Magnaten vor allem ihre Treue unter Beweis. Als Anastas Mikojan Zweifel an der Schuld von Verhafteten äußerte, beauftragte Stalin ihn damit, die Führung der Kommunistischen Partei Armeniens nach Volksfeinden abzusuchen. Mikojan reiste nach Armenien und unter Aufsicht Lawrenti Berias, den Stalin ihm als Aufpasser an die Seite gestellt hatte, dort richtete er ein Massaker unter den armenischen Kommunisten an. Danach konnte Stalin sich wieder auf seinen Gefolgsmann verlassen.
Wo Stalin Illoyalität und Verrat witterte, starben nicht nur jene, die in Ungnade gefallen waren, sondern auch ihre Verwandten und Vertrauten. Es lag in der Logik des Klientelwesens und des Patronagesystems, dass Machtstrukturen nur zerstört werden konnten, wenn die Personenverbände zerschlagen wurden, die sie konstituierten. Stalin lebte in einer Welt, die von Treue und Verrat regiert wurde. In ihr konnte nur überleben, wer sich den Regeln unterwarf, die in ihr galten. Aus diesem Teufelskreis scheinen die Magnaten erst in den letzten Lebensjahren des Diktators ausgebrochen zu sein, als Stalin ihnen allen nach dem Leben trachtete. Als Molotow und Mikojan in Ungnade fielen, Beria in Verdacht geriet, überwanden die Höflinge ihre Feindschaft und das gegenseitige Misstrauen. Möglicherweise waren die letzten Lebensjahre Stalins der Anfang jener kollektiven Führung, an der die Nachfolger des Despoten bis zum Ende der Sowjetunion im Jahre 1991 festhielten.6*
Stalin und seine Magnaten lebten in einer Symbiose, in einem hermetisch abgeriegelten Raum, zu dem Fremde keinen Zutritt bekamen, aus dem sich die Mitglieder dieses Inneren Kreises der Macht aber auch selbst nicht hinausbegaben. So errichteten sie sich eine Welt mit Bedeutungen, die ihnen zur Wirklichkeit wurden und der sie nicht mehr entkamen. Was uns als paranoid oder absurd erscheinen mag, war im Horizont Stalins und seines Hofes normal. Alle Höflinge mussten sich dem Arbeitsrhythmus des Diktators unterwerfen, der erst am frühen Morgen zu Bett ging und mittags aufstand. Erst wenn Stalins Sekretär Poskrebyschew das Signal gegeben hatte, dass Stalin nun nicht mehr anrufen werde und sich schlafen gelegt habe, durften auch die Mitglieder der Führung und die Minister ins Bett gehen. Alle Mitglieder des Hofes lebten auf Abruf, sie ruinierten ihre Gesundheit, sie übten sich im Überlebenstraining, und sie konnten unter diesen Umständen von der Welt, in der die anderen lebten, nur wenig noch in Erfahrung bringen. Darin mag nicht zuletzt die groteske Realitätsverweigerung begründet liegen, die das späte Stalin-System auszeichnete. Sebag Montefiore zitiert aus den Erinnerungen von Milovan Djilas, der während einer Kinoaufführung beobachtete, dass Stalin das Geschehen auf der Leinwand – es handelte sich um einen amerikanischen Western – wie ein Kind kommentierte, das den Unterschied zwischen Fiktion und Realität nicht zu erkennen vermag.7*
Sebag Montefiore zeigt uns Stalin und seine Höflinge auch als Gewalttäter. Stalin trug militärische Kleidung, er besaß einen Revolver und wurde von Leibwächtern bewacht, die den Macho-Kult der Gewalt pflegten. Lasar Kaganowitsch und Sergo Ordschonikidse schlugen ihre Untergebenen, die Chefs des NKWD, Nikolai Jeschow, Lawrenti Beria und ihre Helfer Frinowski, Berman, Kobulow, Zereteli und Abakumow folterten ihre Opfer selbst, brachen ihnen die Knochen oder töteten sie mit Genickschüssen. Unvorstellbar, daß Reinhard Heydrich, Heinrich Himmler oder Adolf Eichmann in die Gestapokeller hinabgestiegen wären, um zu foltern und zu töten. Stalin aber umgab sich nur mit solchen Männern, denen die Hand nicht zitterte und die, wenn es darauf ankam, kaltblütig zu morden verstanden. Als Beria nach dem Sturz Jeschows dessen Gefolgsleute zu töten begann, legte Stalin seine schützende Hand über den Henker Blochin, der in der Lubianka für die Ermordung der Todeskandidaten verantwortlich war. Er war es auch, der 1940 mit seinen Gehilfen an mehreren Abenden tausende polnischer Offiziere erschoss, die dann im Wald von Katyn verscharrt wurden. Stalin schätzte diese Arbeit, und so kam es, dass Blochin sein Handwerk auch unter Beria fortsetzen konnte. Nach der Hinrichtung Sinojews und Kamenews im Jahre 1936 trafen sich Stalin und seine Freunde zu einem Gelage, in dessen Verlauf der Chef der Stalinschen Leibwache, der ungarische Friseur Karl Pauker, davon erzählte, wie Sinojew auf Knien um sein Leben gefleht habe. Stalins Höflinge waren amüsiert. Stalin selbst konnte nicht aufhören zu lachen, so sehr gefiel ihm die Parodie, und er musste Pauker bitten, aufzuhören, um nicht an einem Lachanfall zu ersticken. Stalin liebte die Gewalt, und wer die persönlichen Papiere der Satrapen in den Archiven gesehen und in ihrer Sprache gelesen hat, versteht, wie am Hof Stalins gesprochen werden musste. Der Stalinismus war Repräsentation gewordene Gewalt.
Nicht einmal im Krieg mochte Stalin davon absehen, Krisen durch den Einsatz brutaler Gewalt zu beheben. Während des finnisch-sowjetischen Winterkrieges 1939/40 entsandte er den Chef der politischen Verwaltung der Roten Armee und militärischen Laien, Lew Mechlis, an die Front. Er wusste den Offizieren keinen militärischen Rat zu geben. Er ließ sie statt dessen erschießen, wo sich ihm keine Erfolge zeigten. So verfuhr Stalin auch nach dem Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion. Die Dokumente aus dem Archiv des Verteidigungsministeriums, aus denen Sebag Montefiore zitiert, belegen, dass Stalin auch jetzt der Gewalt den Vorzug gegenüber anderen Lösungen gab. Generäle und Offiziere wurden erschossen, Familienmitglieder von gefangenen Sowjetsoldaten als Geiseln genommen und bis zum Ende des Jahres 1942 mehr als 150 000 Soldaten als vermeintliche Deserteure und Feiglinge erschossen. Es gibt keinen Zweifel: Stalin und seine Freunde konnten sich keine anderen Lösungen vorstellten, sie misstrauten ihrer Umwelt und setzten Gewalt ein, um Loyalität und Gehorsam zu erzwingen.
Stalin war kein Russe, er war ein Georgier, der vom Rand des Imperiums kam. Man konnte es sehen und man konnte es hören, wenn er sprach. Auch darüber hat Sebag Montefiore mehr zu sagen als die professionellen Historiker, die diese Seite Stalins entweder für unwichtig gehalten oder ignoriert haben.8* Stalin war stolz auf seine Herkunft, er trank georgischen Wein und aß georgische Speisen, sang Lieder aus seiner Heimat. An seiner Tafel mussten die Kaukasier Ordschonikidse und Mikojan die Funktion des Tamada übernehmen, der Trinksprüche auszubringen hatte. Stalin und Mikojan tanzten zu den Klängen georgischer Volksmusik, und wenn Stalin, umgeben von georgischen Leibwächtern, nach Abchasien in den Urlaub fuhr, lud er Freunde aus seiner Heimat in sein Landhaus ein, damit sie mit ihm die Ferien verbrachten: Lakoba, Tscharkwiani und Mgeladse, die Parteichefs von Georgien und Abchasien, und andere, die auf georgische Weise zu feiern und zu singen verstanden und die dem Diktator jeden Wunsch von den Lippen ablasen.
Stalin teilte die konservativen Auffassungen des georgischen Milieus, in dem er aufgewachsen war. Frauen sollten keine »Ideen« haben, scheu sein und ihre Körper bedecken und sich den Männern unterordnen. Stalin achtete darauf, dass keiner der Günstlinge am Hof gegen die patriarchalischen Familientraditionen verstieß. Die Frau seines Sohnes Jakow fütterte Stalin mit der Gabel, wie es die Patriarchen in georgischen Dörfern tun, wenn sie der Schwiegertochter ihre Zuneigung demonstrieren, er gab den Kindern der Magnaten Wein aus Fingerhüten zu trinken und kritisierte Gefolgsleute, die ihren Eltern nicht den gebührenden Respekt entgegenbrachten. Das System der Freundschaft, der Ehre, der Männerbünde und der Blutrache – all das kam aus Stalins Heimat. Sebag Montefiore sagt, dass am Ende der 1930er Jahre, mit der Ankunft Berias, der Hof Stalins eine kaukasische Färbung angenommen habe.
Wenngleich darüber im Buch nichts gesagt wird, so lässt die Erzählung doch erkennen, dass zwischen den Ressentiments, die Stalin pflegte – gegen Ukrainer, Polen, Juden und Muslime – und seinen Erfahrungen im Kaukasus ein Zusammenhang bestand. Denn an der Peripherie waren soziale Konflikte stets auch interethnische Auseinandersetzungen. Während des finnisch-sowjetischen Krieges fand Stalin einmal eine eigenwillige Erklärung für das Versagen seiner Armee: in ihr dienten zu viele Ukrainer, deshalb gebe es Niederlagen. Die Ethnisierung der Sowjetunion – sie verkörperte sich in Stalin, der nicht verschwieg, dass er vom Rand des Vielvölkerreiches kam.
Jeder, der über Stalin schreibt, spricht von der Ideologie, Sebag Montefiore nicht. Zwar stößt der Leser an zwei Stellen des Buches auf die Behauptung, Stalin sei ein fanatischer Marxist gewesen, aber dann taucht dieser Bezug überhaupt nicht mehr auf. Nirgendwo, wo Sebag Montefiore von der Gewalt und den Beziehungen zwischen den Höflingen spricht, ist überhaupt vom Marxismus die Rede. Die Gefolgsleute unterhielten sich nicht über den Kommunismus und die richtige Auslegung der heiligen Texte. Sie lösten Probleme, und in den meisten Fällen taten sie es mit Gewalt. Aber niemand brauchte, um dies zu tun, einen Verweis auf die heiligen Schriften. Hier liegt das Unerhörte und der Kern des Buches verborgen: Wer Stalin und den Stalinismus verstehen will, muss sich über die Kultur und das Milieu der Täter Klarheit verschaffen. Darin, dass es uns dieses Milieu nahe bringt, hat Sebag Montefiore der Stalinismus-Forschung einen unschätzbaren Dienst erwiesen.
Jörg Baberowski, Berlin 2006
PrologDAS FESTESSEN VOM 8. NOVEMBER 1932
Am Abend des 8. November 1932 machte sich die gerade erst einunddreißigjährige Nadja Allilujewa Stalin hübsch für das rauschende Fest zum fünfzehnten Jahrestag der Revolution. Die asketische, ernste, aber zart besaitete Gattin des ZK-Generalsekretärs betonte sonst ihre »bolschewistische Schlichtheit«, kleidete sich gewöhnlich ausgesprochen unauffällig, mit einfarbigen Schals zu hochgeschlossenen Blusen, das rundliche Gesicht mit den braunen Augen meist völlig ungeschminkt. Doch für das bevorstehende Bankett wollte sie sich besonders herausputzen. In der etwas düsteren Wohnung im Poteschnipalast, einem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Lustschloss des Zaren für Theateraufführungen, drehte sie sich im langen, hocheleganten, schwarzen Kleid mit aufgestickten roten Rosen, einem Import aus Berlin, vor ihrer Schwester Anna. Zur Feier des Tages hatte Nadja sich eine »modische Frisur« statt des üblichen strengen Knotens gegönnt und spielerisch eine tiefrote Teerose in die schwarze Haarpracht gesteckt.
Das Fest, zu dem alle bolschewistischen Magnaten erschienen – darunter Premier Molotow und seine schlanke, kluge, kokette Frau Polina, Nadjas enge Freundin –, richtete alljährlich Verteidigungskommissar Woroschilow aus, der im langen, schmalen Lokal der Reitergarde9* nur einen Katzensprung vom Lustschloss entfernt wohnte. Im intimen kleinen Kreis der bolschewistischen Elite endeten die schlichten, aber ausgelassenen Feiern gewöhnlich damit, dass die Potentaten mit ihren Frauen Kosakentänze aufs Parkett legten und georgische Klagelieder anstimmten. Doch dieser Abend sollte einen ganz anderen Ausgang nehmen.
Derweil saß wenige hundert Meter ostwärts, zum Roten Platz mit dem Leninmausoleum hin, Josef Stalin – ihr mit dreiundfünfzig gut zwanzig Jahre älterer Mann, der Vater ihrer beiden Kinder, seines Zeichens Generalsekretär des Zentralkomitees der Bolschewistischen Partei und Woschd (Führer/Feldherr) der Sowjetunion – in seinem Amtszimmer oben im großen Dreieck des Gelben Palasts10* aus dem 18. Jahrhundert seinem Lieblingsgeheimpolizisten gegenüber: Genrich Jagoda, dem stellvertretenden Vorsitzenden der GPU.11* Der in Nischni Nowgorod geborene Sohn eines Juweliers, mit Frettchengesicht, »Hitlerbärtchen« und einer Vorliebe für Orchideen, Pornographie und literarische Freundschaften, unterrichtete Stalin dort über aktuell in der Partei gegen ihn geschmiedete Komplotte und weitere Unruhen auf dem Lande.
Im Beisein des zweiundvierzigjährigen Molotow und seines drei Jahre älteren Chefökonomen Walerian Kuibishew, der mit wild zerzaustem Haar, einer Leidenschaft für Alkohol, Frauen und, wie es sich gehört, die Poesie an einen wahnsinnigen Dichter erinnerte, ordnete Stalin die Festnahme seiner Widersacher an. Die Last jener Monate wirkte erdrückend, da er sogar befürchten musste, die in einen Strudel von Hungersnot und Chaos geratene Ukraine zu verlieren. Nach Jagodas Abgang um 19.05 Uhr sprachen die Zurückgebliebenen noch über ihre Kampagne gegen die Bauernschaft mit dem Ziel, ihr »das Genick zu brechen«, mochte die größte hausgemachte Hungersnot in der Geschichte des Landes auch Millionen dahinraffen. Im festen Entschluss, mit Hilfe von Getreideexporten ihren gewaltigen Plan zu finanzieren, Russland in eine moderne Industriemacht zu verwandeln, spielte sich die Tragödie an jenem Abend zunächst direkt vor ihren Augen ab: Stalin geriet in die tiefste und schmerzlichste persönliche Krise seiner gesamten Laufbahn, die ihn bis ans Ende seiner Tage immer wieder einholen sollte.
Um 20.05 Uhr schlenderte Stalin in Begleitung der anderen über die verschneiten Gassen und Plätze der mittelalterlichen Festung mit ihren roten Mauern zu der Feier, allerdings ganz und gar nicht festlich gekleidet, mit ausgebeulten Hosen, Wildlederstiefeln, einem abgetragenen Armeemantel und der Wolfspelzmütze mit Ohrenklappen. Sein linker Arm war etwas kürzer als der rechte, was zu dieser Zeit aber noch kaum auffiel – und für gewöhnlich rauchte er Zigaretten oder paffte eine Pfeife. Der Charakterkopf mit dem dichten schwarzen, schon leicht angegrauten Haar strahlte würdevolle Stärke aus; seine fast orientalisch wirkenden »honigbraunen« Augen konnten bei Wutanfällen gelblich blitzen. Kinder fanden seinen Bart kratzig und den Tabakgeruch ätzend, doch Molotow und viele Verehrerinnen bescheinigten ihm noch Anziehungskraft auf Frauen, mit denen er zaghaft und unbeholfen flirtete.1
Der stämmige, nur einszweiundsechzig große Mann, der tapsig, aber flott in seinem derben Watschelgang (den Bolschoi-Schauspieler bei der Zarendarstellung vorsichtig karikierten) neben Molotow herlief und in seinem schweren georgischen Akzent leise mit ihm plauderte, hatte sonst nur den Leibwächter an seiner Seite. Die Magnaten bewegten sich fast ohne Personenschutz durch Moskau. Sogar der argwöhnische Stalin, den man auf dem Lande bereits hasste, ging mit nur einem Bewacher von seinem Büro am Alten Platz nach Hause. Eines Abends liefen Molotow und Stalin »unbegleitet« durch einen Schneesturm über den Manegenplatz heimwärts, als ein Bettler auf sie zukam. Stalin gab ihm zehn Rubel, worauf der enttäuschte Mann schrie: »Ihr verdammten Bourgeois!«
»Wer soll unser Volk verstehen?«, sinnierte Stalin. Trotz der Attentate auf sowjetische Größen (darunter 1918 ein missglücktes auf Lenin) war die Lage bis zur Ermordung des Botschafters in Polen im Juni 1928, als man die Sicherheitsmaßnahmen etwas verschärfte, bemerkenswert ruhig geblieben. Zwar hatte das Politbüro 1930 beschlossen, »dem Genossen Stalin Spaziergänge durch die Stadt zu untersagen«, er jedoch hat gleichwohl noch ein paar Jahre lang an diesem Usus festgehalten. Allerdings sollte dieses goldene Zeitalter wenige Stunden später in Blut, wenn nicht gar Mord versinken.2
Stalin genoss zwar bereits einen gewissen Ruhm als unergründliche Sphinx – ein behäbiger Phlegmatiker, dokumentiert durch seine Art, die Pfeife ostentativ wie ein Dorfältester zu schmauchen, weit davon entfernt, das von Trotzki verachtete bürokratische Mittelmaß zu verkörpern –, doch der wahre Stalin war ein energischer, zielstrebiger Melodramatiker und als solcher in jeder Hinsicht außergewöhnlich.
Unter der Oberfläche dieses unheimlich stillen Wassers wüteten mörderische Strudel des Ehrgeizes, des Zorns und des Unglücks. Ob er eine Politik der kleinen Schritte trieb oder ungestüm voranpreschte: Stalin schien immer von einem Panzer aus kaltem Stahl umgeben, hatte jedoch feinste Antennen, und sein feuriges georgisches Gemüt war derart aufbrausend, dass es ihm fast die Karriere ruiniert hätte, als er seinen Groll an Lenins Frau ausließ. Er war ein launischer Neurotiker mit dem eruptiv brodelnden Naturell eines überspannten Schauspielers, der sich am eigenen Drama ergötzt – was sein späterer Nachfolger Nikita Chruschtschew als einen Lizedei bezeichnete, einen Heuchler oder Simulant. Lasar Kaganowitsch, in mehr als dreißig Jahren einer seiner engsten Genossen (der sich übrigens ebenfalls auf dem Weg zu dem Festmahl befand), hinterließ die beste Beschreibung dieses »einzigartigen Charakters«: Er war »immer wieder ein anderer … Ich kannte nicht weniger als fünf oder sechs Stalins«.
Doch die Öffnung der Archive und die somit neuerdings zugänglichen Quellen bringen viel mehr über Stalin ans Licht als je zuvor, sodass es nicht mehr angemessen erscheint, ihn als »rätselhaft« zu bezeichnen. Heute wissen wir, wie er sprach (ständig über sich selbst, oft mit enthüllender Aufrichtigkeit), wie er Aktenvermerke und Briefe schrieb, was er aß, sang und las. Im Spiegel der facettenreichen Bolschewikenführung, einem beispiellosen Umfeld, tritt er als leibhaftige Person zutage. Als Mensch war er ein hochintelligenter, begabter Politiker, für den vor allem die weltgeschichtliche Rolle zählte, ein Wissenshungriger, der historische und literarische Werke verschlang, aber auch ein extremer Hypochonder, der an chronischer Mandelentzündung, Schuppenflechte und – dank des deformierten Arms und der Eiseskälte des sibirischen Exils – rheumatischen Schmerzen laborierte. Redselig, umgänglich und ein guter Sänger, ruinierte dieser einsame, zerrissene Mann im Lauf der Zeit jede Liebesbeziehung und Freundschaft, indem er das Glück der politischen Notwendigkeit und seiner gefräßigen Paranoia opferte. Obwohl durch eine raue Kindheit ungewöhnlich gemütskalt, bemühte er sich, ein liebevoller Vater und Ehemann zu sein, um am Ende doch jede emotionale Bindung zu ruinieren – als einer, der von Rosen und Mimosen schwärmte, im Tod die Lösung aller menschlichen Probleme sah und auf Hinrichtungen schwor. Der Atheist hatte alles Priestern zu verdanken und sah die Welt im Sinne von Sünde und Reue, war jedoch »von Jugend an ein begeisterter Marxist«. Sein Fanatismus und sein messianischer Egoismus fanden keine Grenzen. Er bekannte sich zwar zum Modell eines großrussischen Reiches, blieb aber im Grunde seines Herzens Georgier.
Die meisten Staatenlenker neigen zu einer cäsarischen Selbstüberhöhung, um ihre historische Rolle wie auf einer fiktiven Weltbühne zu bewundern, doch Stalins Objektivierung ging ein ganzes Stück weiter. Sein Adoptivsohn Artjom Sergeew erinnerte sich daran, dass er seinem Sohn Wasili lautstark vorwarf, den großen Namen auszunutzen. »Aber ich bin doch auch ein Stalin«, verteidigte sich Wasili.
»Nein, bist du nicht«, erwiderte der Vater. »Du bist ebensowenig Stalin wie ich. Stalin ist die Sowjetmacht. Stalin ist sein Abbild in den Zeitungen und auf Porträts – nicht du, nicht einmal ich!«
Er war ein Eigengeschöpf. Wer seinen Namen, seinen Geburtstag, seine Nationalität, seine Erziehung, ja seine ganze Vergangenheit erfindet, um Geschichte zu machen, die Führung zu übernehmen, müsste eigentlich im Irrenhaus enden, sofern er nicht mit Willensstärke, Glück und Geschick die Gunst der Stunde nutzt, den natürlichen Gang der Dinge umzukehren. Stalin war ein solcher Mann. Die erforderliche Dynamik kam aus der bolschewistischen Partei, und die große historische Chance lag im Niedergang der russischen Monarchie. Nach Stalins Tod kam es in Mode, ihn als einen bloßen Fehltritt zu betrachten, aber das war genauso eine grobe Geschichtsklitterung, wie er selbst sie betrieb. Stalins Erfolg war kein Zufall: Niemand unter seinen Zeitgenossen war besser ausgestattet für die niederträchtigen Intrigen, theoretischen Finten, mörderischen Dogmen und unmenschlichen Härten von Lenins Partei. Man findet schwerlich eine engere Synthese aus einem Mann und einer Partei als die ideale Ehe zwischen Stalin und dem Bolschewismus, dessen Stärken und Schwächen er in seiner Person widerspiegelte.3
Nadja weidete sich an ihrer Gala. Noch am Vortag der Revolutionsparade hatten sie starke Kopfschmerzen gequält, aber heute fühlte sie sich beschwingt. Wie der wirkliche Stalin nicht in seinem historischen Erscheinungsbild aufging, so auch Nadeschda Allilujewa. »Sie war sehr schön, doch auf Fotos erkennt man das nicht«, erinnerte sich Artjom Sergeew, »und nicht im landläufigen Sinne hübsch.« Wenn sie lächelte, strahlten ihre Augen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit aus, sie konnte aber auch grimmig und arrogant dreinschauen und litt häufig unter psychischen und körperlichen Beschwerden. Ihre kühle Distanz durchbrachen immer wieder hysterische und depressive Anfälle. Sie war chronisch eifersüchtig. Im Unterschied zu Stalins Galgenhumor entdeckte bei Nadja niemand eine Spur von Witz. Als Bolschewikin konnte sie durchaus bei ihm petzen, um Feinde zu denunzieren. War das also die Ehe zwischen einem Ungeheuer und einem Lamm, eine Allegorie auf Stalins Umgang mit Russland als solchem? Nur insofern, als es in jeder Hinsicht eine bolschewistische Ehe war, typisch für die besondere Kultur, aus der sie erwuchs. Doch in einem anderen Sinne war es bloß die übliche Tragödie: Ein abgestumpfter Workaholic könnte keinen schlechteren Partner für eine egozentrische, unausgeglichene Frau abgeben.
Stalins Alltag stellte sich wie eine vollkommene Synthese aus bolschewistischer Politik und Familienleben dar. Trotz des brutalen Kriegs gegen die Bauern und des immer größeren, auf der Führung lastenden Drucks schien diese Zeit eine glückliche Idylle, mit Wochenenden in ruhigen Landhäusern, ausgelassenen Festen im Kreml und Badeurlaub am Schwarzen Meer, die Stalins Kinder als die glücklichsten ihres Lebens in Erinnerung behielten. Stalins Briefe zeugen von einer schwierigen, aber liebevollen Ehe:
»Hallo Tatka … ich vermisse Dich schrecklich, Tatotschka, bin so einsam wie eine gehörnte Eule«, schrieb Stalin am 21. Juni 1930 an Nadja. »Ich muss nicht dienstlich weg, sondern nur meine Arbeit erledigen, und fahre dann morgen zu den Kindern hinaus. … Also bis bald, bleib nicht zu lange fort, sondern komm lieber etwas früher zurück! Sei geküsst! Dein Josef.«4 Nadja kurte in Karlsbad, um ihre Kopfschmerzen zu bändigen. Stalin vermisste sie und kümmerte sich um die Kinder. Bei anderer Gelegenheit schloss sie einen Brief wie folgt:
»Bitte pass auf Dich auf! Ich küsse Dich ebenso leidenschaftlich wie Du mich zum Abschied! Deine Nadja.«5
Da beide impulsiv und dünnhäutig waren, konnte es keine einfache Beziehung sein. Ihre Konflikte endeten oft in Dramen. 1926 ging Nadja mit den Kindern nach Leningrad, wollte ihn verlassen, doch Stalin flehte sie an zurückzukehren, und sie gehorchte. Man möchte meinen, dass solche Krisen häufig vorkamen, doch sie bildeten nur Unterbrechungen einer bestimmten Art von Glück. Stalin war oft aggressiv und beleidigend, noch schwerer zu ertragen wahrscheinlich jedoch in seiner Unnahbarkeit, Nadja stolz und streng, neigte allerdings zu Krankheiten. Während Genossen wie Molotow und Kaganowitsch sie am Rande des »Wahnsinns« sahen, räumte die eigene Familie nur ein, dass sie »manchmal verrückt und überempfindlich war, denn in allen Allilujews floss ein feuriges Zigeunerblut«.6 Es war ein unmögliches Paar, beide gleichermaßen selbstsüchtig, unterkühlt, jedoch mit hitzigem Gemüt, auch wenn Nadja nichts von Stalins Grausamkeit und Falschheit an sich hatte. Vielleicht waren sie einander zu ähnlich, um glücklich werden zu können. Alle Zeitzeugen stimmen darin überein, dass ein Leben mit Stalin »nicht einfach war – vielmehr sehr hart«. Es war »keine perfekte Ehe«, berichtete Polina Molotowa der Tochter Swetlana, »aber welche Ehe ist schon perfekt?«.
Ab 1929 waren sie oft getrennt, da Stalin im Herbst Ferien im Süden machte, während Nadja noch studierte, doch das änderte nichts an ihrem Glück, und sie erlebten die Zeit als innig und liebevoll: Ihre Briefe beförderten Kuriere der Geheimpolizei hin und her. Beide genossen das Zusammensein und vermissten einander bei längeren Trennungen schmerzlich. »Es ist so langweilig ohne Dich«, klagte sie. »Komm doch her, und wir machen es uns schön.«7
Beide hingen an Wasili und Swetlana. »Schreibe mir etwas über die Kinder«, bat Stalin vom Schwarzen Meer aus. Als sie unterwegs war, berichtete er: »Den Kleinen geht es so weit gut. Allerdings gefällt mir die Betreuerin nicht. Sie läuft den ganzen Tag durchs Haus und lässt Wasja und Tolika [den Adoptivsohn Artjom] von früh bis spät herumtollen. Ich bin sicher, dass Waska nicht weiterkommt, und ich möchte doch, dass er Deutsch lernt.« Nadja legte oft kindliche Grüße Swetlanas bei.8 Auch tauschten sie sich über gesundheitliche Belange aus wie jedes Paar.9
Stalin wechselte ungern die Kleidung und trug noch im Winter Sommeranzüge, sodass Nadja sich immer Sorgen um ihn machte. »Ich schicke Dir einen Mantel, denn nach dem Aufenthalt im Süden könntest Du Dich leicht erkälten.«10 Er dachte ebenfalls an sie: »Ich schicke Dir ein paar Limonen«, schrieb er stolz. »Lass sie Dir schmecken!« Der begeisterte Gärtner sollte bis ans Ende seiner Tage Freude an der Limonenzucht haben.11
Sie tauschten sich auch über Freunde und Genossen aus. »Wie ich hörte, ist Gorki nach Sotschi gekommen«, schrieb sie. »Vielleicht wird er Dich besuchen. Schade, dass ich nicht dabei sein kann! Ich höre ihn so gern reden …«12 Und selbstverständlich war Nadja als gute Bolschewikin fast ebenso politikbesessen wie Stalin und gab stets weiter, was Molotow oder Woroschilow ihr anvertrauten.13 Sie schickte ihrem Mann Bücher, und er dankte ihr, murrte jedoch, wenn ein bestelltes fehlte. Manchmal hänselte sie ihn wegen seiner schwarzen Darstellung in der »weißen« Exilliteratur.
Die streng gewissenhafte Nadja scheute sich auch nicht, selbst Anweisungen zu geben. Im Urlaub schimpfte sie über den finsteren chef de cabinet ihres Mannes, Poskrebyschew, und beklagte sich darüber, dass »wir keine ausländische Literatur mehr erhalten haben, obwohl doch neue Titel erschienen sein sollen. Vielleicht bittest Du Jagoda [den stellvertretenden GPU-Chef]. … Das letzte Mal haben wir so uninteressante Bücher bekommen …«14 Aus dem Urlaub zurückgekehrt, schickte sie Stalin die Fotos: »Nur die besten – sieht Molotow nicht ulkig aus?« (Viel später zog Stalin den nachgerade absurd drögen Molotow vor Churchill und Roosevelt damit auf.) Postwendend revanchierte er sich mit seinen Urlaubsfotos.15
Doch ab Ende der zwanziger Jahre wurde Nadja notorisch unzufrieden, da sie ernsthaft eine eigene bolschewistische Karriere anstrebte. Anfang des Jahrzehnts hatte sie erst für Stalin, dann für Lenin und später für Sergo Ordschonikidse – auch so ein kraftstrotzendes, leidenschaftliches, damals für die Schwerindustrie zuständiges Arbeitstier – die Tipparbeiten erledigt. Anschließend war sie ins Internationale Landwirtschaftsinstitut der Abteilung für Agitation und Propaganda übergewechselt, wo Stalins Frau, in den Archiven versunken, ihr trostloses Tagewerk verrichtete: Der Chef bittet seine reguläre Assistentin, die mit »N. Allilujewa« unterschreibt, einen gähnend langweiligen Artikel zum Thema »Wir müssen die Jugendbewegung auf dem Land erforschen« für die Publikation vorzubereiten.
»Ich kann mit niemandem in Moskau etwas anfangen«, klagte sie. »Seltsamerweise fühle ich mich Nichtgenossen näher – selbstverständlich Frauen. Die sind einfach entspannter … Heute grassieren furchtbar viele neue Vorurteile. Wer nicht arbeitet, ist nichts als eine Baba!«12* Das stimmte. Die neuen Bolschewikinnen, darunter Polina Molotowa, spielten in der Politik eine eigenständige Rolle, verachteten als Feministinnen solche Heimchen und Tippsen wie Nadja. Doch Stalin selbst wollte keine solche Frau an seiner Seite haben: Seine Nadja sollte eine richtige Baba sein.16 1929 beschloss Nadja, Parteikarriere zu machen, und fuhr nicht mit in Urlaub, sondern blieb in Moskau, um die Aufnahmeprüfung für die Industrieakademie abzulegen mit dem Ziel, Faserchemie zu studieren: Nebenbei schrieb sie Liebesbriefe an Stalin. Bildung gehörte zu den großen Anliegen des Bolschewismus und zog Millionen in ihren Bann. Stalin wollte zwar in der Tat eine Baba, unterstützte aber Nadjas Vorhaben: Ironischerweise könnte er damit einen guten Riecher bewiesen haben, denn bald zeichnete sich ab, dass es über ihre Kräfte ging, gleichzeitig zu studieren und ihren Pflichten als Mutter und Ehefrau zu genügen. Oft schloss er mit:
»Was machen die Prüfungen? Küsse meinen Tatka!« Molotows Frau Polina brachte es bis zur Volkskommissarin – und Nadja hoffte gewiss, dass auch sie reüssieren würde.17
Nahe dem Lustschloss trafen die Magnaten und ihre Frauen bei den Woroschilows ein, noch nichts von der Tragödie ahnend, die sich bald ereignen sollte. Keiner von ihnen hatte es weit. Seit Lenins Verlegung der Hauptstadt nach Moskau 1918 lebte die politische Elite in dieser abgeschotteten Geheimwelt hinter vier Meter dicken Mauern, burgundischen Brustwehren mit Zinnen und hoch aufragenden Festungstürmen, Erinnerungen an das alte Moskau. »Hier pflegte Iwan der Schreckliche zu wandeln«, erklärte Stalin Besuchern. Täglich ging er an der Erzengel-Kathedrale mit dessen Gebeinen und am Zarenturm vorüber, und den Gelben Palast, in dem sein Büro lag, hatte Katharina die Große erbauen lassen. Jetzt, 1932, lebte Stalin schon vierzehn Jahre im Kreml, so lange wie einst im Elternhaus.18
Die Potentaten und ihre Leute – im bolschewistischen Jargon die »verantwortlichen Arbeiter« respektive »Zuarbeiter« – wohnten in hohen, weitläufigen Räumen, meist im Lustschloss oder in der Reitergarde, ehedem für zaristische Regenten und Haushofmeister bestimmt, und saßen in den Höfen mit ihren Spitztürmen und Gewölben eng aufeinander. Stalin kam fortwährend irgendwo auf einen Plausch vorbei, ebenso die anderen bei ihm.
Für die meisten Gäste lag die Wohnung Kliment Woroschilows und seiner Frau Ekaterina im zweiten Stock der Reitergarde (eigentlich der »Roten Garde«, aber niemand nannte das Gebäude so) einfach »am Ende des Korridors«. Von außen erreichte man sie über einen Torweg, an dem auch das kleine Kino lag, in das sich Stalin und seine Freunde oft nach dem Essen zurückzogen. Sie war sehr geräumig, dabei aber gemütlich, mit dunklen Holzpaneelen, und bot einen schönen Blick über die Kremlmauer hinweg auf die Stadt. Der zweiundfünfzigjährige Gastgeber Woroschilow – ein leutseliger, schwadronierender Kavallerist, gelernter Dreher, mit einem eleganten, fast an d’Artagnan erinnernden Schnurrbart, blondem Haar und engelsgleich rosigem Teint – galt als populärster Held im Pantheon der Bolschewiken.
Inzwischen war Stalin mit dem ausschweifenden Kuibyschew und dem pingeligen Molotow eingetroffen und dessen Gattin, die dunkle, eindrucksvolle, immer gut gekleidete Polina, von nebenan hinzugestoßen. Nadja kam zusammen mit ihrer Schwester Anna durch das Gässchen vom Lustschloss hinübergelaufen.
Zwar herrschte 1932 kein Mangel an Speisen und Getränken, aber es waren noch jene Zeiten, bevor Stalins Essen zu üppigen Banketten ausarteten. Das Menü – bestehend aus russischen hors d’œuvres, Suppe, verschiedenen gepökelten Fischgerichten und vielleicht etwas Lamm – wurde in der Kreml-Küche zubereitet, in die Wohnung hinaufgebracht und dort von einer Kellnerin serviert. Dazu gab es Wodka und georgischen Wein, selbstverständlich verbunden mit einer Parade von Trinksprüchen. Angesichts der beispiellosen Katastrophe auf dem Land, wo zehn Millionen Menschen verhungerten, einer parteiinternen Verschwörung und damit der Ungewissheit über die Loyalität der Entourage – zusätzlich belastet durch eine besorgte Frau – fühlte sich Stalin im Kriegszustand und wie belagert. Inmitten dieser Turbulenzen musste er wie die anderen trinken, um alle Unbilden zu vergessen. Stalin saß in der Mitte des Tisches, nie an der Stirnseite, Nadja ihm direkt gegenüber.
Im Alltag bildete die Kremlwohnung das Lebenszentrum der Stalins. Die beiden hatten zwei gemeinsame Kinder, den elfjährigen schmächtigen, halsstarrigen, zappeligen Wasili und die siebenjährige rothaarige, sommersprossige Swetlana. Stalins Sohn aus erster Ehe, der bereits fünfundzwanzigjährige Jakow, war 1921 zum Vater gezogen, nachdem er seine Kindheit in Georgien verbracht hatte: ein scheuer, dunkler Junge mit hübschen Augen. Stalin hielt ihn für aufreizend träge. Jakow hatte sich mit achtzehn in eine Priesterstochter namens Soja verliebt und sie gegen den Willen Stalins, nach dem er studieren sollte, geheiratet. In einem »Hilferuf« wollte Jascha sich »erschießen«, streifte aber nur die Brust. Stalin hielt das für »Erpressung«. Die strenge Nadja missbilligte Jaschas Laschheit: »Jascha widerte sie regelrecht an«, befand Stalin. Doch er selbst mochte ihn noch weniger.
»Haha, danebengeschossen!«, spöttelte er grausam. »Das war sein militaristischer Humor«, erklärte Swetlana. Später ließ Jascha sich von Soja scheiden und kehrte nach Hause zurück.19
Stalin stellte an seine Söhne hohe, angesichts des eigenen steilen Aufstiegs sogar unerfüllbare Erwartungen, bewunderte allerdings seine Tochter. Neben den genannten gab es noch Artjom Sergeew, Stalins geliebten Adoptivsohn, der oft bei ihnen wohnte, obwohl seine Mutter noch lebte.13* Stalin war nachsichtiger als Nadja, obwohl er Wasili »einige Male« schlug. Ja, diese gewöhnlich als fast engelsgleich dargestellte Frau war auf ihre Weise noch unerbittlicher als er. Die eigenen Angehörigen hielten sie für »absolut derangiert«, wie sich ihr Neffe Wladimir Redens erinnerte. »Sogar das Personal klagte darüber, dass Nadja sich nicht im entferntesten für die Kinder interessiere.« Auch Tochter Swetlana räumte bei aller Liebe ein, das Studium sei ihr jedenfalls wichtiger gewesen. Nadja sei sehr streng mit den Kindern umgegangen und habe nie ein »lobendes Wort« für sie gefunden. Daher überrascht es wenig, dass sie mit Stalin zankte, weil er angeblich die Kinder verwöhnte.
Doch kann man Nadja dafür kaum Vorwürfe machen. Ihre von Stalin archivierten Krankenakten zeigen, und Aussagen von Bekannten bestätigen, dass sie schwere psychische Probleme hatte, vielleicht unter einer erblichen manisch-depressiven oder Borderlinestörung litt – auch wenn ihre Tochter von »Schizophrenie« sprach –, und außerdem, bedingt durch eine Schädelanomalie, unter Migräneanfällen. 1922 und 1923 verordneten Ärzte ihr Liegekuren, da sie sich ständig »müde und matt« fühlte. Eine Fehlgeburt 1926 zog, Swetlana zufolge, »Unterleibsprobleme« mit monatelang ausbleibender Periode nach sich. 1927, als sie unter Erschöpfung, Angina und Arthritis litt, wurde auch noch ein Herzklappenfehler diagnostiziert. 1930 trat die Angina kurz nach einer Mandeloperation erneut auf. Eine abermalige Kur in Karlsbad befreite Nadja nicht von ihren quälenden Kopfschmerzen.
An ärztlicher Pflege fehlte es nicht. Nadja ließ sich von den besten Medizinern Russlands und Deutschlands behandeln – allerdings keinen Psychiatern.
Nadja war mit einem maßlosen Egomanen verheiratet, der weder ihr noch irgendwem sonst Glück schenken konnte, sondern sie mit seiner unbarmherzigen Energie auszusaugen schien. Allerdings passte sie offenkundig nicht zu Stalin, bot dem Zerrissenen keinen Trost, sondern setzte ihm nur noch mehr zu. Er gestand, dass Nadjas psychische Krisen ihm Rätsel aufgaben und er einfach nicht die emotionalen Mittel besaß, ihr zu helfen. Manchmal spitzte sich ihre »Schizophrenie« derart zu, dass sie von Sinnen war. Die Magnaten und die Allilujews selbst ergriffen Stalins Partei. Doch bei allen Turbulenzen liebten sie einander, trotz oder wegen der seltsam ähnlichen Ausbrüche von Leidenschaft und Eifersucht, auf ihre Weise.
Und schließlich hatte sich Nadja ja für Stalin schön gemacht. Das »schwarze Kleid mit dem aufgestickten Rosenmuster« war ein Geschenk ihres Bruders Pawel Allilujew, des schlanken, braunäugigen jungen Mannes, der soeben, wie üblich mit einem ganzen Füllhorn, aus Berlin eingetroffen war, wo er im Auftrag der Roten Armee arbeitete. Die Rose hob sich auffällig von Nadjas pechschwarzem Haar ab. Stalin sollte staunen, denn ihrem Neffen zufolge »ermunterte er sie nie, sich elegant zu kleiden«.20
Zum Essen wurde schwer gezecht, wofür ein georgischer Mundschenk – Tamada – sorgte, vielleicht Grigori Ordschonikidse, den alle Sergo nannten und der mit seiner Löwenmähne an »einen extravaganten Fürsten« erinnerte. Irgendwann im Lauf des Abends müssen Stalin und Nadja, von den Feiernden unbemerkt, aneinander geraten sein wie so oft. Nadjas Ärger wuchs bedrohlich, als Stalin bei all dem Zuprosten, Tanzen und Flirten kaum zur Kenntnis nahm, wie gut sie aussah, obwohl sie zu den jüngsten Frauen des Kreises gehörte. Das war gewiss unaufmerksam, wiewohl für eine alte Ehe nicht atypisch.
Schließlich lebten sie inmitten von bolschewistischen Haudegen, die jetzt – wenn auch durch die Jahre im Untergrund und den Bürgerkrieg verhärtet, blutbefleckt und etwas ramponiert – über die industriellen Triumphe und Agrarinitiativen der stalinistischen Revolution jubelten. Einige hatten wie Stalin schon die fünfzig überschritten, die meisten jedoch waren stramme, tatkräftige Fanatiker um die vierzig, darunter hochbegabte Organisatoren mit der Fähigkeit, gegen widrige Umstände Fabriken und ganze Städte aufzubauen, aber auch Boykotteure aus dem Weg zu räumen und Krieg gegen die Bauern zu führen. In ihren Kasacken und Stiefeln steckten echte Kraftprotze, schwere Trinker, ausgekochte, weithin bekannte Männer mit einem Hang zum Größenwahn, enormen Kompetenzen und der Mauser im Halfter: Der ungestüme, lärmende, gut aussehende gelernte Schuster Lasar Kaganowitsch, Stalins Stellvertreter, hatte kürzlich noch im Nordkaukasus Massenhinrichtungen und Deportationen beaufsichtigt. Ihn flankierten der prahlerische Kosakenführer Budjonni mit üppigem Schnauzbart und »blendend weißen Zähnen« sowie der schlanke scharfsinnige, adrette Armenier Mikojan, allesamt erprobt in brutalen Feldzügen, um Getreide aufzuspüren und die Bauern zu unterjochen. Das waren Stalins großspurige, hitzige und schillernde politische Bannerträger.
Sie bildeten eine große Familie, ein Netz alter Freundschaften und anhaltender Feindschaften, geknüpft durch gemeinsame Romanzen, das sibirische Exil und Waffengänge im Bürgerkrieg: Der Präsident Michail Kalinin verkehrte seit 1900 bei den Allilujews. Nadja kannte die Frau Woroschilows noch aus Zarizyn (dem späteren Stalingrad) und hatte gemeinsam mit Maria Kaganowitsch und Dora Chasan (der Gattin des ebenfalls anwesenden Magnaten Andrejew), ihren besten Freundinnen neben Polina Molotowa, an der Industrieakademie studiert. Zu den Gästen gehörte schließlich der schmächtige, unausgesetzt zwinkernde Intellektuelle Nikolai Bucharin, ein Maler, Dichter und Philosoph mit rötlichem Vollbart, den Lenin als »Liebling der Partei« bezeichnete, Stalin und Nadja lange Zeit als ihren engsten Freund betrachteten. Er war ein Charmeur – der »Kobold« der Bolschewiken. Stalin hatte ihn 1929 entmachtet, doch Nadja blieb er verbunden. Stalin selbst hegte eine Hassliebe zu »Buchartschik«, jene für ihn charakteristische tödliche Mischung aus Bewunderung und Neid. An jenem Abend hatte man Bucharin, zumindest vorübergehend, wieder in den Zauberkreis aufgenommen.
Verstimmt über Stalins Unachtsamkeit fing Nadja an, mit »Onkel Abel« zu tanzen: Jenukidse, ihrem wollüstigen rotblonden georgischen Patenonkel, dem Kremlleiter, der seine Genossen bereits durch Affären mit blutjungen Ballerinen schockierte. »Onkel Abels« Schicksal sollte, als die Partei das Privatleben vereinnahmte, die Gefahren des Hedonismus veranschaulichen. Vielleicht legte es Nadja darauf an, Stalin zu reizen. Natalja Rykowa, die an jenem Abend mit ihrem Vater, dem ehemaligen Premier, im Kreml war, aber nicht an der Feier teilnahm, hörte anderntags, dass Nadja durch ihr Tanzen Stalin zur Raserei brachte. Der Bericht ist zweifellos glaubhaft, weil auch andere Quellen einen Flirt Nadjas erwähnen. Doch möglicherweise war Stalin zu diesem Zeitpunkt schon so betrunken, dass er gar nichts mehr davon mitbekam.
Im Übrigen flirtete Stalin selbst heftig. Direkt vor Nadjas Augen schäkerte er schamlos mit der »schönen« Frau Alexander Jegorows, eines Kommandeurs der Roten Armee, mit dem er 1920 im Polenkrieg gedient hatte. Die vierunddreißigjährige Galja, geborene Sekrowskaja, war eine forsche Filmschauspielerin, eine »hübsche, interessante und charmante« Brünette, bekannt für ihre Affären und gewagten Dekolletés. Unter den strengen bolschewistischen Matronen muss sie sich gefühlt haben wie ein Pfau auf dem Bauernhof, denn wie sie in ihrem späteren Verhör aussagte, verkehrte sie sonst in der »glanzvollen Gesellschaft mit eleganter Kleidung … Flirts, Tanz und viel Spaß«. Stalins Stil changierte zwischen traditionellem georgischen Minnedienst und, im betrunkenen Zustand, knabenhafter Anmache. Bei diesem Anlass setzte sich letztere durch, denn er bewarf die Schauspielerin mit Brotkügelchen. Seine Neckereien mit Jegorowa machten Nadja manisch eifersüchtig: Sie konnte das nicht ausstehen.
Stalin war kein Schürzenjäger, sondern mit dem Bolschewismus vermählt und emotional tief in sein großes Drama der revolutionären Sache verstrickt. Persönliche Regungen galten nur als Bagatellen, verglichen mit der Rettung der Menschheit durch den Marxismus-Leninismus. Doch auch wenn sie auf seiner Prioritätenliste weit unten standen und er emotional geschädigt war, ließen Frauen ihn nicht kalt – und er sie offenbar ebenfalls nicht. Molotow zufolge waren manche regelrecht in ihn »verknallt«. Jemand aus seinem Umkreis erzählte später, Stalin habe geklagt, die Allilujewas »ließen ihn nicht in Ruhe« und »wollten alle mit ihm ins Bett gehen«. Das lässt sich nicht von der Hand weisen.
Ob Genossinnen, Bekannte oder Untergebene: Frauen umschwirrten ihn wie Motten das Licht. Seine jüngst geöffneten Archive bringen an den Tag, dass Stalin mit Liebesbriefen regelrecht überschüttet wurde. »Lieber Genosse Stalin … Du bist mir im Traum erschienen … und nun hoffe ich auf eine Audienz«, schrieb eine Provinzlehrerin und fügte aufdringlich hinzu: »Ich lege ein Foto von mir bei …« Stalin antwortete leicht kokett, wenngleich ablehnend:
»Unbekannte Genossin! Bitte glauben Sie mir, dass ich Sie nicht enttäuschen möchte und Ihren Brief ernst nehme, aber leider habe ich keine Termine frei (Zeitnot!), um Sie zu empfangen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. J. Stalin. PS: Ihr Brief nebst Bild anliegend zurück.« Manchmal jedoch muss er Poskrebyschew mitgeteilt haben, dass er eine Bewunderin gerne treffen würde. Das gilt insbesondere im Fall der Ekaterina Mikulina, einer offenbar attraktiven, ehrgeizigen Dreiundzwanzigjährigen, die Stalin ihr Elaborat über »Sozialistischen Wettbewerb zwischen Werktätigen« schickte mit der Bitte, den Text auf Fehler zu prüfen. Daraufhin lud er sie für den 10. Mai 1929 ein. Sie gefiel ihm, und es hieß, sie habe in Abwesenheit Nadjas die Nacht in der Datscha verbracht.14* Allerdings zog sie aus der kurzen Liaison keinen anderen Vorteil als die Ehre, dass er ihr ein Vorwort für ihre Arbeit schrieb.
Gewiss traute Nadja, die es ja wissen musste, ihm Affären zu, und mit gutem Grund. Stalins Leibwächter Wlasik flüsterte seiner Tochter zu, dass der Chef bei dem vielfältigen Angebot nicht immer widerstehen konnte: »Schließlich war er ein Mann«, der die georgische Tradition feudalherrlicher Sinnesfreuden in sich trug. Nadja reagierte mal rasend eifersüchtig, mal ganz gelassen. In ihren Briefen spielte sie liebevoll neckisch auf seine Verehrerinnen an, gleichsam stolz darauf, mit so einer guten Partie verheiratet zu sein. Jedoch hatte sie einmal im Theater einen Koller bekommen, als er mit einer Ballerina flirtete, und ihm so den Abend verdorben; und neuerdings gab es im Kreml eine Friseuse, mit der Stalin offenbar eine Art Techtelmechtel unterhielt. Hätte er den Salon lediglich zum Haareschneiden besucht wie andere Funktionäre, so wäre das bestimmt niemandem aufgefallen – doch Molotow konnte sich noch fünfzig Jahre später an die Dame erinnern.
Auch parteiintern hatte Stalin jede Menge Eroberungen zu verzeichnen. Die Affären waren so kurz wie seine Zeiten im Exil, die meisten der Mätressen entweder selbst Revolutionäre oder mit solchen liiert. Molotow beeindruckten Stalins »Erfolge«, und als dieser ihm direkt vor der Revolution eine gewisse Marusja wegschnappte, hielt er seine »schönen tiefbraunen Augen« für den Grund. Doch ein Sieg über diesen Langweiler macht Stalin noch nicht zum Casanova. Kaganowitsch bestätigte, dass er sich mit mehreren Genossinnen einließ, darunter die etwas ältere »pummelige, hübsche« Ludmilla Stal, vielleicht einstmals auch Nadjas Freundin Dora Chasan. Dabei könnte Stalin von der revolutionären sexuellen Libertinage profitiert und trotz seiner Schüchternheit gewisse Erfolge bei Sekretärinnen des Zentralkomitees gelandet haben, doch im Grunde blieb er immer ein traditioneller Kaukasier. Als solcher musste er Abenteuer mit diskreten Staatsdienerinnen bevorzugen, sodass die Friseuse genau ins Bild passte.
Wie kaum anders zu erwarten, förderten Nadjas manische oder depressive Eifersuchtsanfälle genau das, was sie fürchtete, und an jenem Abend kam alles zusammen: die Wut und Enttäuschung über Stalins Missachtung, seine Politik und seine Unverschämtheit.21
Stalin benahm sich in der Tat unmöglich, aber viele Historiker haben in ihrem Vorsatz, ihn als ein Scheusal darzustellen, einfach übersehen, dass Nadja ihm kaum nachstand. Diese »hitzige Frau«, wie Stalins Sicherheitschef Pauker sie titulierte, schrie Stalin oft in aller Öffentlichkeit an, weshalb ihre Mutter sie eine »Närrin« scholt. Der Kavallerist Budjonni erinnerte sich, dass sie Stalin »ständig ankeifte und demütigte«, sodass er seiner Frau zuflüsterte: »Ich weiß nicht, wie der das aushält.« Doch inzwischen waren Nadjas Depressionen so schlimm, dass sie einer Freundin beichtete, sie habe alles satt, sogar die Kinder.
Obwohl das als absolut untrügliches Alarmsignal hätte gelten müssen, kümmerte sich niemand darum. Stalin stand nicht allein vor einem Rätsel, doch kaum jemand in diesem grob gestrickten Kreis, Freundinnen wie Polina Molotowa inklusive, begriff, dass Nadja wahrscheinlich unter klinischen Depressionen litt: »Sie konnte sich nicht beherrschen«, urteilte Molotow, »rang verzweifelt um Sympathie.« Polina Molotowa räumte ein, dass der Woschd »übel« mit Nadja umsprang. Es war ein ewiges Auf und Ab: Mal packte Nadja ihre Sachen, mal liebte sie Stalin wieder.
Bei dem Essen, so Augenzeugen, brachte ein politischer Appell Nadja in Rage: Stalin wollte auf die Vernichtung der Staatsfeinde trinken, als er bemerkte, dass sie ihr Glas nicht erhob.
»Warum trinkst du nicht?«, fuhr er sie gehässig an, wissend, dass sie und Bucharin ebenso wie andere das Aushungern der Bauernschaft verurteilten. Doch sie beachtete ihn nicht. Um sich Gehör zu verschaffen, bewarf Stalin sie mit Orangenschalen und schnipste Zigaretten hinüber, was sie erzürnte. Obwohl Nadja schon vor Wut kochte, rief er ihr zu: »He, trink!«
»Ich bin für dich keine, zu der man ›he‹ sagt!«, gab sie zurück, stand erbost auf und ging vor aller Augen hinaus. Wahrscheinlich in dieser Szene hörte Budjonni, wie Stalin sie anbrüllte: »Halt’s Maul! Halt’s Maul!«
In der anschließend einsetzenden Stille schüttelte Stalin den Kopf.
»Was für eine Närrin!«, murmelte er, in seinem Suff nicht verstehend, wie aufgebracht sie war. Budjonni muss als einer von vielen dort für Stalin Partei ergriffen haben.
»Ich würde mich von meiner Frau nicht so behandeln lassen!«, erklärte der wilde Kosake, der allerdings kaum zum Ratgeber taugte, nachdem seine erste Frau Selbstmord begangen – oder sich beim Spielen mit seiner Pistole »zufällig« erschossen hatte.22
Irgendwer musste Nadja nachgehen, und da sie die Frau des Chefs war, fiel diese Aufgabe der Gattin seines Vize zu. Also streifte sich Polina Molotowa ihren Mantel über und folgte Nadja nach draußen. Sie drehten Runden um den Kreml. Nadja beschwerte sich bitterlich:
»Er murrt die ganze Zeit … und warum muss er ständig flirten?« Sie erwähnte die »Sache mit der Friseuse« und sein Schäkern mit der Jegorowa. Die Frauen befanden, wie es sich anbot, dass Stalin zu viel getrunken hatte und er sich deshalb daneben benahm. Doch die hundertprozentige Polina kritisierte auch ihre Freundin und kreidete ihr an, »Stalin in einer so schwierigen Phase im Stich zu lassen«. Vielleicht trug Polinas Partiinost (Parteihörigkeit) dazu bei, dass Nadja sich noch einsamer fühlte.
»Am Ende beruhigte sie sich wieder«, berichtete Polina später, »sprach über das Studium und ihre Chancen, ins Berufsleben einzusteigen. … Als sie mir ganz gefasst erschien«, in den frühen Morgenstunden, sagten sie einander vor dem Lustschloss gute Nacht. Dann eilte Polina durch die kleine Gasse hinüber zur Reitergarde.
Nadja betrat die Wohnung und ließ gleich an der Tür die Teerose aus ihrem Haar fallen. Vom größten Raum, dem Speisesaal mit einem Beistelltisch für Stalins Amtstelefone, gingen zwei Flure ab. Rechter Hand lagen das Arbeits- und ein kleines Zimmer, in dem Stalin – den alten Gewohnheiten als wandernder Revolutionär verhaftet – entweder auf einem Feldbett oder auf dem Sofa schlief. Bei Stalins Nachtleben und Nadjas frühen Vorlesungen hatten sie getrennte Schlafzimmer. Die Haushälterin Carolina Til, die Kinderfrauen und das Dienstpersonal waren am Ende des rechten Flurs untergebracht. Der linke führte zu Nadjas kleinem Zimmer, dessen Bett sie mit ihren Lieblingsschals drapierte. Die Fenster lagen zu den Alexandrowski-Gärten hin, von denen im Sommer wohlige Rosendüfte aufstiegen.
Stalins Verbleib in den nächsten beiden Stunden liegt im Dunkeln: Ging er nach Hause? Bei den Woroschilows feierte man weiter, doch Chruschtschew (der nicht zu den Gästen gehörte) erfuhr von Stalins Leibwächter Wlasik, dass dieser zum Schäferstündchen mit einer gewissen Gusewa, der Frau eines Offiziers, die der Connoisseur Mikojan als »sehr schön« bezeichnete, zur etwas außerhalb gelegenen Datscha in Subalowo gefahren war. Vielleicht nahm er einige Waffenbrüder mit. Wahrscheinlich nicht Woroschilow, dessen Frau als notorisch eifersüchtig galt, doch Stalin selbst erwähnte anschließend im Gespräch mit Bucharin Molotow und Präsident Kalinin. Zweifellos hätte Wlasik sie begleitet. Als Stalin nicht heimkam, soll Nadja in der Datscha angerufen haben.
»Ist Stalin da?«
»Ja«, habe ein »unerfahrener Dummkopf« von Wachmann geantwortet.
»Wer ist bei ihm?«
»Die Frau Gusews.«
Diese Version würde Nadjas plötzliche Verzweiflung erklären, ebenso allerdings ein weiterer Migräneanfall, ein depressiver Schub oder schlicht die Grabesstille der düsteren Wohnung im Morgengrauen: Molotow, eine Kinderfrau und Stalins Enkelin schworen Stein und Bein, dass Stalin in seinem Bett lag. Gewiss hätte er Subalowo nicht als Liebesnest benutzt, weil sich die Kinder dort aufhielten, doch standen genügend andere Häuser zur Verfügung. Schwerer noch wiegt aber, dass niemand jene besagte Gusewa ausfindig machen konnte, obwohl es mehrere Offiziere dieses Namens gab. Überdies hat Mikojan weder seinen Kindern gegenüber noch in den Memoiren dergleichen erwähnt. Der prüde Molotow könnte Stalin in den späteren Interviews geschützt haben: Er log sich einiges zusammen, ebenso wie der senile Chruschtschew in seinen Erinnerungen. Wenn das Rendezvous tatsächlich einer »schönen« Offiziersfrau galt, so käme eher die Jegorowa in Frage, deren Koketterie ja mit zu der ganzen Ehekrise beigetragen hatte.
Auch wenn sich die Sache nicht mehr aufklären lässt, widersprechen diese Berichte einander keineswegs: Vielleicht fuhr Stalin noch mit einigen Nachtschwärmern, darunter die Jegorowa, in die Datscha und kehrte erst frühmorgens nach Hause zurück. Wie dem auch sei, jedenfalls waren die beteiligten Höflinge Stalin bald auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, und viele von ihnen kamen innerhalb der nächsten fünf Jahre auf grausame Weise ums Leben. Stalin vergaß nie, dass sie an jener Novembernacht mitgewirkt hatten.
Nadjas Blick fiel auf eines der Geschenke, die ihr treusorgender Bruder Pawel ihr einst, ebenso wie das schwarze bestickte Kleid, das sie immer noch trug, aus Berlin mitgebracht hatte. Um dieses hatte sie Pawel ausdrücklich gebeten, denn – wie sie ihm erklärte – »manchmal, wenn nur ein Soldat Dienst hat, fühle ich mich im Kreml so fürchterlich einsam«. Es war eine verzierte Damenpistole im eleganten Lederhalfter: keine Walther, wie immer behauptet wird, sondern eine kleine Mauser. Das gleiche Modell hatte Pawel übrigens auch Polina Molotowa mitgebracht, obwohl es in jenen Kreisen kein Problem war, an Waffen heranzukommen.
Als Stalin nach Hause kam, ging er direkt in sein Zimmer am anderen Ende der Wohnung und ins Bett, ohne noch einmal nach seiner Frau zu sehen.
Manche sagen, Nadja habe sich eingeriegelt. Sie setzte sich hin und schrieb an Stalin, »einen furchtbaren Brief«, wie ihre Tochter Swetlana meinte.15* Irgendwann zwischen zwei und drei, als sie damit fertig war, legte sie sich aufs Bett.