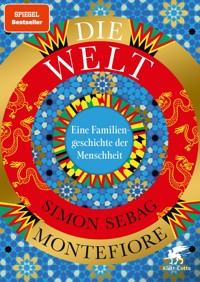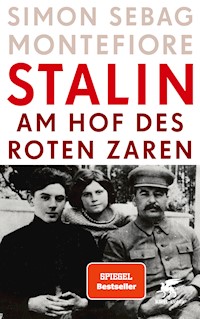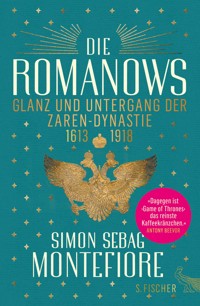12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Drei Jahrtausende Weltgeschichte in Briefen - auf wenigen Seiten extrem spannend und packend dargeboten.« Ysenda Maxtone Graham, The Times In seiner spannenden, unterhaltsamen und informativen Sammlung von Briefen führt uns Simon Sebag Montefiore durch Jahrtausende der Menschheitsgeschichte. Er lässt die großen Persönlichkeiten in Kultur und Politik, aber auch die ›einfachen Menschen‹ in ihren glanzvollen und dunklen Stunden gegenwärtig werden: eine einzigartige, kurzweilig zu lesende Weltgeschichte in Briefen von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart. Geschichte und Leben: Hier verbinden sie sich zu der intimsten aller literarischen Ausdrucksformen, zum Brief als Selbstzeugnis historischer Figuren, die die Geschichte der Menschheit beeinflussten. In den elegant und klug vom Autor eingeleiteten Briefen von geschichtlichen Akteuren und auch unbekannten Zeitgenossen spiegeln sich die Ereignisse der großen Geschichte und des privaten Lebens. Der Bogen dieser Anthologie ist weit gespannt: Sie gewährt Einblicke in faszinierende Lebensgeschichten, ob nun mit den Augen eines Genies (Michelangelo), eines Ungeheuers (Stalin) oder Durchschnittsmenschen – es sind Briefe aus den unterschiedlichsten Kulturen und Traditionen vieler Länder und Epochen. Ihre Themen kreisen um Kämpfe um Rechte (Mandela) und Befehle zu unsagbaren Verbrechen (Mao). Doch auch die großen Liebesbriefe (Katharina die Große, Anais Nin) und Abschiedsbriefe (Hadrian, Churchill, Lucrezia Borgia) sowie die Machtbekundungen von Kaiserinnen, Schauspielerinnen, Komponisten und Dichtern fehlen nicht. Ein hinreißendes Lesebuch, das uns bereichert, indem es uns tiefe zeitlose Einblicke in das Menschlich-Allzumenschliche gewährt, vor allem auch eine Ermutigung an uns alle, inspiriert von der Lektüre dieser Briefe, selber einmal wieder zur Feder zu greifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Simon Sebag Montefiore
Geschichte schreiben
Briefe, die die Welt veränderten
aus dem Englischen von Maria Zettner
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Written in History. Letters
that Changed the World« im Verlag Weidenfeld & Nicolson, London
© 2018 by Simon Sebag Montefiore
Für die deutsche Ausgabe
© 2021, 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung der Daten des Originalentwurfs der Orion Publishing Group, © Studio Helen/The Orion Publishing Group
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98759-1
E-Book ISBN 978-3-608-12114-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einleitung
Liebe
Heinrich VIII. an Anne Boleyn, Mai 1528
Frida Kahlo an Diego Rivera, 19. August 1939
Thomas Jefferson an Maria Cosway, 12. Oktober 1786
Katharina die Große an Fürst Potemkin, etwa 19. März 1774
James I. an George Villiers, Duke of Buckingham, 17. Mai 1620
Vita Sackville-West an Virginia Woolf, 21. Januar 1926
Suleiman der Prächtige und Hürrem Sultan, etwa 1530er Jahre
Suleiman an Hürrem
Hürrem an Suleiman
Anaïs Nin an Henry Miller, etwa August 1932
Zarin Alexandra an Grigori Rasputin, 1909
Horatio Nelson an Emma Hamilton, 29. Januar 1800
Napoleon Bonaparte an Joséphine, 24. April 1796
Alexander II. an Katja Dolgorukaja, Januar 1868
Josef Stalin an Pelageya Onufrieva, 29. Februar 1912
Familie
Elisabeth I. an Mary I., 16. März 1554
Wilma Grünwald an Kurt Grünwald, 11. Juli 1944
Kadaschman-Enlil an Amenophis III., um 1370 v. Chr.
Oliver Cromwell an Valentine Walton, 4. Juli 1644
Toussaint Louverture an Napoleon Bonaparte, 12. Juli 1802
Alexander I. an seine Schwester Katharina, 20. September 1805
Charles I. an Charles II., 29. November 1648
Swetlana Stalina an ihren Vater, Mitte der 1930er Jahre
Augustus an Gaius Caesar, 23. September 2 v. Chr.
Joseph II. an seinen Bruder Leopold II., 4. Oktober 1777
Ramses der Große an Hattuschili, König der Hethiter, 1243 v. Chr.
Schöpfungsakt
Michelangelo an Giovanni da Pistoia, 1509
Wolfgang Amadeus Mozart an seine Cousine Marianne, 13. November 1777
Honoré de Balzac an Ewelina Hańska, 19. Juni 1836
John Keats an Fanny Brawne, 13. Oktober 1819
T. S. Eliot an George Orwell, 13. Juli 1944
Mut
Sarah Bernhardt an Mrs. Patrick Campbell, 1915
Fanny Burney an ihre Schwester Esther, 22. März 1812
David Hughes an seine Eltern, 21. August 1940
Entdeckung
Ada Lovelace an Andrew Crosse, etwa 16. November 1844
Wilbur Wright an die Smithsonian Institution, 30. Mai 1899
John Stevens Henslow an Charles Darwin, 24. August 1831
Ferdinand und Isabella, König und Königin von Kastilien und Aragon, an Christoph Kolumbus, 30. März 1493
Christoph Kolumbus an Ferdinand und Isabella, 29. April 1493
Tourismus
Anton Tschechow an Anatolij Koni, 16. Januar 1891
Gustave Flaubert an Louis Bouilhet, 15. Januar 1850
Krieg
Peter der Große an Katharina I., 27. Juni 1709
Napoleon Bonaparte an Joséphine, 3. Dezember 1805
Dwight D. Eisenhower an die alliierten Truppen, 5. Juni 1944
Katharina, Herzogin von Oldenburg, an ihren Bruder Alexander I., 3. September 1812
Philipp II. an den Herzog von Medina-Sidonia, 1. Juli 1588
Harun ar-Raschid an Nikephoros, 802 n. Chr.
Grigori Rasputin an Nikolaus II., 17. Juli 1914
Blut
Pianch an Nodjmet, um 1070 v. Chr.
Wladimir Lenin an die Bolschewiki von Pensa, 11. August 1918
Josef Stalin an Kliment Woroschilow, 3. Juli 1937
Mao Tse-tung an die Roten Garden der Mittelschule der Tsinghua-Universität, 1. August 1966
Josip Broz Tito an Josef Stalin, 1948
Zerstörung
Theobald von Bethmann Hollweg an Heinrich von Tschirschky, 6. Juli 1914
Harry S. Truman an Irv Kupcinet, 5. August 1963
Katastrophe
Plinius der Jüngere an Tacitus, um 106/107 n. Chr.
Voltaire an M. Tronchin, 24. November 1755
Freundschaft
Captain A. D. Chater an seine Mutter, Weihnachten 1914
Marcus Antonius an Octavian (den späteren Kaiser Augustus), um 33 v. Chr.
Karl Marx und Friedrich Engels, Juli 1862 bis November 1864
Franklin D. Roosevelt an Winston Churchill, 11. September 1939
Adolf Hitler an Benito Mussolini, 21. Juni 1941
Fürst Potemkin und Katharina die Große, um 1774
Torheit
Georg von Hülsen-Haeseler an Emil von Görtz, 1892
Der Marquis de Sade »an die infamen Schurken, die mich quälen«, 1783
Zarin Alexandra und Zar Nikolaus II., 1916
Alexandra an Nikolaus, 14. Dezember 1916
Nikolaus an Alexandra, 16. Juni 1916
Anstand
Maria Theresia an Marie-Antoinette, 30. Juli 1775
Mahatma Gandhi an Adolf Hitler, 24. Dezember 1940
Abraham Lincoln an Ulysses S. Grant, 13. Juli 1863
John Profumo an Harold Macmillan, 5. Juni 1963
Jacqueline Kennedy an Nikita Chruschtschow, 1. Dezember 1963
Babur an seinen Sohn Humayun, 11. Januar 1529
Émile Zola an Félix Faure, 13. Januar 1898
Lorenzo der Prächtige an Giovanni de’ Medici, 23. März 1492
Befreiung
Emmeline Pankhurst an die Women’s Social and Political Union, 10. Januar 1913
Nelson Mandela an Winnie Mandela, 2. April 1969
Abraham Hannibal an Peter den Großen, 5. März 1722
Simón Bolívar, Manuela Sáenz und James Thorne, 1822 bis 1823
Simón Bolívar an Manuela Sáenz, 3. Juli 1822
Manuela Sáenz an James Thorne, 1823
Schicksal
Oscar Wilde an Robert Ross, 28. Februar 1895
Alexander Hamilton und Aaron Burr, Juni 1804
Burr an Hamilton
Hamilton an Burr
Burr an Hamilton
Hamilton an Burr
W. P. van Ness an Pendleton, 26. Juni 1804
Anonymus an William Parker, Lord Monteagle, Oktober 1605
Babur an Humayun, 25. Dezember 1526
Nikita Chruschtschow an John F. Kennedy, 24. und 26. Oktober 1962
Alexander Puschkin an Jacob van Heeckeren, 25. Januar 1837
Macht
Josef Stalin an Waleri Meschlauk, April 1930
Winston Churchill an Franklin D. Roosevelt, 20. Mai 1940
Richard I. und Saladin, Oktober bis November 1191
Richard an Saladin
Saladin an Richard
Arthur James Balfour an Baron Walter Rothschild, 2. November 1917
George Bush an Bill Clinton, 20. Januar 1993
Niccolò Machiavelli an Francesco Vettori, 3. August 1514
Heinrich VII. an seine »lieben Freunde«, Juli 1485
John Adams an Thomas Jefferson, 20. Februar 1801
Herzog von Marlborough an Königin Anne via Sarah, Herzogin von Marlborough, 13. August 1704
Donald Trump an Kim Jong-un, 24. Mai 2018
Untergang
Abd ar-Rahman III. an seine Söhne, 961 n. Chr.
Simon Bar Kochba an Yeshua ben Galgoula, um 135 n. Chr.
Ammurapi an den König von Alašija, um 1190 v. Chr.
Aurangzeb an seinen Sohn Muhammad Azam Shah, 1707
Simón Bolívar an José Flores, 9. November 1830
Abschied
Leonard Cohen an Marianne Ihlen, Juli 2016
»Henriette« an Giacomo Casanova, Herbst 1749
Winston Churchill an seine Frau Clementine, 17. Juli 1915
Nikolai Bucharin an Josef Stalin, 10. Dezember 1937
Franz Kafka an Max Brod, Herbst/Winter 1921
Walter Raleigh an seine Frau Bess, 8. Dezember 1603
Alan Turing an Norman Routledge, Februar 1952
Che Guevara an Fidel Castro, 1. April 1965
Robert Ross an More Adey, 14. Dezember 1900
Lucrezia Borgia an Leo X., 22. Juni 1519
Hadrian an Antoninus Pius – und seine eigene Seele, 10. Juli 138 n. Chr.
Dank
Nachweise
Für Lily Bathseba
Einleitung
Liebe Leserin, lieber Leser,
es geht doch nichts über die Unmittelbarkeit und Originalität eines Briefes. Wir Menschen haben nun mal den Drang, Empfindungen und Erinnerungen, die mit der Zeit verloren gehen könnten, zu dokumentieren und mit anderen zu teilen. Wir suchen verzweifelt nach Bestätigung für Beziehungen, für zärtliche oder auch feindliche Bande, denn die Welt steht niemals still und unser Leben ist eine Aneinanderreihung von Anfängen und Schlusspunkten – sie zu Papier zu bringen, mag uns das Gefühl geben, wir könnten ihnen größere Realität verleihen, sozusagen Ewigkeitscharakter. Briefe sind das literarische Gegenmittel gegen die Vergänglichkeit des Lebens und natürlich auch gegen die Oberflächlichkeit und Schnelllebigkeit des Internets. Goethe, der viel über den Zauber von Briefen nachgedacht hat, hielt sie für »das wichtigste Denkmal, das ein Mensch hinterlassen kann«. Derartige Empfindungen sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, denn noch lange nach dem Tod der Protagonisten leben ihre Briefe weiter. Und auf dem Gebiet von Politik, Diplomatie und Krieg müssen Befehle oder Beteuerungen auf jeden Fall schriftlich festgehalten werden. Endlos viele unterschiedliche Ziele lassen sich mit dem Medium Brief erreichen, und auf diesen Seiten bieten wir ihnen allen eine Bühne.
Es gibt bereits zahlreiche Sammlungen von ausgefallenen und amüsanten Briefen, doch diese hier wurden nicht in erster Linie aufgrund ihres Unterhaltungswertes ausgewählt, sondern weil sie auf die eine oder andere Weise die Geschichte der Menschheit beeinflusst haben, sei es in den Bereichen Krieg und Frieden oder in Kunst und Kultur. Sie gewähren uns Einblicke in faszinierende Lebensgeschichten, ob durch die Augen eines Genies, eines Monsters oder eines Durchschnittsmenschen. Hier finden Sie Briefe aus vielen Kulturen, Traditionen, Ländern und Ethnien, vom Ägypten und Rom der Antike bis zum modernen Amerika, Afrika, Indien, China und Russland, wohin mich ein Großteil meiner Forschungsarbeit geführt hat – daher die vielen Russen, die in diesem Buch vertreten sind, angefangen bei Puschkin bis hin zu Stalin. Es ist die Rede von Kämpfen um Rechte, die wir heute für selbstverständlich halten, von Befehlen zu Verbrechen, die uns unfassbar erscheinen. Auch Liebesbriefe sind dabei sowie fesselnde Bekenntnisse von Kaiserinnen, Schauspielerinnen, Tyrannen, Malern, Komponisten und Dichtern.
Ich habe Briefe ausgewählt, die vor dreitausend Jahren von Pharaonen verfasst und in vergessenen Bibliotheken in untergegangenen Städten konserviert wurden – ebenso wie Exemplare aus dem gegenwärtigen Jahrhundert. Unbestreitbar gab es auch für den Brief ein goldenes Zeitalter: die fünfhundert Jahre vom Mittelalter bis zur breiten Nutzung des Telefons in den 1930er Jahren. Ein gravierender Niedergang setzte dann in den 1990er Jahren mit der Einführung des Mobiltelefons und des Internets ein. Ich konnte die Entwicklung zum Teil selbst nachverfolgen, als ich in den Stalin-Archiven recherchierte. In den 1920er und 1930er Jahren schrieb Stalin lange Briefe an seine Gefolgsleute und auch an Außenstehende, vor allem wenn er im Süden Ferien machte, doch als eine sichere Telefonleitung eingerichtet wurde, hörten die Briefe unvermittelt auf.
Es ist nur folgerichtig, dass mit dem Aufkommen der Schrift der Brief schnell zu einem ausgiebig genutzten Instrument von Herrschern und Eliten wurde, schließlich ließ sich mit seiner Hilfe wunderbar organisieren und lenken – und noch so viel mehr. Während der vergangenen drei Jahrtausende vereinte der Brief in sich all das, was uns heute Zeitungen, Telefon, Radio, Fernsehen, E-Mail, SMS, Sexting und Blogging bieten. Diese Anthologie enthält auch ursprünglich in Keilschrift verfasste Briefe, die in der Bronze- und in der Eisenzeit im Vorderen Orient verwendet wurde. Dabei wurden mit einem Schilfrohr Zeichen in eine feuchte Tontafel geritzt, die dann in der Sonne trocknete. Seit dem dritten Jahrtausend vor Christus schrieb man auf Papyrus, hergestellt aus dem Mark der Papyruspflanze. Dem folgten Briefe auf Pergament – der zäheren, getrockneten Tierhaut –, bis um 200 v. Chr. in China das Papier erfunden wurde und nach und nach über Zentralasien nach Europa gelangte. Dort machte seine preisgünstigere und leichtere Herstellung es ab dem 15. Jahrhundert zunehmend praktischer, verfügbarer und erschwinglicher. Das Briefeschreiben erreichte seinen Höhepunkt zwischen dem 15. und dem frühen 20. Jahrhundert, und das war nicht nur der Verfügbarkeit von Papier geschuldet, sondern auch den Erleichterungen bei der Beförderung und Zustellung durch Kuriere sowie der Entwicklung des Postwesens.
Es ging aber auch über den rein praktischen Aspekt hinaus – war Teil einer neuen Ordnung eines verbindlichen Rechts- und Vertragssystems, einer verantwortungsvollen Staatsführung, eines rechenschaftspflichtigen Finanzwesens und der öffentlichen Moral. Vor allem aber offenbarte es eine neue Geisteshaltung mit frischen Ideen und modernen Visionen von der zuträglichsten Lebensweise, eine Wertschätzung der Privatsphäre sowie einen wachsenden Sinn für eine länderübergreifende Gesellschaft und das eigene Gewissen.
Manche Briefe waren zum Zwecke der Publicity gedacht, andere trugen sozusagen das Siegel der Verschwiegenheit. Die Vielfalt ihrer Verwendung ist eine der Freuden einer Sammlung wie dieser. In der überwiegenden Zahl von Briefen ging es um banale, weitgehend uninteressante Alltagsangelegenheiten – das Bestellen von Waren, das Begleichen von Rechnungen, die Verabredung von Treffen. Auf dem Höhepunkt des Briefeschreibens als Kunstform und als Werkzeug saßen gebildete Menschen viele Stunden am Tag an ihren Schreibtischen, mitunter bei unzureichenden Lichtverhältnissen, und schrieben wie besessen. Katharina die Große bezeichnete sich selbstironisch als »Graphomanin« (sie nannte sich auch eine »Plantomanin« wegen ihrer Liebe zum Gärtnern), und ein Reich, ein Krieg, ein Staat ließ sich tatsächlich nur mithilfe von fieberhaftem Briefeschreiben führen. Es war auch eine Möglichkeit für die Verfasser, sich über ihr Zimmer, ihr Haus, Dorf, Land hinaus in andere Welten und ferne Träume hineinzuversetzen. Es war nicht weniger eine körperlich anstrengende Pflichtübung als ein Zeitvertreib. E-Mails und SMS machen weitaus weniger Mühe, doch sind sie ja vielleicht auch zu einfach, so informell, dass wir die Macht der einzelnen Worte gar nicht mehr zu schätzen wissen, auch wenn natürlich die Kürze, die Schnelligkeit und der Reiz dem Texten Suchtpotenzial verleihen und es in der modernen Welt unverzichtbar machen. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein hatten nur wenige Menschen, Staatsoberhäupter eingeschlossen, Büros, die ihnen bei ihrer umfangreichen Korrespondenz behilflich waren. Die meisten von ihnen beantworteten und versiegelten (zum Teil aus Sicherheitsgründen) ihre Briefe selbst – darunter auch Briefeschreiber aus diesem Buch wie Lincoln, Katharina oder Nikolaus II., der tatsächlich seine Briefe selbst frankierte.
Natürlich bleiben die Verfasser in ihren Briefen nicht immer nur bei der Wahrheit, und mit der Entscheidung, welche sie zerstören und welche sie aufheben, greifen sie mitunter massiv in die Rezeptionsgeschichte ein. Aber so oder so spiegelt ein Brief einen einzelnen historischen Augenblick wider – was Goethe den »unmittelbaren Lebenshauch« nannte. In vielen Gärten wurden schon Feuer entzündet, um die brieflichen Beweise für geheime Absprachen oder verbotene Liebesaffären zu vernichten. Solche literarischen Feuersbrünste vollzogen sich häufig in viktorianischen und edwardianischen Familien nach dem Tod von Granden – auch in meiner eigenen. Doch einen Brief zu vernichten, selbst aus Gründen der Diskretion, bedeutet Goethe zufolge, das Leben selbst zu vernichten.
Die Geschichtsschreibung ist – wie der Journalismus unserer Tage – voll von Klatsch, Rätselraten, Mythen, Lügen, Missverständnissen und Verleumdungen. Wenn wir eine Boulevardzeitung oder eine Klatschspalte lesen, ist uns bewusst, dass möglicherweise die Hälfte davon nicht stimmt. Das Schöne an privater Korrespondenz ist, dass es der wahre Jakob ist. Wir sind nicht auf Klatschgeschichten angewiesen, wir können die authentischen Worte hören. Genau so sprach Stalin zu seinen Schergen, redete Hürrem liebevoll mit Suleiman dem Prächtigen oder Frida Kahlo mit Diego Rivera. Und dann sind da ja auch noch Mozarts sündhaft obszöne Briefe an seine Kusine Marianne.
Die Briefe lassen sich nach verschiedenen Kategorien unterteilen. Als Erstes haben wir die offenen Briefe: Mao Tse-tung setzt die Kulturrevolution mit einem Brief an Studenten in Gang, in dem er sie auffordert, sich gegen ihre Vorgesetzten zu erheben; Balfour verspricht ein jüdisches Heimatland; Émile Zolas Brief »J’accuse!« konfrontiert Frankreich mit seinem Rassismus und Antisemitismus. Leider hat ein solcher Protest im 21. Jahrhundert wieder eine traurige Aktualität erlangt – und ist auch absolut notwendig in dieser neuen vergifteten Zeit des Antisemitismus auf beiden Seiten des Atlantiks, nicht nur von rechts, sondern zunehmend, besonders in Großbritannien, auch von der etablierten sozialistischen Linken, eine üble Tendenz, die uns geradewegs zu Stalins antisemitischen Säuberungsaktionen zurückführt. Aber es geht noch weiter zurück: Der Marxismus ist wieder in Mode. Ich habe ein paar köstliche Briefe der beiden Schöpfer des Marxismus, Karl Marx und Friedrich Engels, aufgenommen, deren boshafter und schamloser Rassismus und Antisemitismus diejenigen überraschen mag, die sie als selbstlose und edle Vorkämpfer für Anstand und Gleichwertigkeit betrachten. Weit gefehlt! Ihre Briefe sind gespickt mit Worten wie »Nigger« und »Jud« oder Spekulationen über das jüdische Glied ihres Kontrahenten Lassalle. Das mag den einen oder anderen Leser schockieren.
In den Jahrhunderten, bevor die Presse breiteren Zuspruch fand, waren viele Briefe darauf angelegt, abgeschrieben und an einen größeren Leserkreis verteilt zu werden. So erfreuten sich literarische Salons in ganz Europa an den Zeilen bedeutender Briefeschreiber wie Voltaire oder Katharina die Große. Ähnlich verhielt es sich mit einer anderen Form des öffentlichen Briefes, der Bekanntgabe militärischer Siege oder Niederlagen. Selbst noch am Ende von Schlachten, wenn die Felder übersät waren mit Leichen und bibbernden, völlig entkräfteten Verwundeten, setzten sich erschöpfte Generäle in zerstörte Hütten oder an Behelfsschreibtische unter freiem Himmel, um die Nacht hindurch der Welt per Brief ihren Sieg kundzutun. Nach den gewonnenen Schlachten von Poltawa, Austerlitz und Blindheim geben Peter der Große, Napoleon beziehungsweise der Herzog von Marlborough die gute Nachricht sogleich öffentlich bekannt – und brüsten sich daneben noch im Privaten vor ihren Geliebten und Ehefrauen. »Komm her und feiere mit mir!«, schreibt Peter der Große an seine Frau.
Bis vor nicht allzu langer Zeit wurden alle Verhandlungen und Befehle, vor allem wenn sie politischer oder militärischer Natur waren, Briefen anvertraut, die nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt waren. Hier ist die verächtliche Nachricht von Ramses dem Großen an den Hethiter-König Hattuschili. Ein Jahrtausend danach beschwert sich Marcus Antonius schriftlich bei Octavian (dem späteren Kaiser Augustus), dass er Cleopatra »vögele« sei nicht politisch relevant – obwohl es das ganz eindeutig doch war. Wieder ein Jahrtausend später verhandeln Saladin und Richard Löwenherz über eine Aufteilung des Heiligen Landes. Dann ein Sprung von fünfhundert Jahren: Philipp II. von Spanien befiehlt seinem Admiral Medina-Sidonia, die Armada gegen England zu führen – obwohl Letzterer ein Scheitern der Unternehmung befürchtet. Vierhundert Jahre später lässt sich Lincolns Großmut gegenüber General Grant bewundern. Und im 20. Jahrhundert gibt es keinen wichtigeren Briefwechsel als den zwischen Roosevelt und Churchill in den dramatischen Monaten des Jahres 1940. Am Vorabend seines Einmarsches in Sowjetrussland offenbart Hitler auf der Höhe seiner anmaßenden Großtuerei seine Motive in einem Brief an seinen Verbündeten Mussolini. Und ein Entwurf wurde niemals abgeschickt: Eisenhowers Botschaft an seine Truppen, falls der D-Day scheitern sollte.
Dann gibt es noch eine spezielle Sorte Brief, der gleichzeitig als politisch und als persönlich gelten muss – das ist von besonderer Bedeutung in Autokratien, in denen auch das Intimleben des Herrschers politisch ist. Wie wir noch heute in vielen der neuen Autokratien des 21. Jahrhunderts beobachten können, wird, sobald ein Machthaber absolutistische Züge an den Tag legt, alles Private zum Politikum. Der Liebesbrief Heinrichs VIII. an Anne Boleyn und der von James I. an seinen attraktiven männlichen Günstling, den Duke of Buckingham, haben politische Relevanz – die amourösen Vorlieben des Herrschers wirken sich nun mal auf die Regierung eines Landes aus. Die widerwärtigen Belustigungen, die seine Höflinge für Kaiser Wilhelm II. veranstalteten und bei denen für gewöhnlich After und Würstchen eine Rolle spielten, offenbaren die grobe Inkompetenz, die den Frieden in Europa gefährdete. Katharina die Große und Fürst Potemkin, Partner in der Liebe wie in der Politik, sind leidenschaftliche Romantiker und dabei auch scharfsichtige Realpolitiker. Unter ihren Briefen beschäftigen sich einige, zehn bis fünfzehn Seiten lang, mit allen Aspekten der Macht – Diplomatie, Krieg, Finanzen, Personal. Doch sie behandeln auch häusliche Angelegenheiten wie das Sammeln von Kunst, den Hausbau, ihre Liebesaffären und nicht zuletzt ihre Gesundheit – kein Brief des 18. Jahrhunderts wäre vollständig ohne das Thema Hämorrhoiden. Ihre kurzen Liebesbriefe hingegen ähneln heutigen E-Mails oder SMS. Solche Briefe waren nie für die Augen eines anderen als des Adressaten bestimmt, doch blieben die meisten auch nach ihrem Tod erhalten. Potemkin starb auf einer wilden Steppe in Moldawien. Umklammert hielt er einen Packen mit Briefen von Katharina, umwickelt mit einem Band, und beim Lesen waren ihm die Tränen heruntergelaufen.
Derartige wirklich private Korrespondenz feiert Liebe und Sex, aber es waren Briefe, die ihre Verfasser sorgsam unter Verschluss hielten. Alexander II. und seine Geliebte (und spätere Ehefrau) Katja schrieben sich die erotischsten Briefe, die je von einem Staatsoberhaupt zu Papier gebracht wurden. Seinerzeit ist man vermutlich davon ausgegangen, dass niemand sie jemals zu Gesicht bekommen würde – und da sind wir nun und lesen die Briefe von Vita Sackville-West und Virginia Woolf, Napoleon und Josephine, Emma Hamilton und Lord Nelson. Balzacs Korrespondenz mit seiner polnischen Bewunderin, der schönen Gräfin Hańska, ist so leidenschaftlich, dass sie sich ineinander verlieben, noch ehe sie sich das erste Mal getroffen haben – allein durch die Macht des geschriebenen Wortes. Der Briefwechsel zwischen Anaïs Nin und Henry Miller glüht förmlich vor Erotik und kommt so lüstern daher, dass er schon den Beigeschmack von Pornografie hat. »Mehr als Küsse«, schrieb der Dichter John Donne, »vereinen Briefe Seelen.« Und Körper.
Selbstverständlich habe ich auch intime Briefe ausgewählt, die nicht nur von Lust, sondern auch von Schmerz erzählen, vom Ende der Liebe ebenso wie von ihrem Anfang. Einer der bemerkenswertesten, wenn auch kaum bekannten, ist Thomas Jeffersons »Unterhaltung« zwischen seinem Kopf und seinem Herzen, adressiert an seine junge Geliebte, die im Begriff ist, ihn zu verlassen. Eine brillantere Analyse der Tollheit der Liebe ist wohl selten geschrieben worden – doch sollte die Geschliffenheit nicht verwundern, schließlich handelt es sich hier um den Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.
Auch Simón Bolívar ist sich unschlüssig über seine Affäre mit der legendären Manuela Sáenz. Die verheiratete Schönheit Henriette bricht, als sie zu ihrem Mann zurückkehrt, Casanova, dem Schürzenjäger schlechthin, das Herz. Kurz vor seinem eigenen Tod verabschiedet sich Leonard Cohen von seiner sterbenden Ex-Geliebten, die ihn zu seinen größten Songs inspiriert hatte, darunter »So Long, Marianne«. Mein Favorit unter den Abschiedsbriefen ist der des siegreichen Kalifen über das islamische Spanien, Abd ar-Rahman III., der auf dem Totenbett darüber nachsinnt, dass er in fünfzig ruhmreichen Jahren nur vierzehn Tage glücklich war. Wenige Briefe sind herzzerreißender als Alan Turings qualvolles Ringen angesichts der Strafverfolgung seiner Homosexualität. Und dann ist da auch noch das schier unerträgliche Grauen eines der seltenen erhaltenen Abschiedsbriefe einer Frau an ihren Mann in einem Vernichtungslager des Holocaust.
Einige Briefe berichten von historischen Ereignissen beziehungsweise Vorgängen. So informiert Kolumbus seine Monarchen über die »Entdeckung« Amerikas. Die Luftschlacht um England wird im Brief eines Piloten an seine Eltern geschildert. Das geht einem besonders ans Herz, da der junge Mann bald darauf den Tod findet. Tschechow beobachtet das Leiden der verzweifelten Gefangenen auf Sachalin. Plinius sieht den Untergang Pompejis mit an. Voltaire sinniert über das Erdbeben in Lissabon im Jahr 1755.
Eine Unterkategorie dessen, was wir vielleicht als Tourismus bezeichnen könnten, erzählt von erotischen Abenteuern an reizvollen Orten. Das war eine beliebte Form des Briefes im 18. und 19. Jahrhundert, als sich das moderne Erlebnis des Reisens als Freizeitgestaltung von den Grand Tours wohlhabender Aristokraten auf die Eisenbahnfahrten der Mittelschicht ausweitete, was die Welt wie nie zuvor zusammenschrumpfen ließ. Tschechow und Flaubert berichten in wunderschöner Prosa vergnügt von Begegnungen mit japanischen Prostituierten und ägyptischen jungen Männern.
Dann sind da die Briefe familiärer Art, die uns zu Zeugen der engen Beziehungen großer Männer zu ihren Kindern machen. Anschauliche Beispiele dafür bieten zwei Mogul-Herrscher: Babur ermahnt seinen Sohn zur Toleranz, Aurangzeb schreibt dem seinen vom Totenbett aus, während sein Reich auseinanderbricht. In Erwartung seiner Gerichtsverhandlung unterweist Charles I. seinen Sohn in der Kunst des Königseins. Kaiserin Maria Theresia warnt ihre Tochter Marie-Antoinette, dass ihre Arroganz noch einmal ihr Untergang sein werde. Es geht auch andersherum: Swetlana Stalina spielt die kleine Diktatorin und erteilt ihrem Vater Anweisungen – darunter auch die, in der gesamten Sowjetunion für ein Jahr die Hausaufgaben zu verbieten. Auch peinliche Situationen innerhalb von Familien bleiben nicht ausgespart, was in Königskreisen durchaus epische Ausmaße annehmen kann. Die künftige Königin Elisabeth I. fleht bei ihrer Schwester, der Königin »Bloody« Mary, um ihr Leben. Joseph II. kommt als Sex-Berater für seine Schwester Marie-Antoinette nach Paris, nachdem sich Ludwig XVI. als unfähig erwiesen hat, die Ehe zu vollziehen.
Die anonyme Warnung vor dem Gunpowder Plot besiegelt bereits das Scheitern der Verschwörung – sie verändert mit einem Schlag den Lauf der Geschichte. Rasputin bemüht sich in seinem Brief an Nikolaus II., den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu verhindern, hat damit jedoch keinen Erfolg. Einige Briefe sind selbst schon Tötungsbefehle: Stalins Schreiben ermutigen seine Geheimpolizei, »Feinde« zu exekutieren, die in Wirklichkeit unschuldig sind, und Lenin ordnet wie von Sinnen Hinrichtungen wahlloser Opfer an. Vor dreitausend Jahren weist ein ägyptischer Herrscher seine Frau an, zwei untergeordnete Beamte zu töten und ihre Leichen »verschwinden« zu lassen. Einer meiner persönlichen Favoriten ist Titos lakonische Mitteilung an Stalin, in der er damit droht, einen Auftragskiller zu schicken, sollte Stalin noch einmal versuchen, ihn zu töten.
Eine spezielle Kategorie beschäftigt sich mit Selbstzerstörung. Oscar Wilde erhält den beleidigenden Brief vom Vater seines Geliebten, in dem dieser ihn einen »Somdomiten« [sic] nennt. Alexander Hamilton und Alexander Puschkin schreiben sich sozusagen in die Duelle hinein, in denen sie den Tod finden. Eine andere besondere Spezies sind die letzten Worte, so etwa in Sir Walter Raleighs Abschiedsbrief an seine Frau vor seiner Hinrichtung. In dem Bewusstsein, dass er bald sterben wird, schreibt Kaiser Hadrian an seinen Adoptivsohn und Nachfolger Antoninus Pius. Kränkelnd und erschöpft verdammt Bolívar den gesamten amerikanischen Kontinent. Kafka ordnet an, dass seine Werke zerstört werden sollen. Und er ist nicht der Einzige, der am Wert seiner Arbeit zweifelt: Ein weiteres Thema sind die Qual und die Enttäuschungen des Schöpfungsprozesses. Beispiele dafür liefern Keats’ Betrachtungen über Liebe und Tod, Michelangelos Überlastung beim Ausmalen der Sixtinischen Kapelle oder T. S. Eliots Ablehnung von George Orwells neuem Roman Farm der Tiere.
Hier können Sie auch zeitlose Briefe lesen, die von den mutigen Freiheitskämpfen jüngerer Zeit erzählen, Kämpfen für die Sklavenbefreiung, das Frauenwahlrecht sowie Bürgerrechte für Afroamerikaner. Toussaint Louverture, der Anführer der haitianischen Sklavenrevolte gegen die Franzosen, die zur ersten unabhängigen schwarzen Republik in Amerika führte, fleht nun um das Leben seiner Familie. Nelson Mandela erklärt seiner Frau Winnie, wie man selbst in einer Gefängniszelle noch hoffnungsvoll leben kann. Abraham Hannibal, ein vermutlich aus Westafrika verschleppter Sklave, der später an die Sklavenmärkte von Istanbul und von da aus an den russischen Zar weiterverkauft wurde, wird der erste schwarze General in Europa. Talentierte Frauen widersetzen sich ihren Fesseln. Ada Lovelace schreibt von ihrer Begeisterung für die Naturwissenschaften; Fanny Burney und Manuela Sáenz wehren sich gegen die Zwangsläufigkeit eintöniger, männerdominierter Ehen; Emmeline Pankhurst rechtfertigt Gewaltanwendung im Interesse des Frauenwahlrechts.
E-Mails und das Telefon mögen zwar dem goldenen Zeitalter des Briefes ein Ende gesetzt haben, aber seine Macht hat er dadurch nicht verloren – in der Diplomatie zum Beispiel. Als Donald Trump 2018 sein geplantes Gipfeltreffen mit dem jungen, mordlüsternen nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un in Singapur absagt, tut er dies mit einem typisch Trump’schen Brief. Das löst eine schwungvolle Korrespondenz aus. Der Gipfel in Singapur findet trotz allem statt. Ein paar Tage danach, am 6. Juli, schreibt der Oberste Führer Kim an Trump: »Das bemerkenswerte erste Treffen mit Eurer Exzellenz war wahrhaftig der Beginn einer bedeutungsvollen Reise.« Trump trieb die Sache noch weiter, als er bei einer Wahlveranstaltung mit seiner nordkoreanischen Brieffreundschaft prahlte: »Ich war echt hart und er auch. Wir spielten den Ball hin und her. Und dann verliebten wir uns. OK? Nein, ernsthaft – er hat mir wunderschöne Briefe geschrieben, und es sind tolle Briefe.« Wie auch immer die Zukunft der nordkoreanischen Nuklearwaffen aussehen mag, hiermit wäre zumindest die emotionale und politische Macht des Briefes erwiesen.
Da wir gerade beim Thema des neuen unverfrorenen, gehässigen Zeitalters autoritärer Großtuerei, erbarmungslosen Schwulstes und boshafter Feindseligkeit im öffentlichen Leben sind, das in Trumps Präsidentschaft seinen reinsten Ausdruck findet – ich habe dieser Sammlung den charmanten, eleganten Brief hinzugefügt, den Präsident George Bush Sr. (Fürsprecher eines freundlicheren, sanfteren Politikstils) für seinen Nachfolger, Bill Clinton, im Oval Office zurückließ. Gewandt und mit Herzlichkeit schiebt er kleinkarierte Befangenheit und politische Boshaftigkeit beiseite, um das beiden gemeinsame amerikanische Ideal zu preisen. Eine solche Geisteshaltung sucht man heute leider vergebens.
Briefe sind neuerdings wieder gefragt bei denen, die bei ihrem Nachrichtenaustausch Wert auf Diskretion legen. Politiker, Spione, Kriminelle und Liebende haben alle – nicht selten auf die harte Tour – die Erfahrung gemacht, dass E-Mails und SMS gelesen und offengelegt werden können. Sie werden nie gelöscht. Aber oftmals verflüchtigen sie sich. Ihre Unbeständigkeit macht sie zu einem unbefriedigenden Medium. Sie lassen das Leben flüchtiger erscheinen, während Briefe ihm einen beständigeren Charakter verleihen. Selbst noch so gründlich verschlüsselte Nachrichten können entschlüsselt werden. Geheimdienste wie CIA, GCHQ oder FSB sammeln, unterstützt von Geisterarmeen freischaffender Hacker, riesige Caches von Nachrichten. Aus diesem Grund greifen Menschen zunehmend wieder zu Stift und Papier, vor allem in Regierungskreisen. Briefe können zwar überdauern, aber paradoxerweise sind sie sicherer, denn es gibt sie nur einmal und man kann sie spurlos vernichten. Russische Spitzenbeamte berichten mir, dass heutzutage im Kreml bei allen bedeutenden Angelegenheiten nur noch brieflich verfahren wird, auf altmodischem Papier, mit altbewährter Tinte oder Blei, Federhalter oder Kugelschreiber und befördert durch loyale Kuriere. Keine schnittigen elektronischen Apparate mehr! Das sollte uns aufhorchen lassen, denn wer wüsste besser als der Kreml unter Präsident Putin, dieser wehrhafte Bienenstock der Cyberspionage, wie unsicher und gefährlich die bequemen SMS und schnellen E-Mails sind. Allerdings haben Briefe, wie diese Anthologie beweist, häufig ein sehr viel längeres Leben, als ihre Verfasser sich jemals träumen ließen.
Ich hoffe, dass die Leserinnen und Leser dieser Sammlung über die Beherztheit, Schönheit und unverfälschte Wahrhaftigkeit der abgedruckten Briefe staunen werden. Während sich der Internetsurfer inmitten von unsichtbaren Millionen isolierter fühlt denn je, ist der Verfasser eines einzelnen Briefes an seinen Adressaten niemals einsam. Lord Byron, dessen Tochter Ada auf diesen Seiten zu finden ist, hat das begriffen, wenn er sinniert, dass »Briefeschreiben das einzige Mittel [ist], das Abgeschiedenheit mit guter Gesellschaft verbindet«, denn der Briefeschreiber wird bereichert durch das wohlige Gefühl, dass jemand in weiter Ferne bald seine Gedanken teilen wird. Möge das für Sie Ermutigung sein, selbst wieder einmal zur Feder zu greifen, inspiriert von diesen Musterbeispielen ihrer Kunst.
Mit den besten Grüßen
Ihr Simon Sebag Montefiore
Mai 2019
P. S. In einigen Fällen habe ich, wo der Text zu lang wurde, die Einzelheiten zu undurchsichtig oder der Sex nicht enden wollend, Briefe gekürzt, um das Lesen zu erleichtern. Außerdem habe ich bei allen regierenden Monarchen die Herrschernamen benutzt, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Briefe noch nicht an der Regierung waren. Das soll der leichteren Identifizierbarkeit dienen. Elisabeth I. war eine Prinzessin mit zweifelhaften Aussichten, als sie den »Gezeitenbrief« an Königin Mary schrieb – doch der Brief erscheint im Inhaltsverzeichnis unter »Elisabeth I. an Mary I.« Ich bitte um Entschuldigung, falls das jemanden stört.
Liebe
Heinrich VIII. an Anne Boleyn, Mai 1528
Dieser Liebesbrief ist von hoher politischer Brisanz. Heinrich war der zweite Sohn Heinrichs VII., der im Jahr 1485 den englischen Thron für seine neu begründete Tudor-Dynastie in Besitz genommen hatte. Erst der Tod seines älteren Bruders Arthur machte Heinrich VIII. 1509 zum König. Arthur hinterließ eine junge Witwe, Katharina von Aragon, Tochter des spanischen Königspaares. Bei seiner Thronbesteigung entschied sich Heinrich, Katharina zu heiraten. Nach fast zwanzig Jahren Ehe wartete der König immer noch verzweifelt auf einen männlichen Erben. Bis dahin hatte nur eine Tochter, Mary, überlebt. Nach einer Affäre mit einer jungen Frau bei Hofe namens Mary Boleyn erregt deren Schwester Anne, ebenfalls Ehrendame der Königin, Heinrichs Aufmerksamkeit. 1528 ist Heinrich bereits rettungslos verliebt in die elf Jahre jüngere Anne Boleyn, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Liebe da schon vollzogen ist. Denn sie entzieht sich seinen Verführungsversuchen. Annes Mischung aus Keuschheit und Kultiviertheit, ihr Ehrgeiz, den König zu heiraten und nicht wie ihre Schwester verführt zu werden, fachen, ebenso wie ihre kühle, hochmütige Anziehungskraft, Heinrichs Leidenschaft noch weiter an. Ihr Naturell lässt ihn spielerisch an ihrer Liebe zweifeln – »Ich hoffe auch auf Eure« – doch später wird er ihr ihre Winkelzüge noch übel nehmen und sich bitter rächen.
Heinrichs Verliebtheit kam seine Überzeugung ganz gut zupass, dass seine Ehe mit Katharina von Anfang an inzestuös gewesen und dass das Ausbleiben eines Sohnes auf göttliches Missfallen zurückzuführen sei. Aufgrund dessen wies er seine Minister an, beim Papst eine Annullierung zu erwirken. Doch die katholische Kirche widersetzte sich Heinrich in seiner »großen Sache«, was schließlich zum endgültigen Bruch mit Rom und zur Gründung der Church of England führte. Das wiederum ermöglichte es ihm, 1532 Anne zu heiraten. Als Anne nur eine Tochter, die spätere Elisabeth I., aber keine Söhne zur Welt brachte, wandte sich Heinrich gegen sie. 1536 wurde sie hingerichtet.
Meine Herrin und Freundin – ich und mein Herz begeben sich in Eure Hände und flehen Euch an, sie als Bewerber um Eure Gunst anzunehmen und dass Eure Gewogenheit durch das Fernesein nicht gemindert werde. Denn es wäre ein großer Jammer, ihren Kummer noch zu vermehren, da das Fernesein sie schon weidlich quält und mehr, als ich je für möglich gehalten hätte, was uns an eine Eigenart der Sternenkunde gemahnt, nämlich dass, je länger die Tage sind, desto weiter entfernt die Sonne ist und dennoch umso glühender. So verhält es sich auch mit unserer Liebe, denn wenn uns auch die Ferne trennt, bewahrt sie doch gleichwohl ihre Inbrunst, zumindest auf meiner Seite, und ich hoffe, auch auf Eurer. Und so versichere ich Euch, dass meinerseits der Verdruss des Ferneseins bereits über Gebühr auf mir lastet. Wenn ich daran denke, was ich unausweichlich noch erleiden muss, wäre das nahezu unerträglich für mich, wäre da nicht meine feste Hoffnung. Und da ich nicht selbst bei Euch sein kann, schicke ich Euch etwas, was dem am nächsten kommt, nämlich mein Bild, in einen Armreif gefasst, mit dem Wahlspruch, den Ihr ja bereits kennt. Ich wünsche mich an ihrer Stelle, sobald es Euch beliebt. Dies von der Hand
Eures treuen Dieners und Freundes
H. Rex
Frida Kahlo an Diego Rivera, 19. August 1939
Frida Kahlos Liebesbriefe an ihren Mann, den Maler Diego Rivera, sind erfüllt von den kräftigen Farben und der ungestümen Leidenschaft ihrer Kunst – und ihres Lebens. Die Tochter eines deutschen Vaters und einer mexikanischen Mutter war schon schwer von Kinderlähmung gezeichnet, als sie 1925, im Alter von achtzehn Jahren, bei einem Busunfall schwer verletzt wurde. Eine Eisenstange hatte sich in ihr Becken gebohrt. Sie verbrachte drei Monate in einem Ganzkörpergips, musste dreißig Operationen und lebenslange Schmerzen über sich ergehen lassen. In der Genesungsphase fing sie mit dem Malen an. Sie begegnete Diego, der bereits eine Berühmtheit war. Beide waren politisch links orientiert und hatten sich über die Kommunistische Partei kennengelernt. Diego wurde Fridas künstlerischer Mentor. Er hatte in Paris gelebt, war durch Italien gereist und hatte seinen eigenen Stil in der Wandmalerei entwickelt mit kräftigen Farben und in ihrer Schlichtheit beinahe aztekisch wirkenden Figuren, mittels derer er die Geschichte Mexikos und seiner Revolution erzählte. Diego und Frida wurden ein Liebespaar. Er war zweiundvierzig, sie zwanzig.
1929 heirateten sie, doch es wurde eine turbulente Ehe. Er war übellaunig und ein notorischer Schürzenjäger, sie hatte Affären mit Männern wie dem russischen Revolutionsführer im Exil, Leo Trotzki, ebenso wie mit Frauen, darunter die französisch-amerikanische Sängerin und Tänzerin Josephine Baker. Weder ihre gesundheitlichen Probleme noch der in der mexikanischen Gesellschaft vorherrschende konservative Katholizismus hinderten sie an der Umsetzung ihrer künstlerischen Vision, und mit ihrer aufwändigen bunten Kleidung brachte sie ihr ethnisch gemischtes Erbe sowie ihr freizügiges Liebesleben zum Ausdruck. Kahlos spektakulärer Kunststil, eine extravagante Mischung aus Fantasie und Realismus, Magie und Folklore, war inspiriert sowohl von Mexiko selbst als auch von ihrem außergewöhnlichen Leben. Das alles offenbart sich auch in ihren Briefen an Rivera, in denen körperliche Liebe und emotionale Turbulenzen mit den Farben der Malerei beschrieben werden.
1939 ließen sie sich scheiden. Lange Zeit galt sie fast ausschließlich als Diegos Frau – doch inzwischen sind Fridas Gemälde und Diegos riesige überschwängliche Wandbilder der Inbegriff von Mexikos Nationalkunst. Die treffendste Beschreibung der stürmischen Beziehung der beiden hat Frida selbst geliefert: »Nur ein Berg kann das Innerste eines anderen Berges verstehen.«
19. August 1939
Diego:
Nichts ist vergleichbar mit Deinen Händen, nichts mit dem grünen Gold Deiner Augen. Mein Körper ist erfüllt von Dir, Tag für Tag. Du bist der Spiegel der Nacht. Du bist das violette Licht des Blitzes. Du bist die Feuchte der Erde. Die Mulden Deiner Achselhöhlen sind meine Zuflucht. Meine ganze Freude ist es, zu spüren, wie das Leben aus Deiner Quellblume hervorsprießt und von mir empfangen wird, um alle meine Nervenwege zu füllen. Sie gehören Dir. Deine Augen sind grüne Schwerter in meinem Fleisch, Wellen zwischen unseren Händen.
Nur Du, in einem Raum voll von Klängen. Im Schatten wie im Licht. Du trägst den Namen Auxochrom, das die Farbe aufnimmt. Ich bin das Chromophor, das die Farbe gibt. Du verkörperst alle Kombinationen von Zahlen. Du verkörperst das Leben. Ich sehne mich danach, die Linie, die Form und die Bewegung zu verstehen. Du beschenkst mich reich, ich empfange Deine Fülle. Dein Wort dringt durch den gesamten Raum und erreicht meine Zellen. Sie sind meine Sterne. Es kehrt zurück zu Deinen Zellen. Sie sind mein Licht.
Frida Kahlo
Thomas Jefferson an Maria Cosway, 12. Oktober 1786
Er ist der amerikanische Botschafter in Paris. Sie ist eine »schmachtende Anglo-Italienerin mit goldblondem Haar und von großer Anmut … äußerst versiert, vor allem auf musikalischem Gebiet«. Er ist dreiundvierzig, sie siebenundzwanzig. Er ist Witwer, sie verheiratet. Der aus Virginia gebürtige Jefferson war ein wohlhabender Gutsbesitzer und hatte 1776 die Unabhängigkeitserklärung der neuen Nation Amerika verfasst. Maria Cosway kam 1759 als Tochter eines englischen Gastwirts im Exil nahe Florenz zur Welt und heiratete später einen exzentrischen Maler. Im Herbst des Jahres 1786 verbringen Maria und Jefferson in Paris viel – intensiv erlebte – Zeit miteinander.
Als sie fortgeht, schreibt Jefferson ihr diesen bemerkenswerten Brief. Darin befasst sich einer der führenden Köpfe der westlichen Welt mit dem Dilemma der Liebe, mit Liebesleid und der menschlichen Natur. Verliebt zu sein, vom Elixier des Liebens zu trinken, so argumentiert er, ist es wert, dass einem unvermeidlich das Herz gebrochen wird. Amerika wäre ja auch nicht befreit worden ohne die Leidenschaft des Herzens. Seine Schlussfolgerung? »Es gibt keine Rose ohne Dornen.« Sie treffen sich niemals wieder, korrespondieren aber für den Rest ihres Lebens.
Kurz nach Marias Weggang kommen Jeffersons Tochter und ihre sechzehnjährige Mischlingssklavin Sally Hemings zu ihm nach Paris. Mit Sally beginnt Jefferson eine Beziehung, aus der mindestens fünf Kinder hervorgehen. 1790 kehrte er nach Hause zurück, um dort in Präsident Washingtons Kabinett der erste Außenminister seines Landes zu werden. 1801 wurde er zum dritten Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Es folgt nun dieser ganz besondere Brief über die Qualen und Konflikte eines Menschen, der sich unangemessen verliebt hat.
Als ich einsam und traurig an meinem Kamin saß, entspann sich der folgende Dialog zwischen meinem Kopf und meinem Herzen.
Kopf: Nun, mein Freund, Du scheinst ja in keiner sehr guten Verfassung zu sein.
Herz: Ich bin fürwahr das elendeste unter allen irdischen Geschöpfen. Überwältigt von Kummer, jede Faser meines Leibes über alles naturgegebene Maß der Erträglichkeit hinaus angespannt, würde ich mit offenen Armen jedwedes Unheil willkommen heißen, das mich nicht mehr fühlen noch fürchten ließe.
Kopf: Das sind die unabänderlichen Folgen Deiner Herzenswärme und Deines Ungestüms. Wieder eine dieser Verlegenheiten, in die Du uns beständig bringst. Du bekennst Deine Torheiten, fürwahr! Doch Du lässt nicht ab, sie zu pflegen und an ihnen festzuhalten. Und auf Läuterung ist nicht zu hoffen, wo keine Reue herrscht.
Herz: Ach, mein Freund! Es ist jetzt nicht der Augenblick, meine Schwächen zu tadeln. Die Kraft meines Kummers reißt mich in tausend Stücke! Wenn Du irgendwelchen Balsam hast, dann gieße ihn in meine Wunden – wenn nicht, so martere sie nicht mit neuen Qualen. Verschone mich in dieser entsetzlichen Stunde! Zu jeder anderen will ich geduldig Deinen Ermahnungen lauschen.
Kopf: Da muss ich aber widersprechen: Ich habe noch nie erlebt, dass Du Triumphe erzielt hättest, indem Du meinen Ermahnungen Beachtung schenktest. Während Du unter Deinen Torheiten leidest, magst Du Dir ihrer ja vielleicht bewusst sein, doch ist der Anfall erst einmal vorüber, dünkt es Dich, er könne niemals wiederkehren. Es ist daher, so bitter die Medizin auch sein mag, meine Pflicht, sie zu verabreichen …
Herz: Der Himmel möge mir versagt sein, wenn das so ist! …
Kopf: Ich wollte Dir begreiflich machen, wie unbesonnen es ist, Deine Zuneigung vorbehaltlos auf Dinge zu richten, die Du so bald schon wieder verlieren wirst und deren Verlust, wenn er kommt, Dir solch schlimme Schmerzen bereiten muss. Denke nur an die vergangene Nacht. Du wusstest, dass Deine Freunde heute Paris verlassen würden. Das alleine schon bereitete Dir Höllenqualen. Die ganze Nacht über hast Du uns von einer Seite des Bettes auf die andere gewälzt. Kein Schlaf, keine Erholung … Um diesen ewigen Kummer zu vermeiden, dem Du uns beständig aussetzt, musst Du lernen, vor jedem Schritt vorauszublicken, der sich auf unseren Seelenfrieden auswirken könnte. Alles auf dieser Welt ist eine Sache des Abwägens. Gehe daher besonnen vor, mit der Waage in der Hand. Lege in die eine Schale die Freuden, die eine bestimmte Sache Dir verheißen mag; doch lege in die andere auch redlich die Schmerzen, die folgen werden, und beachte, was schwerer wiegt. Eine Bekanntschaft zu machen ist keine leichtfertige Angelegenheit. Wenn Dir eine neue ins Haus steht, betrachte sie von allen Seiten. Erwäge, welche Vorteile sie bietet und welchen Beschwerlichkeiten sie Dich aussetzen mag. Schnappe nicht nach dem Köder der Freuden, bevor Du nicht sicher bist, dass kein Haken darunter lauert. Die rechte Lebenskunst ist die Kunst, Schmerz zu vermeiden. Und der ist der beste Lotse, der die Felsen und Untiefen, die ihn bedrängen, am weitesten umschifft. Immer lockt uns das Vergnügen, doch das Ungemach ist stets an unserer Seite. Während wir jenem nachjagen, gebietet dieses uns Einhalt. Das wirksamste Mittel, sich gegen Schmerzen zu wappnen, ist, sich in sein Inneres zurückzuziehen und sich selbst zu genügen …