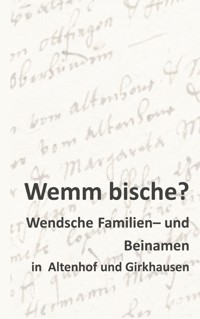Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Offen und ehrlich, schonungslos und liebenswürdig stellt der Autor in einer sehr persönlichen Sichtweise seine Kindheit in seinem Herkunftsort während des ersten Jahrzehnts nach dem Zweiten Weltkrieg vor. Es sind Geschichten, die konsequent aus der Sicht des Kindes erzählt werden. Sie lassen Geschichte transparent werden, nachvollziehbar und authentisch. Durcchgehend hat der Autor nur eine einzige Quelle benutzt: seine Erinnerungen. Und damit ensteht ein neues Heimatbuch, in dem nicht nostalgisch verklärt oder distanziert Dokumente präsentiert werden, sondern es nimmt die vom Autor in seinem Grundlagenwerk "HeimatNeuDenken" entwickelte Sicht ernst. Dort und in diesem Buch ist Heimat der soziale Raum aus Territorium, Beziehungen und Emotionen, gefährdet und gefährdend, sinnstiftend und Zugehörigkeit verweigernd. Dazu werden vor allem die vielfältigen Beziehungen und die begleitenden Emotionen, wie sie das Kind erlebt hat, als Grundlage für das dargestellt, was der Autor war, und was immer noch in seine Seele scheint: Der Junge vom Dorf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich widme dieses Buch meinen verstorbenen Eltern zum Dank dafür, dass sie mich haben werden lassen, der ich bin. Ich widme es aber auch all den Menschen meines Herkunftsortes in ihrer eigenen Art. Wer ich ohne sie geworden wäre, weiß ich nicht, aber wer ich mit ihnen wurde und bin, weiß ich sehr wohl.
Inhaltsverzeichnis
Ein Wort zuvor
Anfang
Kind sein
Früh in Verantwortung
Ambivalenz von Geborgenheit und Forderung
Wanderungen
Geschwister
Prügelstrafe
Spielen
Spielen im Haus und in der Nachbarschaft
Verstecken
Spielen im Dorf
Spielen im Wald
Spielen an der Flut
Spielen im Winter
Aschendüppen werfen
Spiele am Tisch
Gewalt beim Spielen
Gefährliche Spiele
Aktiv
Briefmarken sammeln
Lesen
Drachensteigenlassen
Modelleisenbahn
Schule
Einschulung und erste Klasse
Frommer Unterricht
Die Mittelklasse
Spiele auf dem Pausenhof
Übergang zum Gymnasium
Vorbereitung und Schulwechsel
Schüler der „Höheren Schule“
Schlesisches Kind
Flucht und Vertreibung
Lebensunterhalt
Schlesische Verwandtschaft
Das Schlesische Kind
Brauchtum
Der Neustart zwischen Zuhause und daheeme
Papas Kinderfreund Fritze
Familienleben
Unser Elternhaus
Essen
Spazierengehen
Fotograf
Getränke aus dem Automaten
St. Martin
Weihnachten
Das Dorf
Dorfbebauung
Häuser
Haustypen
Bauboom
Wege
Chaussee – die Schussee
Wasser
Bäume
Vögel
„Klurs Backhaus“
Müll
Leben im Dorf
Selbstorganisation und Genossenschaften
Kirmes und andere Feste
Ostern
Eigen-artige Menschen
Nationalsozialismus, Krieg und Kriegsfolgen
Narrativ des Vaters
Narrativ der Mutter
Im jüdischen Haushalt
Narrative im Dorf
Vertriebene
Kontinuitäten im Schützenverein
Kirche – Glauben
Konservatives Landchristentum
Rituale und Pflichten
Sexualfeindlich und ängstlich besorgt
Magisches Denken
Dörnschlade
Beichte und Erstkommunion
Arbeit
Lebensunterhalt durch Arbeit in Firmen
Handwerker im Dorf
Läden für die Nahversorgung
Selbstständige Landwirte
Fuhrunternehmen und Handel
Heimarbeit
Gaststätten
Erste eigene Firmen im Dorf
Armut
Landwirtschaft
Kühe
Schweine
Schlachten
Kälber
Kartoffelernte
Heuernte
Hauberg
Getreide
Garten bebauen
Hüten
Tiere im Haus
Das alte und das neue Haus
Hygienische Verhältnisse
Fragiler baulicher Zustand
Das neue Haus
Technik - Auto - Fernsehen – Telefon
Autos
Mopeds
Telefon
Fernsehen
Technisierung in der Landwirtschaft
Vater und der Alkohol
Alkoholkultur
Weg in die Abhängigkeit
Hausbau
Tiefer in die Sucht
Wende
Lob der Mutter
Gründe - mit aller Vorsicht
Nachtrag
Ein Wort zuvor…
Ein kulturhistorisches Experiment habe ich dieses Buch im Untertitel genannt, und das bedarf einer Erklärung. Begonnen hat alles mit der Anfrage einer in unserer Region bekannten Journalistin nach Personen und Quellen zur historischen Kartoffelernte. Gerne wollte ich sie darin unterstützen, hatte sie doch bereits gute Artikel für unseren Heimatverein veröffentlicht. Da sie jedoch wesentlich jünger ist als ich, konnte ich nicht davon ausgehen, dass ihr die Vorgänge in der Landwirtschaft aus eigener Anschauung und Erfahrung vertraut waren. Kurzerhand begann ich daher für sie, aus meiner Erinnerung aufzuschreiben, wie die Kartoffelernte zu meiner Kinderzeit bei uns zu Hause im landwirtschaftlichen Nebenerwerb vonstattenging. Als ich fertig war mit den Ausführungen, schaute ich erstaunt auf die an einem Nachmittag geschriebenen Zeilen, weil die Beschreibung so umfangreich und so detailliert geworden war, dass ich mich sogar an das Muster der Tischdecke erinnerte, die unsere Oma ausbreitete, wenn sie die Butterbrote für die Pause der Kartoffelleserinnen und –leser aufs Feld gebracht hatte.
Ich bin danach wieder in Kontakt gekommen mit dem Autor Sauerländer Geschichte Peter Bürger, der mich ermutigte, „eine ehrliche Nachkriegsautobiographie ohne Tabus“ zu schreiben. Und so habe ich in den vergangenen drei Jahren Kapitel für Kapitel verfasst, wobei es mir weniger um meine Biografie ging, sondern das Dorf und seine Kultur aus der Sicht eines Kindes darzustellen. Ich möchte daher dieses Buch, auch wenn es biografisch angelegt ist, keine Biografie nennen, habe ich doch zu viele „Autobiografien“ gelesen, die eher eine Selbstbeweihräucherung oder späte Rechtfertigung darstellten. Aus diesem Grund habe ich mich auch in den vergangenen Jahren einer konsequenten Abstinenz von Biografien oder heimatkundlichen Büchern zum Dorfleben verschrieben, sogar von ehemaligen Freunden. Ich wollte auf Interferenzen und unbewusste Übernahmen verzichten.
Peter Bürger hat mich im Wissen um nur Wenigen bekannte Teile meiner familiären Geschichte ermutigt, auch die dunklen Seiten zu beschreiben, sie sozusagen ans Licht zu holen, weil auch sie den Charakter eines Dorfes und einer Person prägen. Daher bin ich auch schonungslos mit Vorgängen aus der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte in unserem Dorf, den häufig nicht fairen Verhaltensweisen in meiner Verwandtschaft, meinen eigenen Schattenseiten sowie der Alkoholkrankheit meines Vaters umgegangen und habe sie in die Beschreibungen aufgenommen.
Dieses Buch ist ein Experiment, weil ich – auf Ehre und Gewissen – keine andere Quelle benutzt habe, als meine eigenen Erinnerungen. Daher kann es sein, dass sich diese nicht mit denen anderer Personen decken. Es sind meine Erinnerungen und das, was man mir als Kind erzählt hat, die ich aber einordne als älterer Erwachsener und auch auf der Folie meiner wissenschaftlichen Arbeit.
Und das ist der zweite Grund, weshalb ich es ein Experiment nenne. Ich habe mich nie als eine Person erfahren, die Zahlen und Fakten gut lernen und behalten kann. Aber ich habe festgestellt, dass das, was ich mit einer persönlichen Neugier erforscht habe und was mit Emotionen verbunden war, dauerhaft in meinem Gedächtnis verankert ist. Und hier kommt der wissenschaftliche Pädagoge ins Spiel, der einfach in einem Selbstexperiment erkennen will, dass und was Kinder im Laufe ihres Lebens aufnehmen, verarbeiten, behalten und in ihre Persönlichkeit integrieren.
Ich habe dieses Buch nach einigen Überlegungen abgeschlossen, obwohl noch eine Fülle an Details in meinem Kopf und in den Manuskripten zu finden sind. Aber es muss ja noch lesbar bleiben.
Und noch etwas: die Kapitel sind oft in längeren zeitlichen Abständen voneinander entstanden, sodass Dopplungen nicht zu vermeiden waren. Das hatte jedoch einen zunächst nicht intendierten Nebeneffekt: sie lassen sich einzeln in beliebiger Reihenfolge lesen. Um ihnen ihre Stringenz zu bewahren, habe ich sie weitgehend unverändert gelassen. Wer das ganze Buch liest, wird auf diese Dopplungen stoßen, die damit aber auch zu Schlüsselthemen werden.
Drolshagen, im Herbst 2022 Walter Wolf
Das eine ist, dass die Gedanken, wenn sie aufgeschrieben werden, auf andere Weise zu existieren beginnen: Ich kann ihnen, statt sie nur zu vollziehen, mit einer erwägenden und prüfenden Distanz gegenübertreten, sie erlöschen nicht gleich wieder, sondern haben Bestand und sind etwas, auf das ich stets von neuem zurückkommen kann. Indem sie in geschriebenen Worten zum Ausdruck kommen, erlangen sie eine Bestimmtheit, die sie vorher, als stille und flüchtige Episoden des Geistes, nicht besaßen.
Pascal Mercier Das Gewicht der Worte
Anfang
Ein hagerer junger Mann mit schütterem Haar saß unruhig auf der Bank unter dem Fenster des Krankenhauses in Wenden. Er hatte die Beine übereinandergeschlagen und einen Fuß noch einmal hinter den Waden verschränkt. Es war kurz vor Mittag und die Junisonne zeichnete scharfe Schatten. Er hatte schon genug geraucht, zu mehr reichte es nicht. Oder noch eine, die letzte. Drinnen, im niedrigen Kreissaal hatte der Arzt den Kopf des Kindes in der Hand und half behutsam der jungen dunkelhaarigen Frau, immer dann, wenn die Wehen kamen, bis mit einem Mal das Kind ganz in dieser Welt ankam. Die Frau, meine Mutter, und der Arzt, Dr. Hans Schreiber, Hausarzt und Geburtshelfer, atmeten tief durch. Da war ich.
Dann um 11.35 Uhr am 30. Juni 1951 beendete ein Schnitt den innigen Kontakt mit meiner Mutter, Dr. Schreiber gab mir den obligatorischen Klaps und ich schrie, wie wohl jedes Kind, das so auf der Welt begrüßt wird.
Da warf mein Vater die soeben angefangene Zigarette weg und sprang auf, aber wohin? In den Kreissaal durfte er nicht. Unruhig ging er auf und ab, setzte sich, stand wieder auf, ging ein paar Schritte, kam wieder zurück und blieb dann sitzen, bis eine Schwester aus dem Krankenhaus kam und sagte: "Es ist ein Junge."
Das alles habe ich so von meinem Vater und Dr. Schreiber, der auch über 20 Jahre mein Hausarzt war, später erfahren. Dr. Schreiber wusste dies noch genau, weil es damals im Wendschen etwas Außergewöhnliches war, dass der Mann als werdender Vater auch seine Frau zum Krankenhaus begleitete und während der Geburt wartete. Es sollte nicht das einzige unkonventionelle Verhalten meines Vaters im Umgang mit seinem ersten Sohn sein, auch wenn er viel Spott und Unverständnis in einer von hartem Mannsein geprägten Dorfgemeinschaft ertragen musste.
Seinen Eltern, die damals in Wenden wohnten, hat mein Vater meine Geburt gleich mitgeteilt, später nach dem Fußweg zu Hause in Altenhof auch der Schwiegermutter und ihren Söhnen, drei meiner vier Onkels, die ebenfalls dort wohnten. Der älteste Bruder meiner Mutter, Ludwig, war zum Zeitpunkt meiner Geburt gerade ein Jahr aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, der letzte in der Gemeinde Wenden, nach Stalingrad und der Zwangsarbeit in einer Kohlegrube. Er sollte mein Pate werden.
Den ersten Vornamen erhielt ich in Erinnerung an den im Krieg gefallenen Bruder meines Vaters, Walter, den zweiten von meinem Patenonkel. So wurde ich ein Walter Ludwig Wolf.
Die „Klurs Jungens", also die Brüder meiner Mutter, gehörten nicht zu den Leisetretern und Spaßverderbern. Wie ich von meiner Mutter erfuhr, haben sie mich, den ersten Enkel bzw. Neffen, mit einem drei Tage dauernden - man muss es so nennen - Besäufnis gefeiert, „pinkeln lassen", wie man bei uns sagte. Mein Pate Ludwig, von Beruf Schornsteinfeger wie sein Vater und Großvater, war es gewohnt, auch über Dächer und schmale Firste zu laufen. Im „besoffenen Kopf“, so meine Mutter, ist er nach einer ordentlichen Zechtour in Wenden auf der hohen Friedhofsmauer hin und her gelaufen.
Ich glaube, dies war verständlich, war der Krieg gerade einmal sechs Jahre vorbei, seine Gefangenschaft unter russischer Knute eine Tortur und seine Freiheit und die Rückkehr in die Heimat nur ein gutes Jahr Geschichte, die ihn später immer wieder einholen sollte. Mit einem Enkel begann eine neue Zeit, so etwas wie ein Aufbruch. Doch die Euphorie sollte nicht von Dauer sein, vor allem nicht für meine Eltern.
Denn für meine Oma mütterlicherseits, es war für mich immer Oma Klur, war es weiterhin selbstverständlich, dass meine Mutter trotz Kind und eigenem Haushalt weiterhin Hausarbeiten für ihre Brüder erledigte, meinem Onkel Johann, der auf Freiersfüßen ging, noch „mal eben" das Hemd bügelte, so, als wäre sie weiterhin „nur" die Schwester, die für die Hausarbeiten zuständig war, während „die Jungen" bis in die Nacht laut und leidenschaftlich Skat spielten. Zusätzlich galt es, auch alle Arbeiten zu erledigen, die beim bäuerlichen Nebenerwerb und einem großen Garten anfielen.
Auf meinen Vater konnten sie nur unzureichend zurückgreifen. Er war in Bad Reinerz, einer Kleinstadt in der Grafschaft Glatz, groß geworden, hatte dort eine kaufmännische Lehre gemacht, war aber nie mit Landwirtschaft und Gartenbau in Berührung gekommen. Sein Vater, gelernter Schreiner, verlor in den dreißiger Jahren seine Arbeit, seine Mutter hat die Familie mehr schlecht als recht durch Handel auf dem Markt in Glatz durchgebracht. Immerhin waren es sieben Kinder, von denen auch einer, mein Namensgeber Walter, Abitur gemacht und ein Theologiestudium beim Orden der Hl. Familie (msf) begonnen hatte.
So musste also meine Mutter die geforderten Arbeiten auf dem Feld, im Stall und im Garten leisten, was auch dazu führte, dass sich mein Vater, zumindest solange ich das einzige Kind war, intensiv um mich gekümmert hat. Bei den obligatorischen Sonntagsspaziergängen schob er selbstverständlich meinen Kinderwagen. Das war im Dorf absolut unüblich. Den Kinderwagen schob die Frau, allenfalls wurde mal geholfen, wenn es die letzte Steigung zur Dörnschlade hinaufging. Das spöttische Grinsen, das er von den „männlichen" Männern im Dorf erhielt, störte ihn nicht.
Für viele im Dorf galt er als ein Sonderling, der einen fremden Dialekt und ein klares Hochdeutsch sprach, nicht, wie es üblich war, Wendsches Platt. Auf meine Frage, die ich meiner alten Mutter einmal gestellt habe, warum sie sich in „den Peter" verliebt habe, sagte sie ohne zu zögern: „Der war immer so höflich. Der hat mich nicht so grob angesprochen, wie das andere Männer im Dorf getan haben. Und er konnte gut tanzen, nicht nur herumschieben beim Schützenfest".
Wir wohnten damals in dem Elternhaus meiner Mutter, ein typisches Haus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts (später werde ich mehr über unser Haus und die anderen Häuser im Dorf berichten), auf zwei kleinen Zimmern im Obergeschoss. Oma Klur hatte ebenfalls ihr Schlafzimmer auf der Etage, mein Onkel Norbert schlief neben ihr im Bett seines Vaters, der 1936 von Nazis erschlagen worden war. Ebenfalls wohnte meine Großtante Lina, eine unverheiratete Schwester von Opa Klur, in einem Zimmer auf dieser Etage. Im Untergeschoss befand sich die große Küche, ein weiteres Schlafzimmer, eine selten genutzte „gute Stube", die „Alte Küche", die zur Viehküche wurde, Waschküche und Stall. Viele Menschen unter einem Dach und nicht immer einer Meinung.
In diesem System wuchs ich auf, einmal gehegt und gepflegt als erster Enkel, dann wieder der Sohn von dem „Schnesinger", wie Tante Lina meinen Vater verächtlich nannte. Ich war Kind im Dorf, in der Nachbarschaft mit anderen Kindern, dann wieder abgesondert, was unter anderem auch dazu führte, dass ich mir meine geheimen Refugien, Rückzugsorte und Verstecke suchte, wo ich ungestört und unsichtbar meine Zeit verbringen, träumen und spielen konnte
Ich wurde ein Kind im Dorf, Kind meiner Eltern und geprägt von einem eher rauen Umfeld, von unvergessenen Erlebnissen, die wie auch die vielen Blessuren zu Erfahrungen wurden, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute noch bin: der Junge vom Dorf.
Dies werde ich im Folgenden nicht chronologisch, sondern in einzelnen Themen vorstellen und damit auch einen Einblick geben, wie Leben in den fünfziger und sechziger Jahren in meinem Dorf aussah, ohne Rückgriff auf historische Dokumente und einzig aus einer Quelle: meinen Erinnerungen, wie ich sie als Kind gespeichert habe. Damit ist es auch die kindliche Perspektive, das Erleben und Wiedererleben in der Erinnerung. Um Erleben zur Erfahrung zu transferieren, gehört auch die Reflexion und das Einordnen in Kontexte hinzu, die weitgehend das Werk des Erwachsenen sind. Dies wird die folgenden Ausführungen prägen.
Keine meiner freudvollen und leidvollen Erfahrungen möchte ich missen, haben sie mich doch zu dem gemacht, der ich heute als älterer Mann bin, bei aller reflektierten Entwicklung immer auch noch der Junge vom Dorf.
Kind sein
Früh in Verantwortung
Kind sein im Dorf hieß auch, zwischen dem Kind, das spielen, lernen oder einfach mit anderen Kindern zusammen sein wollte, und den Aufgaben, die der Arbeit und dem Zusammenleben der Erwachsenen zugeordnet wurden, zu oszillieren. Wählen war nicht möglich, denn im Vordergrund standen immer die Pflichten und Aufgaben. Dabei waren diese durchaus leistbar, überforderten in den meisten Fällen nicht, aber sie waren immer in dieser Zuordnung auf die Tätigkeiten des Erwachsenen, und das hieß meistens der Arbeit in Haus, Garten und Feld, ausgerichtet. Kinderarbeit war also ganz normal, ja es gehörte schon zum Image, dass ein Kind bestimmte Aufgaben, und die in der Regel allein, erledigen konnte.
Kühe hüten oder sie in den Weidekamp treiben, die Kuh beim Pflügen führen, Unkraut jäten im Garten und auf dem Acker, das Heu in den hintersten Winkel auf dem Dachboden stopfen, bansen, wie man sagte, aber auch die Einkäufe erledigen, im Lebensmittelladen im Dorf oder in der Apotheke und beim Schuster im Nachbarort. Auch das Schlachten der Hühner gehörte dazu, für mich wie auch für andere Jungen bereits mit 10 Jahren, beginnend beim Fangen der Tiere, über das Köpfen, Rupfen, Flämmen, Ausnehmen bis sie fertig für den Topf waren. Manche der Arbeiten waren durchaus auch gefährlich, wie z.B. das Streichen des Blechdachs mit einer Teerlösung, in großer Höhe auf wackeligen Leitern und scharfen Dämpfen ausgesetzt, die ich mit 11 Jahren übernehmen musste.
Aber es waren auch die Botengänge, die wir als Kinder zu erledigen hatten. Neben dem bereits erwähnten Einkauf gehörten dazu auch das Bierholen für die Onkel oder sie vom Frühschoppen abzuholen, bevor sie „ganz versackten“. Um ein wenig Zeit für ein weiteres Bier zu schinden, gaben sie mir manchmal einen Groschen und ich konnte mir ein paar der sonst nicht erreichbaren Leckereien aus dem Erdnussautomaten ergattern, einer mit Nüssen gefüllten Glaskugel, etwa in der Größe eines Fußballs, die auf einem metallenen Sockel mit einem Drehmechanismus saß. Dort konnte der Groschen eingeworfen werden, ein Knebel wurde gedreht und eine kleine Kinderhand voll Erdnüsse kamen bei einer Klappe heraus. Nicht selten, wenn meine Onkel absolut nicht nach Hause wollten, schimpfte meine Oma mich aus, ich hätte sie mitbringen sollen.
Für meine Oma holte ich auch jährlich die kleinen Beträge ab, die der Jagdpächter an die Besitzer der Ländereien zahlte, um sie damit für deren Nutzung bei der Jagd zu entschädigen. Es waren immer Beträge unter 10 DM, die aber für meine Oma wie jeder Geldbetrag bei ihrer kleinen Rente, zählten.
Wie sehr die Pflichterfüllung und die Arbeit im Vordergrund standen, habe ich einmal sehr deutlich und schmerzhaft erfahren. Mein Onkel Hans aus Frankfurt, Bruder meines Vaters, war Zugführer bei der Bundesbahn und hatte einen längeren Aufenthalt in Siegen. Irgendwie hatte er meinen Vater kurzfristig eingeladen, ihn doch in Siegen zu besuchen. Als ich das hörte, war ich – wie man so sagt – Feuer und Flamme, einmal ganz nah an eine D-Zug-Lok zu kommen, auf dem Führerstand in die Brennkammer zu schauen und ein ganz wenig „Große Reise“ zu spielen. Ich war wohl 10 Jahre alt, und mein Vater beschloss, mit seinem Moped nach Kreuztal zu fahren und seinen Bruder nach Jahren wieder einmal zu treffen. Meine Enttäuschung kann man wohl nachempfinden, als ich eindeutig, sowohl von meiner Oma als auch meiner Mutter die Anordnung bekam, an diesem Nachmittag wieder die Kühe zu hüten. Alle Vorschläge, wie das auch anders organisiert werden könnte, wie z.B., dass es ausnahmsweise mein Vetter einmal übernehmen könnte oder die Kühe auf die nahegelegene Weide „Am Stücke“ getrieben werden könnten, wurden abgeschmettert. Mein zorniges Weinen und alle Verhandlungsversuche änderten nichts an der Entscheidung. Ich musste die Kühe auf unsere Wiesen „Hinterm Kreuz“ treiben und sie dort hüten. Mein Vater nahm dafür meinen kleinen fünf Jahre alten Bruder mit, den er vor sich auf den Tank setzte und der mir abends von dem großen Zug erzählte. Als ich die Kühe aus dem Stall trieb, rief mir meine Oma noch hinterher: „Aber komm ja nicht zu früh wieder!“
Ambivalenz von Geborgenheit und Forderung
Sicher waren wir Kinder, und ich spreche weiter für mich, oft hin und her gerissen, wenn Bedürfnisse aufgeschoben wurden oder nie zur Erfüllung kamen. Wenn im Frühjahr die Arbeit im Hauberg losging, sammelte ich das Reisig, dass meine Mutter zu Schanzen band. Dann gab es keine Gelegenheit zum Spielen. Wenn das Heu noch schnell wegen eines drohenden Gewitters nach Hause gebracht und in der Hitze und dem Staub unter dem Blechdach des Balkens verstaut werden musste, konnten andere zum Baden oder Planschen an die Flut oder den Weiher gehen. Wenn die Wagen mit den Garben aus Roggen, Gerste oder Hafer vom Feld zur Dreschmaschine gefahren wurden, und der mehrere hundert Meter lange Konvoi immer Stück für Stück weiterbewegt werden musste, und das bis spät in die Nacht, bis wir an der Reihe waren und wir Kinder die von der Dreschmaschine ausgespuckten Strohballen stapelten, schliefen andere schon lange. Wenn am Abend vor Christi Himmelfahrt noch „mal eben“ die Kartoffelfurchen neu geritzt werden mussten, konnten sich andere schon auf den Feiertag vorbereiten. Immer wieder standen Forderungen den eigenen Wünschen und Bedürfnissen entgegen.
Gleichzeitig schaffte aber auch die Eindeutigkeit der Forderung und das unmittelbar zu beobachtende Ergebnis, das gemeinsame Tun eine Sicherheit des Handelns, und damit auch Geborgenheit. Immer dann, wenn an uns Kinder keine Forderung gestellt wurde, waren wir Kinder, die spielen konnten, albern sein durften oder einfach auch nichts tun konnten. Im selben Augenblick aber, wenn es etwas zu tun gab, vor allem, wenn etwas nicht vorhersehbar war, stand sofort die Forderung im Vordergrund und es war bis auf Weiters aus mit unbeschwertem Kindsein. Beide Seiten jedoch waren Teil des Systems, sie gehörten weitgehend ungefragt dazu.
Wanderungen
Eine sehr prägende Erfahrung sammelte ich bei einer Wanderung mit meinem Vater, als ich 9 Jahre alt war. Wir brachen auf, um den Kindelsberg zu besteigen, einen gut 600 m hohen Berg im Siegerland, der zu den Rothaarhöhen gehört. Für diesen Tag hatte ich meinen Vater ganz für mich allein, während meine Mutter und meine beiden Geschwister zu Hause blieben. Meine Eltern waren, als ich noch sehr jung war, bereits dorthin gewandert, allerdings ohne mich. Das muss auch für sie eine sehr schöne Erfahrung gewesen sein, denn mein Vater sprach immer wieder auf dem Weg diese frühere Wanderung an.
Wir brachen irgendwann am Morgen auf und machten uns auf den 12 km langen Weg zu dem alten Aussichtsturm, über das Kölsche Heck an Eichen und Krombach vorbei, um dann den steilen Weg hinauf zum Gipfel und dem Turm zu steigen. Bis Schönau kannte ich den Weg noch von sonntäglichen Spaziergängen und durch eigene Exkursionen mit Freunden auf unseren Rollern und Fahrrädern. Aber hinter dem Ort begann für mich Neuland. Mein Vater führte mich aber zielsicher weiter, vorbei an der Weggabelung, die links zum Forsthaus und dem verlassenen Ort Buchlerhof führte, rechts in Richtung Bockenbach ging. Als wir auf der Höhe waren, also der Grenze zwischen Siegerland und unserer Region, marschierten wir unter einer Hochspannungsleitung durch. Erstmals nahm ich das tiefe Summen in den dicken Drähten wahr und mir war schummrig zumute im Wissen, dass dort Strom in einer sehr hohen Spannung durchlief. Was ein Stromschlag bedeutete, wusste ich, denn ich hatte öfter mal einen an der Nachttischlampe meines Vaters bekommen. Er hatte diese seinerzeit in der Firma Müller in Olpe selbst aus Kupfer hergestellt, aber offensichtlich nicht alles ganz sicher isoliert. Ich bin sehr schnell unter den summenden Drähten durchgelaufen und war froh, dann in den Ort Bockenbach abzusteigen. Von da an führte uns der Weg an der für meine damaligen Vorstellungen schon sehr befahrenen Straße weiter bis zum Einstieg in den Wanderweg zum Turm. Wir kamen an der Brauerei vorbei, und mein Vater erzählte mir vor dem Bierbrunnen, dass dort beim alljährlichen Brunnenfest statt Wasser Bier laufen würde, er wies auf einen kleinen Laden in einem älteren, bunten, seltsam auf die Straßenecke gebauten Haus hin und dass er dort bei Körtings sein, unser erstes Radio gekauft habe. Und dann sollte es etwas Besonderes geben: Fleischwurst und Brötchen. Als wir in die Metzgerei kamen, entschuldigte sich die etwas füllige Dame hinter der Theke, dass sie leider keine Wurst vorrätig hätten. Aber, wenn wir ein wenig Zeit mitbrächten, könnten wir sie in einer halben Stunde direkt und frisch aus dem Kessel bekommen. Für mich war es etwas Neues und ich habe es erst nicht verstanden, um was es ging. Aber mein Vater war sofort begeistert, Fleischwurst, heiß und frisch aus dem Kessel! Wann gab es so etwas schon bei uns? Wir trödelten danach die Zeit durch Krombach, bis wir die Wurst und zwei frische Brötchen bekamen. Nun zogen wir los, bergauf zum Kindelsberg. Es war schon ein heftiger Anstieg, den ich so nicht erwartet hatte. Kurz unter dem Gipfel hielten wir an einer Stelle an, an der ein Rohr in Bruchsteine eingefasst aus dem Fels kam und aus dem kaltes, frisches Wasser floss. Hier, so sagte mein Vater, habe er auch mit meiner Mutter Rast gemacht und sie hätten das frische Quellwasser getrunken. Tatsächlich schmeckte auch mir das kalte Wasser sehr gut. Nach kurzer Zeit kamen wir an dem steinernen Aussichtsturm an und machten nun eine Rast mit der unglaublich frischen, weichen Fleischwurst, die auch noch ein bisschen warm war und den frischen Brötchen, und ein ganz wenig Senf an dem Pappdeckel. Ein Leben lang ist dieser Augenblick und die frische Fleischwurst ein Höhepunkt für meinen Vater und mich geblieben. Immer, wenn ich heute eine frische Fleischwurst aus dem Kessel bekomme, ist mir dieser Augenblick wieder greifbar präsent.
Dann bezahlten wir 20 Pfennig für mich und 30 Pfennig für meinen Vater und stiegen die Treppe durch den Turm nach oben. Weit konnten wir blicken über das Siegerland, weit über den Horizont, wo irgendwo auch mein Dorf lag, von dem aus ich auch den Kindelsbergturm immer sehen konnte. Zurück sind wir Richtung Ferndorf abgestiegen und von dort mit dem Bus nach Hause gefahren. Diese Wanderung ist bis heute ein Schlüsselerlebnis mit meinem Vater geworden und geblieben.
Ich musste wohl in der Schule auch von dieser Wanderung erzählt haben, denn mein Klassenlehrer Paul Hähner bestimmte mich irgendwann im Sommer dazu, dass ich die Klasse zum Kindelsberg führen sollte. Ja, richtig. Wir machten im dritten Schuljahr eine Wanderung zum Kindelsberg, und er war noch nie da gewesen. Stolz spürte ich, als er mich mit dieser Aufgabe betraute, aber als wir an die Kreuzung kamen, wo es nach Bockenbach oder zum Forsthaus ging, wurde ich doch ganz unsicher. Wo waren wir hergegangen? „Du musst es doch wissen, du warst doch schon mal hier“, sprach er mich an. Es war nicht gerade motivierend, ich zögerte, schaute beide Wege an und entschied mich rein intuitiv für den Weg rechts. Das war richtig, und als wir den Ort Bockenbach vor uns sahen, durchschoss mich noch einmal der Gedanke: Wie hätte ich mich blamiert, wenn wir links abgebogen und damit den falschen Weg genommen hätten. Als wir dann in Krombach waren, erkannte ich den Weg wieder. Am Waldrand, bevor es in den Aufstieg zum Gipfel ging, haben wir Rast gemacht, sind dann zum Turm gewandert und natürlich den ganzen Weg wieder zurück nach Hause. Als wir ankamen, dachte ich bei mir: Ist ja noch mal gutgegangen.
Einmal sind wir als Familie, das heißt allerdings ohne meine Geschwister, nach Crottorf gewandert. Ich kann mich nicht mehr an den Weg erinnern, wohl aber an das Renaissance-Schloss, an die Zugbrücke und den schwarzen Schwan auf dem Wasser vor dem Haupttor sowie die Karpfen, die in dem brackigen Wasser schwammen. So ist auch Crottorf für mich zu einem Inbegriff für ein Wasserschloss geworden, in dem alle Märchen spielen können.
Wenn ich bedenke, dass die Entfernungen zu diesen beiden Orten jeweils 10 – 12 km betrugen, schaue ich schon mit Achtung auf die Leistungen, die wir zu Fuß hinter uns gebracht haben. Eine andere Leistung waren die Ausflüge meiner Eltern mit ihren Fahrrädern, die sie an den Listersee führten, mit denen sie in Schmallenberg auftauchten und zur Hochzeit meines Onkels Franz in Eslohe-Niedersalway. An den Listersee bin ich mitgefahren, in einem Körbchen an der Lenkstange des Fahrrads von meinem Vater. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass mir das Körbchen irgendwann zu eng wurde, vor allem an den Beinen, die bei mir insbesondere an den Waden stärker ausgebildet waren. Danach hat mein Vater einen anderen Kindersitz auf die Stange seines Miele Rades montiert, eine schwarze Schale wie ein Treckersitz und mit Fußrasten an der Gabel. Nun konnte ich auch nach vorne schauen, und meine Waden konnte so dick werden, wie sie wollten. Mit dem Fahrrad sind wir auch nach Gerlingen zu meiner Tante Luzie gefahren, in die Kirche nach Wenden und auch zu anderen Orten, die ich nicht mehr erinnere. Als wir dann drei Kinder waren, war auch die Fahrradzeit vorbei, auch weil mein Vater sich ein Moped gekauft hatte, eine grüne NSU Quickly, aber dazu an anderer Stelle mehr.
Geschwister
Fünf lange Jahre besaß ich die Aufmerksamkeit meiner Eltern für mich allein, dann kam mein Bruder Hans-Peter zur Welt. Und noch einmal 1 ½ Jahr später meine Schwester Ulrike, die als zweiten Namen den ihrer Mutter Maria bekam. Damit wurde unsere Familie noch einmal neu aufgemischt. Als mein Bruder geboren wurde, gab ich mein Kinderbett ab, in dem ich immer in der Nähe meiner Eltern geschlafen habe, den mit einem blauen Stoff ausgekleideten geliebten Käfig. Und ich zog um, in das Schlafzimmer meiner Oma, in das Bett, in dem schon ihr Mann mehr als zwanzig Jahre vorher geschlafen hatte. Ein Ungetüm von einem Bett, schwarz gestrichen, mit hohen Kopf- und Fußteilen und auch einem hohen Einstieg. Der Sprungfederrahmen war zwar etwas erlahmt, aber für ein kindliches Leichtgewicht reichte er noch aus. Die Matratze bestand aus Seegras, mit einem rot-gelb gemusterten Bezug und betonten, wulstigen Ränder, und sie war sehr hart, besser gesagt, durchgelegen. Einen Kopfkeil hatte ich nun auch, und eine riesige Decke mit schweren Federn, genau wie das Kopfkissen, unter der ich Fünfjähriger fast verschwand.
Mein Bruder war kein einfaches Kind, weil er immer wieder versuchte, seinen Kopf durchzusetzen. Er war, wie meine Mutter es nannte, ein Dickkopf. „Und das hat er genau wie sein Patenonkel Johann“. Manches Mal, wenn er versucht hatte, sich gegen alle Aufforderungen und Anordnungen aufzulehnen, ganz gleich ob sie sinnvoll waren oder nicht, schickte ihn meine Mutter in die „Brummeecke“. Das war eine Zimmerecke in unserer kleinen Küche neben dem Herd, wo vorher der Wassereimer gestanden hatte. Dort blieb er, das Gesicht zur Wand, und wenn meine Mutter ihn fragte: „Willst du wieder lieb sein?“ antwortete er oft: „Nein!“ und blieb dort stehen. Irgendwann drehte er sich um und sagte: „Jetzt ja.“ Und damit war es wieder gut. Seine Paten waren Tante Luzie und Onkel Johann, der nebenan wohnte und fast täglich bei uns vorbeikam, insbesondere, wenn er Heu für seine Kuh holte. Dann blieb er in unserer Küche sitzen, typisch für ihn in einer Haltung, bei der er vorgebeugt den linken Ellenbogen auf sein Knie stützte und mit der rechten Hand sein Knie fasste. Zwischen seinen Beinen stand die obligatorische Flasche Bier. Er konnte meinen Bruder regelrecht wütend machen, wenn er sagte: „Du bist ein Stinkmann“. Mein Bruder verneinte dies zunächst, dann wurde er wütend und ging auf seinen Patenonkel los. Der, ein Koloss von einem Mann, Lokschmied von Beruf, nahm ihn dann und rieb ihm mit seinem starken Bart im Gesicht, bis mein Bruder weinte. Auch mit mir hat er das gerne gemacht, ich weiß also, wie sich das anfühlt, vor allem, wenn man dem hilflos ausgesetzt ist. Die intervenierenden Worte meiner Mutter ließen ihn kalt und auf meinen Vater gab er ohnehin nichts. Und die Oma, seine Mutter, ließ ihn auch machen. Wenn mein Bruder dann mit rotgescheuertem Gesicht sich aus seinen Händen befreit hatte, kam die trotzige Antwort: „Kein Stinkmann“. Seine Patentante Luzie wohnte in Wenden und abgesehen von den Besuchen mit dem Palmenbesen hat er von ihr auch nicht viel gehabt. Unsere Tante Luzie war bestrebt, ihr Leben zwischen einer verwöhnten Tochter, einem missmutigen Mann, ihrer krankhaften Körperfülle und offenen Beinen zu meistern, was ihr beklemmender Weise nie richtig gelungen ist.
Als achtzehn Monate nach meinem Bruder meine Schwester geboren wurde, war auch seine Zeit in dem Kinderbett im Schlafzimmer der Eltern vorüber. Für ihn kauften meine Eltern ein eigenes, bereits gebrauchtes Kinderbett. Anders als mein Bett, dass ein Schreiner aus unserem Ort gefertigt hatte, besaß dieses Bettchen eine Klappe an der Seite, mit der das Gitter heruntergelassen werden konnte. So hatte die Mutter einen leichteren Zugriff, aber auch das Kind konnte, sobald es zu laufen verstand, selbst aus dem Bett steigen. Dieses Kinderbett wurde nun quer zu den Fußenden der Ehebetten der Oma aufgestellt, und mein Bruder wohnte von da an fünfzehn Jahre lang mit mir zusammen auf einem Zimmer, auch später im neuen Haus. Meine Mutter übergab mir viel Verantwortung für meinen Bruder, ich kümmerte mich abends um ihn, wenn er ins Bett gebracht wurde. Irgendwann sollte ich auch zur selben Zeit wie er in mein Bettungetüm steigen, und das bedeutet auch: Licht aus und schlafen, wo ich doch so gerne noch gelesen hätte.
Wann es das erste Mal war, weiß ich nicht mehr, aber ich habe das Bild noch sehr gut vor Augen. Mein Bruder stand in seinem Kinderbett, schaute über das Fußteil meines Bettes und bat mich: „Erzähl‘ mir ein Märchen“. Das habe ich getan, kannte ich doch von meinem Märchenbuch sehr viele der Erzählungen und gab sie verkürzt wieder. Und er schlief ruhig ein. Am nächsten Abend das Gleiche. „Erzähl‘ mir ein Märchen“. Und wieder erzählte ich. Irgendwann hatte ich alle Geschichten, die ich kannte, ihm erzählt. Eine Zeitlang konnte ich sie wiederholen, aber dann sagte er einfach: „Kenn‘ ich schon. Eine neue“. Was sollte ich machen? Ich erfand einfach eine aus den Versatzstücken, die ich aus den Märchen kannte, und alle Geschichten gingen gut aus. Und mein Bruder schlief, ich meistens nicht, weil mein Kopf so schnell nicht abschalten konnte. Das ging über Monate, gefühlt ein Jahr. Immer wieder: „Erzähl‘ mir ein Märchen“.
Zu meinem Leidwesen sollte ich auch immer wieder mit ihm spielen. Aber was kann denn ein so kleines Kind schon spielen? Und dann mit diesem Dickkopf! Nun, ich habe immer wieder mal mit ihm gespielt, seine Spiele und mit seinen Spielsachen, wie ein Bär, der auf allen Vieren stand und auf Rollen gezogen werden konnte oder mit seinem Oldtimer Auto, das mit Batterie angetrieben wurde und aus dessen Kühler kleine Rauchwölkchen entströmten, wenn man Speiseöl in einen Tank füllte. Dadurch wurden aber auch die Batterien schnell entleert. Und mein Bruder bekam schon sehr früh ein eigenes Schaukelpferd, einen Apfelschimmel aus massivem Holz.
Und anders als ich erhielt er auch sein Paar Ski, die ich so sehnsüchtig Jahr für Jahr vergeblich erwartet hatte.
Da ich schon als kleines Kind gerne und auch viel gegessen habe, wartete ich, ob mein Bruder auch alles, was meine Mutter ihm zubereitete, aß. Wenn er seinen Bananenbrei, zerdrückt und manchmal mit Zucker „aufgewertet“ oder den geriebenen Apfel nicht mehr mochte, wartete ich und vertilgte mit Vergnügen den Rest.
Meine Schwester kam wohl etwas unerwartet, gerade mal 1 ½ Jahr nach meinem Bruder auf die Welt, als dieser selbst noch ein Kleinkind war. Sie war bei ihrer Geburt sehr klein und wog gerade mal gut zwei Kilo. Offensichtlich hatte meine Mutter, wie man bei uns sagte, „nichts zuzusetzen“, das heißt die Ernährung meines Bruders – meine Mutter stillte ihre Kinder so lange wie es ging – und die ungebremsten Anforderungen in Haus, Garten und Feld gerade über den Sommer hin, hatten wohl sehr gezehrt. Dies hatte zur Folge, dass sich meine Eltern – auch mein Vater, der nun auch ein Mädchen hatte – intensiv um sie kümmerten. Das sollte nicht ohne Folgen bleiben, denn meine Schwester wurde „verwöhnt“, sie bekam häufig ihren Willen, zog ihren Bruder an den Haaren und konnte sehr zänkisch sein. Mein Vater sagte wiederkehrend: „Unsere Ulrike ist eine Hexe“. Das alles wäre für mich ja noch zu ertragen gewesen, wenn sie nicht unter dem besonderen Protektorat unserer Großtante Lina gestanden hätte. Meine Schwester wusste immer genau, wie sie mich ärgern konnte und wenn ich mich wehrte, lief sie zur Tante Lina, die sofort die Tür verriegelte und mich dann beschimpfte: „Lott dat klëine Mäddchen, du aaler Stüergel“ – „Lass das kleine Mädchen, du alter Stürgel“ (ein von ihr mir gegenüber oft verwendetes Schimpfwort, was so viel wie Tölpel meinte). Wenn ich dann wutentbrannt und hilflos vor der verschlossenen Tür stand, hörte ich, wie sie zärtlich mit meiner Schwester sprach.
Mein Bruder spielte gerne in der Nähe meiner Mutter, auch wenn sie in der Waschküche arbeitete. In einem Augenblick, als sie ihn nicht beobachten konnte, vielleicht, weil sie Wäsche auf den Hof getragen hatte, drehte mein Bruder den Ablaufhahn des Waschkessels auf, sodass die kochend-heiße Lauge über seine Füße lief. Als er laut weinte, ja brüllte, kam meine Mutter dazu. Sie nahm ihn und trug ihn schnell in die Küche. Ich stand daneben, als sie ihm die Strümpfe aus- und damit die verbrühte Haut abzog. Mein Bruder hat dann über eine lange Zeit immer wieder Umschläge mit Brandsalbe erhalten, an eine ärztliche Betreuung kann ich mich nicht erinnern. Anders war es mit meiner Schwester. Als sie unsere Treppe im Haus herunterging, blieb sie irgendwie hängen, fiel herunter und schlug mit der Stirn ausgerechnet auf die einzige scharfkantige Aluschiene an einer der Stufen. Die Haut platzte auf, ich hatte das Gefühl, die halbe Stirn war offen. Meine Mutter, die auf ihr Weinen hin dazukam, sah das, nahm sie und presste ein Handtuch auf die Wunde. Es war ein glücklicher Zufall, dass gerade rechtzeitig ein Bus ins Dorf kam, der nach Olpe fuhr. So hat sie meine Schwester ins Krankenhaus getragen, wo die Wunde genäht wurde. Als sie wieder nach Hause kam, trug meine Schwester einen eigentümlichen Verband an der Stirn, der einem unter Mull versteckten Horn glich. Die Wunde ist sehr schlecht verheilt. Mein Vater sagte damals: „Die haben eine alte Singer (Nähmaschine) genommen beim Nähen“.
Die Tochter war insbesondere für den Vater etwas ganz Besonderes. So bekam sie auch immer wieder adrette Kleidchen, die meine Tante Hannelore über ihre Stelle bei der Kindermodenfirma Straube in Olpe besorgte. Es war auch die Zeit, in der kleine und große Mädchen einen Petticoat trugen, was meinen Vater zur Verballhornung „Pettiköter“ animierte. Auch meine Schwester hatte unter ihren Kleidchen einen gestärkten Petticoat, was meine Mutter auch gerne sah. Wenn wir dann sonntags spazieren gingen, bekam sie immer ein frisches Kleidchen an. Was sie allerdings nicht daran hinderte, auch abseits der Wege zu laufen, sodass Grasflecken oder Brombeerreste die Regel waren. Und an die Hand nehmen ließ sie sich nie, erst recht nicht von mir.
Prügelstrafe
Es war zu meiner Kinderzeit durchaus noch üblich, ja fast die Norm, Kinder für ihre tatsächlichen oder vermeintlichen Untaten durch Prügel zu bestrafen. Das betraf in erster Linie die Jungen, an ein geprügeltes Mädchen kann ich mich nicht erinnern. Dabei waren weder die Väter, manchmal auch die Mütter, aber auch die Lehrer nicht wählerisch. Ich erinnere mich daran, dass ein Junge erzählte, dass er immer von seinem Vater Prügel auf den Hintern bekam, und zwar mit dessen Gürtel. Andere hatten einen Stock zu Hause stehen, der einzig und allein zur Züchtigung diente.
Ich selbst bin so gut wie ohne handgreifliche Strafen meiner Eltern aufgewachsen und kann mich nur an zwei Situationen erinnern. Den Grund weiß ich nicht mehr, aber ich muss wohl meine Mutter mit meinem Verhalten oder Widerworten so weit getrieben haben, dass sie den Kochlöffel aus der Schublade holte und mir „den Hintern versohlen“ wollte. Ich lief aus der Küche in den Flur, meine Mutter hinter mir her. Als sie ausholte, um mir einen Schlag zu versetzen, befreite ich mich aus ihrem Griff und sie schlug statt mich mit dem Holzlöffel an das Treppengeländer, woraufhin der Löffel abbrach. Als sie nur noch einen Überrest des Stiels in der Hand hielt und sie überrascht, verdutzt ausschaute, musste ich lachen. Sie selbst fand das nicht lustig und drohte mir nur: „Warte, wenn du gleich in die Küche kommst“. Ich verschanzte mich für eine kurze Zeit in Omas Schlafzimmer und ging dann, als wäre nichts gewesen, in die Küche zurück. Die Prügel habe ich nie bekommen.
Meinem Vater ist einmal die „Hand ausgerutscht“, er hat mir den nassen Waschlappen um die Ohren geschlagen, als er mich badete. Und das kam so: beim Rickesen Bauer war ein Junge in den Ferien zu Besuch, der auch weitläufig über Valberts Josef mit uns verwandt war. Und an diesem Tag, es war ein Samstag, wollte Egon, der jüngste der Bauernsöhne, aber schon lange erwachsen, mit dem alten Deutz-Trecker im Hauberg Holz holen. Dieser grüne 12-PS Trecker mit dem kleinen Motorblock, der langen Welle für die Lenkung und den roten Speichenrädern war damals der erste und damit auch der älteste Trecker im Dorf. Egon fuhr also in den Hauberg, der Junge – ich meine, er hätte Heinz geheißen – und ich saßen auf den Beifahrersitzen über den Rädern. Dort angekommen dauerte es lange, bis Egon das Holz aufgeladen hatte, was uns aber nicht störte, denn wir durften den Trecker mit Anhänger immer das nächste Stück weiterfahren. Am späten Nachmittag begann es zu regnen, aber da es noch warm war, machte uns das nicht viel aus. Es war mittlerweile dunkel geworden, als Egon sich bequemte, nach Hause zu fahren. Als wir an einem Waldstück mit Farnkraut vorbeikamen, streckte ich die Hand aus, um die Blätter von einem Farnwedel abzustreifen. Schmerzhaft musste ich dann feststellen, dass die Stängel des Farns hart und scharfkantig waren, sie schnitten mir nämlich tiefe Wunden in die Finger, die auch ordentlich bluteten. Vielleicht sah es auch nur so gefährlich aus, da meine Hände ja auch vom Regen nass waren. Es war nach 9 Uhr, als ich dann zu Hause ankam, und mein Vater mich zornig erwartete.
Mein Vater war nämlich mit uns drei Kindern allein zu Hause, da sich meine Mutter weit weg bei ihrem Bruder, besser ihrer Schwägerin in Niedersalway, aufhielt, da diese gerade von einem weiteren Jungen entbunden wurde. Mein Vater schimpfte sehr zornig, wie ich ihn bis dahin nicht erfahren hatte, mit mir, betonte dabei immer wieder, dass er ja überhaupt nicht wusste, wo ich mich aufhielt, und als es dunkel geworden und ich noch immer nicht nach Hause gekommen war, hatte er sich große Sorgen gemacht. Einmal allein mit den Kindern, und dann gleich sowas…
Da es Samstag war, und das hieß auch immer Badetag, sollte und wollte ich sofort in die Badewanne. Baden ist mein Leben lang ein besonderes Vergnügen für mich gewesen, aber mein Vater ließ mir keine Zeit, mich selbst zu waschen, sondern nahm den Waschlappen und begann mich abzuseifen. Und im Schimpfen schlug er mir auch einige Male den nassen Waschlappen um die Ohren. Dann rubbelte er mich ganz schnell trocken und schickte mich ohne Essen ins Bett. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, da ich merkte, dass mein Vater sich wirklich Sorgen gemacht hatte und er eher aus Hilflosigkeit im Zorn mich schlug, und wirklich weh getan hat es auch nicht.
Auch in der Schule gab es die Prügelstrafe noch. Gefürchtet war der damalige Schulleiter Karl Kattner, der Jungen auch mit einem Zeigestock auf den Hintern schlug, und das nicht nur einmal. Mädchen bekamen von ihm auch einem Schlag in die offene Hand, allerdings nicht mit der gleichen Kraft, wie bei den Jungen. Wir hatten immer große Angst, wenn er einen Anlass sah, uns zu strafen. Zwar gab es nicht zu jeder Gelegenheit Prügel, aber an den Ohren ziehen oder in die Backe kneifen schmerzte ja auch. An einem Rosenmontag im dritten Schuljahr hatte mich das Mädchen, das „Aufsicht führen“ sollte und jeden der durch Reden die absolute Schweigepflicht durchbrach, „schwätzen“ hieß es immer, meldete, indem sie den Namen an die Tafel schrieb. Ich habe oft an der Tafel gestanden. An diesem Rosenmontag waren wir zu dritt oder viert, die sich nicht an das verordnete Schweigen gehalten hatten. Als der Lehrer Kattner nun in die Klasse kam und die Namen an der Tafel sah, sprach er nur: „Nach vorne kommen!“ Diesen Ton kannten wir und er versprach nichts Gutes. Zögernd gingen wir nach vorne, aber diesmal holte er nicht den Zeigestock, sondern nahm die bunte Kreide aus der Pultschublade – und malte jeden von uns mit der bunten Kreide ins Gesicht, ein wenig wie ein Clown, aber Hauptsache bunt. Und dann lachte er laut, zeigte auf uns und sagte: „Die bleibt drauf. Damit geht ihr nach Hause“. Der Prügel waren wir entkommen, nicht aber den Blicken der Erwachsenen, die uns so aus der Schule kommen sahen, und nicht den Fragen zu Hause. „Schon wieder...“, seufzte meine Mutter.
Auch mein Klassenlehrer Hähner hat einmal Tonis mit dem Stock verprügelt, und das war wirklich ein Verprügeln, und den Anlass hatte ich geliefert, was ich an anderer Stelle im Kapitel Schule ausführe. Auch Werner bekam von ihm einmal einen Hieb, ob eine Ohrfeige oder einen auf den Hintern, weiß ich nicht mehr, jedenfalls stand Werner, den wir immer Büffel nannten, auf, brüllte ihn an und sagte: „Das sag ich meinem Papa, und der kommt zu dir!“ Ich weiß noch, dass Paul Hähner etwas überrascht bis hilflos dastand und dann einfach sagte: „Soll er. Ich bin hier“. Werner ist dann aus dem Unterricht nach Hause gelaufen.
Spielen
Spielen im Haus und in der Nachbarschaft
Mein erster Spielgefährte hieß Josef. Es war ein Gummischaf, ein Quietschtier, dessen Stimme erst erbärmlich leise, dann überhaupt nicht mehr funktionierte. Der runde Kopf im Kindchenschema mit einem Lächeln war zur Seite gedreht, die Vorderbeine standen nebeneinander als eine Einheit, während die beiden Hinterläufe gespreizt waren und dem Gummitier einen festen Stand gaben. Mit der Zeit war der wohl mal weiße Gummi des Körpers hellgrün bis braun geworden. Vielleicht hatte auch mein Kinderspeichel beim Herumkauen seinen Teil dazu beigetragen. Obwohl ihn meine Mutter regelmäßig mit Kernseife abwusch, behielt er seinen eigenartig säuerlichen Geruch bei.
Josef habe ich ihn selbst genannt. Warum weiß ich nicht. Aber ich habe schon früh den Dingen um mich herum einen Namen gegeben. So hieß mein Kinderwagen „Hanomag“ und ich nannte mich selbst „Ena“. Keine Ahnung wie ich dazu kam, gibt es doch keine erkennbare Nähe zu meinem Namen oder zum Wort „Ich“. Josef, das freundlich lächelnde Gummischaf, blieb lange mein Spielgefährte, der später auch auf dem Tender meiner Uhrwerkseisenbahn immer im Kreis herumfahren musste.
Nur schwach kann ich mich an einen Teddybären erinnern. Ich meine, er hätte ein gelbes Fell gehabt und war mit Stroh oder Holzwolle gefüllt. Über Drahtschlaufen waren die Arme und Beine am Körper befestigt und ließen sich in einem geringen Maße so auch bewegen. Was allerdings auch dazu führte, dass ich sie immer wieder einmal beim Spielen in der Hand hielt und mein Vater sie mit der Flachzange reparieren musste.
Meine Mutter hatte mir auch ihre Puppe und den Puppenwagen zum Spielen gegeben, aber beides war nicht das Richtige für mich. Sie hatte diese Spielsachen aus besseren Zeiten herübergerettet und sie waren ihr sehr wertvoll. Immerhin hatte diese ihr 1936 von Nazis erschlagener Vater geschenkt, als sie 9 oder 10 Jahre alt war. Der grüne Puppenwagen ließ sich auf großen und dünnen Speichenrädern bewegen, die Seitenflächen waren mit grüner Pappe bespannt. Ließ sich der Puppenwagen auch in typischen Jungenspielen nutzen, auch wenn ich mich nicht hineinsetzen durfte, die Puppe mochte ich überhaupt nicht. Sie zwinkerte zwar mit ihren Schlafaugen, wenn man sie schüttelte – was ich wiederum gerne tat – aber ihr Porzellangesicht blieb für mich immer sonderbar leer. Was mich aber am meisten abstieß und die Erinnerung daran heute noch Widerwillen erweckt, waren ihre langen schwarzen Zöpfe aus echtem Menschenhaar, das sich nach über zwanzig Jahren hart, unangenehm bis eklig anfühlte.
Gerne hingegen erinnere ich mich an den blanken, gebohnerten Fußboden in unserer kleinen, immer warmen Küche. Wiederkehrend wurde nach einigen Jahren der Linoleumboden erneuert. Tatsächlich war es kein echtes Linoleum, das für uns unbezahlbar blieb, sondern ein billigerer, auf Teerpappe basierender und bunt bedruckter, glänzender Belag, Balatum genannt. Solange er neu war, strömte er einen eigenartigen, wohltuenden Geruch aus, den ich heute noch mit „neu“ und „sich was gönnen“ assoziiere. Besonders schön war es, wenn ich zum Leidwesen meiner Mutter und unter heftigen Verbotsworten dennoch auf dem Rücken dort hin und her rutschte, mich mit den Füßen von der Wand oder einem Schrank abstieß und quer durch den Raum glitt. Und je besser gebohnert war, umso schöner war dies. Dass ich dabei auch das Bohnerwachs in meinen Pullover rieb, sah ich – erst einmal – nicht ein.
Der Boden unserer Küche war also mein Lieblingsplatz, auf dem ich saß und spielte. Wer immer uns die große runde Maggi-Dose geschenkt hatte, weiß ich nicht, aber für mich war es die Schatztruhe, in der ich die bleichen Margarinefiguren und die Autos aus Wundertüten oder Werbegeschenken aufbewahrte. Gestalten aus Märchen, Zwerge, Tiere, Häuser und Zäune, eher etwas plastischere Silhouetten in gelblichweißem Kunststoff wurden Teil meiner fantastischen Geschichten, die ich mir selbst beim Spielen erzählte. Die kleinen Autos aus Bakelit mit leicht brechenden Achsen und in Kastenformen der zwanziger und dreißiger Jahre, wurden ohne Räder bewegt. Nachdem mehrfach Figuren, die ich in der ganzen Küche verteilt hatte, durch Unachtsamkeit zertreten worden waren, musste ich auf dem Tisch spielen, was auch ging, aber bei weitem nicht so schön war.
Verstecken
Besonderen Reiz übten schon früh – und ich schätze, seitdem ich mich durch Kriechen vorwärtsbewegen konnte – Verstecke in Küche und Haus auf mich aus. Eins davon war unser Spültisch. Dadurch, dass er zwischen dem Herd und dem Küchenschrank stand, bildete er für mich eine Höhle, ein kleines eigenes und wegen der Nähe zum Herd auch warmes Zimmer im Zimmer. Dort saß ich oft und beobachtete, was sich in der Küche tat. Besonders schön war es, wenn ich in den Auszug eine leichte Wolldecke klemmen konnte und damit für die Außenwelt verschwunden war. Manchmal saß ich unter dem Esstisch oder unter dem kleinen Radiotischchen, das in der Ecke neben dem Sofa stand. Dorthin kam ich nur kriechend über den „Umweg“ unter dem Esstisch her.
Wenn ich gerne ganz ungestört sein wollte, kroch ich einfach unter Omas Bett. Der besondere Reiz war hier, dass sich unter dem Bett das „Wärmeloch“ befand, eine kreisrunde tellergroße Öffnung in der Decke der darunterliegenden Küche. Hier wurde Wärme aus der großen Küche ins Schlafzimmer geleitet, sodass es im Winter – anders als in dem zur Nordostseite gelegenen Schlafzimmer meiner Eltern, wo ich schlief – hier ein wenig wärmer war. Allerdings zog auch der Küchendunst, der reichlich von Schmalz, Speck, Zwiebeln, Kohl und Kartoffeln geschwängert war, ins Schlafzimmer. So entstand hier eine seltsame Geruchsmischung aus alten Betten mit Seegrasmatratzen, dem Dunst der alten Kleider im Schrank, den Ausdünstungen der hier Schlafenden und den Küchengerüchen. Trotz des täglichen Lüftens konnte die Luft nie so ganz frisch werden. Da aber das alte Haus noch viele andere Gerüche zu bieten hatte, fiel das nicht so sehr ins Gewicht. Und wenn ich unter dem Bett auf den alten Eichendielen lag, über mir die Matratzen und Sprungfedern, unter mir der unvermeidliche Staub, kribbelte es mir in der Nase, aber ich war zufrieden in meiner eigenen Behausung, wo mich niemand fand, nicht einmal vermutete, auch weil ich sorgsam Staub und Flusen von meiner Kleidung zupfte.
Was mich aber besonders reizte, war, dass ich die Gespräche, die in der Küche darunter geführt wurden, ungestört belauschen konnte. Und nicht alles war auch für meine Ohren bestimmt, was noch einmal besonders reizvoll war. Später habe ich auch einen kleinen Taschenspiegel aus einer Wundertüte vom Schützenfest benutzt, um zu beobachten, was sich dort in der Küche tat. Noch später, als mein Onkel Norbert mit seiner Frau dort einzog, nagelte er mit einer Hartfaserplatte das Loch im Schlafzimmer zu. Doch vergebens. Nicht lange danach habe ich – ganz Junge vom Dorf - mit Zange und Schraubenzieher das Hindernis wieder abgebaut. Zur Tarnung blieb die nun nicht mehr befestigte Platte auf dem Loch liegen. Das hat niemand erfahren.
Noch eine Zeit später habe ich tollkühn, wie ich meinte, einmal den Teddybären meiner Schwester durch das Loch bis auf den darunter stehenden Küchenschrank gesenkt und mit einem Faden wie bei einer Marionette den Arm bewegt. Meine kleine Cousine Evelyn, das jüngste der Kinder von Onkel Norbert und Tante Hannelore, damals vielleicht ein Jahr alt, war ganz entsetzt und begann zu weinen, während sie zu dem Bären zeigte. Da habe ich ganz schnell das Plüschtier wieder hochgezogen, bevor meine Tante ihn sehen konnte, bin schnell zurückgekrochen, habe den Staub und die Flusen vom Pullover abgeschüttelt und bin leise in unsere Küche zurückgegangen. Mein kleines Geheimnis ist bis heute bewahrt geblieben. Auch Evelyn hat es nie erfahren. Sie ist vor einigen Jahren jung gestorben.
Noch tiefer zog ich mich in die Kleiderschränke meiner Oma zurück. Dort im tiefen Dunkel hinter all den alten Kleidungsstücken, die auch in den dreißiger Jahren bessere Zeiten gesehen hatten, und dem beißend-muffigen Geruch der Mottenkugeln verkroch ich mich für eine gefühlt lange Zeit. Und niemand fand mich, auch wenn sie das ganze Haus abgesucht haben. Irgendwann stand ich mit unschuldigem Blick wieder in der Küche. Aber niemals habe ich gesagt, wo ich gewesen war. „Weg“, habe ich auf die Frage geantwortet, wo ich die ganze Zeit gewesen wäre.
Eine sommerliche Variante des Sich-Versteckens bestand später darin. dass ich aus Heulaken, der dreieckigen Wehrmachtszeltplane meines Vaters und Stöcken, die an vielen Stellen auf unserem Grundstück herumlagen, auf der Wiese mein Zelt gebaut habe. Der eigentliche Spielreiz bestand im Bauen selbst, im Zelt verweilen wurde schnell langweilig, da ja alle anderen wissen konnten, wo ich war.
Ich habe viel alleingespielt. Meine Eltern haben mich zu Weihnachten mit Spielzeug versorgt, aber nicht immer konnte ich damit über längere Zeit etwas anfangen, wie bei einer – ich nenne es einmal so – eine Art Achteroder Grubenbahn, bei der ein Wagen mit einem von einem Uhrwerk betriebenen Turm heraufgezogen wurde und dann über drei Wippen wieder nach unten rollte. Das wurde schnell langweilig. Ganz anders war hingegen ein wirklich großer roter LKW in der Art der amerikanischen Pick-ups, der die Länge meiner Arme hatte. Dieses rote Auto hatte, wie alle Fahrzeuge damals, die eigenständig fahren sollten, ein Uhrfederwerk, musste also aufgezogen werden. Aber das Besondere an diesem LKW war, dass er nicht nur eine kippbare Ladefläche hatte, sondern auch eine echte Gangschaltung: zwei Gänge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten vorwärts und einen Rückwärtsgang. Mit ihm habe ich die Holzbauklötze und die Bilderwürfel durch die Küche und das Treppenhaus transportiert. Und im Sommer auf dem Feld auch Heu eingefahren. Ich glaube, mein Vater hat sich damit über mich einen eigenen Jungentraum erfüllt. Das sollte später bei der Modelleisenbahn noch einmal der Fall sein.
Die Bilderwürfel mit den Märchen- und Tiermotiven erfuhren schnell eine Zweckentfremdung, waren sie doch hervorragend geeignet als Bausteine und konnten den Baukasten mit den kantigen Holzbausteinen, den Brückenbögen, den Säulen und den Fenstern mit den roten Papierscheiben ergänzen. Erst später, nachdem ich bei Onkel Erwin und Tante Luzie mit Legosteinen gespielt habe, bekam ich auch einen eigenen Bausatz, mit dem ich unermüdlich Häuser, vor allem Geschäfte wie im Dorf, nachbaute. Aber das war später.
Gut erinnern kann ich mich noch an meine erste Eisenbahn. Es war Heiligabend, und das Christkind war gerade wieder durch das Fenster weitergeflogen, wie mein Vater sagte, da fuhr in einem kleinen Kreis auf Aluminiumschienen eine Lok mit Tender und einem Personenwagen immer rundherum. Vier Schienen, die in Kreisform zusammengesteckt wurden, eine Lok mit Tender und ein Personenwagen mit den bekannten Balkonen vorne und hinten, ganz so, wie ich sie noch im Sommer bei einem Besuch bei meiner Tante Luzie in Gerlingen, die unmittelbar an der Bahnlinie wohnte, gesehen hatte.
Und jetzt sind wir wieder bei Josef, meinem Schaf, das als einziger Passagier im Tender herumfahren musste, bis ich den Schlüssel für das Federwerk verloren hatte und ihn – erst einmal – nicht wiederfand.
Noch früher habe ich in einem Schaukelhahn gesessen, ja richtig, kein Schaukelpferd, sondern ein Hahn. Es war ein ziemlich enges Schaukelstühlchen und vorne, wo andere einen Pferdekopf hatten, befand sich bei meinem Schaukeltier ein bunter Hahnenkopf. Meine Eltern hatten das Gerät, das ich ehrlich gesagt nie richtig mochte, bei Nachbarn, bei Lisenianz, ausgeliehen. Hildegard, die ein Jahr älter war als ich, passte nicht mehr in das Schaukeltier und ihre jüngere Schwester Hedwig, war noch ein Säugling. Erst mein Bruder bekam später ein Vollholzschaukelpferd, einen Apfelschimmel.
Auch draußen habe ich viel allein gespielt, ohne dass ich mich dabei alleingelassen fühlte. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich – vielleicht 9 oder 10 Jahre alt – auf unserem Kuhwagen hinter den Bracken lag und darüber nachdachte, wer ich wohl wäre, wenn mein Vater tatsächlich, wie er mir erzählt hatte, im Krieg wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet worden wäre. Und was wäre ich, wenn ich nicht geboren wäre, also auch in Paradoxien versunken. Und in dieser Zeit habe ich auch erstmalig meine Denkregeln entwickelt, die mich bis heut prägen: „Warum ist das so? – Wozu ist das so? Und könnte es nicht auch ganz anders sein?“ Das entsprach dem, was meine Oma an mir überhaupt nicht leiden konnte: ich war immer neugierig, wollte alles wissen und habe, was auch heute noch für mich gilt, meist selbst nach Erklärungen gesucht, gelesen, was es zu lesen gab, mir meine eigenen Gedanken gemacht und meine Welt aufgebaut. „Sej nit so vöarwitzich – Sei nicht so vorwitzig“, sagte Oma immer.
Nun habe ich nicht nur allein gespielt. Nachdem ich den kleinen Kreis der Küche verlassen konnte, fand ich natürlich auch andere Kinder vor, mit denen ich spielte. Da war unser gleichaltriger Nachbarjunge Walter-Ulrich, der von seinem Siegerländer Vater eine geschmiedete Sandschüppe bekommen hatte. Unter der großen Linde neben der Alten Schule, wo die Bohns wohnten, konnte er endlos in dem feinen Staub und mit Wasser spielen, Häuser bauen mit Steinen, die wir suchten und Mörtel aus Staub und Wasser. Ich fand das aber nicht lange interessant.
Anders war es dann – ich war wohl vier oder fünf Jahre alt – mit Baslers Günther, der ein Jahr älter war als ich, ebenfalls ein Nachbarjunge. Seine Mutter stammte aus Altenhof, sein Vater, ein Schneider, der mir auch mal einen Mantel genäht hatte, kam von weit her, wie ich meinte. Er sprach so anders, aber nicht schlesisch. Günther hatte auch eine viel ältere Schwester Hannelore, die ich als ein dunkelhaariges, aber immer blasses Mädchen in Erinnerung habe. So ähnlich, aber viel schöner, vermutete ich, musste Schneewittchen ausgesehen haben.
Was und womit wir gespielt haben, weiß ich nicht mehr, aber wir waren sehr viel zusammen und ich erinnere mich, dass es auch eine sehr emotionale Freundschaft war. Wir waren auch bei Baslers in der Wohnung, die ich immer als überheizt, blitzblank geputzt und vollgestellt in Erinnerung habe. Günther ist nach meiner Erinnerung nicht mehr in Altenhof eingeschult worden, da die Familie nach Wenden gezogen war. Nun war ich erst einmal wieder allein.
Als wir beide etwa zwanzig Jahre alt waren, haben wir wieder gemeinsam etwas unternommen, nämlich Musik gemacht mit unserer Band „Peacetrain“, aber das ist ein späteres Kapitel, bei dem auch ein anderer Freund aus Kindertagen wieder dabei war, Minches Manfred.
Zu Weihnachten hatte ich einmal einen Magirus LKW bekommen, den mit der runden Motorhaube, mit Plane und Anhänger und einem Warndreieck auf dem grünen Führerhaus. Dass dies damals noch ein Zeichen dafür war, dass der LKW einen Anhänger hinter sich herzog, wusste ich nicht, hatte ich auch noch nie gesehen, also habe ich das schnell entfernt. Ansonsten entsprach der LKW ganz unseren Jungenträumen, denn wir wollten alle „Solbachs Otto“ werden, der damals einen großen LKW mit Anhänger fuhr, einen grünen MAN, und damit Lohnfahrten unternahm. Wenn jemand im Dorf einen Wagen Sand zum Bauen brauchte, fuhr Otto zu den irgendwo liegenden Kiesgruben und brachte Sand, oder Steine oder was auch sonst noch transportiert werden musste. Einmal hat er – den Grund kenne ich nicht – sogar für uns Heu von der Wiese „Hinterm Kreuz“ geholt. Da durfte ich auch im Führerhaus sitzen, ein tolles Erlebnis und die ganze Welt vor mir.
Einen LKW beherrschen zu können war eben ein Traum, ein richtiger Jungentraum. Auch Berni hatte diesen Traum. Er war ein Jahr älter als ich. So spielten wir an der Böschung bei seinem Elternhaus unter dem Garten, „Solbachs Otto“. Wir haben uns oft gestritten, wer im Spiel „Otto“ sein durfte und wer nur „Hänns“, der Bruder von Otto war. Hänns war Obsthändler und fuhr einen alten blauen Vorkriegs Opel-Blitz, mit dem er Gemüse und Obst aus dem Rheinland holte und im Ort und auf den Dörfern vertrieb. Ich rieche noch heute die besonderen Abgase dieses kleinen blauen LKW mit Plane, denn er fuhr mit Gas, das in einer roten Flasche unter der Ladefläche befestigt war.
In der Nachbarschaft wohnte auch Wurmes Gerhard, zwei Jahre jünger als ich, dessen Leidenschaft das Schützenfest war. Wochenlang im Sommer spielte er Schützenfest, und wir mit ihm. Eine große runde Heringsdose aus dem Spargeschäft, die wir in dem kleinen verlandeten Weiher, der zur Abfallkippe mitten im Dorf geworden war, fanden, wurde mit einem Einmachgummi um die Hüfte gebunden und mit Holzknüppeln aus Schanzen als Schlegel geschlagen, an eine abgebrochene Bohnenstange wurde ein Heulaken als Fahne gebunden und schon marschierten wir durchs Dorf. Gerhard war musikalisch und kannte die Melodien, die unser Musikverein Lyra auf dem Marsch durch das Dorf spielte, und er konnte auch gut singen. Neben dem Lalala (das wir vor James Last kannten) hatten wir natürlich auch Texte wie: „Parademarsch, Parademarsch, der Lehrer hat ‘nen Knüppel im Arsch“ oder „das war Lüttchens wildgewordene Jagd“. Lüttchen war der körperlich klein gebliebene Schlimms Ferdi, der leidenschaftlich die kleine Trommel im Musikverein rührte. Und Lüttchen war Lützow, aber was eine wildverwegene Jagd war, wussten wir nicht. Daher haben wir auch „wildgewordene Jagd“ gesungen.