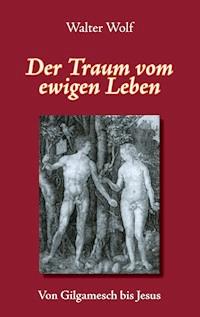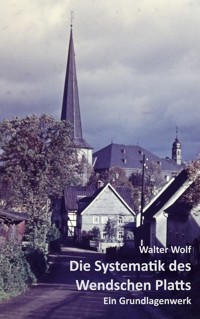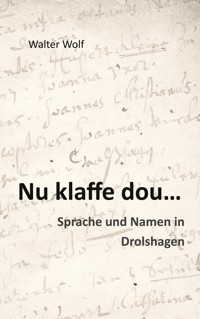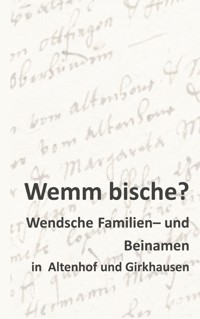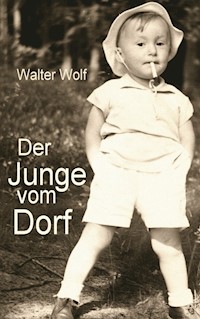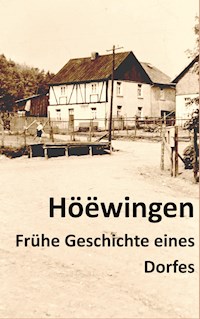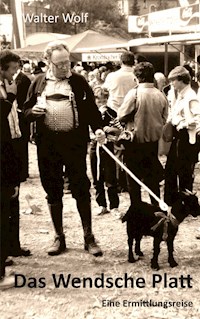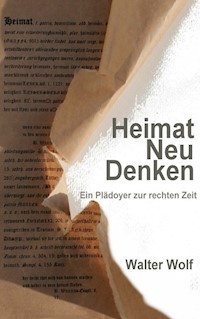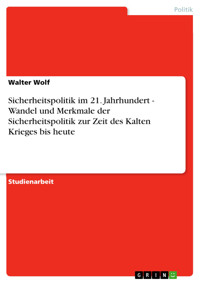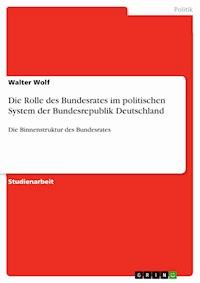Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sechzig Ortsnamen im Stadtgebiet Drolshagen werden vorgestellt und detailliert mit wissenschaftlichem Anspruch auf ihre geografische und sprachliche Herkunft erläutert, davon die Hälfte überhaupt erstmals Der Autor geht in seiner Analyse von der ältesten auffindbaren Bezeichnung aus, die er von der Sprache der Entstehungszeit her deutet. Dazu greift er auch auf den regionalen niederdeutschen Dialekt des Drolshagener Platt zurück, durch den manche Bezeichnung in Verbindung mit seiner ausgezeichneten Ortskenntnis sich erst schlüssig erklären lassen. Das Werk stellt die Namen aller heute noch existierenden Orte vor und erläutert zusätzlich exemplarisch weitere Ortsnamen von Siedlungsteilen, die in anderen Orten aufgegangen oder die wüstgefallen sind. Die theoretischen Abhandlungen zur Entstehung der Ortsnamen, ihre Systematik, die Analysemethode sowie eine Positionierung zu Ortsname und Identität runden die Darstellung ab. Trotz des wissenschaftlichen Anspruchs ist das Buch für jeden lesbar und verständlich. Wert legt der Verfasser auch darauf, dass seine Recherchen für weitere Untersuchungen und Positionierungen anschlussfähig bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich meiner Frau Dorothee, die mich nicht nur bei diesem Buch mit ihrer Kompetenz und Zuneigung unterstützt hat. Ohne sie und ihre Kenntnisse zum Drolshagener Platt wäre die Bezugnahme zu der Mundart nicht möglich gewesen. Ihr Wissen um das heimische Dialekt als Alltagssprache haben wesentlich zu den hier publizierten Erkenntnissen beigetragen
Autor:
Walter Wolf, Jahrgang 1951, Studium der Pädagogik, Soziologie, Psychologie und Katholischen Theologie; bis zum Ruhestand Bildungsarbeiter und Leiter von Bildungshäusern; 50 Jahre ehrenamtlich im sozialen, verbandlichen und kirchlichen Bereich, zuletzt als Geschäftsführer und Referent im Heimatverein für das Drolshagener Land.
Veröffentlichungen vor allem zu innovativen konzeptionellen Themen, u.a. bei der Bundeszentrale Politische Bildung und Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten; Diverse Fachartikel zu regionalen, politischen und historischen Themen.
Beratung, Begleitung und Coaching von kleinen Organisationen und großen Verbänden, vor allem im NGO-Bereich.
Letzte Veröffentlichungen bei Books on Demand
„HeimatNeuDenken – Ein Plädoyer zur rechten Zeit“ Norderstedt 2021
„Höëwingen - Eine Ermittlung zur Frühen Geschichte eines Dorfes“ Norderstedt 2021
„Das Wendsche Platt - Eine Ermittlungsreise zu den Quellen“ Norderstedt 2021
„Der Junge vom Dorf - Ein kulturhistorisches Experiment“ Norderstedt 2022
„Wemm bische - Wendsche Familien- und Beinamen“ Norderstedt 2023
„Nu klaffe dou - Sprache und Namen in Drolshagen“ Norderstedt 2024
Inhalt
Vorwort Bürgermeister
Ein Wort zuvor
Ortsnamen – eine Einführung
Ortstypen in Drolshagen
Namensbildung
Formen der Ortsnamen
Das Grundwort
Die Bestimmungswörter
Methodisches Vorgehen
Die Grundworte
Kategorie Grundwort ohne Bestimmungswort – Simplex
Kategorie -bracht
Kategorie -hausen
Kategorie -hagen
Kategorie -ingen
Kategorie -inghausen
Kategorie -micke
Kategorie -scheide
Kategorie -ohl / -sohl
Kategorie Schotten
Kategorie Landschaftliche Eigenheiten
Die Ortsnamen heutiger Siedlungen
Alperscheid
Benolpe
Berlinghausen
Beul
Bleche
Brachtpe
Breitehardt
Brink
Bruch
Bühren
Dirkingen
Drolshagen
Dumicke
Eichen
Eichenermühle
Eltge
Essinghausen
Fahrenschotten
Feldmannshof
Fohrt
Frenkhausen
Gelslingen
Germinghausen
Gipperich
Grünenthal
Halbhusten
Hammerteich
Heiderhof
Heimicke
Herpel
Hespecke
Husten
Hustert
Hützemert
Iseringhausen
Junkernhöh
Köbbinghausen
Kram
Lüdespert
Neuenhaus
Öhringhausen
Potzenhof
Scheda
Schlade
Schlenke
Schreibershof
Schürholz
Schützenbruch
Sendschotten
Siebringhausen
Stupperhof
Wegeringhausen
Wenkhausen
Wintersohl
Wormberg
Wüstungen und andere nicht mehr existierende Orte
Aldenfelde
Herrnscheid
Myddelenbleken
Niederndorp
Steupingen
Einige Anmerkungen zur wissenschaftlichen Erforschung der Ortsnamen
Ortsnamen und Identität
Literatur- und Quellenverzeichnis
Anmerkungen
Der Wert alter Ortsnamen
Ein Vorwort des Bürgermeisters der Stadt Drolshagen Uli Berghof
Manchmal hat es ein Ortsname nicht leicht. Das merke ich immer wieder, wenn ich erzähle, dass ich mit meiner Familie in Halbhusten lebe. Sofort folgen Schmunzeln oder Kommentare à la „Na, hoffentlich bleibt ihr gesund!“. Tatsächlich haben die Ortsnamen Husten und Halbhusten nichts mit Erkältungen zu tun – ihre Wurzeln reichen weit. So geht z. B. der Name Halbhusten auf Halfhusen im 15. Jahrhundert zurück. Damit waren vermutlich geteilte Höfe oder die dort lebenden Halbbauern (Halfbure) gemeint – und keineswegs das Wort Husten im Sinne des Hustens bei einer Erkältung.
Walter Wolf erforscht diese Hintergründe in seinem Buch „Die Ortsnamen in Drolshagen“ mit großer Akribie und wissenschaftlicher Präzision. Damit bringt er Licht in ein spannendes Kapitel unserer Heimatgeschichte und widerlegt volkstümliche Fehlinterpretationen.
Ortsnamen als Spiegel der Geschichte
Ortsnamen sind weit mehr als bloße Bezeichnungen auf einer Landkarte. Sie erzählen zum Beispiel von:
den Menschen, die hier vor Jahrhunderten siedelten,
der Sprache, die sie sprachen,
den Landschaften, die sie prägten.
Auf diese Weise werden Ortsnamen zu wertvollen Zeugnissen der Vergangenheit. Sie sind bodenständig und raumgebunden und ermöglichen Einblicke in die Siedlungsgeschichte und Sprachentwicklung – oft weiter zurückreichend als jede schriftliche Überlieferung.
Entschlüsselung der Ortsnamen
In seinem Buch vereint Walter Wolf historische Quellen, sprachwissenschaftliche Analysen und lebendige Erzählungen, um die Ursprünge unserer Ortsnamen zu entschlüsseln. Durch diese interdisziplinäre Herangehensweise entsteht ein Werk, das nicht nur für Sprach- und Geschichtsinteressierte von Bedeutung ist, sondern für alle, die sich mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Alte Urkunden, Dialekte und Überlieferungen werden zusammengeführt, um ein möglichst vollständiges Bild der Namensherkunft zu zeichnen. So erfährt der Leser auf verständliche Weise, woher unsere Ortsnamen stammen und was sie bedeuten.
Namen und Identität
Besonders spannend ist, wie Ortsnamen Identität stiften. Sie sind Teil unseres kulturellen Erbes und verbinden uns mit den Generationen, die vor uns hier lebten. Gleichzeitig bleibt die Erforschung der Namen ein dynamischer Prozess – neue Erkenntnisse können alte Deutungen ergänzen oder korrigieren. In diesem Sinne ist Wolfs Buch nicht nur eine Bestandsaufnahme, sondern auch eine Einladung, weiterzudenken und sich mit der Geschichte unseres Raumes auseinanderzusetzen.
Dank und Ausblick
Ich danke Walter Wolf herzlich für seine wertvolle Arbeit und freue mich, dass dieses Buch nun allen zugänglich ist. Es zeigt einmal mehr: Unsere Ortsnamen sind nicht nur Teil der Vergangenheit, sondern auch ein lebendiger Bestandteil unserer Gegenwart und Zukunft.
Drolshagen, im Februar 2025
Uli Berghof, Bürgermeister der Stadt Drolshagen
Ein Wort zuvor
In den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts hielt ich mich oft in meinem Nachbarort Hünsborn auf. Dort hatte ich Freunde und auch eine Freundin. Wiederkehrend kam ich an der Werkstatt des Schreiners Schrage vorbei, der öfter in der typischen Schreinerkluft mit blauweiß gestreiftem Kittel, vor allem aber mit der langen Schreinerschürze vor seiner Werkstatt stand und mir wohlwollend mit einem Augenzwinkern – natürlich im Wendschen Platt – zurief: „Do kümmet hä alt wear, dä Höëwinger Jung – Da kommt er schon wieder, der Höëwinger Junge“. Klar, ich wusste, dass mein Herkunftsort Altenhof im Platt immer Höëwingen genannt wurde, aber warum wusste ich nicht. Das ließ mir keine Ruhe und so forschte ich danach, als junger Mann mit wenig Erfolg, konnte aber mit Ruhe und mit ein wenig mehr Grundwissen erst in den letzten Jahren dieser Benennung auf den Grund gehen, was u.a. in den beiden kleinen Büchern zum Wendschen Platt und zu Höëwingen auch eine systematische Darstellung bekam.
Im Nachgang stelle ich fest, dass mir die Benennung, die auch eine Zuweisung zu deren Nachbarort war, nicht unbedeutend blieb und Teil meiner Lebensgeschichte und Identität wurde. Rückblickend fällt mir auch auf, wie oft und wie genau ich im Rahmen meiner Bildungsarbeit bei den über Jahrzehnte gehenden Rundfahrten durch den Kreis Olpe auf die Namen der Orte einging und mit diesen auch deren Geschichte und ihre Geschichten zum Thema machte. Da ich mit manchen Gruppen mehr als zwanzig Jahre gearbeitet habe, kannten und erwarteten sie dies. Ließ ich dies einmal aus, kam sofort die Frage: „… und woher kommt das?“. Und dann musste ich wieder Rede und Antwort stehen.
Damit kamen zwei Bedürfnisse zusammen, mein schon seit Jugendzeiten hohes Interesse an Sprache (ich kann heute noch den Anfang des althochdeutschen Hildebrandlieds aus dem 9. Jahrhundert auswendig sprechen) und der Wunsch meiner Teilnehmer in den Seminaren. Diese habe ich auch im Alter nicht abgelegt, im Gegenteil. Nach den Recherchen zu den Bei- und Familiennamen meines Herkunftsortes und aus Drolshagen brannte mein Interesse, diese Untersuchungen auch zu den Ortsnamen meiner (heutigen) Heimat Drolshagen auszuweiten. Aus den zunächst sporadischen und privaten Recherchen (u.a. zu Steupingen) wurde schnell eine systematische und wissenschaftlich orientierte Suche.
Wiederum spielten zwei Bedingungen eine Rolle. Zum einen gab es bislang zu den Ortsnamen von Drolshagen keine umfassenden Untersuchungen oder Abhandlungen, die auch wissenschaftlich belastbar waren. Josef Hesse hat in seinem Buch „Geschichte des Kirchspiels und Klosters Drolshagen“ eine Fülle von Dokumenten angeführt, aber oft den heutigen Sprachgebrauch zu den Orten verwendet, sodass erst durch einen Rückgriff auf die Originaldokumente mehr Klarheit entstand. Und seine Deutungen waren in vielen Fällen spekulativ und nicht belastbar. Zum anderen liegt seit 2014 ein umfangreiches und hervorragend recherchiertes Standardwerk zu den Ortsnamen im Kreis Olpe vor. Dies ist als Band 6 der Reihe „Westfälisches Ortsnamenbuch“ im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen erschienen. Der Autor Dr. Michael Flöer hat in diesem Werk mit über 300 Seiten akribisch alle Ortsnamen des Kreises Olpe aufgeführt und sprachlich gedeutet, sofern sie bis 1600 in schriftlichen, gedruckten Quellen erfasst sind. Das schließt Orte ein, die es zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr gab wie Steupingen, Herrnscheid oder Aldenfelde, schließt aber die Ortsnamen aus, die nicht schriftlich dokumentiert sind oder später entstanden. Bewundernswert ist in diesen und den anderen Untersuchungen z.B. für den Märkischen Kreis, den Hochsauerlandkreis oder Soest die präzise und umfassende Kenntnis der auf das Altsächsische zurückgehenden Namen und Ortsbezeichnungen. Nur kommt dabei zu kurz, dass für unsere Region im Drolshagener, Olper und Wendener Land auch wesentliche niederfränkische Merkmale die Sprache bestimmen. So habe ich mit Flöer u.a. die Deutung des Ortsnamen Wormberg diskutiert und darauf verwiesen, dass das Grundwort „berg“ in unseren Dialekten auch mit „Wald“ übersetzt werden kann, was für die Deutung und Bedeutung unserer Ortsnamen tatsächlich einen Unterschied macht.
Dennoch bin ich ihm dankbar für diese umfangreiche fundierte Arbeit. Allerdings habe ich dort, wo meines Erachtens eine andere, meist auf eine Flurbezeichnung oder auf den heimischen Dialekt zurückzuführende Deutung zielführender ist, diese vorgeschlagen.
Diese Deutungen habe ich am 12. Februar 2025 im Rahmen der Bildungsarbeit unseres Heimatvereins vorgestellt. Durchgehend wurde sie dort angenommen und sogar durch eigene Kenntnisse der Teilnehmer bestätigt und erweitert. Ein Beispiel dafür war die Deutung des Ortsnamens von Benolpe durch Sturmi Engel, der auf die Lage des ursprünglichen Dorfes im sumpfigen Grund verwies.
Meine Recherchen waren so umfangreich, dass die immerhin zwei Stunden dauernde Präsentation nur einen Bruchteil der Kenntnisse und Erkenntnisse vermitteln konnte. Ich habe mich daher entschlossen, diese in Buchform weiterzugeben, auch verbunden mit der Erwartung, dass die Recherchen weitergehen, meine Aussagen korrigiert oder ergänzt werden. Deshalb habe ich alle meine Aussagen auch so gestaltet, dass sie anschlussfähig bleiben für eine Weiterarbeit. Nicht zuletzt freue ich mich, das erste wirklich alle 56 Ortschaften und zusätzlich weitere wüstgefallene Siedlungen umfassende Ortsnamenbuch der Öffentlichkeit zu übergeben.
Drolshagen, im Februar 2025
Walter Wolf
Ortsnamen – eine Einführung
Menschen siedeln sich an….
Gehen wir einmal ganz weit zurück in die Zeit, als die ersten Siedler in unsere Region kamen. Sie zogen flussaufwärts die Ruhr, die Lenne, die Bigge und dann die Brachtpe oder die Rose, um sich dann irgendwo im Quellgebiet dieser Gewässer niederzulassen. Für sie war es unbedingt notwendig, eine einigermaßen ebene Grundfläche zu finden, die nahe am Wasser lag, aber wiederum nicht so nah, dass bei Frühjahrshochwasser ihr Haus und ihre Stallungen überschwemmt wurden. Und die Flusstäler waren die beste, manchmal die einzige Möglichkeit in das bisher unbesiedeltes Gebiet zu kommen.
Und weil alles, was sich Menschen vertraut machen und worüber sie mit anderen kommunizieren, einen Namen bekommt, wurden diese Gewässer benannt, die auch dazu dienten, sich in diesem noch menschenleeren Gebiet zu orientieren. Die dazugehörigen Grundworte waren z.B. „apa“ für Wasser, oder „beke“ für ein Fließgewässer, das zu Bieke und Bach wurde. Und da es viele Bachläufe gab, wurden sie nach ihrer Art benannt. Ob sie schnell oder träge flossen, ob ihre Quelle in einem kleinen Waldstück oder einer höher gelegenen Brachfläche lag, ob sie in vielen Kurven mit Wendungen flossen oder sich wie ein Wurm durch das Gehölz, später durch die angelegten Wiesen wanden, jedes dieser Gewässer bekam einen Namen. Zunächst zur eigenen, dann aber auch zur Orientierung für andere. So hießen sie bald „Heimicke“, „Brachtpe“, „Wende,“ „Wormbeke“ oder „Erlenbiche“.
Die Areale, die an diesen Gewässern lagen, wurden nun nach diesen benannt, und auch die Siedlungen, die dort mit der wachsenden Bevölkerung angelegt wurden, bekamen von ihnen ihren Namen. So waren Gewässer, Areal und Ort als eine Einheit erkennbar.
Neue Siedlungen, die man nicht noch einmal nach den Gewässern benennen konnte, erhielten Namen, die mit den Leuten zu tun hatten, die sich diesen Teil des mit Urwald bedeckten Landes zu eigen machten und dort siedelten. Auch sie bauten ihre Häuser in der Nähe der Gewässer, aber benannten ihre Siedlung nach einem der ihren. Das waren meist die Protagonisten dieser Landnahme oder der Familienvorstand. Dann wurde eine solche Siedlung beispielsweise „Ort, wo die Leute des Dietrich wohnen“ genannt. An den Namen des Protagonisten wurde ein Wort angehängt, dass in den germanischen Sprachen, vor allem aber den niederfränkischen Dialekten, „ingen“ lautete. Der Ort des Dietrich hieß dann „Dirkingen“.
In späterer Zeit wurden die Siedlungen nach dem benannt, was man zuerst sah: die Häuser, was zu Formen mit dem Wort „hausen“ führte. Dann war der Ort, wo Franken wohnten eben Franken-hausen, was heute Frenkhausen heißt. Oder wenn es ein einzelner Hof war, der weiter bachabwärts angelegt wurde, war dies ein neues Haus, eben „Neuenhaus“. Der alte Ort, von dem man ausgegangen war, dementsprechend der „Altehof“ (bei Benolpe).
Um noch ein Beispiel zu nennen, schauen wir uns bestimmte landschaftliche Formen an, z.B. wenn eine Siedlung unterhalb eines dichten Waldes auf der langziehenden Höhe der Berge, die z.T. undurchdringliche Grenzwälder waren, lag oder auf der Anhöhe, die beispielsweise eine Wasserscheide darstellte, wurde der Ort nach der Scheide benannt. Das wurde dann Scheda, Alperscheid oder Herrnscheid.
Das sind noch lange nicht alle Möglichkeiten, wie Menschen, die in unser Land kamen, unsere Altvorderen, ihre Siedlungen benannten. In dem Teil zu den Grundworten werde ich dies systematisch vorstellen, und zwar nach den für unsere Region typischen Formen.
Ortstypen in Drolshagen
Das Drolshagener Land zeigt gegenüber dem Olper oder dem Bilsteiner Land, aber in einer besonderen Weise auch in Abgrenzung zum benachbarten Wendener Land eine Siedlungsform, die überwiegend aus Weilern und Kleinweilern zusammengesetzt ist. Weiler sind kleine Siedlungen, kleiner als ein Dorf und haben in der Regel keine geschlossene Bebauung und keine Gebäude mit zentraler Funktion wie Kirche oder Gasthaus. Als Größenordnung geht man von bis 15 Wohnhäusern aus.
Im 19. Jahrhundert – vor dem Bau der Bahnlinie von Siegburg nach Olpe, die abseits vom „alten Dorf“ auch durch Hützemert führte,– gab es neben der Stadt Drolshagen nur ein weiteres älteres Dorf, und das war Iseringhausen1. Dort existierte bereits im späten 16. Jahrhundert eine Kapelle, die damit eben jenes Gebäude mit zentraler Funktion darstellte. Von den 56 Ortschaften im Stadtgebiet Drolshagen zählten 27 zu den Kleinweilern und weitere 19 zu den Weilern. Zusätzlich kamen 8 Einzelhöfe vor, die auch heute noch existieren (u.a. Potzenhof oder Fahrenschotten).
Diese Siedlungsform findet sich im Kreis Olpe besonders ausgeprägt im Drolshagener Land, in der Römershagener Gegend, die sich direkt an das Drolshagener Land anschließt, und um Rhode herum. Das Drolshagener Land und Römershagen liegen in unmittelbarer Nähe zum Bergischen Land, für das ebenfalls die Kleinweiler typisch sind. Auf die historischen Gründe kann ich hier nicht eingehen. In den Vertalungen des Bilsteiner Landes sind eher langgezogene Siedlungen zu finden, die dem Flussverlauf folgen, während im Wendener Land, auch durch den Siegerländer Einfluss, häufiger Dorfbildungen zu finden sind, die typischerweise auch als Ringdörfer mit Gehöften rund um einen zentralen Platz angelegt wurden. Bis heute ist diese Siedlungsform in Wenden, Hünsborn, Altenhof oder Ottfingen erkennbar. Im gesamten Kreisgebiet sind im 19. Jahrhundert nur wenige Höhensiedlungen (wie z.B. Hünsborn, aber auch Junkernhöh) zu finden. Von 247 im Jahr 1841 registrierten Orten lagen mehr als 200 an Bach- oder Flussläufen. Siedlungen direkt in den Talauen sind wegen der Hochwassergefahr eher selten. Vielmehr befinden sich die meisten Siedlungen an den auslaufenden Berghängen unmittelbar über der Talaue. Dies gilt für die meisten Orte des Drolshagener Landes, wenn man z.B. Schreibershof, das alte Hützemert, Berlinghausen oder Bleche betrachtet. Bevorzugt wurde schon bei der Besiedlung die sogenannte Quellmuldenlage2, also meist im Talschluss mit direktem Zugang zum Wasser des Bachs oder der Quelle für die menschliche Versorgung, aber vor allem auch für das Vieh3. Im 19. Jahrhundert lagen 25 Orte in Drolshagen in einem Quellmuldenbereich, 11 in einem Seitental, 10 in Tal- oder Talhanglage und nur einer, die Stadt, am Zusammenfluss zweier wasserreicherer Bäche oder Flüsse.
Warum diese Ausführungen? Wenn wir auf die Bezeichnungen für die Siedlungen im Drolshagener Land schauen wollen, kommen wir nicht an den Grundlagen für die Ortsgründungen vorbei. Oft geben gerade die Namen einen wichtigen Hinweis auf die Ursprünge und im umgekehrten Sinn verweisen auch landschaftlichen Besonderheiten auf die Namensgebungen. Dies wird immer wieder auch in den folgenden Ausführungen eine Rolle spielen.
Namensbildung
Wie es notwendig ist, dass Personen einen eigenen Namen bekommen, der den / die einzelne/n von anderen unterscheidet, gilt dies auch für Orte, gilt dies für Areale, die Flurnamen bekommen oder für Gewässer. Es geht um Orientierung. Dies zunächst im Raum, der Region: wer wohnt wo, in welchem Teil des Landes? Darüber hinaus sind aber auch Fragen des Rechts, des Besitzes und gerade in den grundherrschaftlichen Verhältnissen des Mittelalters in Sachen Lehnsrechte oder Leibeigenschaften von Bedeutung. Und diese lassen sich nur mit den Bezeichnungen für Areale und Siedlungen verwalten. Wenn Rechtsgeschäfte getätigt wurden, tauchten Ortsnamen in Urkunden auf, die z.T. heute noch einsehbar sind und auf die ich mich auch im Wesentlichen beziehe4. Selbstredend sind nicht alle Orte und deren Namen in Urkunden zu finden, nicht immer sind die niedergeschriebenen Ortsnamen auch korrekt, sondern häufig nur so festgehalten, wie sie der des Schreibens Kundige verstanden hat, und im Laufe der Zeit haben sich Worte neuen Formen angepasst, vor allem, wenn bestimmte überkommene Begriffe nicht mehr verstanden wurden. Ich werde mehrere Beispiel aufführen. Und auch ist festzuhalten, dass nicht erst mit der Fixierung in Urkunden Ortsnamen bestanden, sondern umgekehrt: die Ortsnamen bestanden seit der Gründung dieser Siedlung.
Methodisches Vorgehen
Um den möglichst authentischen Sinn eines Ortsnamens zu erforschen, gehe ich auf die älteste mir zugängliche Form zurück. Diese ist in entsprechenden Urkunden zu finden, die zum guten Teil in Zusammenfassungen der rechtsrelevanten Inhalte zu finden sind wie die Regesten von Gut Ewig. Hier habe ich mich auf die Analysen und Recherchen von Michael Flöer, vor allem sein Kompendium zu den Ortsnamen im Kreis Olpe7, verlassen. Wo mir Zweifel kamen – und das ist einige Male passiert – habe ich (Online-verfügbare) Originale der Urkunden zu Rate gezogen. Dies war insbesondere dann wichtig, wenn bereits in Abhandlungen wie bei Josef Hesse8 für die Orte die aktuellen, neuhochdeutschen Formen geschrieben wurden.
Wenn ich die älteste Form gefunden hatte, begann die Analyse über die einschlägigen Wörterbücher, allen voran das „Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm“, das einen ungeheuren Schatz an alten Formen bis zum Sanskrit für die von mir recherchierten Begriffe bot, aber dazu auch parallel das Althochdeutsche Wörterbuch der Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, das Mittelhochdeutsche Handwörterbuch von Matthias Lexer, das Etymologische Wörterbuch des Deutschen, digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitet, das Rheinische Wörterbuch, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities oder das Westfälische Wörterbuch, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities. Von großer Hilfe waren bei den Recherchen auch meine Kenntnisse zum Niederdeutschen, insbesondere zum Drolshagener und Wendener Platt, die häufig eine schlüssige Erklärung geben konnten, die trotz allen Kenntnisreichtums und wissenschaftlicher Akribie einem dieser Sprache Unkundigen verborgen bleiben, wie es sich u.a. am Beispiel von Wormberg, Sendschotten oder Kram weiter unten zeigen wird. Hilfreich dabei war auch meine Frau Dorothee, die das Drolshagener Platt als aktive Sprache kennt und manchen Tipp geben konnte und manche Korrektur meiner Ausführungen und Annahmen vornahm.
Nicht immer konnte ich eine eindeutige Deutung der Ortsnamen vornehmen. Das war auch in den von mir geschätzten Ausführungen von Michael Flöer häufiger der Fall, der ein hervorragender Kenner der altsächsischen Sprache ist, aber keinen Zugang zu den örtlichen, auch niederfränkisch geprägten Dialekten hat. Ich habe mich dann – wie er – auf die mir plausibelste Deutung entschieden. Ob diese auch weiterhin tragfähig ist, wird eine – hoffentlich erfolgende – Fortführung meiner Recherchen bringen. Wissenschaftliche Untersuchungen müssen immer anschlussfähig bleiben.
Eine Zusammenstellung der in diesem Buch in den Zitaten verwendeten Kürzel sind am Ende der Anmerkungen zu finden. Im Sinne wissenschaftlicher Redlichkeit sind die Kürzel in den Zitaten übernommen. Alle Anmerkungen sind wegen der umfangreichen Quellenangaben aus Gründen besserer Lesbarkeit als Endnoten verfasst. Die Rechtschreibung in den Zitaten entspricht der in den Originalen.