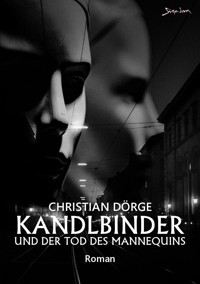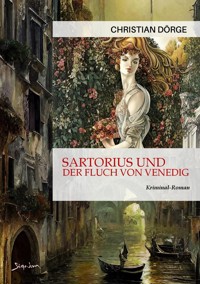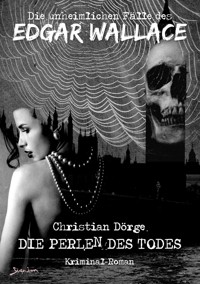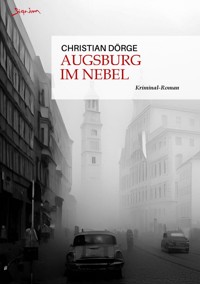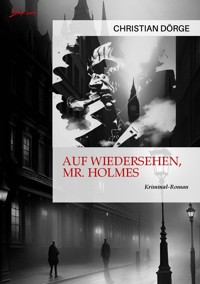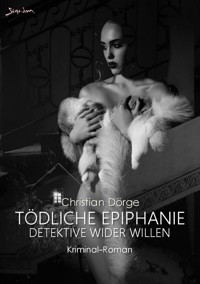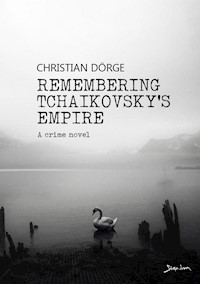8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
DER LETZTE SCHUSS ist nach NACHT ÜBER GUNLOCK und IM ANGESICHT DES TODES bereits die dritte umfangreiche, von Christian Dörge zusammengestellte und herausgegebene Western-Anthologie, die in der Reihe APEX WESTERN erscheint. Der Band versammelt 16 erstklassige Western-Erzählungen US-amerikanischer Spitzen-Autoren und -Autorinnen, u. a. von Louis L'Amour, Wayne D. Overholser, Peggy Simson Curry, Dorothy Johnson, Luke Short und Will Henry.
DER LETZTE SCHUSS wird ergänzt durch eine ausführliche bibliographische Notiz von Dr. Karl Jürgen Roth.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
CHRISTIAN DÖRGE (Hrsg.)
Der letzte Schuss
Apex Western, Band 26
Erzählungen
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
John Prebble: STADT DES HASSES (A Town Named Hate)
Fred Grove: DIE WEISSE INDIANERIN (Comanche Woman)
Henry Wilson Allen: ISLEY UND DER FREMDE (Isley's Stranger)
Peggy Simson Curry: DIE ZEIT DER ERNTE (The Brushoff)
Bill Gulick: DER DIEB IM LAGER (Thief In Camp)
Thomas Thompson: DER MANN, DEN KEINER KANNTE (Blood On The Sun)
Will Henry: DER GRÖSSTE INDIANER IN TOLTEPEC (The Tallest Indian In Toltepec)
Thomas Thompson: ZWISCHEN DEN FRONTEN (Lynch Mob At Cimarron Crossing)
Noel M. Loomis: STARKE MEDIZIN (Grandfather Out Of The Past)
Wayne D. Overholser: DER LETZTE SCHUSS (The O'Keefe Luck)
Dorothy M. Johnson: DIE VERLORENE SCHWESTER (Lost Sister)
Luke Short: DER HENKER (The Hangman)
Joseph Chadwick: MENSCHENJAGD IN WYOMING (Gunsmoke Over Wyoming)
Gordon D. Shirreffs: DIE VERSCHOLLENE MINE (Gold Trouble)
Gardner F. Fox: IN DIE ENGE GETRIEBEN (The Man From Nowhere)
Louis L’Amour: GALGENVÖGEL (Murphy Plays His Hand)
Der amerikanische Traum -Bio- und bibliographische Notizen zu den Western-Stories
von Dr. Karl-Jürgen Roth
Das Buch
DER LETZTE SCHUSS ist nach NACHT ÜBER GUNLOCK und IM ANGESICHT DES TODES bereits die dritte umfangreiche, von Christian Dörge zusammengestellte und herausgegebene Western-Anthologie, die in der Reihe APEX WESTERN erscheint. Der Band versammelt 16 erstklassige Western-Erzählungen US-amerikanischer Spitzen-Autoren und -Autorinnen, u. a. von Louis L'Amour, Wayne D. Overholser, Peggy Simson Curry, Dorothy Johnson, Luke Short und Will Henry.
DER LETZTE SCHUSS wird ergänzt durch eine ausführliche bibliographische Notiz von Dr. Karl Jürgen Roth.
John Prebble: STADT DES HASSES (A Town Named Hate)
Martha Boyd sah den Reiter zuerst. Sie presste gerade Kartoffelwasser durch ein Tuch, um Stärkemehl zu gewinnen. Zufällig blickte sie aus dem Fenster, und da sah sie den Reiter aus westlicher Richtung kommen.
Er war noch ziemlich weit entfernt - vier Meilen oder sogar mehr -, und er war nicht größer als eine Fliege, die über den gelben Sand kroch. Martha strich ihr Baumwollkleid glatt und beobachtete ihn eine Weile lang, während sie ab und zu den Schweiß von der Stirn wischte. Die flirrende Hitze trieb ihr Spiel mit dem Reiter, ließ ihn auf und nieder hüpfen wie ein Blatt auf den Wellen. Nach zehn Minuten schien er Salt Flats kaum näher gekommen zu sein und sich von den blauschimmernden Bergen auch nicht weiter entfernt zu haben.
Martha schwankte, ob sie ihren Vater benachrichtigen sollte. Doch bei dieser Hitze schien alles so sinnlos. Die Männer auf der Veranda würden den Reiter sowieso bald sehen, wenn sie ihn nicht schon entdeckt hatten. Sie gab der Schüssel einen kleinen Stoß, wendete den Blick von dem Reiter ab und schaute hinüber zu dem alten Halladay-Windrad am Rand der Siedlung. Boyd hatte die Windradpumpe vor fast dreiundzwanzig Jahren aus Illinois kommen lassen, als er und die anderen Bewohner von Salt Flats noch daran geglaubt hatten, die Trail-Mannschaften würden im Sommer auf dem Weg nach Denver durch den Ort kommen. Wasser und Whisky waren für Rinder und Cowboys unentbehrliche Güter; und deshalb hatte Boyd eine Bar und eine Windradpumpe bauen lassen.
Martha Boyd konnte sich nicht mehr an die Cowboys erinnern; doch entsann sie sich noch gut, wie ihre Mutter von ihnen erzählt hatte. Der Staub, den die Rinder aufwirbelten, hing wie eine Wolke über dem Tal, und die Sonne stand wie ein roter Ball darin. Doch die gewaltigen Herden, die sich durch das Tal wälzten wie ehemals beim Auszug des erwählten Volkes aus Ägypten, kamen nur zwei Jahre, dann blieben sie fort für immer. Denn die Cowboys entdeckten eine viel lieblichere Landschaft weit oben im Osten, wo ihre Herden das Wasser umsonst aus einem Fluss saufen konnten. Doch Salt Flats gefiel sich in dem Wahn, dass die Treibherden eines Tages wiederkehren würden. Marthas Mutter hatte immer gesagt, dass sie das nicht mehr erleben würde, und damit hatte sie recht gehabt. Sie war jetzt seit sechzehn Jahren tot.
Auf dem Hügel hinter der Pumpe war der Friedhof. Und wenn Martha aus ihrem Fenster hinüberblickte, sah sie nicht den Hügel, sondern nur das Grab ihrer Mutter. Es war das hübscheste Grab, mit einem Grabstein und einer Kette darum herum. Auch eine Vase mit Wachsblumen gehörte dazu. Die stammte ebenfalls aus Illinois.
Martha probierte die klebrige Stärke mit dem Finger und wischte sich die Hände an der Schürze ab. Wieder warf sie einen flüchtigen Blick hinaus zu dem Reiter und konnte noch immer nicht entscheiden, ob er inzwischen näher gekommen war. Dann ging sie hinüber in den Schankraum.
»Ein Reiter kommt, Pa«, sagte sie. Ihr Vater drehte nicht einmal den Kopf. Er war in Hemdsärmeln, lehnte sich auf die Bar und starrte in das grelle Sonnenlicht hinaus. Zwei Männer saßen in einer schattigen Ecke des Raumes und spielten Dame. Die Schwingtür stand offen, die Flügel waren an den Pfosten festgebunden. Martha sah drei Männer, die draußen auf der Veranda saßen, die Füße auf dem Geländer und die Hüte in die Stirn gezogen. Ihre Hemden waren dunkel von Schweiß. »Siehst du den Reiter, Pa?«
Ein Stuhl knackte, als einer der Männer auf der Veranda sich herumdrehte und in den Raum hineinblinzelte. Das war Mr. Harvey. Er saß immer auf der Veranda, wenn er sein Bier trank, jeden Tag an der gleichen Stelle, von wo aus er seine Ladengeschäfte gegenüber beobachten konnte. Das waren Harveys Futter- und Saathandlung, Harveys Gemischtwaren und Harveys Ladies Emporium.
Harvey war ein hagerer, dunkelhäutiger Mann. Die meisten seiner Zähne waren ihm bereits ausgefallen, doch was er noch hatte, bleckte er jetzt gelblich, als er lächelte. »Wir haben ihn gesehen«, sagte er.
»Wer kann das sein, Pa?«, fragte Martha, als habe ihr Vater geantwortet.
Boyd blickte sie an. Wie immer verriet er sich mit diesem Blick. Er war in den Westen als Spekulant gekommen - wollte ein Vermögen in einer neugegründeten Stadt machen, die an Rinder-Trail lag. Auch seine Frau hatte er mitgebracht - wie viele andere Männer auch -, um mit dem Geld auch die Nachkommen zu mehren. Söhne wollte er großziehen, doch nur eine Tochter war ihm geblieben, die seiner verstorbenen Frau viel zu ähnlich sah. Salt Flats war ein kleiner Ort geblieben mit falschen Gebäudefassaden, die sich an der einzigen staubigen Straße aneinanderreihten. Nicht einmal siebzig Leute lebten hier und ernährten sich kümmerlich vom Geschäft mit den Schafzüchtern. All das stand in dem Blick, den Boyd seiner Tochter zuwarf.
»Woher soll ich das wissen?«, sagte er. »Bist du mit deiner Arbeit fertig?«
»Ja, Pa.«
»Dann setz dich in den Schatten und kühl dich ab!«
Martha holte einen Stuhl und stellte ihn in die Nähe der Tür, damit sie den Reiter und auch die Schmiede am Ende der Straße sehen konnte. Sie hoffte, dass Jason herauskommen würde; aber sie wurde enttäuscht. Man hörte nicht einmal den Amboß klingen. Salt Flats brütete schweigend unter der Sonne, und die Hunde gähnten faul auf den Brettergehsteigen.
Marthas Hände lagen locker im Schoß. Sie las das Schild über der Schmiede:
JASON FLETCHER - STELLMACHER UND SCHMIED.
Martha wiederholte die Worte in Gedanken immer wieder, legte Gewicht und Bedeutung hinein.
Nathan Harvey legte seinen Stiefel auf dem Geländer bequemer zurecht. »Was glaubst du?«, fragte er.
Er sprach von dem Reiter, das war klar. Aber es dauerte eine ganze Weile, ehe jemand antwortete, ehe John McGill, der Sattler, seinen Rücken gegen die Stuhllehne stemmte und sagte: »Er ritt einen Esel.«
»Kann also kein Apache sein«, sagte der dritte Mann auf der Veranda. Martha erkannte ihn an der asthmatischen Stimme. Das war der al-te Reuben, der Verwalter der Postkutschenstation.
»Wenn die kommen«, meinte Harvey, »dann siehst du sie bestimmt nicht - erst wenn sie schon in der Stadt sind.«
Martha wünschte sich, dass die Apachen endlich einmal kämen. Solange sie zurückdenken konnte - praktisch ihr ganzes Leben lang -, sprachen Harvey und die anderen von nichts anderem. Als ob jeden Tag, jede Stunde die Indianer Salt Flats überfallen könnten - die Gewehre schwingend und heulend, wie sie auf einem Bild im Kalender abgebildet waren.
»Und einen Berglöwen erkennst du eher als einen Apachen«, sagte Harvey, den Blick auf den Reiter gerichtet.
Das sagte er auch jedes Mal, und Martha wartete jetzt auf den dritten Satz, der das Thema beendete: »Ich weiß gar nicht, wozu wir eigentlich eine Regierung haben.«
Martha erinnerte sich, dass Harvey die gleiche Leier schon damals gesungen hatte, als sie ihr Haar zum ersten Mal nach oben gekämmt hatte. Und das lag schon etliche Jahre zurück. Niemand hatte ihm jemals widersprochen oder sich in anderem Sinne geäußert, und Martha dachte, dass Harvey selbst heute noch Recht behalten könnte.
Der Fremde in der Stadt, der mit Martin Schurmann Dame spielte, hob den Kopf: »Worum geht's eigentlich?«
Er war Vertreter, der in Galanteriewaren und Dessous für Damen reiste. Er war gestern mit der Postkutsche aus Lordsburg gekommen und wollte eigentlich nur einen kleinen Zwischenaufenthalt auf der Reise nach Holbrook einlegen. Doch niemand hatte es für nötig gehalten, den Fremden aufzuklären, dass die nächste Kutsche erst in einer Woche fuhr. Der Fremde trug sein Missgeschick mit philosophischer Gelassenheit. Er hatte wohl geglaubt, für den ungewollten Aufenthalt einigermaßen entschädigt zu werden, als er den Inhalt seiner schweinsledernen Taschen in Harveys Ladies Emporium zeigte. Die Muster waren Lockenscheren mit Elfenbeingriffen, Haarnadeln aus Bernstein, Turnüren, Büstenpolster, die mit Schwanendaunen gefüllt waren; Seidenschlüpfer und Unterröcke, mit Herzassen bestickt. Harvey hatte den Kopf geschüttelt und gemeint, in Salt Flats gäbe es keine Frau, die solche gewagten Sachen tragen würde. Also wurde aus dem Vertreter ein Gast in Boyds Saloon, der sich mit Geduld und einer Kiste von Harveys billigen Zigarren wappnete.
Martha war im Laden gewesen, als die Schweinsledertaschen geöffnet wurden. Die Stimme des Vertreters erinnerte sie jetzt wieder lebhaft an all die verlockenden Sachen in seinen Taschen.
»Was hat es mit den Apachen auf sich?«, fragte er.
Harvey drehte seinen Stuhl herum und starrte in den Saloon. »Es ist kein Apache. Das haben wir doch schon gesagt.«
»Erwartet ihr Indianer?«, fragte der Handlungsreisende. Er bemerkte, wie Martha ihn ansah, und lächelte ihr zu, als wolle er sie zur Parteinahme anstiften. Doch sein Lächeln dauerte länger, als es die Höflichkeit erlaubte, und Martha wendete rasch den Kopf ab.
»Die edlen Wilden sind doch jetzt in Reservate gesperrt«, sagte der Vertreter. »Seit zehn Jahren schon, habe ich gehört.«
Nathan Harvey spuckte in den Sand. »Edle Wilde?«
»Eine Metapher, mein Freund.«
»Sie waren ja nicht hier«, sagte Harvey. »Damals, als sich Victorio in den Mogollons herumtrieb.«
»Nein«, erwiderte der Vertreter verwundert, »natürlich nicht.«
»Natürlich nicht ist der richtige Ausdruck, verdammt noch mal!«, rief John McGill.
Der Vertreter nahm die Hand wieder von dem Stein, den er eben berührt hatte. »Was ist denn los? Gibt es Neuigkeiten von den Indianern, die ich wissen sollte? Etwas Unangenehmes?«
Niemand antwortete ihm. »Ich meine«, fuhr der Vertreter fort, »ihr habt doch keine Angst mehr vor ihnen - nicht wahr?« Martin Schurmann klopfte mit den Fingerknöcheln auf den Tisch. »Sie haben den Stein berührt«, sagte er, »also müssen Sie auch damit ziehen.«
»Schon gut«, murmelte der Vertreter und schob den Stein vor.
Die Hitze war daran schuld, die Hitze, der Staub und die Einsamkeit. Und weil die Stadt so erbärmlich war, überlegte Martha. Das hielt den Hass wach, als sei es erst gestern gewesen. Martin Schurmann lachte scheppernd, als er seine Dame kreuz und quer über die Felder springen ließ. »Sie verlieren!«
»Ja«, murmelte der Vertreter und sah sich um. »Ihr habt mir noch gar nicht...«
»Es ist Keno«, sagte John McGill.
Harvey nickte. »Hab's mir schon gedacht.«
Boyd kam hinter der Bar hervor und streifte die Ärmelhalter weiter hinauf. Er ging zur Tür, hielt die Hand schützend über die Augen und spähte in die Hitze hinaus. »Tatsächlich«, sagte er. »Es ist Keno. Diesmal hoffentlich mit Geld in der Tasche.« Harvey blickte den Vertreter nachdenklich an und nuckelte an einem Zahn. »Da Sie aus dem Osten stammen, haben Sie ja keine Ahnung.«
»Ahnung wovon?«, fragte der Vertreter.
»Wie wir über die Apachen denken.«
Boyd wendete sich von der Tür ab und schlenderte zur Bar zurück. Doch der Vertreter hielt ihn am Ärmel fest. »Was ist denn mit den Apachen, Mr. Boyd?«, fragte er.
Boyd blickte mit gerunzelten Brauen auf den jungen Mann hinunter. Ehe er antworten konnte, mischte sich Martha ein: »Die Leute in Salt Flats machen sich immer noch Sorgen wegen der Apachen. Als läge es erst zwei Jahre zurück. Aber es leben nur noch zehn Indianer in den Bergen. Niemand sieht sie jemals. Und sie belästigen auch niemand.«
Boyd drehte sich mit ausdruckslosem Gesicht zu seiner Tochter um. »Du hältst den Mund!«, befahl er.
Dann blickte er wieder auf den Vertreter hinunter. »Sie haben ihre Mutter getötet. Man sollte meinen, sie dürfte das niemals vergessen - niemals!«
»Brachten meinen Jungen um«, fügte Harvey hinzu.
»Das tut mir aber leid!«, murmelte der Vertreter. Aus seiner Stimme sprach echtes Mitgefühl.
»Verstehen Sie jetzt?«, sagte Boyd.
»Aber das liegt doch schon lange zurück, nicht wahr?«
»Uns kommt das nicht so lange vor«, erwiderte Boyd, ging hinter die Bar und trank mit finsterem Gesicht sein Glas aus. Die Hitze und das Schweigen bedrückten Martha. Und beinahe wären ihr die Tränen gekommen; denn alles, was ihr Vater gesagt hatte, war wahr - und vielleicht auch das, was sie von den Apachen noch immer dachten -, und weil sie in diesen Augenblicken den Hass in dieser kleinen Siedlung so sehr spürte, als liege er wie ein Tuch über ihrem Gesicht.
Harvey fuhr sich mit der rechten Hand über den Nacken. Er rieb den Schweiß an der Hose ab. »Verdammte Hitze!«, fluchte er. »Zieht einem das Wasser aus den Poren und die angenehmen Gedanken aus dem Hirn.«
»Es ist Keno«, sagte John McGill. »Kommt reichlich spät dieses Jahr.«
»Wer ist Keno?«, fragte der Vertreter.
»Bei mir bekommt er nichts zu trinken«, murmelte Boyd und stemmte die Ellenbogen auf die Bar. »Es sei denn, er hat dieses Jahr eine Tasche voll Geld mitgebracht.«
»Wer ist Keno?«
Niemand ließ sich herbei, dem Fremden die Frage zu beantworten. Martha tat der Mann leid. »Keno ist ein alter Mann«, sagte sie. »Ein Goldgräber. Er verbringt das ganze Jahr in den Bergen; doch bis jetzt hat er noch nie Gold gefunden.«
Boyd blickte zu seiner Tochter hinüber. »Hast du nichts anderes zu tun, als hier herumzusitzen?«
Martha stand schweigend auf und ging in die Küche. Sie hörte die Stimme des Vertreters: »Aber wenn es doch schon Jahre zurückliegt und nur noch zehn Indianer in den Bergen leben...«
Dann kam Harveys erregte Stimme: »Deswegen bleiben sie trotzdem Apachen - oder etwa nicht?«
»Ja, aber...«
»Man zertritt die Schlangen, wo man sie findet, oder etwa nicht? Und das Unkraut jätet man, ehe es hochkommen kann. Wir hätten sie ausmerzen sollen, als sich die Kavallerie aus den Mogollons zurückzog.«
»Wann war denn das, Mr. Harvey?«
»Vor zwölf Jahren.«
»Das ist aber eine lange Zeit, genug, um vergessen zu können...«
»Haben wir Sie um Ihre Meinung gebeten, Mister?«
Martha setzte sich wieder hinter ihre Schüssel mit den geriebenen Kartoffeln. Erneut kamen die Tränen. Es war die Hitze, versuchte sie sich einzureden. Doch Salt Flats war immer so - jedes Jahr, wenn die Hitze so schlimm und das Land so trocken wie eine Schüssel voll Sand war.
Keno kam jetzt die Straße entlang, die Sonne im Rücken, mit gespreizten Beinen auf seinem Esel reitend. Sieb und Pfanne klapperten bei jedem Schritt des Esels. Er hielt das Tier vor Boyds Saloon an, strich sich den schmutzigen Bart und blickte mit traurigen Augen hinauf zur Veranda.
»Ziemlich heiß, wie?«
John McGill nickte ihm zu. »Hallo, Keno. Kommst spät dieses Jahr.«
»Ich nicht. Ihr seid früher dran.«
»Was willst du damit sagen?«
»Ihr habt nichts zu tun in der Stadt - außer die Minuten zu zählen. Ihr zählt zu rasch.«
Keno rutschte vom Esel herunter, stand unten am Geländer und kratzte sich ausgiebig von der Schambeuge bis zu den Achselhöhlen. Dann ging er die Stufen zur Veranda hinauf und blinzelte in den schattigen Raum hinein. Er wartete. Doch Boyd versperrte ihm mit dem Arm den Weg in den Schankraum. »Hast du Geld mitgebracht, Keno?«
»Du weißt, dass ich nie Geld mitbringe, Boyd. Ich tausche meine Pfanne gegen drei Gläser Bier ein.«
»Nein«, sagte Boyd und ging an die Bar zurück. Dann rief er: »Und bleib bloß draußen, Keno! Du stinkst wie dein Esel!« Keno grinste und setzte sich draußen auf den Verandaboden. Er hatte Zeit. Als er glaubte, lange genug gewartet zu haben, sagte er: »Mr. Harvey - Sie spendieren doch einem alten Jäger ein Bier - nur ein Glas!«
»Nein.«
»Wie steht's mit Ihnen, Mr. McGill?«
»Meine Frau geht gerade in deinen Laden, Nathan«, sagte McGill.
Harvey stand widerwillig auf und überquerte die Straße. Als er fünf Minuten später wiederkam, setzte er sich in den Schankraum; denn der Gang über die Straße hatte ihm noch mehr Schweiß aus den Poren getrieben. Auch sein Ärger war gewachsen, und als der Vertreter die Steine für ein neues Spiel auf dem Brett ordnete und dabei das Gespräch wieder auf die Apachen brachte, knurrte Harvey: »Mister, Sie haben ja noch nie einen Apachen gesehen!«
»Ich habe welche gesehen - in Taos. Sie verkauften dort Decken.«
Schurmann brach wieder in schepperndes Gelächter aus. »Das sind Pueblos. Sie haben keine Ahnung!«
»Er hat keine Ahnung«, bestätigte Keno auf der Veranda.
»Du hältst den Mund!«, befahl Harvey. »Du Wüstenratte!«
»Spendieren Sie der Wüstenratte nicht ein Glas Bier, Mr. Harvey?«, fragte Keno und kam in den Schankraum.
»Keno!«, brüllte Boyd. »Ich habe dir gesagt, du sollst draußen bleiben!«
Keno zog sich zu den Schwingtüren zurück. »Eine freundliche Stadt«, sagte er und blickte den Vertreter an. »Wollen Sie mir nicht ein Glas Bier spendieren?«
»Nun...«, antwortete der Vertreter zögernd.
»Nichts da!«, sagte Boyd. »Ohne Geld kein Bier!«
Keno verzog das Gesicht. »Jeder schimpft nur mit mir. Keiner sagt guten Tag, Keno, was hast du in den Bergen erlebt?«
»Interessiert sowieso keinen«, erwiderte Boyd.
»Ihr redet über die Apachen. Jedes Jahr das gleiche. Komme ich hier her, redet ihr über die Apachen«, sagte Keno. »Als lauerten sie hinter der nächsten Ecke. Als wären noch Zeiten wie früher.«
»Na und?«, knurrte Harvey.
»Kaufen Sie mir ein Bier?«
»Nein.«
»Dann erzähl' ich auch nichts.«
»Du hast auch nichts zu erzählen.«
»Als kämen sie wieder aus den Bergen«, sagte Keno, und seine Stimme wurde lebhafter. »Und ich sag' euch - sie kommen!« Niemand regte sich in den nächsten Sekunden. Keno kratzte sich; aber von den anderen bewegte sich keiner. »Keno«, sagte Boyd endlich, »das ist keine Sache zum Spaßen.«
»Ist auch kein Spaß«, sagte Keno.
John McGill nahm seine Füße vom Geländer. »Was sagt er?« Keno grinste. »Dass ich Durst habe.«
Boyd richtete sich hinter der Bar auf. »Keno, wenn du dir auf diese Weise nur ein Glas Bier...«
»Ihr wollt es also nicht wissen. Auch gut«, murmelte Keno. »Boyd«, rief Harvey, »gib ihm ein Bier!«
»Und einen kurzen Joe Gideon«, sagte Keno. »Schlechtes Bier braucht hinterher etwas Gutes für den Magen.«
Doch Boyd schenkte nur das Bier ein und hielt das Glas fest. »Nathan, du bezahlst das also?«
»Ich bezahle.«
Keno warf den Kopf zurück und leerte das Bierglas auf einen Zug. Er wischte über seinen Bart und leckte die Schnurrbartspitzen mit der Zunge ab. »Hat gut getan«, sagte er.
»Was ist los mit den Apachen?«, fragte Harvey.
Keno schüttelte den Kopf. »Ich habe immer noch Durst. Der Wüstenstaub reicht hinunter bis in den Blinddarm.«
»Du bekommst noch ein Glas, wenn du uns alles erzählt hast«, sagte Harvey und stand auf. »Also - was war los?«
»Ich hab' sie gesehen«, sagte Keno. »Heulende und mordende Apachen.«
»Wer?«, fragte John McGill.
Keno dachte einen Moment nach. »Dieser junge Kerl - Chiquito. Und noch zwei andere.« Er blickte Harvey an und bettelte: »Wie wär's jetzt mit dem kleinen Whisky, Mr. Harvey?« Harvey blickte zu Boyd hinüber. »Was meinst du?«
»Kannst du das auf der Bibel beschwören, Keno?«, fragte Boyd. »Ich habe sie gesehen - das hab' ich doch eben gesagt!«
»Du bist ein Lügner!«
»Schön, Mr. Harvey - wenn Ihnen der Whisky zu teuer ist, trinke ich noch ein Glas Bier.«
Jungen stürzte ins Feuer, während sich ein roter Fleck auf seinem Rücken ausbreitete. Der andere flüchtete wie ein gejagtes Wild in den Busch. Chiquito bewegte sich nicht, blickte Fletcher nur starr an.
Boyd fluchte und lud durch. Er stand in den Steigbügeln und zielte sorgfältig.
Der Apache rührte sich immer noch nicht. Er blickte nur Fletcher an und flüsterte: »Sikisn?«. Fletcher beugte sich nach rechts und riss Boyd das Gewehr aus den Händen. Einen Moment kam es dem Vertreter so vor, als wollte er den älteren Mann schlagen.
»Fletcher!«, brüllte Boyd wütend.
»Chiquito!«, rief Fletcher. »Kümmere dich um deinen Freund!« Der Apache zog den Körper seines erschossenen Kameraden aus dem schwelenden Holzfeuer. Er kniete neben ihm nieder und löschte die Glut auf dem Hemd mit den bloßen Händen. Dann stand er auf. »Er ist tot«, sagte er mit ausdruckslosem Gesicht.
»Das tut mir leid.«
»Warum bist du gekommen, Sikisn?«
»Chiquito - man hat uns berichtet, du und deine Freunde hätten Mr. Bowyer und seine Familie umgebracht.«
»Wirst du mich töten, Sikisn!«
»Nein - wie steht es mit den Bowyers, Chiquito?«
Das Gesicht des Apachen war kalt und abweisend. »Wir haben niemand getötet.« Er blickte auf den Toten und dann zu Boyd hinauf. »Aber er hat Panayotishn erschossen. Du ihn festnehmen, Fletcher!«
»Ich will mein Gewehr!«, kreischte Boyd außer sich vor Wut. Fletcher drängte sein Pferd zur Seite, so dass Boyd nicht nach dem Gewehr greifen konnte. »Chiquito - du kommst mit uns zu den Bowyers!«, rief er. »Wir wollen feststellen, was an dem Gerede Wahres ist!«
Der Apache deutete mit dem Kopf auf Boyd. »Du wirst ihn hängen wegen Mord an Panayotishn?«
Fletcher holte tief Luft. »Chiquito, mach uns keine Schwierigkeiten!«
Der Apache lächelte höhnisch. »Töten Büffel, töten Apachen - kein Unterschied.« Er sah Fletcher an. »Wenn ich renne weg, du schießen?«
Fletcher seufzte. »Chiquito, wenn du wegläufst, weiß du doch, was das bedeutet.«
»Wenn ich bleibe, er wird mich erschießen.«
»Chiquito, mach keinen Ärger. Wir haben davon schon genug.«
»Ich mache niemand Schwierigkeiten.« Der Apache verschränkte die Arme über der Brust. »Keinen töten.«
»Er ist ein verdammter Lügner!«, schrie Boyd. »Du Schlange - wo hast du das Schaf her? Woher den Sonnenhut?«
»Von den Bowyers.«
»Natürlich hast du beides von den Bowyers!«
»Chiquito«, sagte Fletcher, »wir haben keinen Spaten. Wir können deinen Freund nicht begraben. Möchtest du Steine über ihn häufen?«
Chiquito blickte unbewegt auf den Toten hinunter. Er schüttelte den Kopf. »Meine Leute kommen bald.«
»Das wird wohl stimmen!«, rief Boyd. »Fletcher, wollen Sie hierbleiben, bis man Sie niedermetzelt?« Er sah sich wild in alle Richtungen um.
»Schön«, meinte Fletcher, »reiten wir also weiter zu den Bowyers.«
»Sie!«, rief Boyd dem Vertreter zu. »Geben Sie mir mal den Revolver!« Ehe der Vertreter die Aufforderung richtig verstanden hatte, hatte Boyd ihm schon die Waffe aus dem Gürtel gerissen.
»Fletcher«, knurrte Boyd, »wir reiten nur in eine Richtung - zurück nach Salt Flats. Der eine, den Sie entkommen ließen, wird uns bald die ganze Meute auf den Hals hetzen, wenn wir weiterreiten!«
»Wir reiten zu den Bowyers«, erwiderte Fletcher gelassen. »Versuchen Sie's doch!«, rief Boyd. »Wagen Sie nur einen Schritt in diese Richtung, und ich knalle ihn nieder. Wir nehmen ihn mit nach Salt Flats, andernfalls ist er ein toter Indianer!« Er richtete den Revolver auf den Indianer, der ganz ruhig dastand.
»Sie sind ein verdammter Narr, Boyd!«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich will am Leben bleiben. Also reiten wir zurück.«
»Sikisn, er ist ein böser Mann!«
»Du hältst dein Maul, verstehst du?«, brüllte Boyd.
»Wir haben keinen begründeten Anlass, ihn festzunehmen«, sagte Fletcher.
»Wir haben Kenos Bericht über das, was er selbst mitangesehen hat. Wir haben die drei mit einem von Matt Bowyers Schafen erwischt und mit Mrs. Bowyers Sonnenhut. Ist das vielleicht nichts?«
»Chiquito«, sagte Fletcher, »willst du mir dein Wort geben, nicht davonzulaufen?«
Der Apache warf Boyd einen raschen Blick zu, ehe er antwortete: »Kann ich dir vertrauen, Sikisn?«
»Das weißt du doch, Chiquito.«
»Dann komme ich mit.«
Boyd nahm ein Seil von seinem Sattel und ging damit auf den Apachen zu. Den Revolver hielt er in der Linken auf den Kopf des Apachen gerichtet. »Dreh dich um, verdammt noch mal!«, sagte er. »Hände auf den Rücken!«
Chiquito sah Fletcher an, der sich im Sattel vorbeugte. »Das ist nicht nötig, Boyd. Er gab mir sein Wort.«
»Ihnen gab er sein Wort - mir nicht. Und ich würde ihm auch nicht trauen, wenn er es getan hätte.« Er winkte mit dem Revolver. »Dreh dich um!«
»Mr. Fletcher«, mischte sich der Vertreter ein, »es ist bestimmt klüger, wenn man...«
Fletcher beachtete ihn nicht. »Lassen Sie ihn in Ruhe, Boyd!« Boyd spannte den Hahn des Revolvers und drückte die Mündung gegen Chiquitos Schläfe. Er grinste. »Wie wollen wir es jetzt halten, Fletcher? Ich drücke liebend gern ab!«
Der Apache starrte einen Moment auf die Waffe, drehte sich dann gelassen um und verschränkte die Hände auf dem Rücken. Boyd band die Gelenke brutal zusammen, kehrte dann zu seinem Pferd zurück und befestigte das lose Ende des Seils am Sattelhorn. Er stieg auf, riss das Pferd herum, und der Apache stürzte zu Boden. Boyd lachte schallend.
Chiquito stand ohne Hast wieder auf. Seine linke Gesichtshälfte war von der Holzasche grau.
Boyd lachte wieder. »Jetzt hat er seine Kriegsbemalung angelegt, der Hund!«
»Boyd«, sagte Fletcher, »ich werde Ihnen das nicht vergessen!«
»Reiten Sie jetzt mit uns nach Salt Flats zurück, oder wollen Sie allein hierbleiben?«
»Chiquito...«
»Was ist, Sikisn?«
»Ich möchte gern wissen, was mit den Bowyers passiert ist.«
Das Gesicht des Apachen wurde kalt und abweisend. Er schwieg.
»Auf geht es!«, rief Boyd und gab seinem Pferd die Sporen. Der Apache wurde wieder zu Boden gerissen. Das Seil schleifte ihn über den Leichnam seines Freundes hinweg. Fletcher setzte sein Pferd jetzt ebenfalls in Bewegung und fiel Boyd in die Zügel. Der Apache stand wieder auf.
»Boyd - machen Sie das nur noch einmal, dann erschieße ich Sie!«
Boyd grinste. »Sie wollen Marthas Vater erschießen? Nicht Sie, mein Junge!« Doch diesmal ritt er langsamer an, so dass der Indianer zu Fuß folgen konnte.
Fletcher sah den Vertreter mit steinernem Gesicht an. »Ich erwarte von Ihnen eine Zeugenaussage über diesen Vorfall!«
»Was für einen Vorfall, Mr. Fletcher?«
»Sie sollen bezeugen, was Sie mitangesehen haben. Verstehen Sie das nicht, Mann?«
»Wenn Sie es so wünschen, Mr. Fletcher!«
»Also schön!« Fletcher hob die Zügel und folgte Boyd. Und der Vertreter, der den Schluss bildete, schüttelte den Kopf, als müsse er einen bösen Traum loswerden.
Martha Boyd saß im Dunkeln. Draußen vor dem Fenster, längs der Straße, brannten überall Lichter. Mit der Abenddämmerung hatte das erregte Stimmengemurmel im Saloon eingesetzt. Seitdem war es immer lauter geworden. Sie hörte das tiefe Grollen der Stimme ihres Vaters, und sie erschauerte. Vor vier Stunden hatte er zu trinken angefangen, kurz nachdem er den Indianer in die Stadt gebracht hatte. Die Leute waren auf die Straße herausgekommen, um zuzuschauen, und die Kinder hatten johlend im Staub getanzt. Zuerst hatte Martha das zum Lachen gereizt, aber jetzt war ihr zum Weinen zumute. Der Apache war über und über mit Staub und geronnenem Blut bedeckt gewesen. Ihr Vater hatte ihn am Seil durch die ganze Straße geschleift, als bringe er ein Kalb ins Schlachthaus. Er hatte gejohlt und getobt, bis Jason das Seil durchgeschnitten und den Indianer in die Schmiede geführt hatte.
Martha hatte das alles mit angesehen. Sie stand auf und öffnete die Zwischentür zum Saloon einen Spalt. Mr. Harvey fuchtelte mit beiden Händen. John McGill redete, und Martin Schurmann pflichtete ihm mit seiner asthmatischen Stimme bei. Es gab nur ein Thema. Sie wollten den Indianer aufhängen.
Sie schloss die Tür und ging ans Fenster zurück. Sie blickte durch die Scheibe zur Schmiede hinüber. Der Staub auf der Straße sah im Licht des Mondes wie ein weißes Tuch aus, gesprenkelt mit gelben Flecken, die die Petroleumlampen hinter den Fenstern auf die Straße warfen. Das Licht der Lampen und des Mondes war kräftig genug, dass man die Schrift auf den Schildern lesen konnte. Und Marthas Blick huschte immer von neuem darüber hin - ohne dass sie sich klar wurde, weshalb. Harveys Gemischtwaren; McGills Sattlerei und Lederwaren; Schurmanns Barbierstube. Das einzige Gebäude ohne Licht war die alte Belle-Union-Filiale. Die Schrifttafel war fast ganz ausgebleicht, und die Fenster hatte man vor sechzehn Jahren mit Brettern vernagelt. Und nachdem Martha die Schilder gelesen hatte, wurde ihr Blick immer wieder von der schwarzen Fassade der Schmiede angezogen, wo sich Jason mit seinem Gefangenen aufhielt.
Auch Fletcher hörte die Stimmen aus dem Saloon. Er stand in der Schmiede, den Rücken gegen Harveys Wagen gelehnt, auf dessen Räder er neue Eisenreifen ziehen musste. Ab und zu sank das Feuer in sich zusammen und schickte knisternde Funken in die Esse hinauf. Und er hörte auch das tiefe, regelmäßige Atmen dort im Dunkeln, wo Chiquito lag, Hände und Füße gefesselt, den Rücken gegen die Wand gelehnt. Doch meistens horchte Fletcher auf die Stimmen im Saloon. Er konnte zwar die Worte, die geredet wurden, nicht verstehen; aber die leidenschaftliche Erregung der Stimmen war deutlich genug. Fletcher hatte die Leute gezählt, die seit Einbruch der Dämmerung in Boyds Saloon gegangen waren. Inzwischen mussten dort dreißig Männer versammelt sein - fast die vollzählige männliche Einwohnerschaft von Salt Flats.
Einmal hatte Mrs. Harvey sich sehen lassen - war vom Laden über die Straße zum Saloon hinübergegangen. Fletcher hatte ein wenig gelächelt. Wahrscheinlich wollte sie ihren Mann nach Hause holen. Doch als sie dann wieder allein herauskam - steifbeinig, die Röcke ein wenig angehoben, damit der Saum nicht durch den Staub schleifte, da hatte er keinen Anlass mehr, sich zu mokieren. Ihre Entrüstung war eine zusätzliche Warnung. Denn Harvey hatte auf einmal die Courage, gegen seine Frau aufzubegehren. Der Whisky und seine Saufkumpane hatten ihm wohl Mut gemacht.
Auch die anderen Ehefrauen waren gekommen und hatten sich unter der Lampe vor dem Eingang auf der Straße versammelt. Doch keiner von ihnen war es gelungen, ihren Mann aus dem Saloon zu holen. Also kehrten sie zurück in ihre Wohnungen und ließen die Petroleumlampen in den Fenstern brennen. Fletcher ging zu seinem Bett im Anbau der Schmiede und nahm das Gewehr vom Haken. Zum ersten Mal seit seiner Knabenzeit schien ihm der Umgang mit einer Waffe abstoßend und widersinnig zu sein. Er hatte noch nie einen Lynchmord miterlebt, aber er hatte schon oft davon gehört. Manchmal waren die Voraussetzungen die gleichen gewesen wie hier in Salt Flats; eine heiße Nacht, Enttäuschung, Hass und Wut, die sich jahrelang auf gestaut hatten; und zu viel Whisky für Männer, die nüchtern überlegen sollten. Andere Lynchpartys hatten wieder andere Motive gehabt - Dürre und Missernten. Fletcher wusste nicht, was er denken und was er erwarten sollte. Nur eines wusste er ziemlich genau. Er stand ganz allein und ohne Hilfe da.
Hinter ihm bewegte sich der Indianer. »Sikisn?«
»Was willst du, Chiquito?«
»Es ist sehr heiß.«
Fletcher ging zum Wasserfass, tauchte die Kelle ein und brachte sie dem Indianer. Fletcher sah die Zähne und die Augäpfel des Apachen, die im Schein des Schmiedefeuers aufleuchteten. Seine gefesselten Hände erschienen im Licht, als er die Kelle stützte, um besser trinken zu können.
»Danke, Sikisn.«
Fletcher war erschöpft und gereizt. »Warum nennst du mich Bruder? Wir sind uns höchstens dreimal begegnet.«
»Ein Mann weiß, wer sein Bruder ist.«
»Mag sein«, murmelte Fletcher. Er schüttete den Rest des Wassers auf den Boden und nahm sich dann selbst eine Kelle voll. Er trank sie leer, schöpfte von neuem und goss sich das Wasser über den Kopf. Das kühlte ein wenig ab. Er kehrte zur Tür der Schmiede zurück, und wieder folgte ihm die heisere, drängende Stimme des Apachen: »Sikisn?«
»Was hast du jetzt wieder, Chiquito?«
»Lass mich frei.«
Fletcher holte tief Luft. »Nein. Du weißt, dass das nicht...«
»Du hörst die Männer reden.«
»Mehr hat das nicht zu bedeuten, Chiquito. Sie reden nur.«
»Werden sie mich hängen, Sikisn?«
Fletcher wollte darauf keine Antwort geben. Er blickte ärgerlich zu Boyds Haus hinüber. Im Mondlicht sah es glänzend weiß aus. Die hohe Veranda war ein Zeichen von Boyds Stolz und Ehrgeiz. Er hatte sich geweigert, einen überdachten Plankensteig auf gleichem Niveau mit der Straße zu bauen. Die Stimmen wurden immer lauter. Ein Glas zersplitterte. Das Gewehr in Fletchers Händen war feucht vom Schweiß. Fletcher band sein Halstuch ab, um die Waffe abzuwischen.
»Sie werden töten, Sikisn.«
»Nein, Chiquito.«
»Ich weiß. Du weißt.«
»Du bist im Irrtum. Morgen früh ist alles vorbei. Ich kann dich dann mitnehmen zur Ranch der Bowyers.«
»Vielleicht ist Bowyer tot.«
Fletcher zögerte einen Moment. »Tatsächlich, Chiquito?«
Der Indianer antwortete nicht. Fletcher trat vor den Eingang zur Schmiede. Er blickte die Straße hinunter und sah eine Frau auf sich zukommen. Zuerst glaubte er, es wäre Mrs. Harvey, die ihn bitten wollte, ihren Mann aus dem Saloon herauszuholen. Doch dann erkannte er Martha. Sie ging, leicht wie eine Feder, doch ihr Kopf war gesenkt, als würde er durch eine Last niedergedrückt. Ein paar Meter vom Eingang der Schmiede entfernt blieb sie stehen, und Fletcher trat aus dem Schatten des Gebäudes heraus, damit sie ihn erkennen konnte.
»Jason?«
»Ja, ich bin hier.«
»Kann ich näher kommen?«
»Ja«, antwortete er bitter. »Er ist gefesselt, wie es dein Vater haben wollte.«
Sie kam auf ihn zu, hob ihm ihr ovales Gesicht entgegen. »Das meinte ich nicht. Ich dachte, als Stadtmarshai gibt es für dich vielleicht Verordnungen, die...«
»Es gibt keine Verordnungen«, erwiderte er. »Ich weiß nichts von den Rechten und Pflichten eines Marshals - außer dass ich die Arbeit tun muss, für die andere Leute nicht genügend Mut aufbringen.«
Sie sagte eine Weile nichts. Dann spähte sie in das Dunkel der Schmiede. Das Feuer in der Esse war nur noch eine schwache Glut. Doch in der Schmiede roch es wie immer nach heißem Eisen. »Was macht er, Jason?«
»Er ist verschnürt wie ein Paket. Was kann er da wohl tun?« Wieder eine Pause. Dann fragte sie: »Hat er die Bowyers getötet?«
»Er hat es mir nicht gesagt. Ich glaube, er hält das nicht für nötig - wenn man deinen Vater und den anderen zuhört.« Jetzt sprach sie rasch und aufgeregt: »Sie reden davon, dass sie ihn hängen wollen. Harvey, John McGill und sogar der alte Reuben.«
»Und dein Vater?«
Er hörte ihren Atem. »Er auch. Er am allermeisten. Er stachelt sie dazu auf.«
»Ich hätte dich wegbringen sollen«, sagte er. »Vor zwei Jahren schon, als meine Eltern starben. Als ich um deine Hand anhielt und dein Vater mit der Peitsche auf mich losging.«
»Jason!«, rief sie flehend.
»Ich hätte schon ganz andere Dinge tun sollen«, fuhr er fort. »Ich hätte deinen Vater zur Vernunft bringen sollen, ehe er die jungen Indianer in den Bergen erschoss. Ich hätte...«
»Versuche ihn doch zu verstehen!«
»Er springt mit der Stadt um, als gehöre sie ihm.«
»Er war einer von den ersten hier - versteh ihn doch.«
»Ich verstehe ihn nur zu gut. Erst deine Mutter - jetzt du. Jedes Mal, wenn er dich ansieht, erinnert ihn das an deine Mutter und dass sie nicht mehr am Leben ist. Aber das hier ist eine ganz andere Geschichte.«
»Was ist daran anders, Jason?«
»Er hat einen Indianer gefangen. Verstehst du das nicht? Er hat einen Indianer, den er aufhängen kann. Aber nicht für das, was den Bowyers vielleicht zugestoßen sein mag. Er will ihn für den Tod deiner Mutter büßen lassen.«
»Die Stadt ist schuld, weil sie nichts bedeutet, Jason.«
»Dann wird sie uns ebenso verändern, wenn wir hierbleiben. Du musst mit mir kommen.«
»Ich kann nicht.«
»Willst du hier alt und grau werden?«, fragte Fletcher heftig. »Möchtest du vertrocknen wie die Stadt?«
»Ich kann ihn nicht im Stich lassen, Jason.«
»Du schuldest ihm nichts. Kommst du mit?«
»Noch nicht.«
»Wann? Wann, Martha?«
»Ich weiß es noch nicht.«
Sie stand vor dem Eingang, die Hände ineinander verkrampft. Sie konnte Jason im Halbschatten kaum erkennen. »Du verstehst mich doch, Jason - nicht wahr, du verstehst mich?«
Sie wartete auf seine Antwort. Doch als er nichts sagte, drehte sie sich langsam um und ging zurück zum Saloon. Fletcher sah ihr nach.
»Sikisn?« Fletcher wirbelte herum und rief ärgerlich in die dunkle Schmiede hinein: »Jetzt halt endlich deinen verdammten Mund, Chiquito! Hörst du mich? Ich bin nicht dein Bruder!«
Er hörte nur noch das Knarren des Antilopenrohleders, als der Indianer sich gegen seine Fesseln aufbäumte. Dann wurde es wieder still. Fletcher spähte erneut auf die Straße hinaus - auf den flackernden Schein der Petroleumlampen. Er hörte Rufe und Gelächter.
Eine Stunde später stieß Boyd die Schwingtüren seines Saloons auf. Er kam herausgeschossen wie eine Kugel und stand einen Moment auf der Veranda, sein mächtiger Körper eine schwankende Silhouette gegen das Licht über der Tür. Er johlte wie ein Cowboy und taumelte dann die Stufen auf die Straße hinunter. Dort schwankte er wieder johlend hin und her. Dann folgten die anderen.
Es war eine sich stoßende, schiebende Meute. Sie schwangen die Fäuste, hielten Flaschen über die Köpfe hoch. Auch der Vertreter war dabei. Sein Kragen stand offen, und er trug nur noch die Weste zu der staubigen Hose. Er grölte und sang und war betrunkener als alle anderen.
Und dann zog sich die Meute zusammen - instinktiv, dem Massentrieb gehorchend. So kamen sie auf die Schmiede zu. Wenn dreißig Männer schreien, klingt das nicht mehr menschlich, dachte Jason und trat auf die Straße hinaus. Er hielt das Gewehr mit beiden Händen quer vor dem Körper. Er wusste, dass man ihn gut sehen konnte, doch die Meute blieb nicht stehen. Sie rückten vor, Boyd allen voraus, der ein Seil wie ein Lasso schwang.
Als sie nur noch zwanzig Schritt von ihm entfernt waren, rief Fletcher: »Mr. Boyd!«
Sie hielten an, und für einen Moment schwiegen sie alle, ein stupides Grinsen auf den schwitzenden, trunkenen Gesichtern. Fletcher versuchte, die Gesichter nach Namen zu identifizieren. Es gelang ihm nicht, obgleich er sie alle gut kannte.
Der Vertreter drängte sich nach vorn, stellte sich neben Boyd. »Mr. Fletcher«, lallte er, »Für die Sicherheit im Westen und den Schutz unserer tapferen Frauen...«
Hinter ihm erklangen spöttischer Applaus und Hochrufe, und der Vertreter drehte sich um und verbeugte sich aus der Hüfte. Dann schwenkte er wieder herum und öffnete den Mund; doch ehe er einen Ton herausbringen konnte, packte Boyd ihn bei den Schultern und warf ihn in den Staub.
»Fletcher!«, grölte er.
»Was wollen Sie von mir, Mr. Boyd?«
»Sie wissen ganz genau, was wir wollen!«
»Sie sollten es lieber selbst aussprechen, damit die anderen es hören und sich später gut daran erinnern können!«
Boyd trat wieder einen Schritt vor und klatschte mit dem Seil gegen sein Bein. Dann hob er es hoch. »Nun, wir haben daran gedacht, einen Indianer am Hals aufzuhängen.« Er blickte über die Schulter. »Was meint ihr dazu?«
Ein Jubelschrei antwortete ihm. Der alte Reuben brach aus der Meute aus, bewegte seinen Kahlkopf ruckartig auf und ab und stampfte auf der Stelle. Er heulte, wedelte mit der gestreckten Hand vor dem Mund und führte einen grotesken Kriegstanz auf, bis ihn jemand umrempelte. Er stand wütend wieder auf und fuchtelte mit beiden Armen. Die Meute drängte vorwärts, stieß gegen Boyd. Fletcher lud den Karabiner durch und hob ihn an die Schulter. Wieder blieb die Menge stehen.
»Fletcher«, sagte Boyd, »jetzt hören Sie mal zu!«
»Ich habe genug gehört, Mr. Boyd. Jetzt geht nach Hause!«
»So, so«, meinte Harvey, schob sich nach vorn, die Daumen in die Weste gehakt, ein prahlerisches Grinsen auf den Lippen. »Seht ihn euch an!«
»Sie gehen ebenfalls nach Hause, Mr. Harvey«, sagte Fletcher. »Ihre Frau hat Sie bereits vermisst!«
Das Gelächter der Menge machte Harvey wütend. »Was denken Sie eigentlich, wer Sie sind, junger Mann?« herrschte er Fletcher an.
»Ich bin der Stadtmarshai, Mr. Harvey - von euch allen gewählt!«
»Dann, beim Zeus, wählen wir dich eben wieder ab!«, rief der alte Reuben, und die Menge jubelte wieder ihren Beifall.
»Haben Sie das gehört?«, rief Boyd. »Sie sind nicht mehr länger Marshal. Machen Sie, dass Sie uns aus dem Weg gehen!«
»Ich lege mein Amt erst nieder«, erwiderte Fletcher, »wenn es mir von einer ordentlichen Gemeindeversammlung abgesprochen wird. Ihr seid keine ordentliche Versammlung.«
»Wollen Sie uns vielleicht belehren, was eine...«
»Tut mir leid, Mr. Boyd. Aber ihr seid betrunken und wisst nicht, was ihr tut.«
»Was wollen Sie daran ändern, he?«, grölte Schurmann. »Wollen Sie uns alle mit Ihrer Fliegenspritze erschießen, eh?«
Fletcher antwortete nicht. Hinter ihm erklang eine leise, drängende Stimme: »Sikisn!«
»Wir vergeuden nur unsere Zeit!«, röhrte Boyd. »Er wird es nicht wagen, auf uns zu schießen!« Er schwankte, nach vorn geneigt, auf den Eingang der Schmiede zu. Als Fletcher das Gewehr auf ihn richtete, blieb er verwundert stehen. Doch dann lachte er laut.
»Stellen Sie das Ding weg!«, rief er. »Ich sagte Ihnen schon - Sie erschießen keinen von uns!«
»Das werde ich tun, wenn ich muss. Mr. Boyd.«
Einen Moment lang starrte ihn Boyd an, dann drehte er sich schwankend um. »Hört mir mal alle gut zu!«
»Bringt die Sache endlich zu Ende!«, rief Harvey.
»Hört zu - horcht genau her! Denn wenn er mit dem Gewehr auf mich schießt, sollt ihr auch alle wissen, warum!«
»Warum?«, grölte der Vertreter und stieß gegen Boyd. »Erzählen Sie schon!«
Boyd stieß ihn weg. »Er glaubt, er könne meine Martha haben, wenn ich tot bin. Er will den Indianer gar nicht schützen. Er braucht einen Vorwand, um mich auf legalem Wege töten zu können!«
Er wendete sich wieder Fletcher zu. Sein Gesicht war verzerrt. »Ich habe doch recht - nicht wahr? Schon seit Jahren ist er hinter meiner Martha her. Nur ich habe sie dir nicht gegeben. Habe dir einen Korb gegeben - mit der Peitsche, erinnerst du dich noch? Wenn du mich erschießt, mein Junge, musst du schon einen verdammt guten Grund dafür haben.«
Fletcher ließ die Waffe ein paar Zentimeter sinken. In diesem Moment handelte Boyd. Sein Arm schoss vor, das lose Ende des Seils klatschte Fletcher ins Gesicht, blendete ihn, ringelte sich um das Gewehr.
Er taumelte zurück und fühlte sich von vielen Händen ergriffen. Sie warfen sich auf ihn, als er stürzte. Jemand riss ihm das Gewehr aus den Händen. Andere wieder knieten sich auf seine Brust, quetschten ihm den Atem aus dem Leib. Eine Faust schlug auf seinen Schädel ein. Man packte seine Hand- und Fußgelenke.
Die Hölle brach los. Er hörte Johlen, Gelächter, grölendes Schreien. Obgleich seine Augen offen waren, konnte er in der dunklen Schmiede nicht viel erkennen, während er mit den Männern rang, die auf ihm lagen. Vorübergehend gelang es ihm, seinen Oberkörper aufzurichten. Im hellen Viereck des Eingangs waren Boyd, Harvey und der Vertreter damit beschäftigt, den Indianer an den Füßen aus der Schmiede zu schleifen. Der Kopf des Apachen holperte über den harten Steinboden.
Dann hatten sie Fletcher wieder niedergedrückt. Er hörte eine Stimme schreien: »Nein, nein!« Er wusste nicht, dass er selbst geschrien hatte. Er roch den Whiskydunst, ekelhaft süßlichen Schweiß und Pferde. Dann konnte er keine Muskel mehr rühren; denn die Männer saßen auf seinen Armen, lagen quer über seinen Beinen, und Martin Schurmann und der alte Reuben hockten auf seinem Brustkasten und grölten sich gegenseitig an.
Aber er konnte noch den Hals bewegen und die Tür sehen. Er sah, wie das Seil hochflog, wie die Schlinge hin und her pendelte, als das Seil am Balken des Heuaufzugs hing. Die Schlinge schien endlos zu pendeln, bis sich ein Arm danach reckte und sie festhielt - ein Arm in Hemdsärmeln und einen Gummihalter darum herum.
Dann kam Chiquito in sein Blickfeld, gestützt von Harvey. Die Schlinge legte sich um den Hals des Apachen.
Plötzlich gab es einen schrillen Schrei. Der betrunkene Vertreter stürzte sich mit schwingenden Fäusten auf Boyd. Er schlug auf ihn ein, doch der kräftige Saloonwirt lachte nur, packte den Handlungsreisenden bei der Kehle, als dieser den Hals des Indianers aus der Schlinge befreien wollte, und warf ihn hinaus. Diese unerwartete Unterbrechung hatte die Männer, die auf Fletcher lagen, abgelenkt. Er riss sich los, kam auf die Füße, schwang die Fäuste. Er sprang zur Tür, sah das straffe Seil sich spannen.
Der Apache starrte Fletcher an. »Sikisn!«, sagte er. Seine Augen waren wie die eines wehrlosen Tieres.
Fletcher schrie und warf sich auf Boyd. Der riesige Mann hob beide Arme und schmetterte den Kolben des Gewehres auf Fletchers Kopf. Dann war nichts mehr - nichts als Dunkelheit und ein Rauschen wie die Regenflut während der Winterzeit.
Er kam nur langsam aus der Dunkelheit heraus. Er fühlte, roch und hörte, ehe er den Schmerz ertragen konnte, die Augen zu öffnen. Er fühlte etwas Kaltes auf seinem Gesicht und spürte dünne, pochende Fäden, die sich von seinen Wangen bis zum Genick hinzogen. Er roch Staub und heißes Eisen. Und er hörte das rhythmische, unerbittliche Knarren eines schwingenden Seiles.
Schließlich öffnete er die Augen. Über ihm war der Nachthimmel - klar und sauber im Licht des Mondes und der Sterne. Er sah sie, bis ein Schatten sich dazwischenschob und ein Gesicht auf ihn herunterblickte. Es war Martha, und ihre Hand lag auf seiner Stirn. Er schloss wieder die Augen, damit die Schmerzen nachließen, doch er wusste, dass er eigentlich nur eine Ausflucht suchte, um sich nicht umsehen zu müssen, weil er Angst hatte vor dem, was in seiner Nähe war. Er hörte das Rascheln von Marthas Kleid, als sie mit der Schöpfkelle Wasser holte und ein Tuch auswrang. Dann lag wieder etwas Kühles auf seinem Gesicht.
Endlich stützte er sich auf die Ellenbogen, obwohl Martha ihn niederhalten wollte. Er zwang sich, nach oben zu sehen. Dort hing Chiquito in der Schlinge, und der Körper pendelte im Nachtwind hin und her, und das Seil knarrte leise.
»Zur Hölle mit ihnen!«, fluchte Fletcher.
»Jason«, flüsterte Martha unglücklich.
Er schob sie weg, stand auf, hielt sich schwankend am Amboß fest. Er blickte starr nach oben.
Etwas bewegte sich zu seinen Füßen. Eine Hand tastete nach seinem Bein und ein Gesicht, nass von Tränen, blickte zu ihm auf.
Es war der Vertreter.
»Ich wollte helfen«, stöhnte er. »Ich versuchte, sie aufzuhalten. Gott erbarme sich meiner!«
Fletcher blickte die Straße entlang. Salt Flats lag jetzt im Dunkeln. Nur ein Licht brannte im Haus von Boyd. Doch die Dunkelheit wich bereits dem Licht eines neuen, heißen Morgens. Im Osten zog sich ein Streifen rosenfarbenes Grau mit Säumen aus dunklem Gelb über den Horizont. Und immer noch knarrte das Seil mit dem schwingenden Körper von Chiquito.
»Gott erbarme sich meiner!«, wiederholte der Vertreter immer wieder. Dann erstarben die Worte zu einem Flüstern, bis sich seine Lippen nur noch lautlos bewegten.
»Jason.«
Fletcher drehte sich um. »Wo sind sie alle? Wo ist dein Vater?«
»In seinem Zimmer. Er sitzt dort und starrt auf Mamas Bild.«
»Ich hoffe, er findet keinen Schlaf mehr. Ich hoffe, keiner in dieser Stadt kann mehr schlafen.« Fletcher schwankte hinaus, blieb mitten auf der Straße stehen, schrie gellend: »Hört ihr mich? Hoffentlich könnt ihr nicht mehr schlafen! Ihr sollt nie mehr schlafen - hört ihr?«
»Gott erbarme sich meiner«, stöhnte der Vertreter.
Fletcher ging zurück in die Schmiede, legte den Arm gegen die Wand und stützte seinen Kopf darauf. Martha trat neben ihn und legte ihm zögernd den Arm um den Hals.
»Sollen wir ihn herunterholen, Jason?«
Er hob den Kopf und sah sie an. »Herunterholen?«
»Den Indianer.«
»Nein«, sagte er. »Lass ihn dort hängen. Sie sollen ihn hängen sehen. Ihre Frauen sollen ihn sehen. Und die Kinder. Sie waren betrunken genug, ihn zu hängen - sollen sie zusehen, ob sie ihn begraben können, wenn sie wieder nüchtern sind.«
»Was werden wir beide tun, Jason?«
»Wir?«
»Du und ich.«
Er begann zu begreifen. »Nur du und ich?«
»Es gibt nichts, was uns beide hier hält.«
Er blickte zu Chiquitos Leiche hinauf. »Es wird immer etwas geben, was uns an diesen Ort bindet.« Dann blickte er sie an. »Dein Vater?«
»Als er zurückkam - später«, sagte sie, »saß er eine Weile nur da und stierte vor sich hin. Dann bat er mich, dir zu helfen. Dann küsste er mich. Er hat das nicht mehr getan, seit Mutter starb.«
»Chiquito würde sich darüber freuen, wenn er es hören könnte«, sagte Fletcher verbittert.
»Ich habe meine Sachen gepackt«, sagte sie. »Ich habe ja nicht viel, aber was ich habe, ist in Mutters alter Reisetasche dort drüben. Bring mich weg, Jason. Jetzt sofort.«
»Gott erbarme sich meiner«, wimmerte der Vertreter.
Die Sonne stand eine Handbreit über dem Horizont, als sie Salt Flats verließen. An anderen Tagen wäre um diese Zeit bereits Leben auf den Straßen gewesen - Leute, die ihren Arbeiten nachgingen, ehe die Hitze jede Verrichtung zu einer Plage werden ließ. Um diese Zeit fegte sonst Martin Schurmann den Gehsteig vor seinem Geschäft, und Harvey trug Mehlsäcke vor den Laden und schichtete sie dort auf. Aber heute war niemand auf der Straße, als Fletcher mit dem Einspänner durch den Ort fuhr. Hinter dem Wagen trabte sein Rotschimmel, den er mit der Trense am Wagen festgebunden hatte.
Sie blickten weder nach rechts noch nach links, als sie durch Salt Flats fuhren. Und sie blickten auch nicht mehr zurück zu den gebleichten Holzhäusern.
Fünf Meilen vor der Stadt begegneten sie einem Planwagen. Er kam auf dem Fahrweg aus den Mogollons heran, und Fletcher hielt an einer Ausweichstelle, um den größeren Wagen vorbei zu lassen.
Auf dem Bock saß ein Mann neben einer Frau. Unter der Plane lugten vier Kinder hervor, ihre Gesichter sauber geschrubbt und freundlich. Im Wagen saß noch einer, der scheu durch die Ritzen der Seitenplanken spähte. Das war der Apachenjunge, der in den Busch gerannt war, als Boyd Panayotishn niedergeschossen hatte.
Der Wagen hielt neben Fletcher, und der Mann steckte die Peitsche in die Halterung. Er nickte Fletcher zu und tippte an die Hutkrempe, als er Martha sah. Er lächelte nicht.
»Guten Morgen, Jason... Guten Morgen, Miss Boyd.«
Sie erwiderten seinen Gruß. Er blickte sie einen Moment an, deutete dann mit dem Daumen hinter sich. »Ist das wahr, was der Indianer uns erzählt hat?«
»Es ist wahr.«
»Eine schlimme Nachricht, Jason.«
»Sie ist schlimmer, als Sie glauben.«
Der Mann betrachtete neugierig die Reisetaschen und Schachteln auf dem Einspänner. »Verlasst ihr Salt Flats?«
»Ja, wir verlassen den Ort.«
Der Mann nickte ernst und sagte dann: »Wo ist Chiquito? Ist er in der Stadt.«
»Er ist in der Stadt.«
»Ich möchte mit Ihrem Vater über den Vorfall sprechen, Miss Boyd.«
»Er wird Ihnen zuhören, denke ich«, sagte Fletcher mit harter Stimme.
»Nun denn«, murmelte der Mann.
Fletcher berührte flüchtig die Krempe seines Hutes. »Guten Tag, Mr. Bowyer«, sagte er. »Guten Tag, Mrs. Bowyer.«
Er schnalzte mit der Zunge, schwang die Zügel und fuhr weiter.
Fred Grove: DIE WEISSE INDIANERIN (Comanche Woman)
Es war erstickend heiß. Die Reiter auf der Prärie ritten weit auseinandergezogen, schleiften lange Travois-Stangen hinter sich her, die dünne Sandfontänen aufwirbelten. Sie ritten auf mageren Pferden, rückten langsam und behutsam vor wie Fremdlinge in einem Land, in dem sie früher unumschränkt herrschten. Sie folgten einem einzelnen Krieger, der auf das steinerne Fort zuhielt. Dort erwartete ihn eine Schwadron vor den Mauern.
»Glauben Sie, es gibt Schwierigkeiten?«, fragte der junge Lieutenant, der das Kommando führte, nervös. Er wendete sich einem Mann mit wettergegerbtem Gesicht zu, dessen struppiger Bart, der Linie des Jochbogens folgend, die breiten Lippen halb verdeckte. Als Kundschafter der Regierung war der Mann schon sehr sonderbar gekleidet, dachte der Lieutenant: speckige blaue Kniehosen, gemustertes Kattunhemd, eine Weste aus Kalbfell und dazu dieser lächerliche Hut mit der riesigen Krempe und dem Band aus verblichenem Biberfell, das irgendein Kennzeichen oder Abzeichen sein sollte.
Der Alte - er war viel älter, als er den Offizieren des Forts eingestehen wollte - legte die Hand über die Augen. Blinzelnd spähte er in die Prärie hinaus, verharrte in dieser straffen, angespannten Haltung. Seine Augen taugten nicht mehr viel; aber er kannte diese Leute nur zu gut, die Krieger der Antilope! Er beobachtete den Anführer des Trupps. Über dem breiten Comanchengesicht mit den ausgeprägten Wangenknochen flatterte blondes Haar - hell wie Weizengrannen.
»Sie kommen in friedlicher Absicht«, murmele der Alte. »Indianer nehmen ihre Familien nicht mit auf den Kriegspfad«, fuhr er fort. »Was Sie dort sehen, sind die letzten Comanchen, Lieutenant.« Der Alte unterdrückte den Groll, der in ihm aufsteigen wollte. »Buffalo ist tot, der Krieg vorbei. Vergessen Sie das nicht.«
Es gab eine Menge, was man nicht vergessen sollte, dachte der Alte. Sein Geist begann zu wandern, tauchte ein in die Vergangenheit, holte sich das Bild der endlosen Grasflächen, der sonnenüberfluteten Berge zurück, zwischen denen dieses Volk dahinritt wie ein Wirbelwind. Und dann sah er wieder das träumende Gesicht der weißen Frau vor sich, die vor so langer Zeit bei diesem Volk gelebt hatte...
Es war bereits später Nachmittag, als die Frauen Mezquiteholz für die Kochfeuer sammelten, ehe Emily Gelegenheit fand, sich dem kleinen weißen Mädchen zu nähern, das Bärentöter am Morgen als Gefangene ins Lager gebracht hatte.
Das Mädchen wirbelte herum. Sein kleines, verschüchtertes Gesicht verzerrte sich in jähem Schrecken. »Lass mich!«, schrie es und zuckte zurück. Die Haut - viel zu blass für die glühende Sonne von Texas - schälte sich schon von Nase und Wangen. Sein Haar hatte die Farbe des Flachses und war mit Staub und Sand verklebt. Doch was Emily wie ein Stich ins Herz traf, war das jähe Entsetzen, das in diesem kleinen, mageren Gesichtchen mit den weit aufgerissenen blauen Augen stand, die viel zu groß für dieses Kindergesicht zu sein schienen. Das Mädchen konnte höchstens zehn Jahre alt sein.
»Nicht weh tun - dir«, sagte Emily. Sie hatte sich immer wieder dazu gezwungen, englisch zu sprechen; damit sie nicht die Sprache ihrer Leute vergaß.
Sie streckte vorsichtig die Hand aus. Sie war nicht überrascht, als das Mädchen sie wegschlug.
»Nicht weh tun - nicht weh tun.«
»Geh weg, du dreckige Indianerin!« Das Mädchen raffte ihr kleines Holzbündel auf und rannte fort.
Emily fing sie wieder ein. Die Kleine wimmerte und wand sich, und während dieses kurzen Ringens kam es Emily schmerzhaft zu Bewusstsein, dass das weiße Mädchen viel zu schwach für die Lagerarbeit war. Lange nicht so kräftig wie Emily, als man sie damals gefangengenommen hatte. Sobald es Winter wurde, würde die Kleine sterben wie eine junge Wachtel, die vom Schneesturm überrascht wird.
»Ich weiß - ich weiß«, Emily suchte verzweifelt nach Worten, hielt das Mädchen fest, ohne ihm weh zu tun. Sie deutete auf ihre eigenen blauen Augen und ihr blondes Haar. »Siehst du? Ich so weiß wie du!«
Die Kleine ließ ihr Holzbündel fallen. Der Schrecken wich aus ihrem Gesicht, als sie Emilys Gestalt zum ersten Mal richtig zu betrachten schien. Ihre Lippen zitterten, und sie warf sich schluchzend in Emilys Arme. Emily murmelte Worte, die sie seit Jahren nicht mehr gesprochen hatte.
»Wie heißt du denn, Kleines?«, fragte sie nach einer Weile. »Mary - Mary Tabor.«
»Wo kommst du her?«
»Fort Belknap - ein Stück flussabwärts.«
»Am Salt Fork bei den Brazos.«
Mary lächelte mit nassen Augen. »Bist du schon dort gewesen?«
»Ist schon lange her«, log Emily, um das Kind bei guter Laune zu halten.
»Meine Eltern...«, fing Mary wieder an. Ihre Lippen zuckten. Emily schüttelte den Kopf. »Sprich jetzt nicht davon. Geh zurück ins Lager. Zeige den Indianern nicht, dass du geweint hast. Sei tapfer.«
An jenem Abend sprach sie mit Springender Bulle über Mary. »Das kleine Texaner-Mädchen, das Bärentöter gefangen hat - ich möchte sie als Sklavin für unser Zelt haben.«
»Sie ist nicht kräftig. Du wirst sie pflegen müssen.«
»Sie ist nicht kräftig, weil Bärentöter sie misshandelt. Sie muss hungern. Sie sehnt sich nach ihren Leuten. Ich könnte ihr vieles beibringen. Sie könnte mir eine jüngere Schwester ersetzen.« Im Dämmerlicht des Zeltes sah Emily, wie der Blick aus den dunklen Augen ihres Mannes über sie hinglitt. Ein zärtliches Gefühl stieg in ihr auf. Sie konnte nicht vergessen, wie er damals Antilopenrenner, der sie gefangengenommen hatte, viele Pferde als Lösegeld für sie bezahlt hatte. In gewisser Weise war sie sogar stolz auf ihn. Springender Bulle war ein Krieger, dessen Ansehen im Stamm ständig wuchs. Er konnte immer mit einer großen Zahl von Anhängern rechnen, wenn er einen Kriegszug gegen die Utes oder die Tejanos unternahm. Und selbst wenn sie wusste, dass er die Siedlungen der Weißen heimsuchte, hoffte sie immer, dass er unversehrt zurückkehrte. Sie wunderte sich nur, dass er als reicher Krieger, der nur einen Sohn hatte, nicht noch eine weitere Frau in seinen Wigwam geholt hatte. Als erprobter Jäger konnte er mit Leichtigkeit mehrere Frauen und Kinder ernähren.
Dennoch lag eine Kluft zwischen ihm und ihr - die Erinnerung an ihre ermordeten Angehörigen, obgleich dieser Tag schon so lange zurücklag, als wäre er nur ein böser Traum gewesen. Und damals war Springender Bulle auch noch zu jung gewesen, um sich an dem Kriegszug beteiligen zu können.
Er antwortete ihr nicht. Und da sie sich noch nie etwas so sehr gewünscht hatte wie die Obhut über dieses kleine weiße Mädchen, unterdrückte sie wohlweislich ihren Eifer.
Zwei Tage vergingen. Da entdeckte sie plötzlich, dass sich die Pferdeherde ihres Mannes verkleinert zu haben schien. Ein paar seiner schnellen Buffalo-Renner waren verschwunden. Sie sagte nichts und wartete.
Am dritten Tag zog Mary Tabor zu ihnen in den Wigwam. »Nun berichte mir von deinen Angehörigen«, bat Emily die Kleine.
Mary starrte auf die Spitze ihrer Mokassins. »Ausgelöscht. Es sei denn, Onkel Arnos konnte sich retten.« Sie zitterte, und Emily sah wieder die Angst in ihrem Gesicht - so deutlich wie die Strieme eines Peitschenhiebes.
»Eines Tages wirst du wieder dorthin zurückkehren können«, sagte Emily ernst. Das arme Ding tat ihr leid. »Gib die Hoffnung nie auf, Mary. Ich tue es auch nicht.«
Marys große Augen ruhten nachdenklich auf ihr. Sie blickten viel ernster, als man es bei ihren Jahren erwarten konnte. »Du würdest Springender Bulle verlassen, wenn du könntest?«
Emily schlug die Augen nieder. Irgendwie schien sie verletzt und überrascht.
»Springender Bulle ist ein guter Mann - sehr rücksichtsvoller Mann für einen Indianer«, plapperte Mary weiter. »Hat gute Pferde für mich gegeben. Er ist nicht gemein wie Bärentöter, der immer seine Frauen schlägt. Ich glaube, ich habe sehr großes Glück gehabt. Ich weiß das ganz genau. Und du - du bist so gut zu mir, Emily. Zeigst du mir jetzt, wie man Indianerarbeit verrichtet? Ich muss ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich kann ein bisschen nähen. Ich kann auch kochen - und Maisbrot machen.«
»Wir haben kein Maismehl«, erwiderte Emily lächelnd. Mary würde ihnen bestimmt nicht zur Last fallen, dachte sie. Als erstes wusch sie Marys Haare und flocht sie zu Zöpfen. Schon am Nachmittag hatte die Kleine ihren gequälten, verschüchterten Blick verloren. Emily nähte ihr Kleider aus Rehfellen, nachdem sie sie weich und glatt gegerbt hatte. Und die Säume und Ärmel bestickte sie mit bunten Perlen.
In Marys Nähe erwachte in Emily wieder die Erinnerung an längst vergessen geglaubte Worte und Redewendungen. Heimweh ergriff sie. Deutlicher als je zuvor stieg vor ihren Augen das Bild der Landschaft im Frühling wieder empor, als sie vor den Palisaden des Lagers mit den anderen Kindern gespielt hatte - unter den roten Pflaumenbüschen, an denen schon die Früchte hingen. Sie erinnerte sich an das liebe Gesicht ihrer Mutter, die freundlichen Nachbarinnen, an ihren Vater, der gerade nicht im Lager weilte, als die Indianer sie überfielen. War er noch am Leben? Hatte er nach ihr geforscht oder Lösegeld geboten? Sie fühlte die Stärke eines neugefassten Entschlusses. Sie verwendete jetzt viel mehr Zeit darauf, ihren Sohn Gelbvogel zu erziehen.
»Friede ist besser als Krieg«, pflegte sie zu sagen, wenn Springender Bulle gerade nicht in der Nähe war. »Es ist nicht recht, wenn man tötet.«
»Die Tejanos töten uns aber«, antwortete der Knabe. Er war dunkelhäutig wie ein reinblütiger Indianer und hatte die stolzen, hohen Jochbeine seines Vaters. Doch der großzügige Schnitt seiner Lippen, die blauen Augen und die blonden Haare verrieten seine gemischte Abkunft. Leider dachte er auch wie ein Comanche.
»Es gehört viel Mut dazu, dem Weg des Friedens zu folgen, wenn die anderen das Kriegsgeheul anstimmen«, sagte sie.
Der Junge sah sie an. »Mein Vater ist tapfer. Er kämpft.«
Jedes Mal, wenn sie bei ihrer Unterhaltung am toten Punkt angelangt waren, sprang er erleichtert auf und rannte aus dem Zelt. Emily, ihren Träumen überlassen, sah ihn als weißen Mann heranwachsen und ein festes Haus mit Fenstern beziehen.