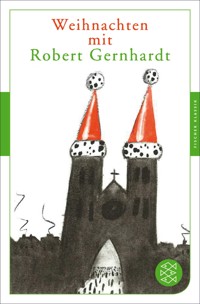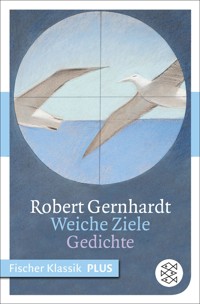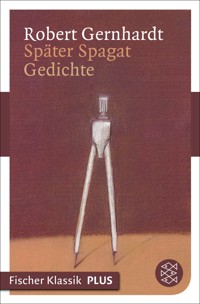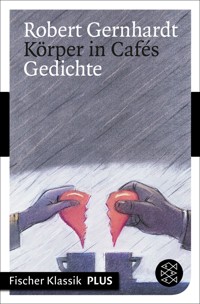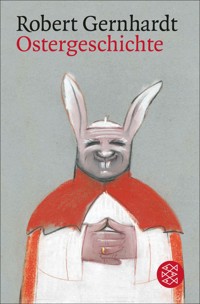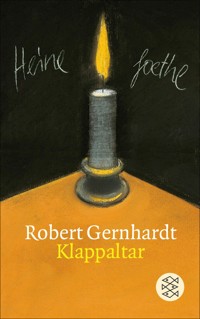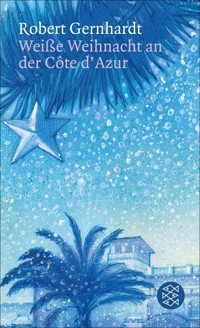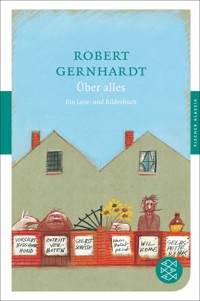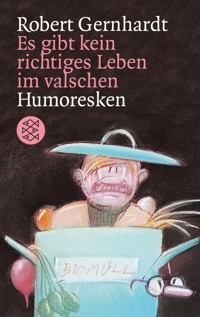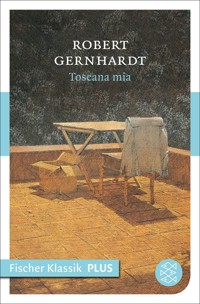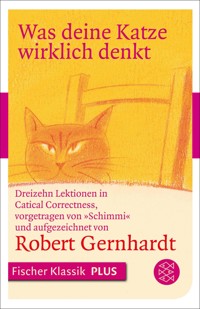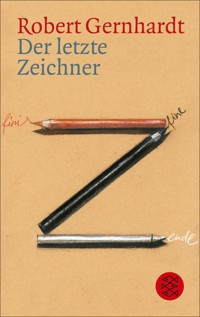
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Ein unverzichtbarer Wegweiser durch die Kunst Robert Gernhardt spitzt die Feder: Kampf den Dilettanten in der Kunst! In der Titelgeschichte erklärt der letzte Meister seinem letzten Schüler die verheerende Entwicklung der Kunst. Während Gernhardt mit dem ewigen Dilettanten abrechnet, äußert er sich profund über die von ihm verehrten Künstler und Könner. Von Giotto über Leonardo und Michelangelo bis hin zu Busch, Pfarr und Sowa, von den Klassikern der Malerei bis zu den großen Karikaturisten unserer Tage reicht Gernhardts Palette. Ein unverzichtbarer Wegweiser durch die Kunst, ein Buch, das den Zeichner und Schriftsteller Gernhardt in neuem Licht zeigt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Robert Gernhardt
Der letzte Zeichner
Aufsätze zu Kunst und Karikatur
Über dieses Buch
Robert Gernhardt spitzt die Feder: Kampf dem Dilettanten! Voller Verve weist Robert Gernhardt einen Weg durch die Kunst, gibt Hinweise, was man sehen sollte und wo man besser wegschaut. Er rechnet ab mit dem ewigen Dilettanten und stellt wahre Künstler und Könner vor. Von Giotto und Michelangelo bis hin zu Busch, Pfarr und Sowa, von den Klassikern der Malerei bis hin zu den großen Karikaturisten unserer Tage reicht Gernhardts unterhaltsamer und kenntnisreicher Führer durch die Kunst.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books 2016
© 2001 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Buchholz/Hinsch/Hensinger
Coverabbildung: Robert Gernhardt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403214-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
I Zum Stand der Dinge
Der letzte Zeichner
II Zu Künstlern
Die tollen Streiche der florentiner Renaissance-Künstler
»Schweer, Schweer«
Alt aussehen
Faz, Beuys, Schmock
Es ist ein Has’ entsprungen
III Vor Bildern
Dein Museum am Main
Fünfmal Begeisterung
Fünfmal Verwunderung
Fünfmal Ärger
Stille Stunden in Karlsruhe
Das hab ich bei Vermeer gelernt
Das Steckbrett auf dem Streckbett
IV Von Könnern
Lachen in Frankfurt – Ein Trauerspiel?
Vom Wettlauf zwischen Hase Hochkunst und Igel Karikatur
Wenn Künstler zuviel witzeln
Schlag nicht nach bei Flemig
Mann unter Strom
Caricatura Ricca
Krieg wegen Chlodwig Poth?
Alles von ihm
Was ein guter Cartoonist braucht,was einen guten Cartoonisten ausmachtundwas einem guten Cartoonisten zusteht
Feier oder Feuer
»Sowas möchte ich auch haben«
Grill-Patzer
V Über den Lauf der Zeit
Engel, Löwe, Lichtfleck
Ballade von der Lichtmalerei
Nach- und Hinweise
IZum Stand der Dinge
Der letzte Zeichner
Der Tempel erstürmt, die Bildsäulen gestürzt, die Opferstätten verwüstet. Die Altäre umgewidmet, die Kelche entweiht, das Tabernakel geschändet. Die Fackel gesenkt, die Lunte gelegt, der Sieg vollkommen – wäre da nicht der Alte, der sich in die Cella, das siebenfach geschützte Allerheiligste des Kunsttempels, geflüchtet hat und nun so irr wie wirr auf seinen Begleiter, den Jungen mit den geweiteten Augen, einredet:
»Antonio, hör mir gut zu: Höre nicht auf mich! Habe ich dir jemals gesagt, Kunst käme von Können, käme sie von Wollen, hieße sie Wulst? Vergiß es! Die Wulst hat gesiegt, die Kunst ist am Ende, zusammen mit dem Jahrtausend, das einige ihrer glorreichsten Siege sah, räumt sie geschlagen das Feld dem, der sie seit Anbeginn gewünscht und verwünscht, verteufelt und vergöttert hat: dem ewigen Dilettanten. Sieben Pforten muß er noch sprengen, eine aus Holz, eine aus Stein, eine aus Eisen, eine aus Stahl, eine aus Bronze, eine aus Silber und eine, diese hier, aus eitel Gold. Sieben Kerzen brennen in diesem Leuchter, erlischt die erste, bedeutet das, daß die erste Pforte überwunden wurde und so fortan: Ist die letzte Kerze niedergebrannt, werden sie durch die goldene Pforte in unser Versteck treten, sie, denn der ewige Dilettant ist Legion.
Er war es seit Beginn der Menschheits-, und das meint ja zugleich: Kunstgeschichte. Schon in den Höhlen der Steinzeit war er so zahlreich wie der Begabte rar, der verfluchte ewige Begabte, der ihm in den vergangenen zwanzigtausend Jahren immer dann lächelnd in den Weg trat, wenn er, der ewige Dilettant, drauf und dran war, auch einmal vom Honig des Künstlertums zu kosten, von Beifall und Ruhm, Wirkung und Dauer. Wenn er sich unterstand, im Schein blakender Fackeln unbemerkt zu Malrohr und Farbe zu greifen, um die beeindruckende Kavalkade der die Höhlenwand entlangstürmenden Hirsche, Büffel und Steinböcke durch ein – ja was eigentlich? – zu bereichern.
›Was malsten da, Og-Og?‹
›Ja, seht ihr das denn nicht? Ein Wildpferd!‹
›Ein Wildpferd? Aber ein Wildpferd hat doch keine Tellerohren wie die Kuh! Und hinten hat es keine Knie wie der Mensch! Wildpferde scheinen ja nicht gerade deine Stärke zu sein, Og-Og!‹
Und unter allgemeinem Gelächter war dann einer der ewigen Begabten aufgestanden, hatte dem Möchtegernkünstler lächelnd den Malstock aus der Hand genommen, ihn in Farbe getaucht und mit so beneidenswerter Schnelligkeit wie hassenswerter Sicherheit hier und da Korrekturen angebracht, die das soeben noch berätselte Tier auf nicht weniger rätselhafte Weise zum derart lebensechten Abbild eines dahinjagenden Wildpferds machten, daß der jubelnden Zuschauerschar das Wasser im Munde zusammenlief und einige bei dem verlockenden Anblick unwillkürlich damit begannen, vor lauter Jagdeifer die Speere und Feuersteinäxte zu schwingen …«
Während dieser Worte hatte der Alte die Schränke, Schubladen und Regale des ihm offensichtlich wohlvertrauten Raumes flüchtig gemustert, mit einem »Wußt ich’s doch!« eine große bauchige Korbflasche hinter einer gegen die Wand gelehnten Kopie der ›Schule von Athen‹ hervorgeholt, sich einen ausgedehnten Schluck gegönnt, nun wandte er sich den Büchern und Katalogen zu, die neben einem Reißbrett, Zeichenpapieren und den vielfältigsten Kreiden vor ihm auf dem großen Tisch lagen.
»Alles parat«, sagte er, um fortzufahren: »Antonio, habe ich dir jemals zugerufen: Zeichne, Antonio, zeichne? Ich tat es mehr als einmal, heute aber bereue ich die Jahre, die ich dich Tag für Tag anhielt, deine dir von der verschwenderischen Natur verliehene Begabung vor der Natur zu schulen und zu vervollkommnen. Denn das warst du bereits als Heranwachsender: zum Zeichnen begabt. Alle Kinder können zeichnen und malen, da jedes Kind das Inbild von allem und jedem in sich trägt. Jeder Mensch ist in der Tat solange Künstler, wie sein Verstand noch nicht damit begonnen hat, die Inbilder mit den Vorbildern zu vergleichen, doch ist er erst einmal soweit, dann erlebt der soeben noch träumerisch, ja gottgleich vor sich hin malende und zeichnende kleine Schöpfer seinen Sündenfall in menschlich-allzumenschliche Beschränktheit: ›So sieht ein Pferd doch nicht aus! Papi! Wie geht denn ein Pferd?‹
Da nun müssen traditionell 99 % aller Papies passen, Dilettanten allesamt. Zwar ahnen auch sie, daß ein Pferd so nicht geht, mit menschenähnlich kniebegabten Hinterbeinen, aber wie es geht, haben sie weder gelernt noch jemals durch eigene Wahrnehmung begriffen: Hieße man sie ein Pferd zeichnen, sie würden sich an verschüttete Reste ihres kindlichen Pferde-Inbildes klammern – lange Mähne, langer Schweif – und versuchen, dieses rudimentäre Inbild mit vagen Erinnerungen an Pferde-Abbilder zu ergänzen: So ein runder Leib auf vier Beinen, aber wie gehen diese Beine eigentlich? Vorne haben sie Knie. Und hinten? Hinten, wenn man so will, haben wir Menschen Knie. Warum nicht auch ein Pferd? Klar, auch ein Pferd!
Kaum hingezeichnet, verliert sich die Euphorie. So geht ein Pferd jedenfalls nicht. Aber wie dann?
Auch dein Vater, Antonio, wußte es nicht besser, doch vermochte er es wenigstens zu würdigen, wie du, der Zehnjährige, dich damals durch Versuch und Irrtum vom Inbild zum Abbild zeichnend vorangearbeitet hast, zweifelnd, doch nie verzweifelnd, da du jenem Doppellicht folgtest, das im Verlauf der Jahrtausende allen zeichnerisch Begabten den Weg gewiesen hat, dem, von allen Meistern zu lernen, sowie dem, jedem Meister immer dann zu mißtrauen, wenn der eigene Augenschein die Formulierung des Meisters als Formel entlarvte und das eigene Zeichnen in Erfahrung brachte, was die bisherigen Abbilder beim Vorbild übersehen oder unterschlagen hatten.
Erst Albrecht Dürer hat der Menschheit Augen und Herz für Erscheinung und Wesen des Hasen geöffnet, alle vorherigen Hasendarstellungen waren lediglich Annäherungen gewesen, jeder seitherige Hase hätte niemals wieder hinter Dürers Hasen zurückfallen dürfen. Statt dessen –«
Der Alte seufzte tief auf, fischte brüsk ein Blatt aus einer abgestoßenen Mappe, knallte es regelrecht auf den Tisch: »Ein Linolschnitt aus meinen Anfängerzeiten, ein Ostergruß aus jenen frühen 50ern, als nicht mehr der Hase das Ziel der Kunstanstrengung sein durfte, sondern bestenfalls das Hasenhafte. Damals kam ich mir mit dieser Mischung aus Franz Marc und Gerhard Marcks mächtig mutig und modern vor, heute rührt mich der Murcks eher, als daß mich meine hasenhafte Angst, nicht auf der Höhe der Zeit zu sein, beschämt. Eine Jugendsünde – anders als du, Antonio, hatte ich damals nicht das Glück, meine Talente an einem Lehrer messen und in seiner Obhut ausbilden zu können. Das zweifelhafte Glück, wie wir heute wissen, denn wenn der ewige Dilettant etwas unerbittlich bekämpft hat und bekämpfen wird, dann –«
Das jähe Erlöschen der ersten Kerze läßt den Alten innehalten, um sodann eiliger fortzufahren: »Antonio, verzeih! Nicht um meine in diesem Augenblick vollkommen unerheblichen Irrwege, Umwege und Wege zur Zeichnung darf es angesichts des bevorstehenden Untergangs gehen – die wenige Zeit, die uns in diesem Versteck noch bleibt, will und muß ich dafür nutzen, dir in groben Zügen und nach bestem Wissen und Gewissen zu berichten, wie es zu dieser vollständigen Niederlage respektive diesem totalen Sieg kommen konnte. Hör mir also zu, Antonio, hör mir gut zu! Vom ewigen Dilettanten habe ich gesprochen, doch über Jahrtausende schien es so, als werde der lediglich eine Randerscheinung bleiben, belächelt, wenn nicht verspottet. Er fällt hier und da als Möchtegernzeichner in ägyptischen Totenbüchern auf und belustigt noch heute durch die Ungeschicklichkeit, mit welcher er die damals üblichen und üblicherweise mit traumwandlerischer Sicherheit notierten Bildzeichen verhaut, all die hundsköpfigen Götter, säugenden Göttinnen und anbetenden Männlein und Weiblein. Offenbar hatte da ein einflußreicher Mann seinem Filius einen Job verschafft, der eindeutig über dessen Kräfte ging: ›O du weiser Rahotep, das ist wohlgetan, daß du meinen Sohn in deiner Totenbuchwerkstatt anstellst, denn wenn du dich weiterhin so angestellt hättest, von wegen Begabung, dann hättest du deine Bücher gleich persönlich zu den Toten bringen können!‹
Wir finden den ewigen Dilettanten wieder unter jenen spätantiken Malern, die in Fayum mit der ewiggleichen Aufgabe beschäftigt sind, Porträts auf Holztafeln zu malen, Mumienbildnisse, welche samt der einbalsamierten Mumie im konservierenden Erdreich Ägyptens überlebt und bis auf den heutigen Tag auch jene unbekannten Ungeschickten überliefert haben, denen es nicht gegeben war, die Bravura der auftrumpfend schmissigen Konkurrenten auch nur annähernd zu erreichen. Offensichtlich machten sie durch den Preis wett, was ihnen an Talent fehlte: ›Nicht für fünf Sesterzen, nicht für vier Sesterzen, nein, für den sensationellen Schnupperpreis von drei, weil Sie es sind, zwei Sesterzen male ich Ihnen Ihre Frau Mutter hin, daß ihr eigener Sohn sie nicht mehr wiedererkennen wird!‹
Und so fortan: Meist namenlos versucht der ewige Dilettant nach besten, leider nie ausreichenden Kräften mit dem stetig voran und höher schreitenden Künstler Schritt zu halten, bis er im Italien der Renaissance vollends zur Lachnummer wird. Zumal in Florenz, dessen Künstlerwerkstätten Michelangelos beschwörende Mahnung ›Zeichne, Antonio, zeichne‹ bereits seit den Tagen Giottos von Generation zu Generation derart inbrünstig befolgt hatten, daß Michelangelo und einige seiner Kunstkumpanen sich den exquisiten Spaß erlauben konnten, bei einem ihrer Zusammentreffen nicht den besten, sondern den schlechtesten Zeichner dadurch zu ermitteln, daß jeder, nach Maßgabe seiner Kräfte, einen völlig mißratenen Menschen aufs Papier legte. Die Palme aber errang kein anderer als Michelangelo, der mit einer veritablen Klozeichnung aufgetrumpft hatte und – folgt man seinem Biographen Vasari – schon deswegen zum Sieger prädestiniert gewesen war, weil er als bester Zeichner naturgemäß auch die beste schlechteste Zeichnung hatte verfertigen können.
Selige Zeiten, als noch jedermann wußte, was eine gute Zeichnung ist, was eine schlechte! Glorreiche Zeiten, als gute Zeichner noch spaßeshalber schlecht zeichnen konnten in der seligen Gewißheit, dieser Satz werde sich niemals ins Gegenteil verkehren können! Paradiesische Zeiten für begabte Hände, höllische für Dilettantenpratzen!
›Scheiße, wenn man unbegabt ist!‹ Wohl niemals in der Geschichte der bildenden Kunst ist der Fluch des ewigen Dilettanten häufiger von Werkstattwänden, Kirchenfassaden und Palastmauern zurückgeworfen worden: ›Scheiße, daß ich unbegabt bin!‹
Nicht nur in Florenz! In den dortigen Werkstätten wurden die Unbegabten vermutlich am raschesten erkannt, aussortiert und entweder nach Hause geschickt oder jenen Arbeiten zugeteilt, die mit etwas gutem Willen auch von anstelligen Handwerkern zu packen waren: Fensterläden bemalen, Schilde schmücken, Wirtshausschilder pinseln.
Anders in der Provinz. Um 1470 sind vier Maler in Ferrara damit beschäftigt, im Auftrage des Herzogs Borso d’Este den Palazzo Schifanoia auszumalen: Der virtuose Cosmè Tura, der extravagante Ercole Roberti, der geniale Francesco Cossa und der – ja, wer eigentlich? ›Maestro B‹ wird er von den Kunsthistorikern genannt, aber auch ›Meister der aufgerissenen Augen‹, als ›Tura-Schüler‹ führt ihn der eine, als ›Antonio Cicognara‹ der andere – eine Vieldeutigkeit, zu der die Wandbilder dieses Malers den denkbar entschiedensten Kontrast bilden: Die sind eindeutig dilettantisch. Eine Eindeutigkeit, die durch eine derart exemplarische Laune des Zufalls unterstrichen wird, daß ich fast geneigt bin, an eine List der Kunstgeschichte zu glauben. Vier Künstler, sagte ich, schmückten den Prunksaal des Palastes mit Monatsbildern aus, jeder von ihnen hatte demzufolge drei Monate zu bewältigen. Drei Monate à je drei Bilder, da das Programm dahingehend festgelegt war, daß jeder Maler zu jedem Monat drei Aufgaben in aufsteigender Folge zu bewältigen hatte. Zuunterst feierte jedes Monatsbild die gute Herrschaft des Fürsten und schilderte zugleich die Tätigkeiten, die im jeweiligen Monat anfielen. Im Mittelstreifen das zum Monat gehörige Sternbild, sowie allegorische Darstellungen. Darüber der Triumphzug einer dem Monat zugeordneten heidnischen Gottheit – es geschieht nicht gerade häufig, daß Maler unter derart sportiven Bedingungen gegeneinander antreten müssen: An die Wände, fertig, los!
Was dann passierte, können wir Heutigen lediglich rekonstruieren, da die Monatsbilder Robertis und Turas im Laufe der Zeit fast vollständig zerstört worden sind. Eine geradezu dämonische Fügung aber hat dafür gesorgt, daß ausgerechnet jene beiden Konkurrenten Wand an Wand überdauert haben, die zu Lebzeiten durch Welten voneinander geschieden waren: der geniale Cossa und der dilettantische Maestro B.
Die Monate März, April, Mai hat Cossa gestaltet, alles mitreißende Lösungen, allesamt unergründlich komplex, ungewöhnlich realistisch, unglaublich phantasievoll. Die Folgemonate Juni, Juli, August hat Maestro B zu verantworten, alles ebenso bemühte wie plumpe Versuche, den gestellten Anforderungen wenigstens in groben Zügen gerecht zu werden.«
Nachdenklich blätterte der Alte im großformatigen Buch, ein Aufflackern der zweiten Kerze mahnte ihn, fortzufahren: »Das alles müßte gerechtigkeitshalber und der besseren Anschaulichkeit wegen nicht vor diesen Abbildungen, sondern vor den Wänden selber verhandelt werden. Wer uns daran hindert? Der, welcher über kurz oder lang in dieses Gemach einbrechen wird – Maestro B persönlich. Denn das war er ja seit Anbeginn, der ewige Dilettant: Meister B oder C oder D oder E oder ein weiterer Aftermeister auf der nach unten hin offenen Unbegabtenskala. Und er ist’s noch heute, obwohl er seit gut zweihundert Jahren die frohe Botschaft einer klassenlosen, weil von überprüfbarer Begabung gereinigten Kunst nicht nur verkündet, sondern mit Feuer und Schwert verbreitet – als wolle er Rache nehmen für alles Leid und alle Unbill, die ihm die Cossas aller Zeiten zugefügt haben!«
Erneutes zages Flackern der zweiten Kerze, der Alte beugt sich zum Knaben und hebt belehrend den Zeigefinger: »›Gegen große Vorzüge gibt es kein anderes Heilmittel als die Liebe‹, hat Goethe in seinen ›Wahlverwandtschaften‹ notiert – doch dieser Bevorzugte hatte gut reden. Der Benachteiligte denkt da in der Regel anders, und was Maestro B-enachteiligt jeden Morgen dachte, wenn er seine Arbeitsstelle im Monatsbildersaal des Palazzo Schifanoia betrat, das läßt sich unschwer denken: ›Scheiße, daß ich unbegabt bin!‹
Mochte er auch abends vom Gerüst gestiegen sein im Gefühl, ein ganz ordentliches Tagewerk geschaffen zu haben, hatte die gnädige Dämmerung ihn noch glauben lassen, er und Cossa malten nicht nur an Vergleichbarem, sondern Vergleichbares; so hielt ihm das harte Licht des Morgens Tag für Tag den himmelweiten Unterschied gerade deswegen so unerbittlich vor, weil das zu Vergleichende so nah beieinander lag, räumlich und inhaltlich. Unfaßbar, was dieser Cossa da an Landschaft, Architekturen, Menschen und Tieren auf die Wand zauberte, unbegreiflich, wie er das Gewimmel so gliederte, daß komplizierteste Verkürzungen, dichteste Gruppierungen und waghalsigste Perspektiven sich auf einen Blick erschlossen, während das Auge zugleich endlos spazierengehen konnte und auf diesen Wanderungen mit nicht enden wollenden Erfindungen und Funden belohnt wurde: Da! Der geile Affe am Bein des Knaben! Dort! Der vom Einsturz bedrohte Torbogen! Hier vorn die feiernden Herrn! Da hinten die arbeitenden Bauern! Jeder von eigener Statur, jedweder bei einer unverwechselbaren Tätigkeit! Alles verwirrend vielfältig wie im wirklichen Leben und dennoch so traumhaft sinnfällig, wie es nur in echter Kunst vorkommt. Ein Bild, um hineinzugehen und sich für immer darin zu verlieren, seufzt Maestro B, aber er muß ja noch die paar Meter weiter, zu seinem Bild, dessen Anblick ihn mal wieder fragen läßt, was er eigentlich in diesem Monatsbildersaal verloren habe.
Landschaft auch hier, doch nicht zum Eintreten verlockend, sondern phantasielos gestaffelt und abschreckend karg. Architekturen von fragwürdigster Standfestigkeit. Schematische Reitergruppen, pedantisch gereihte Figuren mit Köpfen vom Faß und Kostümen von der Stange. Aber der Vertrag ist unterzeichnet, die monatlichen Zahlungen aus der herzoglichen Schatulle laufen, der Mensch muß essen, die Familie will leben, das Tagwerk ist vorgeschrieben, der Verputz ist aufgetragen, die Farben sind angerührt, also weitermalen: Ciao Cosmè! Ciao Ercole! Wo bleibt der Francesco eigentlich?
Und eine Stunde später schlendert der Cossa doch tatsächlich herein, wohl wissend, daß er sein Tagwerk auch heute wieder als erster beenden wird, schnell wie er ist, und er findet auch noch Zeit für ein Schwätzchen mit dem bereits längst wacker vor sich hinmalenden Maestro B:
– Maestro! Welch göttliche Arbeit! Aber nein – du übertriffst ja den Schöpfer noch!
– Wie das? Erkläre dich deutlicher, Francesco!
– Nun, als der Herr den Hund schuf, hat er da dessen Vorderläufen Knie verliehen? O nein, Maestro, es blieb dir vorbehalten, einen Hund zu erschaffen, der einer Kuh gleich vor seinem Schöpfer in die Knie gehen kann. Wirst du uns als nächstes mit einer Anbetung der Hunde überraschen, Maestro?
Gelächter der Kollegen Tura und Roberti, Verwirrung bei Maestro B:
– Wovon redest du denn da, Francesco?
– Ja, hast du denn keine Augen im Kopf, Maestro? Ich rede von jener seltsamen Kreatur, die du neben dem prallen Pferd des dicken Herzogs Borso dahintrotten läßt, beide, Pferd und Hund, übrigens bei dir Passgänger, eine Gangart, die du in seltenen Fällen beim Pferd, nie aber beim Hund beobachten wirst. Aber du mußt dich ja auch nicht damit abgeben, die Natur zu beobachten, du erschaffst sie neu mit kniebegabten Hunden, mit prallen Pferden, die Sandsäcken auf Stützen gleichen, und mit Menschen, die allesamt vom Huhn abzustammen scheinen, da sie einander gleichen wie ein Ei dem anderen!
Und unter erneutem Gelächter der beiden anderen Maler besteigt Cossa sein Gerüst, greift zum Pinsel und bereichert eine Gruppe von Höflingen um einen schreitenden Jagdhund, der geradezu aufreizend den Vorderlauf anhebt, den langen Vorderlauf mit der elegant angewinkelten Vorderpfote …
Maestro B vergleicht und begreift: Nicht bereits in der Mitte des Beines knickt die Pfote des Hundes ab, sondern im Verhältnis vier Fünftel – ein Fünftel, doch zu spät, die Farbe seines Hundes hat bereits abgebunden, die Töle ist nicht mehr zu ändern, sein Herrchen und Maestro muß sich sputen, will er nicht vollends ins Hintertreffen geraten gegenüber seinem Kollegen und Konkurrenten, der seine Monatsbilder nur deshalb nicht schon längst fertig gemalt hat, weil ihn ein unerklärlicher Ehrgeiz dazu antreibt, auf seinen Wänden nicht nur das unbedingt Nötigste zu erzählen, sondern mehr, unendlich viel mehr, nicht weniger als die ganze Welt der Erscheinungen, eingebettet in Nähe und Ferne, Licht und Luft, Raum und Zeit.
Verhalten fluchend greift Maestro B zum Pinsel, um sein Tagwerk runterzumalen, tief im Innern aber schwört er den Cossas dieser Welt ewige Rache: Es wird kommen der Tag, da wird sich im Staube wälzen, was heute noch auffährt und uns in den Staub tritt. Es wird kommen die Stunde, da nicht ihr uns verlacht wegen der Knie, die wir den Hunden verliehen haben, sondern wir euch, weil ihr wie die Hunde vor uns knien und Abbitte leisten werdet dafür, daß sich Künstler nur nennen durfte, wer zeichnend sein Wissen darüber unter Beweis stellen konnte, wo Pferd und Hund ihre Knie haben – wo doch jeder ein Künstler ist, nicht nur der, der die Welt der Erscheinungen sklavisch und kleinlich nachzubilden weiß, sondern vor allem der andere, der sie nach seinem Bilde modelt und ihr Knie da verpaßt, wo sie seiner Meinung nach hingehören, an die Vorderbeine oder an die Hinterbeine oder an beide oder an gar keine, da wir mit dem ganzen überprüfbaren Spuk aufräumen werden, mit Proportion und Komposition, Anatomie und Perspektive, Ähnlichkeit und Naturtreue: In Staub mit allem, was sich uns überlegen dünkt, in den Orkus mit jenen Künsten, die sie in dieser Gewißheit bestärken!«
Zischendes Erlöschen der zweiten Kerze, grimmiges Nicken des Alten, der den Leuchter so vor den großen Spiegel rückt, daß der das verbliebene Licht verdoppelt. Ein Schluck aus der Korbflasche, dann fährt er drängender fort: »Antonio, es war viel von Maestro B die Rede, doch ich hätte dir auch ganz andere Namen nennen können, Raffaelo Bottincini, Farrando Spagnuolo, Giovanni di Francesco, Maestro di Pratovecchio, Giovanni di Piemonte, Marco Zoppo oder wie sie alle hießen, die das Unglück hatten, in eine Zeit hineingeboren zu werden, in welcher die Künstler gerade dabei waren, die Meßlatte höher und immer noch etwas höher zu legen, und in welcher die Kunden ihren Kunstverstand bereits derart an Gelungenem geschult hatten, daß jenen, die vor dem kundig prüfenden Auge versagten, auch die großen Aufträge der großen Auftraggeber versagt blieben, großes Geld und, bis heute, großer Ruhm: ›Scheiße, daß wir unbegabt sind!‹
Es sollte gut vierhundert Jahre dauern, bis der Fluch des Maestro B sich zu erfüllen begann, obgleich der ewige Dilettant seiner Natur gemäß nicht nachließ, nach dem Künstlerlorbeer zu greifen. Höre, Antonio, die Geschichte von Reinfall und Glückstreffer des Carl Philipp von Greiffenclau! Der war 1749 zum Fürstbischof von Würzburg gewählt worden und hatte mit dem Amt auch die Verpflichtung übernommen, endlich das von keinem Geringeren als Balthasar Neumann entworfene und 1744 fertiggestellte Gebäude der bischöflichen Residenz auch im Innern zu vollenden: Noch immer harrten Treppenhaus und Kaisersaal der Ausmalung.
Als ahnte er, daß ihm nur fünf Regierungsjahre beschieden sein würden, engagiert der frischgebackene Fürstbischof sogleich einen Maler, der aus dreierlei Gründen für das anspruchsvolle Projekt geeignet erscheint: Er kommt aus Mailand, also Italien, dem Ursprungsland großer Wandmalerei, er legt eine beeindruckende Skizze vor, und er versteht es, seine Vorzüge herauszustreichen. Hör nur, was er in seinem ›Contract‹ zu leisten versprach!«
Kurze Suche, rascher Zugriff, dann liest der Alte mit erhobener Stimme: »›Demnach der Künstler und Maler Joseph Visconti aus Mayland offeriert, den großen Saal en Fresco auf eine solche arth, wie man von einem Künstler immer nur praetendieren könne, dergestalten zu mahlen, daß an seiner Kunst und arbeit männiglichen ein vollkommens Vergnügen haben solle‹ – doch dauert es nicht lange, und der am 17. Oktober abgeschlossene ›Contract des Mahlers‹ wird Makulatur. Bereits am 16. November nämlich ist allen Kunstverständigen klar, daß sie einem Schwindler aufgesessen sind, einem Filou, der zwar von den vereinbarten 6000 fränkischen Gulden Lohn bereits 1000 Reichstaler eingesackt, jedoch nichts zustande gebracht hat, Dilettant, der er ist.
Seine ›voluble Zung‹ habe ihm den Auftrag verschafft, berichtet der Höfling und Chronist Spielberger, doch die Zung allein reichte damals glücklicherweise noch nicht aus, den Künstlerstatus zu praetendieren, noch entschied die Hand über Aufstieg und Fall eines Malers. Und letzterer ist nach einem Monat Hochstapelei unausweichlich. Visconti habe zwar ein Gerüst im Kaisersaal errichten lassen, berichtet der Chronist, aber dort ›verschlosse er alles und ließe niemanden dahin auch nit einmahl den fürsten!‹ Der freilich scheint sich dennoch Zutritt verschafft zu haben, und was er da sah, sprach für sich: Visconti ›mahlete so elend schlecht, da er ob S. hochfürstlichen Gnaden lauter Apellesstück mit Worten vorstellete seine ganze arbeit als erbärmliche Nichtsnutzigkeit nit verdecket bleiben konnte.‹
Lauter Apellesstück, Antonio, lauter Apellesstück!«
Schallendes Lachen schüttelt den Alten, die fragenden Augen des Knaben lassen ihn innehalten und gesammelt fortfahren: »Apellesstück – damit meint Spielberger, der saubere Visconti habe seine Stümpereien zu Meisterwerken vom Rang eines Apelles, des berühmtesten aller griechischen Maler, schönreden wollen. Die Zung, die Rede, das Wort – sie vermögen viel, Antonio! Schon immer war es leichter zu reden als zu zeichnen, doch heute erst ist es den Maestro Bs dieser Welt gelungen, einer verwirrten, ja verängstigten Öffentlichkeit einzureden, das Wort sei bereits die Sache, der Glaube an ein Kleidungsstück bereits die Bekleidung und der Kaiser nicht nackt, sondern prächtig gewandet.
Wie anders am Hofe des Philipp von Greiffenclau! Der läßt sich kein X für ein U vormachen, möchte aber nicht alleine über Wert und Unwert des Gesehenen entscheiden. Er beauftragt vier Künstler, zwei Maler und zwei Bildhauer, damit, das bisher Gemalte zu taxieren. Es wird ›nit einen bazen werth‹ befunden und ein ungnädiger Auftraggeber entläßt den ›Vilou‹, ein Getäuschter, der ›seine vilen blaudereyen geglaubet, seynd aber von Ihm Fisconte schändlich betrogen worden: weilen die Sach so schlecht gemahlet ist, daß man sie völlig wiederum heraushauen muß.‹
›Voluble Zung, Apellesstück in Worten, Blaudereyen‹ – merke dir diesen verhängnisvollen Dreiklang, dieses Trio infernale, wenn du begreifen willst, was um uns geschieht, und wenn du dich wappnen willst für das, was dich als Künstler von heute erwartet, das Blaue vom Himmel zu blaudern nämlich oder doch blaudern zu lassen – aber noch sind wir nicht soweit. Wie weit sind wir eigentlich? Wie weit ist es mit uns gekommen? Und wieso konnte es so weit kommen?«
Gedankenverlorenes Starren aufs Buch, dann hellt sich die Miene des Alten auf: »Bevor ich dir in gebotener Kürze anvertraue, wann und wieso die dem Augenschein nach unsinkbare ›Bildende Kunst‹ auf falschen Kurs und in von Piraten wie Eisbergen gleichermaßen verseuchtes Gewässer geriet, lasse mich, Antonio, noch einen Augenblick im Würzburg von 1750 verweilen, dem vielleicht letzten lichten Moment, da Kunst und Können noch jene untrennbare Einheit bildeten, welche jahrtausendelang gegolten und für Abertausende von Meisterwerken gesorgt hatte. Einen weiteren Reinfall kann und will sich der Fürstbischof nicht leisten, also engagiert er als Nachfolger des redegewandten Mailänder ›Vilous‹ den allseits anerkannt besten Wandmaler seiner Zeit, den Venezianer Giovanni Battista Tiepolo. Der wird in der Würzburger Residenz zwei Jahre lang damit beschäftigt sein, Hunderte Quadratmeter Wand und Decke auszumalen, doch was tut er als erstes? Er zeichnet, und damit meine ich nicht die Kartons, eins zu eins gezeichnete Vorlagen für das jeweilige malerische Tagwerk, ich spreche von Handzeichnungen, mit deren Hilfe Tiepolo sich das zu Malende nicht nur unermüdlich vergegenwärtigt, sondern regelrecht erarbeitet. Hier – die gemalte Figur des Stukkateurs Bossi, welche den im Treppenhaus Emporschreitenden von oben herab anschaut, unvergeßlich eindringlich. Und hier die Erklärung für so viel beeindruckende Präsenz: zehn Rötelskizzen, weiß gehöht auf blauem Papier. Sie zeigen, wie sich Tiepolo an seine schlagende Lösung herangetastet hat und was Zeichnung ihrem Wesen nach ist. Nicht die Lösung selber, sondern ein Schritt auf dem Weg dorthin, nicht Mittel zum Zweck, etwas unter Beweis zu stellen, etwa das Zeichnenkönnen, sondern Medium, etwas in Erfahrung zu bringen, in diesem Fall: Wie postiere ich eine Figur in schwerem Mantel so, daß daraus eine suggestive, möglichst monumentale Form wird? Das weiß auch ein zeichnerisches Genie nicht mit letzter Sicherheit, und sollte es auch, mit Dürer zu sprechen, ›inwendig voller figur‹ sein. Da bleibt auch einem Tiepolo, der bei Bedarf einen Götterhimmel samt Putten, Musen und Sonnenrössern aus der Untersicht zu imaginieren und zu malen imstande ist, nichts weiter übrig, als sich vors Modell zu setzen und in aller Bescheidenheit sowie mit ganzem Kunstverstand in doppelter Hinsicht festzuhalten, was er da vor sich sieht, in natura und auf dem Papier. Sieh nur, Antonio, wie er der Sache näherkommt! Wie er das stehende Modell veranlaßt, erst nach rechts zu blicken, ihn dann en face anzuschauen, wie es auf Befehl den Hut aufsetzt, abnimmt, sich weiter dreht und immer weiter, bis wir zusammen mit dem Zeichner bei der den Kopf wendenden Rückenfigur angelangt sind, bis kein Pelzkragen mehr stört und kein Degen mehr die geschlossene Figur durchspießt: Zeichnen als der Königsweg zur sinnlichen Erkenntnis. So, wie sich nach Heinrich von Kleist die Gedanken beim Reden verfertigen, so bilden die Bilder sich beim Zeichnen, sofern der Künstler dazu imstande ist, das, was er in sich hat – seine Idee – von dem, was er da vor sich sieht – sein Modell – in Frage stellen, in Gang setzen und auf Trab bringen zu lassen. Ich sage: der Künstler, ich hätte auch sagen können: der Meister. Als Tiepolo die Würzburger Residenz ausmalt, ist er Mitte fünfzig und auf der Höhe seiner Kunst. Er ist bereits als Knabe zum Maler ausgebildet worden und hat sich seither ständig zeichnend und malend vervollkommnet. Er hat ungezählte Lösungen gefunden, doch er verläßt sich nicht auf seine Formeln. Als er die segnende behandschuhte Rechte jenes Bischofs malen muß, der Kaiser Barbarossa und Beatrix von Burgund vermählt, zeichnet er sie erst einmal. Um sicherzugehen? Um in Form zu bleiben? Weil er einfach gerne zeichnete?
Wer sich im Zeichnen fortgebildet hat wie du, Antonio, der weiß, daß kein Meister vom Himmel fällt. Selbst die größten Genies begannen unselbständig und unbeholfen. Immer wieder sind es die Hände gewesen, die Zeichnern zu schaffen machten, und sind sie nicht, bei Licht betrachtet, zum Verzweifeln? Pfote, Tatze, Kralle, Huf – wie schön und leicht faßlich die Tiere auftreten und wie fragwürdig der Mensch in seinen Extremitäten endet! Unten in Fleischbroten, die ein arglistiger Konditor zu allem Überfluß viermal eingekerbt hat – gottlob wird dieses Gebilde bei allen zivilisierten Völkern vom sehr viel leichter zu zeichnenden Schuh bedeckt. Aber die Hände! Da endet eine bereits reichlich unausgesprochene Form in fünf unterschiedlich langen Würsten, die schon in Ruhestellung schwer zu packen sind. Nur daß die Hand nie Ruhe gibt. Anders als der Fuß ist die Hand auch dann in steter Bewegung begriffen, wenn der Rest des Körpers zu ruhen geruht. Entweder greift sie etwas, um es an Mund, Nase, Auge oder Ohr zu führen, oder sie unterstreicht etwas, beispielsweise die Rede des Mundes, oder sie macht sich an fremdem oder eigenem Körper zu schaffen, im schlimmsten Falle an der anderen Hand. Denn jede hat ja einen Zwilling, jede vergewissert sich dauernd dieses Spiegelbildes, jede ist jederzeit dazu fähig, sich in die andere zu verschränken, zu verknäulen, zu verwursteln –: Wer nie versucht hat, diesen Zehnfingerwurstsalat zeichnend zu entknäulen und in eine plausible Form zu bringen, der –«
Sehr ferner Klang wie Paukenschläge und Gelächter, doch der Alte hört nicht darauf. Er redet weiter auf den Knaben ein, der die großen Augen nur zögernd wieder auf den Erzähler richtet: »Du, Antonio, weißt um diese Schwierigkeiten. Du hast Hände geübt, wie andere ihre Vorhand trainiert haben. Und du hast Fortschritte gemacht, da sich bei dir, dem Begabten, die für alle Unbegabten so grausame Regel erfüllt hat: Wer kann, der kann. Denn sinnvoll ist solch Spezialstudium der Hände lediglich dann, wenn Hände nur ein Schwachpunkt sind, nicht der Höhepunkt einer Schwäche, der nämlich, nicht zeichnen zu können, und schon gar keine Hände. Wer nicht sehr rasch inwendig begreift, wie ein Körper gebaut ist; wer sich nicht zeichnend in den Körper seines Gegenübers zu verwandeln vermag, und sei dieser ein Pferd oder ein Hund, der wird nie über Stückelung und Klitterung hinauskommen.
Goldene Zeiten für die Künste, als noch der Meister dem begabten Schüler den Weg zum Tor der Kunst zu weisen wußte, durch welches der so geschulte Begabte leichtfüßig hindurchschritt! Graue, ja grausame Zeiten aber für die, denen der Einlaß trotz aller Hilfe verwehrt wurde, da unübersehbar ihre Zeichnungen wider sie zeugten, jene korrigierbaren, überprüfbaren, lediglich in Maßen erlernbaren, nur wenigen verfügbaren und nicht übertragbaren Entrebillets in die Tempelvorhalle, die Kunstakademie, vor deren Türen sich einst die Zutrittheischenden drängelten, indes Zerberusse mit Argusaugen und Herkuleskräften die Riesenspreu vom Häufchen Weizen trennten, bis die Spreu aufbegehrte und nicht nur Weizen werden wollte, sondern den Weizen mitsamt dem Bade ausschüttete, seit ein staatlich bestallter Türhüter wie der Düsseldorfer Kunstprofessor Joseph Beuys kurzerhand jedermann zum Künstler erklärte und in seine Klasse aufnahm – aber noch einmal und zum letzten Mal gefragt: Wer oder was hatte die scheinbar so wehrhaften Bastionen des Kunsttempels zuvor durchlöchert?
Der ewige Dilettant? Gewiß. Doch hätte er diesen Triumph niemals feiern können, wären ihm nicht Verbündete außerhalb und, leider leider, auch innerhalb der Mauern zur Hilfe geeilt, Literaten und Verräter, Sprüchemacher und Malschweine.
Tiepolo malte noch, da drängte es die Sprüchemacher bereits, Sturmleitern anzulegen, naturgemäß erst einmal an die Zitadelle »Literatur«. Nieder mit Regel und Kanon hieß die Parole der Stürmer und Dränger, jedermann, vor allem aber: jeder Jüngling trägt den Kunstmarschallstab in der fühlenden Brust, der ihn befähigt, aus dem Stand und ohne alle Ausbildung – je unverbildeter, desto besser – ein Homer zu sein, ein Pindar, ein Ossian, ein Shakespeare. Karriereaussichten, die den bildenden Dilettanten elektrisieren mußten: Wenn die Literaten jedwede Regel für Gedicht, Drama und Epos in den Staub treten konnten – warum mußten die Künstler sie nach wie vor hochhalten? War nicht das großgedachte und weitgefühlte Sujet wichtiger als die kleinliche Ausführung? Galt nicht die Reinheit der subjektiven Idee mehr als das objektiv stets dem Schmutz und der Materie verhaftete Handwerk?
Literatengedanken, Antonio, Sprüchemacherei! Zugleich aber auch der Beginn einer so unheiligen wie unausweichlichen Allianz, der des Dilettanten mit dem Literaten. Warum ersterer seit Urzeiten sehnlichst in den Kunsttempel einzudringen wünschte, wissen wir bereits. Doch wieso mischten sich plötzlich die Literaten in diese Auseinandersetzung ein? Wieso halfen sie dabei, die Sophismen zu gießen, mit denen der Tempel sturmreif geschossen wurde, die Argumente zu zimmern, dank derer seine Mauern erstürmt werden konnten? Es war der ständig heller erstrahlende Glanz, durch den die Malerei in den Jahrhunderten ihrer Blütezeit die Literaten zugleich geblendet und angelockt hatte. Waren Malerei und Bildhauerei im Mittelalter – anders als Rhetorik oder Geometrie – noch nicht einmal für würdig befunden worden, unter die sieben artes liberales aufgenommen zu werden, hatte man Maler und Bildhauer – anders als Musiker und Philosophen – nicht zu den Künstlern, sondern zu den Handwerkern gerechnet, so zählte spätestens seit dem 16. Jahrhundert wer zeichnen und malen konnte zur kleinen Schar schöpferischer, ja gottgleicher Geister, vor denen sich selbst höchste Häupter in Demut neigten: Michelangelo, dem die Mitwelt das Beiwort divino verlieh und der den ungebeten eintretenden Auftraggeber und Papst von seinem Gerüst in der Sixtinischen Kapelle aus mit Steinwürfen traktierte; Tizian, nach dessen zu Boden gefallenem Pinsel Kaiser Karl v. sich anstandslos bückte; Leonardo da Vinci, der in den Armen des französischen Königs Franz 1. starb; Velázquez und Rubens, welche ihre Herrscher und Auftraggeber nicht nur malten, sondern auch als Diplomaten an den großen Höfen vertraten – all diese verehrungswürdigen Gestalten verkörperten Rang, Glanz und Pracht der Künste derart sichtbar, daß wer ›Künstler‹ sagte, ohne weiteres den ›bildenden Künstler‹ meinte und nicht etwa den Dichter, den Schriftsteller, den Komponisten oder gar ausführende beziehungsweise dienstbare Geister wie den Sänger, den Musikus oder den Schauspieler. ›Nein, nein, nein – wir dürfen hier nicht rein‹ – was heute noch Hunden hier und da den Eintritt in Fleischerläden verwehrt, stand bis zum 18. Jahrhundert für alle soeben Genannten gut sichtbar über dem Kunsttempel angeschlagen, was naturgemäß ihre Gier, sich Einlaß zu verschaffen, bis zur Besinnungslosigkeit anstachelte: So wie die Völker der Steppe jahrhundertelang von den Wundern der vielkuppligen Stadt Byzanz träumten, so wie sie die Uneinnehmbare vom Wasser und vom Lande aus unablässig umkreisten und umschwärmten in der Hoffnung, eine zufällige Bresche, ein durch Unachtsamkeit nicht geschlossenes Tor zu finden, so strich der Literat nimmermüd um die Kunstbastion, wo er früher oder später auf jenen treffen mußte, der bereits seit Höhlenzeiten den gleichen verzweifelten Wunsch hegte, auf den ewigen Dilettanten. Aber war es überhaupt ein Gegenüber, auf das er da stieß? Nicht vielmehr ein Doppelgänger?«
Ohne das leiseste Zeichen einer Vorwarnung erlischt die dritte Kerze. Das sehen, zur Korbflasche greifen und der Verblichenen grüßend zuprosten ist für den Alten eins. Sinnend stützt er das bärtige Haupt in die kräftige Hand, dann nimmt er den Faden mit Nachdruck wieder auf: »Die Eisenpforte … Nur noch vier Tore zu sprengen, dann werden sie hier sein! Sie, die sich mit Fug und Recht als ›Sonderkommando Werther‹ bezeichnen dürfen oder als die ›Werther-Rächer‹ oder als ›Werther-Zombies‹ oder meinetwegen auch als ›Werthers Echte‹ – denn was sind die Tobenden da draußen anderes als Wiedergänger dieser ersten Doppelfigur von Bildarmut und Wortreichtum, von Literat und Dilettant?«
Ohne Zögern fischt der Alte ein Buch aus dem Wust von Papieren und Broschüren, die den langen Tisch bedecken, ohne Suchen schlägt er es auf: »Wie Goethe begreift sich Werther als Künstler, meint natürlich: als bildender Künstler. Wie sein Autor hat er von Kindesbeinen an gezeichnet, anders als sein Autor aber das Zeichnen bereits in den jungen Jahren, in welchen wir seine Bekanntschaft machen, so gut wie ganz eingestellt. Doch welchen Schluß zieht er daraus? Beklagt er sein Versagen? Leidet er gar darunter, wie es der Titel des ihm gewidmeten Buches nahelegen könnte? Im Gegenteil! Im zweiten Brief bereits hat er aus der Not eine Tugend gemacht, mehr noch, eine Leistung: ›Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühl von ruhigem Daseyn versunken, daß meine Kunst darunter leidet.‹ Seine Kunst, Antonio, aber nicht er, der Künstler: ›Ich könnte jetzo nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin niemahlen ein größerer Mahler gewesen als in diesen Augenblicken.‹
Vom 4. Mai 1771 bis zum 20. Dezember 1772 dauern die Leiden dieses Unseligen an, dann schießt er sich eine Kugel in den Kopf. In all der Zeit hat er zweiundachtzig Briefe geschrieben und ganze zwei Zeichnungen zu Papier gebracht, sofern man den Schattenriß Lottes auch dann noch als Zeichnung gelten lassen will, wenn man erfährt, daß Werther seit der Begegnung mit der geliebten Frau ›keinen Umriß packen‹ könne. Und dieser Nichtszeichner und Vielschreiber hat die Stirn, folgende Bilanz zu ziehen: ›Das Beste, was ich hier getan habe, ist mein Zeichnen.‹
Sein Zeichnen, Antonio! Ein Zeichnen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, ohne Gegenstand, risikofrei und unüberprüfbar. Sein Zeichnen hat in unserem schwergeprüften, seinem verdienten Ende entgegengehenden Jahrhundert unendlich viele Nachahmer gefunden, nur daß sie sich jetzt nicht einfach Künstler, sondern Konzept-Künstler nennen dürfen oder Minimal Artists, sofern sie nicht Ready Mades, Objects Trouvées, unbemalte Leinwände oder gar nichts ausstellen: All das begann mit dem Literatengeschwätz jenes Möchtegernkünstlers Werther, Antonio, und das alles wird erst mit dem endgültigen Sieg seiner Wiedergänger enden. Der freilich ließ zu Werthers Zeiten noch eine Weile auf sich warten. Kein anderer als der Autor des ›Werther‹, Goethe selber, der ein ›eingebohrnes Talent‹ als Zeichner in sich wähnte und sich Jahrzehnte lang immer wieder als Zeichner versuchte, geht als alter Mann hart mit sich ins Gericht: ›Einer meiner Fehler ist, daß ich nie das Handwerk einer Sache, die ich treiben wollte oder sollte, lernen mochte. Daher ist es gekommen, daß ich mit soviel natürlicher Anlage so wenig getan und gemacht habe.‹ Mitleidlose Worte, wenn man bedenkt, mit welcher Inbrunst der Dichter zeit seines Lebens danach gestrebt hatte, unter die wirklichen Künstler aufgenommen zu werden: Er, der sich auf seiner Harzreise anfangs als ›Zeichenkünstler von Gotha‹ ausgegeben hatte, dann als ›Darmstädter Maler Johann Wilhelm Weber‹, er, der sich in Rom als ›Filippo Miller, pittore tedesco‹ registrieren ließ, er, der seinem Herzog und Brötchengeber von Rom aus mitteilen zu können glaubte: ›Ich darf wohl sagen: ich habe mich in dieser anderthalbjährigen Einsamkeit wiedergefunden; aber als was? – Als Künstler!‹
Als bildender Künstler mag sich der Dichter am Ende seiner von viel Zeichnerei begleiteten italienischen Reise gefühlt haben; im Rückblick hat er diesen Zeitpunkt als eine Periode bezeichnet, in welcher er sich von der Illusion verabschiedete, aus ihm könne wirklich und wahrhaftig ein großer bildender Künstler werden: ›Ich bin zu alt, um von jetzt ab mehr zu tun als zu pfuschen.‹«
Der Alte sprang auf: »Welch großer Mann!« schrie er und rüttelte Antonio an den Schultern, als müsse er ihn aufwecken und aufrichten, dabei saß der Knabe doch die ganze Zeit wie schreckensstarr vor dem Alten.
»Verneigen wir unsre Häupter vor diesem großen Mann! Zweitausendsiebenhundert Handzeichnungen hat dieser Schreiber uns hinterlassen und ist doch schließlich zur Einsicht gelangt, daß er nie Künstler geworden, sondern ein Leben lang der Dilettant geblieben ist, der 1775 den ›Scheide Blick nach Italien‹ aufs Papier zu bannen suchte: ›Ich hatte mich an dem Fußpfad, der nach Italien hinunterging, niedergelassen‹, erinnert sich der fünfundsechzigjährige Goethe in ›Dichtung und Wahrheit‹, ›und zeichnete, nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und noch weniger ein Bild geben konnte: die nächsten Gebirgskuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtniß unauslöschlich geblieben.‹ Dabei hat sich die Mühe sogar teilweise gelohnt! Sieh nur, Antonio, wie sorgfältig und suggestiv Goethe den Bleistift einsetzt, um schwarze Bergrücken und weiße Schneefelder zu scheiden! Freilich, freilich, bei den menschlichen Rückenfiguren hier unten und beim lediglich skizzierten Rest der Landschaft, da verließen sie ihn. Kein großer Zeichner, wirklich nicht, aber auch kein Literat, ganz und gar nicht! Ein vergeblich Liebender – denn auch solche Dilettanten gibt es, Antonio, und keiner wußte das so schön in Worte zu fassen wie Goethe: ›Dem Dilettanten ist die Nähe des Künstlers unerläßlich, denn er sieht in diesem das Complement seines Daseins. Die Wünsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.‹ Ein großer Mann, dieser Goethe und ein großer Liebhaber der Künste! Ein Mann, der nicht so zeichnen konnte, wie er wollte, dafür jedoch die richtigen Worte zu finden wußte: ›Wir sollten weniger sprechen und mehr zeichnen.‹ Ein Mann, der den unerfüllbaren Wunsch auszusprechen wagte: ›Ich meinerseits möchte mir das Reden ganz abgewöhnen und wie die bildende Natur in lauter Zeichnungen fortsprechen.‹ Auf die Knie fallen möchte man vor diesem Mann! Ein Mann des Wortes, der im Bild das ehrt, was es einzig macht: das Schweigen! Die Füße küssen möchte man ihm für sein Wort von der ›bildenden Natur‹, das er der bildenden Kunst für alle Zeiten an die Seite gestellt hat! Welch herrlicher Doppelsinn! Die Natur, die sich selber in unendlichen Formen bildet und zugleich den, der bei ihr in die Lehre geht und sich in ein noch so kleines Detail dieser Unendlichkeit versenkt. Nicht nach der Natur, wie die Natur wollte noch ein Paul Klee arbeiten, doch das sind Haarspaltereien. ›Wär nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nicht erblicken‹, und wäre ich nicht Pferd, Hund oder Katze – ich könnte keines der Tiere so zeichnen, daß noch dem stumpfesten Betrachter sich etwas vermittelt von der Wendigkeit des Pferdes, von der Wachheit des Hundes und von der Ruhe der Katze. Aber ich verliere mich in Erinnerungen, Antonio, und müßte mich sputen, dir vor Ablauf der Frist die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit über den Sieg des Kommandos ›Werther‹ mitzuteilen. Verneigen wir uns also rasch noch einmal vor Goethe, diesem großen Dichter der uns Künstlern unser Künstlersein zwar neidete, jedoch nicht verübelte. Ich werde dir nämlich von anderen Vertretern dieses Berufsstandes berichten müssen, Antonio, von ganz anderen!«
Den ›Werther‹ beiseite schiebend, kramte der Alte in einem Stapel von Katalogen, zog einen hervor und begann noch während des suchenden Blätterns weiterzureden: »Etwa zwanzig Jahre nach dem Ende des unseligen Werther setzte ein anderer Literat Möchtegernkünstlern einen weiteren verhängnisvollen Floh ins Ohr … ›Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders‹ – heißt ein Büchlein, das des blutjungen Wilhelm Heinrich Wackenroders, welches die Wahnidee propagiert, große Kunst habe große Frömmigkeit und große Keuschheit der Künstler zur Voraussetzung und große Themen wie Religion oder die Kunst selber zum Inhalt. ›Ich vergleiche den Genuß des edleren Kunstwerks dem Gebet‹, lesen wir da, und einer, der ihm glaubte, war der junge Franz Pforr, der mit dem jungen Overbeck und den anderen ebenfalls jungen Lukasbrüdern darin wetteiferte, große Ideen wie ›Allegorie der Freundschaft‹ oder ›Raffael, Fra Angelico und Michelangelo über den Wolken von Rom‹ in der denkbar steifsten, unsinnlichsten und ängstlichsten Weise aufs Papier zu bringen. Hier!« Der Alte deutet auf eine Abbildung: »Schau dir diese drei sonderbaren Heiligen doch einmal genauer an! Da stimmt aber auch nichts, keine Proportion, kein räumlicher Bezug; und da lebt ebenso wenig, kein Strich, kein Ausdruck. Alles seelenlos, macht aber nichts, Hauptsache, der Herr Zeichner ist von seinem großen Thema beseelt, Hauptsache, die Gesinnung stimmt, Hauptsache, das Bürschchen erlebt sich als großen Künstler, wenn er seine großen Vorbilder in einer Manier darstellt, die ihm jeder Einzelne der Dargestellten achtkantig um die Ohren geschlagen hätte, selbst der fromme Fra Angelico. Wenn nicht aus ästhetischen Gründen, dann aus persönlichen: Der engelhafte Bruder, weil er den Himmel nicht mit einem Hurenbock wie Raffael hätte teilen wollen; Michelangelo, weil er bereits zu Lebzeiten zu sehr unter dem Plagiator Raffael gelitten hatte, um ihn nun auch noch im Jenseits als Nachbarn auf der Wolke ertragen zu können. Denn das war der so heiligmäßig verehrte Urbiner in Wirklichkeit: Ein sauberer Kollege, der sich über Bramante heimlich Zutritt zur Sixtinischen Kapelle zu verschaffen wußte, die bis dato noch so gut wie niemandem bekannte Manier des gerade in Florenz weilenden Michelangelo genau studierte, seine eigenen, gerade begonnenen Wandgemälde der Kirche San Agostino auf den neuesten Stand, den des Divino, brachte und den heroischen Stil kaltblütig als seine Erfindung ausgab – so einer war er! Raffael, das Kameradenschwein, das leider, leider bereits im Alter von siebenunddreißig Jahren das Zeitliche segnete, weil er sich zu Tode gevögelt hat. Zu Tode! Gevögelt!« Der Alte hält ein, da ihn die Augen des Knaben noch geweiteter anstarren. »Gebumst«, sagt er versöhnlich, »oder wie es sein Biograph Vasari ausdrückt: ›Er frönte auch vor seiner bereits festgesetzten Heirat mit einer Nichte des Kardinals Bibbiena den Freuden der Liebe und überließ sich deren Vergnügungen ohne Maß, da geschah es, daß er es eines Tages noch schlimmer als gewohnt trieb‹ – er kehrt mit starkem Fieber zurück, verschweigt den Ärzten seine Ausschweifungen, wird wegen Erkältung zur Ader gelassen und verscheidet an Schwäche. Und ausgerechnet diesen Schlawiner reklamierte Literatenunverstand als Musterbeispiel des großen, weil reinen Künstlers, ausgerechnet diesen Society-Liebling feiern die Lukasbrüder alias Nazarener in aller Unschuld als einen ihrer Schutzheiligen, als göttlichen Raffael: O sancta simplicitas!«
Zögerndes Blättern: »Wo steckt denn der Bastard?« Dann ein erfreuter Ausruf: »Da ist ja der Bastard! Aber was für ein Zeichner! Hier, diese Karyatide: Kann man hauchdünnes Gewand leichthändiger und verführerischer um einen erblühenden Mädchenkörper wehen lassen? Zum Anbeißen, Antonio, zum Vernaschen! Die dunklen nackten Achselhöhlen, ah! Der wohlgerundete Busen, oh! Und derselbe Mann, der diesen Racker mit schwarzer und weißer Kreide auf weißgrundiertes Büttenpapier zaubert, greift zum unbarmherzigen, weil nicht korrigierbaren Silberstift, wenn es darum geht, sich die Figur des Philosophen Diogenes für sein Wandbild ›Die Schule von Athen‹ zu erarbeiten. Zu erarbeiten, jawohl! Hier die Figur des würdigen halbnackten Modells, das dabei ist, ein Schriftstück zu studieren, hier ein Detail der Schulter, hier Knie, hier Fuß, hier Faltenwurf, und alles auf einem