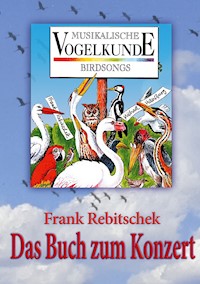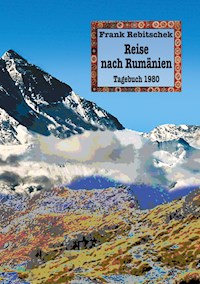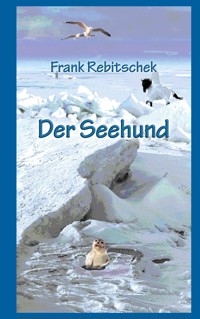
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Seehund" spannt als Sammlung von Erzählungen und Märchen den Bogen von 1962 bis 2016. Darin schildert der Autor mit Ost-West-Biografie Geschichten aus der ehemaligen DDR, als die Ostsee zufror, ein Märchen aus dem Dreiländereck Polen, Deutschland, Tschechien und manch schräge Kurzgeschichte über die historische Achse des Mauerfalls hinweg abwechslungsreich und spannend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Was vor uns liegt
Und was hinter uns liegt,
sind Kleinigkeiten zu dem,
was ins uns liegt.
Und wenn wir das, was in uns liegt,
nach außen in die Welt tragen,
geschehen Wunder.
Henry David Thoreau
Inhaltsverzeichnis
Flieger Schorsch
Der Kontrabassist
Erna
Die Nonne und der Wassermann
Der Mauerläufer
Die Flucht aus den Bergen
Heiligabend
Der Seehund
Das Märchen vom Kaviar
Wollhandkrabben
Die Funkerin
CK oder wenn nur der Labrador nicht wäre
Naturerforscher Linse
Der Tierfotograf
Nebensonnen
Kapitänsbilder
Flieger Schorsch
Das Dorf meiner Kindheit ist ein Tälerdorf, aber eines von denen, die sich nur in einer Richtung ausbreiten konnten, denn hoch oben stand seit ewigen Zeiten der Wald als unüberwindbare Grenze. Nach dem Krieg hatten die Truppen der Roten Armee die Höhe als Stützpunkt für ihre Hubschrauber besetzt gehalten, aber auch die verschwanden eines Tages.
Einkerbungen in der Landschaft hatten durch Jahrtausende erst dem Bach den Weg geebnet, später schmiegten sich diesem ein Weg und dann die Straße an. So wie in den meisten Ortschaften dieser Gegend, in den Städtchen und Dörfern waren nicht nur die Hänge aneinander gerückt, sondern auch die Menschen und man wusste von einer bis zur gegenüberliegenden Straßenseite beinahe alles voneinander. Mein Vater war in dieser Zeit Bürgermeister dieser Vierhundertseelengemeinde und die Ereignisse im Tal waren am Mittagstisch ständig Gesprächsstoff.
Nun gab es im Ort ein Original, das sich dieser Vorbestimmtheit entzog, einen Sonderling, oder wie, nicht wenige behaupteten: einen Narren. Die ganz Boshaften redeten vom Dorftrottel. Der alte Mann mit dem dicken Bauch und mit dem steifen Bein war für uns Kinder immer ein wundersamer und spannender Erzähler gewesen. Im Dorf nannten sie ihn den Flieger-Schorsch, weil er behauptete Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg gewesen zu sein und Jedem der es hören wollte, die unglaublichsten Geschichten aus seiner Pilotenlaufbahn auftischte.
Wie unsere Eltern erzählten, ereignete sich dergleichen vor allem im Gasthof an der Mühle, wenn er wieder einmal zu tief ins Glas geguckt hatte, was nicht selten vorkam.
Wenn ein Wanderer oder ein Besucher an einem der Tische in der verräucherten Stube gelandet war, wusste Schorsch bald, diesen wie in eine Spinne in ihr Netz in ein Gespräch zu verwickeln. Irgendwie gelang ihm immer der Einstieg in sein Lieblingsthema, das Fliegen. Meist begannen die Unterhaltungen der Gäste mit dem Thema des Wetters, dem harmlosesten und ergiebigsten, weil ehrlichsten aller Themen.
Es glich dem Sichgegenseitiglausen der Affen, einem belanglosen Miteinander von hohem Wert.
Wenn der entscheidende Zeitpunkt gekommen war, schaltete er sich wie beiläufig in die Unterhaltung ein. Das klang dann etwa so:
»Ist wahrlich kein Flugwetter heut. Da lassen wir die Maschinen besser am Boden.«
Und wenn die Sonne vom blauen Himmel schien, hieß es:
»Wir haben bestes Flugwetter heut.«
Das war die Startfreigabe. Wenn bis jetzt noch niemand verwundert gefragt hatte, half die Wirtin nach, obwohl sie Schorschs Geschichten seit Jahrzehnten kannte. Es war das alte Spiel zwischen den Beiden, die sich zwar nicht mochten und dennoch gegenseitig nutzten.
»Er ist der Flieger Schorsch«, verkündete sie und wusste, daß der Abend zu ihrem Vorteil sein Ende nehmen würde, vertrauend auf Schorschs Erzähltalent. Waren andere Dorfmitglieder im Raum, womöglich der Stammtisch, hob sich manche Augenbraue und einige zogen den Alten auf:
»Ja, erzähl mal, Schorsch, wie war das damals im Packeis mit deiner Notlandung?«
Er tat dann, als hätte er den Spott nicht bemerkt, auch wenn sie lachten. Aber er befand sich längst auf der Startbahn. Meist handelten die Geschichten vom Krieg. Namen von Flugzeugtypen fielen. Messerschmidt, Heinkel, die Ju-88, die Stuka und was er sonst alles geflogen haben wollte. »Sein Gedächtnis gleicht einem Luftwaffenmuseum.«
Das waren die Worte unseres Vaters, mit abfälliger Miene beim Abendessen vorgetragen, wenn er aus dem Gasthof nach Hause kam.
Was er nicht wusste war, daß Flieger Schorsch auch uns Kindern seine Abenteuer erzählte und lange Zeit verrieten wir den alten Mann nicht.
Es war für uns immer ein besonderer Spaß, wenn wir ihn bei seinen Eseln entdeckten.
Von seiner Mutter hatte er das halbverfallene Haus am Waldrand geerbt und war nach deren Tod dort eingezogen. Seine Frau sei in Hamburg beim Bombenangriff ums Leben gekommen, hieß es. Zum Häuschen gehörte ein Stück Grünland auf welchem Schorsch drei Esel hielt. Sie hießen Boreas, Zephyros und Notos; für uns seltsam klingende Worte und auch als er erklärte, daß sie die Namen von Winden bedeuteten, sahen Tiere für uns immer noch wie alte, traurige Esel aus.
Während Schorsch redete, standen sie meist wie geistesabwesend in der Nähe des Zauns, als hätten sie seiner Geschichte schon hunderte Male gelauscht und warteten nur darauf, ob der Mann eine Veränderung anbringen würde. Wir dagegen hockten wie Spatzen auf dem Zaun des Geheges und lauschten. Schorsch saß beim Erzählen entweder auf seiner aus Weiden geflochtenen Kiepe oder lehnte sich an den uralten Birnbaum mit der rissigen Rinde neben dem Weg.
Meist aber stand er breitbeinig auf dem Weg und blickte erhobenen Hauptes über das Tal und das Dorf in die Ferne, als prüfe er die Luft. Die Daumen steckte er in die Taschen seiner Weste und schob seinen immensen Bauch nach vorn. Darüber trug er sommers wie winters eine abgewetzte Joppe mit Fellbesatz auf dem Kragen. Seine Füße steckten in schwarzen, klobigen Schuhen.
Eine unserer Lieblingsgeschichten war die vom Nordmeer. Jedes Mal lauschten wir wie gebannt, wenn er von seinem Flug über die Eisberge berichtete.
»Das Nordmeer ist blau, tiefblau und dann siehst du plötzlich kleine, milchig weiße Fleckchen wie Griesklößchen in der Suppe und in der Mitte haben sie einen hell leuchtenden weißen Fleck. Das ist sie. Das ist die Spitze des Eisbergs. Die berühmte Spitze, die man nur vom Flugzeug so sehen kann, denn der größte Teil dieser Dinger liegt unter der Wasseroberfläche. Da bin ich runter gegangen und wollte mir die Sache aus der Nähe betrachten. Dicht über dem Wasser umkreiste ich den weißen Koloss und was sah ich da?«
Jeder von uns hielt den Mund, obwohl wir die Antwort kannten.
»Einen Eisbären,« fuhr Schorsch fort. »Der saß ganz oben auf der Spitze und ließ es sich gut gehen.«
Wir klatschten begeistert, aber er hob beschwichtigend seine großen Hände.
»Das ist nicht das Ende der Geschichte, liebe Freunde.«
Wir horchten auf, denn weiter kannten wir sie noch nicht. Auch einer der Esel wackelte mit den langen Ohren. Ein anderer schüttelte den Kopf. Der dritte drehte sich weg.
»Ich zog die Maschine wieder nach oben«, fuhr Schorsch fort.
»Und dann entdeckte ich ihn. Aus der Höhe kann man sie am Besten erkennen. Dort schwamm einer von ihnen. Ein riesiger Wal schwamm durch das eisige Wasser gen Norden. Den wollte ich mir natürlich aus der Nähe ansehen. In weitem Bogen folgte ich ihm und ging wieder hinunter. Aber was war das? Hatte der Bursche mich entdeckt? Plötzlich tauchte er ab. Also ich wieder rauf und es dauerte ziemlich lange, bis ich ihn sah. Meine Zeit wurde langsam knapp, genau wie das Benzin. Bis zum Abend musste ich unsere Basis in Grönland erreicht haben.
Einen Versuch noch, sagte ich mir. Ganz dicht flog ich über dem Wasser. Das Fahrwerk streifte manchmal die Wellenkämme des Nordmeers. Das war riskant. Ich kam ihm von hinten immer näher und dann schoss er.«
Uns blieben vor Staunen die Münder offen stehen.
»Er blies seine Fontäne direkt vor mir in die Luft und ich bekam die ganze Dusche direkt gegen die Scheibe des Cockpits. Ich sah gar nichts mehr und wäre beinahe abgeschmiert. Das hätte das Ende bedeutet. Mir blieb nur noch, den Steuerknüppel an mich zu reißen und nach oben zu ziehen. Erst nach Minuten hatte der Wind die Scheiben wieder frei gepustet. Ja, ein Wal hatte mich angeniest und damit fast vom Himmel geholt.»
Die Esel trabten plötzlich davon und auch Schorsch wollte nach seiner Kiepe greifen, als er unsere enttäuschten Gesichter sah.
»Weil Ihr so tapfer zugehört habt«, sagte er und fummelte mit seinen vom Rauchen gelben Fingern in der Westentasche herum. Er zog ein paar Briefmarken hervor.
»Möchte jemand eine haben? Aber vorsichtig. Die sind sehr wertvoll.«
Natürlich wollten wir und sprangen vom Zaun. Jedem von uns gab er eine alte, manchmal schon etwas zerknitterte Briefmarke. An einigen fehlten bereits Zähne, aber das störte uns nicht. Wichtig waren die darauf abgebildeten Flugzeuge, Luftschiffe, Raketen oder auch Ballons. Schorsch holte sein riesiges, kariertes Taschentuch heraus und schnäuzte sich, nachdem er noch einmal über das Tal geblickt hatte.
»Dann will ich mal«, sagte er, schnallte die Kiepe über.
»Es ist bestes Flugwetter heut.« Mit schweren Schritten stapfte er in Richtung Wald.
Eine dieser Briefmarken trage ich heute noch im Portemonnaie bei mir. ich hatte sie schon fast vergessen und wurde daran erinnert, als sie bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen herausfiel und einsam auf dem Transportband lag. Der Beamte hob sie auf und reichte sie mir mit einem Lächeln. Es war das berühmte große Wasserflugzeug Dornier Wal. Später sah ich auf meinem ersten Atlantikflug in der Nähe von Grönland tatsächlich die Eisberge unter mir. Die Sonne schien durch das Fenster herein und an den Scheiben bildeten sich Eiskristalle. Es ist bestes Flugwetter heute. Schorschs Worte wirkten in mir nach. Der konnte doch unmöglich den gleichen Anblick aus dieser Höhe erlebt haben, wie er mir jetzt vergönnt war. Einzig seine Fantasie war es, die uns als Kinder so begeistert hatte und seine unglaublich spannenden Erzählungen, auch wenn er dabei umso mehr übertrieb, je älter er wurde. Die Erwachsenen hörten ihm schon lange nicht mehr zu, verspotteten ihn oder wiesen ihn zurecht. Sie nannten ihn einen Lügenbaron, der eines Tages auch behaupten würde, er wäre auf einer Kanonenkugel geflogen. Außerdem betrank er sich immer häufiger.
Aber trotz seines steifen Beins schleppte er sich tagsüber mit seiner Kiepe auf die Höhen des Waldes und sammelte Holz, damit der Schornstein seines Häuschens rauchte. So ging es in jedem Jahr bis zum Herbst. Wir hatten auf der Bergwiese unsere Drachen steigen lassen, aber der böige Wind riss sie uns immer wieder vom Himmel. Da entdeckten wir Schorsch beim Striegeln der Esel. Er sah unsere arg mitgenommenen Drachen.
»War wohl kein Flugwetter heute?«, rief er uns lachend zu. »Wenn ihr Lust habt, gibt’ s nachher Bratbirne.«
Bratäpfel kannten wir, aber Bratbirne hatten wir noch nie gegessen. Wir schauten uns ungläubig an.
»Ihr könnt es euch ja noch überlegen. Ich gehe hinein und heize den Ofen an.«
Der Himmel wurde grauer und der Sturm pfiff uns um die Ohren, während wir unschlüssig am Zaun warteten.
»Meine Eltern haben mir verboten, zu dem ins Haus zu gehen“, sagte Elisa und Benno der Sohn vom Ziegenbauern stimmte ihr zu. Sie rannten ins Dorf.
Für Fritz, meinen Bruder Karl und mich galt ein solches Verbot nicht, aber wir zögerten dennoch. Niemand von uns hatte das Häuschen je betreten. Wie mochte es darin aussehen? War es da genauso schmutzig wie Schorschs Kleidung manchmal, so ungepflegt wie seine alte, rissige Haut? Wir sahen, wie Rauch aus dem kleinen Schornstein aufstieg, der mehr an eine versteinerte, sich öffnende Blume erinnerte, als an einen Kaminschlot. Schorsch heizte. Egal. Wir kletterten über den Zaun und liefen an den verwunderten Eseln vorbei zum Häuschen. Er öffnete die Tür, hatte sich eine schmuddelige Schürze umgebunden und hielt ein Messer in der Hand.
»Kommt rein«, sagte er und ging voran. Wir folgten ihm mit gemischten Gefühlen in das Halbdunkel der Küche, die fast das ganze Innere des Häuschens ausfüllte. Es gab nur noch eine Tür im Raum. Die führte vielleicht zu seinem Schlafzimmer. Der Herd mit seiner leuchtenden Messingstange verbreitete bereits angenehme Wärme und durch die Spalte zwischen den Ringen auf der Platte leuchteten die Flammen.
»Setzt euch«, forderte Schorsch uns auf und blieb an den Herd gelehnt stehen. Wir nahmen an einem großen Eichentisch Platz, sahen uns im Raum um und waren begeistert. An der Decken hingen Flugzeugmodelle, ein Zeppelin, ein Ballon, unter dem ein Kerzenlicht brannte und an den Wänden gab es Fotos von zahlreichen Flugmaschinen; den Zeichen auf den Rümpfen nach wahrscheinlich Kriegsflugzeuge.
»Die Birnen sind in der Röhre und brauchen noch etwas Zeit. Wenn kein Flugwetter ist, bleibt man besser am Boden.«
Er goss sich aus einem Zinnkännchen eine merkwürdig riechende Flüssigkeit ein. Überhaupt roch es im Haus seltsam, eine Mischung aus feuchter Rinde, Tabak, Stroh und Rauch.
»Das Rezept für die Birnen habe ich mir von einer Reise in den Urwald mitgebracht…«
»Erzähl Schorsch!« rief mein Bruder. Was konnte es in diesem Moment Schöneres geben, als einem neuen Erlebnis zu lauschen.
»Aber diese Geschichte ist wahrhaft unglaublich.«
Er schmunzelte und trank einen Schluck aus seinem Glas. Wann waren das seine Geschichten nicht?
»Ich befand mich mit einem Wasserflugzeug auf einem Erkundungsflug in Afrika. Der Motor machte plötzlich Schwierigkeiten und ich musste auf einem dunklen Urwaldfluss notlanden. Das wäre noch nicht das Schlimmste gewesen, aber beim Landen hatte ich mit einem Schwimmkörper ein Krokodil gerammt und das Biest hat ihn mir aus Wut darüber abgebissen und verschlungen. Krokodile haben einen Magen, der kann so ziemlich alles verdauen. Darin kommen sie gleich nach den Haien.«
Plötzlich hörten wir ein lautes Rumpeln in der Wand und blickten erschrocken auf.
»Ah, da hat der Wind wieder einen Ziegel vom Schornstein in den Kamin geworfen. So geht Stück um Stück verloren. Aber er raucht ja noch.«
Schorsch öffnete die Klappe der Ofenröhre. Auf einem verrosteten Blech blubberten und rekelten sich die Bratbirnen und entließen einen verführerischen Duft in den Raum. Er verteilte sie für uns auf Teller. Sie waren heiß und so weich, daß wir sie nur mit einem Löffel essen konnten. Und sie schmeckten köstlich und süß.
»Wie ging es weiter?«, fragte ich schmatzend.
»Ich geriet ganz schön in Schieflage und musste aufpassen, daß mich das Vieh nicht als Nächstes verspeiste. Mit Mühe erreichte ich das Ufer. Dort wurde ich sofort von Eingeborenen gefangen genommen und zu ihrem Häuptling geführt, der mich für einen ihrer Götter hielt und deshalb als Gast aufnahm. Bereits nach wenigen Tagen konnte ich mich mit ihm verständigen und erzählte von meinem Problem. Und siehe da: Er wusste Rat. Seine Männer brachten aus dem Wald ein riesiges Stück weißes Holz, das so leicht war wie Papier und wir schnitzten es in die Form eines Schwimmers. Bereits am nächsten Tag schraubten wir es am Flugzeug an. Ich fühlte mich schon fast gerettet, als unerwartet eine riesige Schlange aus dem Wasser auftauchte und einen der Arbeiter in den Griff nahm. Mir blieb nichts anderes übrig, als zur Maschinenpistole zu greifen und das Tier zu töten.
Endlich war es soweit. Den Motor hatte ich inzwischen repariert und startete. Der Häuptling stand auf einem Hügel, winkte mir zu und was glaubt ihr, was er gerufen hat:
»Es ist bestes Flugwetter heut«, riefen wir wie aus einem Mund.
»Ich sehe, wir verstehen uns«, brummte Schorsch. »Aber ich glaube, ihr solltet bald gehen. Draußen wird es langsam dunkel und ich möchte nicht, daß eure Eltern sich Sorgen machen.«
Diesmal gab es keine Briefmarken. Es hätte für uns Kinder immer so weiter gehen können, aber in der darauffolgenden Zeit sahen wir Flieger-Schorsch nur noch selten. Es hieß, ihm ginge es nicht gut. Auch hörten wir von Streitereien im Wirtshaus. Angeblich hätten die Stammgäste ihn hinausgeworfen, weil er betrunken gewesen war und weil er stank, wie einige behaupteten. Auch meine Eltern waren überzeugt, daß so Einer nie bei der Luftwaffe gewesen sein konnte, allenfalls beim Bodenpersonal. Es gab Leute, die ihn in Hamburg als Flakhelfer gesehen haben wollten. Dann kam der Tag, an dem er auch uns Kinder als seine dankbarsten Zuhörer verlor.
Das geschah an einem Frühlingstag und wir standen wieder am Zaun bei den Eseln. Eigentlich war alles wie immer, nur daß Flieger-Schorsch ab und zu eine kleine, flache Blechflasche aus der Tasche zog und daraus trank.
»Was ich euch noch nie erzählt habe, war mein Einsatz in der Wüste. Die Wüste ist etwas ganz Besonderes, weil sie die Augen täuscht. Du fliegst in der flimmernden Hitze über das Sandmeer und sie gaukelt dir Dinge vor, die gar nicht da sind. So ging es mir. Ich suchte einen Flugplatz zum Landen, denn ich brauchte dringend etwas zu trinken, weil meinen Wassertank eine feindliche Kugel durchlöchert hatte. Da sah ich endlich vor mir eine Landebahn und ging runter. Aber erst, als die Räder den Sand berührten, der in riesigen Wolken aufstob, bemerkte ich den Irrtum: Ich war einer Fata Morgana gefolgt. Ich brachte die Maschine vor einer Düne zum Stehen und saß nun bei fünfzig Grad Hitze in der Patsche. Glücklicherweise besaß ich noch ein paar Eier, die auf wundersame Weise die harte Landung überstanden hatten. Ich briet sie mir auf der glühend heißen Tragfläche, als sich ein Fuchs näherte.
>Kann ich auch eins abbekommen?< fragte er mich mit menschlicher Stimme. >Dann zeige ich dir, wo du Wasser findest.<
Ich gab ihm von dem Ei. Wir staunten erst und dann lachten wir aus vollem Halse. Nur Elisa war außer sich.
»Das ist doch alles gelogen!«, rief sie plötzlich. »Ich kenne die Geschichte. Die hat der kleine Prinz geschrieben.«
Wir blickten fragend zu Schorsch, dessen Mundwinkel zuckten, als er sich zu einem Lächeln zwang.
»Ja, ja, der kleine Prinz«, murmelte er. »Den habe ich gut gekannt.«
»Jetzt habe ich aber genug«, schrie Elisa und rannte davon.
Es schien, als hätten sich auch die Esel weggedreht und ihre Köpfe ins Gras gesteckt.
»Ja, dann mal tschüss, Schorsch«, sagte Benno.
Wir anderen wollten auch gerade gehen, als Flieger-Schorsch noch einmal in die Westentasche griff und eine Handvoll Briefmarken herausfischte.
»Nehmt die noch mit«, sagte er mit matter Stimme. »Es sind die letzten.«
Dann rannten wir durch die Koppeln ins Dorf und ließen die Flugabenteuer für alle Zeit hinter uns. Es war, als wollten wir von nun an keinen Kinderfilm mehr anschauen. Wir wandten uns anderen Dingen zu und begannen, uns für die Mädchen zu interessieren. In dieser Zeit bekam mein Vater eine neue Stelle in der Stadt.
Am letzten Abend vor unserem Umzug, als er noch einmal in den Gasthof ging, um sich von den Leuten am Stammtisch zu verabschieden durfte ich ihn begleiten. Der Raum war mit Gästen gefüllt, aber nicht nur an den Tischen. Um den Kamin herum hockten junge Wanderer neben ihren Rucksäcken am Boden und direkt vor dem Kamin saß Flieger-Schorsch rittlings auf einem mit Saufell bezogenen Hocker. Doch wie sah er inzwischen aus? Die Augen waren eingefallen, die Haut des Gesichts nicht mehr rot, sondern gelblich. Seine rechte Hand hing schlaff herab, als könne er sie gar nicht mehr bewegen. Dennoch erzählte er wie eh und je und wieder einmal ging es um den Krieg.
»Ich war Aufklärer und wurde auf die andere Seite geschickt, über das ganze riesige Russland bis an den Pazifik.«
Er schilderte die sibirischen Weiten, als hätte er sie tatsächlich überflogen, hatte angeblich Bären und Tiger aus der Luft gesehen.
»Mein japanischer Flughafen, auf dem ich tanken sollte, wurde gerade bombardiert und so musste ich weiterfliegen und geriet mit nur wenigen Tropfen Sprit über den Ozean. Das hätte mein Ende bedeuten können.«
Schorsch schien gar nicht zu bemerken, daß sich die Gesellschaft nur noch über ihn lustig machte mit Einwürfen wie:
»Unglaublich! … Tatsächlich! … Ist denn das die Möglichkeit!«
Mir war es peinlich und mein Vater verzog nur mitleidig das Gesicht. Schorsch fuhr unbeirrt fort und seine Stimme wurde immer lauter. Das Holz im Kamin knisterte. Die Wirtin brachte ihm Bier, das die jungen Leute ausgegeben hatten. Mühsam trank er mit der linken Hand und lief dann noch einmal zu großer Form auf. Alle warteten auf das Finale.
»Da entdeckte ich einen amerikanischen Flugzeugträger. Aber die sollten mich nicht abschießen. Es half nichts: ich musste mich ergeben. Ich zog mein weißes Pilotenhalstuch heraus und sah schon, wie sie da unten die Kanonen auf mich richteten. Ich öffnete das Fenster des Cockpits einen Spalt und ließ das Halstuch in den Wind hinaus. Meine weiße Fahne knatterte neben der Scheibe und tatsächlich sah ich, wie sich die Kanonen senkten. Ich riskierte die Landung, mein Gott, ich probierte es und schrammte mit dem Heck über die Kante. Hoffentlich würden sie mich wegen des Schadens nicht erschießen, dachte ich noch. Ich besaß ja keinen Haken für die Fangleine. So etwas hatten die deutschen Ingenieure nicht vorgesehen und die wären wohl niemals auf die Idee gekommen, daß eine ihrer Maschinen jemals auf einem Flugzeugträger landen müsste. Ich setzte auf und ein Reifen platzte, was in diesem Moment mein Glück war, weil sich die Maschine nun wie ein Kreisel um die eigene Achse drehte, was die Energie raus nahm und mich schließlich quer vor dem Kommandoturm zum Stehen brachte. So geriet ich wenige Tage vor Kriegsende in amerikanische Gefangenschaft. Ob ihr’ s glaubt oder nicht…« Den letzten Satz hätte er sich sparen können, dachte ich.
Aber plötzlich brach ein tosender Applaus los. Selbst seine härtesten Kritiker klopften auf die Tischplatte und riefen:
»Bravo, Münchhausen! Du hast dich selbst übertroffen.« Mein Vater hatte genug und wollte gehen. Ich stand ebenfalls auf und nickte Flieger Schorsch zu, der es ein letztes Mal geschafft hatte, mich in den Bann seiner Fantasie zu ziehen.
Später bei meiner Arbeit als Journalist dachte ich noch oft an diese Kindheitserlebnisse. Im vorigen Jahr aber wurde ich auf besondere Weise an Flieger Schorsch und seine Geschichten erinnert. Ich hatte eine Rezension über eine Shakespeareaufführung in Berlin zu schreiben und fuhr am nächsten Tag zurück. Der Dramaturg hatte ein Zitat im Programmheft abgedruckt, das mich während der ganzen Rückfahrt nicht los lies:
Why shot he be treated as a liar, because he is not ashamed to be a Storyteller.
Warum wollt ihr ihn einen Lügner schelten, nur weil er sich nicht schämt, ein Geschichtenerzähler zu sein.
Ich fuhr wegen eines Staus von der Autobahn ab und geriet so in die Nähe meines Heimatdorfs. Plötzlich entschloss ich mich zu einem spontanen Besuch. Vielleicht lebte die Wirtin noch und hatte ein Zimmer für mich. Ich konnte nicht ahnen, was auf mich wartete. Mir blieben noch zwei freie Tage Zeit und ich wollte genau dort auf meinem Computer die Rezension schreiben.
Beim Betreten der Gaststube schien alles unverändert. Lediglich die Tapeten waren noch dunkler als früher. Im Kamin brannte wegen des Sommers kein Feuer, aber der Hocker mit dem Saufell stand wie immer davor.
Ich war der einzige Gast. Die Wirtin begrüßte mich, als wäre ich erst gestern fortgegangen. Sie setzte sich zu mir an den Tisch und wir unterhielten uns lange.
Natürlich könne ich ein Zimmer bekommen, sagte sie und ich solle in aller Ruhe meinen Artikel schreiben. Am nächsten Mittag saß ich nach einem Spaziergang wieder am Tisch. Auch am Stammtisch hatten sich Gäste eingefunden. Ich klappte das Gerät auf und legte Programmheft und meine Notizen daneben, als sich die Tür öffnete und zwei Männer eintraten, ein jüngerer mit kurzen Hosen und TShirt und ein älterer, großer mit weißem Haar und Krückstock. Sie setzten sich und bestellten Kaffee.
Als die Wirtin die Tassen abstellte, fragte der Alte:
»Gute Frau. Ich bin hierher gekommen, um einen alten Freund zu treffen. Sein Name ist Georg Wiedemann, er hat ein steifes Bein und erzählt gern, wenn Ihnen das etwas sagt.«
Ich hob ungläubig den Kopf, als die Wirtin herausplatzte:
»Flieger-Schorsch!«
»Ach so haben Sie ihn genannt. Das passt auch. Bei uns hieß er G.G. - Geschichten-Georg.«
»Da kommen sie ein Vierteljahr zu spät. Der liegt oben auf dem Bergfriedhof. Und hier gibt es auch keine wilden Geschichten mehr.«
Der Alte schwieg einen Moment und meinte nur:
»Das ist schade. Ich war mal sein Co-Pilot. Wir flogen zusammen in der Staffel vom Grönlandfjord.«
Knisternde Stille hatte sich im Raum ausgebreitet. Die Wirtin ließ sich auf ihren Hocker am erkalteten Kamin fallen. Der alte Mann legte Geld auf den Tisch und sagte:
»Komm, mein Sohn, dann wollen wir zu ihm gehen.«
»Vater, du kannst doch nicht bei der Hitze da hinauf wollen und in deinem Alter.«
Aber der war schon an der Tür.
»Warum nicht? Ist doch bestes Flugwetter heut…«
Der Kontrabassist
Ich schaltete ab und öffnete weit das Fenster. Die gerade noch im Radio gehörte Stimme verfolgte mich und ich war dankbar, als der Lärm eines vorbeifahrenden ICE herüber drang und sich für ein paar Sekunden darüber legte. Seit einem Jahr wohnte ich in der WG in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ich konnte auf Züge schauen, was ich schon als Kind gern getan hatte. Aber in diesem Moment drohte mich ein Schatten der Vergangenheit einzuholen und auch dieser Anblick konnte mir nicht helfen. Vielmehr hatte er eine Zeit näher gerückt, die ich schon verdrängt glaubte. Es gibt Geschichten, die gelangen offenbar nie an ihr Ende. Immer kommt noch etwas nach. Ich musste weit zurück bis an den Anfang gehen. Und ich dachte an den Kontrabassisten.
Kennengelernt hatte ich ihn auf einer Studentenfete, zu der ich einlud, nachdem meine Bude renoviert war. Wie andere Musikstudenten auch, wohnte ich in einem Abrißhaus. Der Putz fiel von den Wänden, das Dach war undicht, ebenso wie der Ofen, bei dem man durch die Spalte zwischen den Kacheln das Feuer flackern sah. Bevor die Abrissbirne kommen würde, hatte die Musik in diesem Haus ein Refugium gefunden und konnte sich ausbreiten, ohne daß es jemanden störte.
Fünf Studenten saßen um den kleinen Tisch, drei auf dem Bett, einer auf dem Schreibtischstuhl und einer auf dem Klavierhocker. Der dickliche rothaarige Tom, der Trompeter aus dem Nachbarzimmer ‚Elmar, der Klarinettist aus der untersten Etage und Peter Pechstein der Kontrabassist. Außerdem hatte ich Barbara eingeladen, die wie ich Gesang studierte. Sie wohnte nicht in unserer Musikerruine, sondern in einem Internat. Bereits am ersten Tag des Studiums war mir die blonde Studentin mit dem ernsten Gesicht und den schmalen Lippen aufgefallen und ich ließ nichts unversucht, um in ihre Nähe zu gelangen. Deshalb freute ich mich besonders, als sie meine Einladung angenommen hatte. Wir hatten uns mit Wein versorgt und ab und zu setzte sich jemand ans Klavier. Barbara spielte hervorragend. Neben dem Gesang studierte sie Komposition. Irgendwann kam jemand auf die Idee, gemeinsam zu singen. Auf meinem Klavier lag die Partitur von Bachs Kunst der Fuge. Wir teilten die Stimmen auf. Barbara übernahm freiwillig den Bratschenschlüssel, den sie als Einzige sicher lesen konnte. Dann wurde Bachs Musik als Vokalise aus Kehlen hervorgebracht, wie sie unterschiedlicher kaum sein konnten. Peter füllte mit seinem warmen Basston die Unterstimme aus, als trüge er sein Instrument in sich. Bis zum Ende kamen wir nicht, wollten es bei einer anderen Gelegenheit proben. Elmar fragte plötzlich:
»Warum habt ihr euch eigentlich entschlossen, Berufsmusiker zu werden? Mir hatte mein Lehrer dazu geraten, nachdem ich einen Wettbewerb gewonnen hatte.«
Tom sagte:
»Lag bei mir in der Familie. Mein Vater spielt im Staatsorchester. Mein Großvater blies die Tuba in der Feuerwehrkapelle.«
Barbara meinte nur:
»Ich habe immer gern gesungen. Und außerdem will ich Musik schreiben, vor allem für Gesang.«
Dass ich ebenfalls viel und gern gesungen hatte, konnte ich nur bestätigen. Alle blickten zu Peter, der als Einziger keinen Wein trank, sondern sich aus einer Colaflasche nachschenkte. Er strich sich seine Haare aus der Stirn und tat, als hätte er die Frage nicht gehört oder müsse über etwas Wichtiges nachdenken. Er hatte so eine bedächtige, beinahe schüchterne Art, die gar nicht zu dem einmeterundneunzig großen Mann passen wollte. Stets war er schwarz gekleidet und ging in seinen ebenfalls schwarzen Sandalen sommers wie winters barfuß.
Peter Pechstein war ein Original und ein exzellenter Musiker zudem. Er schrieb traurige Gedichte und bissige Kritiken über Ballettaufführungen. Als er bei einer Grillparty ein scharfes Messer aus der Tasche zog und vor unseren Augen sein Steak ungebraten verzehrte, war sein Ruf als Sonderling endgültig besiegelt.
»Peter, warum hast du dich entschlossen, Berufsmusiker zu werden?«, fragte Barbara noch einmal. Wir erwarteten eine originelle Antwort und wir wurden nicht enttäuscht. Er trank noch einen Schluck von seiner Cola und sagte mit ruhiger, tiefer Stimme:
»Damit kein Flugzeug abstürzt.«
Einen Augenblick herrschte Stille. Tom fing an zu lachen. Elmar und ich konnten uns ebenfalls kaum zurückhalten. Der Rotwein zeigte bereits Wirkung. Nur Barbara blieb ernst und fragte:
»Kannst du uns diesen Satz bitte enträtseln?«
»Das ist sehr einfach. Ich hatte bereits als Kind Geige gelernt und eine Lehre als Flugzeugmechaniker begonnen. Während das Geigenspiel ganz gut lief, entwickelte sich meine Lehre zu einer einzigen Quälerei. Mir unterliefen Fehler, die noch nie jemandem passiert waren. Jedenfalls behauptete das mein Lehrausbilder. Und meist konnte ich nichts dafür. Es passierte einfach. Was ich anfasste, die einfachsten Dinge vermasselte ich. Als sich eine Turbine wegen Materialermüdung beim Testlauf beinahe von der Tragfläche losriss, war ich derjenige gewesen, der sie am Tag zuvor gereinigt hatte. Aber mich traf garantiert keine Schuld. Dennoch nahm mich der Meister beiseite:
>Pechstein,< hatte er gesagt: >Dein Name ist Programm. Ich gebe dir einen Rat. Lass die Finger von diesem Beruf. Suche dir was, bei dem kein Mensch zu Tode kommt, wenn du mal wieder eine Strähne hast.< Das habe ich dann gemacht. Allerdings waren die Chancen, mit der Geige mein Geld zu verdienen nicht sehr groß.
Habe dann auf Kontrabass umgesattelt und damit das Instrument meines Lebens entdeckt.«
Ich hätte ihn mir auch nie als Geiger vorstellen können, eher noch als Mathematiker, Stararchitekt oder Astrophysiker. Peters Antwort ist mir auch später immer wieder in den Sinn gekommen. Barbara bin ich nicht näher gekommen, was immer ich auch veranstaltete.
Ich traf sie ausgerechnet an dem Tag als ich am Bahnhof auf den Zug wartete, der mich zu meinem ersten Engagement bringen sollte. Sie erzählte mir, dass sie und Peter geheiratet hatten. Ich muss damals ein ziemlich blödes Gesicht gemacht haben. Danach hörte ich lange Zeit nichts mehr von den Beiden.
Nach einem Konzert im Erzgebirge saß ich abends noch mit Musikern zusammen. Plötzlich fiel der Name Pechstein. Der Cellist, der offenbar mit Peter im gleichen Orchester spielte, erzählte, dass diesem bei Sinfoniekonzerten zweimal etwas passiert sei, was einem Kontrabassisten auf offener Bühne nie oder höchstens einmal in seinem ganzen Leben geschieht. Mit lautem Knall sei der Steg am Instrument unter der Spannung der Saiten umgeklappt. Der unglückliche Musiker hätte sich jedes Mal vor dem Publikum verbeugt und sei dann von der Bühne gegangen. Ich stellte mir vor, wie diese große Gestalt mit den dichten, schwarzen Haaren, der eckigen Brille und dem ebenfalls schwarzen Instrument seine Schmach mit ernstem Gesicht ertrug. Womöglich hatte er da in seinen Sandalen wie ein Büßer vor den Leuten gestanden.
Bis ich das nächste Mal etwas von ihm hörte, vergingen einige Jahre. Das war, als ich Tom bei einem Weihnachtsoratorium in Bremerhaven begegnete. Wir saßen anschließend zusammen und erinnerten uns gemeinsam an unsere Studentenzeit. Wie von unsichtbarer Hand gesteuert kam das Gespräch auch auf jene erste Fete in meiner Studentenbude.
»Du weißt wohl nichts?«, fragte Tom.
Was hätte ich wissen sollen.
»Barbara ist tot.«
Die Nachricht traf mich wie ein Schlag.
»Wie,…tot…?«, stotterte ich hilflos.
»Genaues weiß man nicht. Sie soll in den letzten Jahren zunehmend depressiv gewesen sein. Die Ehe mit Peter lief wohl nicht gut. Sie ist eines Nachts zwischen Halle und Leipzig aus dem fahrenden Zug gesprungen, sagt man.«
Ich schluckte. Nicht zum ersten Mal versuchte ich mir eine Ehe zwischen der feinsinnigen Barbara und dem ebenfalls hypersensiblen und anstrengenden Peter vorzustellen. Das musste schiefgehen.
»Dann ist am Ende doch ein Flugzeug abgestürzt,« konnte ich nur hervorbringen und fragte Tom nach einer Weile:
»Was macht er jetzt?«
»Der Pechvogel hatte Glück. Eine Erbschaft. Ziemlich üppig. Aber ein Pechvogel bleibt ein Pechvogel, wie ein Pechstein ein Pechstein bleibt. Nach dem Desaster seines Lebens wollte er so weit wie möglich weg und kaufte sich von dem ererbten Geld eine Farm in Australien. Irgendwelche Neider haben sie ihm niedergebrannt und er ist gerade so mit dem Leben davon gekommen.«
Auch dieses Gespräch liegt schon Jahre zurück und es verfolgt mich bis heute. Gibt es tatsächlich ein vom Schicksal vorbestimmtes Unglück, das an einem Menschen haftet? Immer noch wehre ich mich gegen diesen Gedanken.
Da war wieder die Stimme aus dem Radio; jene knarrende aber nicht heisere, möglicherweise die eines starken Rauchers. Ich hatte die Sendung nebenbei gehört, denn heute war ich mit dem Spülen dran. Ein Regionalsender brachte eine Reportage über lebenslänglich in Haft sitzende Menschen.
Mit Genehmigung des Leiters und unter Bewachung hatten sie einen Mann vor die Tore der Anstalt führen dürfen, der wegen mehrfachen Mordes einsaß. Neben dem Parkplatz am Eingang gab es ein Rasenstück. So beschrieb der Reporter. Der Strafgefangene kniete auf dem Gras nieder, berührte es erst mit seinen Händen und grub dann sein Gesicht in die Halme.
»Das habe ich so lange nicht mehr gespürt«, sagte er.
»Aus welchem Grund sind Sie hier?,« hörte ich den Journalisten fragen.
»Ich habe Menschen aus fahrenden Zügen gestoßen. Das war für mich der Kick.«
Alles, was er danach noch sagte, hörte ich mit der Kaffeetasse in der einen und dem Geschirrtuch in der anderen Hand. Meine Erstarrung löste sich erst, als er sagte:
»Bin damals durch die Bundesrepublik gereist. Wie gesagt, es war ein Kick. Was niemand ahnte; ich bin auch in die damalige DDR gefahren, wo mein Bruder in Halle lebte. Der freute sich immer, wenn ich im ein paar Sachen mitbrachte, die es dort nicht gab. Bananen, Taschenrechner, gute Schokolade. Abends bin ich dann losgezogen und in den Zug nach Leipzig gestiegen. Die Fahrt dauerte nicht lange. Die Bullen da drüben wären mir niemals drauf gekommen.«
Schwang am Ende noch Stolz in der knarrenden Stimme dieses Mannes mit?
Natürlich dachte ich an Barbara und ich dachte an Peter. Hatte dieses Tier die von mir geliebte Studentin und seine Ehefrau auf dem Gewissen?
Plötzlich sagte der Mann: »Ich möchte jetzt wieder in meine Zelle gebracht werden und ich möchte auch nicht mehr raus in die sogenannte Freiheit. Käme da gar nicht mehr zurecht. Viel zu gefährlich…«
Das Fenster stand immer noch offen und trug vom Bahnhof den Lärm der ein- und ausfahrenden Züge herüber.
Erna
Es war Freitagnachmittag. Die Luft flimmerte über dem Rhein. Auf dem gegenüber liegenden Ufer, wo neben der Brücke die Türme des Doms aufragten, wuchs von Minute zu Minute eine dunkle Wetterfront heran. Seit zwei Wochen war kein Tropfen Regen gefallen und der Fluss hatte sich so weit in sein Bett zurückgezogen, daß die größeren Schiffe nicht mehr fahren konnten.
Auf der Promenade ließ es sich nur unter den Kronen der Bäume aushalten. Erna saß wie fast jeden Freitagnachmittag auf ihrer Bank und neben ihr lag Chuzpe, ein Rest von einem Hund, einem italienischen Windspiel, wie die offizielle Bezeichnung der Rasse lautete. Aber der spielte schon lange nicht mehr mit oder vor dem Wind, der mit ihm ohnehin leichtes Spiel gehabt hätte, wenn er aufstehen könnte, aber auch das klappte nicht mehr. Selbst das Heben des Kopfes bereitete dem altersschwachen Tier unendliche Mühe. Deshalb trug ihn Erna auf den Schultern, wenn sie unterwegs waren und legte ihn sich um den Hals wie einen Fuchspelz. Rechts und links ergriff sie dabei Chuzpes Beine, der aus Dankbarkeit dafür an ihrem Ohr leckte. Jetzt lag er neben Erna auf der Bank und ließ in der Hitze die Zunge heraus hängen. Wie er zu seinem Namen gekommen war, ließ sich nicht einmal ahnen, denn er war weder frech, noch verschlagen, was er nach der Bedeutung des jiddischen Wortes eigentlich sein müsste. Vielleicht war er früher ein Anderer gewesen. Beide waren sie auf ihre Weise in die Jahre gekommen, Erna mochte siebzig sein oder auch älter und Chuzpe stand ihr in seinem Hundealter nicht nach.
Sie trug ein hauchdünnes, grünes Kleid aus einem seideähnlichen, leichten Stoff, das ihren mageren Körper umhüllte. Von Frühjahr bis Herbst lief sie barfuß.
Ihre nackten Beine, die für ihr Alter noch sehr weiblich, beinahe mädchenhaft wirkten, hatte sie übereinander geschlagen. So saß sie in aufrechter Haltung und schaute auf den Fluss. Manchmal ging sie ans Ufer, wo Betonstufen direkt zum Wasser hinunter führten und ließ dort ihre Füße von der Strömung umspülen.
Es war für Erna nicht einfach, ihren Hund beim Namen zu rufen. Wenn er Hanka oder Beppo geheißen hätte, wäre es ihrem zahnlosen Mund leichter gefallen. Aber Chuzpe gehorchte trotzdem, spätestens seit er nicht mehr weglaufen konnte. Ihre Zähne hatte sie zu Hause gelassen, genauso wie die einzige Brille, die sie noch besaß und für das Lesen von Rechnungen, amtlichen Schreiben und den abendlichen Blick in die Heilige Schrift brauchte. Es war das Gebiss ihrer vor zwei Jahren verstorbenen Schwester und auch wenn es nicht ideal passte; zum Essen genügte es. Kurz bevor die Leiche abgeholt worden war, hatte sie ihren Schwager um die Prothese gebeten. Der hätte sie sonst mit in die Grube fahren lassen oder ein Totengräber hätte sie zu Geld gemacht. Anfangs war der Mann etwas pikiert gewesen, zeigte sich dann aber einverstanden; wahrscheinlich weil er befürchtete, daß Erna ihn, der zu einigem Vermögen gekommen war, ansonsten um Geld für eine eigene Prothese bitten könnte. Er konnte nicht ahnen, daß Erna dergleichen nie in den Sinn gekommen wäre, denn er hatte sich noch nie für die Schwester seiner Frau interessiert.
In der Ferne hörte sie Donnergrollen und einzelne Blitze zuckten hinter den Baumkronen, als sich ein Mann auf der Uferpromenade näherte. An seinen ausgebeulten Jeans und den klobigen, schwarzen Schuhen, die er das ganze Jahr über trug, erkannte sie den Pfandsammler. Hinter sich zog er einen umgebauten zweirädrigen Einkaufswagen her, auf dem eine leere Bierkiste, ein großer Plastiksack und ein gelber Köcher befestigt waren.
Über dem ausgewaschenen blauen T-Shirt trug er eine schmutzig weiße Weste mit zahlreichen Taschen, die mit Bibelsprüchen bekritzelt war.
»Presseschau!«, sagte er statt »Guten Tag« und ließ sich am anderen Ende der Bank nieder.
»Was hast du heute gefunden?«, fragte Erna.
Er zog aus seinem Plastikköcher ein Bündel zusammengerollter Zeitungen heraus.
»Eine halbe Kölner Rundschau. Aber hier klebt was dran. Vergiss es.«
Er faltete das Blatt angewidert zusammen und warf es in den Papierkorb.
Sie hatten ihr Ritual, das sie im Sommer beinahe an jedem Freitagnachmittag auf dieser Bank abhielten. Der Pfandsammler brachte Zeitungen mit, die er auf seinen Streifzügen gefunden hatte und las Erna daraus die Schlagzeilen einzelner Artikel vor. Wenn sie den Inhalt hören wollte, nickte sie gnädig und wenn nicht schüttelte sie den Kopf. Er konnte gut vorlesen, beinahe wie ein Nachrichtensprecher. Man merkte ihm dabei das Vergnügen an, vor allem weil er auf Ernas anschließende Kommentare wartete.
Er trug eine besondere Brille. Eigentlich bestand sie aus zwei Brillen, die er mit Klebeband übereinander montiert hatte. Er war ein Finder, kein Sucher, wie er immer behauptete. Mit den Jahren hatte er sich eine nach vorn gebeugte Haltung angewöhnt, die es ihm erleichterte, in Parks, auf Bahnsteigen und in Papierkörben leere Dosen und Flaschen, aber auch manche Kostbarkeit aufzuspüren. Darunter waren Handys, einmal auch ein Fotoapparat, die er dann zu Geld machte. Auch Brillen hatte er gefunden, nur war noch nie die richtige für seine schwächer werdenden Augen dabei gewesen, bis er auf die Idee mit der Doppelbrille kam.
Erna und er wussten wenig voneinander. Er mochte vierzig Jahre alt sein, kannte nur den Namen der alten Frau und sie nannte ihn nur den Pfandsammler. Er hatte Leute merkwürdige Dinge über sie sagen hören, auch daß sie nicht ganz richtig im Kopf sein solle und aus Südamerika stamme. Aber das war ihm egal. Ernas Worte klangen für ihn wie aus einer anderen Welt und brachten ihn fast immer auf neue Gedanken. Er kramte in den Blättern herum.
»Die Bildzeitung. Aber die liest du ja nicht.«
»Immer noch nicht. Man hat so seine Ansprüche. Beeil’ dich Pfandsammler! Da zieht was herauf.«
Hinter dem Dom hatte sich die Wolkenwand immer bedrohlicher aufgetürmt.
»FAZ habe ich hier, fast ungelesen, hat wohl jemand liegen gelassen. Sogar das Kreuzworträtsel ist noch leer. Ich fang mal vorn an: Streit in Brüssel.«
Kopfschütteln.
»Berliner Kulturkaspereien, Oberstes Gericht billigt Obamas Gesundheitsreform.«
Es blieb beim Kopfschütteln.
»Nicht die große Politik,« bat sie.
»Hier ist was aus der Region: Kölner Lehrer sollen für Schulhofparken zahlen.«
»Die armen Lehrer,« seufzte Erna und der Pfandsammler zweifelte, ob sie es ernst gemeint hatte.
»Hier ist noch einmal Köln: Die Opfer der Hexenprozesse in Köln sind rehabilitiert…«
Durch Ernas Gestalt ging ein Ruck. Sie nickte hastig und er las weiter:
»…Der Stadtrat verurteilte die Prozesse am Donnerstag einstimmig und sprach sich zugleich gegen jede Verletzung der Menschenwürde aus. Der evangelische Pfarrer Hartmut Hegeler hatte sich für die Rehabilitierung eingesetzt – auch in anderen Städten. Insgesamt wurden in Köln vor 400 Jahren 38 Todesurteile wegen Hexerei vollstreckt.
Zu den Opfern gehörten nicht nur Frauen, sondern auch drei Männer und ein Junge. In ganz Deutschland wurden 25000 bis 30000 Frauen und Männer als Hexen und Zauberer hingerichtet.
»Ich frage mich, was das heute noch soll, vierhundert Jahre später. Als ob wir keine anderen Sorgen hätten,« warf der Pfandsammler ärgerlich ein, wie es sonst nicht seine Art war.
»Das ist gut.« Ganz leise hatte Erna es gesagt und dann noch einmal bekräftigt: »Das ist sehr gut. Endlich.«
Er stutzte, aber sie redete weiter:
»Weil es heute immer noch Hexenverfolgungen gibt. Auch mich haben die Leute hier schon eine Hexe genannt.«
»Das ist mir aber neu,« log der Pfandsammler. Das Thema gefiel ihm gar nicht.
»Wenn man nicht ins Bild der Leute passt und anders lebt, sind sie schnell mit ihrem Urteil dabei.«
Ihre Stimme hatte an Kraft gewonnen, auch wenn ihr das Sprechen schwer fiel und der Pfandsammler sie nur mühsam verstehen konnte, lauschte er überrascht ihrer Geschichte.
»Hexen werden verbrannt, mit Worten oder mit Feuer. Meine Mutter war auch eine Hexe, jedenfalls in den Augen der Mächtigen. Sie hatte Krankheiten besprochen, an denen die Ärzte gescheitert waren und irgendjemand hatte sie als Zigeunerin denunziert.
Sie kam ins Feuer von Auschwitz. Von ihr weiß ich, daß auch ihre Mutter und ihre Großmutter Heilerinnen waren.«
Er verstand immer noch nicht, worauf Erna hinaus wollte.
»Mein Vater und ich gingen damals nach Chile. Meine Zwillingsschwester kam zu einer Tante nach Trier.
Nach dem Krieg traf ich in Santiago meine große Liebe. Er war ein Schamane und ich ging nach Vaters Tod mit ihm in sein Dorf.
Es wurde die glücklichste Zeit meines Lebens und ich lernte von ihm die Geheimnisse des Heilens. Aber eines Tages starb er. Sein Herz hatte plötzlich aufgehört zu schlagen und niemand im Dorf konnte es glauben. Sie wollten es nicht glauben, sondern beschuldigten mich, an seinem Tod Schuld zu sein, ihn behext zu haben. Auf einmal war ich labruja alemana, die Hexe aus Deutschland. Sie jagten mich. Erst flüchtete ich in die Berge und wanderte dann an der Küste entlang nach Süden. Jahrelang schlug ich mich irgendwie durch, auch mit Betteln und Stehlen und ich wäre wohl heute noch dort, wenn mir nicht ein reicher, britischer Arzt das Geld für die Überfahrt gegeben hätte.«
Plötzlich riss eine heftige Windböe dem Pfandsammler die Zeitung fast aus der Hand. Erna war aufgestanden und ging einige Schritte nach vorn. Sie schwankte. Das musste vom Sturm kommen, denn sie trank nicht. Ihr dünnes Kleid flatterte um den mageren Körper, der vor der dunklen Kulisse des Himmels an einen Totempfahl erinnerte. Blitze und Donner waren jetzt ganz nah. Die Kronen der Bäume rauschten im wilden Sog des Sturms.
»Was hast du vor?«, rief der Pfandsammler: »Gleich wird es regnen. Lass uns zum Kiosk gehen und uns dort unterstellen. Bei dem Wetter wird der Penner doch nicht wieder verlangen, daß wir etwas verzehren müssen.«
»Regen macht mich nicht nass!«, kreischte sie plötzlich mit einer Stimme, die er von ihr noch nie gehört hatte:
»Ich muß meine Füße kühlen. Mir ist wie Feuer so heiß.«
Langsam stieg sie die Betonstufen zur Wasseroberfläche, die in diesem Sommer so tief lag. Bald war der kleine Kopf dem Blick des Pfandsammlers entschwunden, der entsetzt dasaß. Erst als der Regen losbrach, sprang er auf, aber es war schon passiert. Erna lag rücklings auf den Stufen, die Füße wurden vom Wasser umspült.
Er beugte sich über sie, fühlte nach ihrem Puls, wie er es einmal beim Bund gelernt hatte, er rief ihren Namen. Nichts. Sie war rücklings mit dem Kopf auf eine der Betonstufen geschlagen. Hatte ein Windstoß die schwache Gestalt umgeworfen? Der Regen peitschte auf die Beiden herab. Die Tropfen ließen das blutige Rinnsal, das aus Ernas Mundwinkel rann über ihrer eingefallenen Wange zu einem winzigen Delta werden. Ihm kam es vor, als lächelte sie. Sie muß früher eine sehr schöne Frau gewesen sein, dachte er mechanisch und wimmerte verzweifelt vor sich hin. Hastig fummelte er sein Handy hervor und rief nach der Polizei und nach dem Notarzt, obwohl das wahrscheinlich vergeblich sein würde. Bis sie eintrafen, blieb er hilflos über der Toten auf den Stufen sitzen.
Sie nahmen ihn mit in den Einsatzwagen. Völlig durchnässt hockte er an einem Tischchen, während Sturm und Regen von außen an dem Fahrzeug rüttelten. Mechanisch antwortete er auf die Fragen der Beamten, als sie seine Personalien aufnahmen. Seltsamerweise fragte er sich nicht, ob sie ihm glaubten. Er war noch immer wie betäubt. Durch die verregneten Fenster des Autos sah er, wie sie Erna in einen Sarg legten und in den Leichenwagen schoben. Dann ließ man ihn gehen.
Chuzpe lag immer noch auf der Bank. Niemand hatte sich um das Tier gekümmert. Er hob den Kopf, als der Pfandsammler sich über ihn beugte und den schlaffen Körper ergriff. Er legte ihn über den Sack mit den leeren Dosen auf seinem Wägelchen und sie rollten durch den Regen davon.
Die Nonne und der Wassermann
Es war einmal, dachte ich, als ich vor dem Hauptgebäude des Schlosses ankam, welches hoch über dem Fluss das Tal überragte. Auf dem Vorplatz sprossen grüne Grashalme munter zwischen den Steinen empor, Flechten hockten auf den Stufen zum Eingang und die große Tür, die Fenster der unteren Etage waren mit Brettern zugenagelt worden. Ein Schild wies darauf hin, dass das einstige Hotel seinen Betrieb eingestellt hatte und demnächst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen beginnen würden. Was entstehen sollte, konnte ich nicht erkennen, aber seit dem angekündigten Baubeginn war bereits mehr als ein Jahr vergangen. Die Bauherren waren mit ihrem Vorhaben in Verzug geraten oder sie hatten es gänzlich aufgegeben.
Als ich vor ein paar Jahren auf einer Dienstreise durch dieses Tal gekommen war, hatte der Anblick dieses Winkels auf mich gewirkt, wie ein Erlebnis aus einer anderen Welt. Auf der Landkarte konnte ich keinen besonderen Namen für dieses Fleckchen Erde finden.
Es lag am Fuße eines Gebirges, zwischen dessen Gipfeln sich ein Fluss von Süden her seit Jahrtausenden seinen Weg gebahnt hatte. In weitem Bogen umarmte er auf der einen Seite Wiesen und Felder und wurde am gegenüberliegenden Ufer durch eine bewaldete Hügelkette begrenzt. An seinem Ufer stand schon seit Jahrhunderten das Schloss. Im Tal gab es ein paar verstreute Dörfer und in der Ferne ragten die Umrisse eines alten Klosters auf.
Ich hatte schon häufig von Orten gehört, an welchen die Zeit stehen geblieben sein sollte und diesen Fleck der Erde zählte ich seit meiner ersten Begegnung dazu. Immer noch glaube ich daran, dass es gut tut, mindestens einen heimlichen Ort auf der Welt zu kennen, der sich auch nach vielen Jahren kaum verändert und an den man jederzeit zurückkehren kann, wenn man es möchte. Damals entdeckte ich in einer Wochenendbeilage der Lokalzeitung eine Anzeige für das Schloss oberhalb des Flusses. Ich schnitt sie aus und nahm mir fest vor, noch einmal dorthin zu fahren, sobald es meine Zeit erlaubte. Aber meine Arbeit nahm mich bald wieder vollends in Anspruch. Ich verlor den Zettel aus den Augen und aus meinen Gedanken, bis er eines Tages unvermutet wieder auftauchte.
Lore, meine Frau hatte das zerknitterte Papier in einer Tasche meines Mantels gefunden, den sie in die Reinigung bringen wollte, gefragt, ob es noch wichtig sei.
Märchenhaftes Schlosshotel am Fluss bietet kreativen Geistern Gelegenheit für Arbeit und Entspannung. In unseren Mauern finden Sie zwar keinen Luxus, aber eine freundliche und inspirierende Atmosphäre.
Gönnen Sie Ihrer Fantasie eine Stärkung in unseren historischen Gemächern und spüren Sie den Atem vergangener Zeiten.
Speisen und Getränke aus ökologischem Anbau.
Vermietung nur während der warmen Jahreszeit!
Rufen Sie uns an oder klopfen Sie einfach an die Pforte.
Sofort tauchte vor mir wieder die märchenhafte Kulisse des alten Schlosses auf, das sich im stillen Wasser des Flusses spiegelte. Sie hatten auch eine Telefonnummer abgedruckt, aber der untere Teil des Zettels war abgerissen und die Nummer verschwunden. Die Anzeige fiel mir im richtigen Moment in die Hände. Dringend brauchte ich eine Ruhepause, musste für eine Weile meinen ständig wachsenden Arbeitsstrom unterbrechen. Seit Wochen verfolgte mich das Gefühl, dass ich in allem was ich tat, zu spät kommen würde und häufig geschah das auch. Worte wie Burnout oder Stress hatte ich immer von mir gewiesen. Ich war nicht ausgebrannt, sondern mit einem Durcheinander ständig neuer Gedanken beladen und den Begriff Stress hatte ich mir noch nie zu eigen gemacht. Verband ich doch damit eine lebensbedrohliche Situation aus dem Tierreich. Kurzerhand erklärte ich Lore, ich bräuchte eine Märchentherapie und dabei würden mir diesmal kein Buch und kein Film genügen.
Ich verkündete, dass ich für ein paar Tage ins Märchenland fahren wollte und heftete den Zettel an die Pinnwand. Sie lachte und meinte nur, ich solle mich nicht verzaubern lassen.
Eine Woche später begab ich mich auf die Reise in das Tal am Fluss und zu jenem Märchenschloss und stand nun vor einer Bauruine. Das Klopfen an die Pforte hatte sich somit auch erledigt. Es war einmal.
Also musste an diesem Tag noch eine Übernachtung gefunden werden, wollte ich nicht gleich wieder zurückreisen. Und danach stand mir nicht der Sinn.
Ich sah mich um, entdeckte aber nur einen türkischen Imbiss mit Fastfoodangebot neben der Bushaltestelle. Also fuhr ich weiter zum nächsten Dorf. Die Asphaltstraße zwängte sich zwischen steilen, mit Obstbäumen bestandenen Hängen in scharfen Kurven hindurch. Sofort drosselte ich das Tempo. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich ausweichen sollte, wenn mir plötzlich ein Traktor oder womöglich ein Lastwagen begegnete, aber nichts dergleichen geschah. Ich erreichte das Dorf und fuhr bis zu einem Parkplatz, den sie mit neuen Pflastersteinen vor einem Gasthof angelegt hatten. Das alte Gebäude mit seinen blauen Fensterläden trug an der Fassade einen mir unbekannten Namen: Vodjanoi und über dem Sandsteintürbogen des Eingangs prangte eine kleine, verwitterte Figur, die früher wahrscheinlich einmal einen Speer oder einen Dreizack gehalten hatte, von dem Frost und Regen aber nur noch einen kleinen Stumpf übriggelassen hatten.
Aus dem unteren Teil des Körpers wuchsen zwei Schwänze hervor, wie ihn die Seejungfrauen tragen. Neugierig betrat ich den Gastraum und traf auf eine freundliche Wirtin, die nicht nur ein freies Zimmer für mich hatte, sondern zudem noch Klöße und Sauerbraten auf dem Herd. Volltreffer, dachte ich.
Nach dem Essen wollte die Frau wissen, was mich in dieses Dorf geführt hätte. Zu ihr kämen viel zu selten fremde Besucher von weit her. Im Wohlgefühl des köstlichen Essens und angeregt durch ein gutes Bier sagte ich überschwänglich:
»Ich bin auf der Suche nach einem Märchen.«
Die Wirtin schien nicht überrascht über meine Antwort. Ich berichtete von der Anzeige, von meinem vergeblichen Versuch auf dem Schloss und warum ich mir in diesem Landstrich eine Auszeit gönnen wollte.
»Ach das Schloss«, sagte sie und winkte ab. »Aber wenn Sie tatsächlich ein Märchen suchen, sind Sie hier am richtigen Ort. Heute Abend kommt unser Märchenerzähler. Eigentlich lebt er im Vorruhestand und hütet die Ziegen, aber er erzählt leidenschaftlich gern und freut sich immer, wenn er einen Zuhörer findet. Kommen Sie einfach nach sechs Uhr wieder, dann werden Sie ihn kennen lernen. Die Leute nennen ihn Brabeck. Seinen Vornamen kennt hier niemand.«
Warum sollte ich mir eine solche Abendunterhaltung entgehen lassen? Die Frau hatte mich neugierig gemacht.
Zur vereinbarten Zeit fand ich mich ein und sah einen graubärtigen Mann von etwa sechzig Jahren auf der Eckbank am Fenster sitzen. Er trug abgewetzte Jeans, ein kariertes Hemd und auf der Nase eine alte Hornbrille.