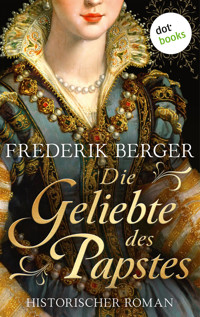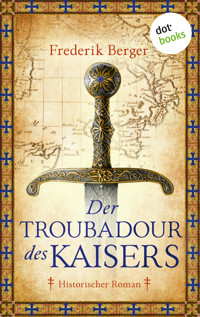
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Troubadour am Hof des Stauferkaisers Provence, im 13. Jahrhundert: Als Adoptivsohn eines Falkners wächst Bernardou nach einem tragischen Ereignis in seiner Kindheit in der Klosterschule von Arles auf, wo er die ehrbare Kunst der Troubadoure erlernt – und die Fertigkeiten eines Ritters. Schon bald führt ihn die Suche nach seiner wahren Herkunft von seiner französischen Heimat über Palermo bis nach Rom: Er gelangt an den Hof Friedrichs II. nach Sizilien, wo er in das Gefolge des mächtigen Stauferkönigs aufgenommen wird, und stürzt sich in die blutigen Wirren des Kriegs gegen die Katharer. Auf seinem abenteuerlichen Weg schlägt Bernardou große Schlachten, erlebt eine verhängnisvolle Liebe und kommt dem Schlüssel zu seiner Herkunft immer näher. Doch was ist er bereit dafür zu opfern? Ein opulenter historischer Roman über ein bewegtes Leben im Schatten eines der größten Herrscher Europas – Fans von Bernard Cornwell werden begeistert sein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Provence, im 13. Jahrhundert: Als Adoptivsohn eines Falkners wächst Bernardou nach einem tragischen Ereignis in seiner Kindheit in der Klosterschule von Arles auf, wo er die ehrbare Kunst der Troubadoure erlernt – und die Fertigkeiten eines Ritters. Schon bald führt ihn die Suche nach seiner wahren Herkunft von seiner französischen Heimat über Palermo bis nach Rom: Er gelangt an den Hof Friedrichs II. nach Sizilien, wo er in das Gefolge des mächtigen Stauferkönigs aufgenommen wird, und stürzt sich in die blutigen Wirren des Kriegs gegen die Katharer. Auf seinem abenteuerlichen Weg schlägt Bernardou große Schlachten, erlebt eine verhängnisvolle Liebe und kommt dem Schlüssel zu seiner Herkunft immer näher. Doch was ist er bereit dafür zu opfern?
Über den Autor:
Frederik Berger (geboren 1945 in Bad Hersfeld) studierte Literatur- und Sozialwissenschaften und lebte einige Zeit im englischen Cambridge und in der Provence. Er arbeitete als Literaturwissenschaftler und Journalist, bevor er hauptberuflich Schriftsteller wurde. Neben Gegenwartsromanen, Sachbüchern und zahlreichen Aufsätzen verfasste er verschiedene historische Romane über den Glanz und die Schatten europäischer Adelsfamilien. Frederik Berger reist viel und ist begeisterter Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Schondorf am Ammersee.
Die Website der des Autors: frederikberger.de
Der Autor auf Instagram: instagram.com/fritzgesing/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine historische Romantrilogie »Das Siegel der Farnese« mit den Bänden »Die Geliebte des Papstes«, »Die Tochter des Papstes« und »Die Kurtisane des Papstes«. Außerdem erschienen seine opulenten historischen Romane »Die heimliche Päpstin«, »Die Provençalin«, »Der Gang nach Canossa«, »Die Schwestern der Venus«, »Die Madonna von Forlì« und »Der Botschafter des Kaisers«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2025
Dieses Buch erschien bereits 2011 unter dem Titel »Der Ring des Falken« bei Rowohlt.
Copyright © der Originalausgabe 2011 by Rowohlt Verlag GmbH,
Reinbek bei Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/I. Pilon und AdobeStock/Iuliia KOVALOVA, AkuAku
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-517-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Frederik Berger
Der Troubadour des Kaisers
Historischer Roman
dotbooks.
Motto
Ai, las tan cuidava saber
D’amor e tan petit en sai.
Weh mir! So viel glaubte ich zu wissen von der Liebe, und so wenig weiß ich davon!
(Bernart de Ventadorn, Lerchenlied)
Ist mir mîn leben getroumet, oder ist ez wâr?
War mein Leben ein Traum, oder ist es Wirklichkeit?
(Walther von der Vogelweide, Elegie)
Ego sum via et veritas et vita.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
(Johannes-Evangelium 14,6)
Hinweis
Erläuterungen zu den im Roman auftretenden oder genannten historischen Personen finden sich am Ende des Buchs.
TEIL I
Die Flucht des Falken
Kapitel 1
Verloren sind die Paradiese der Kindheit erst dann, wenn man sie vergisst. Aber ich, Bernardou, Sohn des Arnaut, getauft im Jahre des Herrn 1187 in Italien, aufgewachsen auf der Burg von Les Baux im strahlenden Licht meiner provençalischen Heimat, vor dem Schimmer der gezackten Kalkfelsen der Alpilles – ich werde nie das Glück meiner Kindheit vergessen, so wenig wie die verschlungenen Wege meines abenteuerlichen Lebens.
Am Anfang waren die Augen.
Die tiefbraunen, fast schwarzen Augen über mir, die Augen meiner Mutter. Und das Lächeln ihrer geschwungenen Lippen, die sanft über meine Kinderhaut strichen und dann ein Lied formten, ein schwermütiges Lied aus unergründlicher Ferne, ein Lied voll Sehnsucht und Kummer. Ich suchte lange seinen Ursprung, auf all meinen weiten Reisen, die mich bis ins farbige, reiche Sizilien führten und später in das kalte Land nördlich der hohen Gebirge. Noch heute klingt mir ihr Gesang als fernes Echo in den Ohren, und erst im Tod wird er verstummen und übergehen in den Gesang der Engel.
Am Anfang waren auch die Augen meiner Spielgefährtin Serena, die von ihrer Mutter meist Maria Serena gerufen wurde.
Häufig spielte ich mit ihr Suchen und Fangen: Einmal versteckte sie sich vor mir, ich entdeckte sie und wollte sie schon greifen, da bückte sie sich und rannte lachend davon, sprang über ein aufgeschrecktes Huhn und verschwand hinter einem Felsen. Ich rief nach ihr, doch sie antwortete nicht. Überall waren Handwerker bei der Arbeit, ein paar Zimmerleute stellten ein Gerüst auf, über den Boden verstreut lagen Balken und Bretter, es wurde gehämmert und gesägt, Rufe und Befehle gingen hin und her, Esel schrien hungrig, und Hühner gackerten, Schweine ringelten grunzend ihre Schwänze – doch von Serena keine Spur. Ich wollte mich zum Taubenhaus zurückziehen, da tauchte sie plötzlich wieder auf, rief »Fang mich! Fang mich!« und wollte sich wieder verstecken.
Doch schon hatte ich sie, sie riss sich los, ich hinterher, übersah einen Balken, und da lag ich.
Ich hatte mir die Knie und die Ellenbogen aufgeschrammt, blutete aus einer Wunde an der Stirn. Natürlich weinte ich nicht, ein tapferer Junge war ich, der einzige Sohn von Arnaut, dem Falkner und Schmied, dem ehemaligen Fußsoldaten und Kreuzfahrer. Ich lag auf dem Rücken, und sie beugte sich über mich. Da waren sie: ihre tiefblauen Augen.
Alle, die sie kannten, so hörte ich später oft genug, bewunderten diese Saphirfarbe, die den Mistralhimmel unserer Heimat in sich aufgesogen zu haben schien. Niemand sonst hatte so blaue Augen und so blondes Haar. Nicht ihr Vater Uc, Senher de Baux, ein Provençale aus dem Urgestein der Alpilles, nicht die Mutter Barrale, die Grafentochter aus Marseille, hochgeboren und hochfahrend, kein Priester und kein Bauer, kein Handwerker – allenfalls der eine oder andere Troubadour, einer der Gaukler und fahrenden Leute, die immer wieder zu uns fanden, da sie wussten, dass man auf der Burg von Les Baux die Kunst des lieblichen Gesangs und der schmachtenden Verse schätzte.
Serena beugte sich über mich, sie lächelte, »jetzt habe ich dich gefangen«, flüsterte sie und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Nein, sie küsste mich nicht, leckte nur das Blut von der Wunde, aber einen Wimpernschlag lang senkte sich ihr übermütiger Blick in meine Augen, bevor sie lachend aufsprang, mir winkte und schon wieder hinter dem nächsten Ginsterbusch oder Feigenbaum verschwunden war.
Ich schaute ihr nach, und jetzt erst biss mich der Schmerz. Mit dem Handrücken wischte ich über die blutenden Wunden, dann humpelte ich zu unserem Häuschen, das unter der Tour Paravelle lag, in der Nähe des Taubenturms, angrenzend an die Schmiede und das Falkenhaus.
Mein Vater, der dem alten Senher de Baux auf dem gemeinsamen Kreuzzug nicht nur einmal das Leben gerettet hatte, war ein geschickter Waffenschmied, stark wie ein Stier, zugleich ein Falkner, der zart und fürsorglich mit den Vögeln umgehen konnte. Mit seinen breiten Schultern und den Aschespuren im Haar sprach er nur das Nötigste, aber ich musste ihm aufs Wort gehorchen, sonst setzte es Schellen. Zugleich führte er mich geduldig in die Falknerei ein. Meine Mutter schaute er immer auf eine ganz besondere Weise an, das erkannte ich sogar als Kind schon: mit stummer Liebe und wortloser Wehmut.
Er sah nicht gern, wenn ich mit Serena zusammen war. Sire Uc, unser Herr, sah es noch weniger gern. Dennoch suchten und fanden Serena und ich uns immer wieder, wir hüpften Hand in Hand über Stock und Stein, fütterten die Tauben und kicherten über ihr gurrendes Sich-Plustern und Rucke-di-guh-Geflatter. Anschließend schlichen wir geduckt zu den Büschen, wo die Nachtigall verborgen flötete, und flog sie schließlich davon, versteckten wir uns hinter einem Felsen, um die Wanderfalken zu beobachten, die im Sturzflug die Dohlen des Donjon schlugen, oder das Adlerpaar, das hoch über der Burg seine ruhigen Kreise zog.
Neben Serena gab es natürlich andere Kinder auf der Burg, Kinder meines Standes. Sie lärmten in ihren schmutzigen, verlausten Kitteln, mussten, wie auch ich, bei der Arbeit helfen, prügelten sich, schnitten Katzen die Schwänze ab oder jagten Ratten und Mäuse. Meist hänselten sie mich wegen meiner unzähmbaren Stirnlocke oder mieden mich gänzlich, als wäre ich aussätzig.
Erst viel später begriff ich, dass es an meiner Mutter lag. Auch sie wurde gemieden. Dabei sprach sie durchaus die Sprache unserer Heimat, ihre Haare und Augen waren nur wenig dunkler als die Haare und Augen von Barrale de Baux oder den Mägden, den Ziegenhirtinnen und Wäscherinnen, den Tänzerinnen der Gauklertruppen, die von Narbonne, Toulouse oder Barcelona hergezogen kamen.
Warum verbinden sich so viele Erinnerungen an meine Kindheit mit Serena? Weil ich sie schon früh liebte und nie aufhören sollte zu lieben? Weil sie die Einzige war, die sich nicht um den düsteren Ruf kümmerte, der meine Mutter umgab wie eine unsichtbare Mauer? Die sich sogar dem Verbot ihres Vaters widersetzte, sich mit dem Sohn eines Falkners abzugeben, und sich mit ihm an den Rand des Felsplateaus setzte. Dort, unter dem Sarazenenturm, ließen wir die Beine über den Abgrund baumeln und schauten nach Süden, auf die Olivenhaine und Weinberge, die in rechteckigem Muster angelegt waren, auf die Zypressenreihen und wilden Hecken, auf die sich schlängelnden Pfade, die zu Bauernkaten und Ölmühlen führten und an deren Rändern Ziegen grasten. An manchen Tagen glitzerte in der Ferne sogar das Meer, es gab keinen Horizont, nur ein Gleißen und Schimmern, ob Himmel oder Wasser, wir wussten es nicht, es kümmerte uns auch nicht, denn wir beide träumten von der Ferne.
An anderen Tagen sah ich Serena nicht. Der Senher empfing wieder Besuch aus Orange oder Arles, aus Marseille oder Tarascon. Ich musste helfen, die Pferde zu versorgen.
Später hörte ich aus dem großen Saal des Palais den Klang der Fidel und der Laute, der Flöten und Tamburine, die sanfte Stimme der Troubadoure, die ihre sehnsüchtigen Lieder sangen zu Ehren von Barrale, der Domna, der zwar lange schöne Flechten auf die Schultern fielen, zugleich aber eine Hakennase im hoheitsvollen Antlitz stand und die, wenn sie lachte, ein Pferdegebiss entblößte. Doch ihre langen Bliauds, in denen sie mehr oder weniger gemessen über die ungleichmäßigen Steinwege der Burg schritt, waren aus dunkelroter Seide und über dem Gürtel seitlich abgenäht, die Borten mit Edelsteinen besetzt oder von Goldfäden durchzogen, die kronenartigen Hauben aus Pelz, und ihre weiten Ärmel hingen tief herab.
Mir war aufgetragen worden, Pferdeäpfel aufzusammeln. Um mich herum schmatzten, grunzten und quiekten die Schweine mit ihrer Ferkelschar. Oben im großen Saal der Burg sangen die Troubadoure. Ich schaute hoch zu den erleuchteten Fenstern des Palais, hörte ihre schmelzenden Stimmen, das belcanto, wie die Italiener sagen, bis mich ein Pferdeknecht unsanft in die Rippen stieß.
Die Tauben flogen und flatterten um ihr Haus, ruckten gurrend ihre Hälse, es dunkelte bereits, und die Fledermäuse schrieben die schwarzen Zacken ihres Flugs in den abendlichen Himmel. Ich hörte meinen Vater den Stahl schlagen, ein helles Plingpling, und durch den Lichtschein der Palaisfenster huschten Schatten. Wieder erhielt ich einen Stoß und die Aufforderung, gefälligst zu schaufeln und nicht zu träumen.
Ich scharrte unwillig die Hinterlassenschaften der Pferde zusammen und kippte sie in einen Eimer, doch wanderte mein Blick erneut nach oben. Jetzt beugte sich sogar eine der Tänzerinnen aus dem Fenster und fächerte sich kühle Abendluft zu. Weit öffnete sich ihr Kleid, die schattige Verheißung ihres Ausschnitts und der schwarze Rahmen ihrer tief fallenden dunklen Haare ließen meinen Mund offen stehen. Doch rasch fasste ich mich und winkte ihr; sie winkte zurück. Ja, sie winkte tatsächlich, warf mir hellauf lachend eine Kusshand zu.
Ich atmete ein paarmal rascher und machte mich wieder an den Pferdeäpfeln zu schaffen.
Kapitel 2
Als ich älter wurde, machte mir mein Vater eine große Freude: Er schenkte mir den Nestling eines Wanderfalken, den er aus einem Horst geholt hatte, um ihn für die Beizjagd abzurichten. Wir nannten den kleinen Vogel Peregrina, weil er ein Weibchen war, und ich lernte, wie man ihn pflegte und fütterte – mein Vater sagte statt füttern immer atzen –, wie man ihn auf einem Handschuh abtrug, an die Umgebung und an die Anwesenheit von Hunden gewöhnte, abspringen und wieder beireiten ließ. Ich hatte viel zu lernen, denn für alles gab es eigene Worte.
»Du bist Vater und Mutter für die kleine Peregrina«, erklärte mir mein Vater, »sie muss dir vertrauen, und später, wenn sie nicht mehr angebunden ist, muss sie für dich jagen und immer wieder zu dir zurückfliegen. Und jetzt sag mir, wie man dieses Verhalten fachmännisch ausdrückt!«
Ich lernte rasch und führte bald die ebenso rasch wachsende Peregrina Serena vor. Stolz trug ich den Lederhandschuh, den mir meine Mutter genäht hatte, ließ Peregrina darauf stehen, und wir zogen gemeinsam über das Burggelände, um sie locke zu machen und zu lüften, und dann über das Felsplateau, wo ich Peregrina ihre Jagdgründe zeigen wollte.
Entdeckte sie eine Taube, sprang sie nervös ab, konnte aber nicht wegfliegen, denn ich hielt sie an der Lockschnur. Immerhin erhielt sie ein Stückchen Atzung als Lockbissen, was sie dann neugierig umherschauen und kurz aufflattern oder ballieren ließ.
Serena wollte Peregrina gern streicheln, aber ich warnte sie vor dem harten Schnabel, mit dem sie nach ihr picken würde, wenn sie sich ihr zu sehr näherte.
Immer häufiger kam ein Kammermädchen der Siressa angerannt und holte Serena mit strengen Worten in die Burg zurück. Schließlich wurde mir mitgeteilt, Maria Serena habe von nun an überhaupt keine Zeit mehr für mich.
Ich begleitete wieder häufiger meinen Vater und dessen Wanderfalken, der bereits erfolgreich jagte und nach einem Pfiff auf den Arm meines Vaters beiritt. Doch oft verließ ich auch allein mit Peregrina die Burganlage, um ihr das Jagdrevier zu zeigen.
Seit einiger Zeit hatte ich mir angewöhnt, morgens mit dem ersten Hahnenschrei aufzuwachen, bei Tagesanbruch aus dem Bett zu kriechen und draußen im Val d’Enfer herumzustromern. Es war möglich, weil ich nicht mehr bei meiner Mutter schlief, sondern in einem kleinen Verschlag.
Und dann, eines Morgens, geschah das Unglück.
Sanfter Schimmer überzog bereits den Himmel, als ich aufwachte. Leise schlüpfte ich in einen kratzigen Kittel und zog mir Sandalen über, warf einen Blick auf meine Eltern. Mein Vater lag frei und schnarchte, von meiner Mutter sah ich nur ihr schwarzes Haar. Draußen war es noch kühl, aber im Tal sangen die Nachtigallen. Sie schmetterten ihre Melodien hoch zu den hellen Felsen, hoch zu dem violetten Himmel, der sich langsam rosa färbte.
Diese frühen Stunden gehörten nur mir. Ohne meine Eltern aufzuwecken, holte ich den Handschuh, schlich ins Freie, misstrauisch beäugt von Krähen, die bereits auf den ersten Abfall warteten. Ein paar Hunde schlugen an. Kein Mensch war zu sehen. Peregrina war ebenfalls schon wach und kam mir auf dem Reck in ihrer Falkenkammer freudig entgegengeflattert. Ich hatte beschlossen, sie an diesem Morgen ihren ersten Wildflug ausführen zu lassen, und steckte mir genügend Lockbissen für sie ein.
Durch eine von mir entdeckte Öffnung in der östlichen Mauer verließ ich mit ihr das Burggelände, kletterte hinab zum Weg. Ich zitterte leicht vor Kälte, aber nun sandte die Sonne ihre ersten Strahlen wie eine Monstranz über den Himmel, die Nachtigallen flöteten und trillerten weiter, Hähne schrien, in der Ferne bellte ein verschlafener Wachhund, andere antworteten ihm, und einer heulte langgezogen, als wollte er seine Freiheit im Wolfsrudel betrauern.
Ich folgte dem Weg, der nach Saint-Remy führte, und stieg dann durch die Felsen, an Ginster-, Salbei- und Rosmarinbüschen vorbei, bis ich unter dem Schatten von Steineichen meine geheime Lieblingsstelle erreichte. Über mir reckten sich zerklüftete Felsen mit Löchern, die den Blick in den grenzenlosen Himmel freigaben, und der helle Kalk war nun in das morgendlich goldene Licht getaucht.
Mittlerweile war ich überzeugt, dass Peregrina mich auch ohne Lockschnur und Fessel nicht verlassen würde, denn sie sah mich immer vertrauensvoll an und schien mir mit ihren Giggig- und Kijaklauten etwas sagen zu wollen. Ich löste daher die Fessel und ließ sie zu ihrem ersten Wildflug aufsteigen. Sie flog auf den Ast einer knorrigen Eiche und pickte nach der Bell und dem Geschüh. Ich holte schon einmal die Lockbissen aus der Tasche, setzte mich dann auf den Boden und schaute zu ihr hoch. Peregrina erwiderte meinen Blick, drehte dann ihren Kopf nach allen Seiten, hüpfte hin und her, flatterte kurz, als müsste sie das Fliegen wieder lernen.
Die Bell klingelte leise, ich schloss kurz die Augen, ein leiser Wind sang in den Zweigen, die Nachtigallen flöteten mehrstimmig, und ich glaubte wieder den Gesang der Troubadoure zu hören, sah die Tänzerin mir zuwinken und wünschte mir, Serena würde sich über mich beugen und mir einen Kuss geben.
Die Sonne wärmte bereits die Luft, und ich hörte in der Ferne die Burg erwachen. In diesem Moment tiefsten Friedens wollte ich noch eine Weile vor mich hin träumen.
Als ich neben dem Geklingel Flügelschlagen hörte, öffnete ich erschrocken die Augen. Peregrina hatte sich in die Lüfte geschwungen, saß nun auf einer Felsenspitze und beobachtete aufmerksam irgendetwas, das ich nicht sehen konnte. Ich pfiff, rief und hielt ihr die Lockbissen hin, wollte dann, als Peregrina keine Anstalten machte, wieder beizureiten, den Felsen hochklettern, doch es war zu spät: Peregrina schwang sich in die Luft, gewann rasch an Höhe, und dann sah ich sie auf eine Wildtaube hinabstoßen.
Ich glaubte schon, dies könnte ihre erste erfolgreiche Jagd werden und sie würde mir die Beute bringen, doch kaum hatte sie die Taube geschlagen, griff sie wie aus dem Nichts ein mächtiger Geier an, und die beiden tauchten hinter einem in die Höhe ragenden Felsen ab. Ich hörte nicht einmal wildes Flügelschlagen und auch sonst keine Kampflaute, doch als ich schließlich über den Felsen geklettert war, hinter dem die Vögel verschwunden waren, entdeckte ich lediglich ein paar helle Federn – und drei hellrote Blutstropfen auf dem gleißenden Weiß der Kalkfelsen.
Wie gelähmt, konnte ich mich nicht von dem Anblick lösen. Dann rief und pfiff ich nach Peregrina. Der Geier hatte ihr vermutlich nur die Taube entrissen. Doch alles Rufen half nichts. Peregrina blieb verschwunden. Sie hatte mich verlassen. Ich war zu unvorsichtig gewesen, hätte sie noch nicht losbinden dürfen. Es war meine Schuld.
Als ich schließlich zu unserem Häuschen zurückkehrte und mit verschmiertem Gesicht in meinen Verschlag kriechen wollte, begegnete mir mein Vater. Mit einem Blick begriff er, dass etwas geschehen sein musste.
»Ist Peregrina auf dem Reck?«, fragte er streng.
Ich stammelte »beim Wildflug«, unfähig, einen ganzen Satz zu bilden.
Wortlos zog er mir den Handschuh vom Arm und schlug ihn mir mehrmals um die Ohren. Es tat nicht einmal weh.
Meine Mutter war inzwischen zu uns getreten.
»Arnaut, lass den Jungen, er hat nichts Böses getan«, wandte sie sich mit ihrer dunklen Samtstimme an ihn. »Der Falke liebt auch nur seine Freiheit.«
»Ja, du und dein Sohn«, gab er zurück und zog mich zu sich heran, bis ich nur noch seine düsteren, grauen Augen unter den buschigen Brauen sah. Leise knurrte er: »Wo ist dein Falke?«
»Peregrina hat eine Taube geschlagen, doch dann kam ein Geier ...«
Mein Vater schaute mich tief enttäuscht an. »Nie wieder wirst du einen Falken von mir bekommen«, sagte er leise und wollte sich schon abwenden, als er sich besann und in strengem Ton anfügte: »Da ist noch etwas: Ich verbiete dir, allein das Burggelände zu verlassen. Ich habe nur einen Sohn, und dieser Sohn soll sich nicht herumtreiben, bis er von Wölfen angefallen oder von einem hergelaufenen Wegelagerer erschlagen wird.« Erneut zog er mich am Kittel zu sich heran, seine Augen näherten sich meinen, seine Stimme wurde leiser: »Ich will auch nicht, dass du mit der Tochter unseres Senhers zusammenhockst, es gehört sich nicht und bringt Unglück.«
Dabei hatte ich sie seit langem nicht mehr gesehen.
Von diesem Zeitpunkt an sprach er nicht mehr von Peregrina, nahm mich aber auch nicht mehr zum Abtragen seiner Falken mit.
Stattdessen versuchte er, aus mir einen Schmied zu machen. Ich sollte Hufeisen herbeiholen und dann den Blasebalg bedienen. Bald schon verließen mich die Kräfte. Zum Auskehren der Schmiede war ich aber noch gut.
Abends sank ich wie tot auf meine Strohsäcke und war eingeschlafen, bevor mir meine Mutter noch einen Trost- und Gutenachtkuss geben konnte.
Auch die nächsten Tage musste ich meinem Vater in der Schmiede zur Hand gehen, biss die Zähne zusammen, wenn mir am Blasebalg meine Arme abzufallen schienen. Dann sollte ich ihm sogar am Amboss helfen, mit einer Zange ein Eisenstück halten. Es flog davon und landete, rotglühend, wie es war, auf seinem linken Unterarm. Er brüllte vor Schmerzen, ließ erst einmal wutschnaubend die Funken sprühen, dass ich schon glaubte, er wollte die Schmiede in Brand setzen, und tauchte seinen Arm schließlich in den Wassertrog. Ich entschuldigte mich, dennoch stieß er mit zusammengepressten Zähnen aus: »Du bist nicht mein Sohn.«
Als er meine erschrockenen Augen sah, korrigierte er sich: »Du bist nicht der Sohn eines Schmieds. Eignest dich weder zum Schmied noch zum Falkner.«
Meine Augen füllten sich mit Tränen, doch ich kämpfte sie nieder.
Noch immer vor Schmerzen fluchend, stapfte er zu meiner Mutter, die die Wunde versorgte und ihm den Arm verband. Ich folgte ihm wie ein schuldbewusstes Hündchen.
Während der nächsten Tage fühlte ich mich sehr einsam. Ich durfte meinen Vater nicht mehr zu den Falken begleiten oder ihm in der Schmiede helfen. Meine Mutter saß immer häufiger am Fenster und blickte stumm nach draußen, wo die Tauben vor ihrem Turm balzten und gurrten, drückte mich an sich, sprach aber kein Wort. Erst als ich flüsterte »›Du bist nicht mein Sohn‹, hat er gesagt«, hob sie kurz ihren Kopf, strich mir über Schopf und Locke und antwortete, ebenso leise wie ich: »Du bist aber mein Sohn – und seiner.«
Natürlich verstand ich nicht, was sie mir sagen wollte.
Als es Serena an einem heißen Tag während der Mittagsstunde gelang, heimlich das Palais zu verlassen und mich aufzusuchen, um mit mir nach langer Zeit einmal wieder Peregrina abzutragen, musste ich sie enttäuschen. Trotz des Verbots meines Vaters krochen wir stattdessen auf die Tour Paravelle, auf der in diesen Tagen eine Dachterrasse gebaut wurde. Da die Hitze groß war, ruhte die Arbeit, die Maurer und Zimmerleute lagerten im Schatten und hielten ihr Schläfchen.
Wir setzten uns gemeinsam auf das Gerüst an der beschatteten Nordseite des Turms. Ab und zu schrie ein Esel und bellte müde ein Hund, die Schwalben und Mauersegler jubelten im Himmel, sonst herrschte weitgehend Ruhe.
Serena beklagte sich, dass ihre Mutter sie kaum noch unbeaufsichtigt lasse und begonnen habe, ihr Sticken beizubringen. Dann musste ich von Peregrina, vom Kampf mit dem Geier und ihrer Flucht berichten. Als ich auch von meiner Ungeschicklichkeit beim Schmieden erzählte und immer trauriger wurde, schaute mich Serena mitfühlend an und lehnte sich an mich.
So saßen wir da, zwei Kinder, die einander ihr Leid geklagt hatten. Ich war glücklich, endlich wieder mit Serena zusammen zu sein, und als sie mir ihre großen, schönen Augen zuwandte, gab ich ihr zwei Küsschen auf ihre Lider. Da sie den Kopf hob, gab ich ihr noch ein drittes unschuldiges Küsschen, diesmal direkt auf ihre schmalen, zart geschwungenen, aber dennoch warmen und weichen Lippen.
Wir lächelten uns an und schauten dann wieder hinüber zu den im Mittagslicht gleißenden Felsen, die sich jenseits des Val d’Enfer erhoben, bis wir plötzlich Serenas Kinderfrau und einen Hausknecht bemerkten, die uns beide beobachteten. Mit schriller Stimme befahl uns die junge Frau, schleunigst vom Gerüst zu steigen.
Schuldbewusst zog Serena von dannen, von der Frau fest an der Hand gepackt. Der Knecht drohte mir Ohrfeigen an, rief mir dann aber bloß zu: »Dein Vater wird sich freuen. Vielleicht wirst du jetzt mitsamt der schwarzhaarigen Hexe davongejagt.«
Wen er mit der Hexe meinte, verstand ich nicht. Oder wollte ich nicht verstehen.
Am Abend und während der nächsten Tage wurde ich jedoch von meinem Vater nicht auf den Vorfall angesprochen; nur seine Stimmung hatte sich verfinstert.
Serena sah ich überhaupt nicht mehr.
Bald darauf, als wir abends unsere Gemüsesuppe schlürften, wandte sich mein Vater an mich. Er sprach ganz ruhig: »Ich habe über deine Zukunft nachgedacht. Weder zum Falkner noch zum Schmied taugst du, mit deinen schlanken Armen und den feinen Fingern deiner Mutter auch nicht zum Waffenknecht oder Bogenschützen.« Es klang nicht abschätzig, nur bedauernd. »Ich bin mir mit Sire Uc einig: Du sollst eine Klosterschule besuchen, dort lesen und schreiben lernen, dann auch Latein, und später Priester werden. Wir wollen, dass du einmal ins Heilige Land pilgerst und in Jerusalem betest, aus dem uns die Ungläubigen vertrieben haben. In dem ich beinahe umgekommen wäre.« Seine Stimme war härter geworden.
Meine Mutter erhob sich, setzte sich wortlos ans Fenster und schaute hinaus in den sich herabsenkenden Abend.
»Hast du mich verstanden, Bernardou?«
»Ja, Vater«, antwortete ich leise.
Kapitel 3
Selbst heute, fast zwei Menschenalter später, habe ich noch die Worte meines Vaters im Ohr, und wenn ich an meine Mutter denke, ihr zunehmendes Verstummen und ihr Ende, erfüllt mich eine bittere, schmerzhafte Trauer.
Was hat sie sich im tiefsten Innern für ihren Sohn gewünscht, den sie unter demütigenden Bedingungen empfangen hatte, der sie ins Unglück stürzte, für den sie bettelte und sich schließlich mit einem Mann verband, der ihr fremd bleiben musste?
Meine Mutter starb, kurz bevor ich Les Baux verließ. Sie starb an keiner Krankheit und schon gar nicht an der Schwäche des Alters, auch nicht im Kindbett. Sie starb durch einen Hassprediger, der damals nicht einmal unsere lebensfrohe Burg verschonte, der gegen den angeblichen Irrglauben wetterte und zugleich dem Aberglauben Vorschub leistete.
Wie ich bereits erwähnte, mieden die meisten Menschen meine Mutter. Erst viel später begriff ich, dass sie als Ungläubige aus der Fremde angesehen wurde. Dabei war sie so gottesfürchtig wie wir alle hier, sie besuchte die Andachten und Messen und betete inbrünstiger als viele. Aber sie trug dieses Brandmal über der Nasenwurzel, eine mandelförmig eingebrannte Narbe, die an ein drittes blindes Auge erinnerte.
Ich beobachtete oft, wie sich die Frauen der Burg bekreuzigten, wenn sie ihr begegneten, und dann scheu ihren Blick senkten und davonliefen. Noch bevor ich die Worte verstand, hörte ich die Menschen vom »Teufelsmal« raunen. »Sie hat den bösen Blick. Sie verhext uns und unsere Kinder. Denkt an die Missgeburt mit den zwei Köpfen!«
Sire Uc gab nicht viel auf das Geschwätz der Menschen, aber er wandte sich auch nicht dagegen. Barrale, seine Frau, schaute nur hochnäsig, falls sie meiner Mutter ansichtig wurde, und bekreuzigte sich verstohlen.
Dann jedoch reiste Bischof Pierre de Castelnau, der Gesandte des Papstes, durch unseren schönen Süden, um gegen die Albigenser zu predigen. Er besuchte auch die Dörfer der Alpilles, prangerte die »Ketzerpest« an und forderte für sie das reinigende Feuer dort, wo sie ihr obstinates, bösartiges Haupt erhebe.
Er ließ, von Saint-Remy kommend, auch unsere Kirche Saint-Vincent nicht aus, donnerte gegen die Anmaßung der Häretiker, denen die Rechtgläubigen mit allen Mitteln entgegentreten müssten, geißelte ihre Weigerung, der Kirche den Zehnten zu geben, und kam schließlich auch noch auf das katharische Weib und das Weib im Allgemeinen zu sprechen, dessen sich der Teufel bediene, um Unzucht, Sünde, Tod und Verderben zu bringen.
Obwohl ich noch jung war, erinnere ich mich an die Predigt, der auch meine Mutter mit wachsender Unruhe lauschte. Bevor der Bischof seine Hasstiraden beendet hatte, erhob sie sich und verließ mit mir die Kirche, verfolgt von Schmähungen, die nur ihr persönlich gelten konnten.
Als wir die Tür unseres Häuschens hinter uns schlossen, fragte ich sie, was denn ein Häretiker sei und wen der Bischof mit katharisch meine.
Sie schüttelte den Kopf und gab mir keine Antwort.
Am nächsten Tag dachte ich nicht mehr an unseren Kirchgang, ich vermisste Serena, die ich so lange nicht mehr gesehen hatte. Mein Vater war mit dem Senher nach Marseille unterwegs, denn Sire Uc war zum Vicecomte der Stadt ernannt geworden.
Als ich gerade dabei war, die Tauben zu füttern, sah ich den Bischof mit zwei weiteren Priestern und einem Bewaffneten auf dem Vorplatz des Palais einen Knecht ansprechen. Der Knecht verwies ihn an mich, und mit priesterlicher Freundlichkeit sprach mich kurz darauf der Bischof an, ob ich ihm den Weg zu »meiner geliebten Frau Mutter« weisen könne.
Arglos, wie ich war, traute ich seiner Freundlichkeit und schickte ihn zu unserem Häuschen.
Es war meine Schuld. Ich hätte ihn woandershin schicken und meine Mutter warnen müssen. Aber hätte ich wirklich wissen können, was nun geschah?
Er verschwand mit seinen Begleitern im Innern und blieb dort längere Zeit. Einmal hörte ich meine Mutter empört aufschreien. Dann verließ der Bischof mit seinen Männern unser kleines Haus und das Gelände der Burg.
Etwas misstrauisch war ich inzwischen geworden, wurde jedoch angewiesen, Wasser für die Pferde heranzuschleppen. Nach einer Weile, als ich mit meinen Eimern zurückkehrte, sah ich eine Gruppe Weiber auf unser Haus zustreben. Noch bevor ich ihnen nachlaufen konnte, waren sie im Innern verschwunden, es ertönte lautes Geschrei, und plötzlich stürzte meine Mutter ins Freie, verfolgt von den Weibern, die fäusteschüttelnd und mit hasserfüllten Verfluchungen ihr nacheilten. Ich kannte keins dieser Weiber, vielleicht waren sie aus anderen Ortschaften heraufgezogen, um dem Bischof zu beichten und ihn um Rat zu fragen, aus Mouriès oder Maussane oder dem Vallon de la Fontaine.
Der Wahnsinn der Angst verzerrte das schöne Antlitz meiner Mutter, ihr Kleid war zerrissen, und Blut rann über ihre Stirn. Ein Auge war zugeschwollen. Als sie mich entdeckte, stürzte sie auf mich zu, riss mich in ihre Arme. Schon waren die Weiber heran und bewarfen uns, mittlerweile von Männern verstärkt, mit Steinen.
Zum ersten Mal in meinem Leben ergriff mich Todesangst.
Meine Mutter presste mich an sich und flüsterte mir in heftiger Erregung ein paar Worte zu, die der Höllensturz der Ereignisse für immer in mein Gedächtnis einbrennen sollte: »Du bist sein Sohn. Auf Sizilien wirst du ihn finden.« Dann gelang es ihr noch, mir etwas um den Hals zu hängen, während sie in größter Erregung rief: »Du darfst das Amulett nie verlieren. Die Buchstaben enthüllen das Geheimnis deiner Herkunft und werden ihm beweisen, wer du bist.«
»Von wem redest du? Wie heißt er denn?«, schrie ich.
»Es ist ...« Ein Stein traf ihren Kopf und streifte mich. Sie schrie vor Schmerzen auf, taumelte, ein weiterer Stein, zum Glück kein großer, traf meinen Rücken, sie riss sich von mir los und stürzte zum Plateau.
An der Windmühle wurde sie eingeholt. Ich sah nur noch die steineschleudernden Weiber, hörte ihr Geschrei, blutrünstig, geifernd, besessen von aufgepeitschter Verfolgungswut.
Meine Mutter flüchtete weiter bis zum äußersten Rand der Felsen.
Noch heute höre ich mich schreien. Doch niemand achtete auf mich.
Und dann, von einem Stein erneut am Kopf getroffen, sprang sie.
Ich weiß nicht, ob mir schwarz vor Augen wurde, ob ich zur Felskante rannte. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist die warme Stimme einer Magd, sie hieß Isabella und führte immer ein Scherzwort im Mund. Sie nahm mich in den Arm und drückte mich an ihre Brust. Ich war stumm vor Entsetzen, meine Glieder zuckten, als hätte ein böser Dämon sich ihrer bemächtigt.
Niemand kümmerte sich um den zerschmetterten Körper meiner Mutter; man überließ ihn den Hunden, Geiern und Krähen. Alle gingen ihrer Tätigkeit nach, und die Weiber verschwanden ebenso schnell, wie sie gekommen waren. Erst mein Vater barg und beerdigte die Überreste meiner Mutter, nachdem er aus Marseille zurückgekehrt war.
Pierre de Castelnau, der Gesandte des Papstes, hatte sich rechtzeitig davongestohlen, mein Vater hätte ihn sonst auf der Stelle erschlagen.
Der Senher schenkte uns ein Goldstück, zum Trost, und sandte eine Botschaft an die Mönche von Montmajour und den Erzbischof von Arles. Sonst geschah erst einmal nichts.
Mein Vater sprach wochenlang so gut wie kein Wort. Auch nicht, als ich ihm das letzte Geschenk meiner Mutter zeigte: eine abgegriffene Goldmünze mit einem Loch, durch das ein Lederbändchen gezogen war. In das Gold waren deutlich drei Buchstaben geritzt. Er kommentierte weder die Münze noch die Buchstaben, die ich noch nicht entziffern konnte, ließ nur lange seinen traurigen Blick auf mir ruhen. Ich wagte nicht mehr, ihn auf die Münze anzusprechen, die ich von nun an immer bei mir trug.
Als er eines Tages, ein paar Monate nach dem Tod meiner Mutter, mit dem Senher im Hof stand und beide Augenpaare auf mir ruhten, wusste ich: Jetzt werden sie dich fortschicken.
Kapitel 4
Es war an einem Mistraltag im späten Frühling. Ich hatte frühmorgens wieder die Tauben gefüttert und dann das Burggelände verlassen, um im Val d’Enfer Vögel zu beobachten. Doch lange blieb ich nicht, denn der Wind nahm von Stunde zu Stunde zu, er fauchte und heulte und bog die Zweige der Pinien, schlug mir die Nadeln der Rosmarinsträucher ins Gesicht und die dornigen Blätter der Kermeseichen, wie mit spitzen Nadeln spickte seine Kälte meine Haut, die mein Kittel kaum schützte. Zugleich war der Himmel rein wie das Azur des Herrn, keine Wolke tummelte sich am Horizont, kein Schleier wollte sich bilden, tiefblau, stahlblau wölbte er sich über die kalkweiß blendenden Felsen.
Ein Adlerpaar in der Höhe kämpfte gegen den Sturm an, versuchte, ruhig seine Kreise umeinander zu ziehen, doch der Mistral war zu stark: Er trieb sie nach Südosten ab, bis sie aus meinem Gesichtsfeld verschwunden waren.
So zog ich wieder zurück zu unserer sicheren Felsenburg, die die Ebene beherrschte. Mein Vater kam mir am Taubenturm entgegen. Er wirkte ernst und zog mich in unsere karge Behausung neben der Schmiede.
Mit der Hand wies er auf einen groben Hocker, auf den ich mich setzen sollte, und ließ sich selbst auf der Pritsche nieder, die ihm als Bett diente. Er kratzte an seinen Flohstichen, fuhr durch seine Haare, bedeckte kurz das Gesicht mit den Händen, und dann eröffnete er mir, dass es Zeit für mich sei, mit dem Herumstromern auf der Burg oder in der Wildnis aufzuhören. Ich sei kein Kind mehr, »du musst nun endlich etwas lernen, was dir eine Zukunft eröffnet.« Er holte tief Luft und fuhr fort: »Außerdem müssen wir dich und die Tochter unseres Herrn endgültig trennen.«
Ich wollte widersprechen, aber eine heftige Handbewegung ließ mich verstummen. »Dies fordert auch Sire Uc, und nach dem Tod deiner Mutter ...« Wieder eine fahrige Bewegung seiner Hände, und erneut bedeckte er sein Gesicht, stützte dann sogar seinen Kopf ab, als plagten ihn schwere Sorgen. Als er wieder sprach, war seine Stimme rau. »Der Senher wird den Mönchen von Saint-Trophime ein Stück Land überlassen, damit sie dich aufnehmen und dir alles beibringen, was du für die Kirchenlaufbahn brauchst. Die Klosterschule in Arles ist im ganzen Süden berühmt. Ich will, dass du nicht immer der Sohn eines Schmieds oder eines Falkners bleibst.«
»Aber Vater«, unterbrach ich ihn, »ich möchte immer dein Sohn bleiben.«
»So meine ich es nicht.« Unwirsch runzelte er die Stirn. »Du sollst über deinen Stand hinaus ... Ich will sagen, du bist zu etwas Besserem geboren.«
»Zu etwas Besserem geboren?«, wiederholte ich. Solche Sprüche kannte ich nicht von meinem Vater, aber ich musste natürlich an die letzten Worte meiner Mutter denken: »Du bist sein Sohn.«
»Nur die Kirche bietet dir die Möglichkeit ...« Er unterbrach sich wieder, als falle ihm das Sprechen schwer, ließ aber nicht zu, dass ich etwas erwiderte. »Vielleicht nimmt Sire Uc demnächst wieder das Kreuz, in Jerusalem herrschen die Ungläubigen, Sultan Saladin hat uns besiegt, und unseren Königen ist es nicht gelungen, die Stadt zu befreien.«
»Vater, ich möchte kein Mönch werden«, sagte ich leise, nicht einmal aufmüpfig, doch er schien gar nichts zu hören. »Wir wurden in Hattin geschlagen, die glühende Hitze und der quälende Durst besiegten uns und dazu die Klugheit des Saladin, während unsere Anführer ... verbohrte Raufbolde, wortbrüchige Totschläger ... nicht einmal Jerusalem konnten wir halten.«
»Vater, ich möchte wirklich kein Mönch werden«, wiederholte ich.
Noch immer achtete er nicht auf meine Worte, sondern starrte ins Leere, erhob sich dann und stellte sich ans Fenster.
Ich war damals zu jung, um über meine Zukunft nachzudenken, über die Grenzen, die dem Sohn eines Schmieds und Falkners gesetzt waren. Ich träumte in die Ferne, indem ich meinen Blick zum Horizont schweifen ließ oder den Flug von Falke und Adler, von Kranich und Reiher beobachtete. Ich verzog mich in mein Versteck zwischen Felsen und Sträuchern, um dort um meine Mutter zu trauern, um dort vergeblich nach Peregrina zu rufen. Und ich vermisste Serena, die mir nach meinem Kuss endgültig entzogen worden war.
»Saladin eroberte Jerusalem, und eigentlich hätten wir, die wir den Sturm überlebten, alle sterben müssen. Doch der Sultan erwies sich als gnädig, er forderte bloß Lösegeld. Wer nicht zahlen konnte, wurde getötet oder in die Sklaverei verkauft, aber ich ... ich ... nahm einem Verwundeten alles, was er besaß, ein Waffenbruder war er, ein Freund sogar, Konrad mit Namen, ein Franke – er würde doch sterben, das wusste ich, und er wusste es auch, mit müden Augen nickte er mir zu. Noch bevor er seine Seele Gott befahl, nahm ich sein Schwert, seinen Schild, die Rüstung und den klimpernden Geldsack. Deshalb lebe ich und bin kein Sklave, deshalb durfte ich das Heilige Land verlassen und zurück nach Italien segeln, wo ich deiner Mutter begegnete.«
Er sprach immer leiser, und ich glaube, so lange hatte ich meinen Vater nie im Zusammenhang sprechen hören.
»Deine Mutter – die du nie vergessen darfst«, flüsterte er.
Kaum erstarb seine Stimme, konnte ich mich nicht länger beherrschen und brach in hemmungsloses Schluchzen aus. Bisher hatte ich nur gelegentlich nachts und in meinen Verstecken über den Tod meiner Mutter geweint, aber nun überwältigte mich alle Trauer, die in den verborgenen Kammern meiner kindlichen Seele eingesperrt war.
Mein Vater drehte sich zu mir um und legte seinen Arm um meine Schulter. Er roch nach dem Rauch der Esse und verbrannten Haaren, nach Pferden und – kaum wahrnehmbar – nach Falken.
Ein predigender Bischof, ein Mann der Kirche, hatte meine Mutter auf dem Gewissen, er hatte die Menschen angestachelt, ihrem Hass freien Lauf zu lassen. Dies hatte ich, so jung ich war, begriffen. Und jetzt sollte ich ein Mann der Kirche werden? Jetzt sollte ich die Burg und Serena und meinen Vater verlassen und mich in ein Kloster begeben?
»Deiner Mutter«, fuhr er mit leiser, brüchiger Stimme fort, »begegnete ich auf der Rückreise aus dem Heiligen Land, in Italien, in Ancona. Davongejagt und ins Elend gestoßen, bettelte sie mit gesenktem Blick am Eingang einer Kirche. Ein Tuch fiel ihr weit in die Stirn, bedeckte ihr ... Brandmal. Als eine Gruppe Söldner nach ihr trat und sie mit sich zerren wollte, griff ich ein. Ich stieß den ersten beiseite, zückte mein Schwert, und da die Trunkenheit sie wanken und straucheln ließ, zogen sie sich unter Flüchen zurück. Und dann schaute deine Mutter mich an. Ich vergesse ihren Blick nie. Er war so ... so voller Dankbarkeit, aber zugleich von einem unbändigen Stolz. Rasch warf ich ihr eine Münze zu und wollte gehen, doch sie folgte mir. Da merkte ich erst, dass sie in einem Brusttuch ein Kind trug ... Es muss Gottes Wille gewesen sein.«
Mein Vater schwieg, und ich schaute ihn erwartungsvoll an, fragte schließlich: »Vater, war ich das Kind? Und wo liegt Ancona? Auf Sizilien?«
Er schüttelte den Kopf und sagte nur: »Wasch und kämm dich! Wir müssen hoch in die Burg, der Senher erwartet uns.«
Ich ließ jedoch nicht locker: »War ich nun das Kind?«
»Dumme Frage, natürlich warst du es.«
Schon sprudelten zahlreiche Fragen aus mir heraus. »Vater, wieso war sie davongejagt worden? Von wem? Von meinem ... anderen Vater? Und wo liegt denn nun Ancona? Sie hat mir gesagt: ›Auf Sizilien wirst du ihn finden.‹ Wer ist es? Weißt du nicht, wie er heißt?«
Er stutzte und schien nachzudenken, sagte dann aber nur: »Ancona liegt in Mittelitalien, viel weiter nördlich als Sizilien, am Adriatischen Meer. Ich weiß nicht, was deine Mutter meinte. Und ich weiß auch nicht, wer er war.«
Obwohl er immer ungeduldiger wurde, bedrängte ich ihn weiter: »Wieso hatte sie diese Brandnarbe auf der Stirn? Konnte sie Menschen verhexen?«
Doch er antwortete nicht mehr und ließ mir auch keine Zeit, weitere Fragen zu stellen. Er riss mir meinen Kittel vom Leib, goss mir einen Eimer Wasser über den Kopf und versuchte, den Schmutz mit seinen rissigen Händen von meinem Körper zu reiben. Seife besaßen wir keine.
Der Mistral fegte über den Burgberg, als mein Vater und ich das Palais betraten.
Im Kamin des großen Saals brannte ein Feuer. Sire Uc begrüßte uns mit einer freundschaftlichen Geste. Barrale de Baux, unsere Domna, saß in der Nähe des Kamins, neben ihr meine Spielgefährtin Serena, die aufspringen wollte, aber durch einen entschiedenen Griff ihrer Mutter zurückgehalten wurde. Im Hintergrund spielten drei Musiker: Einer sang leise, die anderen begleiteten ihn auf Flöte und Fidel.
Während Sire Uc und auch mein Vater auf mich einsprachen, sah ich immer zu Serena und dem singenden Troubadour hinüber. Hinter ihnen brannten mehrere Fackeln, weil wegen des Mistrals die Fenster mit Läden verschlossen waren. Vor den Flammen hoben sich Serenas blonde Haare ab und schienen wie ein Goldkranz zu leuchten. Verstohlen winkte mir Serena zu und lächelte.
»Ich brauche treue Männer mit Verstand, Verwalter, Notare, Ratgeber, Botschafter, die lesen und schreiben können, die Latein beherrschen ...« Sire Uc sprach auf mich ein, ich hörte seine Worte, nickte brav, doch eigentlich achtete ich nur auf Serena.
»Nach dem ... traurigen Tod deiner Mutter ... ich und dein Vater ... vermutlich werden wir bald wieder das Kreuz nehmen und Jerusalem befreien, es ist unsere heilige Pflicht – und ich halte dich für einen klugen Jungen, du sollst die Klosterschule besuchen, ich bezahle für dich, damit du mir später dienst – verstehst du?« Er war aufgestanden und klopfte mir auf die Schultern.
Ich nickte.
»Dann ist ja alles klar«, schloss er zufrieden.
Mein Vater nickte ebenfalls, schaute mich aber nicht an.
»Ich möchte kein Kirchendiener werden«, protestierte ich leise. »Sie haben meine Mutter umgebracht.«
Sire Uc verzog verärgert das Gesicht. »Nicht die Kirche hat sie umgebracht, sondern abergläubische Weiber, denen man nicht rechtzeitig eins auf ihre dreckigen Pfoten gegeben hat, ich habe sie bereits von ihren Männern bestrafen lassen. Die Anführerin liegt in Ketten, sie wird noch öffentlich ausgepeitscht«, polterte er. »Und dich bringt dein Vater morgen nach Arles, ins berühmte Kloster von Saint-Trophime, wo sich einst unser höchster Lehnsherr, der verstorbene Kaiser Frédéric Barberousse, zum König von Arles krönen ließ. Es ist allerdings eine Weile her. Obwohl ich noch ein Junge war, durfte ich an der Seite meines Vaters dabei sein und unsere schöne Kaiserin Beatrix bewundern, die Tochter und Erbin von Burgund. Nie sah ich eine schönere und zugleich herrschaftlichere Frau. Und der Kaiser mit seinen leuchtenden Augen und dem roten Bart, immer lachte er und hatte für jeden ein freundliches Wort, sogar für einen Knirps wie mich. Wenn er nicht in diesem vermaledeiten Fluss ertrunken wäre, so kurz vor dem Ziel, hätte er die Heere die Ungläubigen vernichtend geschlagen – was, Arnaut?«
Mein Vater nickte.
Dann wurden wir entlassen. Diesmal winkte mir Serena nicht mehr zu, weil ihre Mutter ihre Hände festhielt. Die Kappe in der Hand, verbeugte sich mein Vater.
Der Troubadour hatte soeben wieder ein neues Lied begonnen, und beim Verlassen des Raums begleitete uns seine sanfte Stimme. Noch einen letzten Blick erhaschte ich von Serena, und in diesem Blick, so glaube ich zumindest heute, lagen Trauer und Sehnsucht und eine Liebe, die mich nie mehr loslassen würde.
Als wir aus dem Palais ins Freie traten, fauchte und heulte der Mistral, und der Himmel schaute gnadenlos und kalt auf uns herab.
Kapitel 5
Ein letztes Mal kroch ich bei Anbruch des Tages aus dem Stroh meines Lagers, begab mich zu meinem geheimen Felsennest und suchte dort den Himmel nach meiner Peregrina ab. Sie war nirgendwo zu sehen, und so kletterte ich enttäuscht und traurig über die Felsen zur Burg zurück.
Mein Vater erwartete mich bereits. Ohne ein Wort zu sagen, schaute er mich prüfend an, strich mir mit einer ungewohnt gefühlvollen Geste über den Kopf und schenkte mir, »zum Abschied und für alle Zukunft«, wie er anmerkte, ein selbstgeschmiedetes Messer in einem Lederfutteral.
»Und dann noch etwas ...« Seine Stimme stockte, wurde rau, und ich glaube sogar, er kämpfte mit den Tränen. »Zu dem Amulett deiner Mutter – ich weiß nicht, was die drei Buchstaben bedeuten. Deine Mutter konnte nicht lesen, ich kann es auch nicht. Sie werden wohl immer ein Geheimnis bleiben. Deine Mutter hat mir aus ihrer Vergangenheit nur sehr wenig erzählt.« Er musste schlucken, aber dann wurden seine Gesichtszüge hart.
»Dein Vater ...«
»Aber mein Vater bist du doch«, fiel ich ihm ins Wort.
»Dein richtiger Vater.«
»Aber du bist mein richtiger Vater. Ich kenne den anderen gar nicht.«
»Ich spreche von dem Mann, der dich gezeugt hat. Ich bin nur dein Stiefvater.«
Weil er meinen inneren Widerstand bemerkte, versuchte er, mir den Unterschied zu erläutern. »Du musst dir das so vorstellen: Ein Falkenvater stößt einen Nestling aus dem Horst, und ich als Falkner finde ihn und ziehe ihn auf. Ich bin dann sozusagen der Stiefvater des kleinen Falken, und der richtige Vater sitzt noch im Horst oder ist längst weggeflogen – oder sogar tot.«
Nun zog er mich auf seinen Schoß, obwohl ich dafür eigentlich zu groß war, strich mir über Schopf und Locke, zupfte meinen Kittel zurecht und sagte: »Natürlich kann auch ein Stiefvater seinen Stiefsohn lieben.«
Ich nickte, mehr oder weniger überzeugt, denn alle Erläuterungen meines Vaters und auch der Wortzusatz Stief klangen in meinen Ohren nach verstoßen. Mein anderer, richtiger Vater hatte meine Mutter und mich verstoßen – und sollte ich jetzt nicht ein zweites Mal verstoßen werden?
»Aber wenn du mich liebst, warum schickst du mich weg ins Kloster?«, wandte ich ein.
»Weil ich dich liebe, schicke ich dich ins Kloster! Du sollst etwas Besseres als dein Vater werden, das sagte ich doch bereits!«
Ich versuchte, all die Gedanken und Gefühle, die meinen kindlichen Verstand verwirrten, zu ordnen – ohne Erfolg. Schon drängte sich mir eine weitere Frage auf: »Ähnele ich mehr dir oder meinem anderen Vater?«
Bevor er antwortete, überlegte er lange, runzelte die Stirn und setzte mehrfach zu sprechen an, bis er schließlich sagte: »Du bist der Sohn deiner Mutter. Und sein Sohn: Er war schmächtig, das hat deine Mutter einmal erwähnt, ein Hänfling so wie du, aber ein Ritter, wenn auch kein gewöhnlicher.«
Mir schossen die Tränen in die Augen.
»Warum weinst du?«
»Er war ein böser Mensch«, schluchzte ich. »Er hat meine Mutter verstoßen und davongejagt, er hätte sie verhungern lassen, sie musste betteln – das hättest du mit einem Falkennestling nie getan.«
»Da hast du recht!« Er wischte mir die Tränen von den Wangen. »Nun hör auf zu weinen. Auch du würdest einen Nestling nie verhungern lassen.«
»Aber wenn ich so wie mein richtiger Vater bin?«
»Du kannst ja ein anderer werden.«
Noch am selben Morgen marschierten mein Vater und ich zur Abbaye de Montmajour, wo wir eine Nacht Station machten. Wir fanden in der Kirche kaum Raum zum Beten, weil sich Hunderte von Pilgern dort drängten, unter ihnen auch eine Reihe von Kreuzrittern mit ihrem Gefolge. Sie beanspruchten Platz und sonnten sich in den bewundernden oder auch neidischen Blicken des armen Fußvolks. Die meisten von ihnen sprachen Französisch.
Mein Blick ruhte lange auf ihnen, insbesondere auf einem Ritter, der sein schimmerndes Kettenhemd nicht abgelegt hatte; darüber prangte auf dem weißen Leinen seines Waffenrocks unübersehbar ein rotes Kreuz.
»Jerusalem ist verloren, daran wird auch dieser Tempelritter nichts ändern«, stieß mein Vater mit Resignation in der Stimme aus, wandte sich ab und zog mich aus der Kirche, ohne sich zu bekreuzigen.
Am Rande eines Schafstalls fanden wir einen Platz zum Schlafen, erhielten immerhin zuvor von den Mönchen einen Kanten Brot, einen Teller Bohnenbrei, einen Becher Wein und den Segen des Herrn, den mein Vater mit niedergeschlagenen Augen entgegennahm.
Nachts schlief ich schlecht, weil ich über die starken Ritter in ihren glänzenden Rüstungen nachdenken musste. Waren sie gewöhnliche oder ungewöhnliche Ritter wie der schmächtige Mann, der meine Mutter und mich verstoßen hatte? Erst nach den Vigilgesängen erstarb mein Grübeln, und ich schlief ein. Im Traum sah ich mich stolz im Sattel eines starken Schimmels sitzen, am linken Arm den länglichen Schild, am Gürtel das Schwert und in der rechten Hand eine Lanze mit einem Banner, auf dem die blutroten Buchstaben meines Amuletts prangten. Auf dem Streitross galoppierte ich auf Jerusalem zu, das vor mir wie die Burg von Les Baux in den Himmel ragte. Doch bevor ich seine Mauern erreichte, brach der Traum ab.
Am nächsten Morgen wollten wir früh aufbrechen, um rechtzeitig in Arles zu sein. Auch die Ritter machten sich bereits lärmend auf den Weg. Noch im Bann meines Traums achtete ich nicht darauf, dass ein Ritter in ungebremstem Trab auf mich zugeritten kam. Ich hörte das Pferd wiehern, den Drohruf des Ritters, und schon erwischte mich das Ross. Weil ich nicht in den Dreck geschleudert werden wollte, klammerte ich mich an die rote Pferdedecke und erwischte dabei auch den ebenso roten Waffenrock des Reiters. Erschrocken stieg das Pferd hoch, der Ritter, der offensichtlich unachtsam gewesen war, verlor sein Gleichgewicht, und weil ich nicht losließ, stürzten wir beide gemeinsam zu Boden. Gelenkig, wie ich war, rollte ich ab und stand schon wieder, als der Ritter mit voller Wucht zu Boden ging. Ihm blieb die Luft weg, und eine Weile konnte er sich nicht bewegen. Sein Knappe und die Pferdeknechte stürzten unter Geschrei herbei und achteten im ersten Augenblick nicht auf mich.
»Los, weg hier!«, hörte ich meinen Vater rufen. Er packte mich, als ich mich über den Ritter beugen wollte, um ihm aufzuhelfen. »Der erschlägt dich.«
Sein Helm war in den Dreck geflogen, selbst die runde Stoffkappe über den schwarzen Haaren war verrutscht, ich sah noch die gefletschten Zähne und das schmerz- und wutverzerrte Gesicht, die dunklen Augen unter den zusammengewachsenen Brauen. Schon stieß mich mein Vater vorwärts, durch die neugierigen Gaffer hindurch, er zerrte mich hinter sich her, bis wir das Klostergelände verlassen hatten. Vor sich hin starrend, stieß er aus: »Er hätte dich niedergeritten, der Hund!«
Schweigsam marschierten wir, zusammen mit anderen Menschen und ihren Tieren, auf Arles zu.
Niemand verfolgte uns.
Schließlich erreichten wir das Stadttor und stapften durch die engen Gassen voller Händlergeschrei zur Abtei Saint-Trophime. Mein Vater nannte seinen Namen und den unseres Herrn; wir wurden bald eingelassen und zum Leiter der Klosterschule geführt, der kurz mit meinem Vater sprach, einen flüchtigen Blick auf mich warf, um mich dann meinem Lehrmönch anzuvertrauen.
Ich kam kaum dazu, mich von meinem Vater zu verabschieden. »Mach mir keine Schande und vergiss nie, dass deine Mutter dich wie niemanden sonst liebte.«
Bruder Guilhelmus hieß mein Lehrmönch und Mentor; er kam aus der Nähe von Poitiers, war lange im Kloster von Fontevrault gewesen und hatte sogar eine Weile als Dolmetscher und Skriptor im Gefolge der Aliénor von Aquitanien gelebt.
Noch bevor er mich den anderen Klosterschülern vorstellte und mir meinen Platz im Dormitorium zuwies, führte er mich durch den Kreuzgang und zeigte mir all die wunderbaren Figuren und biblischen Darstellungen, die dort in Stein gemeißelt waren. »Hier gibt es viel zu erzählen – und wenn du erst lesen kannst, werden wir gemeinsam die Geschichten von den Rittern der Tafelrunde studieren. Unser großer Dichter Chrétien de Troyes hat sie aufgeschrieben, merke dir seinen Namen.« Er beugte sich zu mir herunter und zwinkerte mir zu. »Auch ich dichte ein wenig, aber das darf unser Abt nicht wissen. Weltliche Ablenkung, verstehst du?«
Ich weiß nicht, ob ich ihn verstand. Plötzlich wechselte der Bruder vom Provençalischen ins Französische, als er begann, mir die Steinfiguren des Kreuzgangs zu erläutern. Manchmal verstand ich ein einzelnes Wort, aber meist nicht mehr. Er lachte nur, als er meine großen Augen sah, und fiel ins Lateinische.
»Ja, es gibt viel zu lernen«, sagte er, strich mir über den Kopf und begann, das Te Deum zu singen.
»Und hast du eine schöne Stimme?«, fragte er nach einer Weile. »Sing mir etwas vor!«
Ich summte und sang die traurigen Lieder, mit denen mich meine Mutter in den Schlaf begleitet hatte.
»Wirklich schön! Aus der Stimme ist etwas zu machen. Aber woher kennst du diese Melodien?«
»Von meiner Mutter«, sagte ich verschüchtert.
»Sie klingen nach Byzanz. Oder nach dem Morgenland. Ich hörte einige Kreuzfahrer Ähnliches singen.«
»Meine Mutter ...« Ich konnte nicht weitersprechen, weil mir plötzlich Tränen in die Augen schossen.
Nun nahm mich Bruder Guilhelmus in den Arm und drückte mich an sich. »Lebt sie nicht mehr?«
Ich schüttelte den Kopf und nickte dann.
»Was bist du dünn, mein Junge! Hat man dir nicht genug zu essen gegeben? Oder ist es die Trauer um deine Mutter?« Er fuhr mit der Hand über die Schulterblätter. »Was ist denn das?«, rief er aus.
Ich wollte ihm mein Amulett nicht zeigen, aber er hatte es bereits aus meinem Kittel gefingert und betrachtete es neugierig. »Eine ganz alte Münze! Aus purem Gold!« Er drehte sie. »Was steht denn da? F H R? Diese Buchstaben sind noch nicht lange hineingeritzt. Und was bedeuten sie?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich und wischte mir die letzten Tränen von den Wangen. »Ich kann ja noch nicht lesen.«
»Ja, dann musst du es schleunigst lernen, damit wir das Geheimnis deines Amuletts lösen können.«
Kapitel 6
Denke ich heute über meine Jahre im Kloster nach, so kann ich nur sagen: Sie vergingen wie im Flug der Falken. Natürlich litt ich zu Beginn unter Heimweh und dem Gefühl, verstoßen zu sein, ich vermisste meinen Vater und grübelte über den unbekannten, den anderen Vater – und sehnte mich zutiefst nach Serena.
Doch gleichzeitig musste ich viel lernen und um die Anerkennung meiner Mitschüler kämpfen, und beides drängte mein altes Leben in den Hintergrund. Da ich den Mitschülern im Lateinunterricht oft die richtige Antwort zuflüsterte, wenn die Rute schon über ihren Fingern schwebte, hänselte mich bald niemand mehr wegen meiner ungewöhnlich schlanken Glieder oder wegen des Haarwirbels über meiner Stirn, der sich nicht glätten lassen wollte. Allerdings nannte man mich gern die Locke.
Außerdem behielt Bruder Guilhelmus ein Auge auf mich, ja, er unterrichtete mich oft allein, weil er rasch entdeckt hatte, wie leicht ich lernte. Es dauerte nicht lange, da konnte ich lesen und schreiben, und nicht viel länger, da war ich in der Lage, viele Psalmen auswendig aufzusagen, auf Latein natürlich, und die Stammformen der unregelmäßigen Verben ratterte ich nur so herunter. Bruder Guilhelmus nahm mich bei der Hand und führte mich zum Abt, ließ mich einen Psalm nach dem anderen vortragen, bis der Abt gähnte, seinen Bruder in Christo lobte, den Herrn im Himmel pries und versprach, an den Senher de Baux zu schreiben und von meinen Lernfortschritten zu berichten.
»Wie heißt du noch einmal, mein Junge?«, fragte er.
Wir lernten nicht nur Latein, die Heiligenlegenden und Taten der großen Römer, sondern sangen inbrünstig und beobachteten nachts, vom Kreuzgang aus, den Himmel und seine Sterne. Als wir die lateinische Grammatik einigermaßen beherrschten, machten wir uns über die alten Dichter her, Vergil und Horaz, studierten Cicero, Boëthius und Isidor von Sevilla und übten schon einmal den mündlichen Vortrag. Auch von Geometrie und ihren Gesetzen, die der Grieche Euklid so klar formuliert hatte, erfuhren wir etwas, ohne immer alles zu verstehen. Natürlich hatten wir Rechnen geübt, und Bruder Guilhelmus hatte uns im Umgang mit dem Abakus unterwiesen, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die Araber ein anderes als das römische Zahlensystem benutzten. »Mit ihm kann man viel leichter rechnen. Es ist ein Dezimalsystem, versteht ihr, und man rechnet mit einer Null.«
»Was ist eine Null?«, fragte ein Mitschüler.
»Nun, eine Null ist eben eine Null, ist gar nichts.«
»Aber wie kann man mit gar nichts rechnen?«, warf ich ein. »Es geht doch immer um etwas.«
»Da hast du ein großes philosophisches Problem angesprochen, mein Junge, das Etwas und das Nichts oder anders gefragt: Warum ist etwas und nicht nichts? Aber das nehmen wir später durch. Und jetzt gehen wir erst einmal raus in die Sonne und spielen Blindekuh.«
Sonntags führte Bruder Guilhelmus mich und andere ausgewählte Schüler in die Stadt, zeigte uns die Säulen des römischen Theaters und die Mauern der Arena mit ihren Gängen, in denen Menschen hausten, während zugleich in den unteren Bögen in babylonischem Sprachengewirr Waren gehandelt wurden. Dort fühlte Bruder Guilhelmus sich wohl, weil er von einem Idiom ins andere springen konnte.
Gelegentlich ging es auch hinaus aus der Stadt, nach Süden, zu den Sümpfen zwischen den beiden Armen der sich ins Meer ergießenden Rhône, und Bruder Guilhelmus erklärte uns die Gräser und Vögel, wies besonders auf die rosaroten Flamingos hin und die zahlreichen Reiher, erzählte uns von den Fischen des Meeres, während wir mit den Händen wedelten, um die Mücken zu vertreiben.
Bevor wir wieder ins Kloster zurückkehrten, wollte Bruder Guilhelmus mit uns unbedingt noch ein Bad in der Rhône nehmen und uns dabei auch das Schwimmen beibringen. Wir zogen uns alle nackt aus, dann ging es unter Gekreisch, Johlen und Spritzen ins Wasser, und der ebenfalls nackte Bruder Guilhelmus zeigte uns die Schwimmbewegungen und alle Kniffe, wie man nicht unterging. Wem es anfangs nicht gelang, seinen Kopf über Wasser zu halten, den hielt unser Schwimmlehrer mit Engelsgeduld.
Diese Ausflüge stellten eine willkommene Abwechslung vom Einerlei der Tage dar, in denen, abgesehen vom Lernen, alle drei Stunden gebetet und jeden Nachmittag im Chor gesungen wurde. Bald musste ich vorsingen, weil Bruder Guilhelmus meine Stimme so engelsrein und klar fand und ich die Töne meistens traf. Danach umarmte er mich voller Lob und drückte mich an sich.
Abends fiel er ins Französische und erzählte uns von König Artus, Perceval, Gauvain und Lancelot, von Erec und Yvain und den anderen tapferen Rittern der Tafelrunde, er erzählte von den Kaisern und ihren Kreuzzügen gegen den starken Sultan Saladin, von der Wunderwelt des Orients mit seinen Düften und Gewürzen, dem harâm, der von Eunuchen bewacht sei, von klugen Gelehrten und wissenden Ärzten, er schwärmte von dem Reichtum in Bagdad und Alexandria – und nährte unsere Träume.
Wenn ich besonders gut gelernt hatte, las er mir abends auch aus seinen eigenen Dichtungen vor, von einem Ritter, der in einem Land mit Namen Arcania aufgewachsen war und eine Königin mit Namen Elenabella liebte, schließlich holte er eine Laute und sang ein Liebeslied, in der diese Elenabella gepriesen wurde. Ich erzählte ihm von Serena und auch von den Troubadouren auf der Burg von Les Baux. Er sah mich wie ein liebender Vater an, fuhr mir mit der Hand durch die Haare und flüsterte mir ins Ohr: »Gibt es etwas Schöneres, als von der Liebe zu singen? Du musst einmal Troubadour werden, Bernardou.«
»Können Troubadoure denn auch Ritter sein?«, fragte ich.
»Ja, natürlich. Manche wurden Mönche, andere waren Ritter, einige sogar hohe Herren: Grafen, Herzöge, Könige!«
Von diesem Tag an übte ich, Harfe zu spielen und zu dichten.
Da wir Jungen waren, hockten wir natürlich nicht nur auf harten Holzbänken und büffelten oder sangen das Gloria. Kaum sahen wir einen Ball, warfen wir ihn uns zu oder traten ihn mit den Füßen, und in den Lernpausen rannten wir um die Wette, machten Bockspringen, stemmten und warfen Steine, suchten Stecken, mit denen sich fechten ließ.
Einer meiner Mitschüler, dem ich oft einsagen musste, war ein Neffe des Senher de Baux, ein Sohn des Prince d’Orange. Er hieß Gaufred, hatte struppiges Haare und einen verkrüppelten Finger, war aber sonst kräftig gebaut und mochte mich. Als wir zusammen im Kloster lernten, konnte er bereits reiten und machte sich häufig auf gutmütige Weise über mich lustig, weil ich nur gelegentlich einmal auf einem Esel oder Maultier gesessen hatte.