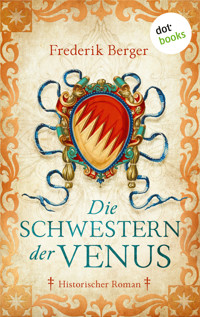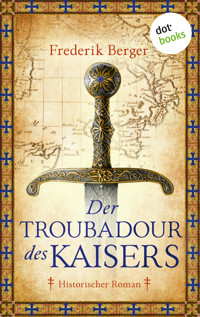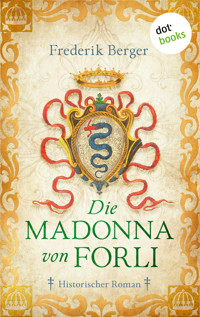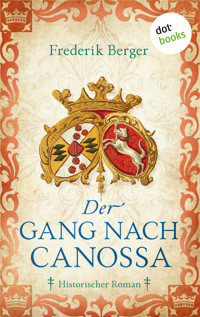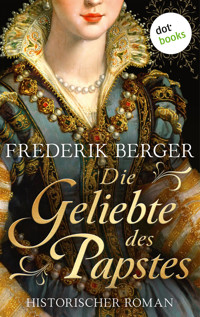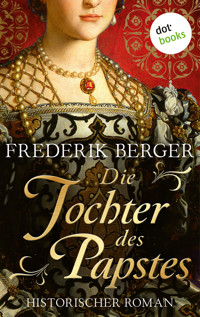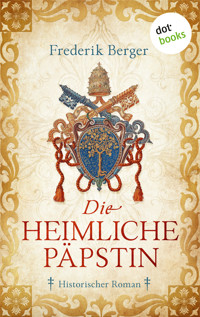
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie will zur Herrscherin Roms werden … Der prachtvolle Historienroman »Die heimliche Päpstin« von Frederik Berger als eBook bei dotbooks. Die Ewige Stadt im 10. Jahrhundert – die Zeit der »Hurenherrschaft«, in der Frauen die Geschicke der Christenheit lenkten: Ihr Leben lang hat Marozia im Schatten ihrer skrupellosen Mutter gestanden, die als Geliebte des Papstes zur mächtigsten Frau Roms aufgestiegen ist. Nun aber fällt der Blick des Papstes auf sie – und die schöne Adlige ist nicht bereit, einfach nur eine seiner zahlreichen Gespielinnen zu werden. Stattdessen schmiedet sie einen tollkühnen Plan: Eines Tages wird ihr Sohn den Heiligen Stuhl besteigen ... und sie die heimliche Päpstin sein! Doch welchen Preis ist sie bereit zu zahlen, um zu höchster Macht aufzusteigen? Ein unglaubliches und dennoch historisch verbürgtes Schicksal – und ein dramatisches Leben, dass die Legende der Päpstin Johanna maßgeblich beeinflusst hat: »Ein farbiges Sittengemälde«, urteilen die Badischen Neuesten Nachrichten. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der opulente historische Roman »Die heimliche Päpstin« von Frederik Berger wird alle Fans der Bestseller von Donna W. Cross und Ken Follett begeistern! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Ewige Stadt im 10. Jahrhundert – die Zeit der »Hurenherrschaft«, in der Frauen die Geschicke der Christenheit lenkten: Ihr Leben lang hat Marozia im Schatten ihrer skrupellosen Mutter gestanden, die als Geliebte des Papstes zur mächtigsten Frau Roms aufgestiegen ist. Nun aber fällt der Blick des Papstes auf sie – und die schöne Adlige ist nicht bereit, einfach nur eine seiner zahlreichen Gespielinnen zu werden. Stattdessen schmiedet sie einen tollkühnen Plan: Eines Tages wird ihr Sohn den Heiligen Stuhl besteigen ... und sie die heimliche Päpstin sein! Doch welchen Preis ist sie bereit zu zahlen, um zu höchster Macht aufzusteigen?
Über den Autor:
Frederik Berger (geboren 1945 in Bad Hersfeld) studierte Literatur- und Sozialwissenschaften und lebte einige Zeit im englischen Cambridge und in der Provence. Er arbeitete als Literaturwissenschaftler und Journalist, bevor er hauptberuflich Schriftsteller wurde. Neben Gegenwartsromanen, Sachbüchern und zahlreichen Aufsätzen verfasste er verschiedene historische Romane über den Glanz und die Schatten europäischer Adelsfamilien. Frederik Berger reist viel und ist begeisterter Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Schondorf am Ammersee.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine historische Romantrilogie »Das Siegel der Farnese« mit den Bänden »Die Geliebte des Papstes«, »Die Tochter des Papstes« und »Die Kurtisane des Papstes«. Außerdem erschien sein opulenter historischer Roman »Die Provençalin«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
Die Website der des Autors: www.frederikberger.de
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/fritzgesing/
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2023
Copyright © der Originalausgabe Rütten & Loening Berlin GmbH, Berlin 2006
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/John Erickson und eines Wappens aus den Insignia Neapolitanorum
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-818-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die heimliche Päpstin«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Frederik Berger
Die heimliche Päpstin
Historischer Roman
dotbooks.
Im Andenken an meine Mutter – an ihren Lebensmut, ihre Leidensfähigkeitund ihre durch nichts zu erschütternde Seelenstärke
Das 9. Jahrhundert zeigte einen tiefen sittlichen Verfall. Aus solchem Zersetzungsprozeß der Gesellschaft erhoben sich jene Frauen, Theodora und Marozia, ehrgeizige Frauen von großem Verstande und Mut, herrschbegierig und genußsüchtig. Ihre auffallenden Erscheinungen durchbrechen seltsam genug die klösterliche Monotonie der Geschichte des Papsttums.
Die unleugbare Tatsache, daß eine Weile Frauen die Papstkrone verliehen und Rom beherrschten, ist sehr entwürdigend für die damaligen Römer; allein statt diese Erscheinung unter das Vergrößerungsglas moralisierender Betrachtung zu stellen, ist es passender, sie als ein historisches Ereignis aufzufassen.
Ferdinand Gregorovius:Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter
PROLOG
»Kennen Sie wirklich schon alle Geheimnisse dieses Grabmals?« fragte uns verschwörerisch der in korrektem Schwarz gekleidete Führer durch die Engelsburg zu Rom. Fürst del Drago, der mich bereits auf die Spuren der Papstgeliebten Silvia Ruffini gebracht und mich zu dieser Privatführung eingeladen hatte, lächelte wissend.
Es war nicht das erste Mal, daß ich die Gewölbe und Verliese, die Gänge und Kammern der Engelsburg durchwanderte, immer auf der Suche nach Zeichen, die in die Vergangenheit führen, in bisher Verborgenes, Verstecktes ...
Der Führer räusperte sich bedeutend und schloß eine schwere Eisentür auf. »Wir verlassen jetzt die Räumlichkeiten, die den normalen Besuchern zugänglich sind.«
Hinab ging es durch dunkle Gänge. Es roch muffig, nach Moder und Verwesung, nach jahrhundertealten Seufzern und verlorenem Stöhnen. Giovanni del Drago begann ein Liedchen zu pfeifen. Vor uns tanzte der Lichtkegel der starken Taschenlampe, mit der unser Führer den Weg in die Unterwelt zu beleben versuchte.
»Es gibt Verliese, die in Katakombentiefe liegen. Manche wurden später zugeschüttet, um die Erinnerung an die Menschen, die hier einen qualvollen Tod fanden, zu ersticken. Aber wer feine Ohren hat, kann noch immer ihre Schreie hören.«
Er öffnete eine knarrende Tür und ließ Licht in das feuchte Dunkel einer Kerkerkammer fallen. Drei magere Ratten huschten aufgescheucht über den staubigen Boden und schienen sich in Nichts aufzulösen.
»Hier lag und litt sie, Marozia, die Tochter des Theophylactus und der Theodora, die Herrscherin Roms und heimliche Päpstin, hier, an diesem Ort von Finsternis und Elend.« Seine Stimme bebte. Ich weiß nicht, ob aus Mitleid oder heimlicher Bewunderung.
Der Lichtkegel seiner Taschenlampe glitt langsam über die schwarzglänzenden Wände aus schweren Quadern.
»Nur ich weiß, daß sie Spuren auch in dieser Gruft hinterlassen hat – hier!«
Mit einer emphatischen Bewegung wies der Führer auf eingeritzte Zeichen in der Wand. Ich trat näher. Es waren griechische Buchstaben, schwer erkennbar unter dem Schimmel der Jahrhunderte: αταραξία, las ich, ataraxia, ein Wort des altgriechischen Philosophen Epikur, das meist mit Seelenruhe übersetzt wird. In dieser Umgebung erschien es mir wie ein höhnischer Kommentar.
Auch Fürst del Drago näherte sich der Wand, schaute über seinen Brillenrand und studierte die Buchstaben.
»Daß Marozia Griechisch beherrschte, ist unwahrscheinlich. Vermutlich wich ihr eine treue Sklavin in den schwersten Stunden nicht von der Seite.« Der Führer flüsterte nur noch. »Achten Sie auf das Echo der Stimmen: Wie flehende Geister rufen sie nach uns.«
Fürst del Drago lachte kurz auf. »Sie hieß Aglaia, war eine gelehrte Griechin, kam aus dem byzantinischen Reich ...«
»Wer?« fragte der Führer leicht verwirrt.
»Marozias Sklavin. Ataraxia anzustreben war das Motto ihres tapferen Lebens. Die beiden Frauen müssen hier tatsächlich ...«
»... eingegangen sein in das Höllenreich, verleumdet von der Nachwelt, die sich auf das Buch der Vergeltung des Bischofs Liutprand von Cremona stützt?«
»Richtig, auf das Werk eines voreingenommenen, geschwätzigen Frauenhassers.«
Der Führer stand bereits in der Tür, sorgsam jeden Kontakt mit den schmierigen Wänden vermeidend. »Habe ich Ihnen zuviel versprochen?«
»Nein, das griechische Wort ist der Beweis.«
»Im Vatikan will man nicht mehr an Marozia, ihre Mutter Theodora und die mörderischen Päpste der damaligen Zeit erinnert werden. ›Aus dem zehnten Jahrhundert, dem saeculum obscurum, gibt es keine neuen Quellen‹, behauptet der Archivar, mit dem ich sprach, ein verlogener Glatzkopf. Sie kennen ihn?«
Die Frage richtete sich an den Fürsten, der jetzt mit mir in den dunklen Gang trat. Giovanni del Drago nickte.
»Sie haben fast alles vernichtet, was es an verräterischen Dokumenten gab, schon früher, teilweise vor Jahrhunderten – die würdigen Kardinäle, die ernsten Bischöfe, der von seiner Mission erfüllte Papst. Wer will schon gerne an die mörderischen Jahrzehnte der sogenannten Hurenherrschaft erinnert werden, die über tausend Jahre zurückliegt.«
Als wir uns verabschiedeten, senkte der Führer seine Stimme: »Im Vatikan gab es schon immer Verschwörungen zur Unterdrückung der Wahrheit, bestochene Lohnschreiber und Geschichtsfälscher. Erwähnen Sie bitte nie meinen Namen! Ich hätte Ihnen nicht einmal diese Verliese zeigen dürfen.«
»Nun, was sagen Sie?« fragte Giovanni del Drago, als wir, gebeugt über die Brüstung der Engelsbrücke, unsere Blicke auf dem träge und schmutzig dahinfließenden Tiber ruhen ließen.
Wollte mir der Fürst eine neue story unterbreiten? Oder warum hatte er diese Privatführung organisiert? Marozia, die schöne, die leidenschaftliche Papstmacherin aus den höchsten römischen Adelskreisen, die mächtigste Frau Italiens im ersten Drittel des zehnten Jahrhunderts – war sie nicht in der Engelsburg, im Grabmal des römischen Kaisers Hadrian, aus der Geschichte verschwunden? Jeder wußte, was diese Formulierung der Historiker bedeutete.
Oder hatte der kriminalistische Spürsinn des fürstlichen Amateurarchäologen del Drago, der offensichtlich über weitreichende Kontakte verfügte, etwas entdeckt, was verborgen bleiben sollte, weil es ein neues Licht auf das dunkle Jahrhundert der Kirchengeschichte warf?
»Mir wurde ein altes Manuskript zugespielt«, erklärte er nicht ohne Stolz. »Irgend jemand wollte die Wahrheit retten, verstehen Sie? Die Wahrheit über das dramatische Leben der Marozia, von Aglaia, ihrer treuen Sklavin, aufgeschrieben. Αταραξία. So lautet der Erkennungscode, den wir in dem Manuskript und auch im Kerker der Engelsburg fanden, Aglaias Losung und Lebensphilosophie.« Er malte sorgfältig die griechischen Buchstaben mit dem Zeigefinger auf den Staub der Brüstung, und als er mich anschaute, blitzte in seinen Augen Begeisterung auf. »Endlich ein Zeugnis, das nicht von einem leib- und frauenfeindlichen Geistlichen verfaßt wurde, sondern von einer lebensklugen, leidensfähigen und wahrhaft starken Frau.«
TEIL I
Das Rätsel der Sphinx
Kapitel 1
Wie konnte all dies nur geschehen?
Vor wenigen Augenblicken mußte ich Marozia noch tröstend in den Arm nehmen. Selten habe ich sie weinen gesehen, nun forderten Unsicherheit und Angst ihren Tribut. Während die Tränen flossen, schüttelte sie den Kopf. Sie wollte nicht begreifen, wie sich unser Leben innerhalb weniger Stunden geändert hatte. Gestern noch fühlte sie sich, die Herrin Roms und die Mutter unseres Papstes, als mächtigste Frau Italiens und zukünftige Kaiserin, heute liegt sie gestürzt und gedemütigt, geschlagen und voller Schmutz im tiefsten Kerker der Engelsburg. Gestern prunkte sie noch im dunkelglühenden Ornat ihrer Hochzeitsfeier, an der Seite eines Königs, der dabei war, Kaiser zu werden, gestern zeigte sie sich noch entschlossen, Italien zu einen, die brandschatzenden Ungarn endgültig zu vertreiben und den Sarazenen den Mut zu nehmen, über unsere Küsten herzufallen, heute sieht sie sich von einem rachsüchtigen Gott in eine dunkle Tiefe gerissen, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint.
Langsam beruhigte sich Marozia wieder, legte sich auf eine der mit schmutzigem Stroh bedeckten Holzpritschen, starrte an die niedrige Decke. Ihre Lippen wurden schmal, ihre Zähne knirschten vor erneut hervorbrechender Wut. Dann schloß sie die Augen, und die Wut in ihrem Antlitz verwandelte sich in Verzweiflung.
»Warum nur?« flüsterte sie. »Aglaia, sag mir: Warum?«
Was sollte ich darauf antworten! Wußte ich denn, warum ein nichtiger Anlaß solch schreckliche Folgen nach sich ziehen und ihre Hochzeit mit König Hugo wie ein Alptraum enden mußte? Es war, als hätte der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Sturm hervorgerufen.
Sie seufzte, und eine letzte Träne quoll unter den geschlossenen Lidern hervor.
Eine Weile wanderte ich durch unser Verlies und ließ mich schließlich auf der zweiten Pritsche nieder, warf einen Blick auf Marozia, die wie eine marmorne Grabfigur ihrer selbst dalag, stumm und kraftlos, doch nicht ohne Stolz und Würde. Ich starrte an die schimmlige Wand, als könnte ich dort eine Antwort finden.
Die Hochzeitsfeier in der Engelsburg, in diesem uralten Mausoleum, zog quälend langsam vor meinem inneren Auge vorbei. Schon sie war ein Sakrileg, das nach Strafe schrie. Alberico, Marozias zweitgeborener Sohn, betrat den Raum, bewegte sich mit gezirkelten Schritten auf König Hugo, seinen Stiefvater, zu. Hugo brach in höhnisches Gelächter aus, und Alberico schritt zur sorgfältig geplanten Tat. Am meisten hat sich mir sein haßerfüllter Blick eingeprägt, den er, bevor er den Raum verließ, auf Stiefvater und Mutter warf. Am nächsten Morgen – gestern! – geschah dann, was niemand erwartet, ja, auch nur für möglich gehalten hatte und was uns schließlich in diesem stinkenden, stickigen und feuchten Kerker enden ließ.
Warum muß Alberico uns so bestrafen? Hätte es nicht gereicht, König Hugo in Fesseln zu legen? Weiß Alberico nicht, daß er mit seiner Tat eine Spirale der Gewalt in Gang setzt, in der einer untergehen muß: seine Mutter oder er?
Ich verstehe nach all dem Demütigenden, das er während der letzten Tage ertragen mußte, seinen Zorn, ich verstehe auch die Verletzungen, die er seit seiner Kindheit hat erleiden müssen – doch warum geht er so weit, alle Brücken der Verständigung abzubrechen? Niemand weiß besser als ich, daß er um die Liebe seiner Mutter kämpfte, daß er hinter seinem Bruder Giovanni zurückstand, dem Erstgeborenen, der auf Marozias Betreiben hin zum pontifex maximus gewählt wurde, während er auf das Erbe seines Vaters bis heute wartet.
Eins ist sicher: Wir alle haben ihn unterschätzt. Seinen Willen, seine Kraft und auch die Entschlossenheit seiner Anhänger.
Marozia öffnete wieder die Augen, als hätte sie nur kurz nachgedacht, und erklärte in die Stille des Kerkers hinein: »Er muß uns freilassen. Hugos Heer liegt vor den Mauern der Stadt und wird sie stürmen, wenn der König nicht bald zurückkehrt. Seine Soldaten werden sich furchtbar rächen, Alberico wird einen grausamen Tod erleiden ...«
»Roms Mauern sind hoch und stark bewehrt«, entgegnete ich.
Marozia richtete sich auf und starrte mich verärgert an.
Ohne die Ruhe zu verlieren, ergänzte ich noch: »Vielleicht hat Alberico sogar den König umbringen lassen.«
Sie sprang abrupt auf und durchschritt unsere Zelle wie eine eingesperrte Löwin. »Selbst wenn Hugos Männer Rom nicht erobern, können sie die Stadt aushungern«, rief sie gegen eine der Wände.
»Bevor die Stadt ausgehungert ist, lebt keiner mehr von uns.«
»Das römische Volk steht hinter mir. Wenn durchsickert, wie Alberico mich behandelt, wird es einen Aufstand geben.«
»Es gab einen Aufstand – gegen dich und König Hugo. Kein Fischer vom Tiber, kein Wasserverkäufer und kein Straßenmädchen haben einen Finger für dich gekrümmt.«
Mein sachlicher Ton dämpfte Marozias Erregung. Die Stirn in Falten gelegt, setzte sie sich wieder auf ihre Pritsche und schwieg. Nach einer Weile erklärte sie: »Alberico hat sich nie damit abfinden können, daß ich seinen Bruder Giovanni zum Papst habe wählen lassen. Ob er auch ihn in den Kerker gesteckt hat?«
»Es wird nicht nötig sein.«
»Du hast recht. Sogar als Papst macht Giovanni, was ihm befohlen wird. Außerdem hat er seinem Bruder nie etwas Böses getan. Bei meiner Hochzeit mit Hugo behandelte er ihn zuvorkommend und vergoß während der Zeremonie Tränen ... Er ist ein weicher Junge, mitleidig und unentschlossen – ängstlich ... im Gegensatz zu Alberico, der verschlagen ist, voller Gewalt, wie sein Vater ...«
»Du irrst dich, Marozia«, unterbrach ich sie, »weder der Junge noch sein Vater waren verschlagen und gewalttätig. Alberico sehnte sich nach Liebe und Anerkennung.«
Erneut legte sich Marozia auf den Rücken, schloß die Augen und flüsterte: »Vielleicht hast du recht.«
Als sie die Rivalität der beiden Brüder angesprochen hatte, war mir eine Szene aus ihrer Kinderzeit eingefallen, die ich nie vergessen habe.
Alberico, der wilde Junge, kam zu seiner Mutter gerannt, die soeben dabei war, sich von dem kirchlich gekleideten Giovanni den Beginn des 119. Psalms vortragen zu lassen, den er hatte auswendig lernen müssen.
»Ich kann ihn auch!« fiel Alberico seinem Bruder mit lautstarker Begeisterung ins Wort und drängte ihn zur Seite. »Ich habe ihn gelernt.« Er baute sich vor seiner Mutter auf.
»Na, dann laß hören«, sagte sie, nicht ohne Stirnrunzeln über seinen ungebührlichen Auftritt.
Alberico begann zu rezitieren, zuerst zögernd und vorsichtig, dann immer sicherer: »Ich danke Dir von rechtem Herzen, daß Du mich lehrest die Rechte Deiner Gerechtigkeit. Deine Rechte will ich halten; verlaß mich nimmermehr. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält nach Deinen Worten.« An dieser Stelle begann er stotternd, nach dem Anschluß zu suchen, der ihm offensichtlich entfallen war. Giovanni begann spöttisch zu kichern, und Alberico warf ihm einen wütenden Blick zu. »Ich habe ihn gerade noch gekonnt«, rief er. Nun lachte auch seine Mutter, nicht ohne Spott.
»Ich weiß, wie der Psalm weitergeht«, mischte sich Giovanni ein, im seltenen Triumph über seinen Bruder, und streckte sich hoheitsvoll. Doch schon hatte ihm Alberico einen heftigen Stoß versetzt, stürzte sich auf ihn, um ihn zu Boden zu ringen. Wie so häufig, begann Giovannis Nase zu bluten. Ich trennte die Brüder mit sanftem Nachdruck, während Marozia mit verärgerter Miene nach Alberico schlug, ihn mit einem schrillen »Raus!« aus dem Raum jagte und dann voll überfließenden Mitleids Giovanni an ihre Brust zog, ohne auf das Blut zu achten, das ihre Tunika befleckte.
Alberico blieb nach diesem Ereignis tagelang verstockt und ließ sich nur von seinem Vater trösten, der ihm geduldig die Tricks des Fechtens sowie die Künste des Reitens zeigte und ihm, als Alberico zu ermüden begann, von der Wolfsjagd erzählte, bei der ein Junge zu einem richtigen Mann werden könne.
Kapitel 2
Ich schreckte hoch.
Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, wo wir uns befanden, daß ich auf dem feuchten Stroh der Pritsche eingenickt war, womöglich sogar länger geschlafen hatte.
Die Kerkertür war geöffnet worden, und vor uns stand Alberico im Schein mehrerer Fackeln. Rasch setzte ich mich auf, fuhr durch meine Haare und suchte nach einem Tuch. Marozia lag neben mir, die Augen geöffnet.
Alberico, gerade und hoch gewachsen, mit starken Gliedern und wettergegerbter Haut, ragte auf wie ein zorniger Engel, seine helle Löwenmähne umflackert von unstetem Licht. Kinn und Wangen hatte er glatt geschabt, und seine zwei Grübchen ließen sich von tiefen Narben kaum unterscheiden. Man hätte ihn für den Erzengel Michael halten können, doch fehlte das Schwert in seiner Hand. Er trug allerdings einen Brustschutz aus Leder, und ich glaubte Blutspuren an seinem Arm entdecken zu können.
Noch immer sah er auf uns herab. Die Fackeln knisterten und schickten ihre rußenden Flammen zur Decke; hinter ihm, an den feuchten Wänden, umtanzten ihn Schatten wie wilde Dämonen.
Stöhnend setzte sich Marozia auf, strich sich ihr Obergewand glatt. Ohne ihren Sohn anzuschauen, sagte sie mit heiserer Stimme: »Hast du endlich Vernunft angenommen? Oder willst du mich in diesem Loch verrecken lassen?« Augenlider und Lippen zitterten.
Ich wollte ihr ins Wort fallen, denn offensichtlich hatte sie ihre Lage noch immer nicht begriffen, und machte eine abwiegelnde Geste. Ich befürchtete, Alberico könnte in einen ungehemmten Wutanfall ausbrechen; zugleich sah ich in seinen Augen eine tiefe Verletzung, ja, Verzweiflung.
»Was hast du mit Hugo gemacht? Ihn ermordet?« Ihr Ton war unangemessen herrisch.
»Ich hätte ihn gleich über die Klinge springen lassen sollen«, antwortete Alberico. »Oder blenden – das hätte er verdient.«
Marozia verzog angewidert ihren Mund.
Tatsächlich wirkte Alberico nicht so sicher, wie er nach seinem Sieg über Stiefvater und Mutter hätte sein müssen. Dies schien Marozia zu spüren.
»Hugos Männer werden Rom stürmen und dich wie eine Ratte erschlagen.«
Alberico lachte auf, doch sein Hohn klang wenig überzeugend. »An Roms Mauern haben sich schon ganz andere Heere die Zähne ausgebissen – und bevor ein feindlicher Soldat die Stadt betritt, bist du tot.«
»Willst du wirklich wagen, dich am Leben deiner Mutter zu vergreifen?« Marozia hatte ihre Stimme so gesenkt, daß sie kaum zu verstehen war.
»Wenn du mich zwingst ...«
Jetzt lachte Marozia auf, künstlich und schrill.
Alberico beherrschte sich nur mühsam.
»Gut, ich habe verstanden«, erklärte sie, nun weniger provokant. »Dann erlaube mir, Rom zusammen mit dem König zu verlassen. Hugo wird auf den Kaisertitel verzichten – und du wirst uns nie wiedersehen.« Ihre Stimme wurde weich. »Quäle deine Mutter nicht länger in dieser stinkenden Gruft!«
»Meine Mutter ...« Alberico hatte den Ausdruck verächtlich wiederholen wollen, doch unvermittelt brach seine Stimme weg, und er klang nach Klage, bitterem Vorwurf und tiefer Verletzung.
Noch einmal wiederholte Alberico das Wort Mutter, um sofort »Du blutschänderisches Weib!« auszustoßen, als wollte er die Wirkung des vertrauten Klangs ersticken. »Du wirst hier bleiben, bis dich die Ratten aufgefressen haben, und deinen heimtückischen Hugo soll ebenfalls der Teufel holen!«
Sie schluckte. Nach einer Weile fragte sie: »Was forderst du?«
Weil sie sich erheben wollte, streckte sie Alberico die Hand entgegen. »Hilf mir auf!«
Er trat einen Schritt auf seine Mutter zu, doch statt ihr zu helfen, gab er ihr einen heftigen Stoß, so daß sie fast von der Pritsche gefallen wäre.
»Wie kannst du es wagen, du Bastard!« zischte sie.
»Giovanni ist der Bastard«, antwortete Alberico, zitternd vor unterdrückter Wut, »ich bin dein legitimer Sohn, der Nachfolger meines Vaters Alberich und meines Großvaters Theophylactus. Ich bin princeps Romanorum, Adel und Volk stehen hinter mir, die Tore der Stadt sind geschlossen, kein Fremdling wird hereingelassen, schon gar kein Soldat des Usurpators aus der Provence« – Alberico zögerte wie vor einem Geständnis – »der sich feige davongestohlen hat.«
Ich wollte nicht glauben, was ich hörte, auch Marozia starrte ihren Sohn mit offenem Mund an.
»Ja, ihr hört richtig: König Hugo hat letzte Nacht die Wachen bestochen und sich aus dem Gefängnis abgeseilt.« Wütend ballte er die Faust. »Aber seine Helfer mußten bereits für ihre Tat bezahlen: Ich ließ ihnen die Hände abhacken und sie dann aufknüpfen, mit Hilfe des Taus, das deinem Gemahl zur Flucht verhalf. So wird es allen Verrätern gehen.«
Er versuchte, sich zu mehr Ruhe zu zwingen. »Damit nicht auch du versuchst, deine Wachen zu bestechen, sollte ich dich erwürgen lassen. In diesen Gemäuern sind bereits andere erwürgt worden, wie du weißt. Es wäre nur ausgleichende Gerechtigkeit.«
Selbst in dem schwachen Licht der Fackeln sah ich Marozia erbleichen. Nach einem Hustenanfall veränderte sie grundlegend ihren Ton und flüsterte: »Mein Sohn ... Ich bin deine Mutter, die dich unter dem Herzen trug und unter Schmerzen gebar. Ich liebte deinen Vater, ich liebte auch dich, war stolz auf deine Stärke, selbst wenn ich es nicht immer zeigen konnte.«
Als Alberico nicht reagierte, versuchte sie gewinnend zu lächeln: »Ich verstehe, daß du zornig bist. König Hugo hat sich dir gegenüber nicht richtig verhalten, er hätte sich entschuldigen sollen, aber er ist aufbrausend und unbeherrscht ...«
»Du hast mir das Erbe meines Vaters vorenthalten«, unterbrach sie Alberico. »Und wer sagt mir, daß Hugo nicht plante, mich aus Rom zu vertreiben, mich sogar zu ... töten.«
Marozia bedeckte theatralisch ihr Gesicht mit den Händen.
»Die Würfel sind gefallen«, trumpfte Alberico auf.
Ich muß gestehen, so bedrohlich die Situation war: Seine Worte klangen ein wenig hohl.
»Und was willst du jetzt tun?« fragte Marozia mit dumpfer Stimme.
»Aglaia darf gehen. Sie hat immer versucht, mir deine fehlende Liebe zu ersetzen, sie ist gerecht und voller Verständnis. Sie lasse ich in ihre Heimat zurückkehren.«
Er reichte mir die Hand, zog mich auf die Beine, drückte mich kurz an seine Brust. Ich konnte kaum atmen, so erschrocken war ich.
»Alberico«, stammelte ich.
»Du bist keine Sklavin mehr.« Er lächelte mich an, ohne Arglist.
»Laß auch deine Mutter frei«, bat ich ihn. »Hol sie wenigstens aus dieser Gruft heraus. Ihr könnt euch einigen. Es soll Frieden sein.«
»Sie wird nie Frieden halten können.« Er hatte sich abgewandt und gab das Zeichen zum Aufbruch. Mir winkte er. »Komm mit mir, ich stehe zu meinem Wort.«
»Ich kann deine Mutter nicht allein lassen«, beschwor ich ihn, »ohne zur Verräterin an meinem Kind zu werden ...« Ich nahm seine Hand und schaute ihn flehend an: »Es ist genug Schreckliches geschehen. Du mußt den Kreislauf der Gewalt beenden.«
Alberico hatte mich protestierend unterbrechen wollen, beherrschte sich jedoch und ließ mich ausreden, während er seinen Körper straffte. »Genau dies will ich tun«, erwiderte er schließlich. »Die Zeit der Willkür ist vorbei. Ich werde den Römern ein gerechter Herrscher sein. Hilf mir dabei!«
Verzweifelt schaute ich auf Marozia.
»Geh mit ihm, Aglaia!« Ihre Stimme klang nun schwach und gebrochen.
Ich schüttelte den Kopf.
»Alberico hat recht. Du solltest endlich in deine Heimat zurückkehren, auch ich gebe dich frei.«
Als ich noch immer zögerte, fügte sie an: »Denk an Alexandros, deinen Sohn, suche ihn! Du wirst ihn finden und von mir grüßen, von seiner Milchschwester, seiner einzigen, unvergessenen Liebe.«
»Nein, ich kann nicht! Ich ...« Ich war verzweifelt.
Bevor Alberico uns verließ, ohne seine Mutter eines weiteren Blickes zu würdigen, rief er mir noch zu: »Du kannst es dir jederzeit anders überlegen, Aglaia.«
Die schwere Kerkertür fiel dumpf ins Schloß, die Riegel wurden mit mächtigem Schlag zugeschoben, und schlurfend entfernten sich die Schritte der Wärter. Ihre Stimmen wurden leiser und verschwanden.
Marozia fiel wie gefällt auf ihre Pritsche.
Gelähmt stand ich neben ihr. Ich hatte nicht vermocht, sie allein zu lassen.
Unsere Kerzen flackerten, als wollten auch sie ihre Verzweiflung ausdrücken.
»Warum bist du nicht gegangen?« fragte Marozia tonlos. »Willst du unseren Alexandros nicht wiedersehen?«
Kapitel 3
Seit Tagen sitzen wir nun in unserem Verlies. Marozia schwankt zwischen zornigen Ausbrüchen, düsterer Mutlosigkeit und beschwörendem Beten.
Immerhin sind wir versorgt mit Kerzen und frischem Wasser, Brot, Wein und Öl sowie einem Eimer, der regelmäßig geleert wird.
Und einem Stapel Pergament!
Alberico war nicht mehr erschienen, doch gelang es mir, ihm über einen der Wärter eine Bitte zu übermitteln: Ich wünschte mir eine Möglichkeit zu schreiben, um die stumpfsinnigen Stunden der freiwilligen Kerkerhaft leichter ausfüllen und ertragen zu können. Und tatsächlich, mir wurde mein Wunsch erfüllt!
Nun habe ich die ersten Blätter beschrieben und fühle mich gefaßter.
Soll ich etwa hadern, stöhnen und weinen? Nein, ich habe ganz andere Zeiten voll Schmerzen und Schmach, Erniedrigung und Todesnähe ertragen müssen. Das geschriebene Wort hilft, den Schrecken zu bannen, es dämpft die Aufwallungen des Herzens, es gibt der Seele die Ruhe, deren sie in stürmischen Zeiten bedarf.
Marozia ist in ein undurchdringliches Schweigen gefallen. Ich suche ihren Blick, doch sie hat eine abweisende Maske aufgesetzt. In der beklemmenden Stille wachsen ihr Atem, das Kratzen der Feder und das Knistern der Fackeln zu bedrohlichen Geräuschen. Die Worte, die eine Weile willig flossen, stellen sich nur noch mühsam ein ...
Melden sich Zweifel an meiner Entscheidung? Helfe ich Marozia wirklich, wenn ich bei ihr bleibe? Kann ich nicht, ohne Fesseln, besänftigend auf Alberico einwirken und mit unserem Giovanni sprechen, dem Papst ...?
Die Verlockungen der Freiheit sind wie fruchtbare Tiere: Sie vermehren sich rasch. Schon sage ich mir: Du bist nicht als Sklavin geboren. Hast du nicht lange genug gelitten, ohne zu klagen? Hast du nicht sogar das dir zugeteilte Los angenommen? Der Allmächtige reicht dir die Hand zur Freiheit, weise sie nicht hochmütig zurück! Alberico wird seine Mutter nicht lange in Gefangenschaft halten, auch sie wird bald wieder unter der Sonne Roms lustwandeln.
Am meisten lockt mich eine Hoffnung, die Marozia bereits andeutete: In Kürze wird eine Gesandtschaft aus Konstantinopel eintreffen, die eine Antwort bringt auf Marozias Angebot, ihre jüngste Tochter Berta dem zukünftigen Kaiser von Byzanz als Gemahlin zu geben. Könnte es nicht sein, daß mein Sohn Alexandros diese Gesandtschaft begleitet? Würde es nicht ihm – und mir – das Herz brechen, erführe er von unserem Schicksal und könnte nichts tun, als unverrichteter Dinge in seine Heimat zurückzukehren?
Die Kerzen flackern, die lähmende Kälte unseres Kerkers kriecht in meinen Körper wie ein Gift, das sich meiner bemächtigen möchte. Es gibt nur ein Gegenmittel: Ich muß meinen Blick zurückschweifen lassen in ferne Zeiten, muß mich wappnen und wärmen durch die Erinnerung an Tage des Glücks. Sie spenden uns Trost wie der thebaische Mohn, sie helfen, das undurchschaubare Schicksal hinzunehmen, die Ratschlüsse des Allmächtigen, die häufig ungerecht erscheinen, wie selbst Hiob, der Gerechte, erfahren mußte. Ich lasse die Tage des Verlusts und der Versklavung im tiefen Schatten meines Gedächtnisses, richte das Licht des Gedenkens auf die Wunder der Rettung und das Glück der Mutterschaft: Zweiundvierzig bewegende Jahre ist es nun her, daß kurz nacheinander mein eigener Sohn Alexandros und Marozia, mein Milchkind, zur Welt kamen.
Da ruhten sie in meinen Armen und tranken, die Augen selig geschlossen. Meine kleine Marozia, von mir häufig Mariuccia genannt, legte ihr Händchen auf meine Brust, streckte und beugte die Finger, als wolle sie mich kraulen. Später, als kleines Kind, strahlte sie, wenn ich sie anlächelte und hochnahm, und nicht nur mich begrüßte sie mit diesem Strahlen, auch ihre Eltern, die Kammermädchen, Diener und Wachen, sogar die Besucher des Hauses. Sie tollte mit den Hunden, streichelte die Katzen und sang mit den Vögeln. Nie scheute sie sich vor einer Berührung und genoß die Bewunderung all der Menschen, denen sie begegnete – ein dunkellockiges Engelwesen, das mit seinem lächelnden Liebreiz bereits als Kind Hof zu halten wußte. Als junge Frau verzauberte sie jeden, der in ihre Nähe trat, am meisten Alexandros, er sank vor ihr auf die Knie, und in federnder Anmut bewegte sich ihr Körper wie im Tanz.
Als ihre Amme, Kinderfrau und Lehrerin durfte ich Marozia nur selten verlassen, blieb ihre Vertraute und Beraterin in allen Lebenslagen, und gleichwohl stellt sie für mich bis heute ein Rätsel dar – das Rätsel der Sphinx? Die Liebe ist kein Instrument der Erkenntnis; vielleicht hat sie mich verblendet. Hätte ich Marozia nicht oft genug verurteilen müssen? Und doch ist sie Teil meines Herzens – nie werde ich aufhören, sie zu lieben, was immer auch geschieht.
Wer Marozia angeschaut mit Augen, ist der Sehnsucht schon anheimgegeben, dichtete einst Alexandros, wen der Pfeil der Schönen je getroffen, ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe – welch prophetische Worte!
Nein, ich werde sie nie verurteilen.
Neigen wir nicht ohnehin dazu, der Schönheit, gepaart mit Liebreiz, alles zu verzeihen? Erschreckt sie uns nicht zugleich, weil wir befürchten, daß ein Gott sich rächen wird mit Aussatz und Verfall? Bereits die griechischen Götter waren neidische Wesen; der christliche Gott übertrifft sie noch an herrischer Eifersucht. Gelegentlich denke ich, so wie Marozia sah Lilith aus, Adams erstes Weib, das Zauberwesen, das in die Hölle gestürzt wurde, um als Nachtgespenst, als Todesengel wieder aufzuerstehen.
Während ich schrieb, hatte sich Marozia erhoben, war vor der Wand stehengeblieben und zog mit einem Finger langsam eine Linie durch den Schimmel, der auf den schweren Quadern blühte. Schließlich wandte sie sich mit einem Ausdruck tiefen Bedauerns von der Kerkerwand ab und suchte meinen Blick.
»Weißt du, an wen ich denken muß?« fragte sie und wartete auf keine Antwort: »An deinen Alexandros, meinen Geliebten –«
Hatten sich meine Gedanken auf sie übertragen? Hatte sie einen Blick auf das Pergament geworfen und seinen Namen entziffert, obwohl sie Griechisch kaum lesen kann?
»Er hätte mich bis zum letzten Atemzug verteidigt. Wäre er in Rom geblieben ...«
»... hättest du ihn wahrscheinlich längst geheiratet, ich weiß«, fiel ich ihr ins Wort, selbst erschrocken über meinen barschen Ton.
Marozia blickte mich erstaunt an. »Ich hätte vor allem nicht Albericos Vater geheiratet.« Als wäre ihr eine Erkenntnis gekommen, unterbrach sie sich und schaute auf ihre Hände. »Ich habe in dem Sohn tatsächlich zu sehr den Vater gesehen. Er sah ihm ja auch so ähnlich: diese Löwenmähne und dann die beiden Grübchen auf den Wangen ... Wäre Alexandros nicht spurlos verschwunden, hätten wir seine Söhne aufziehen können, und alles wäre gut geworden.«
Ich starrte in eine Kerze, schwieg. Sie belog sich selbst; sie weiß genau, daß ihre Mutter Theodora eine Vermählung mit dem Sohn einer Sklavin nicht zugelassen hätte. Alles, was ihre Mutter tat, sollte Macht und Einfluß der Familie vergrößern – was bedeutete da schon die Liebe von Kindern!
»Ein Meer von Tränen haben wir um Alexandros vergossen«, fuhr Marozia nachdenklich fort, »aber keine Träne hat die Trauer um ihn gelindert. Ich mußte mich ablenken, wollte ihn vergessen und mein Heil anderswo suchen – und dennoch verging kaum eine Nacht, in der ich nicht von ihm träumte ... Weißt du das eigentlich?«
Nein, ich wußte es nicht und erwiderte nichts auf ihre Frage.
»Er streckt mir seinen Arm entgegen; wenn ich ihn ergreifen will, verwandelt sich sein Gesicht in eine abstoßende Fratze, und eine unsichtbare Macht zieht mich zurück. Kannst du mir sagen, warum er sich plötzlich verändert, welche Kraft mich daran hindert, seine Hand zu ergreifen, mich an seine Brust zu werfen und sein wahres Gesicht zu ertasten?«
Sie hielt inne und zog einen zweiten Strich durch den Schimmel, betrachtete dann ihren verschmierten Finger. »Warum ist er nicht längst nach Rom zurückgekehrt? Meine Mutter hat er doch seit Jahren nicht mehr zu fürchten. Nie werde ich ihr verzeihen, daß sie ihn davongejagt hat, als ich ihn am meisten brauchte.«
Sie schaute noch immer auf ihren Finger, rührte sich nicht, als wäre sie zu einer Salzsäule erstarrt. »Oder glaubst du, daß er tot ist?«
Ohne zu antworten, erhob ich mich und legte ihr tröstend den Arm auf die Schultern. Auf diese Weise tröstete ich mich auch selbst, denn Alexandros verbindet uns in Sehnsucht und Schmerz – und könnte uns trennen wie nichts anderes auf der Welt.
Beide standen wir am Eingang des tiefen Gangs, der in die Katakomben der Vergangenheit führt, und suchten zugleich das Licht am Ende des Labyrinths.
Bis heute verberge ich die Wahrheit in der dunkelsten Kammer meiner Seele: Vor langer Zeit mußte ich Alexandros wegschicken, bevor ein Dolch ihn traf. Nicht Theodora hat ihn verjagt, wie Marozia glaubt: Ich habe ihm die Flucht befohlen, um sein Leben zu retten. Es sind vierundzwanzig Jahre vergangen, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr habe ich gezählt.
Alles Schreckliche, was das Schicksal mir bisher beschert hat, konnte ich letztlich bejahen, doch seinen Tod hinzunehmen wäre ich nicht in der Lage. Die Angst, ich müßte den Fluß des Vergessens überqueren, ohne meinen Sohn wiedergesehen zu haben, schnürt mir die Kehle zu, läßt meine Hand nur noch zittrig schreiben. Nie darf mich diese Hoffnung verlassen – und mit ihr die Hoffnung, meine Heimat wiederzusehen: die Frühsonne über Konstantinopel, diese Woge rosigen Lichts, die sich über die erwachende Stadt ergießt, begleitet vom Gesang der Vögel, die in ihren Käfigen vor den Fenstern die Augen öffnen und sich nun gegenseitig von ihren Träumen erzählen, von der Sehnsucht nach einem grenzenlosen Himmel, in den sie sich schwingen können.
Kapitel 4
Ich weiß nicht, wie lange seit unserer Einkerkerung vergangen ist. In unserem Verlies gibt es keine Zeichen von Tag und Nacht, nicht einmal die Wärter kommen regelmäßig, so scheint es mir, um die Eimer auszutauschen und uns etwas zu essen zu bringen. Noch nie habe ich mich so wesenlos gefühlt, so im eigenen Dämmer gefangen, müde und trostlos. Marozia muß es ähnlich ergehen. Wir tigern durch unseren Kerker, stoßen aufeinander, fauchen uns an, gereizt und zugleich abgestumpft. Es gibt Momente, in denen wir nur noch schreien, um kurz darauf zusammenzubrechen. Dann sehen wir in der Entleibung den einzigen Ausweg: Wir könnten uns gemeinsam ein Messer in das Herz stoßen. Bereits beim nächsten Atemzug sprechen wir uns erneut Mut zu und versuchen, die Wut nicht gegen uns selbst zu richten, doch bald schon verursacht die lähmende Leere einen eisigen Schmerz. In diesem Zustand vermag ich mich nicht einmal aufzuraffen, mich über das Pergament zu beugen, das mir hilft, dieser nichtigen und zugleich bedrohlichen Gegenwart zu entfliehen.
Gestern kratzte ich wie eine Irre Buchstaben in die Wand: αταραξία – ataraxia. Ruhe des Gemüts. Trost und Seelenfrieden. Das Lächeln des Herzens. Alles ist gut, so wie es ist. Dein Körper umschließt dich wie ein Gefängnis, deine Seele indes kann niemand fassen und fesseln. Sie ist frei, mit dir hinaus ins Licht zu fliegen, zurück in das reiche Glück der Kindheit, nach vorne in den Morgen der Verheißung.
Leide und meide, ruft mir Epiktet zu.
Was soll ich meiden, rufe ich klagend zurück. Ich bin gemieden, bin abgesunken in den tiefsten Zustand der Meidung. Und dies nur, weil ich Marozia nicht verraten und allein lassen will.
Ich könnte frei sein, frei!
Dulde, mein Herz! Du hast eine härtere Kränkung erduldet, flüstert mir Odysseus ins Ohr.
Zehn Jahre Kampf um Troja, zehn Jahre irrfahrende Heimkehr! Und ich? Fast ein halbes Jahrhundert Leben als Sklavin in tiefster Erniedrigung und Trauer, doch auch in Luxus, Zufriedenheit und Augenblicken des Glücks.
Glück?
Das Wort klingt wie äußerster Hohn, betrachte ich die schwarzglänzenden Wände. Wir sind eingemauert wie Antigone – die Leidensgenossin. Vieles ist ungeheuer, doch nichts ist ungeheurer als der Mensch. Hat jemand etwas Wahreres gesagt? Und steht nicht auch bei Sophokles geschrieben: Wen Gott verderben will, verblendet er zuvor. O kleine, altgewordene Mariuccia – ereilt dich jetzt der Fluch der bösen Tat?
Ich kratzte weiter, bis der Stein sich erweichen ließ: αταραξία. Die Buchstaben starrten mich an, stumm und für kommende Generationen geschaffen. Das Wort wird bleiben, bis diese Gewölbe unter dem Gewicht der toten Seelen zusammenbrechen und nichts außer einem Ruinenhaufen zurücklassen.
Trotz der düsteren Gedanken erfrischte anschließend tiefer Schlaf unsere Seelen. Zärtlich strich ich nach dem Aufwachen über die Buchstaben im Stein, und tatsächlich gab es heute nicht nur besseres Essen, sondern auch einen Krug Wein und einen zweiten Eimer zum Waschen. Dafür fiepen die Ratten verstärkt, und Marozia fiebert leicht. Auf der Kopfhaut juckt es, und nicht nur da. Doch nach dem Waschen und dem Genuß des Weins fühlten wir uns beide deutlich wohler.
»Hugo wird einen Weg finden, uns hier herauszuholen.« Marozia hatte es sich, soweit dies möglich war, auf ihrer Pritsche bequem gemacht.
»Ich bin mir nicht sicher«, erwiderte ich leise.
»Es müßte ihm ein Leichtes sein, Römer zu bestechen, die uns aus der Engelsburg fliehen lassen. Vielleicht findet er auch willige Hände, die Alberico und seine Kumpane kalt ... stellen.«
Um Marozia auf weniger blutige Gedanken zu bringen, suchte ich verstärkt nach friedlichen Wegen des Ausgleichs und der Befreiung. »Du solltest Alberico rufen lassen und ihm erklären, daß du dich ins Kloster zurückziehst – und zuvor solltest du dich für deine womöglich nicht ausreichende Mutterliebe entschuldigen.«
Marozia zog die Augenbrauen hoch. »Er wird mich auslachen – ins Kloster! Und für die Mutterliebe ist es zu spät.«
»Für Mutterliebe ist es nie zu spät.« Mir traten Tränen in die Augen, die ich zu verbergen suchte.
»Außerdem bin ich verheiratet, und mein Gemahl lebt! Ich kann nicht einfach in ein Kloster gehen. Und glaubst du etwa, Hugo würde Rom und den Kaisertitel aufgeben, weil sein sich überschätzender Stiefsohn die römischen Adelsfreunde gegen ihn aufwiegelte? Er wird auf Rache sinnen und sie zerquetschen wie Läuse auf der Kopfhaut eines Bettlers.«
Sie kratzte sich unwillkürlich am Kopf, und ihre Lider zuckten. »Wenn ich wirklich diesen Kerker lebend verlassen sollte, werde ich das alte Spiel weitertreiben müssen.«
Eine Weile dachte sie nach, dann fuhr sie fort: »Meine Zeit ist abgelaufen, so oder so – deswegen solltest wenigstens du deine Freiheit suchen. Ich habe es dir bereits gesagt: Hier unten kannst du mir nicht mehr helfen.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Denk an Alexandros! Die kaiserliche Delegation aus Konstantinopel müßte mittlerweile eingetroffen sein: Du könntest unsere unschuldige Berta zum byzantinischen Hof begleiten, ihr die Mutter ersetzen – in deiner Heimat, Aglaia! Ich weiß, an wen deine Gedanken sich heften. Ob Alexandros die Gesandtschaft begleitet, weiß ich nicht, aber in Konstantinopel wirst du ihn sicher finden können. Und wenn du Bertas Kinder wiegst, wirst du an mich denken, an deine kleine Tochter ...«
Kapitel 5
Marozias Worte hören nicht auf, in mir nachzuklingen. Sie führen mich heim an die Gestade des Bosporus und des Marmarameers. Ich tauche in den Fluß des Erinnerns, in dem der teure Schimmer der versunkenen Dinge vorbeitreibt. Nicht nur, um mir die Stunden zu verkürzen, will ich die Seiten füllen. Es gibt ein wichtigeres Ziel: Damit mein Sohn dereinst, wenn er seine Mutter nicht mehr lebend antreffen sollte, wenigstens von ihr lesen kann, sollen die letzten Spuren meines flüchtigen Lebens zu schwarzen Schatten auf dem Pergament zusammenfließen.
Am Anfang unseres Lebens, so lehrt uns die Heilige Schrift, lebten die ersten Menschen im Paradies. Dies gilt für jeden von uns, noch immer: Das Paradies leuchtet uns aus unserer Kindheit entgegen, liegt in der Erinnerung an eine Zeit, in der jeder Tag ein Abenteuer war, voller Licht und Wunder.
Am Anfang meines Lebens war alles gut, und ich war glücklich. Die Sonne Konstantinopels erhob sich im Strahlenkranz, die Kuppeln der Hagia Sophia ragten, golden überstrahlt, in den blaßblauen Himmel, und in der Ferne winkte der Kaiserpalast mit seinen Wundern und Weihen. Der Duft der Goldorangen und Limonen durchzog die Luft unseres Gartens, die Zitronen blühten und die Myrten flossen über vor weißem Flor. Die sanfte Stimme meiner Mutter lockte, ermunterte und tröstete mich, das lichte Lächeln ihrer Augen wird mich ewig begleiten, selbst wenn ich nie mehr den Abenddämmer über dem Marmarameer, die Gerüche meiner Heimat, die helle Stimme meines Sohnes erleben werde. Je schwächer die Kerzen ihre unruhigen Lichter durch unser Verlies schicken, desto stärker flimmert das Spiegelbild des Mondes auf dem Bosporus – doch bald schon erhebt sich die Sonne wieder aus der Vereinigung von Himmel und Meer.
Geweckt werde ich durch den Gesang der Vögel, die mich vorsichtig aus meinen Träumen holen und mich in Freude und Neugier die Augen aufschlagen lassen. Jeder Morgen ist wie die Erschaffung der Welt, und der Tag eine nicht endende Entdeckungsreise. Vor unserer Loggia, in die ich singend trete, wiegen sich die Palmzweige und reichen mir die süßen Datteln. Neben den Säulen wächst der Lorbeer empor und umrahmt einen Feigenbaum, dessen Früchte kaum weniger süß sind. Gegenüber beugt sich ein Granatapfel mit seinem blutroten Fleisch.
Mein Vater nimmt mich auf den Arm und gibt mir einen Kuß, er reicht mich meiner Mutter, die umgeben ist von schwebenden und schwingenden Seidentüchern wie von Fittichen großer Traumvögel. Alle lächeln, lachen und necken mich. Selbst die Hunde scheinen lachend zu bellen und mich zu umspringen, die Katzen streichen an meinen Beinchen vorbei, und der kleine Singvogel pickt mir das Futter von den Lippen.
Später bahnen wir uns einen Weg durch die Labyrinthe der Gassen, in denen das Geschrei der Händler, Ausrufer und Kutscher sich bricht, an Ständen vorbei, in denen Duftwässer und Riechsalben, Schönheitspulver und würzige Kräuter verkauft werden, damit sich vor den Mauern des Kaiserpalasts eine Mauer der Wohlgerüche erhebe. Weihrauch umwabert uns, bis wir vor den geöffneten Flügeln des riesigen Portals stehen und in das Allerheiligste eintreten dürfen. Himmelragende Säulen und Marmor, der in allen Farben und Mustern schimmert, kostbare Gewänder und gedämpftes Stimmengemurmel. Wir werden zum Kaiser geleitet, der mich freundlich begrüßt und mir Naschereien in den Mund steckt. Ich rieche noch den Duft von Zeder und Aloë, sehe seine spitzen Finger, höre die hohe Stimme und lausche dem Gesang, der sich in den hohen Hallen bricht. Wir küssen die Ikonen, und später zeigt mein Vater dem Kaiser silberglänzende Teller, die er an alle Küsten der Meere verschickt, um so den Ruhm und Reichtum unserer Familie und des Reichs zu mehren, und der Kaiser überreicht ihm ein kostbares Gewand und eine Kette aus Gold.
Schon früh genieße ich es, mit meiner Mutter unter den Kolonnaden der Mese zu lustwandeln und durch die Läden zu schlendern, in denen Seidentücher und Elfenbeinschnitzereien verkauft werden. Ermüden wir, lassen wir uns in einer Sänfte zu den Bädern des Zeuxippos tragen, wo die reichen Damen sich treffen, um die wichtigen Neuigkeiten und den letzten Klatsch auszutauschen.
In den Stunden, in denen draußen die Hitze glüht, liebe ich auch, mich im kühlen, winddurchhauchten Raum mit einem Lehrer über die Buchstaben der Bücher zu beugen. Als ich älter wurde, sprach mein Vater mit mir über die Bedeutung von Recht und Frieden, die es ermöglichen, daß die Menschen in Fleiß und Erfindungsgabe sich entfalten, in Handel und Wandel dem Wohlergehen der Familie, der polis und des Reichs dienen und so den Wohlstand mehren können. Leider ziehe der Wohlstand auch Neid nach sich, räuberische Gier, doch gebe es kein besseres Mittel, Frieden und Recht zu erhalten.
Weil mein Vater kein Mann der Theorie war, sondern der Praxis, zeigte er mir, wie er seinen Wohlstand erschaffen hatte und am Leben hielt, er führte mich in die Werkstätten der Handwerker und ließ mir ihre Kunst vorführen, Keramikkrüge und silbergetriebene Teller zu schaffen. Anschließend sprach er über die Bedürfnisse der Menschen im Reich und darüber hinaus in den westlichen Ländern, nicht nur wie die Hunde aus einfachen Holztellern zu essen, sondern aus verziertem Ton und edlem Silber. Mein Vater ging sogar so weit, mir und meiner unersättlichen Wißbegierde die Grundlagen der Buchhaltung zu erläutern.
Natürlich wußte er, daß dies seiner Tochter nicht genügen würde, und so fand er Euthymides, einen bärtigen Griechen aus der Schule des Epikur, der mich Latein, dann auch Grammatik, Rhetorik und Dialektik lehrte, schließlich Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, der mit mir die Schriften der großen Schriftsteller las, Boëthius natürlich, Homer und Herodot, Aischylos und Sophokles, später auch Platon. Wir sangen die Lieder der Sappho, wanderten im Schatten der Säulengänge und sprachen über den Philosophen des Glücks. Ich liebte meinen Lehrer sehr, denn er war nie aus der gelassen lächelnden Ruhe zu bringen. »αταραξία, ataraxia, mein Kind, ist der eine Schlüssel zum Glück. Um Seelenfrieden und Gleichmut eines heiteren Gemüts zu erreichen, müssen die Schmerzen dich meiden, so schwer dies zu erreichen ist. Аπονία, aponia, ist also der zweite Schlüssel.«
»Wie erlange ich diese Schlüssel?« fragte ich ihn. »Durch Reichtum, wie mein Vater, oder durch Macht, wie der Kaiser? Durch ruhmreiche Siege auf dem Schlachtfeld, wie der kluge Stratege und der tapfere Schwertkämpfer?«
Euthymides schüttelte den Kopf, und ich sah, während ich ihn neugierig anschaute, ein paar seiner grauen Härchen in der Sonne leuchten. »Du wirst nie auf einem Schlachtfeld kämpfen, mein Kind, und ob du einen Kaiser heiratest, steht in den Sternen. Was den Reichtum angeht: Du hast keine Brüder, wirst also vermutlich das Vermögen deines Vaters erben. Aber Reichtum macht noch nicht glücklich – und schnell kann er verloren gehen.«
»Wie hast du sie denn erlangt, die ataraxia?« fragte ich. »Du bist nicht reich, bist nicht einmal ein freier Mann, sonst müßtest du dich nicht verdingen.«
»Ich bin so frei, wie ich mich fühle«, antwortete er mir und schaute mich lange an. »Einst lebte ich in Athen und steckte all mein Geld, das ich von meinen Vorfahren geerbt hatte, in ein Handelsunternehmen, in ein einziges Schiff, das seine Ware nach Venedig bringen sollte, Seide und Glas, Schmuck, Gewürze und Sklaven. Die Ladung versprach einen sagenhaften Gewinn.«
Ich werde nie vergessen, was mit dem Schiff, der Ladung und dem Gewinn geschah, mit dem Kapitän, den Ruderern, Schiffsjungen und Sklaven. Sie fielen einem sarazenischen Seeräuberboot in die Hände. Euthymides hatte alles verloren. Er beendete seine Erzählung durch einen Satz, der sich mir tief einprägte. Er sagte nur: »Und dann war ich frei.«
»Frei?« antwortete ich skeptisch.
Lächelnd fügte er an: »Weißt du, welchen Rat Epikur seinen Schülern gab, wenn sie mit ihm im schattigen Garten lustwandelten und den Weg zur Weisheit suchten? Λαθε βιωσας, lathe biosas, lebe im Verborgenen, meide den Jahrmarkt, das Schlachtfeld und die Tauschbörse des Lebens, meide die Paläste und Hinterzimmer der Macht. Der Garten ist der Ort des Glücks, und gute Freunde sind seine Gärtner.«
Kapitel 6
Als ich zu einer jungen Frau herangewachsen war, erhielt mein Vater den Auftrag des Kaisers, eine Gesandtschaftsreise nach Rom zu unternehmen. Er belud eines seiner Schiffe mit den schönsten Waren und außerdem mit wertvollen Geschenken des Kaisers. Er befand, ich sei nun alt genug, mehr von der Welt zu sehen als unsere Villa und die Straßen von Konstantinopel. Meine Mutter wollte uns nicht alleine reisen lassen.
Beim Abschied von Euthymides flossen die Tränen. Er allerdings blieb gelassen und drückte mich an sein Herz. »Was immer auch geschieht«, flüsterte er mir zu, »vergiß meine Lehren nicht. Ich werde bei dir sein.«
Bald segelten wir, begleitet und geschützt von einer Dromone, durch das gleißende Licht der Ägäis. Abends ankerten wir in einem belebten Hafen der Kykladen. Als hätten sie mich gestern umfangen, erinnere ich mich noch an die Nächte im sanften Schaukeln der Wellen, die Weltenschöpfung am Morgen und schließlich an den Gesang der Ruderer vor dem letzten ungetrübten Sonnenuntergang.
Bevor wir die Meerenge von Messina durchsegelten, traf uns ein heftiger Sturm, der den Mast der Dromone brach. Mein Vater wollte nach Abflauen des Unwetters nicht auf unseren Begleitschutz warten und auch dessen Ruderern nicht zumuten, den restlichen Weg nach Rom in den Riemen zu liegen, und so ließen wir das Schiff den nächsten byzantinischen Hafen ansteuern und segelten allein weiter.
Wir durchpflügten das tyrrhenische Meer, als sich ein unbekanntes Segel über den Horizont schob. Mein Vater wurde bleich und ließ die Ruder aufnehmen. Dennoch kam das fremde, schlanke Schiff näher. Wie wir bald erkannten, trug es keine Waren und Geschenke, nur Männer in Waffen, und diese näherten sich uns offenkundig nicht in friedlicher Absicht. Schwerter blitzten in der Sonne, erste Pfeile zischten in das Wasser oder blieben mit einem dumpfen Laut im Rumpf des Schiffes stecken. Wir, die wir bisher unbehelligt durch die Frische klarer Sonnentage gesegelt waren und den Sturm überstanden hatten, mußten der Heimsuchung der Meere begegnen – und obwohl die Ruderer vor gehetzter Anstrengung keuchten, gelang uns nicht die Flucht. Der Blick meines Vaters verdüsterte sich, und als er mich und unsere Mutter in den Arm nahm, um uns die Angst zu nehmen, lächelte er in panischem Leid.
Die sarazenischen Seeräuber hatten unser Schiff bald eingeholt und begannen es unter dem heiserem Geschrei von Allahu akbar zu entern. Sofort entstand ein Gewimmel aus blitzenden Klingen und drohenden Fäusten. Mit ihren barbarischen Lauten sprangen immer mehr Angreifer an Deck. Unsere kleine Soldatenschar, die dem Schutz der Menschen und Waren dienen sollte, kämpfte, angeführt von meinem Vater, mit dem Mut der Verzweiflung, mit der Tapferkeit der Treue, doch hatte sie keine Chance. Manche Männer wurden kurzerhand über Bord gestoßen, andere sanken nieder, durchbohrt von spitzen Klingen, im erwürgten Schmerzensgebrüll. Die Sarazenen schrien sich Mut zu, und ihre Wut steigerte sich, als einige von ihnen fielen.
Ich sah ihre Augen begehrlich auf meine Mutter und mich gerichtet, auf die Truhen mit den Keramik- und Silbertellern, den Goldschmiedearbeiten und Duftwässern und den verschnürten Ballen mit ihren kostbaren Stoffen. Dem ersten, der sich mir näherte, schlug mein Vater die Hand ab, das Schwert klirrte zu Boden, mir vor die Füße, und ich bückte mich blitzschnell, um es zu ergreifen.
Zum ersten Mal in meinem behüteten Leben hatte ich die Städte und Gewässer meiner byzantinischen Heimat verlassen – und schon begegnete uns die Geißel der Meere. Unserem Schiff erging es so wie dem Schiff meines Lehrers. Hätte ich kämpfen – oder mich entleiben sollen, um dem zu erwartenden Schmerz, der untilgbaren Schande zu entgehen? Ich konnte mich nicht entscheiden und unterließ beides – zu Recht! Lag mein Schicksal nicht in der Hand eines Gottes, dessen Ratschlüsse unerforschlich sind? Hatte nicht mein griechischer Lehrer den Philosophen zitiert, daß niemand vor seinem Tode glücklich – aber auch nicht unglücklich – zu schätzen sei? Hatte nicht Epiktet geschrieben, daß unsere Gegner nur unserem Körper schaden können, nicht der unsterblichen Seele, vorausgesetzt, sie folgt den labyrinthischen Wegen des Schicksals, ohne sich aufzulehnen?
Der dunkelhäutige Sarazene starrte einen Moment auf seinen Armstumpf, bevor er bewußtlos niedersank. Mein Vater starrte nicht minder entsetzt auf das, was er angerichtet hatte – da traf ein Schwert die Fibel, die seinen Umhang auf der Schulter zusammenhielt, zum Glück, denn sie rettete ihn vor einem sofortigen Tod. Er torkelte zur Reling, wich dort so unglücklich – oder glücklich – einem weiteren Stoß aus, daß er rückwärts über Bord kippte.
Als mehrere blutverschmierte Hände nach mir griffen, wehrte ich mich kaum. Unter gierigem Brüllen wurde meine geliebte Mutter zu Boden gedrückt, die Hände über dem Kopf gefesselt. Als sie einige Worte auf Arabisch herauspreßte, warfen sich ihre Peiniger einen erstaunten Blick zu, um dann in Gelächter auszubrechen. Die letzten Verteidiger des Schiffs wurden überwältigt und hektisch unter erneutem Anrufen des angeblich so unbesiegbaren arabischen Gottes am Segelmast aufgeknüpft, Todesschreie gellten herüber. Einige unserer Ruderer versuchten sich mit einem beherzten Sprung ins Wasser zu retten. Die Sarazenen schickten ihnen Pfeile nach.
Ich wurde an einen Stoffballen gedrückt, in dem sich Seide aus Byzanz für den Heiligen Vater befand, und spürte die Hände, die an meiner Kleidung zerrten. Was ich noch heute in unvergeßlicher Deutlichkeit sehe, ist ein starres, totes Auge und ein behaarter Handrücken mit einer breiten Narbe.
Wir schrieben das Jahr des Herrn 887, ich war damals achtzehn Jahre alt – ich kannte die Verse Homers und die Dramen des Sophokles, ich sang wie Sappho, beherrschte das Trivium und das Quadrivium, war neugierig auf die Welt, von der ich, bevor ich mich einem Ehemann hingab, etwas sehen sollte und wollte – Seide riß, die perlenbestickte Seide meines eigenen Gewands, nicht weit entfernt meine Mutter ...
Ich schloß die Augen, weil ich vom bloßen Anblick zu sterben glaubte.
Doch man stirbt nicht vom Schauen, man stirbt auch nicht vor Scham, nicht einmal vom Ertragen der Schande. Mein Körper, entblößt, rutschte über die glitschigen Planken. Triumphierendes Johlen ging in fletschendes Knurren über – es war, als wollte man mir meine Glieder nach allen Seiten auseinanderreißen ... Ich spürte einen Schmerz, der wie die Spitze eines Dolchs in mich eindrang und sich dann wie ein aufloderndes Feuer ausbreitete ... Alle Geräusche rückten in eine aufsaugende Ferne, der Schmerz zog sich zusammen, erbrach sich pulsierend, schien an sich selbst zu ersticken – und ich verlor das Bewußtsein.
Noch heute bedrängen mich die Erinnerungen an diese dunkelste Stunde meines Lebens und, überlagert von anderen dunklen Stunden, verwischt und aufgehellt von Glücksmomenten, verschwimmen sie wie hinter einem purpurroten Vorhang, der teils einem schweren Brokatstoff, teils durchsichtiger Seide gleicht – sogar heute und hier in der Gruft der Engelsburg, katakombentief, rattenverseucht, seufzerschwer, drängen sie mich, niedergeschrieben und festgehalten zu werden, um so ihre Schrecken zu verlieren. Sie sind der Schatten, der sich über das Licht der Kindheit gelegt hat. Sie zeigen das Unglück, durch das ich das Glück zu messen in der Lage bin.
Fünfundvierzigmal wiederholte sich der Tag meiner Geburt seitdem, ein Wunder, daß ich die Höhen und Tiefen eines stürmischen Lebens durchschreiten konnte, ohne unterzugehen in seinen fauchenden, aufheulenden Winden, in seinen wild aufschäumenden Wogen. Immer wieder stand ich am Eingang zu der Welt des Vergessens – doch unser Schöpfer ließ mich nicht eintreten. Er will, daß ich das Unglück bestehe, sogar bejahe, er will, daß ich sage: Und siehe, es war gut.
Damals, auf unserer Reise nach Rom, mußte ich dem Bösen in seiner unverfälschten Form begegnen: Noch spüre ich die Narbe, aber seit langem schmerzt sie nicht mehr. Die Wunde, die man mir riß, verheilte, wenn auch in mir ein Gefühl abgetötet wurde, das Frauen, so weiß ich von Marozia und ihrer Mutter Theodora, bis in den Wahnsinn treiben, das sie vor Glück schreien und vor Unglück sterben lassen kann. Ich vermag keine Lust mehr zu spüren, keine Wollust in den Gliedern und auf der Haut, kein Begehren nach Verschmelzung und Vereinigung. Statt dessen vermag ich Liebe zu verströmen: Liebe, die ich meinem Sohn Alexandros schenkte und meinem Milchkind Marozia, Mariuccia, Mariechen, der Herrscherin Roms, der Königin Italiens, die an meiner Seite sitzt und, gezeichnet vom niederschmetternden Geschehen der letzten Tage, auf meine Schreibfeder schaut, ohne die griechischen Buchstaben entziffern zu können, die ich schreibe.
Ich atme tief durch und lächle sie an, und sie lächelt zurück. Für einen Augenblick sehe ich den alten Liebreiz, sehe im tiefen Schatten des Unglücks einen Funken letzter Hoffnung aufglimmen.
Kapitel 7
So klar mir die Kaperung des Schiffes noch vor Augen steht, so unscharf werden die folgenden Jahre. Mein Leben schien zerstört, wie ein Bild, das in tausend Einzelteile zerschlagen wurde – und doch entwickelte sich ein neues Bild, ein Mosaik, mit tausend feinen Rissen.
Irgendwann fiel die Nacht über unsere Schiffe, eine Nacht, in der ich aus einem Schmerz bestand, der wie ein halbgelöschtes Feuer glühte, immer wieder aufflackerte, um schließlich in sich zusammenzusinken. Vermutlich waren es nur die Wellen der Ohnmacht, die mich erlösten – bis tatsächlich mehrere Eimer Wasser die Glut löschten. Über mir sah ich einen schwarzbärtigen Mann aufragen, der anderen etwas befahl. Ich wurde aufgerichtet, mit Seide bedeckt, die aus den Ballen gerissen wurde, und auf ein Lager gebettet, das weich mit Stroh und Wollstoffen ausgepolstert war.
Den nächsten Tag verbrachte ich im gedämpften Licht einer Zeltplane. Ein Mann, vielleicht ein Arzt, setzte mir eine Schnabeltasse an die Lippen, versorgte meine Wunden mit einer Salbe und gab mir etwas zu essen. Ich fiel erneut in tiefen Schlaf, aus dem mich der Mann weckte, der die unaufhörliche Schändung meines Körpers beendet hatte. Schnell begriff ich, daß es der Kapitän des Schiffes war und daß ich sein Eigentum sein sollte. Eine gewisse Erleichterung ergriff mich, die sich verstärkte, als er mich anlächelte.
»Umm?« stieß ich als ersten Laut aus. Er mußte ihn verstehen, es war das Wort für Mutter in Arabisch, so wie ich es zu Hause gehört hatte. Der Mann lachte und sagte dann etwas, was ich nicht verstand.
»Wo ist meine Mutter?« fragte ich flehend. »Ist sie noch am Leben?«
Lachend zeigte er auf sich.
Nachts mußte ich ihm zum ersten Mal zu Diensten sein. Bewundernd, so schien es mir, schob er seine Hand über meinen Körper, als sei ich eine Skulptur des Praxiteles. Ich versuchte, die Schmerzenslaute zu unterdrücken, was mir nicht gänzlich gelang. So befriedigte er sich schnell und schickte dann wieder den Arzt zu mir.
Während der zweiten Nacht, als der Kapitän schnarchend neben mir lag, schlich ich aus unserem Zelt und wollte meine Mutter suchen. Trotz des Mondscheins stolperte ich über ein Bündel Kleiderfetzen; schon wurde ich gepackt und zurück in das Zelt gestoßen.
Am nächsten Tag erreichten wir einen Hafen an der Flußmündung des Garigliano, wie ich später erfuhr. Dort konnte ich meine Mutter erspähen, die mit den überlebenden Ruderknechten in die Sklaverei verkauft werden sollte. Ich rief ihr etwas zu, was sie zusammenzucken und sich umdrehen ließ, winkte heftig. Ihr Gesicht war kaum wiederzuerkennen: blauschwarz, geschwollen, verdreckt. Als man sie vorwärtsstieß, bedeckte sie es mit dem Tuch, das sie über den Kopf geschlagen hatte. Wie Vieh wurden die Gefangenen zu einem staubigen Platz getrieben und eingepfercht.
Es war das letzte Mal, daß ich meine Mutter erblickte. Der Schmerz, den mir ihr Verschwinden bereitet, läßt nicht zu, daß ich an ihren Tod glaube. Alle Wahrscheinlichkeit sagt mir, daß sie ihr geschundenes Sklavinnendasein nicht lange überleben konnte – und doch gibt es noch heute Augenblicke, in denen ich hoffe, sie lebend in die Arme schließen zu können.
Während der nächsten Wochen blieb Yussuf, mein Kapitän, im Lager am Garigliano. Es dauerte eine Weile, bis die Waren und Sklaven weitergegeben oder verkauft waren, das Schiff mußte neu ausgerüstet werden, und außerdem zog er mit seinen Männern und einer weiteren Truppe auf Beutezug in Richtung Rom. Ich hatte zwar bereits gehört, daß die Sarazenen nicht nur die Schifffahrt bedrohten, sondern sich sogar südlich von Rom festgesetzt hatten, um die Ländereien im mittleren Italien auszurauben und die ewige Stadt zu umlauern. Wie fern war dies alles in unserer heimatlichen Villa, während ich Lieder der Sappho sang. Mein Vater hatte nie davon gesprochen, daß eines seiner Handelsschiffe bedroht oder gar aufgebracht worden war – vermutlich hatte ihm bis dahin das Glück gelächelt, sonst hätte er uns nicht mit auf die lange Seereise genommen und wäre schon gar nicht ohne den Schutz der Dromone weitergesegelt.
Während Yussuf Dörfer und Gehöfte ausraubte, blieb ich im Lager am Garigliano, mißtrauisch und zugleich gierig umschlichen von den Männern, die es bewachten. Yussufs Stellung hielt sie davon ab, sich an mir zu vergreifen, aber an Flucht war nicht zu denken.
Tage später kam der Beutetrupp, reich beladen, ins Lager zurück, und wir schifften uns nach Tunis ein. Jede Nacht bestieg Yussuf mich wie der Hengst seine Stute, und ich befürchtete, schwanger zu werden. Zum Glück blieben meine Befürchtungen unbegründet.
Ich weiß heute nicht mehr, was ich tagsüber tat. Ich erinnere mich nur noch daran, daß ich die Stellen aus den Gesängen Homers, die ich auswendig wußte, leise vor mich hinsummte, während das Schiff träge durch die stumme Meereswüste glitt, die Männer schliefen oder mit Knöchelchen würfelten. Yussuf hörte mir einmal heimlich zu, als ich, an der Reling stehend und übers Meer schauend, Odysseus’ Sirenenabenteuer den Wellen zurief. Plötzlich tauchte ich in Schwärze: Yussuf hielt mir die Augen zu und drückte mich ungewohnt sanft an sich.
Noch immer konnten wir uns nicht verständigen. Ich weigerte mich, Wörter seiner Sprache zu sprechen, obwohl ich mittlerweile das eine oder andere verstand, und er wurde ärgerlich, wenn ich Griechisch oder Latein sprach. Er flüsterte mir einige Worte ins Ohr und schob gleichzeitig seine Hand unter den Mantel, den ich von ihm erhalten hatte, als wolle er fühlen, ob ich schwanger sei. Ich verstand nur Alf Laila und dann noch Schehrazad. In der folgenden Nacht erkannte er mich nach der Art der Christen und ließ sogar seine Zunge mit meinen Ohrläppchen spielen.
Obwohl Sarazene und beutegieriger Räuber, der meine Eltern auf dem Gewissen hatte – aber fühlte er überhaupt so etwas wie ein Gewissen