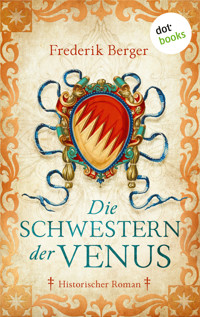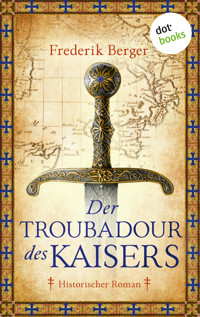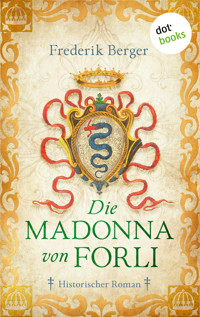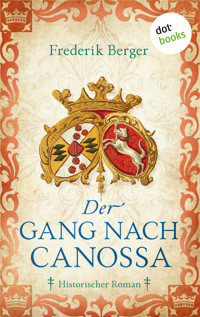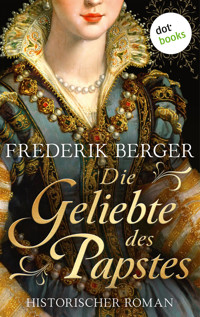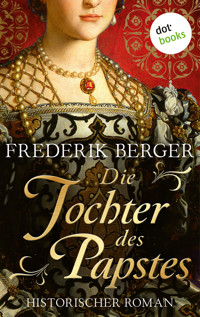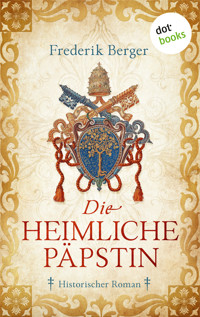5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Siegel der Farnese
- Sprache: Deutsch
Eine große Liebe in stürmischen Zeiten: Der opulente Historienroman »Die Kurtisane des Papstes« von Frederik Berger jetzt als eBook bei dotbooks. Rom zur Zeit des 16. Jahrhunderts: Der neu ernannte Papst Paul III. Farnese will die Kirche mit strenger Hand regieren – und deshalb schreckt er vor nichts zurück und belegt die früheren Exzesse und die Verschwendungssucht der Ewigen Stadt mit seinem Bann. Die immer strenger werdende Moral bekommt vor allem die betörende Kurtisane Lucrezia zu spüren, die über florierende Bordelle herrscht und deren Einfluss bis in den Vatikan reicht. Noch dazu bringt ihre Liebe zu Alessandro, dem Enkel des Papstes, sie zunehmend in Gefahr – und ins Visier des so skrupellosen wie fanatischen Kardinals Carafa. Während in Rom die ersten Scheiterhaufen der Inquisition entzündet werden, kämpft Lucrezia verzweifelt um ihre Liebe – und ihr Leben: Droht auch ihr der Feuertod? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der prachtvolle historische Roman »Die Kurtisane des Papstes« von Frederik Berger ist der dritte Teil seiner Romantrilogie über den Aufstieg der Farnese zu den unangefochtenen Herrschern Roms und kann unabhängig von den Vorgängern gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom zur Zeit des 16. Jahrhunderts: Der neu ernannte Papst Paul III. Farnese will die Kirche mit strenger Hand regieren – und deshalb schreckt er vor nichts zurück und belegt die früheren Exzesse und die Verschwendungssucht der Ewigen Stadt mit seinem Bann. Die immer strenger werdende Moral bekommt vor allem die betörende Kurtisane Lucrezia zu spüren, die über florierende Bordelle herrscht und deren Einfluss bis in den Vatikan reicht. Noch dazu bringt ihre Liebe zu Alessandro, dem Enkel des Papstes, sie zunehmend in Gefahr – und ins Visier des so skrupellosen wie fanatischen Kardinals Carafa. Während in Rom die ersten Scheiterhaufen der Inquisition entzündet werden, kämpft Lucrezia verzweifelt um ihre Liebe – und ihr Leben: Droht auch ihr der Feuertod?
Über den Autor:
Frederik Berger (geboren 1945 in Bad Hersfeld) studierte Literatur- und Sozialwissenschaften und lebte einige Zeit im englischen Cambridge und in der Provence. Er arbeitete als Literaturwissenschaftler und Journalist, bevor er hauptberuflich Schriftsteller wurde. Neben Gegenwartsromanen, Sachbüchern und zahlreichen Aufsätzen verfasste er verschiedene historische Romane über den Glanz und die Schatten europäischer Adelsfamilien. Frederik Berger reist viel und ist begeisterter Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Schondorf am Ammersee.
Die Website der des Autors: www.frederikberger.de
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/fritzgesing/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine historische Romantrilogie »Das Siegel der Farnese« mit den Bänden »Die Geliebte des Papstes«, »Die Tochter des Papstes« und »Die Kurtisane des Papstes«. Außerdem erschienen seine opulenten historischen Romane »Die heimliche Päpstin« und »Die Provençalin«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Dieses Buch erschien bereits 2013 unter dem Titel »Die Liebe der Kurtisane« bei Rowohlt.
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Roberto Castillo und eines Gemäldes von Girolamo da Capri »Bildnis einer Dame«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-879-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Kurtisane des Papstes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Frederik Berger
Die Kurtisane des Papstes
Historischer Roman – Das Siegel der Farnese 3
dotbooks.
Für Patricia
Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut,dass der Mensch alleine sei;
ich will ihm eine Gehilfin machen,die um ihn sei.
(Genesis 2,18)
Omnia vincit Amor et nos cedamus Amori.
Alles besiegt der Gott der Liebe,also wollen auch wir uns ihm fügen.
(Vergil, Ecloga X)
Prolog
Rom, Tor di Nona, im Dezember 1558
Mein Liebster,
ich flehe dich an: Befreie mich aus diesem Albtraum!
Vor ein paar Tagen wurde ich auf der Piazza Navona in aller Öffentlichkeit von den Bütteln des bargello angehalten, beschimpft, geschlagen und gefesselt. Sie schleppten mich anschließend zum Tor di Nona und warfen mich in den düstersten Kerker, ohne wärmende Kleidung, ohne Wasser und Brot. Erst als Marta fünfzig scudi brachte, wurde mir ein bequemerer Raum zugestanden, ordentliches Wasser, Stroh und eine Mahlzeit. Nun sitze ich hier und darf dir schreiben. Auch das Blatt Papier lassen sich die Wärter bezahlen, als müsse es mit Gold aufgewogen werden.
Meine Hand zittert, denn mir droht im schlimmsten Fall die Todesstrafe – durch den Strick oder sogar auf dem Scheiterhaufen. Was habe ich nur getan? Der Liebe einen Schutzraum gewährt! Kann dies Unrecht sein?
Mein Liebster, ich flehe dich an: Eile nach Rom und befreie mich aus diesem Rattenloch! Wie viele Unschuldige hat man schon zu falschen Geständnissen gezwungen, indem man sie der Folter unterwarf ... Wie viele Todgeweihte bangten, gebrochen und bis aufs Blut gepeinigt, in schaudernder Angst der Stunde entgegen, in der sie vor ihren letzten Richter treten mussten!
Bereits als junges Mädchen habe ich das Schlimmste erdulden müssen. Auch später noch, du weißt es, wurde ich erniedrigt und gequält. Die Kehle schnürt sich mir zu, wenn ich daran denke, was mir drohen könnte. Die alten Dämonen kehren wieder, ich kann mich ihrer kaum erwehren, wie Abgesandte der Hölle greifen sie nach mir, wollen mich hinabziehen ...
Ich bete, dass dich meine Zeilen erreichen! Gedenke der Liebe, die uns stets verbunden hat! Ich weiß, dass dich der Ehrgeiz treibt, endlich das große Ziel zu erreichen, das du seit Jahren anstrebst. Auch du hast verzichten müssen – dafür wirst du belohnt werden, wenn es denn einen gerechten Gott gibt.
Und es kann nur einen gerechten Gott geben.
Mein Liebster, lass nicht zu, dass ich alles verliere, was mir in diesem Leben geblieben ist. Ich bin Opfer einer wahnhaften Verfolgung geworden, die unser ehrwürdiges Rom wie eine Seuche heimsucht. Dabei habe ich noch immer nicht die Hoffnung verloren, dass uns beiden die Gnade der erfüllten Liebe gewährt werden könnte.
Mein Liebster, lass mich nicht im Stich!
Immer die deine – Lucrezia
TEIL I
Die Dämonen
Kapitel 1
Rom, Villa Diana, April 1535
Der Morgen begann schon zu dämmern, als Lucrezia die letzten Gäste am Portal ihrer Villa mit einem vielversprechenden Lächeln verabschiedete. Ihr bedeutendster Gast, Papst Paul III. Farnese, hatte sich bereits früher zurückgezogen – immerhin hatte er Lucrezia die Ehre seines Besuchs erwiesen und sogar ihr Haus geweiht, mitsamt dem kunstvoll angelegten Garten, der sich bis zum Tiberufer erstreckte. Zahlreiche Gäste gehörten zu seinem Gefolge, insbesondere sein Enkel, der frischgebackene Kardinal Alessandro Farnese, und seine jungen Freunde, aber auch weitere, ältere Kardinäle, nahezu alle in weltlicher Tracht. Hinzu kamen Männer aus den besten Adelsfamilien der Stadt, Roms Philosophen und Literaten, reiche Kaufleute und banchieri, Botschafter aus Frankreich und Venedig, Florenz und den Ländern nördlich der Alpen.
Die jungen Mädchen, die Lucrezia zu Perlen ihres Berufs ausbildete und die bereits für sie arbeiteten, hatten nicht ausgereicht, all die anspruchsvollen Gäste mit Gesang und Flötenspiel, Tanzvorführungen und Stegreifeinlagen sowie kluger Konversation zu unterhalten. Lucrezia hatte daher noch einige ihrer Kolleginnen und Konkurrentinnen eingeladen: Die meisten waren in teuerster, tief ausgeschnittener Robe erschienen, keine ohne Gefolge, manche süßlich gratulierend, andere spitzzüngig, alle voller Neid und Bewunderung.
Lucrezia Onesta Aretina, von ihren Bewunderern La Luparella, die Wölfin, genannt, hatte es geschafft.
Sie war die schönste und teuerste Kurtisane der Stadt, größer als die meisten ihrer Kolleginnen und zugleich schlanker, aber blond wie alle, mit hochstehenden Wangenknochen und weiten Augen unter sanft gewölbten Brauen, einer schmalen Nase und einem starken Kinn. Das Verführerischste an ihr war jedoch ihr Lächeln, das Unschuld mit magischer Lockung verband, sowie ihre Stimme, die noch samtiger und zugleich rauchiger klang als die Stimme ihrer Mutter Diana und die aus den Tiefen ihrer vollen, wohlgerundeten Brust hochstieg, um in einem hellen Springbrunnenlachen zu enden.
Obwohl erst zwanzig Jahre alt, hatte Lucrezia bereits einige Häuser gekauft, die meisten in der Nähe des Ponte Sisto und des Palazzo Farnese. In dem am schönsten gelegenen Haus, der weiträumigen Villa Diana, lebte und arbeitete sie selbst, in den anderen arbeiteten ihre Mädchen.
Endlich hatte Lucrezia ihr Portal an der Via Giulia schließen können. Sie rief nach Mansueto, ihrem Mastino Neapolitano. In weiten Sätzen sprang er heran und schmiegte seinen mächtigen Kopf an ihre Hüfte. Er war ihr Liebster. Bereits als Welpe hatte er immer ihre Nähe gesucht. Kürzlich war seine Mutter Rabbia gestorben, die wegen ihres leicht reizbaren Verhaltens einige ihrer Kunden verschreckt hatte und daher immer eingeschlossen werden musste. Vermutlich hatten die Erlebnisse während des acht Jahre zurückliegenden sacco ihr von Natur aus gutmütiges Temperament verändert. Die Eroberung und Plünderung durch die Söldner des Kaisers hatten Rom in Trümmern zurückgelassen und alles verändert, nicht nur das Verhalten der Hunde, sondern auch der Menschen – derjenigen, die das Glück hatten, die apokalyptischen Tage zu überleben.
Mansueto, so stark er war mit seinem grauen Kopf und einem Gebiss, das jeden Knochen zermalmte, ließ sich im Gegensatz zu seiner Mutter selten aus der Ruhe bringen. Die Liebe zu seiner Herrin war unerschütterlich. Nur selten gab er Laut: ein tiefes Grollen, das in schärferem Knurren oder in heiserem Bellen enden konnte. Aber ihm entging nichts. Solange er seine Herrin in Sicherheit wähnte, blieb er friedlich, ließ sich ohne Protest wegschicken, wenn sie Besuch empfing. Doch wehe, jemand näherte sich ihr in feindlicher Absicht!
Lucrezia schlenderte zum cortile, dem säulengesäumten Innenhof ihrer Villa, in dessen Mitte ein Springbrunnen plätscherte. Unter der Aufsicht Martas, ihrer alten Amme und Vertrauten, wurden die gröbsten Folgen des Fests beseitigt. Zu Bett würde heute niemand mehr gehen, es sei denn, um sich dort der – in dieser Nacht besonders teuren – Liebe hinzugeben. Für diesen Fall waren im Gästetrakt der Villa einige Zimmer gerichtet. Wer sonst noch zu später Stunde aus den Honigtöpfen naschen wollte, hatte die paar Schritte zu den Häusern der Mädchen zu gehen oder sich mit den Kolleginnen auf den Weg zu machen.
Hinter dem Geviert des Haupthauses umfassten zwei Flügel einen Hof und führten in den Garten. In diesen Flügeln befanden sich Speicherräume und eine Werkstatt, war der Pferdestall untergebracht, stand Lucrezias neu erworbene Kutsche, ein Prachtstück und wahrhaft nicht billig.
Leichter Nebel war vom Tiber hochgezogen und verwandelte den leicht abschüssigen Garten mit seinen buchsgesäumten Wegen und den bereits blühenden Narzissen, den duftenden Hyazinthen und Veilchenrabatten in ein Feenreich.
Trotz der Morgenkühle spazierte Lucrezia mit Mansueto an der Seite zum Tiberufer, zu ihrer antikengeschmückten Säulenloggia. Hier träumte sie in ihren Ruhestunden über den Fluss hinweg, dankte dem gnädigen Gott für ihren Erfolg und versuchte, die vergangenen Heimsuchungen zu vergessen.
Im Wasser spiegelte sich eine weitere Loggia, die am gegenüberliegenden Ufer stand, und hinter ihr, durch die kahlen Äste der mächtigen Platanen halb verborgen, erhob sich die schönste Gartenvilla der Stadt, vor gut zwanzig Jahren von dem banchiere Agostino Chigi erbaut und von Raffaello Sanzio und seinen Schülern wie Kollegen mit Fresken geschmückt, ein stein- und bildgewordener Hymnus an die Liebe – seit Lucrezias Kindheit war diese villa d’amore das Wunschbild ihrer Träume. Mittlerweile war die Villa, fünfzehn Jahre nach dem Tod des reichsten aller römischen banchieri, selten bewohnt, und der Park verwilderte – mit der Folge, dass die Familie Farnese ein Auge auf sie geworfen hatte. Gerüchte gingen um, der kürzlich frisch ernannte Kardinal Alessandro Farnese interessiere sich für die Villa und beabsichtige, sie vom Geld seines päpstlichen Großvaters zu erwerben.
Einen besseren Nachbarn als ihn konnte sich Lucrezia nicht vorstellen. Der blutjunge Kardinal – er war erst vierzehn Jahre alt – hatte sich während des Abends bemüht, in seinem Brokatwams mit den enganliegenden Seidenstrümpfen und den goldbestickten Schuhen wie ein vollendeter gentiluomo auszusehen und ihr dabei die charmantesten Komplimente zuzuflüstern. Eigentlich hätte sie lachen müssen, aber natürlich reagierte sie mit gewinnenden Augenaufschlägen, samtigem Lächeln und scheinbar zufälligen Berührungen – vielleicht wuchs mit ihm ein neuer Kunde heran. Alessandro Farnese wirkte trotz seiner Jugend bereits männlich, seine großen dunklen Augen versprachen seelische Tiefe und warmes Mitgefühl, und mit den breiten, vollen Lippen mochte man in einem Kuss versinken. Auf jeden Fall schien er bereits jetzt schon über üppige Pfründe zu verfügen, denn könnte er sonst in Erwägung ziehen, die kostbar ausgestattete Gartenvilla zu kaufen?
Mittlerweise zogen die Preise für Häuser in Rom spürbar an, nachdem sie im Anschluss an die Verwüstungen des sacco in den tiefsten Keller gefallen waren. Dies hatte Lucrezia, beraten durch ihren leider in Venedig lebenden Vater und ihren bereits in jungen Jahren durch die europäischen Finanzzentren reisenden Halb- und Milchbruder Antonio, rasch begriffen. Alles verfügbare Geld und zudem noch geliehenes hatte sie in den Kauf von Häusern und hübschen Weingärten gesteckt. Der Wert ihrer Liegenschaften war mittlerweile um ein Mehrfaches gestiegen, sodass sie jetzt noch leichter an Kredite kam. Für ihr Alter hatte sie es schon sehr weit gebracht – und sie war noch längst nicht am Ende ihres Wegs!
Lucrezia ließ sich auf einer steinernen Bank nieder. Hinter ihr glänzte im sanften Marmorweiß eine Diana-Skulptur, die man kürzlich bei Ausgrabungen in ihrer vigna, ihrem Weingarten auf dem Monte Palatino, gefunden hatte. Die guterhaltene Figur aus der großen Zeit römischer Kaiser war Gold wert, und es gab genügend Männer, die sie um das Kunstwerk beneideten und es ihr abkaufen wollten. Aber sie verkaufte es nicht – die nackte Göttin der Jagd hatte es ihr angetan. Ein leicht gedrehter Körper, ein erstaunter Blick, ein feines Lächeln – Lucrezia strich mit ihrer Hand über den Arm und die Wölbungen der Hinterbacken. Sie hatte schon zahlreiche junge Frauen nackt gesehen, aber so vollkommen, so vielversprechend geformt wie diese Marmorskulptur war keine gewesen.
Mansueto legte seinen Kopf auf ihren Fuß. Sie streichelte ihn und ließ ihren Blick über das sanft fließende Wasser gleiten. Die Rötungen am östlichen Himmel färbten auch den Fluss, über den zarte Schleier tanzten. Kleine Strudel drehten sich in der Nähe des Ufers, und der eine oder andere unbestimmbare Gegenstand trieb vorbei.
Lucrezia fröstelte. Mansueto schaute kurz zu ihr hoch, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war. Sie schloss die Augen, holte das kleine goldene Kreuz hervor, das tief und kaum sichtbar in ihrem Ausschnitt steckte, und hielt es abwehrend vor sich. Aber selbst das Kreuz war nicht in der Lage, sie fernzuhalten ...
Die Dämonen der Erinnerung.
Die Dämonen, die sie zurückführten in den Mai des Jahres 1527, als die Horden der Eroberer durch die Straßen Roms stürmten und alles niedermachten, was sich ihnen in den Weg stellte. Eine Orgie aus Blut, Schmerzensschreien und dem Gebrüll der entmenschten Männer. Spanische Soldaten, deutsche Landsknechte, italienische Söldner und jede Menge Gesindel und Banditen – habgierige, grausame Gestalten.
Bald schon trieben im Tiber, vom Borgo Vaticano kommend, grausam entstellte Leichen, einzelne Körperteile, Tierkadaver vorbei und färbten den Fluss rötlich. Aus dem Wasser stieg ein stechender Gestank nach Fäkalien, Fäulnis und fortschreitender Verwesung empor.
Im Haus jetzt das gierige Grölen der Männer, die schrillen, verzweifelten, kaum noch menschlichen Schreie der Frauen ...
Da stürzte ihre Mutter herbei, das Gesicht zerkratzt, Blut an den Händen.
»Du musst dich ans andere Ufer retten!«, schrie sie, drückte Lucrezia ein ausgehöhltes Rohr in die Hand und stieß sie ohne weitere Erklärung ins Wasser. Dann rannte sie wieder zurück. Lucrezia sah nur noch unscharfe Bewegungen, schloss die Augen, merkte nicht einmal die Kälte, ließ sich treiben ...
Kapitel 2
Ein leises, freundliches Bellen holte Lucrezia zurück in eine Welt ohne Blut, in eine Welt, in der die Nachtigallen sangen und sie ihren ersten großen Triumph hatte feiern dürfen. Sie zitterte, aber es war nicht allein wegen der Kälte. Noch immer lagen die Schatten der Erinnerungen über ihr – sie kamen ungerufen und waren gefürchtet, überfielen sie wie das Höllengetier, manchmal tagsüber, häufiger nachts, in Albträumen, die ihren Schrecken jedes Mal noch steigern konnten und aus denen es kaum ein Entrinnen gab.
Mansueto hatte sich schwanzwedelnd erhoben und legte seine Schnauze auf ihr Knie, und sie drückte ihn an sich. Der warme Körper des starken Hundes versprach Sicherheit, und das Zittern ließ nach. Die ersten Sonnenstrahlen fanden jetzt ihren Weg zum gegenüberliegenden Park und tauchten die Villa in ein warmes Leuchten, in ein Gold der Hoffnung. Doch gleichzeitig erinnerte sie Lucrezia an ihre Vorgängerin und ihr Vorbild Imperia, die Kaiserin der Kurtisanen, der es nicht gelungen war, als Chigis Ehefrau in die Villa einzuziehen – der alternde banchiere hatte ihr eine Jüngere vorgezogen. Diese Jüngere hatte ihm zwar fünf Kinder geschenkt, doch seinen frühen Tod nicht verhindern können. Trotz ihrer Jugend starb sie sieben Monate nach ihm, und sein Bankhaus wurde bald nach dem sacco aufgelöst.
Während Lucrezias Blick noch sinnend auf der Villa lag, näherte sich ihr Marta mit einem Pelzmantel über dem Arm. Groß gewachsen und schlank, bewegte sie sich trotz ihrer fast vierzig Jahre mit der Anmut einer Raubkatze. Sie legte Lucrezia den Mantel über die Schultern und sagte: »Du solltest nicht so oft am kühlen Wasser sitzen, mein Kind. Ein wenig Schlaf täte dir und deiner Schönheit ebenfalls gut.«
Lucrezia schüttelte den Kopf und starrte auf das sich violett und rötlich färbende Wasser, wandte sich dann ihrer vertrauten Dienerin zu und zog sie neben sich auf die Bank.
Marta war als zweite Geliebte von Lucrezias Vater zur gleichen Zeit schwanger geworden wie Lucrezias Mutter und daher von ihr als Amme ausgewählt worden. Stolz auf ihre sizilianische Herkunft, hatte sie sich immer geweigert, ihre fast schwarzen Haare blond zu färben, wie es die meisten römischen Kurtisanen und zahlreiche adlige Damen taten. Sie bemühte sich auch nicht, ihre dunkle, glatte Haut mit fragwürdigen Mitteln aufzuhellen. Mittlerweile versuchte sie nicht einmal mehr, durch Schminke die Folgen eines sfregio zu verbergen: Sie hatte sich drei Jahre nach Antonios Geburt auf einen neapolitanischen Tunichtgut eingelassen, der sie dann in einem Anfall eifersüchtiger Wut mit einem Messer verunstaltete. Seither zog sich eine Narbe quer über ihre linke Wange. Lächelte sie, schien ihr Mund immer schief zu grinsen, und daher blieb sie meistens ernst.
Marta wandte sich Lucrezia zu und strich ihr über die Haare.
»Mein Vögelchen, du hast es geschafft«, sagte sie. »Dir gehört in Roms vornehmster Straße das schönste Haus, das eine römische Kurtisane besitzt. Der Heilige Vater hat es geweiht, er ist dir gewogen und wird auch in Zukunft die schützende Hand über dich halten. Wer hätte nach allem, was geschehen ist, gedacht, dass es noch eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt.«
Lucrezia schüttelte kaum merklich den Kopf. »Sie reicht mir nicht. Ich will mehr.« Und mit einer knappen Geste wies sie auf die am anderen Ufer liegende villa d’amore, über die sich jetzt die Sonnenstrahlen schoben wie eine Monstranz.
»Wer hoch steigt, kann tief fallen«, sagte Marta leise.
Als hätte Mansueto Martas Worte verstanden, sprang er mit einem leisen Knurren auf und starrte in den wieder in dichterem Morgennebel liegenden Garten. Beide Frauen drehten sich, um den Grund seiner warnenden Aufmerksamkeit zu entdecken. Jetzt knurrte er stärker, drehte seine Ohren nach vorn, straffte den Körper – und schon hechtete er davon. Lucrezia wollte ihn zurückrufen, sprang dann jedoch auf: Vor dem Zypressenlabyrinth am Rande des Grundstücks bewegte sich etwas. Genau konnte sie es nicht erkennen, vielleicht hatte nur ein anderer Hund ein Schlupfloch in den Garten gefunden, die Straßenköter trieben sich gern vor Mauern und Eingängen herum.
Der Nebel lag wie ein Schleier über Bäumen und Sträuchern, ließ sie unwirklich erscheinen. Nein, es war kein Hund! Selbst ein ausgewachsener Mastino war nicht so groß. Es konnte nur ein Mann sein. Die Gestalt verschwand jetzt im Labyrinth, hinter dem die hohe Mauer das Anwesen vor unerwünschten Eindringlingen schützen sollte. Allerdings befand sich dort auch eine durch starke Riegel gesicherte Eichentür.
Beide Frauen rannten den Zentralweg hoch. Mansueto war mittlerweile verschwunden, man hörte ihn knurren, als habe er einen Gegner gestellt und warte nur auf den Befehl, ihn zu Boden zu reißen. Lucrezia wollte gerade in das Labyrinth der Zypressen eintauchen, als Marta sie zurückriss.
»Bist du lebensmüde?«, rief sie. »Wie schnell hast du ein Messer am Hals! Lauf ins Haus und hole Crespo und Lino. Sie sollen sich bewaffnen.«
Lucrezia befreite sich und stieß Marta zur Seite. »Hole du sie! Mansueto wird nicht zulassen –«
Marta packte sie ein zweites Mal, diesmal mit eisernem Griff. »Willst du das Schicksal herausfordern? An einem solchen Tag?« Ohne den Griff zu lockern, schrie sie: »Crespo, Lino, zu Hilfe!«
Da stand ihr schwarzer Diener Crespo schon vor ihnen, als hätte ihn das Labyrinth ausgespuckt. An seiner Seite, von ihm am Halsband gehalten, Mansueto.
Noch bevor Lucrezia eine Frage stellen konnte, sah sie Lino herbeirennen, erregt mit den Armen fuchtelnd.
»Herrin! Ihr müsst kommen, es ist etwas Schreckliches geschehen! Clelia! Ich habe sie gerade entdeckt, in einem der Gästeräume.«
Lucrezia überlegte nicht lange. Marta hinter sich herzerrend, folgte sie Lino.
Sie fanden das fünfzehnjährige Mädchen nackt auf dem Bett liegend, auf zerwühlten, blutgetränkten Laken, ihre Kehle klaffte blutig auf. Noch immer sickerte Blut heraus. Die Augen starrten gebrochen an die Decke.
Mit einem hemmungslosen Schrei warf sich Lucrezia auf die Tote, küsste ihre Augen, küsste Stirn und Mund – bis Marta sie zurückzog und wie ein untröstliches Kind in die Arme nahm.
Kapitel 3
Der Schock war so groß, dass Lucrezia den ganzen Vormittag wie gelähmt war. Erst als sich die Sonne bereits dem Zenit näherte, lösten sich Erstarrung und Fassungslosigkeit, und als sie sich schließlich mit Marta in ihr Studio zurückzog, begann sie zu realisieren, was geschehen war. Clelia, ihr Liebling, war tot. War ermordet worden – in der Nacht, in der sie selbst den größten Triumph ihres bisherigen Lebens gefeiert hatte. Clelia, die sie wie eine Schwester liebte und zugleich wie eine Tochter und die sie längst zu ihrer Nachfolgerin bestimmt hatte.
Obwohl Clelia aus der verrufensten Gegend von Trastevere stammte, war sie dennoch so rein wie ein vom Himmel gefallener Engel. Der Bruder und die eigene Mutter hatten sie an Lucrezia regelrecht verkauft – schmutzig, wie sie damals war, und in ihrer Gossensprache kaum zu verstehen. Doch Clelia lernte unglaublich rasch, wie eine Signorina zu sprechen, lernte wie von allein die Laute zu spielen und brachte sogar ihren Lateinlehrer dazu, ihr eine ungewöhnliche Begabung zu bescheinigen. Zudem wickelte sie ihn wie alle Menschen mit ihrem verführerischen Charme um den Finger.
Bis auf den einen, der sie während oder nach dem Liebesakt umgebracht hatte.
Manchmal hatte Lucrezia sogar Neid gegenüber Clelia verspürt: In Klugheit und ungewöhnlicher Schönheit waren sie sich ebenbürtig, wohl auch in perfekter Körperbeherrschung, doch in leidenschaftlicher Empfindsamkeit übertraf Clelia sie bei weitem. Wie rasch vibrierte Clelia vor Erregung, während Lucrezia seit den Tagen des sacco Erregung nur vorzuspielen, nicht jedoch zu empfinden vermochte.
»Wir können Clelia nicht einfach auf ihrem Bett liegen lassen«, sagte Marta, während Lucrezia noch immer in Gedanken bei der lebenden Clelia war. »Außerdem müssen wir mit Lino und Crespo reden und herausfinden, was geschehen ist. Sie müssen doch etwas beobachtet haben – oder sie machen sich selbst verdächtig.«
Lucrezia wischte sich die Tränen von den Wangen und schüttelte den Kopf. »Ich habe ihnen bisher immer vertraut ...« Dann schloss sie die Augen und versuchte, sich daran zu erinnern, mit welchem Gast Clelia am vergangenen Abend gescherzt hatte. Einer der jungen Männer hatte Gefallen an ihr gefunden. Zu vorgerückter Stunde war man zuerst im Garten, später in einem der dafür vorgesehenen Zimmer verschwunden.
»Hast du erkannt, mit wem Clelia sich zurückgezogen hat?«, fragte sie.
Marta schüttelte den Kopf. »Ich konnte die vielen adligen Herren zum Schluss nicht mehr auseinanderhalten.«
Die beiden rätselten noch eine Weile lang und beschlossen dann, Lino und Crespo zu fragen. Lucrezia war es inzwischen gelungen, ihre Trauer um Clelia in eine abgedunkelte Kammer ihres Herzens zu schieben. Sie staunte selbst häufig darüber, dass es ihr gelang, Gefühle wie eine Kerze auszupusten – zumindest für eine Weile. Sie brachen dann erneut hervor, wie von selbst entzündet, oft in Träumen, gelegentlich in unpassenden Momenten. Dennoch: Sie war eine beherrschte Frau, nur so hatte sie überleben, hatte sie erfolgreich sein können.
Marta holte zuerst Lino ins Studio. Er wirkte ungewöhnlich unsicher, zugleich verkniffen und unwirsch. Seine Augen waren gerötet, als hätte er Tränen vergossen. Noch bevor Lucrezia fragen konnte, erklärte er, den Mann nicht zu kennen, mit dem Clelia sich eingelassen hatte.
»Hast du nichts Auffälliges an ihm entdeckt?«, hakte Marta nach. »Kein Erkennungszeichen wie ein aufgesticktes Wappen, ein besonderes Schmuckstück oder einen Spruch am Barett?«
»Nein!« Lino fuhr sich durch sein schulterlanges Haar, wagte weder Lucrezia noch Marta direkt anzuschauen. »Höchstens so seltsame Augen.«
»Was heißt seltsam?«
»Seltsam eben. Crespo muss ihn ebenfalls gesehen haben. Er sollte ihn am Gartentor hinauslassen.«
»Warum am Gartentor?«, fragte Lucrezia.
»Weiß ich’s? Der junge Mann wollte kein Aufsehen erregen. Hat ja schließlich einen Mord begangen.«
»Woher weißt du, dass er es war?«, wollte Marta wissen.
»Dumme Frage«, fuhr Lino sie an. »Er verschwand mit der quicklebendigen Clelia in dem Zimmer, und nachdem er gegangen war und sie nicht wieder auftauchte, schaute ich nach und fand sie tot.«
Nun verlor Lucrezia doch für einen Augenblick die Nerven. »Aber warum sollte ein Gast eine meiner Kurtisanen in meinem Haus ermorden wollen?«, schrie sie. »So unbeherrscht und leichtsinnig kann niemand sein!«
Lino beugte sich vor und faltete zugleich die Hände vor seinem Mund, als wollte er ein verräterisches Mienenspiel verbergen.
»Clelia konnte ganz schön frech werden, sogar hochmütig, höhnisch ... und manchem jungen Herrn sitzt der Dolch sehr locker. Die sind leicht beleidigt, brausen auf, und dann ... Die denken nicht viel nach und glauben ohnehin, dass ihr Onkel sie gegebenenfalls heraushaut.«
»Wieso sprichst du von einem Onkel?«, fragte Marta. »Hast du den jungen Mann doch erkannt?«
»Und warum trug er eine Waffe?«, schob Lucrezia nach. »Solltest du nicht darauf achten, dass niemand mit einer Waffe eingelassen wurde?«
Lino schaute von einer zur anderen und schüttelte den Kopf, ging indes nur auf Lucrezias Frage ein. »Habe ich doch. Aber in dem Gedränge ... Und manche Messer sind klein und unter dem Wams versteckt.«
»Ist gut«, unterbrach ihn Lucrezia. »Hol mir Crespo!«
Nachdem Lino hinausgeschlichen war, nicht ohne sich noch einmal vergewissernd umzudrehen, schüttelte Marta den Kopf. »Ich traue ihm nicht«, wandte sie sich an Lucrezia, »auch wenn euch einiges verbindet. Er war schon immer ein auf seinen Vorteil bedachtes Schlitzohr, wie die meisten Neapolitaner. Während er sprach, habe ich ihn beobachtet: Er lügt uns an.«
Auch Lucrezia spürte, dass Lino etwas verbarg.
Während sie mit Marta auf Crespo wartete, tigerte sie unruhig im Studio auf und ab. Der Gedanke, dass dieser Mord ihr nicht nur das liebste Mädchen von der Seite gerissen hatte, sondern auch alles andere als eine Werbung für sie und ihre Geschäfte war, bedrängte sie. Würde er publik, hätte sie schnell die sbirri im Haus, und der procuratore würde sie vorladen. Die Folgen wären verheerend.
»Die Leiche muss möglichst rasch und ohne Aufsehen verschwinden«, erklärte Marta, als habe sie Lucrezias Gedanken erraten. »Ich werde allen, die von dem Mord etwas mitbekommen haben, einen scudo versprechen, wenn sie ihren Mund versiegeln. Lino oder Crespo müssen sich um ... das Opfer kümmern. Clelias Familie wird schon nicht nachfragen, sie ist hier nie wieder aufgetaucht, hat Clelia längst abgeschrieben oder wird mit irgendeiner Geschichte bedient, mit Geld ruhiggestellt. Die Mutter ist eine Bettlerin, der Vater vor Jahren angeblich bei einer Messerstecherei nach einem Glücksspiel umgekommen. Vielleicht lebt ohnehin keiner mehr von ihnen.«
»Der Bruder, der sie abgeliefert hat, wirkte aber ernsthaft«, erwiderte Lucrezia. »Ich erinnere mich noch gut an ihn. Terzo hieß er, glaube ich. Er hat uns seine Schwester ungern überlassen. Wie er sie beim Abschied umarmt hat ...«
Marta zog die Augenbrauen zusammen. »Die Überlegungen zu Clelias Familie sind nicht vordringlich.«
»Vielleicht nicht«, sagte Lucrezia, »aber wir machen uns erpressbar, wenn wir Clelia durch Lino und Crespo verschwinden lassen. Anschließend haben sie uns in der Hand.«
Marta schüttelte den Kopf. »Lino und Crespo sind viel erpressbarer. Sie hatten direkten Kontakt mit dem Mörder. Haben sich womöglich bestechen lassen. Man könnte ihnen sogar selbst den Mord in die Schuhe schieben. Wer weiß, was zwischen Clelia und ihnen vorgefallen ist? Vielleicht war einer in sie verliebt, Lino zum Beispiel, es würde mich nicht wundern. Du hast doch gehört, was er über sie gesagt hat.«
»Wäre Lino in sie verliebt gewesen, hätte er sie wohl kaum umgebracht. Das ergibt keinen Sinn.«
»Und was ist mit einem Mord aus Eifersucht? Aus verschmähter Liebe? Sie werden auf jeden Fall den Mund halten, denn wenn sie unter Verdacht gerieten, würde ihnen rasch die Folter winken, während du dich jederzeit freikaufen könntest.«
Sie unterbrach sich, weil Crespo eintrat. Obwohl er groß und stark wie ein Ochse war – genau das Gegenteil von Lino –, wirkte er jetzt wie geschrumpft und fiel sofort vor Lucrezia auf die Knie.
»Ich habe ihn hinausgelassen, es war meine Schuld«, stammelte er, »ich hätte wissen müssen, dass da etwas nicht stimmt. Mansueto hat den Mord gerochen und den jungen Mann angeknurrt. Lino hat mich geschickt, und dann ...« Ohne aufzuschauen, hielt er Lucrezia einen Goldscudo hin. »Den hat mir der Fremde in die Hand gedrückt, ich hätte Verdacht schöpfen müssen.«
»Jetzt steh auf und erzähle mir alles der Reihe nach.« Lucrezia machte eine ungeduldige Geste. »Wen hast du hinausgelassen? Wer hat dir den scudo gegeben?«
»Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht erkennen können, es war dunkel, und er wollte keine Fackel, nicht einmal ein Öllicht. Wir sind sogar gestolpert. Lino lief mir mit ihm vor den Ställen über den Weg und gab mir den Auftrag, ihn am Gartentor hinauszulassen. Die Riegel klemmen leicht, man braucht Kraft, um sie zu bewegen, Lino ist zu schwach, daher ... Und außerdem wird er gern einen Auftrag an mich los.« Crespo verstummte.
Lucrezia ließ ihren Blick auf ihm ruhen. Bisher hatte sie ihrem schwarzen Diener blind vertraut, und sie konnte sich nicht vorstellen, dass er in einen Mord verwickelt war, nicht einmal als Mitwisser.
Den immer breit und freundlich lächelnden Crespo hatte ihre Mutter Diana als jungen Mann von einem arabischen Händler gekauft. Afrikanische Sklaven und Sklavinnen waren teuer und begehrt und machten vor dem sacco fast so viel Eindruck wie gegenwärtig eine Kutsche. Crespo war zudem ansehnlich, ungewöhnlich fleißig und konnte gut mit Hunden umgehen. Sogar Rabbia hatte ihm aus der Hand gefressen, und auch Mansueto gehorchte ihm. Weil sowohl ihre Mutter Diana als auch sie selbst Crespo nie wie einen Sklaven, sondern immer mit Respekt, ja mit Zuneigung behandelt hatten, konnte sie nicht glauben, dass er sie betrog.
Dennoch meldete sich in ihr immer stärker das Gefühl, dass noch keineswegs die ganze Wahrheit offen lag.
Kapitel 4
Bevor Lucrezia ihre Gedanken endgültig geordnet und überzeugende Schlussfolgerungen gezogen hatte, rief Marta Lino wieder herein. Der schmächtige Neapolitaner mit seinen dunklen buschigen Brauen, die über unruhigen Augen lagen, ließ seinen Blick blitzschnell über die Anwesenden gleiten und richtete sich dann stolz, ja, regelrecht überheblich auf.
»Ihr beiden wisst«, sprach Marta die beiden Männer an, nachdem sie Lucrezia signalisiert hatte, ihr die Regelung der Angelegenheit zu überlassen, »dass ihr bei diesem ... traurigen und verbrecherischen Ereignis Verdacht auf euch geladen habt, dass euch eine Befragung droht, bei der sogar die Tortur angewandt werden könnte, damit ihr die Wahrheit sagt.« Lino wollte widersprechen, aber Marta unterband dies mit einer entschiedenen Handbewegung. »Unsere Herrin will jedoch kein Aufsehen, sie wird die Sache sogar auf sich beruhen lassen, wenn es euch gelingt, nun ... Wir haben sie alle gerngehabt, unsere arme Clelia, aber jetzt wird sie niemand mehr ins Leben zurückrufen. Kurz: Sie muss spurlos verschwinden. Die Laken müssen mitsamt der Matratze verbrannt werden, ohne dass irgendwer etwas davon mitbekommt, und wer von Clelias Tod weiß, soll schweigen.« Mit ihren Fingern signalisierte sie, dass ihre Herrin bereit sei, Schweigegeld zu zahlen.
Während Crespo Marta ungläubig anstarrte, verstand Lino sie sofort und grinste, konnte aber zugleich ein Zucken nicht unterdrücken.
Lucrezia schüttelte unwillkürlich den Kopf über Martas kaltblütige Planung, fand jedoch selbst auch keinen besseren Ausweg. Sie wusste nur, dass es ihr schwerfallen würde, Clelia zu vergessen.
»Kein Problem«, erklärte Lino komplizenhaft. »Überlasst das mir. Ich bin mir meiner Schuld bewusst, ich hätte misstrauischer sein müssen – allerdings sah ich kein Blut an der Kleidung des vornehmen jungen Herrn und entdeckte, wie gesagt, auch keinen Dolch.« Er versuchte, ernsthaft und vertrauenswürdig dreinzuschauen. »Aber vielleicht hat der junge Herr ein Messer aus der Küche entwendet – oder vom Festmahl mitgenommen.« Er unterbrach sich kurz. »Also, groß war er nicht, sprach nicht viel, aber seine Stimme klang hart, so wie die Spanier sprechen, er hatte schlanke Beine, ich glaube, auch lange Haare ...«
»Würdest du ihn wiedererkennen?«, fragte Lucrezia.
Er schüttelte skeptisch den Kopf. »Es waren jede Menge junger Männer da, ich hatte viel zu tun, blicke ihnen selten ins Gesicht, das mögen manche nicht, sie fühlen sich von einem Diener provoziert.«
»Und du?« Sie schaute Crespo an.
»Er roch so eigen, süßlich, nach Blut – so wie manche Frauen riechen.«
»Aber Frauen riechen doch nicht nach Blut«, warf Marta ein.
»Und dann ging er leicht vornübergebeugt, als hätte er Schmerzen dort unten ...«
»Hat wahrscheinlich zu heftig gevögelt.« Lino versuchte zu grinsen, doch es gelang ihm nicht richtig, und er wirkte plötzlich hilflos und tief getroffen. »Ich meine ja nur«, krächzte er und wandte sich ab. »Wir alle haben unsere Clelia gemocht, und jetzt ...«
Nachdem sie die beiden Diener fortgeschickt hatte, ließ sich Lucrezia von Marta einen Becher mit kühlem Wasser holen.
»Glaubst du, wir können Lino trauen?«, fragte sie. Dann trank sie mit kleinen Schlucken.
»Ich war immer skeptischer als du.«
Lucrezia nickte. Marta hatte ihr damals abgeraten, Lino in die famiglia aufzunehmen, aber es verband sie viel mit ihm, und bei rechtem Licht betrachtet, verdankte sie ihm sogar ihr Leben.
Zum ersten Mal war sie dem Neapolitaner während des sacco begegnet, als sie, geschändet und verstümmelt, durch die Straßen kroch. Sie wollte sich nur noch in den Tiber stürzen, um ihren Qualen ein Ende zu bereiten. Auch Lino strich damals halb verhungert durch die verkohlten Ruinen der Häuser, wo er sich der streunenden Köter erwehren musste, wo er Ratten totschlug, briet und fraß.
Als er Lucrezia entdeckte, half er ihr auf die Beine, erneuerte notdürftig den Lappen um ihren Finger und schleppte sie zum Portal des Palazzo Farnese, in dem sich der damals kaiserliche condottiere Pierluigi Farnese, der Sohn des gegenwärtigen Papstes, mit einem Teil seiner Söldnerbande niedergelassen hatte.
Lucrezia war sich weder damals noch später sicher, ob Lino sie nicht nur an die Söldner im Palazzo hatte verhökern wollen, aber bevor sie dort in die falschen Hände fiel, geriet sie an Joana, eine Köchin und Gelegenheitshure, die im Palazzo einen Weg gefunden hatte zu überleben und die noch nicht ganz abgestumpft war. Sie nahm Lucrezia auf, wusch sie, gab ihr zu trinken und zu essen und versorgte ihren Finger und die anderen Wunden. Da sie genau wusste, was mit ihr geschehen war, nahm sie hin, dass Lucrezia wochenlang nicht sprach.
Zum Glück heilte der Finger ohne Wundbrand, sonst wäre Lucrezia verloren gewesen.
Später, als sie längst in der Küche des Palazzo arbeitete und für Joana die Kauflisten anfertigte, wurde Pierluigi Farnese, der Hausherr, auf sie aufmerksam. Er wunderte sich, dass eins dieser schmächtigen Küchenmädchen schreiben konnte, zudem sauber war und kein stumpfes Bauerntrampelgesicht hatte. Zumindest hatte er dies Lucrezia später einmal gönnerhaft lachend berichtet. Er rief sie zu sich und war äußerst erstaunt, als er hörte, dass sie sogar etwas Latein beherrschte und Flöte spielen konnte. Als sie ihm dann den Namen ihrer Mutter und ihres Vaters nannte, leuchtete sein Gesicht wie über einen unerwarteten Goldfund auf, und sie musste ihm für eine Weile als Schreiberin dienen.
Zum Glück hatte er kein männliches Interesse an ihr, da sich sein Interesse auf seine Söldner richtete – er versuchte nicht einmal, sie wie einen Lustknaben zu benutzen.
Später, nachdem das kaiserliche Heer nach Neapel abgezogen war und Rom aufzuatmen wagte, blieb Lucrezia im Palazzo. Sie wurde für kurze Zeit Dienerin von Silvia Ruffini und Kardinal Farnese, den Eltern des condottiere, die wieder in den Palazzo zurückgekehrt waren.
Zufällig begegnete Lucrezia damals beim Einkaufen Lino erneut. Noch immer hauste er in Ruinen und schlug sich als Strichjunge und Straßenhändler durch. Er besorgte ihr auf dem Schwarzmarkt einiges, was sie benötigte, und suchte immer ihre Nähe. Als sie dann Marta wiedergefunden hatte und den Palazzo Farnese verließ, um wieder in das Haus ihrer Mutter zu ziehen, nahm sie ihn in ihre famiglia auf. Sie vertraute ihm. Vertraute der Bindekraft ihres gemeinsamen Schicksals. Außerdem setzte sie darauf, durch ihn einen besseren Kontakt zu den Neapolitanern und den Spaniern in der Stadt zu bekommen. Lino sprach ihren Dialekt, er beherrschte Spanisch, er wusste, was sie liebten und hassten, wie man sie umschmeicheln musste und wie man auf ihre Vorstellung von Ehre einging.
Tatsächlich stellte er sich bald als sehr nützlich heraus: Er half Lucrezia, sich als Kurtisane einzurichten, besorgte ihr Möbel, Kleider und dann auch Kunden. Und später, als sie reichlich Geld verdiente, wusste er, welche Häuser günstig zu erwerben, welche Straßenmädchen so intelligent, schön und begabt waren, dass Lucrezia aus ihnen gebildete und anspruchsvolle Kurtisanen machen konnte.
Noch immer saß sie mit gesenktem Kopf in ihrem Studio und dachte über Lino und das Geschehene nach. Sollte ihr Vertrauen in ihn blind gewesen sein? Oder hatte er sich während der vergangenen Jahre geändert?
»Jetzt kann ich ihn nicht mehr loswerden«, sagte sie resigniert zu Marta. »Ich weiß nicht einmal, ob ich ihn loswerden will.«
Da plötzlich heftige Kopfschmerzen sie überfielen, zog sie sich in ihr Schlafzimmer zurück, das an ihr Bad und die camera d’amore grenzte. Sie kniete sich vor das kleine Pult, das ihr mit Kruzifix, aufgeschlagener Heiliger Schrift und zwei Kerzen auf silbernen Leuchtern zur Andacht diente. Über dem Pult war ein von Raffaello Sanzio gemaltes Porträt ihrer Mutter Diana in die dunklen Wandpaneele eingelassen – hob Lucrezia den Kopf, schaute sie ihr direkt in die schönen, geheimnisvollen Augen.
Sie versuchte zu beten, doch ihre Worte klangen hohl und verlogen vor dem Hintergrund dessen, was geschehen war. Warum hatte der Vater im Himmel diesen Mord an Clelia, einem unschuldigen Engel, zugelassen? Warum hatte die Muttergottes, die doch angeblich so voll der Gnade war, ihn nicht verhindern können? Und warum hatte der Heiland nicht die Hand erstarren lassen, die das Messer erhob? Warum konnte er das grundlos Böse nicht verhindern? Wo blieben göttliche Gerechtigkeit und Barmherzigkeit?
Kapitel 5
Lucrezia war nach dem Abbruch der Gebete in quälende Zweifel und in einen anfangs albtraumgepeinigten, später jedoch ruhigeren Schlaf gefallen. Erst am Mittag erwachte sie wieder, fühlte sich gefestigt und gestärkt, sodass sie Marta zu sich rief, um sich berichten zu lassen, was mittlerweile geschehen war.
»Alles ist auf gutem Weg«, erklärte Marta, »die Spuren sind beseitigt. Nur zwei deiner alten Dienerinnen haben von dem Mord etwas mitbekommen. Für einen scudo haben sie sich jedoch bereit erklärt, für alle Zukunft zu schweigen.«
»Glaubst du, dass wir uns auf sie verlassen können?«
Marta nickte. »Sie wissen, dass du nichts Unrechtes tun kannst, und vertrauen mir.«
»Und was ist mit Lino und Crespo?«
»Ich habe sie noch in der Nacht ein weiteres Mal verhört, aber es ist nichts Neues dabei herausgekommen. Später sind sie dann in einem Boot flussabwärts gerudert, bis hinter den Ponte Sisto. Clelia war in einen festen Sack eingepackt, zusammen mit schweren Steinen ... du verstehst, im Dunkel haben sie den Sack dann in den Tiber geworfen. Du kannst beruhigt sein, alles wird gut.«
Lucrezia musste tief durchatmen und verbarg eine Weile lang ihr Gesicht hinter den Händen. »Und wenn jemand aus ihrer Familie nach ihr fragt, was sagen wir dann?«
»Wir sagen, ein reicher Kaufmann habe sich in sie verliebt und sie mit nach Spanien genommen.«
»Und wenn sich Antonio nach ihr erkundigt?«
»Sagen wir das Gleiche.«
Lucrezia seufzte. »Er und Clelia – sie hätten ein Paar werden können. Ich glaube sogar, sie waren ineinander verliebt. Auf jeden Fall hat er sie mehrfach aufgesucht, um mit ihr ... sicher nicht nur zu plaudern.«
Marta begann nun, Lucrezias Nacken und Schultern zu massieren. Sie waren noch schmerzhaft verkrampft, und nach einer Weile legte sich Lucrezia wieder auf ihr Bett, um sich zu entspannen.
»Ich habe sie geliebt«, flüsterte sie und brach, ohne dass sie es unterdrücken konnte, in Tränen aus. »In ihrem fröhlichen Lachen habe ich mich selbst wiedergefunden – wie ich vor dem sacco war.«
»Wir alle haben sie geliebt«, antwortete Marta sachlich.
Lucrezia nickte. »Meinst du, ich sollte Pater Tiberio beichten?«
»Du hast nichts zu beichten. Auf keinen Fall darfst du Clelias Tod erwähnen. Du musst in die Zukunft schauen. Es gilt, deinen Erfolg jetzt auszubauen. Wir dürfen uns nicht vom Weg abbringen lassen.«
Lucrezia legte ihren Kopf auf die Arme, schloss die Augen und atmete gleichmäßig. Unter den sanften Bewegungen ihrer Amme wurde sie ganz weich. Eine Weile lang fühlte sie eine tiefe Ruhe durch ihren Körper strömen, doch dann sah sie plötzlich wieder die tote Clelia vor sich, die Erlebnisse während des sacco kamen ihr in den Sinn, und sie setzte sich auf. Marta blickte sie fragend an.
Lucrezia presste die Fingerspitzen gegen ihre Schläfen und sagte leise: »Ich möchte vergessen, doch es gelingt mir nicht, all die grausamen Ereignisse bewegen sich wie hinter einem Vorhang. Ich erahne sie zunächst nur, sehe ihre Schatten, doch dann brechen sie plötzlich in schmerzhafter Klarheit hervor. Ich kann mich nicht gegen sie wehren. Schließlich verschwinden sie, als würden sie in einen tiefen Brunnen gesogen. Ich blicke ihnen nach, schaue in dieses schwarze Loch – und möchte springen.« Sie hielt kurz inne. »Kannst du mich verstehen?«
»Ja«, antwortete Marta mit rauer Stimme, »es gibt Tage, da brennt auch meine Narbe wieder.«
Lucrezia streckte die linke Hand aus, als müsse sie Marta Schmuck oder einen Ring zeigen. Aber ihr Blick fixierte den Stummel des kleinen Fingers. »Nicht die Narbe schmerzt, der Schmerz ist da, wo nichts mehr ist.« Sie ballte die Hand zur Faust, um die Verstümmelung zu verbergen. »Zum Glück quält er mich nur gelegentlich, und ich merke oft nicht einmal mehr, dass mir etwas fehlt.«
»Solange dir nicht mehr als ein Fingerglied fehlt ...«, sagte Marta nach einer Weile, ohne den Satz zu vollenden, drückte Lucrezia sanft in die Kissen zurück und begann wieder, sie zu massieren.
»Mir fehlt meine Mutter«, flüsterte Lucrezia, wie zu sich selbst. »Und mein Vater.« Sie seufzte. »Das Lachen, die Unschuld meiner Kindheit. Weißt du noch, wie mein Vater mit mir im Tiber geschwommen ist, wie er mich auf seinen Schultern reiten ließ und später auf den Schoß nahm, um mir seine Gedichte vorzulesen oder mich Reime suchen zu lassen? Er hat mich sogar in Chigis villa d’amore mitgenommen. Ach, warum kehrt mein geliebter Vater nicht nach Rom zurück?«
Marta antwortete nicht.
Lucrezia war noch sehr klein gewesen, als ihr Vater Pietro Aretino mit seiner Geliebten, seiner zweijährigen Tochter und deren Amme 1517 nach Rom überwechselte, um in der kunstverliebten und vergnügungssüchtigen Stadt des Medici-Papstes Leo X. sein Glück zu suchen. Schon sehr bald wusste er sich durch die Eleganz seiner Schmeicheleien, den Witz seiner Worte und die Überzeugungskraft seines Auftretens in die mächtigsten Kreise der Stadt einzuführen. Sein wichtigster Gönner war der banchiere Agostino Chigi, der seit ein paar Jahren in seiner Gartenvilla am Tiber wohnte und der Lucrezias Vater erlaubte, jederzeit mit seinem Töchterchen auf der Schulter durch ihre Säle und Gemächer zu spazieren.
»Weißt du eigentlich, Marta, dass mein Vater mir damals all die Geschichten, die die Fresken in Chigis Villa erzählen, in Versform erläutert hat? Natürlich verstand ich kaum, wovon er sprach, aber noch heute höre ich sein Lachen. Es kam ganz tief aus seiner mächtigen Brust und steckte alle an, die ihm zuhörten. Wie war ich damals stolz und glücklich!«
Während Marta ihre Beine knetete, sah Lucrezia die Bilder von frechen kleinen Jungen vor sich, die ihre Pfeile abschossen, sah dann auch dieses schüchterne Mädchen am Bett sitzen: Es erwartete in der Hochzeitsnacht seinen Ehemann, Alexander den Großen.
Lucrezia stöhnte wohlig. »Kannst du dir vorstellen, Marta, was mein größter Traum ist?«
Als Marta nicht antwortete, fuhr sie fort: »Dass ich einmal in Chigis Villa residieren darf. Als wiederauferstandene Imperia. Als Roms schönste und erfolgreichste Frau.«
Am späten Nachmittag spazierte Lucrezia mit Mansueto eine Weile durch den Garten, las dann bis zur Dunkelheit in der Bibel, und am Abend musizierte sie. Sie war selbst überrascht, wie sehr sie sich von dem Gedanken an Clelias Tod zu lösen vermochte. Doch in der folgenden Nacht überfiel sie einer ihrer sich seit Jahren wiederholenden Albträume, aus dem sie nicht fliehen konnte, auch dann nicht, als ihr bewusst wurde, dass sie träumte.
Zuerst waren da die vorbeitreibenden Leichen und das Wasser, das ihr in Nase und Mund drang, es stank und schmeckte so ekelerregend faulig, dass sie sich übergeben musste. Dann spürte sie nur Kälte, Atemnot und Beklemmung. Da es dunkel war, wagte sie, das Wasser zu verlassen. Hinter einem Busch versteckt, beobachtete sie die betrunkenen Männer, die um ein Feuer saßen. Sie zitterte vor Angst, ihr Unterhemd klebte am Körper.
Auf allen vieren kroch sie schließlich durch den blühenden, teilweise niedergetrampelten Garten in Richtung Haus. Es trillerte, flötete und schluchzte sogar eine Nachtigall, als wolle sie das Grölen und Johlen der Männer übertönen.
Lucrezia wusste nicht, wohin sie sich retten konnte, es gab keinen Ort, an dem sie sicher war. Doch noch lebte sie.
Plötzlich packte eine grobe Hand sie, und als sie schreien wollte, schlug sie ihr ins Gesicht. Sie sah die schiefen und krummen Zähne, roch den fauligen Atem. Und wieder Dunkel. Bewegungslosigkeit. Gelächter, nichts als betrunkenes, tierisches, brüllendes Gelächter, und wie aus dem Nichts heraus flackerndes Licht. Auf dem Marmorboden ein Feuer, daneben schmutziges Stroh. Auf einer Matratze kniete ein buntgekleideter Mann mit nacktem Hintern, umrahmt von anderen Männern, die ihn anfeuerten, er kniete zwischen den Schenkeln einer Frau, deren Gesicht vor Blut und Dreck kaum zu erkennen war, er bewegte sein Becken, stieß es nach vorn, keuchte und stöhnte.
Lucrezia wollte schreien, fliehen – aber nichts gelang, kein Schrei, keine Flucht.
»Du bist auch noch dran!«, hörte sie, dazu ein Stoß, ein Tritt, ein Schlag ins Gesicht, bis warmes Blut aus der Nase floss.
Die Frau wie tot, nur von den Stößen des Mannes ruckhaft bewegt. Es war ihre Mutter.
Dann stieß jemand Lucrezia in die Nähe des Feuers, die Reste ihrer Kleidung wurden ihr vom Körper gerissen, die Beine gespreizt, zwei Männer knieten auf ihren Handgelenken, es schmerzte, dass sie jetzt doch schrie, aber der folgende Schmerz zwischen ihren Schenkeln übertraf alles.
Und dann einer nach dem anderen, bis sie sich bibbernd auf einem Haufen blutiger, schleimiger, kotiger Stofffetzen krümmte.
Schließlich noch der Letzte, ein Junge. Sie spürte schon nichts mehr – oder war der ganze Körper ein schreiender Schmerz? Er kämpfte zwischen ihren Schenkeln, schwitzte und stöhnte und heulte auf, und rings um ihn ein johlendes Theater, Anfeuerungsrufe, bis er auf sie sackte, ganz nahe sein Gesicht, sein ängstliches Jungengesicht mit seltsamen Augen, bis ein Tritt ihn traf und von ihr wegschleuderte ... Die Klinge eines Kurzdolchs blitzte auf ... »Mach sie fertig, schlitz sie auf!«
Ihr letzter Schrei ... und nur noch Dunkel.
Kapitel 6
Am nächsten Tag sah sich Lucrezia gezwungen, trotz des Albtraums wieder ihren ersten Kunden zu empfangen. Zum Glück hatte sich nur einer für den Abend angemeldet, sodass sie vorher Zeit fand, auf Roms Kunstmarkt ein Geschenk für den Heiligen Vater zu suchen, dem sie noch für die Weihe ihres Hauses zu danken hatte.
Bald fand sie etwas Angemessenes, und sie bat um eine Privataudienz im benachbarten Palazzo Farnese, die ihr für eine Woche später gewährt wurde.
Zur angegebenen Zeit erschien Lucrezia im Palazzo Farnese, von Marta und Crespo begleitet, in einem hochgeschlossenen, dunkelblauen Samtkleid, die Haare von einem Schleier bedeckt. Sie wurden durch das Eingangsgewölbe in den cortile geführt, wo sie warten sollten. An mehreren Stellen des Gebäudes hämmerten und sägten die Bauleute und riefen sich Befehle zu, von denen sie kaum ein Wort verstand.
Da der Garten westlich des Palazzos direkt an die Via Giulia grenzte und schräg gegenüber ihrer eigenen Villa lag, hatte sie seit der Papstwahl verstärkte Erweiterungsarbeiten an dem Gebäude beobachten können. Materialien wurden über den Tiber angeliefert und in schweren Ochsenkarren herangeschafft, überall machten sich die Handwerker breit, sodass die Via Giulia oft verstopft war und jede Menge Lärm herrschte. Aber das ganze Viertel – seit langem eng und verschachtelt bebaut, besiedelt von Handwerkern und Huren, bestückt mit Gasthäusern und Tavernen – würde an Ansehen gewinnen.
Nachdem Lucrezia eine gute Stunde gewartet hatte, wurde sie die breite Treppe zum piano nobile hochgeführt. Im großen Saal begrüßte sie ein freundlich lächelnder Prälat – erfreut erkannte sie in ihm Tiberio Crispo, ihren Beichtvater, den Stiefsohn und Geheimen Kammerherrn des Papstes.
Als sie in den mit antiken Skulpturen, Wandteppichen und goldgerahmten Gemälden reich geschmückten Saal traten, musste sie erst einmal tief durchatmen. Gegenüber dieser Pracht wirkte ihr salone äußerst bescheiden, und eine gewisse Ehrfurcht ergriff sie. Am Fenster zur Piazza stand der Papst mit seinem Sohn Pierluigi und dessen ältestem Sohn, dem vierzehnjährigen Kardinal Alessandro Farnese, der ihr bereits auf ihrem Fest durch seine charmanten Worte aufgefallen war, der jetzt allerdings in seiner Kardinalsrobe wie verkleidet wirkte. An der Seite von Pater Tiberio schritt sie verkrampft durch den weiten Raum, unter dem Arm ihr Geschenk, einen kaum noch erhältlichen Stich von Marcantonio Raimondi. Er zeigte Raffaello Sanzios Lucretia, die dabei war, sich den Dolch ins Herz zu stoßen.
Papst Paul III., bekleidet mit einer weißen Soutane und mit einem schweren Goldkreuz auf der Brust, aber ohne Kopfbedeckung, sprach erst noch mit Pierluigi, während Alessandro sich lächelnd vor Lucrezia verbeugte, nicht ohne ihr ein Kompliment über ihre »ehrbare Schönheit« zu machen.
Schließlich war es so weit. Der Heilige Vater wandte sich ihr mit leutseligem, ja, freundlichem Lächeln zu, sie reichte Pater Tiberio das Geschenk und fiel erst einmal zur Reverenz auf die Knie. Aber der Papst hielt ihr nur den Ring zum Kuss hin und zog sie hoch, noch ehe sie seinen Fuß geküsst hatte, murmelte »wie schön, dich zu sehen, meine Tochter«, ließ sich das Geschenk zeigen, kommentierte es mit »wie sinnig« und »immer wieder erhebend, den Sieg der Tugend im Augenblick ihrer Tragik dargestellt zu sehen«, worauf sein schwarzbärtiger Sohn Pierluigi die Augen verdrehte und der Enkel Alessandro kichern musste. Mit freundlicher Miene ermahnte ihn sein Großvater, doch bitte seiner Kardinalswürde eingedenk zu sein, worauf Alessandro sofort wieder ernst wurde und sich vor seinem nonno verbeugte.
Papst Paul fasste Lucrezia nun wie eine alte Bekannte am Ellenbogen und führte sie zum Fenster, das den Blick auf die quirlige Piazza freigab.
»Die Gasse zum Campo de’ Fiori werde ich erweitern lassen. Wir benötigen ein wenig Luft zum Atmen. Was hältst du davon?« Er wies mit einer Geste auf den Vicolo dei Baullari und den sich an seinem Ende öffnenden Platz. »Rom soll nach den Verwüstungen durch den sacco schöner denn je werden. Die Schönheit ist Ausdruck göttlichen Wirkens in diesem weltlichen Jammertal, dieser Meinung bist du doch auch, meine Tochter?« Ein leicht anzüglicher Blick glitt über ihren Schleier; zugleich gab sich der Papst so natürlich, dass Lucrezia alle Anspannung verlor.
»Lasst uns in mein Studio gehen, im kleinen Kreis miteinander sprechen.« Er hatte seine Aufforderung so laut gesprochen, dass die im Hintergrund stehenden Prälaten sie verstehen mussten und sich knapp verbeugten. Im selben Moment winkte er Alessandro und Tiberio, ihn zu begleiten. Wieder nahm er Lucrezias Arm und geleitete sie durch den Saal.
Kaum näherten sie sich jedoch der Tür zu einem weiteren Raum, stürzte ihnen unter lärmendem Geschrei und Gejohle ein Trupp Kinder entgegen, gefolgt von hilflos wirkenden Kindermädchen.
»Benehmt euch vor eurem nonno, Rasselbande!«, schrie Papstsohn Pierluigi sie an, doch die Wirkung war gering. Einige von ihnen hielten hölzerne Steckenpferde zwischen den Beinen und ahmten Galoppieren nach, andere schwangen Holzschwerter durch die Luft, die Mädchen lachten kreischend, und nun umrundeten alle wie im Tanz ihren nonno, der ihnen scherzhaft mit dem Finger drohte.
Im Studio angekommen, ließ sich der Papst seufzend in einem lederbezogenen und mit Löwenköpfen geschmückten Lehnstuhl nieder. Auch Lucrezia sowie Alessandro und Tiberio durften sich setzen. Pierluigi hatte sich mit einer knappen Verbeugung verabschiedet.
»Du musst entschuldigen, meine Liebe«, sagte der Papst, »dass die heranwachsende Enkelschar so ungebührlich gelärmt hat. Es fehlt die strenge Hand. Meine Tochter Costanza und meine Schwiegertochter Girolama sind mit ihrem Nachwuchs überfordert. Um elf Kinder muss sich Costanza kümmern! Und von Pierluigi kommen, abgesehen von den älteren, noch einmal zwei hinzu. Die wollen später einmal alle versorgt werden, verstehst du? Eine schwere Aufgabe für einen nonno.« Er lachte leise in seinen gepflegten eisgrauen Bart und strich sich über die ihm noch verbliebenen Kopfhaare.
»Ich kannte deine Mutter«, sagte er übergangslos, »sie erlitt ein schweres Schicksal, wie so viele Römerinnen.« Kurz verlor sich sein Blick in der Ferne. »Und natürlich auch deinen Vater Pietro Aretino. Ein begabter Bursche, er konnte mit Worten zaubern, dass einem ganz schwindlig wurde, und seine mächtige, tiefe Stimme beherrschte jede Gesellschaft. Leider hat er Rom verlassen müssen, seine Gedichte und Satiren waren doch zu gewagt – sehr bedauerlich, ich hätte gern einen so klugen und unerschrockenen Mann an meiner Seite. Speichellecker gibt es genug ... Hast du noch Kontakt mit ihm, meine Tochter?«
»Wir schreiben uns Briefe.« Sie räusperte sich, weil sie viel zu leise gesprochen hatte, und wiederholte ihre Worte. »Gelegentlich«, fügte sie hinzu.
»Ja, oft müssen wir auf die Nähe derjenigen Menschen verzichten, die wir am meisten lieben«, sagte der Papst, und erneut verlor sich sein Blick in der Ferne.
Lucrezia verstand seine Anspielung, die sich auf Silvia Ruffini bezog, die Mutter seiner Kinder. Es war in Rom ein offenes Geheimnis, dass er sie sehr liebte, sie aber in einem eigenen Haus in der Via Giulia, also nicht weit von Lucrezia entfernt, untergebracht hatte und keinen öffentlichen Verkehr mit ihr pflegte. Signora Ruffini, der Lucrezia in der Zeit nach dem sacco eine Weile gedient hatte, war eine vornehme, zurückhaltende, aber warmherzige Frau, deren Schicksal im Verzicht lag.
Ja, im Verzicht.
In Lucrezia erhob sich ein innerer Protest. Eins hatte sie von ihrer Mutter wie auch von ihrem Vater gelernt: Ein Leben in Verzicht, Unterordnung und Rückzug musste nicht für jede Frau gelten. War man keine Fürstin, dafür aber ansehnlich und klug, sollte man die Gaben nutzen, die einem der Schöpfer verliehen hatte. Und war man dabei erfolgreich, durfte man sich in Rom sogar als cortigiana honesta, curiam sequens fühlen und bezeichnen. Daher nannte sich Lucrezia auch Onesta: Sie betrachtete sich als ehrbare Frau, trotz ihres Berufs.
Plötzlich durchzuckte sie das Bild ihrer geliebten Clelia, wie sie mit dieser klaffenden Wunde stumm und starr dalag, und sofort folgte der Gedanke an die Art und Weise, wie man sie ›beerdigt‹ hatte. Nicht einmal namenlose Tote wurden einfach im Tiber versenkt. Und sie, ihre ältere Schwester, trug die Verantwortung dafür. Würde sie irgendwann einmal diese Schuld von sich abschütteln können? Clelia würde nie mehr an ihrer Seite als cortigiana honesta Triumphe feiern, nie würde ihr Mörder zur Rechenschaft gezogen werden.
Erschrocken schaute sie auf, als sie merkte, dass Papst Paul sie forschend musterte.
»Hast du Sorgen, meine Tochter?«
»Nein, nein!«, rief Lucrezia viel zu laut.
»Meine Tochter, wir müssen alle umdenken ... und umkehren«, sagte er ohne Übergang. »Die schrecklichen Ereignisse des sacco waren die Strafe für unser sündiges Verhalten, jetzt bedrängen die Anhänger dieses auf Irrwegen wandelnden Augustinermönchs Martinus Luther die heilige römische Kirche, wir brauchen Reformen, eine neue apostolische Besinnung und Ernsthaftigkeit.«
Erstaunt zog Lucrezia die Augenbrauen zusammen. Solche Worte hatte sie gerade von diesem Papst nicht erwartet, galt er doch als liberal und lebenslustig. Man sagte ihm sogar nach, das Zölibat abschaffen zu wollen.
»Es gibt glaubensstarke Männer wie den Frömmsten unter den Frommen, unseren Ordensgründer und verehrten Bruder Gianpietro Carafa, die am liebsten die sittenlosen Frauen ganz aus der Stadt verbannt sähen«, sagte er, und sein Blick ruhte wohlwollend auf Lucrezia. »Dieser Meinung bin ich nicht unbedingt«, fuhr er fort, »doch sehe ich die Notwendigkeit, Kompromisse zu schließen, bescheidener aufzutreten, nicht mit Reichtum zu protzen, keinen Schmuck und keine teuren Kleider auf Roms Straßen zu tragen und schon gar nicht in Kutschen zu fahren wie die Gräfinnen.«
»Aber, Heiliger Vater«, protestierte Lucrezia. »Wir tun doch nur, was sich viele Männer, auch und gerade Männer der Kirche, von uns wünschen, und außerdem zahlen wir Steuern. Ich habe sogar einen Teil der Via Giulia neu pflastern lassen und versorge die Armen regelmäßig mit Almosen.«
Der Papst ließ ein melancholisches Lächeln über seine Lippen huschen, während sein junger Enkel ungefragt und unerwartet ausrief: »Sie hat recht, nonno! Hätten wir kein Zölibat, gäbe es weniger Kurtisanen. Ohne Zölibat könnten die Kurtisanen sogar ehrbare Ehefrauen werden – und so mancher ehrwürdige Diener Gottes im Vatikan wäre glücklich.«
Während Alessandros Onkel Tiberio dessen Worte mit einem tadelnden Räuspern kommentierte, reagierte der Papst mit einem ironischen Schmunzeln. »Das hast du schön gesagt, mein Guter.«
»Ich meine es ernst, nonno!«, ereiferte sich Alessandro. »Und ich weiß, dass auch du ...«
»Lass es gut sein, Alessandro!«, unterbrach ihn der Papst, noch immer freundlich, wenn auch entschieden, und wandte sich wieder Lucrezia zu.
»Du hast recht, meine Tochter – aber trotz eurer Steuern und der sündigen Diener der heiligen Mutter Kirche weht ein neuer Geist. Wir sollten ihn nicht zu einem gefährlichen Sturm werden lassen.« Der Papst erhob sich. »Ich danke dir für dein Geschenk. Es wird einen Ehrenplatz finden. Und nun wird dich mein lieber Tiberio zum Ausgang geleiten.«
Während Lucrezia die Treppe hinunterschritt, dachte sie über die Worte des Papstes nach. Sie waren deutlich gewesen, und doch glaubte sie nicht daran, dass sie ihr Verhalten – schon gar nicht während seines Pontifikats – ändern musste. Kurtisanen konnten doch nicht wie graue Büßerinnen auftreten!
Pater Tiberio hatte bisher kein einziges Wort gesprochen, und noch immer schwieg er, wie auch Alessandro, der ihnen folgte.
Im cortile stand sein Vater Pierluigi, umgeben von ein paar jungen Männern in Fechtkleidung, bewehrt mit Degen und Langdolch. Pierluigi Farnese sagte etwas zu ihnen, und als Lucrezia durch die Arkaden zum Ausgang ging, noch immer flankiert von Pater Tiberio und Alessandro, drehten sich alle Männer nach ihr um, lachten plötzlich, winkten mit ungehörigen Gesten, einige pfiffen sogar.
Pater Tiberio stellte sich vor sie, als müsse er sie abschirmen, aber sie sah nicht ein, warum sie wie eine verhöhnte Hure davonschleichen sollte. Einige der jungen Männer kamen ihr bekannt vor, sie waren vermutlich auf ihrem Fest gewesen. Umso gröber und unhöflicher war ihr Verhalten.
Lucrezia blieb stehen, ging sogar einige Schritte auf die jungen Gecken zu und musterte sie herablassend vom Scheitel bis zur Sohle.
Da standen sie, grinsten höhnisch, aber zugleich unsicher, warfen sich in die Brust, und einer fuhr sich sogar mit einer betonten Geste über die Schamkapsel. Beinahe hätte Lucrezia mit einer entsprechend obszönen Geste geantwortet.
»Dürfen wir Euch, galantdonna, unsere Aufwartung machen?«, rief ein anderer.
Lucrezia verzog ihre Miene in hochmütiger Verachtung, während Pater Tiberio sie zum Ausgang ziehen wollte. Aber sie schüttelte ihn ab.
»Wenn Eure Manieren sich bessern und Eure Börse prall gefüllt ist, gern!«, rief sie ihnen zu.
Sie antworteten mit Gelächter, und wieder umfasste einer unter ihnen seine dick gepolsterte Kapsel, und ein anderer mit einem Wieselgesicht zückte seinen Dolch, fuhr mit einem Finger über die Spitze und ließ seine Zunge zwischen seinen Lippen hervorschnellen.
Angewidert wandte sich Lucrezia ab und folgte Pater Tiberio und Alessandro zum Portal. Marta und Crespo eilten herbei.
»Verzeiht ihr Benehmen, es sind unerzogene Burschen«, flüsterte Pater Tiberio ihr zu. »Ich werde den Heiligen Vater bitten, sie nicht mehr in unserem Palazzo zu dulden. Leider umgibt sich Pierluigi nicht immer mit Männern, die ...« Er verstummte.
»Es waren die Neffen von Bischof Carafa, ›dem Frömmsten unter den Frommen‹«, ergänzte Alessandro. »Giovanni und Carlo, widerliche Kerle. Streitsüchtig und brutal. Vor allem Carlo, der Jüngere, der mit dem Dolch. Es gibt Gerüchte, aber mein Vater ...« Auch er führte seinen Satz nicht zu Ende.
»Ich danke Euch«, sagte Lucrezia, als sie am Portal angekommen waren, verbeugte sich zum Abschied vor Pater Tiberio, lächelte Alessandro an, nicht ohne Augenaufschlag und ausgedehnten Blickkontakt. Als er errötete, lächelte sie erneut, winkte ihm und kämpfte sich dann, mit Marta und Crespo im Schlepptau, durch das Gedränge der Handwerker und Passanten zurück zu ihrer Villa.