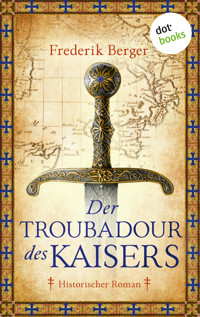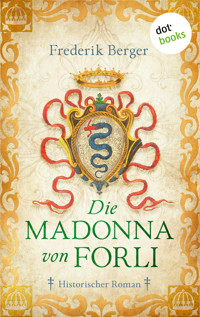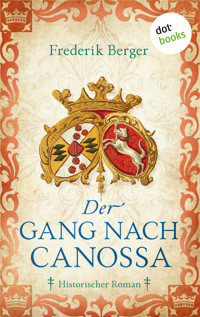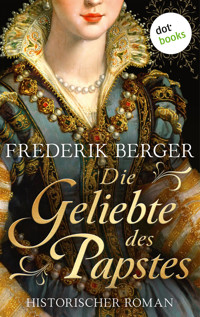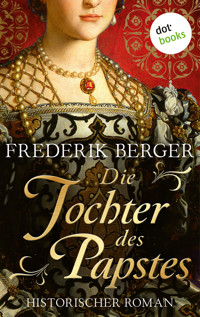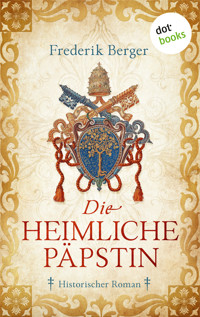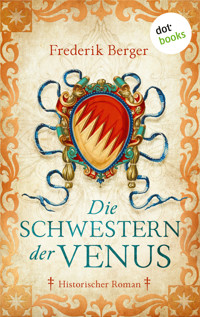
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Edelmann im Bann der »Kaiserin der Kurtisanen« … Venedig im März 1511. Agostino Chigi, durch Glück und Geschick zum reichsten Mann der Ewigen Stadt aufgestiegen, rettet während eines schweren Erdbebens die schöne Francesca und gerät in ihren Bann. Um sie nach Rom zurückzubringen, geht er große Wagnisse ein – doch dort erwartet ihn bereits Imperia, »die Kaiserin der Kurtisanen«, deren Anmut und Gelehrtheit unter den Reichen und Schönen der Stadt legendär sind. Der Finanzier des Papstes ist für sie eine vielversprechende Trophäe, und so beginnt zwischen Agostino, Francesca und Imperia ein Ringen um Liebe und Anerkennung, Reichtum und Macht, das die Aristokratie Roms erschüttern wird – mit fatalem Ausgang … Ein opulenter historischer Roman über das Rom der Renaissance, das in Luxus und schönheitstrunkenen Vergnügungen schwelgte – Fans von Noah Martin werden begeistert sein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Venedig im März 1511. Agostino Chigi, durch Glück und Geschick zum reichsten Mann der Ewigen Stadt aufgestiegen, rettet während eines schweren Erdbebens die schöne Francesca und gerät in ihren Bann. Um sie nach Rom zurückzubringen, geht er große Wagnisse ein – doch dort erwartet ihn bereits Imperia, »die Kaiserin der Kurtisanen«, deren Anmut und Gelehrtheit unter den Reichen und Schönen der Stadt legendär sind. Der Finanzier des Papstes ist für sie eine vielversprechende Trophäe, und so beginnt zwischen Agostino, Francesca und Imperia ein Ringen um Liebe und Anerkennung, Reichtum und Macht, das die Aristokratie Roms erschüttern wird – mit fatalem Ausgang …
Über den Autor:
Frederik Berger (geboren 1945 in Bad Hersfeld) studierte Literatur- und Sozialwissenschaften und lebte einige Zeit im englischen Cambridge und in der Provence. Er arbeitete als Literaturwissenschaftler und Journalist, bevor er hauptberuflich Schriftsteller wurde. Neben Gegenwartsromanen, Sachbüchern und zahlreichen Aufsätzen verfasste er verschiedene historische Romane über den Glanz und die Schatten europäischer Adelsfamilien. Frederik Berger reist viel und ist begeisterter Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Schondorf am Ammersee.
Die Website der des Autors: frederikberger.de
Der Autor auf Instagram: instagram.com/fritzgesing/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine historische Romantrilogie »Das Siegel der Farnese« mit den Bänden »Die Geliebte des Papstes«, »Die Tochter des Papstes« und »Die Kurtisane des Papstes«. Außerdem erschienen seine opulenten historischen Romane »Die heimliche Päpstin«, »Die Provençalin«, »Der Gang nach Canossa«, »Die Schwestern der Venus«, »Die Madonna von Forlì« und »Der Botschafter des Kaisers«.
***
eBook-Neuausgabe März 2025
Copyright © der Originalausgabe Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2012
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/John Erickson, Shapevector und die Digitale Bibliothek München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-534-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Frederik Berger
Die Schwestern der Venus
Historischer Roman
dotbooks.
Widmung
Für Sandro Pignatti,
der mich durch die Villa Farnesina führte und ihren Genius Loci zum Leben erweckte, mit Dank
Motto
In noi vive, e qui giace la divina Beltà da morte anz’ il suo tempo offesa.
In uns lebt, und hier liegt die göttliche Schönheit, vom Tode vor ihrer Zeit niedergestreckt.
Michelangelo Buonarroti
TEIL I
Kapitel 1
Ein Gefühl lähmender Angst schreckte sie aus dem Schlaf. Regungslos lauschte sie, die Augen aufgerissen, doch die Dunkelheit im Raum blieb undurchdringlich. Neben ihr atmeten kaum hörbar ihre zwei Schwestern. Vom Zimmer ihrer Eltern drangen ein tiefer Seufzer und das Schnarchen ihres Vaters herüber. Sonst war es still. Warum sie aufgewacht war, wusste sie nicht, und warum die lähmende Angst sie überfallen hatte, noch weniger. Lauschte sie genauer, hörte sie ein untergründiges Rauschen, ein kaum auslotbares Geräusch, das sie nicht zum ersten Mal wahrnahm. Es hatte sie bisher nie beunruhigt, da Venedig auf Wasser stand, auf Tausenden von Eichenpfählen, durchzogen war von Kanälen – nein, da musste etwas anderes gewesen sein ...
Francesca Ordeaschi, die lebenslustige und aufgeweckte Tochter des Krämers Ludovico Ordeaschi und seiner Frau Anna Maria, setzte sich kurz auf und ließ ihren Nacken dann wieder auf die Kissenrolle fallen. Sie fröstelte, der März des Jahres 1511 war kühl und regnerisch, die Stadt ächzte unter den Folgen des Krieges gegen die Liga von Cambrai, die Geschäfte gingen schlecht, sehr schlecht sogar, wie Francescas Vater täglich mit düsterer Stimme berichtete, er wisse nicht mehr, die nimmersatten Mäuler seiner Familie zu ernähren ...
Plötzlich ein tiefes, fernes Rumpeln, begleitet von einem Knirschen und einem lauten Knacken, als stünden Holzbalken direkt vor dem Brechen.
Francesca flüsterte die Namen ihrer Schwestern. Auch sie waren wach. »Was ist das?«, fragte Caterina, die Ältere. »Ich habe Angst«, jammerte Camilla, die Jüngere. Der Vater schnarchte noch immer, aber die Mutter hatte ein Talglicht angezündet, man sah einen schwachen Lichtschein unter dem Türspalt hervorquellen.
Vorsichtig schob Francesca ihre Füße aus dem Bett und tastete sich zur Tür, öffnete sie. Mit wirren Haaren stand ihre Mutter in ihrem weißen Nachtkleid vor ihr, wie ein Gespenst.
»Was ist mit dir, kannst du nicht schlafen?«, fragte sie verärgert. »Das Schnarchen deines Vaters raubt mir den Schlaf ...«
»Da war ein seltsames Geräusch ...«, flüsterte Francesca.
»Du hast schlecht geträumt. Geh zurück ins Bett!«
Das Muttergespenst schwebte zu den Schwestern, die ihr die Arme entgegenstreckten, setzte sich zu ihnen, strich ihnen beruhigend über den Kopf, beachtete Francesca nicht weiter.
Und wieder das Rumpeln, diesmal lauter! Zugleich spürte Francesca ein Zittern an ihren nackten Füßen, dann bewegte sich der Boden schwindelerregend. Die Mutter schrie auf, Caterina und Camilla klammerten sich an sie, der Vater fuhr aus seinem Schnarchen hoch, und aus dem schmalen Kabuff nebenan hörte Francesca ihren kleinen Bruder aufweinen.
Noch bevor sie etwas sagen konnte, brach es über sie herein.
Zuerst ein ungeheures Poltern, Knirschen, Brechen, wie aus den Tiefen der Hölle aufsteigend, begleitet von einem erneuten Zittern des Bodens, des ganzen Hauses. Plötzlich schwankten Decken und Wände, und wie von Geisterhand gezogen, erschien ein schwarzer Riss quer über der Tür.
Die Mutter ließ das Talglicht fallen. Francesca hob es blitzschnell auf, bevor es erlosch, und stürzte die Treppe hinunter. Sie wollte ins Freie, wollte nicht begraben werden unter dem einstürzenden Haus, den schweren Balken, oder eingeschlossen, während sich Feuer ausbreitete, bei lebendem Leib verbrennen ... und wieder ein Stoß, diesmal kurz und heftig, gefolgt von einem Krachen, Scheppern und Rattern, und erneut das tiefe Rumpeln, überlagert von klatschenden Geräuschen, die Becher und das einzige Muranoglas, das ihr Vater besaß, fielen von den Borden, Zinnteller schepperten zu Boden ...
»Nur raus hier!«, hörte sie den Vater schreien, die Mutter rief nach Licht, und wieder ein Stoß, der so stark war, dass Francesca beinahe gefallen wäre. Auf der Gasse gellende Schreie und Rufe, ein Aufheulen, dem ein ungeheures Krachen folgte, als wäre das Haus nebenan eingestürzt, und dann tierisches Schmerzgebrüll.
Sie riss die Tür auf, die ins Freie führte, stürzte auf die Gasse. Über ihr stand der fast volle Mond am Himmel, unter ihm die Schornsteine mit ihren trichterförmigen Öffnungen, wie aufgerissene Münder, wankend, wie Baumstämme im Sturm, und nicht nur die Schornsteine wankten, die Häuser wankten wie betrunken, und vor ihr prasselten ganze Ladungen von Dachziegeln aufs Pflaster und zersplitterten in tausend Geschosse.
Francesca schaute sich nach ihrer Familie um, doch da sie niemand sah, rannte sie los, sprang über die Scherben, hielt geistesgegenwärtig ihre Hände über den Kopf, lief zickzack von der einen zur anderen Seite, stieß mit einem Nachbarn zusammen, der wie ein Ochse brüllte, er sank nieder, seine junge Frau versuchte ihn zu halten, über sein Gesicht lief Blut, in ein Auge hinein, die Nase entlang und in den Mund, er spie es aus und röchelte.
Als Francesca den Campo San Martino erreichte, hörte sie aus dem Krachen, Poltern, Beben und Knirschen heraus die Glocken: Alle Glocken der Stadt begannen gleichzeitig zu läuten, zu dröhnen, zu warnen vor dem Verderben, vor dem endgültigen Untergang der Stadt, die zusammenbrach und im Meer zu versinken drohte.
Trat jetzt ein, wovor die Wanderprediger seit Monaten auf allen Plätzen Venedigs mit heiseren Stimmen gewarnt hatten? Der Vater berichtete täglich von ihren fanatischen Predigten gegen das sündige Treiben in der Stadt. Sie selbst durfte nur zum Besuch der Kirche, ihrer Nonnenschule und in Begleitung ihrer Mutter auf die Straße, selten mit dem Vater zu seinen Geschäften, es ging um Sittsamkeit und Gefährdung. Dennoch stahl sie sich gelegentlich allein aus dem Haus, in ärmlicher Kleidung wie eine Bettlerin und nicht ohne ihr Gesicht zu beschmutzen, huschte neugierig durch die Gassen und über die Kanäle, beobachtete die Menschen, lauschte verstohlen ihren Unterhaltungen und genoss dabei den Kitzel des verbotenen Abenteuers.
Und wieder ein Erdstoß, tausendfaches Schreien, die Fassade der Chiesa San Martino wankte, der Heilige neigte sich von seinem Sockel und fiel, zuerst langsam, dann immer rascher und zerschmetterte einen Mann. Blut spritzte, der Kopf des Heiligen rollte über das Pflaster bis zu dem Brunnen in der Mitte des Campo.
Francesca rannte weiter, über den Ponte dei Penini, folgte den Menschentrauben, die alle zum Kai von San Marco zu drängen schienen. Tatsächlich tauchte plötzlich das schwarze Wasser der Lagune vor ihr auf, wild taumelten Boote und Gondeln in der Nähe des Ufers, ihre nassen Füße schmerzten, und bevor sie sich versah, warf eine Welle sie um. Ihr Schrei ging im Gurgeln unter, sie strampelte und schlug um sich, kämpfte gegen das an Land flutende Wasser, bis sie mühsam Halt fand, sich aufrichten wollte, und wieder riss ihr das zurückströmende Wasser die Füße vom Boden ...
Zwei Hände griffen nach ihr, hielten sie fest. Sie schaute in das nasse Gesicht eines Mannes, der so alt war wie ihr Vater, vornehm gekleidet, mit einem seidenen, gefütterten Mantel und einem roten Barett auf dem Kopf – mit letzter Kraft klammerte sie sich an ihn.
Der Mann sagte etwas Beruhigendes, sie verstand ihn nicht, nur die sanfte, weiche Stimme hob sich ab vom Geschrei um sie herum. Er stützte sie, trug sie, dann wankte erneut der Boden, so dass der Mann mit ihr fast umgefallen wäre. Das Wasser schwappte hoch, spritzte und gurgelte, und wie auf Befehl verstummten alle Glocken der Stadt.
Die Menschen verstummten ebenfalls, als erwarteten sie, dass Gott zu ihnen spräche.
Noch einmal ein tiefes Grummeln, eine Säule krachte vor ihnen auf den Boden – nun schrien die Menschen wieder, riefen um Hilfe, manche rissen die Arme hoch, andere sackten einfach um. Überall lagen Tote in ihrem Blut, Verletzte, halb im Wasser, krochen über den Boden. Flammen leckten aus mehreren Fenstern, begleitet von aufbauschenden Wolken aus Rauch, der auch aus den Gassen quoll, in die Höhe schoss, den Mond verdunkelte und ihr den Atem nahm.
Dann nur noch Schwärze.
Als Francesca aus der Ohnmacht aufwachte, spürte sie ein sanftes Schaukeln. Ihr Kopf lag im Schoß des Mannes, der sie gehalten hatte. Sie befanden sich in einer Gondel, umgeben von anderen Gondeln, die sich alle auf dem Canale San Marco von der Kaimauer entfernt hatten, so dass sie keine herabstürzenden Teile erreichen konnten. Der Dogenpalast schien im Wirbel der Rauchschwaden zu tanzen, der Campanile neben ihm, dunkel gegen den Feuerschein abgesetzt, reckte sich wie eine drohende Faust in den Himmel. Den Mond konnte sie nicht mehr entdecken. Aus einem Palazzo in der Nähe des Dogenpalasts züngelten kleine Flammen, in einem Fenster waren Teile der tragenden Fassadensäulen eingeknickt.
Francesca musste husten, weil beißende Rauchschwaden über das Wasser zogen und ihr den Atem nahmen. Dann schielte sie nach oben, zu ihrem Retter, unter dessen Barett angegraute Haare hervorquollen. Eine scharfgeschnittene, überaus kräftige Adlernase harkte das Gesicht in zwei Teile, aber die großen, blassblauen Augen lagen sanft und beruhigend auf ihr, der Mund lächelte freundlich – zumindest schien es ihr so im flackernden, aber schwachen und rauchgeschwängerten Licht.
Er strich ihr übers Gesicht, flüsterte: »Du bist in Sicherheit, ich konnte uns retten. Ein schweres Erdbeben ...«
Er musste husten, wie auch der Gondoliere, der mühsam das schaukelnde Boot zwischen anderen Booten hindurchzulavieren versuchte.
Sie erwiderte sein Lächeln, richtete sich auf. Als sie nach ihren brennenden Füßen schaute, bemerkte sie, dass sie notdürftig mit einem blutdurchtränkten Tuch umwickelt waren. Sie erinnerte sich jetzt, dass sie barfuß aus dem Haus gestürzt war. Ihr Retter hatte ihren Blick wahrgenommen und sagte: »Deine Fußsohlen sind von Schnittwunden übersät. Hast du Schmerzen?«
Sie schüttelte den Kopf, bewegte ihre Gelenke. Sonst schien sie unverletzt zu sein. Vorsichtig setzte sie sich auf die weiche Bank, dem Mann gegenüber, musterte ihn forschend. Dies durfte sich, wie ihr sofort einfiel, ein junges Mädchen nicht erlauben; doch in diesem Augenblick war ihr gleichgültig, was die strenge Mutter ihr beigebracht hatte.
Der Mann lächelte sie an, und sie lächelte zurück.
»Ihr habt mich gerettet«, flüsterte sie.
»Ich glaube schon«, antwortete er, noch immer lächelnd.
Dann schaute sie sich um und versuchte sich zu besinnen: Venedig war nicht im Orkus versunken, nicht in die Hölle hinabgerissen worden, nicht vom Meer überspült – ein Erdbeben hatte es heimgesucht, in diesem trüben und kalten März, in Zeiten, in denen gierige und gewaltbereite Männer wie hungrige Wölfe nach Beute suchten, ausgemergelte Kinder den Passanten ihre skelettdürren Finger entgegenstreckten, in denen Bettler wie Aasfliegen auf jedes edle Gewand flogen und aufgedunsene Tote morgens durch die Kanäle trieben. Ihr Vater berichtete immer wieder davon, wenn er verbittert nach Hause kam, weil er wieder nichts verkauft hatte, wenn er, der sonst so sanft war, auf alle Gauner der Stadt fluchte, auf das Geschmeiß des Adels, der noch immer Feste feiere, als stünde Venedig nicht das Wasser am Hals, auf die blutsaugerischen Geldverleiher, auf Krieg und Papst, auf den französischen König, auf Kaiser Maximilian, den Sultan und die ganze Welt.
Erst gestern war es zu einem solchen Ausbruch gekommen. Nach einer Weile fiel sein Poltern und Fluchen in sich zusammen, verpuffte im trüben Schweigen. Er ließ sich auf die Holzbank der Küche fallen, verbarg sein Gesicht. Nun baute sich die Mutter vor ihm auf, die Arme in die Seite gestemmt, und fuhr ihn an, er solle sich nicht so gehen lassen, solle arbeiten und kämpfen und Geld verdienen. »Wenn du nicht so viel Geld an deine Huren vergeudet hättest, ginge es uns heute besser.«
Er schaute müde auf. »Was verstehst du schon von Geschäften!«, stieß er verächtlich aus und zog Francesca, die neben ihm stand, an sich heran.
Dies schien die Mutter noch wütender zu machen. »Ja, du und dein Herzchen! Eines Tages werde ich gehen, und dann sieh zu, wie du dich und deine Lieblingstochter ernährst! Vielleicht wird sie dich sogar ernähren!«
Der Vater ließ Francesca los, stand auf und machte eine Bewegung, als wollte er die Mutter ohrfeigen. Mit einem verächtlichen Laut gab sie ihm einen Stoß, schnappte sich ihren weinenden Jüngsten und verzog sich.
Die Eltern stritten oft, aber dann hörte Francesca abends auch wieder das Bettgestell im Nebenraum knarzen, die Mutter kicherte, der Vater stöhnte, die Knarzgeräusche wurden regelmäßiger und heftiger, die Mutter stieß einen kurzen Schrei aus, unterdrückte den nächsten. Francesca konnte nicht einschlafen, wenn ihre Eltern sich liebten. Sie fühlte selbst ein Ziehen und Drängen, ein süßes, feuchtes Sehnen, ihre Hand wanderte an Stellen, an denen sie nichts zu suchen hatte, und diese Sünde, die sie nicht einmal zu beichten wagte, quälte sie. Aber dann fragte sie sich doch, wie es wäre, wenn ein schöner junger Mann – sie presste die Augenlider zusammen – zwischen ihre Schenkel glitte ... Der junge Maler aus der Nachbarschaft zum Beispiel, von dem sie nicht einmal den Namen kannte. Er hatte ihr einmal zugewinkt, als sie an einem heißen Tag auf der Fensterbank eine frische Meeresbrise genoss und sich dabei die Haare auskämmte. Zuerst hatte sie sein Winken betont übersehen, doch als er einen Stift in die Hand nahm und auf ein Stück Karton etwas zeichnete, hatte sie sich empört abwenden wollen. Dann blieb sie aber trotzig sitzen, lächelte ihm sogar zu.
Francesca wurde wieder in die Gegenwart zurückgerissen, als eine andere Gondel unsanft an ihre stieß und die beiden Gondolieri sich mit rüden Worten beschimpften. Noch immer brannten zahlreiche Häuser, auch hörte sie ein lautes Krachen, als das beschädigte Haus in der Nähe des Dogenpalast zuerst ein wenig nach unten sackte und dann langsam, schließlich immer schneller in sich zusammenstürzte. Ein vielstimmiger Aufschrei folgte.
Ihr Retter neben ihr lachte kurz auf, aber es steckte zugleich ein ratloses, kopfschüttelndes Erstaunen in diesem Lachen, er nestelte an seinem Wams und hielt plötzlich eine Goldmünze hoch, eine venezianische Zechine, drehte sie wie ein geschickter Gaukler zwischen Daumen und Mittelfinger, warf sie schließlich in hohem Bogen in die Luft.
Er fing die Münze nicht etwa auf, sondern ließ sie ins Wasser platschen, wo sie versank. Mehrere Gondolieri sprangen ihr sofort hinterher, und einem gelang es tatsächlich, sie aus dem schwarzen Grund des Kanals zu fischen.
»Behalte sie!«, rief ihm ihr Retter großzügig zu.
Der Palazzo am Ufer war jetzt lediglich ein in Rauch und Staub verhüllter Steinhaufen.
Francesca schien alles albtraumhaft, unwirklich – sie hockte auf dem weichen Sitz einer Gondel, und vor ihr saß dieser vornehme Mann in seiner kostbaren Kleidung, betrachtete sie unverwandt aus seinen milden, lebendigen Augen.
»Wen habe ich da retten dürfen?«, fragte er, so ruhig, als sei das ganze Erdbeben mit all seinen Toten und Bränden und schreienden Menschen nichts als ein übermütiges Karnevalsvergnügen.
»Ich heiße Francesca«, antwortete sie errötend, »Francesca Ordeaschi, mein Vater ist ein Händler, wir wohnen am Rande des Sestiere Castello.«
»Dann verbindet uns etwas«, antwortete ihr Retter. »Auch ich bin Händler, verleihe zudem ein wenig Geld. Mein Name ist Agostino Chigi, und ich komme aus Rom.«
Kapitel 2
Agostino Chigi, der reichste Bankherr und Fernhandelskaufmann Roms, Freund und Darlehensgeber von Papst Julius II., der ihm so zugetan war, dass Chigi seinen Namen mit dem Zusatz der Papstfamilie della Rovere schmücken durfte, war nach Venedig gekommen, um bei seinem langjährigen Geschäftspartner Alessandro Franci hohe Außenstände einzutreiben, in der Hauptsache aber, um mit der Serenissima, die seit neuestem Bündnispartner des Papstes war, einen Vertrag zu schließen. Es ging um ein Darlehen in Höhe von zwanzigtausend Dukaten. Venedig hatte einen seiner schlimmsten Winter seit Menschengedenken hinter sich und benötigte für seine Verteidigung dringend Bargeld, um seine Condottieri und Söldner zu bezahlen. Chigi war in der Lage, der Stadt das Geld sofort auszuzahlen, aber natürlich benötigte er Sicherheiten, und außerdem knüpfte er die Gewährung des Darlehens an eine Bedingung.
Chigis Bedingung bestand darin, dem von ihm gepachteten und unter seiner Leitung gewonnenen Alaun, den man in erster Linie zum Färben von Tüchern und in der Glasherstellung benötigte und der in den päpstlichen Minen bei Tolfa nördlich von Rom abgebaut wurde, eine Monopolstellung in den westlichen Ländern Europas zu ermöglichen. Venedig spielte als Hauptumschlagsplatz des kleinasiatischen Alauns eine entscheidende Rolle und war so in der Lage, die Monopolstellung des päpstlichen Alauns zu sichern oder zu durchbrechen. Agostino Chigi war eigens vom Papst beauftragt worden, das Monopol unbedingt durchzusetzen. Eigene und päpstliche Interessen fielen somit in dem gemeinsamen Ziel zusammen, die Alaunpreise diktieren und hochhalten zu können.
Der komplizierte Darlehensvertrag lag im März 1511 zu Chigis Zufriedenheit vor, weitgehend ausgehandelt, allerdings noch nicht unterschrieben. Es gab Widerstände in der venezianischen Regierung und unter den wichtigen Familien der Stadt, von denen fünfzig eine Ausfallbürgschaft unterzeichnen sollten. Chigi wusste, dass die Serenissima mit ihrer verschlungenen Regierungsform aus den sich gegenseitig kontrollierenden Gremien der Savi, Dieci und Pregadi und dem überaus klugen Dogen Leonardo Loredan ein Geschäftspartner war, der sich selten übers Ohr hauen ließ. Im Gegenteil! Wie es dem Dogen gelungen war, Papst Julius aus der antivenezianischen Liga von Cambrai herauszubrechen und auf die Seite der Serenissima zu ziehen, war ein Glanzstück diplomatischen Geschicks und vermutlich die Rettung der Stadt, der militärisch, ökonomisch und politisch das Wasser am Hals stand, wie man überall sehen und hören konnte.
Trotz dieser prekären Situation am Rande der Katastrophe und trotz des Luxusverbots luden Venedigs reiche Familien, die Grimani, Vendramin, Priuli, den römischen Geschäftspartner der Stadt zu pompösen Festen ein und taten so, als habe Venedig nicht fast seinen gesamten Festlandsbesitz verloren und könne seine Söldner wie zuvor bezahlen.
Die unaufdringliche, dadurch aber um so wirkungsvollere Überheblichkeit der Venezianer war dabei ebenso erstaunlich wie die Raffinesse ihrer gebildeten Kurtisanen, die durchaus mit den schönsten und klügsten Kurtisanen Roms konkurrieren konnten.
Chigi verbrachte den Abend vor dem Erdbeben in einem ausgewählten Kreis von Schönen, die ihn einlullten mit Lautenspiel und Taubenzungen, mit durchsichtigem Schleiertanz und betörend reimenden Versen – für einen unverschämt hohen Preis natürlich –, er musste den Krösus spielen, den Mann, der über unerschöpfliche Geldquellen verfügte, den Kenner von Kunst und weiblicher Wohlgestalt, von Gaumenfreuden und Liebesspiel. Dabei gab er sich bis zur Grenze des Genusses den Vergnügungen hin – mit einem Augenzwinkern, doch erschöpft erläuterte er Raffaele Befalù, seinem Stellvertreter und fattore in Venedig: »Alles geschieht im Dienste des Geschäfts, man muss in jeder Lebenslage seinen Mann stehen.« Dabei lachte er fröhlich und von sich selbst überzeugt, verließ schließlich gemeinsam mit Befalù das Haus der schönen Venusjüngerinnen und atmete auf. Endlich konnte er die schweren Räucherdüfte hinter sich lassen und sich noch ein wenig die Beine vertreten.
Während Befalù mit den Leibwächtern ein paar Schritte hinter ihm blieb, verglich Chigi die beiden venezianischen Kurtisanen mit Roms großer Imperia, seiner Imperia, und musste feststellen: Imperia blieb in ihrer Schönheit und Liebeskunst unübertroffen. Seit er sie kannte, verhielt sie sich nach einem guten Mahl, kluger Konversation und einem aufreizenden Flötenspiel abwartend wie eine sprungbereite Katze und dann hungrig wie eine Löwin, raffiniert in ihrer Verführungstaktik, einfallsreich in ihrem Stellungsspiel und leidenschaftlich auf dem Höhepunkt. Er hatte sie kennengelernt, als sie sehr jung war; bald darauf brachte sie seine Tochter auf die Welt. Mittlerweile hatte sie ihr dreißigstes Lebensjahr erreicht und wurde von ihm noch immer besucht. Ja, es hatte sich eine tiefe Zuneigung zwischen ihnen entwickelt, obwohl langsam das Alter im Liebreiz der Venus durchschimmerte.
Als er, in Gedanken an Imperia noch immer die frische Nachtluft genießend, kräftig ausschritt, um endlich seine Unterkunft zu erreichen und ins Bett sinken zu können, brachte das Erdbeben, wie ein Donner aus nächtlichem Mondscheinhimmel, die Stadt ins Wanken.
Anfangs hatte er es nicht glauben wollen.
So richtig im Zentrum eines Bebens hatte er noch nie gestanden, trotz seiner weiten Reisen, und selbst als alles wackelte und wankte, ratschte und rumpelte, als die Heiligen von den Sockeln fielen und die Menschen schreiend durch die Gassen stolperten, schien ihm das Ganze wie ein aufwändiges Theater, wie ein Karnevalsfest mit Feuerwerk und allem Drum und Dran. Er glaubte, dass die Erdstöße der Stadt und ihren Menschen nicht wirklich etwas anhaben konnten. Und ihm schon gar nicht. Schon immer fühlte er sich als Glückspilz, der unter günstiger Sternenkonstellation geboren war. Allerdings würden die Folgen des Bebens den Abschluss seiner Geschäfte verzögern. Dies sah er voraus, und dies war misslich.
Seine Leibwache, die ihn vor desperaten Bettlern und gewaltbereiten Söldnern schützen sollte, stürzte in Panik davon, als die ersten Dachziegel wie Geschosse herniederprasselten. Die Menschen drängten und schoben ihn in ihrer Panik durch die Gassen, und tatsächlich gab es eine Reihe von Toten oder Verletzten in seiner Nähe. Dann kam ihm auch Befalù abhanden.
Als Chigi schließlich mit nassen Füßen, aber unverletzt am Kai des Canale San Marco landete, auf dessen heftigen Wellen die Gondeln tanzten, stieß er auf das Mädchen, das, in seinem leinenen Nachtkleid umherirrend, von heftig über die Mole schlagenden Wellen ergriffen wurde und zu ertrinken drohte. Jung und trotz der Ohnmacht von einer verlockenden Frische, sinnlich, ja, verführerisch mit prallen, festen Formen und dem üppigen Glanz wirrer Haare – er spürte die fesselnde Wirkung ihres Körpers sofort, als er sie festhielt und an sich zog, sie schließlich hochhob, um sie in Sicherheit zu bringen. Noch etwas anderes traf ihn, so dass sein Herz plötzlich auszusetzen schien und dann in heftiges Rasen geriet.
Das Mädchen auf den Armen, schleppte er sich durch die Wellen zum Kai und versprach einem Gondoliere eine ganze Zechine, kramte das glänzende Goldstück aus seinem Wams, und der Kerl mit zwei fehlenden Zähnen und einer Hakennase, dazu aschblonden Haaren, ließ sich nicht zweimal bitten, die Münze zu ergreifen und dem vornehmen Herrn die Ohnmächtige abzunehmen, um sie auf dem weich ausgeschlagenen Sitz niederzulegen.
Kaum hatte sich Chigi gesetzt, ruderte der Gondoliere hinaus auf den breiten Kanal, auf San Giorgio Maggiore zu, wo sie in Sicherheit waren und der Rauch sie weniger am Atmen hinderte.
Chigi bedeckte die junge Frau mit seinem pelzgefütterten Mantel und versorgte die blutenden Füße, bettete sie dann bequemer und legte ihren Kopf auf seinen Schoß. Heiliger Christophorus, dachte er, was widerfährt mir in dieser seltsamen Stadt! Es durchfuhr ihn so etwas wie ein heiliger Schauer, den er in seinem Leben bisher nur an drei entscheidenden Tagen gespürt hatte: Als er den ersten Pachtvertrag mit Papst Alexander VI. Borgia über die Weiderechte in der Hand hielt – dieser Pachtvertrag begründete seinen wirtschaftlichen Aufstieg. Als er das verwunschene Gelände entdeckte, auf dem er später seine Villa suburbana, seine Chigiana deliziosa, bauen würde. Und als er seiner Margherita zum ersten Mal begegnete und ihn unmissverständlich wie ein Blitz die Erleuchtung traf: Diese junge betörende Frau muss einmal dein dir angetrautes Weib werden. Alle drei Ereignisse lagen lange zurück, blieben aber eingebrannt in sein Gedächtnis wie ein Brandmal.
Was ihn jetzt wie ein erneuter Blitz im Donnergetöse des Erdbebens getroffen hatte, war die Ähnlichkeit zwischen seiner Margherita und der von ihm geretteten jungen Frau.
Während Chigi auf die Bewusstlose starrte und nicht glauben wollte, was ihm da zugestoßen war, kam sie wieder zu sich. Chigi lächelte sie an und fragte nach ihrem Namen. Francesca hieß sie. Ein schöner Name, der einen mutigen und wilden, aber auch handfesten Charakter vermuten ließ. Francesca klang fast so schön wie Margherita. Margherita war in seinen Augen der schönste aller Frauennamen, magisch und geheimnisvoll, verführerisch, doch auch von unvergänglichem Trauerhauch umweht. Francesca klang bescheidener, weder so erinnerungsträchtig wie Margherita noch so auftrumpfend hochherrschaftlich und siegessicher wie Imperia.
Chigi unterdrückte einen wehmütigen Seufzer. Seine Margherita würde er nie vergessen, auch wenn ihr Tod im Kindbett bereits lange zurücklag. Ihr hatte er ewige Treue geschworen.
»Ich danke Euch, Ihr habt mir das Leben gerettet, Signore«, sagte Francesca, während sie sich aufsetzte und ihm erstaunlich ungehemmt in die Augen sah.
»Es war meine Pflicht als Christenmensch«, antwortete er. Charmant lächelnd fügte er an: »Und natürlich eine Freude.«
Jetzt lächelte auch sie, schwach zwar und ein wenig ängstlich – genau wie Margherita bei ihrer ersten Begegnung auf dem Ponte Sant’Angelo. Noch heute legte er nachts, wenn er sich unbeobachtet wähnte, eine rote Rose an die Stelle, an der ihn das Schicksal seiner ersten und einzigen wirklichen Liebe ereilt hatte.
Nun wurde ihm wieder die Situation bewusst, in der sie sich befanden. »Hast du keine Angst?«, fragte er sie. »Ich meine, vor dem Erdbeben – deine Eltern ... Wo wohnst du?«
Obwohl in dem rötlichen Glimmerlicht ihre Haut rosig wirkte, meinte Chigi erkennen zu können, dass Francesca vor Schrecken erbleichte. »Meine Eltern, meine Geschwister ...«, stammelte sie. »Ich bin einfach weggerannt. Ich glaubte, unser Haus würde zusammenbrechen, alles wankte und krachte ...«
Sie begann zu zittern und konnte nicht weitersprechen, weil sie gleichzeitig auf das Ufer starren musste, an dessen Rand ein Palazzo in sich zusammensackte. Dies war wirklich ein seltsames Schauspiel.
Wie unter Zwang zog Chigi eine Zechine aus seinem Wams, hielt sie kurz hoch, drehte sie zwischen den Fingern – ein altes Kunststückchen, das er von seinem Vater gelernt hatte und mit dem er Margherita immer zum Lachen hatte bringen können. In hohem Bogen schnipste er sie ins Wasser.
Einige der Gondolieri hatten ihn beobachtet und sprangen, obwohl das Wasser eiskalt sein musste, der Münze hinterher. Einem gelang es sogar, sie zu greifen, was erstaunlich war, denn das schwere Gold sank rasch, aber es bestand kein Zweifel: Er hielt die Zechine triumphierend hoch. Natürlich überließ Chigi sie ihm.
Als Francesca, die ihren Blick nicht von dem eingestürzten Haus hatte lösen können, sich schließlich Chigi zuwandte, zitterte sie noch immer. Er setzte sich neben sie und legte den Arm um ihre Schulter, um sie zu wärmen und zu beruhigen. Ohne Scheu lehnte sie den Kopf an ihn. Als er ihr väterlich über die Wangen strich, schien sie sich stärker an ihn zu schmiegen. Er ergriff ihre Hand. Sie schaute kurz auf, sagte jedoch nichts, seufzte.
Kein Ring schmückte ihre schlanken Finger. Sie sahen nach Arbeit aus und waren ganz kalt. Als könnte er sie verbrennen, hauchte er vorsichtig seinen Atem über sie. Wie alt mochte die Nymphe wohl sein? Vermutlich so alt wie Margherita damals, ein wenig älter als sein Kurtisanentöchterchen heute. Ja, sie könnte seine Tochter sein, sogar seine Enkelin, hatte vermutlich nicht einmal das Heiratsalter erreicht: Sie begann erst, sich aus dem Knospenstadium zu schälen und die Blüte ihrer Weiblichkeit zu entfalten.
Ein Wink des Schicksals hatte Chigi in seinem tiefsten Inneren getroffen. Dies spürte er. Sollte die Wiedergeborene, die Wiederauferstandene in ihrer jungfräulichen Frische, in ihrem Glücksversprechen die Pforte seines Herzens erneut aufgestoßen und ihm eine überraschende, überwältigende Liebesbotschaft gesandt haben?
Kapitel 3
Vor Morgengrauen wachte Francesca auf. Noch immer schaukelte sie mit ihrem Retter in der Gondel vor dem Dogenpalast, hinter dem rötliche Rauchschwaden den Himmel bedrohlich erleuchteten. Er war wach, und als sie sich aufrichtete, lächelte er sie an und konnte die Augen nicht von ihr wenden, als sei sie die Madonna persönlich.
Sie spürte sich erröten, weil sie auf dem Schoß eines Fremden eingeschlafen war, weil sie noch immer das Nachthemd trug, in dem sie auf die Gasse gerannt und umhergeirrt war. Der Fremde hatte ihr allerdings seinen wärmenden Mantel umgelegt.
»Ich wohne am Rande des Castello-Viertels, in der Nähe des Arsenale«, sagte sie leise. »Könnt Ihr mich zu meinen Eltern und Geschwistern zurückbringen? Hoffentlich leben sie noch. Sie werden Angst um mich haben.«
Ihr Retter nickte, gab dem Gondoliere einen Wink, und mühsam bugsierte der Mann sein Gefährt durch das Dickicht der anderen Boote. Schattenhaft lag der Dogenpalast auf der linken Seite, hinter ihnen, ebenso schattenhaft, San Giorgio Maggiore. Langsam graute der Tag, nur noch der Morgenstern leuchtete am rauchigen Himmel.
Als die Sonne sich blutrot aus der Lagune erhob, gingen sie bei San Biagio an Land. Ihr Retter gab dem Gondoliere eine zweite Zechine und ließ sich von ihr in das Gewirr der Gassen führen. Weil sie an all den klagenden Verletzten und den stummen Toten vorbei über die Trümmern eilte und er nicht mitkam, streckte sie ihre Hand aus, um ihn zu ziehen. Tatsächlich nahm er die Hand, lachte kurz auf und hüpfte dann fast wie ein Jüngling über die Ziegel und Mauerbrocken.
Das Haus der Eltern war auf den ersten Blick unversehrt geblieben. Als Francesca über einen heruntergestürzten Balken zur Tür kletterte, verunsichert jetzt, als kehre sie von etwas Verbotenem zurück, stürzte auch schon der Vater aus der Tür, riss sie mit einem Schrei der Freude und Erleichterung an sich, ihm folgte die Mutter, den Kleinen auf dem Arm, hinter ihr Caterina und Camilla, alle mit verschmierten Gesichtern und staubiger Kleidung.
»Du lebst!« Dem Vater standen die Tränen in den Augen.
Dann fiel sein Blick auf ihren Retter, und er wurde ernst, ja, abweisend. Die Mutter stammelte: »Ihr bringt uns unsere Tochter?«
Signor Chigi erläuterte kurz, was geschehen war. Als er seinen Bericht beendet hatte, entstand eine Pause, in der alle schwiegen. Ihre Eltern erwarteten, dass er sich verabschiede, doch ihr Retter zögerte, suchte nach irgendwelchen Worten, ohne sie zu finden, und hatte es dann plötzlich eilig, die ärmliche Ecke der Stadt, in der sie wohnten, zu verlassen. Er deutete nur eine Abschiedsgeste an, sie vermochte sich nicht einmal bei ihm zu bedanken. Fast hätte er den pelzgefütterten Mantel vergessen. Sie rief ihm nach, er kehrte zurück, machte eine Geste, als wollte er ihr den Mantel schenken – doch da hatte sie ihn bereits ausgezogen und ihm gereicht. Die Mutter schrie auf, als sie ihre Tochter im Nachthemd sah, schrie »Ludovico, das Kind!« und »O Maria, hab Erbarmen, diese Schande!«
Rasch umfasste sie der Vater, als könnte er sie auf diese Weise verbergen. Jetzt verabschiedete ihr Retter sich mit einer Verbeugung und rief lächelnd: »Auf Wiedersehen. Bis bald.«
Sie lächelte zurück, wollte seine Worte wiederholen, doch ein kurzer Blick zu ihren Eltern ließ sie verstummen. Leichtfüßig stieg ihr Retter über die Trümmer. Als ihm ein verletzter, blutverkrusteter Mann den Arm entgegenstreckte, half er ihm auf die Beine, und obwohl der Verletzte seinen kostbaren Mantel beschmutzte, stützte er ihn.
Bis bald hatte er gesagt. Ob sie ihn wiedersehen würde?
Widerstrebend folgte sie dem Vater ins Haus. Hinter ihr rief die Mutter vorwurfsvoll: »Francesca, was bist du nur für eine Tochter! Lässt uns einfach im Stich, wir hätten alle tot sein können.«
Als sie sich in der warmen Küche niederließen, hörte die Mutter nicht auf zu zetern. »Macht sich einfach davon – und kommt mit einem wildfremden Mann zurück. Das fängt ja früh an ...«
»Halt den Mund!«, fuhr der Vater sie an, nicht einmal laut. »Verbinde lieber ihre Füße neu!«
»Ja, du willst die Wahrheit nie hören. Sie springt einfach davon, im Nachthemd, und lässt sich von einem vornehmen Mann auflesen.«
»Er hat mir das Leben gerettet, Mamma!«
Die Mutter stieß einen Laut aus, als sei dies nichts Besonderes.
»Wir haben dich schon erschlagen gesehen, von einem herabfallenden Dachziegel oder einem Mauerteil«, flüsterte der Vater und drückte sie an sich.
Francescas Familie hatte keinen Grund zu klagen. Das Haus stand fest, mit ein paar Rissen, die der Vater am Tag nach dem Beben ausfugte. Er musste nicht einmal eine Wand oder Decke abstützen. Natürlich hatte es jede Menge Staub gegeben, Putz war heruntergebrochen, einige Dachziegel waren herabgesegelt, aber der Schornstein stand noch, und ein Feuer hatten sie auch verhindern können.
Am späten Nachmittag nach dem Beben – die Stadt blieb weiterhin ohne Glockengeläut – eilte die Mutter mit Caterina und Camilla zur Vesper, während der Kleine schlief. Francesca sollte zu Hause bleiben und dem Vater beim Aufräumen helfen.
Ihr war es recht, obwohl sie gerne zur Messe ging, weil sie dabei ihr enges Haus verlassen, fremde Menschen sehen und in der Kirche all die schönen Kurtisanen mit ihren reichen Verehrern beobachten konnte. Im Laden ihres Vaters gab es nicht viel zu tun, der Vater räumte wortlos auf, sie stand dabei oder ordnete eingestaubte Gegenstände in den Regalen.
Plötzlich fiel ihm ein von angelaufenem Silber eingefasster Spiegel in die Hände, den er lange betrachtete. Francesca wollte ihm den Spiegel abnehmen, doch er gab ihn nicht her, und Tränen traten in seine Augen.
»Papa, was ist?«, fragte sie erschrocken.
Er reagierte nicht, blickte hilflos auf den Spiegel, blickte sie dann an, während ihm die Tränen über die Wangen liefen.
Ihr wurde ganz unheimlich, weil sie einen solchen Gefühlsausbruch von ihrem Vater nicht gewöhnt war. »Der Spiegel stammt von deiner ...«, flüsterte er so leise, dass sie ihn kaum verstand.
»Von wem stammt er, Papa?«
»Von deiner ... Großmutter«, sagte er mit ersterbender Stimme. »Von meiner Mutter, die ... früh gestorben ist. Von uns gegangen.«
In diesem Augenblick wurde ihr wieder bewusst, wie sehr sie ihren Vater liebte.
Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange und wollte ihm erneut den Spiegel aus der Hand nehmen, um ihn zu den anderen Waren ins Regal zu stellen. Der Vater umarmte sie jedoch heftig, mit einem aus tiefster Brust aufsteigenden Seufzer, und hielt sie noch eine Weile fest.
»Ich schenke ihn dir«, sagte er.
Obwohl der Spiegel am Rand bereits blind war, freute sie sich wie über ein wirklich kostbares Geschenk, und kaum war ihre Mutter mit den Geschwistern zurückgekehrt, zeigte sie ihn ihr ganz stolz. Sie konnte noch sehen, wie sich die Augen des Vaters vor Schreck weiteten, er eine Geste machte, als wollte er Francesca warnen.
Schon hatte die Mutter ihr den Spiegel entrissen und in den Kamin geworfen. Zum Glück brannte kein Feuer, und die Restasche fing ihn so weich auf, dass er nicht zerbrach.
»Was machst du da!«, empörte sich Francesca.
Die Miene des Vaters verdunkelte sich vor Zorn.
»Weg mit dem Dreck deiner ...«, fuhr die Mutter ihn an, ohne auf Francesca zu achten.
Der Vater packte sie jedoch, stieß sie gegen ein Regal, so dass alle so säuberlich aufgereihten Waren zu Boden purzelten, und bevor sich die Mutter besinnen konnte, schlug er ihr ins Gesicht.
Einen Augenblick erstarrten alle.
Obwohl die Mutter sich häufig mit dem Vater stritt und dabei laut werden konnte, ihn sogar schon einmal mit einem Topf beworfen hatte, wischte sie sich diesmal über ihre Wange, als müsste sie die Spuren des Schlags entfernen, richtete ihre Haube und sagte mit vor gepresster Beherrschung zitternder Stimme: »Das machst du nicht noch einmal, sonst bist du mich los.«
Schon rumpelte sie die Treppe zu den Wohnräumen hoch.
Caterina und Camilla folgten ihr.
Der Vater kniete sich vor den Kamin und holte den Spiegel aus der Asche, reichte ihn Francesca, kommentierte aber mit keinem Wort das Geschehene.
»Was meinte Mamma ...?«
»Schluss jetzt! Nimm den Spiegel und hilf deiner Mutter!«, schnitt er ihr die Frage ab.
In den nächsten Tagen besuchte die Mutter täglich die Morgenmesse, ohne ihre Kinder; Francesca hatte ihren kleinen Bruder zu beaufsichtigen und zu versorgen.
Wenn sie später das magere Essen richtete, betonte die Mutter: »Gott will uns strafen.« Dann hockten alle um den blankgescheuerten Tisch, löffelten Hirsebrei und kauten das salzarme Brot, das zwischen den Zähnen knirschte.
Am Sonntag gab es einen Hühnerschenkel und einen grätenreichen Fisch für die gesamte Familie, am Montag kam eine Suppe, nach deren Zutaten Francesca lieber nicht fragte, auf den Tisch. Mehr hungrig als satt, half sie anschließend der Mutter, die Küche aufzuräumen, und verschwand dann hoch in das Mädchenzimmer, während ihre Schwestern den Hof auskehrten.
Francesca setzte sich ans Fenster, schaute sehnsüchtig nach draußen, dachte an das Erdbeben und ihre Rettung und den reichen Mann aus Rom. Sie holte den Spiegel aus der Truhe und betrachtete sich. Früher hatte sie nie darüber nachgedacht, ob sie nun hübsch aussah oder nicht, aber seit einiger Zeit, seitdem der junge Maler sie gezeichnet hatte, fand sie sich viel hübscher als ihre Schwestern. Die Mutter war bereits alt und verhärmt, dunkle Warzen wuchsen in ihrem Gesicht, und ihr spitzes Kinn trat vor wie ein Genuesenschädel, wie man in Venedig sagte.
Francesca lächelte ihr Bild im Spiegel an, drehte den Kopf leicht zur Seite und pustete sich ein paar vorwitzige Strähnen aus der Stirn.
Ja, sie war hübscher als alle Mädchen, die sie kannte.
Eigentlich gehörte sie auch nicht in dieses verdreckte, enge und ärmliche Viertel, sondern in einen Palast. Zumindest in einen kleinen.
Mit kokett verzogener Schnute lächelte sie ihr Spiegelbild an.
So ähnlich hatte sie den Maler angelächelt, der sie, ohne sie zu fragen, porträtiert hatte. Eigentlich frech von ihm. Dennoch mochte sie ihn.
Sie mochte auch den reichen Römer. Von ihm würde sie sicher träumen. Ein Retter der Jungfrauen, hoch zu Ross ... zumindest in einer Gondel ...
»Kommst du Faulpelz jetzt mal runter und hilfst mir gefälligst beim Putzen!«, rief die Mutter laut und herrisch. Seit Tagen ging dies schon so, genauer: seit der väterlichen Ohrfeige. Obwohl die Wohnung längst vor Sauberkeit glänzte, wischte die Mutter weiter.
Bedächtig rutschte Francesca vom Fenstersitz und tappte noch bedächtiger die knarzende Treppe hinunter.
Ohne nach ihr zu schauen, fuhr die Mutter fort, den Lappen in den Wassereimer zu tauchen und, auf den Knien, über den nass glänzenden Boden zu schrubben.
Einen Stock tiefer hörte man den Vater einen Kunden aus dem Laden begleiten.
»Er wird uns verhungern lassen«, stieß die Mutter aus und warf den Lappen in den Eimer. Dann richtete sie sich auf, über ihren schmerzenden Rücken stöhnend, stützte eine Hand auf ihre Hüfte. »Dein Vater«, wandte sie sich an Francesca, »hätte reich sein können. Aber er hat sich immer wieder hereinlegen lassen – von Gaunern und Zinswucherern, die es nicht anders treiben als die Juden. Ehrliche Leute wie wir sind denen nicht gewachsen. Und jetzt hat Gott uns alle bestraft – zuerst mit dem Krieg und dem Gesindel, das er in die Stadt gespült hat, dann mit dem Erdbeben ... Verstehst du? Der Patriarch hat es in San Marco verkündet, sie haben seine Worte in San Zanipolo, in der Morgenmesse, wiederholt, die Prediger lesen uns die Leviten: Venedig ist wie Sodom und Gomorrha, der Herr schickt Feuer und Schwefel.«
Eigentlich tat Francesca ihre Mutter leid, aber diese seit Tagen immer gleichen Redensarten gingen ihr auf die Nerven, insbesondere, wenn sie die übertriebene Putzwut unterstützen musste.
Sie verdrehte die Augen und wollte die Mutter darauf hinweisen, dass kein Feuer vom Himmel gefallen war, sondern die Erde gebebt hatte, verzichtete dann aber auf ihre Belehrung. Sie blieb allemal ohne Wirkung. Die Mutter rannte zu häufig in die Kirche und jammerte zu viel über die sündige Welt, über den Luxus der Reichen und den angeblichen Einfluss der Kurtisanen, die sie nur aufgedonnerte Huren nannte. Jedes Mal, wenn eine von ihnen am Haus vorbeiging, schüttete sie einen stinkenden Pisseimer aus dem Fenster, was Gezeter nach sich zog und das Geschäft des Vaters nicht gerade förderte.
Die Mutter wrang den Lappen aus und warf ihn Francesca zu. »Los, wisch die Treppe!« Francesca ließ den Lappen an sich abprallen und auf den Boden fallen. »Wenn es uns wie Sodom und Gomorrha geht«, antwortete sie, »dann ist es sinnlos, die Treppe zu wischen. Wir sollten stattdessen schleunigst die sündige Stadt verlassen.«
Die Mutter baute sich vor ihr auf, ihre Augen funkelten vor Ärger. »Du Nichtsnutz wirst auch einmal auf der Straße enden und vor jedem hergelaufenen Söldner die Beine breit machen«, stieß sie aus.
»Wen meinst du mit auch?« Francesca blieb ruhig, aber ihre Bemerkung klang natürlich schnippisch. Sie spürte wirklich keine Lust, auf den Knien herumzurutschen, sie musste an ihren Retter Agostino Chigi denken und an die Gondelfahrt während des Bebens, an den duftenden Mantel mit dem weichen Pelz, an die Eleganz seiner mit Goldfäden bestickten Schuhe, das vornehme rote Barett und den weichen Schwung seiner Wimpern. Und an seine Stimme, die so klar und deutlich sprach.
»Du freche Göre du ...«
»Wir könnten nach Rom gehen«, fuhr Francesca fort. »Dort gibt es keinen Krieg, und viele reiche Prälaten suchen Frauen, die ihnen den Boden wischen. Mittlerweile bin ich darin wie du eine Meisterin.« Mit dieser Bemerkung hatte sie eigentlich nur ihre Mutter ärgern wollen, ohne sich dabei viel zu denken.
Eine schallende Ohrfeige war die Antwort. Und gleich noch eine. Wie eine Furie schlug die Mutter zu. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich Francesca in Sicherheit bringen, und während ihr kleiner Bruder in seinem Ställchen zu heulen begann, rannte sie die Treppe hoch in ihr Zimmer.
Ihre Mutter folgte ihr nicht, schrie ihr etwas Unverständliches nach. Dann hörte Francesca sie ebenfalls heulen.
Sie setzte sich wieder ans Fenster und betrachtete sich erneut im Spiegel. Ihre Wangen brannten, die Haare waren durcheinander, außerdem lange nicht gewaschen, und vermutlich roch sie nach fauligem Putzwasser und modrigen Wänden. Wie gern hätte sie sich Puder auf die Wangen gestreut, die Haare ausgekämmt und ein paar Tropfen Duftwasser auf ihrer Haut verteilt, wie die edlen Kurtisanen, denen die Mutter immer ihre Pisse auf den Kopf schütten wollte.
Während ihre Wangen nur noch rosig schimmerten, fuhr sie mit den Fingern über ihre Lippen, die sie ein wenig vorstülpte, strich über ihre langen dunklen Haare. Nicht einmal einen anständigen Kamm aus Holz besaß sie, von Elfenbein ganz zu schweigen. Der Vater hatte zwar eine Weile mit Luxusgütern für reiche Edeldamen und Kurtisanen gehandelt und dabei ordentlich verdient, aber seit Beginn des Krieges tauchten kaum noch Galane auf, die ihre Geliebten verwöhnen wollten, nicht einmal Kurtisanen.
Sehnsüchtig schaute sie nach draußen auf die Wand des Nachbarhauses, von der schon seit langem der Putz bröckelte und in der das Erdbeben lange Risse hinterlassen hatte. Seit dem Unglück hatte sie den Maler nicht mehr gesehen.
Abwechselnd schaute sie in den Spiegel und durch das zugige Fenster in die Ferne, auf die schmale Gasse und die Dächer mit den zahlreichen Schornsteinen, während sie hörte, wie der Vater jeden Passanten mit kriecherischer und zugleich krächzender Stimme ansprach, ohne etwas zu verkaufen.
Francesca hauchte über den Spiegel und wischte ihn sauber. Ihr Kinn war vielleicht ein wenig zu stark, aber längst nicht so vorstehend wie das ihrer Mutter. Ihre Augen waren dagegen schön geformt, tiefdunkelbraun und außergewöhnlich groß, sie beherrschten ihr Gesicht. Während die Mutter mausgraue Äugelchen hatte.
Als es dunkelte, träumte Francesca noch immer vor sich hin. Ja, sie sollten wirklich nach Rom ziehen. Signor Chigi hatte sie ahnen lassen, dass es eine andere Welt gab als die ihres schmalen, modernden Hauses, eine Welt vornehmer Seidenstoffe und warmer Pelze, eine Welt mit Ohrgehängen aus Gold und silbergefassten Perlen, eine Welt, in der die Frauen Zeit und Geld fanden, sich mit Salben und duftenden Tinkturen zu verwöhnen, in der sie nicht mit nassen Putzlumpen traktiert, sondern von einem Heer von Bediensteten umsorgt wurden. Und natürlich durften sie nach der Messe über die Piazza schlendern und huldvoll ihre Verehrer grüßen oder mit ihren Freundinnen plaudern, ja, sie durften sogar jungen Malern Modell sitzen, damit ihre Schönheit für immer der Nachwelt erhalten bliebe. Und keine sittenstrenge Mamma würde sich aufregen, wenn dabei das eine oder andere Scherzwort fiel.
Signor Chigi hatte ihr zudem gezeigt, dass es reiche Menschen voller Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit gab, nicht nur Betrüger, wie ihr Vater meinte. Und alle schönen Frauen waren auch nicht nur sündige Kurtisanen, wie die Mutter glaubte. Überhaupt: Was war so schlimm am Gewerbe der Kurtisanen? Ihre Sünde? Sündigten nicht auch die Priester, die Nonnen und Mönche in ihren Klöstern? Das wusste sogar sie. In der Nonnenschule, die sie besuchte, wurde so einiges hinter vorgehaltener Hand erzählt. Kurtisanen spielten Laute und sangen schöne Lieder. Wenn sie, die züchtige Francesca, jedoch einmal vor lauter Lebensfreude sang, wurde sie gleich von ihrer Mutter getadelt. Dabei hatte sie eine weiche, reine Stimme, dies hatte ihr einmal ihr Beichtvater gesagt, dem sie hatte vorsingen müssen.
Francesca fiel wieder der Traum der vergangenen Nacht ein, ein Traum, den sie in ähnlicher Form schon häufig geträumt hatte. Sie sah sich an der Hand einer schönen, warm und weich duftenden Frau über satten Marmorboden hüpfen, sah sich auf ihrem Arm, wie sie an ihren langen blonden Haaren zupfte und mit einer Stirnperle spielte. Die Frau sang dann, aber Francesca konnte nichts hören, als hätte sie die Ohren verstopft, die Frau winkte ihr und sang weiter – ein seltsamer Traum, aber klar und deutlich, als hätte sie ihn gestern erlebt.
Francescas Brust krampfte sich zusammen, und sie sah im Spiegel, wie Tränen über ihre Wangen liefen. Eine namenlose Traurigkeit umfing sie. Auslöser konnte allein der Traum sein. Der Traum von ihr als kleiner Prinzessin. Warum nur mussten sie so arm sein! Warum musste sie Putzlumpen schwingen oder auf ihren kleinen Bruder aufpassen, statt zu singen, über die Piazza San Marco zu schlendern und sich von schönen jungen Edelmännern oder auch von reichen Römern wie Signor Chigi grüßen zu lassen?
Verloren starrte sie nach draußen.
Kapitel 4
Das Erdbeben lag nun einige Wochen zurück, die meisten Schäden waren beseitigt oder notdürftig repariert. Einige Paläste hatte man eingerüstet, aber die Bautätigkeit lief nur schleppend voran, da das Geld fehlte.
Die Serenissima hatte zusätzliche Steuern erhoben, doch auch damit die allgemeine Not nicht behoben. Nicht einmal ihre eigenen Beamten konnte sie bezahlen. Den Papst hatte der Doge zwar aus der Allianz der Gegner herausbrechen können, die militärischen Auseinandersetzungen mit Ferrara waren allerdings ungünstig verlaufen, und Niccolò Orsini, der capitano generale der venezianischen Truppen, verlangte für sich und seine Söldner Zigtausende an Dukaten, die die finanzschwachen venezianischen Bankhäuser keineswegs allein aufbringen konnten.
Der Doge Leonardo Loredan bat Agostino Chigi zu sich, um noch einige offene Fragen des Vertragswerks zu verhandeln. Chigi ließ sich von Raffaele Befalù in den Dogenpalast begleiten und setzte sich mit ihm nach den Gesprächen auf eine Steinbank an der Piazza San Marco, um die augenblickliche Lage zu resümieren.
»In erster Linie geht es Venedig um das Darlehen von zwanzigtausend Dukaten, das ich jederzeit, selbst ohne die Einnahme der Franci-Schulden, bereitstellen kann«, erklärte Chigi. »Aber ohne Sicherheiten läuft nichts: Die Bürgschaften allein reichen mir nicht aus. Ich will Juwelen aus dem Schatz von San Marco im Wert von mindestens dreißigtausend Dukaten. Damit bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite.«
Befalù nickte. »Loredan hat zugestimmt, wenn auch nur äußerst zähneknirschend. Ich glaube, die Serenissima hat noch nie den Schatz angerührt.«
»Einmal ist immer das erste Mal. Sie muss runter von ihrem Podest. Der zweite Punkt ist der Alaun, den die Stadt unbedingt für ihre Tuch- und Glasherstellung benötigt. Fünftausend cantari können wir liefern, Venedig zahlt in zwei Jahren zwanzig Dukaten pro cantaro, zwei Dukaten mehr als der augenblickliche Marktpreis. Auf diese Weise umgehen wir das Zinsverbot.«
»Wir müssen mit Widerstand rechnen, insbesondere bei den Familien der Bürgen und den Prokuratoren von San Marco«, erklärte Befalù.
Chigi sprang verärgert auf und setzte sich sofort wieder: »Die glauben doch nicht ernsthaft, ich gewähre ihnen eine Zahlungsfrist von zwei Jahren und leihe ihnen zwanzigtausend Dukaten ohne ausreichende Sicherheiten. Die Venezianer wollen etwas von mir, ihnen steht das Wasser am Hals, nicht mir. Wenn Kaiser Maximilian es ernst meint, campieren in ein paar Wochen deutsche Landsknechte vor San Marco. Die Stadt ist noch nie geplündert worden, das lässt sie in ihrer Überheblichkeit verharren. Aber sie soll sich nicht täuschen. Und die sturen Häupter der Adelsfamilien sollen an ihre Frauen und Töchter denken. So ein Landsknecht kann ziemlich grob werden.«
Befalù nickte.
»Überhaupt ist die Preisdifferenz lächerlich gering. Zehn Prozent in zwei Jahren!«, fuhr Chigi fort. »Die Herrn Pregadi sollen mal bei den hiesigen Juden, bei Scilocco und Konsorten, nachfragen. Mir ist viel wichtiger, dass unser Alaunmonopol langfristig nicht unterlaufen wird. Genauso sieht es Papst Julius. Er ist sogar willens, die Serenissima oder einzelne Familien zu exkommunizieren, wenn sie ihn in diesem Punkt betrügen.«
Befalù schwieg nachdenklich, obwohl ihn Chigi auffordernd anschaute. Nach einer Weile sagte er: »Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl. Der Vertrag ist zu kompliziert und wird von Tag zu Tag komplizierter. Schon die Klausel zum halbjährigen Rücktrittsrecht zeigt, dass die Venezianer abspringen wollen, sobald sie einen Hoffnungsschimmer sehen. Ihr Stolz ist zutiefst getroffen: Sie müssen Geld von einem Römer annehmen, sollen die geheiligten Juwelen von San Marco antasten und drohen, ihre wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit zu verlieren – das schmerzt.«
Chigi verzog sein Gesicht zu einer Miene der Verachtung. »Soll es sie schmerzen. Hier geht es um Geschäfte und darum, dass ein endgültiger Verlust der terra ferma oder gar eine Eroberung der Stadt viel schmerzhafter wäre. Mich schmerzt auch etwas: nämlich die Tatsache, dass sie mir zwar Honig um den Bart schmieren, mich aber zugleich für einen windigen Trickser halten. Dies spüre ich. Ihre Art der Herablassung lasse ich mir nicht einmal bei Papst Julius gefallen, und der hat ein anderes Format. Ich bin Agostino Chigi della Rovere, der reichste Mann Roms und neben Jakob Fugger einer der reichsten der Welt. Ich habe Papst Julius mit meinen Bestechungsdukaten verholfen, den Thron Petri zu besteigen ...«
Befalùs leerer Blick ließ Chigi sich selbst unterbrechen. Er musste an dieser Stelle, vor seinem eigenen fattore, nicht seine Bedeutung herausstellen. Er schluckte, zwickte kurz seine Nasenspitze, kratzte sich hinterm Ohr und fuhr dann in sachlichem Ton fort: »Zumindest müssen wir keine Steuern zahlen, das habe ich durchgesetzt. Außerdem liefern wir Weizen und Salpeter in die Stadt. Die Menschen hungern. Schießpulver für die Flotte gibt es auch nicht. Also muss sofort bezahlt werden, vor Lieferung, und zwar ein guter Preis.«
»Die Priuli wollen vorschießen, die Vendramin schauen nach, ob sie vielleicht doch noch die eine oder andere Zechine in ihren Schatullen finden, und natürlich horten die reichen Familien genug Gold und Silber. Hinzu kommt, dass seit Monaten kein Tafelsilber mehr exportiert werden darf, es wird alles eingeschmolzen und zu Münzen geprägt.«
»Der Preis für Weizen ist explodiert, das sehe ich bei meinen täglichen Spaziergängen durch die Stadt, sogar die Kurtisanen jammern, dass die Gesetze gegen das Zurschaustellen von Luxus ihnen die Möglichkeit nehmen, sich schön genug in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Stadt hat wirklich an Attraktion verloren.«
Chigi fing einen spöttischen Blick von Befalù auf, der ihn ärgerte. Sollte er sich etwa vor seinen eigenen Leuten wegen seiner Vergnügungen und speziellen Interessen Vorhaltungen anhören? Seine Zeit war zu kostbar, um sie mit weihrauchgeschwängerten Messebesuchen und dem Brüten über Vertragsklauseln zu verplempern. Für Details hatte er Befalù, das Entscheidende behielt er im Kopf, und Entscheidungen traf er rasch. Und um etwas zu entscheiden, brauchte er keine langen Zahlenkolonnen zusammenzurechnen. Intuitio, so nannten die Lateiner sein Erfolgsrezept.
Wichtiger als Zahlen waren ohnehin die weitgestreuten Kontakte, der gute Ruf, das Vertrauen, das man ihm entgegenbrachte, und das Wissen, was im Land und in den Köpfen der Menschen vor sich ging. Wichtig war sein Charme. Seine Freundlichkeit, die niemand mit Unterwürfigkeit verwechseln durfte. Sein offenkundiger Erfolg – auch bei weithin gepriesenen Frauen wie Imperia. Wichtig war sein Ruf als neuer Mäcenas, als Kunstkenner, der Roms fähigste und teuerste Künstler wie Raffaello Santi und Baldassare Peruzzi für sich arbeiten ließ, der eine Villa an das Ufer des Tiber baute, die ihresgleichen in ganz Italien suchte. Wichtig war nicht zuletzt seine Großzügigkeit: Er konnte mal fünfe gerade sein lassen. Wer unschuldig in Not geriet, durfte mit seiner Unterstützung rechnen. Wer ihm freiwillig etwas Gutes tat, den entlohnte er doppelt und dreifach. Auf diese Weise war er groß und reich geworden.
Chigi ließ seinen Blick über die Fassade des Dogenpalasts zum Eingangsportal von San Marco gleiten. Die Piazza wimmelte nicht nur von Tauben, sondern auch von Bettlern, Dienstboten, Händlern, Huren und zwielichtigen Figuren. Aufgeblasene Adlige unter schwarzen Baretten standen in Gruppen beisammen und palaverten, berichteten stolz wie die Laus auf dem Teller von ihren Gewinnen auf den Meeren des Ostens. Rümpften die Nase über die Fremden, die in ihrer Stadt wirklich arbeiteten. Oder intrigierten mit- und gegeneinander.
Er auf jeden Fall ließ sich von keinem Venezianer hereinlegen. Wer es versuchte, wie Franci, der musste es bereuen. Auf sein Betreiben hin hatte der Doge den Gauner ins Schuldgefängnis werfen lassen – da sollte er erst einmal schmoren und sich bei Wasser und Brot vor Augen führen, dass man einen Agostino Chigi lieber nicht um sein Geld brachte. Für die Serenissima würde also gelten: fünftausend cantari Alaun zu einem anständigen Preis und dann noch die Juwelen für das Darlehen. Dazu fünfzig Bürgen. Basta!
Chigi erhob sich erneut und vertrat sich die Beine. Er hasste Vertragsverhandlungen, die sich über Wochen und Monate hinzogen. Ursprünglich hatte er nicht ewig in einer Stadt bleiben wollen, die gegen Pest, Hunger und Verbrechen kämpfte – aber seit dem Erdbeben gab es etwas, was ihn hielt: die wiedergeborene Margherita. Francesca Ordeaschi. An deren Haus er bereits mehrfach vorbeigeschlendert war, nicht ohne ihren Vater freundlich zu grüßen. Einmal hatte er ihm eine wertlose Kleinigkeit abgekauft und sich dabei anteilnehmend nach Francescas Befinden erkundigt. Es gehe ihr gut, war die knappe Antwort. Ein andermal hatte er sogar Francesca im Fenster entdeckt, mit einem Spiegel in der Hand. Sie hatte ihn jedoch nicht gesehen.
Chigi winkte einen Wasserverkäufer herbei und ließ sich einen Becher reichen. Über die Piazza wurden Dutzende von Schweinen getrieben, die Räder von Lastkarren mahlten knirschend über den Marmorboden, ein Geräusch, das er nicht vertragen konnte. Als sich ihm eine Gruppe verkrüppelter Bettler von der einen und eine schmucke Kurtisane von der anderen Seite näherte, winkte er Befalù eine knappe Abschiedsgeste zu und brach auf.
»Nächsten Montag«, rief er ihm im Weggehen zu, »werden wir dem versammelten Collegio und den Prokuratoren von San Marco den Vertrag erläutern. Du wirst auf jede kritische Frage eine Antwort haben. Darauf verlasse ich mich.«
Die Kurtisane wollte ihm den Weg abschneiden, aber er war schneller, und sie blieb mit enttäuschter Miene zurück. Chigi schüttelte unwillig den Kopf. Alle hielten ihn offensichtlich für einen nimmersatten Hurenbock, dabei konnte ihn selbst allererste Ware zur Zeit nicht locken. Es war verrückt: Die Begegnung mit Francesca hatte ihm die Lust auf Kurtisanen genommen. Seit dem Erdbeben, seit der Nacht auf der Gondel ging ihm die wiederauferstandene Margherita nicht mehr aus dem Sinn, und er sehnte sich danach, sie wiederzusehen. Abends vor dem Einschlafen sah er sie verstärkt vor sich, fühlte sich an seine glücklichen Jahre erinnert und konnte die beiden jungen Frauen gar nicht mehr auseinanderhalten. Margherita war seit langem tot, daher wusste er nicht einmal, ob das Bild, das vor seinem inneren Auge stand, mehr der jungen Margherita oder Francesca entsprach. Letztlich war dies auch gleichgültig: In Gedanken an seine Angebetete verabschiedete er sich wie ein sehnsüchtiger Jüngling in Schlaf und Träume.
Tagsüber versuchte er sich abzulenken, indem er Bücher erwarb, die Werkstätten der Maler besuchte, die in Farben schwelgende Süße ihrer Madonnenfiguren bewunderte – aber gerade sie erinnerten ihn wieder an Margherita-Francesca. Sie schwebten vor ihm wie ein Glückspfand, ein zu Fleisch und Blut gewordenes Glücksversprechen, das man nicht aus den Augen lassen durfte, weil es sonst womöglich für immer verschwand.
Während er am Kai von San Marco entlangschlenderte, entschloss er sich, bei den Ordeaschi vorbeizuschauen. Er konnte ja wieder Vater Ordeaschi irgendetwas abkaufen, wollte dann aber darauf bestehen, Francesca persönlich begrüßen zu dürfen, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen – und auch, um zu prüfen, ob sich die überwältigende Ähnlichkeit zwischen ihr und seiner Margherita noch im Licht des Tages bestätigte.
Kapitel 5
Francesca hatte längst ihren Schwestern von dem reichen und vornehmen Signor Chigi erzählt und ihnen mehrfach haarklein den Ablauf der Rettung beschrieben. Auch heute wieder lagen die Mädchen gemeinsam auf dem breiten Bett von Caterina und Camilla und tuschelten kichernd und schwärmend. Francesca rief leise: »Er hätte mir beinahe seinen pelzgefütterten Mantel geschenkt. Er ist ein wirklicher gentiluomo, nicht so ein ärmlicher Krämer wie unserer Vater.«
»Jetzt übertreibst du aber, Francesca«, sagte Camilla, »unser Vater ist ein Kaufmann, kein Krämer.«
»Ja, aber Signor Chigi ist ein richtiger Kaufmann und reich dazu: Wie er schon geht und sich verbeugt und so klar die Worte spricht! Außerdem kümmert er sich um die Armen, ist ein echter Christ.«
»Du bist ja richtig in ihn verliebt«, bemerkte Caterina spitz. »Er hat dir den Kopf verdreht, dein Signore.«
»Das hat er nicht!« Francesca schlug spielerisch nach ihr. »Du bist gemein.«
»Aber er ist doch viel zu alt«, warf Camilla ein.
»Lieber ein älterer reicher Kaufmann als ein junger stinkender Bootsbauer«, sagte Francesca. »Ihr seid ja nur neidisch.«
»Aber ein klein wenig verliebt bist du schon«, rief Caterina. »Gib es zu!«
Francesca schwieg.
»Wenn das unsere Mutter wüsste! Und unser Vater«, sagte Camilla. »Außerdem habe ich dich beobachtet, wie du dem Maler schöne Augen gemacht hast. Das war noch vor dem Erdbeben.«
»Du bist wirklich gemein«, presste Francesca hervor und biss sich auf die Lippen.
»Dabei hat uns unsere Mutter immer eingebläut, die Augen niederzuschlagen, wenn wir einem Mann begegnen. Nur die Huren ...«
»Was weißt du schon von Huren!«, fuhr sie Francesca an. »Und außerdem geht dich gar nichts an, was ich tue.«
»Mich hat der Maler auch schon einmal angelächelt«, betonte Caterina.
»Und mich hat nach der Messe sogar ein junger Adliger angelächelt«, übertrumpfte sie Camilla.
»Signor Chigi war ein zweites Mal hier und hat sich nach mir erkundigt. Aber Papa hat mich nicht gerufen.« Francesca schaute traurig zu Boden.
»Danach haben sich die Eltern gestritten«, erklärte Caterina mit gewichtigem Augenaufschlag. »Das habe ich gehört.«
»Und was genau hast du gehört?«
In diesem Augenblick stand plötzlich ihre Mutter vor ihnen. Keines der Mädchen hatte ihr Hereinkommen gehört. Francesca zuckte regelrecht vor Schreck zusammen, Camilla versteckte ihr Gesicht hinter ihren Händen, Caterina wollte sogar protestieren, kam jedoch nicht zu Wort.
»Du hast Besuch, Francesca«, sagte die Mutter, zu ihrer großen Verwunderung nicht harsch und streng wie gewöhnlich, sondern freundlich, ja liebevoll. »Signor Chigi aus Rom. Er hat sich nach den Verletzungen an deinen Füßen erkundigt und möchte dir ein kleines Geschenk überreichen.«
Francesca schoss das Blut ins Gesicht. Camilla kicherte.
»Aber Papa ...«, stotterte Francesca. »Er will doch nicht, dass ...«
»Dein Vater ist unterwegs.« Nun klang die Mutter wieder streng. »Kämm dich und sieh zu, dass keine Flecken auf deinem Kleid zu sehen sind.«
Ihre Mutter trampelte die Treppe hinunter und rief Signor Chigi etwas zu, während Francesca vor Aufregung gar nicht wusste, was sie zuerst tun sollte. Schließlich kämmte Caterina sie, während Camilla, sich wiederholend, sang: »Ach, was bin ich verliebt, so verliebt!«