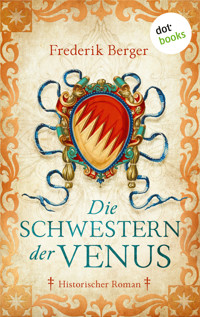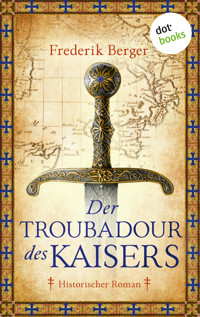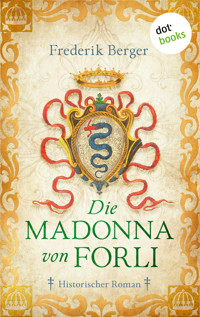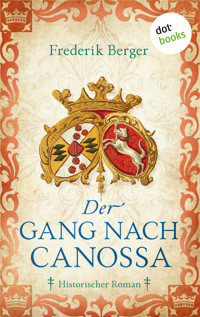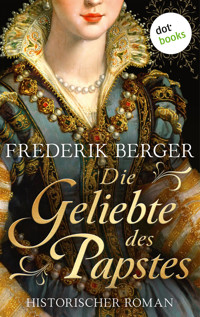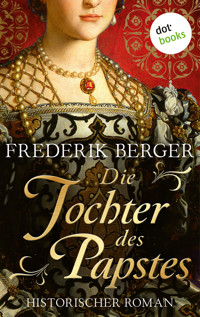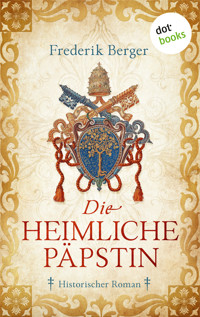2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Romeo und Julia in der Provence: Der opulente historische Roman »Die Provençalin« von Frederik Berger jetzt als eBook bei dotbooks. Wenn Liebe in Hass umschlägt … Die Provence in der Blütezeit der Renaissance: Die schöne Madeleine wird von vielen Edelmännern umworben, auch vom mächtigen Jean Maynier. Als sie ihn abweist, und einen anderen heiratet, so wie von ihr verlangt wird, kann er diese Schmach nicht hinnehmen – und beginnt, hasserfüllt Intrigen zu spinnen, die ihren grausamen Höhepunkt erreichen, als viele Jahre später sich ausgerechnet sein Sohn Pierre in Madeleines Tochter verliebt. Madeleine muss hilflos mitansehen, wie der fanatische Patriarch nicht nur das Leben ihrer Familie, sondern auch das seines einzigen Sohnes und Erben zu zerstören droht: Wird Rachsucht beide Familien ruinieren – oder kann am Ende die Liebe siegen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der farbenprächtige Historienroman »Die Provençalin« von Frederik Berger wird alle Fans von Rebecca Gablé und Matteo Strukul begeistern! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1065
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn Liebe in Hass umschlägt … Die Provence in der Blütezeit der Renaissance: Die schöne Madeleine wird von vielen Edelmännern umworben, auch vom mächtigen Jean Maynier. Als sie ihn abweist, und einen anderen heiratet, so wie von ihr verlangt wird, kann er diese Schmach nicht hinnehmen – und beginnt, hasserfüllt Intrigen zu spinnen, die ihren grausamen Höhepunkt erreichen, als viele Jahre später sich ausgerechnet sein Sohn Pierre in Madeleines Tochter verliebt. Madeleine muss hilflos mitansehen, wie der fanatische Patriarch nicht nur das Leben ihrer Familie, sondern auch das seines einzigen Sohnes und Erben zu zerstören droht: Wird Rachsucht beide Familien ruinieren – oder kann am Ende die Liebe siegen?
Über den Autor:
Frederik Berger (geboren 1945 in Bad Hersfeld) unterrichtete nach dem Studium der Literatur- und Sozialwissenschaften an einem bayerischen Internat, arbeitete anschließend als Literaturwissenschaftler und Journalist, lebte einige Zeit im englischen Cambridge und in der Provence, bevor er hauptberuflich Schriftsteller wurde. Neben Gegenwartsromanen, Sachbüchern und zahlreichen Aufsätzen verfasste er verschiedene historische Romane über den Glanz und den Schatten europäischer Adelsfamilien. Frederik Berger reist viel und ist begeisterter Fotograf. Er lebt mit seiner Frau in Schondorf am Ammersee.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine historische Romantrilogie »Das Siegel der Farnese« mit den Bänden »Die Geliebte des Papstes«, »Die Tochter des Papstes« und »Die Kurtisane des Papstes«. Außerdem erschienen seine opulenten historischen Romane »Die heimliche Päpstin« und »Die Provençalin«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
Die Website des Autors: www.frederikberger.de
Der Autor auf Instagram: www.instagram.com/fritzgesing/
***
eBook-Neuausgabe August 2023
Copyright © der Originalausgabe 1999 Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Kiselev Andrey Valerevich, Yakutsenya Marina
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-797-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Provencalin«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Frederik Berger
Die Provençalin
Historischer Roman
dotbooks.
TEIL I
Kapitel 1
1515
Der erste Pfeil hatte den Keiler nur leicht verletzt. Mit dem zweiten Pfeil mußte Jean Maynier, Baron d’Oppède, einen seiner besten Jagdhunde töten, nachdem die Hauer ihm den Bauch aufgerissen hatten. Aber nun wurde der Keiler auf eine kleine Lichtung getrieben und eingekreist. Hechelnd verharrte das Tier, blutigen Schaum vor dem Maul. Jean Maynier spannte den Bogen, bis er zu brechen drohte. Seit Tagen schon jagte er den Keiler quer durch den Luberon, diesmal gab es für ihn kein Entrinnen mehr. Der Pfeil schwirrte von der Sehne, aber zu spät, einen Augenblick zu spät hatte er losgelassen. Der Keiler griff ihn an, der Pfeil steckte im Widerrist. Jean Maynier warf den Bogen zur Seite und riß den Sauspieß an sich, er wollte ihn gegen das heranrennende Tier richten, aber reagierte zu spät, er konnte sich nur noch zur Seite werfen, gerade noch rechtzeitig. Einen winzigen Augenblick verharrte er Auge in Auge mit diesem schwarzen, wutschnaubenden Abgesandten des Teufels, dann hetzte der Keiler an ihm vorbei und entkam ins Dickicht.
Keuchend richtete Jean Maynier sich auf, starrte auf die zerknickten Zweige und stieß einen wilden Fluch aus. Auf dem Boden die Blutspur. Schweiß rann ihm in die Augen. Benommen betrachtete er die blutenden Kratzer an Armen und Beinen, fühlte aber keinen Schmerz. Aufbrüllend griff er nach dem Spieß und rammte ihn in den nächsten Baumstamm. Aber es nützte nichts, er hatte den Keiler nicht töten können, obwohl er ihn in seiner Jagdgier bis zur Erschöpfung verfolgt hatte. Daß der Keiler jetzt langsam verenden würde, irgendwo in einem Dornengestrüpp versteckt, mit zwei Pfeilen im Rücken, bedeutete nichts als Schmach und Erniedrigung für ihn, den Jäger.
Jean Maynier hob den Bogen auf, zog den Spieß aus dem Baumstamm und stapfte, die Hunde im Schlepptau, zu seinem Rappen, der nicht weit entfernt ruhig graste. Noch immer rann ihm der Schweiß übers Gesicht, und Durst plagte ihn. Er schwang sich in den Sattel und gab dem Pferd die Sporen.
Nach einem kurzen Ritt durch das Vallon du Châtaignier näherte Jean Maynier sich zwei großen grauen Felsbrocken, zwischen denen ein schmaler Pfad zu einem im Wald versteckten Weiher hinabführte. Vor längerer Zeit schon hatte er ihn gemeinsam mit seinem Jagdgenossen, Kommilitonen und Freund Raymond d’Agoult entdeckt, und seitdem suchte er ihn immer wieder auf, wenn er nach der Jagd Erfrischung oder auch nur Ruhe zum Nachdenken brauchte. Obwohl er einen halben Tagesritt von seinem Heimatort Oppède entfernt auf dem Gebiet der Agoults lag, war er sein Lieblingsort im ganzen Gebirgszug des Luberon geworden. Doch hatte er hier seit der gemeinsamen Entdeckung nie mehr eine Person aus der Familie der Agoults getroffen, auch nicht seinen Freund.
Zur Zeit war dies ohnehin unmöglich, weil Raymond als schwerbewaffneter Ritter, in voller Rüstung und begleitet von einem guttrainierten Fußtrupp, mit dem König nach Italien zog, um Mailand zu erobern. Ja, im Gegensatz zu ihm war Raymond in der Lage, sich einen solchen Aufwand zu leisten. Als junger Herr von Lourmarin war er reich und konnte darauf hoffen, von François, dem jungen König, mit dem er eine Weile gemeinsam aufgezogen worden war, ein lukratives Amt zu erhalten und Ländereien, vielleicht sogar in dem kultivierten Italien, von dem alle schwärmten.
Jean Maynier band sein Pferd an einen Baum, riß sich seine Jagdkleidung vom Leib und stürzte sich ins Wasser. Ein paar Schwimmzüge lang tauchte er unter, schwamm dann prustend bis zum anderen Ufer und paddelte anschließend gemächlich zurück. Über ihm der Himmel in einem klaren Blau, die große Kastanie streckte ihre Äste weit ins flirrende Licht. Erfrischt von der Abkühlung, fühlte er seine Kräfte zurückkehren. Und auch die Wut verschwand. Niemand wußte von seiner Niederlage, zu beichten gab es nichts. Beim nächsten Keiler würde er nicht mehr zögern, er würde seinen Spieß ihm bis ins Herz rammen und ihn zur Hölle schicken, ohne Gnade.
Er ließ sich auf dem Wasser treiben und genoß die weiche Stimmung des späten Nachmittags. Er fühlte wieder die Stärke seiner zwanzig Jahre. Zwar konnte er sich nicht mit der Eleganz Raymonds messen, aber an Kraft übertraf er ihn bei weitem. Einmal hatte ihm Raymond seinen Harnisch leihen wollen. Es war ihm nicht gelungen, ihn anzulegen, weder Schultern noch Brust ließen sich hineinpressen.
»Du hast eine Brust wie ein Stier«, hatte Raymond bewundernd bemerkt, aber dann noch angefügt: »Bietest aber auch den Lanzen des Gegners ein größeres Ziel.« Und dann hatte er gelacht.
Plötzlich hörte Jean Maynier vom anderen Ufer her ein Knacken. Er wagte kaum zu atmen, ließ sich langsam unter einen überhängenden Zweig treiben. Vielleicht doch noch unvermutetes Jagdglück? Nein, Stimmen drangen herüber, von Beerensammlerinnen wahrscheinlich, Frauen und Mädchen aus den Dörfern der Agoults, die sich bis hierhin verirrt hatten. Auf den Wegen und an den Feldrändern begegnete er ihnen gelegentlich, aber selten blickte er in freundliche Gesichter. Schuldbewußt beugten sie ihr Haupt oder wandten sich ängstlich ab, – als hätte er den bösen Blick, als wollte er sie ins nächste Gebüsch zerren wie ein ausgehungerter Landsknecht, er, Jean Maynier, Baron d’Oppède, der Sohn des viel zu früh verstorbenen Accurse Maynier, des päpstlichen Gesandten in Venedig! Diese armseligen Waldenser, die auf verlauste Wanderprediger hörten, drehten ihm dem Rücken zu, bückten sich, als wollten sie etwas aufheben, er kannte sie, die Vollkommenen, die sich über andere Menschen erhaben fühlten ...
Helles, fröhliches Lachen! Durch das Unterholz brach eine Gruppe junger Mädchen in langen luftigen Gewändern, sie umringten eine Frau von siebzehn oder achtzehn Jahren, die sich nun die Spangen aus ihrem braunen Haar nahm. Lockig fiel es ihr über die Schultern. Ein Mädchen griff nach einer Schlaufe, ein anderes öffnete den Gürtel, sie streiften ihr tatsächlich das Kleid ab, die Riemen an den Sandalen wurden gelöst. Nun stand sie nackt am Ufer. Alle kicherten sie und schauten sich vorsichtig um, streiften ebenfalls ihre Kleider ab. Die junge Frau fuhr mit ihren Händen in ihre Haare, schüttelte lustvoll den Kopf, und die Mähne legte sich über Rücken und Brust.
Jean Maynier hielt die Luft an und drückte sich noch tiefer unter die Zweige. Er schielte nach seinen Pferd, das zum Glück hinter einem Baum graste, und zischte den Hunden zu, auf ihrem Platz zu bleiben. Aufrecht saßen sie auf ihren Hinterpfoten und beobachteten genau, was sich am gegenüberliegenden Ufer abspielte.
Die Nacktheit blendete ihn. Ein Teil der Mädchen plantschte schon im Wasser, nur die Herrin stand noch, ein Bein leicht angewinkelt. Ihm war inzwischen klar, wer ihn so blendete: Madeleine d’Agoult, Raymonds Schwester, die Großnichte des Marschalls von Trivulce und künftige Erbin von Cental. Mit ihrem Bruder gehörte sie zu einer der reichen Adelsfamilien, die die Fremden aus dem Piemont hergerufen hatten, das Waldenserpack, diese häretische Pest.
Einmal, als er mit Raymond von der Jagd nach Lourmarin zurückgekehrt war, hatte er Madeleine über den Hof huschen sehen. Später stellte Raymond sie ihm vor, und er durfte mit ihr ein paar Worte wechseln. Damals war sie noch jünger, eine Rosenknospe, aber heute war sie voll erblüht, eine Frau, die auf ihre Bestimmung wartete.
Vorsichtig steckte sie ihren Zeh ins Wasser und sprang zurück, als ihre Dienerinnen sie naßspritzen wollten.
Jean Maynier, gefangen von dem Anblick, suchte nach Worten für ihre Schönheit: Wie die Morgenröte brachte sie Licht in das Dunkel des Waldes, ihr Leib wie Elfenbein, die Haut wie Pfirsich, und runde, weiche Hüften hatte sie, die festen Schenkel von Susanna, von Bathseba, Brüste wie die Zwillinge der Gazellen ... Er suchte nach weiteren Vergleichen. Eine Göttin war sie, Diana ...
Madeleine stürzte sich nun in den Weiher, juchzte auf, das Geplätscher und helle Lachen verstärkten sich.
Was sollte er tun, wenn die Hunde anschlugen? Sollte er aus dem Wasser steigen, nackt wie Adam, und die schöne Madeleine bis auf den Tod erschrecken? Würde sie aufschreien, fliehen, ihn verfluchen? Würde sie sich rächen wollen und ihm ihren Bruder auf den Hals hetzen? Nein, den Bruder sicher nicht, denn er marschierte zur Zeit auf Mailand zu. Vielleicht ihren Cousin Louis?
Jean Maynier mußte ein Auflachen unterdrücken. Louis de Bouliers, wie er selbst Studiosus in Aix, war zwar Herr über La Tour d’Aigues und reiche Ländereien im fruchtbaren Süden des Luberon, aber als Frauenrächer denkbar ungeeignet. Wenn er wollte, könnte er Louis mit einem Schlag zu Boden strecken. Woran er aber nicht dachte, denn als Waffenbrüder des Geistes hockten sie gemeinsam in den juristischen Vorlesungen, repetierten abends ihre Skripte und gingen anschließend noch einen Becher Wein trinken in der Weißen Lilie. Vergnügten sich sogar gemeinsam im Badehaus der Rue Saint Jacques. Louis war kein Kämpfer, aber ein netter Kumpan. Genauso wie der meist fröhliche Raymond ein netter Kumpan war und sich zum Beispiel nie damit brüstete, daß die Grafen d’Agoult seit Jahrhunderten in der Provence ansässig waren und geholfen hatten, sie von den Sarazenen zu befreien – uraltes Blut im Vergleich zum Blut seiner Familie, die die Baronie von Oppède erst von Papst Alexander VI. erhalten hatte.
Die Mädchen stiegen wieder aus dem Wasser. Die schöne Madeleine wurde sorgsam abgetrocknet. Sie setzte sich auf einen Baumstamm, und eine ihrer Gespielinnen reinigte ihre Füße, eine andere kämmte die nassen Locken. Die nackten Körper wurden nun wieder von den Gewändern bedeckt, die Haare hochgesteckt und Zöpfe geflochten. Das lustige Geschnatter und Gekicher hörte nicht auf. Jean Maynier merkte, wie ihm kalt wurde, aber er wagte sich nicht zu rühren. Niemand durfte ihn entdecken, das Geheimnis dieser süßen Augenweide mußte er für sich behalten. Die schöne Madeleine. Die reiche Madeleine. Madeleine und Jean Maynier. Madeleine Maynier, Baronesse d’Oppède. Die Mutter vieler Söhne. Die Gattin des Herrschers über den Luberon. Mochten seine Eltern auch nicht mehr leben, seine Studien beider Rechte machten Fortschritte, die Professoren betrachteten wohlwollend seine Leistungen, er war nicht nur stärker als der mickrig geratene Louis, sondern lernte auch schneller. Vielleicht würde er später einmal die lange Robe anziehen und Recht sprechen am Obersten Gerichtshof der Provence. Oder in der kurzen Robe einer der Heerführer des Königs werden.
Zwischen seinen Brauen bildete sich eine tiefe Falte. Er, dessen Schwerthieb einen Baumstamm durchtrennte, der sein Pferd beherrschte wie kein zweiter und mit der Lanze jeden Gegner aus dem Sattel gehoben hätte, er hatte als Ritter dem König nicht nach Italien folgen können, um sich dort zu bewähren und Ruhm zu ernten. Und trotzdem würde ihm die Zukunft offenstehen. Sie mußte ihm offenstehen! Warum sollte er also nicht die schöne Madeleine begehren?
Er konnte sich nicht sattsehen an den langen, weichen Haaren, an dem heiteren Gesicht, an der glatten Haut. Eine solche Frau mußte gesunde Söhne gebären. Und mußte, auch wenn dies vor Gott vielleicht nicht wohlgefällig war, im Bett Freude bereiten. Heiratete er sie, wäre er Raymonds Schwager und angeheirateter Cousin von Louis – sie wären die drei Brüder aus dem Luberon und stark in ihrer Gemeinsamkeit. Der eine würde Erster Präsident des Obersten Gerichtshofs von Paris, der andere Konnetabel, oberster Heerführer, und der dritte Kanzler von Frankreich. Die Triumvirn aus dem Luberon würde das Königreich beherrschen!
Sein Körper zitterte inzwischen vor Kälte, und die Hunde begannen, leise zu jaulen. Der Rappe rupfte ungerührt die Gräser am Rande des Wassers. Am gegenüberliegenden Ufer war es ruhiger geworden. Er sah die fröhlichen Mädchen nicht mehr, hörte sie aber noch im Walde tollen.
Endlich konnte er das Wasser verlassen.
Er schob seinen Körper zum Ufer und mußte sich der Hunde erwehren, die an ihm hochsprangen. Schnell schlüpfte er in seine Kleider. Er merkte erst jetzt, wie zerrissen und schmutzig sein Jagdkittel war. Als er sich aufs Pferd schwingen wollte, warf er noch einmal einen Blick zum anderen Ufer hinüber.
Da stand sie plötzlich, die schöne Madeleine, die Göttin, stand allein zwischen zwei mächtigen Baumstämmen, ihr bis zum Boden reichendes Gewand unter dem Busen zusammengebunden, die Haare hochgesteckt, die Arme frei – und schaute zu ihm herüber. Sein Atem stockte.
Kurz hob sie die Hand und verschwand im Dunkel des Waldes.
Sie hatte ihn gegrüßt! Daran gab es keinen Zweifel. Und hatte sie ihn erkannt? Sie mußte ihn erkannt haben, den Freund ihres Bruders. Aber sie mußte ihn auch ohne Kleidung gesehen haben. Triefend vor Nässe, mit haariger Brust und ohne Lendenschurz. Sie waren sich, wie das erste Menschenpaar, nackt begegnet, im paradiesischen Zustand, und hatten einander erkannt!
Jean Maynier stand neben seinem Pferd. Er starrte auf den dunklen Schatten des Waldes, in dem Madeleine verschwunden war, und wußte, er war seiner Liebe, seinem Schicksal begegnet.
Kapitel 2
1515
Benedictus Dominus, Deus meus, qui docet manus meas ad proelium, et digitos meos ad bellum. Gepriesen sei der Herr, mein Gott, der meine Hände übt zum Kampf und meine Faust zum Krieg ...
Es war kalt in der Kapelle, in der sie für den Sieg des Königs in Italien beteten und für die gesunde Rückkehr von Raymond d’Agoult, der keine Kosten gescheut hatte, sich dem jungen Abenteurer François anzuschließen, der, kaum war der alte König gestorben, nicht umhin konnte, sein Glück im Kampf um Mailand und Italien zu suchen.
Madeleine saß zwischen ihrem Cousin Louis und Jean Maynier, der gebeten hatte, bei der Andacht dabeisein zu dürfen. Ihre Großmutter hatte sie neben Louis gesetzt, aber noch bevor ein anderer sich zu ihrer Linken niederlassen konnte, kniete dort schon Jean Maynier und vertiefte sich inbrünstig seufzend in sein Gebet. Kurz drehte Madeleine sich zu ihrer Großmutter um, zu ihren Eltern, die nun ebenfalls erschienen waren und die Stirn runzelten über den jungen Mann, der diesen Platz, der einem Gast nicht zustand, so ungeniert eingenommen hatte. Natürlich kannten sie ihn, den Baron d’Oppède, aber ...
Misericordia mea, et refugium meum: susceptor meus, et liberator meus. Du mein Erbarmer, meine Zuflucht, mein Schirmer Du und mein Erretter ...
Madeleine konnte sich schlecht auf Pater Julius’ Worte konzentrieren. Er leierte sein Gebet herunter, schien sie aber gleichzeitig zu beobachten. Noch am Abend zuvor hatte sie bei ihm beichten müssen und Ablaß erreicht nur durch viele Ave Marias und das Versprechen, eine Gans zu liefern und einen Taler für die heilige Mutter Kirche und ihren Kampf um Gerechtigkeit und Gnade ...
Protector meus, et in ipso speravi. Mein Hort, auf den ich baue ...
Sie zog ihre altmodische Haube, die sie nur noch bei der Messe trug, tiefer ins Gesicht und schlug sich ihr seidenes Tuch um den Hals. Wie ein drohender Gott hing der Gekreuzigte über ihr. Er schaute grimmig, obwohl er doch die Welt erlösen sollte, und Pater Julius, der so hieß wie der kürzlich verschiedene Heilige Vater, schaute nicht minder grimmig auf sie ...
... qui subdit populum meum sub me. ... der Völker mir zu Füßen legt.
Außerdem war die Kapelle der kälteste Ort im ganzen Schloß. Pater Julius liebte sie, er dehnte gewöhnlich die Beichte aus, bis sie ihm alles gestanden hatte, bis sie auch den letzten sündigen Gedanken aus den verschlossenen Kammern ihres Herzens hervorgeholt hatte. Er wollte jede Regung genau wissen, denn sonst, so drohte er, würde Gott der Herr seine Hand abziehen von seiner Magd, und die heilige Mutter Kirche ...
Domine, quid est homo, quia innotuisti ei? Was ist der Mensch, o Herr, daß Du Dich um ihn kümmerst?
Madeleine hatte ihm von der Begegnung am Weiher erzählen müssen. Sie fand nichts Sündiges dabei, an einem schönen Tag im Wald nach Beeren zu suchen und dann im Wasser den Körper zu erfrischen und zu reinigen. Aber Pater Julius sprach von unzüchtigen Gedanken, sprach von den Versuchungen der Nacktheit, von Jungfräulichkeit und Keuschheit.
»Aber wir haben doch nur im Wasser geplantscht«, entgegnete sie ihm.
»Domine, disperde suberbos«, flüsterte er, »zerstreu die Stolzgesinnten.«
Sie war nicht stolz, obwohl sie eine Agoult war und Bruder Julius aus einem verarmten Apter Geschlecht stammte, aber die Mönche hatten sich schon immer minderwertig gefühlt, weil ihre Brüder die Erben und Titelträger waren und sie ins Kloster abgeschoben wurden. Sie verdammten in ihren Predigten den Reichtum und häuften ihn in ihren Klöstern und Kirchen an, sie erhoben den Zehnten und Ablaßgelder und ließen sich alles bezahlen, sie predigten Keuschheit und ließen doch keine Gelegenheit aus ... Nein, Madeleine wollte es sich nicht vorstellen. Sogar in Rom, hatte Raymond ihr mit spöttischem Lachen erzählt, sollte es Huren geben, und nicht einmal die Kardinäle seien frei von Versuchungen ...
Aut filius hominis, quia reputas eum? Was ist ein Menschenkind, daß du es achtest?
Daß ein nackter Mann am anderen Ufer stand, hätte sie Pater Julius beinahe verschwiegen. Aber dies wäre wieder eine Sünde gewesen, und Gott sah sowieso alles. Sie erwähnte, einen fremden Mann am Weiher gesehen zu haben und dann schnell weggerannt zu sein. Vor Gottes Augen waren alle Menschen nackt, die Jungfrau Maria würde es ihr verzeihen, daß sie ... Sie erwähnte nicht, ihn erkannt zu haben, den Freund ihres Bruders. Sie sei sofort in den Wald zurück und nach Hause geeilt, erklärte sie in das begierige Schweigen hinein, und habe einen Rosenkranz gebetet.
Homo vanitati similis factus est: dies eius sicut umbra praetereunt ... Ein flüchtiger Hauch nur ist der Mensch: hinschwinden seine Tage wie die Schatten ...
Zum Glück hatten auch ihre Begleiterinnen nichts bemerkt. Nackt war er gewesen, breitschultrig, Arme wie Samson, – ob er sie ebenfalls unbekleidet gesehen hatte? Sie fröstelte. Jetzt saß Jean Maynier an ihrer Seite, in einem fleckigen Wams, das nicht mehr der Mode entsprach, mit wirren Haaren und Bartstoppeln, die der Pflege eines Barbiers bedurften. Trotzdem strömte er eine Wärme aus, gegen die sie sich am liebsten gelehnt hätte, während ihr Cousin Louis auf der anderen Seite zwar elegante breitmäulige Fußbekleidung aus feinstem Leder trug, seine Seidenstrümpfe aber die dünnen Beine kaum verbargen. Jean Mayniers Waden dagegen strotzten vor Kraft.
Domine, inclina caelos tuos, et descende: tange montes, et fumigabunt. Herr, neige deine Himmel, steig herab, berühr die Berge, daß sie rauchen.
Weil ihr ein Tropfen aus der Nase lief, holte sie ein Tüchlein und tupfte sie trocken. Aus Versehen ließ sie es fallen. Pater Julius hob die Stimme und donnerte auf sie herab: Fulgura coruscationem, et dissipabis eos: emitte sagittas tuas, et conturbabis eos! Laß zucken Deine Blitze und zerstreue sie, schieß Deine Pfeile, schrecke sie!
Blitzschnell hatte sich Jean Maynier gebückt und das Tüchlein mit sicherem Griff an sich gebracht, auch Cousin Louis bückte sich, doch zu spät. Louis war ein braver Bursche, ein wenig langsam, ein wenig schwerfällig, trotz seiner dünnen Waden, und noch nicht einmal ein guter Jäger, wie Raymond ihr erzählt hatte. Jean Maynier reichte ihr das Tüchlein, er lächelte und deutete eine galante Verbeugung an. Ein wenig steif zwar, aber saßen sie nicht in einer kalten Kapelle und mußten sich die Sprüche von Pater Julius anhören, der für den Sieg des Königs betete und für Raymonds Rückkehr? Es war ihr gleichgültig, ob der König Mailand eroberte oder nicht, aber Raymond durfte nichts geschehen.
Sie besaß nur einen Bruder und sie liebte ihn sehr. Raymond war nie schlecht gelaunt, sah gut aus und kleidete sich immer elegant. Außerdem konnte sie ihm alles erzählen, und er behandelte sie auch nicht wie einen zweitrangigen Menschen, nur weil sie eine Frau war, die zu dienen hatte. Raymond war am Hofe von Königmutter Louise erzogen worden, wie François, der König, wie Marguerite, die Schwester des Königs, und dort herrschte ein freier Geist, dort hatte man schon viel aus Italien gelernt. François, so erzählte Raymond, liebte und verehrte die Frauen, er war nicht nur ein guter Kämpfer, sondern auch ein Charmeur und ein Dichter. Ja, Raymond konnte schwärmen. Nein, Raymond durfte vor Mailand nicht fallen oder verwundet werden ...
Emitte manum tuam de alto, eripe me, et libera me de aquis multis: de manu filienorum alienorum. Streck von der Höhe aus die Hand, errette mich, und reiß mich aus den mächtigen Wassern; befrei mich aus der Hand der Fremden.
Noch immer starrte Pater Julius sie an. Sie hüstelte, und noch voller Angst wiederholte sie flüsternd seine Worte: »Eripe eum, libera eum, laß ihn wieder zurückkommen, ich werde auch jeden Abend einen Rosenkranz beten!«
Jean Maynier hielt ihr noch immer das Tüchlein hin und schaute sie fragend an. Sie nahm es und lächelte. Seine blauen Augen schienen sich in ihre Augen bohren zu wollen. O Gott, was sind seine Augen kalt, dachte sie, hätte Pater Julius solche Augen, nie könnte sie vor ihm etwas verheimlichen. Aber Jean Mayniers Lächeln war einnehmend. Er hielt ihr Tüchlein einen Augenblick länger, als es der Anstand verlangte, und berührte, wie aus Versehen, ihre Hand. De manu filienorum alienorum, wiederholte sie stumm. Jean Mayniers Gesicht hatte eine dunkle Röte überzogen, er wandte sich ab und bedeckte es mit seinen Händen wie zum schamvollen Gebet. Auch Louis hatte sich abgewandt, zog aber ein Gesicht wie nach einer verhagelten Ernte. Nach ihren Eltern und nach ihrer Großmutter wagte sie gar nicht zu schauen. Ihr Verhalten würde ohnehin wieder Vorwürfe nach sich ziehen. Jean Maynier galt in ihrer Familie als Hungerleider.
»Der Sohn eines Borgia-Günstlings«, hatte die Großmutter einmal gesagt, die selten ein Blatt vor den Mund nahm, »dieser Baron aus dem Rattennest von Oppède.«
Nur Raymond hatte ihn verteidigt: »Seine Familie vertrieb zwar nicht die Ungläubigen aus der Provence, aber er ist ein guter Christ, geradeheraus und rechtschaffen, ein hervorragender Jäger, ein Herkules, er rennt so schnell wie ein Pferd und ist ausdauernd wie kein anderer. Außerdem ist er im Kollegium der beste.«
»Wenn er so stark und schnell ist, warum begleitet er dann den König nicht nach Mailand, wie es sich für einen jungen Mann von Adel gehört.«
Raymond wurde unsicher: »Er hat sich bei der Jagd verletzt, sonst würde er ...«
Die Großmutter lachte ihn aus.
Quorum os locutum est vanitatem: et dextera eorum, dextera iniquitatis. Ihr Mund spricht Lug und Trug, gefüllt ist ihre Rechte mit Gewalttat.
Tatsächlich hatte Madeleine weder am Weiher noch jetzt in der Kapelle etwas von einer Verwundung bemerkt. Ein Feigling war Jean Maynier sicher nicht, dies würde er noch allen beweisen.
»Warum zieht Louis nicht mit?« fragte sie, um ihrem Bruder beizuspringen.
»Louis ist nicht für den Kriegsdienst geschaffen, basta.« Basta sagte die Großmutter immer, wenn sie eine Diskussion beenden wollte. »Es reicht schon, wenn einer unserer Familie in dieses Abenteuer zieht. Basta!«
Gloria Patri, rief Pater Julius, und alle stimmten sie ein.
Als sie schließlich zum Ahnensaal zogen, in dem man einen Schluck Wein trinken und eine kleine Stärkung zu sich nehmen wollte, nahm die Großmutter Louis demonstrativ am Arm und ließ sich von ihm führen. Die Eltern trotteten schweigend hinter ihr her.
Madeleine schaute sich kurz nach Jean Maynier um, der einen Schritt zurückgeblieben war und offensichtlich nicht wußte, ob er gleich sein Pferd besteigen oder die Familie in den Saal begleiten sollte. Sie fühlte seinen Blick in ihrem Nacken. Nackt hatte sie ihn gesehen, vielleicht auch er sie! Verband sie nun nicht ein geheimes Band, ein Band, das Gott eingefädelt hatte? Wie er ihr in der Kapelle das Taschentuch gereicht hatte! Und sein Blick!
Aber warum war er überhaupt erschienen? Noch nie hatte er in ihrer Familienkapelle an einer Andacht teilgenommen. Es war gut vorstellbar, daß er um ihre Hand anhielt. Nein, heute noch nicht, aber demnächst. Und sie? Wie sollte sie sich verhalten? Hitzewellen durchströmten sie und ließen sie erröten. Was würden ihre Eltern sagen? Und die Großmutter?
Im Ahnensaal wollte Madeleine Jean Maynier zuerst übersehen, aber als er in seiner männlichen Größe neben ihr stand, fühlte sie sich so angezogen, daß sie ihm, wie unter Zwang, ein Glas Wein reichte. Ein wenig steif, aber höflich verbeugte er sich, und wieder, wie in der Kapelle, stand sie im Banne seiner Nähe, seines Körpers, seines Geruchs. Feuchte Gemächer vermischten sich mit dem Schweiß von Pferden, und das Blut von Schwarzwild ...
Louis, der nicht von ihrer Seite weichen wollte, hüstelte. »Er wird sicher wiederkommen, unser Raymond«, betonte er. »Im Glanz des Ruhms.«
»Der Ruhm steht dem König zu«, warf Jean Maynier ein.
»Aber unser verstorbener König hat bei Novara verloren, und er war ein guter Herrscher«, sagte Madeleine, »François ist noch jung, ein Heißsporn, wie es heißt.« Als niemand auf ihre Bemerkung einging, fügte sie noch an: »Müssen wir Mailand wirklich erobern?«
Die Großmutter drehte sich schwungvoll den jungen Leuten zu. »Was verstehst du schon von Krieg und Politik, du dumme Gans«, fuhr sie Madeleine an. »Weißt du eigentlich, wo Centallo liegt? Jenseits der Alpen, nicht weit vom Herzogtum Mailand entfernt, dem gierigen Zugriff der Feinde ausgesetzt. Die Schweizer haben sich jetzt schon im Piemont eingenistet, die Nachrichten aus unserer alten Heimat sind wenig beruhigend.«
»Aber der König ist noch unerfahren«, wagte Madeleine zu widersprechen, »und die Schweizer sind unbesiegbar. Denkt doch nur an den Herzog von Burgund. Vor Nancy mußte er sterben. Und er war ein tapfrer, ein unerschrockener Ritter.«
Ihre Eltern waren nun ebenfalls herangetreten, der Vater runzelte die Stirn.
»Was die Mädchen heutzutage alles lernen!« Die Großmutter schüttelte den Kopf. »Auf jeden Fall das Falsche.« Ihre ausladende Haube drohte herunterzurutschen, mit einer heftigen Bewegung schob sie sie zurecht. »Mein liebes Kind«, wandte sie sich erneut an Madeleine, »der König ist ja nicht allein, Bourbon ist bei ihm, Bayard, Montmorency und nicht zuletzt Marschall Trivulce, mein Bruder, Edelleute also, die schon so manchen Strauß ausgefochten haben und die wissen, wofür sie kämpfen. Ein Ritter, der für seine Ehre kämpft und für den Boden, auf dem er verwurzelt ist, wird es mit vielen Söldnern aufnehmen. Und was sind die Schweizer anders als geldgierige Bauernburschen, aufgeplusterte Gockel, die jedes Pferd von Charakter abwerfen würde, dressierte Feiglinge, die sich hinter ihren Piken und Hellebarden verstecken ...«
»Liebste Mutter ...,« unterbrach sie Madeleines Vater, aber mit einer barschen Handbewegung wurde er zum Schweigen gebracht.
Pater Julius hatte die Hände vor die Brust gelegt und warf einen seufzenden Fürbitteblick zur Decke des Saals. »Gott der Herr wird der gerechten Sache zum Sieg verhelfen, er ist gnädig und liebt die Jugend ...«
»Wäre ich doch bei Raymond und bei dem König!« rief Louis aus.
»Schluß jetzt. Basta!« Die Stimme der Großmutter wurde schrill. »Pater, sprecht ein Machtwort!«
»Wie frische Sprößlinge voll Kraft, so sind in ihrer Jugend unsere Söhne; und wohlgestaltet unsre Töchter, gar schmuck wie Tempelzier. Gefüllt sind unsre Speicher, überfließend von Früchten jeder Art. Fruchtbar sind unsre Schafe, ohne Zahl auf ihren Triften, und fett sind unsre Rinder ...«
Die Großmutter drehte sich um, rief »Amen« und »So soll es sein« und noch einmal »Basta!« und humpelte, auf ihren Stock gestützt und geführt von ihrer Kammerfrau, in Richtung Saaltür. Kurz bevor sie den Raum verließ, drehte sie sich noch einmal um und richtete ihren Stock auf Madeleine und Louis: »Ich will, daß ihr beide heiratet«, knurrte sie, »unser Land muß zusammenbleiben!«
Madeleine errötete, Louis nicht minder. Jean Maynier trat einen Schritt zurück und straffte seinen Körper.
»Kein Riß in unserer Mauer, keine Bresche, kein Klageruf ertönt auf unsern Plätzen. Glückselig jenes Volk, dem das beschieden Gott der Herr! Amen.«
Madeleine sah, wie Jean Mayniers Augen schmaler wurden. Sie preßte das Tüchlein in ihrer Hand.
»Amen«, echoten ihre Eltern.
»Amen«, sagte auch Louis.
Kapitel 3
1516
»Sie kommen, sie kommen«, hörte Madeleine die Mägde rufen und eilte zum Fenster. Die Schloßwachen rannten nervös durcheinander, die Schwerter schlenkerten um ihre Hüften. Befehle hallten über den Hof. Die Wachen sollten ein Spalier bilden, bis hinab zur Zypressenreihe, einer streng ausgerichteten Doppelallee, die man mit lilienbestickten Tüchern umwunden hatte. Die gründlich polierten Helme, Brustpanzer und Hellebarden glänzten in der milchigen Wintersonne, die das Schloß von Lourmarin, das Dorf und die dunklen Bergrücken des Luberons in ein warmes Licht tauchte.
Lilien hingen nicht nur um die Zypressen, Lilien hingen überall und zwischen ihnen der Salamander, der aus dem Feuer kam. Aufgeblühte Lilien in Weiß auf blauem Samt, sogar Goldfäden hatte man auftreiben können und mit ihnen die Konturen veredelt, das Feuer noch mehr leuchten lassen. Teppiche und Tücher, mit Lilien bestickt oder belegt, schmückten die Fenster und das Portal und lagen auf der Treppe. Neben dem Wappen der Agoults hatte man François’ Wappen angebracht. Der Salamander spie Feuer, über seinem Kopf schwebte die Krone, unter seinen Drachentatzen stand stolz und selbstbewußt nutrisco et extinguo – ich ernähre und vernichte.
Aber weder die Großmutter noch Madeleines Eltern waren glücklich über den Empfang, den sie dem jungen König bereiten konnten. Man hatte keine Kosten gescheut, und doch fiel die Prachtentfaltung bescheiden aus. Das ganze Schloß war bescheiden, trotz der beiden Pfaue, die man stolz herzeigte, obwohl sie nur selten ihr Rad schlugen. Und natürlich war das Schloß viel zu klein für den Sieger von Marignano, der mit dem gesamten Hofstaat durch die Provence zog, den Bezwinger der Helvetier, den neuen Cäsar, der die Alpen so wagemutig überquert hatte wie einst Hannibal.
Zum Glück zog der Haupttroß über Arles nach Avignon. Diese Botschaft hatte Raymond ihnen zukommen lassen, der König werde ihn aber bis zu seinem Heim begleiten, mit Louise, seiner Mutter, und Marguerite, der entzückenden Schwester. Claude, des Königs Gattin, fühle sich für den Umweg zu schwach und wolle sich in Avignon ein wenig ausruhen, sie sei also nicht dabei, auch die Garde erscheine nur mit hundert Mann, und die Marschälle und Heerführer hielten sich schon im Comtat Venaissin auf, in der Grafschaft des Papstes.
Madeleine hörte laute Hochrufe und sah eine Staubfahne hinter den Zypressen. Die Bevölkerung von Lourmarin und die Bauern der umliegenden Dörfer hatten sich versammelt und jubelten, angefeuert von einem Schloßbediensteten, dem König zu. Während der letzten Tage hatten sie Ochsen, Schweine und Ferkel, Hühner und Gänse abliefern müssen, waren dafür aber bezahlt worden. Raymond wünschte sich dies in seiner Botschaft, zum Mißfallen seines Vaters.
Aber die Großmutter erklärte: »Der Junge hat recht. Wenn ein Sieger nicht großzügig ist, wer dann? Basta!«
»Und trainiert schon einmal für das Turnier«, war Raymonds letzter Satz, »der König will zeigen, daß er der beste Ritter im ganzen Land ist.«
Louis, der dabeistand, als man die Botschaft verlas, wurde bleich. Die Großmutter kratzte sich am Hals und knackte dann einen Floh, der ihren Fingerspitzen nicht hatte entkommen können.
»Jean Maynier«, rief Madeleine begeistert, »wir müssen Jean Maynier einladen, er ist der einzige ...«
Die Großmutter schaute sie scharf an. »Sie hat recht! Der Baron von Borgias Gnaden muß her. Wir wollen dem König zeigen, daß der Luberon nicht nur unseren untadeligen Raymond hervorgebracht hat, sondern auch andere tapfere Ritter. Die bereit sind, sich von der allerhöchsten Lanze in den Sand setzen zu lassen. Apropos Sand. Habt ihr dafür gesorgt, daß ...«
Und die hektische Vorbereitung der Empfangs nahm ihren Fortgang.
Inzwischen hatte sich die Wache in Reih und Glied aufgestellt und Haltung angenommen. Madeleine trieb die Kammermädchen an, ihr Brokatgewand zu richten und das Seidenfutter durch all die Schlitze zu zupfen. Auch war die Frisur noch nicht endgültig gerichtet. Zweimal hatte man ihre Haare auskämmen müssen, die Locken neu geflochten, und sogar ihre Mutter war erschienen und hatte ihr die Stirn noch weiter ausrasiert. »Das ist in Italien Mode, und der König kommt aus Italien.« Die Haube war zwar mit Perlen bestickt, blieb aber fast unschicklich knapp und wollte so gar nicht zu der hohen Stirn und dem üppigen Haarkranz passen. Die Mutter runzelte die Stirn, ließ es aber dabei bewenden, konnte jedoch nicht umhin, den Ausschnitt zu beanstanden, der wegen des kalten Wintermistrals nicht frei lag, sondern den Busen unter halb durchsichtiger Seide nur erahnen ließ.
»Er sieht nicht üppig genug aus. Da muß noch etwas geschehen«, befahl sie.
Madeleine, die sich aus dem Fenster lehnte, winkelte erst ein, dann das andere Bein an, damit ihr die bestickten und mit Perlen verzierten Schuhe übergezogen werden konnten, und wartete auf das Erscheinen des hohen Besuchs. Und natürlich auf Raymond, der unverletzt geblieben sein sollte. In erster Linie aber auf den König! Den jungen strahlenden Herrscher, von dem nach seinem Sieg über die Schweizer und nach dem Treffen mit dem Heiligen Vater überall in höchsten Tönen die Rede war. Gab es einen König auf der Welt, der seine Herrschaft mit solch einem Triumph begonnen hatte? Noch dazu gerade mal einundzwanzig Jahre alt. Ein Heißsporn, den Fortuna liebte. Madeleine hatte viel von ihm gehört. Kaum war die Nachricht vom Sieg bei Marignano durchgedrungen, schien ein Damm gebrochen. Als hätten vorher alle den Atem angehalten, brach es jetzt aus allen Mündern heraus. Sogar die Dienstboten steuerten ihre Geschichten bei, sie wollten Zeichen am Himmel gesehen und geträumt haben von niederstoßenden Adlern und von Stürmen, die in die Reihen der Schweizer gefahren seien.
Insbesondere die Familien, deren Männer und Söhne Raymond begleiteten, führten sich regelrecht hysterisch auf. Noch wußte von ihnen niemand, ob nicht einer aus der gräflichen Truppe verwundet oder gar getötet worden war. Die beiden Bogenschützen und die zwei jungen Diener kannte Madeleine persönlich. Von ihnen ließ sich Raymond häufig auf der Jagd begleiten. Falls er in voller Rüstung vom Pferd gestoßen wurde, hatten sie ihn wieder auf die Beine zu stellen. Von dem fünften hatte sie nur gehört. Er war Schlachter und stammte aus Bonnieux. Seine Aufgabe bestand darin, dem zu Boden gegangenen gegnerischen Ritter unter dem Harnisch die Kehle durchzuschneiden. Beziehungsweise zu verhindern, daß ein anderer Soldat das gleiche bei Raymond versuchte. In dem Gewühl aus Pferdeleibern, Rüstungen, Schwertern und um sich stechenden und schlagenden Soldaten war das keine leichte Aufgabe.
Madeleine verstand sowieso nicht, warum man nicht den gegnerischen Ritter am Leben ließ. Schließlich war auch er ein Edelmann. Wer vom Pferd geworfen wurde, zog sich freiwillig zurück und schied wie bei einem Turnier als der Schwächere aus dem Kampf aus. So ein Sturz vom Pferd war schon schmerzhaft genug, und manch einer brach sich die Knochen. Dann mußte einem nicht auch noch die Kehle durchschnitten werden. Wenn es schon nötig war, daß sich Männer in einer Schlacht umbrachten, dann sollte dies auf die Söldner beschränkt bleiben; die wurden dafür bezahlt und konnten ihretwegen sterben. Aber die Ritter, die nur einen lächerlich geringen Sold erhielten, dafür aber die ganze teure Ausrüstung stellen mußten, hatten gefälligst zu überleben!
Raymond hatte sie ausgelacht, als sie ihm vor seinem Aufbruch ihre Meinung gesagt hatte. »Ein Ritter kämpft für seinen König und seine Ehre. Und für eine gerechte Sache. Und für Gott. Stirbt er, braucht er kein Fegefeuer zu befürchten.«
Aber dann sah sie seine Knie doch plötzlich zittern.
Die Großmutter und die Eltern standen im Turmportal, als ein nervöser Rappe durch das Hoftor tänzelte. Auf ihm saß ein Hüne von Mann in lilienübersätem Samt. Der König! François I. Er lächelte leicht spöttisch, aber freundlich, hielt kurz an, drehte sich um, und da war auch schon Raymond auf seiner Fuchsstute. Er rief »Madeleine, Madeleine!« Er hatte sie gesehen. Auch der König winkte, keine Spur von majestätischem Gehabe und steifer Etikette. Breitschultrig war er, gegen ihn sah Raymond wie ein schlanker Page aus. Aber die Nase! Von der Nase hatte sie schon gehört, und sie war tatsächlich riesig.
Und nun tänzelte eine junge Frau heran, die ihm wie ein Zwilling ähnelte. Sie mußte seine Schwester sein, die gebildete entzückende Marguerite. Eine Sänfte wurde herbeigetragen, Louise wohl, die Königmutter, und neben ihr ein unglaublich fetter Mann in golddurchwirktem Rot. Das konnte nur Duprat sein, der Kanzler, François’ väterlicher Ratgeber und rechte Hand. Und um sie herum überall die Soldaten des Königs, der sich nun mit einem Handschuh den Staub von seiner Kleidung klopfte.
Madeleine sah ihre Eltern sich tief verbeugen. Raymond schwang sich vom Pferd. Nun hielt sie es nicht mehr am Fenster aus, sie flog die Treppe hinunter, um ihren geliebten Bruder in die Arme zu schließen. Tränen schossen aus ihren Augen, Tränen der Freude, und sie übersah sogar den König, als sie Raymond an den Hals flog. Sie küßte ihn, sie herzte ihn, bis eine warme, dunkle Stimme in ihr Ohr flüsterte: »Schönste Provençalin – und ich?«
Es war der König. Und sie sank auf die Knie.
Madeleine, inzwischen gesättigt, die glühenden Wangen vom Wein gerötet, konnte immer nur staunen, wie jungenhaft locker und unkompliziert der König sich verhielt, obwohl er durch seine Größe und seine kostbare Kleidung wie ein geborener Herrscher wirkte. Natürlich hatte er vor dem gemeinsamen Mahl die Kleidung gewechselt, trug nun ein hermelinbesetztes Barett und ein aufbauschendes, beigefarbenes Seidenwams, das von schwarzen Samtstreifen überzogen und reich bestickt war. Seine Brust schmückte ein Goldmedaillon, das an einer langen, mit Perlen durchsetzten Kette hing. Für einen so großen und starken Mann waren seine Finger erstaunlich schlank. Aber am meisten faszinierten sie sein spöttisches und doch wohlwollendes Lächeln, das immer wieder in ungehemmtes Gelächter ausbrach, der kluge, blitzende Blick, dem nichts entging, und die weiche, dunkle Stimme, mit denen er die Damen umschwärmte.
»Ein Hof ohne Frauen ist ein Jahr ohne Frühling, ist ein Frühling ohne Rosen«, hatte er sogleich der Großmutter zugerufen, die Louise, der Herzogin von Savoyen, ihren Kopf zuneigte.
Marguerite, seine Schwester, unterbrach ihn sofort: »Aber wir haben Winter, und in dieser Jahreszeit blühen die Rosen nicht, sondern stechen jeden, der sie brechen will.«
Der König lachte, er hob seinen Pokal und rief ironisch: »O wie geistreich dieser Reim!« Er prostete ihr zu, prostete allen zu, ließ sich den Pokal wieder füllen und wandte sich an Madeleine. »Diese Rose duftet besonders gut.«
Sie spürte, wie die Röte in ihrem Gesicht sich zu Purpur verdunkelte.
»François!« ermahnte ihn seine Schwester.
»François!« ermahnte ihn auch seine Mutter, aber er lachte nur und ließ die Gläser klingen.
Madeleine blickte verstohlen zur Großmutter, die auf das charmante Zuprosten ohne mißbilligende Stirnfalte reagierte. Auch die Mutter reagierte mit einem sehr feinen Lächeln, der Vater schaute weg, und Raymond unterhielt sich gerade mit dem Kanzler. Nur Jean Maynier, der am unteren Ende der Tafel saß, verzog keine Miene, starrte sie mit einem wilden Blick an und trank hastig. Er hatte sich bisher noch nicht von der fröhlichen Stimmung anstekken lassen, aber vielleicht fühlte er sich in seiner altmodisch straffen Kleidung unwohl, fühlte sich auch schuldig, daß er seinem König nicht den ritterlichen Ehrendienst geleistet hatte und nun wie ein Drückeberger vor ihm sitzen mußte.
Zum Glück hatten es allen geschmeckt, die Pistazientorte und die mit Zimt bestreuten Bratäpfel, die mit Artischockenherzen gezierten Pasteten, die Taubeneier in Safransauce, das mit Mandeln gewürzte Fischragout, das Forellenfilet und schließlich das kandierte Obst. Der Wein aus eigenem Anbau war besonders von Kanzler Duprat gelobt worden.
François’ Charmieren hatte etwas nachgelassen, weil man ihn und Raymond bat, von seinem Siegeszug nach Italien zu erzählen. Der König legte in seiner jugendlichen Begeisterung los, und auch Raymond ließ sich anstecken. Die beiden sprangen schließlich auf und lieferten das Drama einer Schlacht, die das Schicksal Frankreichs, so glaubte sein König, entschieden hatte.
Madeleine hörte von der geschickten Sperrung des Alpenübergangs durch die Schweizer, die sich bei Susa festgesetzt hatten, hörte davon, wie sie hereingelegt wurden – durch Improvisation, Wagemut und Kühnheit. Marschall Trivulce, ihr Großonkel, hatte einen unbekannten Alpenübergang entdeckt, den Paß von Larche, und wie einst Hannibal hatte man das Unerhörte und scheinbar Unmögliche gewagt und einen neuen Weg gefunden: der Herzog von Bourbon an der Spitze der Vorhut, dann das Heer, die Ritter in ihrer schweren Rüstung, sogar die Kanonen, alle an Eis und Schnee vorbei, durch reißende Bergbäche, durch Schluchten und geduckt unter Felsen. Keiner nahm Rücksicht auf die Tücken der Natur, und manches Pferd stürzte in die Tiefe und mit ihm der Ritter. Mancher Fußsoldat wurde durch Steinschlag getötet. Kaum Schlaf, nur Verpflegung für drei Tage, weil der Troß nicht nachkam, zwei Tage nur Schnee, Felsen, Wind und Schweiß.
Hätten die Schweizer bemerkt, welchen Weg die französische Armee zu klettern wagte, so hätten sie die Falle zuschnappen lassen. Dann wären sie aufgerieben worden, mausetot wären sie, all die Edelleute, die mutigen Ritter mit ihren Mannen. Aber die Schweizer hatten nichts bemerkt. Sie warteten in Susa hinter ihren Schanzen vergeblich.
Doch noch war auch ohne die Schweizer das Wagnis nicht durchstanden. Der Abstieg! Die Pferde scheuten! Die Männer rutschten und verstauchten sich die Knöchel. Die Kanonen mußten von Fels zu Fels abgeseilt werden! Doch keiner murrte. Tollkühn war der Versuch, und nun hatten sie es fast geschafft. Nun würden sie auch den Rest noch schaffen. Eine kleine Schlacht gegen die stachligen Schweizer Haufen. Wer die Alpen bezwungen hatte, würde auch die Spieße und Hellebarden niederwalzen.
Der König stieß mit Raymond an, trank und drückte ihn anschließend an seine breite Brust.
»Und dann Colonna!«
Beide wollten sich ausschütten vor Lachen.
»Ich wußte von nichts«, rief der König, »aber Bayard und die junge Bande überraschten den päpstlichen Condottiere mitsamt seinen Offizieren beim Fressen und setzten sie im Handstreich matt, fingen sie wie Tauben im Käfig. Tausend Ritter, da glotzten sie, als käme der Heilige Geist über sie, ein Streich sondergleichen, genial, und Colonna fluchte wie ein Pferdeknecht.«
»François, achte auf deine Wortwahl«, ermahnte ihn seine Mutter, »du befindest dich im Kreise von Damen!«
»Entschuldigt, Madame, die Begeisterung reißt mich fort.«
»Weiter, weiter!« rief Madeleine und hielt sich dann, erschrocken über ihren Mut, die Hand vor den Mund.
Die Großmutter schaute nur milde.
Der König ließ sich nicht zweimal bitten. Die Schweizer, so berichtete er, gaben ihre Sperrstellung bei Susa auf, so daß nun weitere französische Truppen unbehelligt durchkamen, zogen sich aus Piemont nach Mailand zurück, die französische Armee sammelte sich, ordnete sich, rückte langsam vor.
»Wir verhandelten sogar!«
Ja, der König war nicht nur ein wilder Draufgänger, er war im Grunde ein friedensliebender Mann. Er gab dem Gegner eine Chance, er wollte Mailand, aber er wollte auch Frieden. Eine Million Goldtaler war ihm der Frieden wert, eine Million für die Schweizer Bauernburschen. Mailand sollte ohne einen Blutstropfen französisch werden.
An seinem Geburtstag am zwölften September, dem Tag des Heiligen Apollonius, hatte der König noch an einen Sieg ohne Blutvergießen geglaubt, am dreizehnten jedoch gellten die Sturmglokken durch Mailand.
Der König hatte sich auf einen Schemel gestellt, riß sein Schwert in die Luft: »Sie wollten den Krieg! Ich gab mich in das Unabänderliche und bat Gott um einen gerechten Sieg. Mir blieb nicht viel Zeit fürs Gebet. Sie rückten an, sie richteten ihre Spieße gegen uns, sie bedrängten Bourbon und wollten die Kanonen erobern, um sie gegen uns zu wenden. Es wurde höchste Zeit, sich ins Kampfgetümmel zu stürzen!«
Madeleine hielt die Luft an. Raymond war zurückgetreten und ließ den König noch einmal seine Schlacht schlagen.
An der Spitze seiner Kavallerie donnerte er Bourbon zu Hilfe, aber schon hatten die Schweizer die ersten Kanonen erobert und sie gegen die Franzosen gerichtet. Der Kampf stand, kaum hatte er begonnen, auf Messers Schneide, nein, er war fast schon verloren. Besäßen die Schweizer erst alle Kanonen, wären die Würfel gefallen, und der Tod könnte reiche Ernte halten.
Aber in diesem Augenblick erreichte der König mit zweihundert seiner schweren Reiter die Artillerie.
»Wir warfen uns auf sie wie wütende Keiler, wir knickten ihre Piken wie Hölzchen, wir trampelten sie nieder und drängten sie zurück. Die Kanonen waren wieder unser. Und da rückte auch schon der schwarze Landsknechtshaufen nach, Bourbon griff erneut an, der Kampf tobte weiter, bis in die Nacht hinein, bis der Mond gespenstisch das Getümmel beleuchtete. Wir trugen das weiße Kreuz auf unserer Brust, die Schweizer ebenfalls, man konnte den Feind kaum mehr vom Freund unterscheiden. Dann schoben sich Wolken vor den Mond, und wir mußten einhalten. Noch hatte niemand gewonnen. Die Nacht war schwarz. Ich wollte aus einem vorbeifließenden Bach trinken: Doch das Wasser war so rot vor Blut wie der Wein eurer Heimat.«
Er ließ sich von Raymond seinen Pokal reichen, trank ihn leer und genoß die gebannten Blicke der Zuhörer.
»Ich traf alle Vorbereitungen für den Sieg, aber ich traf auch die Vorbereitungen für eine Niederlage, sprach mit den Rittern, mit den Bogen- und Armbrustschützen und den Landsknechten. Und ich betete. Bei Morgengrauen dann wälzte sich der Feind wieder heran. Wie eine Lawine voll spitzer, todbringender Eisen. Wie ein tobender Sturmwind. Ich hielt stand. Bourbon hielt stand. Unsere Kanonen lichteten die Reihen der Schweizer. Doch gaben sie nicht auf. Plötzlich hörte ich, daß Alençon auf dem linken Flügel überrannt worden war.«
Er warf einen Blick auf seine Schwester, die Gattin des Herzogs von Alençon.
»Unsere Flanke war offen und verwundbar, das Glück schien sich gegen uns zu wenden, denn noch immer hatten wir nicht gesiegt. Da ertönte plötzlich das Kampfgeschrei San Marco! San Marco! Die venezianische Kavallerie eilte uns zu Hilfe, fiel den Schweizern in den Rücken. Welch ein Glück, daß ich die Venezianer rechtzeitig benachrichtigt hatte!«
Er reckte das Schwert noch einmal siegreich in die Höhe.
»San Marco! La France! Da gaben die Schweizer auf. Geordnet zogen sie sich zurück. Sie nahmen sogar ihre Toten mit. Aber sie hatten die Schlacht verloren. Und ich hatte den Ruf ihrer Unbesiegbarkeit zerstört.«
François stieg vom Stuhl herab, steckte sein Schwert in die Scheide, setzte sich mit einer bescheidenen Geste an den Tisch und wies auf Raymond.
»Ohne meine Ritter und Freunde wäre ich jetzt tot, und Frankreichs Schmach wäre nie wieder auszulöschen.«
Plötzlich schluchzte er auf und warf sich Raymond an die Brust.
»Zehntausend Mann sind gefallen«, stieß er hervor. »François de Bourbon ist tot, der Bruder des Konnetabel, Talmont, Boisy, Imbercourt, alle sind sie tot, Guise hat zweiundzwanzig Lanzenstiche im Leib, und ohne meine Garde stünde auch ich längst vor dem Allmächtigen.«
»Sire!« Raymond richtete den König wieder auf und wischte ihm die Tränen aus dem Gesicht, »Sire, Marignano ist ein Meilenstein in der Geschichte, und Ihr seid der strahlende Sieger. Ihr habt die Schmach von Novara gerächt und Frankreichs Ruhm vermehrt. Ihr habt die Helvetier bezwungen, Mailand erobert, mit dem Papst ein Konkordat geschlossen. Ihr seid der größte Herrscher unter unseren Völkern. Seid Euch dessen bewußt. Ihr solltet Kaiser werden! König von Frankreich, Herzog von Burgund, König von Neapel und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs.«
»Recht hat er«, rief Duprat und hielt seinen Pokal hoch. »Es lebe François, der neue Cäsar, der Kaiser der Zukunft!«
Der König lächelte nun wieder. Wie der römische Imperator streckte er seine rechte Hand in die Höhe. Seine Mutter strahlte. Marguerite, die Herzogin von Alençon, strahlte nun auch. Fort war der düstere Schatten, der über ihr Gesicht gezogen war, als ihr Bruder die Niederlage ihres Mannes erwähnt hatte. Madeleines Eltern applaudierten, die Großmutter hielt huldvoll ihre Hände in die Höhe und murmelte »Amen, amen!«
Madeleine war aufgesprungen, zu ihrem Bruder geeilt und hatte ihn geküßt. Ein fester Griff umfaßte ihre Taille, und nun hielt ihr der König seine Wange hin. Fast schwanden ihr die Sinne. Alles wirbelte in ihrem Kopf, sie sah die wilden Kämpfer und den König inmitten von Eisen und Blut, Lanzen und Spießen, Pferden und Schlamm. Der Held trug sie davon. Und alle applaudierten. Der Wein war ihr zu Kopf gestiegen, die Haare hatten sich zum Teil aufgelöst, und es war so warm geworden, daß sie ihren Ausschnitt befreit hatte. Sie wußte nicht mehr, was Wirklichkeit vom Traum trennte. Vor ihr der Tisch mit dem Wein, dem Obst, den Kerzen, und im Kamin loderte das Feuer. In allen Kaminen loderten Feuer, und die Flammen rissen sie mit. Die leuchtenden Augen der Anwesenden zogen vorbei. Ihr war schwindlig, und sie wußte nicht, was sie tun sollte, als der König sie wieder auf einen Stuhl setzte.
»Musik!« rief er.
Ein wenig kläglich stimmten eine Laute und eine Flöte eine Melodie an.
Madeleine war der Kopf auf die Arme gesunken. Sie hob ihn wieder und sah Jean Maynier ins Gesicht. Seine Augen blickten sie in kalter Wut an, aber sein Mund lächelte. Er reichte ihr ein Glas. Alle stießen sie an.
»Wir wollen tanzen!« rief der König.
»Ja, tanzen«, lallte Madeleine.
Kapitel 4
1516
Am nächsten Morgen erwachte Madeleine spät. Ihr Kopf schmerzte. Draußen schien die Sonne, es war kühl, aber klar, und sie ließ sich ankleiden. Der König sei schon auf der Jagd, hörte sie, mit dem jungen Herrn und Baron d’Oppede. Die Hundemeute sei in der Frühe ganz wild gewesen.
Als sie sich aus dem Fenster beugte, hörte sie Hörnerschall in der Ferne. Ihre Mutter erschien und ordnete an, sie solle ihr schönes Kleid anlegen, das goldbestickte Brokatkleid, aber die Ärmel müßten gründlich aufgebauscht werden, das sei Mode in Italien. Den Ausschnitt dürfe sie mit der dreifachen Perlenkette zieren, die der Marschall von Trivulce der Großmutter nach einem seiner ersten siegreichen Feldzüge aus Italien mitgebracht habe. Für solch einen Tag sei nichts gut genug, um ein schönes Mädchen noch schöner zu machen, und außerdem solle sie sich mit Rosenwasser benetzen. Madeleine errötete. Der Scheitel gehöre glatt und genau auf die Mitte des Kopfes, die Haare sollten zu Zöpfen gebunden und um den Hinterkopf gelegt werden. Die Kammermädchen wurden angewiesen, sorgfältig zu arbeiten.
»Und womit bedecke ich meine Haare, Mama?«
»Du darfst mein Diadem tragen.«
»Sonst nichts?«
»Laß den König deine vollen Haare bewundern.«
»O Mama!«
Noch bevor die Sonne den Zenit erreichte, erschien die Jagdgesellschaft fröhlich lärmend, und es gab einiges zu erzählen. Man hatte dem König sogar einen kapitalen Hirsch vor seine Armbrust treiben können. Mit einem sicheren Schuß hatte er getroffen, aber der Hirsch war noch nicht tot, und bevor die Hunde ihn zerrissen, gab ihm Jean Maynier mit seinem Bogen den Fangschuß.
Der König war von der sicheren Hand und der ruhigen Kraft seines Begleiters begeistert. Auf dem Rückweg ritt er neben dem Baron, verglich die beiden Rappen, fand seinen zwar gehorsamer und schneller, lobte aber den edlen Kopf des anderen.
»Für den hast du sicher einiges bezahlen müssen.«
»Sire, einer der ketzerischen Waldenser hat ihn mir mitsamt Haus und Land überlassen, als er sich Hals über Kopf dem Arm des Gesetzes entzog.«
Der König lachte und schaute Jean Maynier prüfend von der Seite an. »Überlassen. Ich verstehe. Du sorgst für Ordnung bei deinem Landvolk.«
»Der reine Glauben unserer Mutter Kirche ist mir ein Anliegen, Sire. Hier im Luberon gibt es zu viele Anhänger des Petrus Waldus aus Lyon. Sie stiften Unfrieden, sie glauben nicht an die Lehren der Heiligen Kirche, sie stellen sogar die Autorität des Heiligen Vaters in Frage.«
»Na, solange sie arbeiten, Steuern zahlen und nicht öffentlich zur Ketzerei aufrufen ... Und was den Heiligen Vater angeht ... Wie dem auch sei, mir haben sie zugejubelt.«
»Sie sind scheinheilig und verlogen. Sie treffen sich heimlich, und während ihrer Messen huldigen sie teuflischer Magie.«
Der König machte eine ungeduldige Geste. »Von den Waldensern hat mir der Seneschall der Provence schon erzählt. Nicht nur Schlechtes. Im übrigen: Warum bist du eigentlich nicht mit mir nach Italien gezogen? Statt dir so viele Gedanken um ketzerische Umtriebe zu machen, hättest du deine Kraft im Kampf um Mailand einsetzen können.«
»Eine Verletzung«, murmelte Jean Maynier mit gesenktem Kopf, »eine Jagdverletzung.«
»Hast du häretische Bauern gejagt?«
Jean Maynier warf ihm mit zusammengekniffenen Augen einen kurzen Blick zu, richtete sich wieder auf und schwieg.
»War nur ein Scherz. Wie vertreibst du dir sonst die Zeit?«
»Ich studiere in Aix die Rechte.«
»Wie Cousin Louis«, warf Raymond ein, der hinter den beiden ritt.
»Der König von Frankreich braucht auf allen Gebieten loyale Diener«, sagte François.
»Ich werde Euch stets zu Diensten sein, Sire!«
Raymond hatte Madeleine alle Einzelheiten berichten müssen, auch die Unterhaltung zwischen dem König und Jean Maynier. Kaum saßen sie im Rittersaal und nahmen einen Imbiß. Noch verschwitzt, Staub und Piniennadeln in Kleidung und Haar, wandte sich ihm der König erneut zu.
»Und deine Eltern haben sich zum Empfang des Königs nicht nach Lourmarin begeben?«
»Sie leben beide nicht mehr, Sire, die Pest hat sie hinweggerafft.«
»Ach, die Pest! Warum der Allmächtige uns nur mit all den Krankheiten geschlagen hat und uns immer wieder neue schickt, als hätten wir nicht schon an Gicht, Krätze und Schlagfluß genug.«
»Er will die Menschen prüfen.« Jean Mayniers Stimme hatte einen scharfen Unterton angenommen. »Man muß sich ihm fügen.«
François kratzte sich nachdenklich, schien sich dann von einem unangenehmen Gedanken wegzureißen und gab Jean Maynier einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter: »Ja, Gottes unerforschlicher Ratschluß ...« Dann rief er nach einem Wein für die beiden treffsicheren Schützen.
Madeleine setzte sich an den Tisch. Dem König sah man nicht an, daß er nur eine kurze Nacht hinter sich hatte, daß auch er gestern abend nicht mehr ganz nüchtern gewesen war. Raymond hatte Ringe unter den Augen und war blaß, Louis wirkte trotz des überdimensionalen Federbuschs auf seinem Kopf noch schmaler, trank Wasser und schwieg. Der Vater hatte sich verzogen. Marguerite, die Herzogin, hatte gefragt, ob sie nicht ein wenig Schlagball spielen könnten, aber da Madeleine weder einen Schläger besaß noch in der Lage war, einen Ball zu treffen, hatte sie sich den älteren Damen angeschlossen, die zu einem Spaziergang durch die Olivenhaine aufgebrochen waren und schließlich den Taubenturm besichtigten. Duprat saß mit Pater Julius zusammen, langweilte sich aber offensichtlich, denn seine Augen wurden immer schwerer, und er nickte ein.
Auch die Garde des Königs hatte es sich bequem gemacht. Die Soldaten saßen vor den Kaminen, würfelten oder spielten Mühle oder Trictrac. Manche schnarchten, andere suchten nach Läusen oder knackten Flöhe. Aus der Küche hörte man Grölen und Gekicher, Gurren und Prahlen. Es wurde schon wieder kräftig getrunken, manchmal kreischte eins der Mädchen auf, krachendes Gelächter folgte.
Madeleine konnte noch immer nicht fassen, daß vor ihr der König von Frankreich saß, daß dieser junge Mann, der kaum älter war als sie und so unbekümmert wirkte, gerade eine blutige Schlacht geschlagen hatte und beinahe getötet worden wäre. Er hätte ein Bruder sein können, wie Raymond, er scherzte und witzelte und sprach dann wieder ganz ernst und neugierig mit Jean Maynier. Gestern hatte er Madeleine sogar um die Hüfte gefaßt und später mit ihr tanzen wollen, aber sie war nur gestolpert, hatte keine Figur mehr gewußt, die Herzogin hatte ihr vortanzen müssen, und der König hatte sie in die Seite gezwickt.
»Bis es dunkel wird, können wir noch kurz die Lanzen kreuzen«, rief er in die Runde. »Ich muß in Übung bleiben. Wer wagt es?«
Louis verkroch sich unter seinem verwegenen Federbusch.
»Wenn Ihr milde mit mir verfahrt, Sire«, sagte Raymond und wischte sich über die Stirn, »dann werde ich es wagen.«
Jean Maynier schwieg.
Der König sah ihn auffordernd an.
Jean Maynier schwieg noch immer.
Der König kniff seine Augen zusammen und zog die Mundwinkel erstaunt nach unten.
»Ich habe weder Harnisch noch Lanze mitgebracht. Und Oppède liegt einen halben Tagesritt von hier entfernt.«
»Raymond leiht dir seine Rüstung.«
»Er paßt nicht in sie hinein.«
Der König schien nun seine gute Laune verlieren zu wollen, aber dann fiel ihm plötzlich etwas ein. »Das Geschenk des Papstes! Der Heilige Vater hat mir in Bologna einen wunderschönen Harnisch geschenkt. Er stammt von einem breitbrüstigen Krieger und wird dir passen.«
Jean Maynier richtete sich auf.
»Es heißt, Cesare Borgia, des Sohn von Papst Alexander, habe ihn getragen.«
»Ich werde antreten, Sire.« Jean Maynier war aufgestanden, seine rechte Hand zur Faust geballt.
»Na also.«
»Aber es ist ein Prunkharnisch, Sire«, warf Raymond ein, »zu kostbar und außerdem gefährlich, die Lanze kann sich festhaken ...«
François winkte ab. »Es ist doch nur ein Turnier, ich werde ihn schon nicht töten.« Sein Blick glitt nun über Louis, ein spöttisches Lächeln auf den Lippen. »Stellt den Trennzaun auf und vergeßt nicht, genügend Sand hinzuschütten, so ein Sturz läßt ordentlich die Knochen krachen. Und beeilt euch, die Sonne geht bald unter.«
Es setzte hektische Betriebsamkeit ein. Das Turnierfeld mußte gerichtet, die Kämpfer umgekleidet und in ihre Rüstungen gesteckt werden. In der Tat paßte Jean Maynier in den Harnisch. Er sah darin majestätisch wie ein Bruder des Königs aus.
Die Damen waren inzwischen wieder von ihrem Spaziergang zurückgekehrt, und alle, auch die Soldaten, versammelten sich um den Turnierplatz. Es wurden schon Wetten abgeschlossen. Pater Julius betete, Duprat ließ sich einen Stuhl holen, auf den er mit seinem dicken Bauch keuchend niedersank. Bevor dem König der Brustpanzer angesetzt wurde, riß er sich das Medaillon vom Hals und warf es Madeleine zu. Er deutete eine Verbeugung an: »Darf ich für Euch den Strauß ausfechten, gnädiges Fräulein?«
Sie nickte aufgeregt und drückte das Medaillon an ihre Brust.
Jean Maynier wurde schon auf sein Pferd gehievt, nahm die Lanze und ritt ein paar Runden um den Turnierplatz. Der König folgte ihm. Dann stellten sich die beiden Ritter auf, Raymond gab das Startzeichen, und die Pferde galoppierten los. Jean Maynier hatte sich kurz zur Seite gedreht, so daß die Lanze des Königs ihn nicht traf, er selbst aber auch nicht mehr genau zielen konnte und den König nur am Oberschenkel berührte. Damit sie sich nicht verhakten oder zersplitterten, hatten sie die Lanzen fallengelassen und ließen sie sich jetzt erneut reichen. Die Gardesoldaten feuerten ihren König an. Sein Pferd wurde zunehmend nervöser: es drehte sich um die eigene Achse, und als der König am Zügel riß, stieg es hoch und hätte ihn beinahe abgeworfen. Auf der anderen Seite der Turnierbahn wartete Jean Maynier geduldig. Er hatte sein Visier aufgeklappt und hielt die Lanze nach oben. Die Zuschauer schauten sich fragend an.
»Oppède schlägt sich beachtlich«, sagte die Großmutter, »in Borgias Harnisch – wenn das kein Omen ist.«
»Unser Sohn wirkt nervös«, bemerkte die Königmutter. Ihre Tochter nickte.
Raymond wandte sich ihnen zu. »Im Prunkharnisch zu kämpfen ist sehr gefährlich. Das Eisen ist dünner, und die vielen Verzierungen lassen die Lanze nicht abgleiten. Wenn der König seinen Gegner ungünstig trifft, kann er ihn töten. Eigentlich ist ein solcher Kampf gegen die Regeln.«
François klappte nun ebenfalls sein Visier hoch. Er gab dem Pferd die Sporen und ließ es eine Runde um den Turnierplatz galoppieren. Nun zitterten zwar seine Flanken, aber es stand.