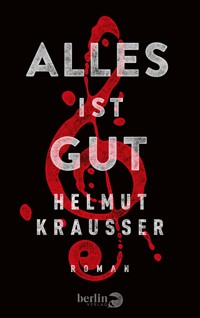15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Jahreszeiten und vier Himmelsrichtungen gibt es. Vier Reisen hat Helmut Krausser unternommen. In alle Winkel Deutschlands ist er gereist. Mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit dem Taxi und zu Fuß. Helmut Krausser charakterisiert Städte aufmerksamer und sensibler als andere Autoren ihre Romanfiguren. Er ist ein scharfsinniger Beobachter unserer Gegenwart, knallhart zu sich selbst und zu allen, die ihm über den Weg laufen. Ergänzt um die Poetikvorlesungen ›Pathos und Präzision‹, die der Autor an der LMU München hielt, werden die Reiseberichte und Tagebuchaufzeichnungen so zum intimsten Einblick in sein Werk. »Es ist seltsam, in ein Alter gekommen zu sein, da man die meisten Städte, die man bereist, mit Siegen oder Niederlagen in Verbindung bringen kann. Die Landkarte wird historisch, wird zum Schlachtfeld.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Helmut Krausser
DEUTSCHLANDREISEN
eBook 2014
© 2014 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagabbildung: © Stephan Balkenhol
und Johnen Galerie, Berlin; Foto: Gunter Lepkowski
Satz: Fagott, Ffm
ISBN eBook: 978-3-8321-8780-4
www.dumont-buchverlag.de
Stephan Balkenhol gewidmet
in Freundschaft und Dankbarkeit
SOMMERREISE 2006
Berlin–München
Seit gestern lebe ich in der siebten Septime. Jetzt also der Abschnitt von 42 bis 48, die Jahre, in denen der römische Mann politikfähig wurde. Reif.
Bei jeder Fahrt nach Tegel treibt mir das baldige Ende des Flughafens Tempelhof Tränen in die Augen. Hochziehen und runterschlucken. Geht bei Tränen nicht? Bei imaginären schon. Fliegen zum Taxipreis. Seltsamer Slogan. Was würde ein Taxi von Berlin nach Athen wohl kosten? Jedenfalls mehr als 29 Euro. Berlin, Athen, auf Wiedersehn.
Was ist an München schön? Einige Freunde, die dort noch wohnen, die Buch- und Weinhandlung Dichtung und Wahrheit und natürlich ein Steckerlfisch im Hirschgarten. Warum brät in Berlin niemand Steckerlfisch? Könnte man gut Geld mit machen. Zweihundertdreißig Seen ringsum. Grillkohle gibts auch zu kaufen. Rendite müßte ganz stattlich sein. München. Diese überzuckerte Stadt. Immerhin ist Peter Jonas endlich weg. Im Flieger sitzen, nebst vielen anderen, der Schauspieler Herbert Knaup und die Literaturpreisempfängerin Herta Müller.
Seit vielen Jahren der erste schröderfreie Sommer – aber auch der erste ohne Gernhardt. Letzterer hat nie den Büchnerpreis bekommen. Daß es ernsthaft Menschen gibt, die glauben, in fünfzig Jahren würde man noch was von (hier die Namen etlicher Büchnerpreisträger einsetzen) lesen, das macht diesen Planeten so schillernd einzigartig im Kosmos.
Stieg vorhin in die U-Bahn, raus trat eben ein älterer Mann, er wandte sich zu drei fünfzehnjährigen Girlies um und rief: »Wie soll man denn da ein Gedicht vortragen, wenn ihr andauernd gakkert!« Das hat mich sehr gerührt. Die pinkigen Girlies eher nicht, die kippten halb von den Sitzen und johlten. Gedanke, daß Mädchen vielleicht gnadenlos überschätzt werden. Gäb es kein Testosteron, Mädchen würden kaum wahrgenommen werden, außer als Belästigung.
Schwere Gewitter über München. Vom Flugzeug aus wunderbar zu beobachten, die Ränder des Sturms sind messerscharf gezogen.
Schnell Mails checken gehen im EasyInternet gegenüber vom Hauptbahnhof. Ich tippe lang erwartete Antworten und hinter mir stehen zwei Männer, unterhalten sich laut, sehen mir über die Schulter. Kann ich nicht ab. Drehe mich um. Ob die beiden bitte einen dezenten Mindestabstand halten möchten? Der eine nickt und dreht ab, der andere geifert mich an.
»Du Scheiß-Rassist!«
»Wie bitte?«
»Du kann dir vorstellen, wie ist, jeden Tag! Jeden Tag!«
Der Mann, vom Teint vielleicht ein Perser, haut mir mit der Handfläche ins Schulterblatt. Geht ja gut los.
»Scheiß- Rassist!« schreit er. »Komm mit raus, du Sau! Jeden Tag! Jeden Tag das!«
Er wirkt wirklich zornig, scheint den Tränen nahe. Irgendwie unverdient, wenn man das so sagen kann.
»Ich will keinen Streit mit Ihnen«, sage ich, »lassen Sie mich einfach hier meine Mails tippen.«
Das ist natürlich der völlig falsche Ton. Ich hätte aufstehen, vor ihm niederknien und seine Hand küssen müssen, um Verzeihung bitten müssen, daß ich ihn mit dem Hinweis auf landesübliche Sitten belästigt habe. Er ist sauer, richtig sauer. Gleich zieht er ein Messer. Er weint. Allen Ernstes. Tausende rassistische Übergriffe müssen sein Hirn mürbe gemacht haben. Er geht einfach nicht weg. Er ballt die Fäuste, reißt sich letzte verbliebene Haare aus, stampft auf und ab. Brüllt mich an.
»Jeden Tag! Jeden Tag!«
Er erinnert mich an den cholerischen Perser aus L. A. Crash, dabei ist er vielleicht Armenier oder aus dem Irak, was weiß ich. Er stürmt aus der Tür, ich atme auf. Er stürmt gleich wieder zur Tür herein, fuchtelt mit den Fäusten. Was ist da zu tun? Es paßt mir nicht, aufzustehen und zu gehen, aber sitzen zu bleiben und weiter lang erwartete Antworten zu tippen, dazu bin ich nicht cool genug. Ein wenig zu furchtsam, vielleicht. Wie gerne würde ich dem Irren sagen, hör mal, es ist mir egal, woher du kommst, wohin du gehst, aber du scheinst mir ein selbstgerechter Versager zu sein, der bei anderen die Schuld findet, die er bei sich selbst suchen sollte. Das geht nun leider nicht, schon wegen des Messers, das der Kerl vielleicht doch bei sich haben könnte. Also verlasse ich den Laden, räume das Feld.
Genügt leider auch nicht, das Arschloch läuft mir hinterher, will sich auf dem Gehsteig mit mir prügeln. Kann ich mir nicht leisten. Will ich nicht. Habe mich mit 19 zum letzten Mal geprügelt, und wenn die Polizei kommt, behauptet der Irre am Ende, ich hätte ihn einen »Scheiß-Kanaken« genannt. Wie steht man da? Also laufe ich los, ab in die U-Bahn, Rolltreppe runter, von meiner Flucht beschämt, nun ist es an mir, vor Zorn beinahe zu platzen, nun kann ich die Gefühle dieses Menschen einigermaßen nachvollziehen, ja. Alles ist ja für irgendwas gut. Wenn man darüber schreiben kann, ist es gut. Viele können das nicht. Welch angestautes Leben müssen jene führen? Kaum vorstellbar. Dem Perser sollte ich vielleicht ein paar Orte in Brandenburg nennen, wo er seine Opferkarriere zum krönenden Abschluß bringen kann. Gut, das ist böse formuliert, aber schließlich bin ich sauer.
Steckerlfisch, endlich. Und eine Radlermaß. Hier bin ich wieder. Unter Freunden. Im Hirschgarten, einem Wohnzimmer meiner Kindheit. Die Gewitterwolken verziehen sich. Ein hübscher, gemütlicher Nachmittag. München, meine Stadt, immer noch. An der Schießbude lege ich die neun Walzen mit drei Schüssen um, das ist mir, glaube ich, nie zuvor geglückt und hat mir einen häßlichen kleinen Stoff-Frosch eingebracht. Die Alternative wäre ein Deutschland-Wimpel gewesen.
Später mit den Freunden auf Zentrumstour. Wir kehren ein im Spatenhaus gegenüber dem Nationaltheater. Ich liebe diesen großen, weiten, herrlich illuminierten Platz, links von mir die Bayerische Akademie der korrupten Künste, rechts die alte Post, die man im Falle einer Revolution als erstes zu besetzen hatte. Was wird in der Oper heute denn gegeben? Königskinder von Humperdinck. Nichts gegen Humperdinck grundsätzlich. Aber seine Königskinder sind einfach nur dröger Mist. Daß Peter Jonas so was seine Lieblingsoper nennt, sagt schon alles. So viele kleine Geschichten fallen mir ein, hier und da und dort erlebt. Es gibt eine innere Haut, die behält jede Schlange subkutan für sich, so oft sie sich auch schält.
Am Nebentisch sitzen fünf Asiaten, die ein Stückchen Emmentaler in fünf winzige Würfel schneiden und diese dann, unter langem Zögern, Drehen und Wenden, verzehren. Ungefähr wie Kugelfisch-Essen für uns.
Augsburg
Soll heute auf der sechsten Radionacht des BR zehn Minuten Lyrik lesen, die irgendwas mit Brecht zu tun hat. All meine Lyrik hat irgendwie mit Brecht zu tun, zum Glück. Ich hasse es, zehn Minuten Lyrik zu lesen.
Eine Stunde, gut, von mir aus auch zwei. Zehn Minuten dagegen – furchtbar. Ich bin von 20:34 bis 20:44 dran. Immerhin, die Kohle stimmt. Plus Übernachtung im Steigenberger. Im Erdgeschoß des Filmpalastes ist für die Mitwirkenden ein Buffet aufgebaut. Nennen wir’s das »Wurst-Käs-Szenario«. Nein, das stimmt nicht ganz, im Kühlschrank gibt es abgepackte Sülze, die ist ungewöhnlich – und versöhnlich schmackhaft. Vorher langer Spaziergang durch diese Stadt, die mit »au« losgeht und mit »urg« aufhört. Brecht konnte sich ein idealeres Sprungbrett nicht wünschen. Die Stadt in Deutschland mit den meisten Feiertagen. Nur – was fragt ein Freiberufler nach Feiertagen? Verlust an Einkaufsmöglichkeiten. Der Bürgermeister empfängt uns Kulturschaffende im goldenen Saal des Rathauses, fuggerische Pracht, die ich mit meiner Wegwerfkamera einzufangen suche, ein ironischer Akt, den niemand versteht, nicht mal ich selbst.
Landsberg/Ulm
Landsberg, schönste Stadt Deutschlands, das heimliche Heidelberg Bayerns. Soviel Idylle war sonst selten wo. Ich plantsche mit den Füßen im Lech, finde zwischen den Zehen uralte Patronenhülsen voller Sand und taumle durch die hängenden Gärten. Schade, daß ich hier niemanden kenne, mit dem das gemeinsam zu genießen wäre. Kaufe an der Tankstelle kühle, abgeflaschte Weinschorle und beneide jedes zweite Häuschen.
Fahre, von Pracht halb erschlagen, am Abend weiter nach Ulm. Dort wohne ich in einem sehr alten, schmalen Haus, inzwischen Hotel, die Mauern stammen aus dem 15. Jahrhundert und liegen hinter Glas. Sie zu berühren, ist verboten, sagt ein Schild. Ist gar nicht möglich, sagt die Physik. Der Fußboden ist schräg, die Zimmerdecke schief. Das Fischerviertel – ein anachronistischer Schaumtraum mit überaus glücklichen Trauerweiden, eine Zeitmaschine, die jederzeit zuschlagen und mich drei Jahrhunderte zurückkatapultieren könnte. Ich laufe, der Gefahr bewußt und um mich davon zu erholen, dreimal um das düstere Monstermünster herum, der Schneider von Ulm war eine erste Lieblingserzählung, viel Kindheit kehrt wieder, als seien die sechziger Jahre nie wirklich vergangen. Gegen die Illusion hilft eine doppelte Dosis Fußgängerzone. Was macht man hier? Man ulmt. Ist das ein Gegen-was-Anulmen oder mehr ein Vor-sich-Hinulmen? Eher ein unpersönliches, großes und gleichgültiges Urulmen, das uns alle zermahlt und zerreibt. Ulm weiß über mich Bescheid. Ulm.
Ich sei einfach eine gute Woche zu früh da, meint die Barkeeperin. Warum ich nicht am Schwörmontag gekommen sei? Am was? Am Schwörmontag, das sei hier der oberste Feiertag. Da gebe es das Fischerstechen, die Lichterserenade, das Nabada und das Hockete. Aha.
Der Schwörmontag ist ein traditioneller Ulmer Feiertag, der jedes Jahr am vorletzten Montag im Juli begangen wird. Nabada – schwäbisch für »Hinunterschwimmen« – ist der Abschluß des Schwörwochenendes in Ulm. Ab 16 Uhr befinden sich Hunderte Nabader im Wasser der Donau, um auf selbstgebastelten und sonstigen Fahrgeräten den Fluß hinabzutreiben und sich gegenseitig naßzuspritzen. Das Publikum skandiert zur Anfeuerung den Schlachtruf »Ulmer Spatza, Wasserratza, hoi, hoi, hoi!«. Die Lichterserenade, eine Lichterschau zu Wasser, ist die Einleitung des Schwörwochenendes in Ulm. Dabei werden bei Anbruch der Dunkelheit von den Ordinarischiffen, sogenannte »Ulmer Schachteln«, mehrere tausend Teelichter auf das Wasser gesetzt. Im Anschluß gibt es noch ein Feuerwerk.
Die sogenannte »Hockete« (= gemütliches Beisammensitzen) findet als Schwörmontagsausklang unter freiem Himmel in der Ulmer Friedrichsau statt. Bei vielerlei Musikrichtungen, Speisen und Getränken läßt es sich in einem der zahlreichen Biergärten bis spät in die Nacht hinein aushalten. All das also bald.
Stuttgart
Sagen wir’s mal so. Nichts gegen Stuttgart, an sich keine schlechte Stadt, aber: Ich stehe jüngst an der U-Bahn-Station Gneisenaustraße, kommt so ’ne Art blonder Zottelossischlacks, Typus tiefste Uckermark, auf mich zu und fragt:
»Sagen Sie mal – wo gibt’s denn hier Taxis?«
»Da vorne.«
»Vielleicht können ja auch Sie mir helfen – hier soll es einen Swingerclub geben …«
»Ja, der ist auch da vorne.«
»Haben Sie von dem die Telefonnummer?«
»Nö.«
»Scheiße!«
Uckermarkzottel schüttelt erbost den Kopf und geht ab.
So was erlebt man halt nicht in Stuttgart.
Hier wollte ich mich mit Dr.Schickling treffen, dem spezialisiertesten Puccini-Experten weltweit, aber er verbringt den Sommer in seiner Datsche am Lago Maggiore. Unser beider Forschung stagniert, der Schlüssel zum letzten großen Geheimnis Puccinis, ein Protokoll mit Notizen zweier von ihm beschäftigter Detektive, liegt, nur in Auszügen bekannt, im Tresor der Bibliothek einer gewissen Stadt, kann uns nicht ausgehändigt werden, weil es formal noch nicht der Bibliothek gehört. Weil das italienische Kultusministerium das Geld zum Ankauf einfach nicht überweist. Wir haben beinahe alle Teile des Puzzles zusammen, das letzte aber verweigert uns ein Bürokrat. Wenige Zentimeter Tresorstahl trennen uns von der Wahrheit.
Weil es für die Identität von Corinna, Puccinis Geliebter von 1900 – 1903, zwei konkurrierende Möglichkeiten gibt, wird dieser Tresor zu einer Art Käfig von Schrödingers Katze – und in meinem Kopf entstehen zwei Romane, je nachdem. In dem Sinne ist die Katze tatsächlich gleichzeitig lebendig und tot. Ansonsten, das hat Daniel Kehlmann neulich sehr überzeugend vertreten, ist es natürlich immer die Katze, die die Messung vornimmt.
Weltweit aber sterben täglich glühende Puccinianer, die gerne noch gewußt hätten, wer jene sagenhafte Corinna denn nun gewesen ist. Untragbar. Immerhin haben wir in Sachen Doria Manfredi, seiner Kammerzofe, die Selbstmord beging, endlich erfahren, was da Sache war und was nicht.
Mannheim
Auch, in Teilen, schön, wenngleich etwas goldrußmorbid eingefaßt. Hier wird weithin unterschätztes Bier ein- und ausgeschenkt, das Eichbaum. Und ich werde immer etwas wehmütig in Mannheim, hier hatten wir, hatte meine Band Genie und Handwerk ihren vorletzten Auftritt, 1987, im Club Old Vienna, der, glaub ich, nicht mehr existiert. Und es gab damals keine versöhnlich stimmende Sülze im Kühlschrank. Alles sagte: Ende Musik, Ernst des Lebens beginnt. Prosa (also Geld) machen, nicht Musik.
Weitergehen, bitte prosaisch weitergehn. Gehorcht hab ich. Später wurde hier, 1998, am Nationaltheater, Moritz Eggerts und meine zweite Oper Wir sind daheim uraufgeführt, leider war sie nicht so gut wie Helle Nächte. Es ist seltsam, in ein Alter gekommen zu sein, da man die meisten Städte, die man bereist, mit Siegen oder Niederlagen in Verbindung bringen kann. Die Landkarte wird historisch, wird zum Schlachtfeld.
Heidelberg
Das unheimliche Landsberg Baden-Württembergs. Hier ist gar nichts schön, außer den Touristen. Was tue ich hier nur? Ich kaufe, Vorsatz ist es gewesen, Heidelberger Heidelbeeren. Sie halten nicht, was sie nicht versprochen haben, das ist konsequent. Die Häuser behandeln mich ausgesprochen feindlich, stehen herum und sehen nach oben. Einmal, beim Stückemarkt, wurde hier Dienstag vorgelesen, atemberaubend schlecht. Warum eigentlich kann fast kein Schauspieler gut vom Blatt vortragen? Wäre eine Untersuchung wert. Heidelberg ist Disneyland ohne Mickey Mouse. Man kann es mögen, Venedig mag man ja auch, trotz allem. Mit der richtigen Braut wird man überall glücklich. Der Genius Loci existiert überall, manchmal ist er aufdringlich vorhanden, manchmal bedarf er eines Köders, der ihn hervorlockt.
Ich hocke vor der Universität, esse Eis, der einzige Platz, der nicht von einer unsichtbaren Glasglocke behütet scheint. Ein Leierkastenmännchen (Barcarole, Offenbach) wimmert in gebrochenem Deutsch um Spenden.
»Woher kommst du?«
»Aus Ukraine. Bitte.«
Ich gebe ihm zwei Euro, er soll dafür zehn Minuten Pause machen. Es beschämt mich, daß er auf so ein mieses Geschäft bereitwillig eingeht. Eine Beleidigung hinnimmt. Die Ruhe ist und bleibt erkauft. Tut mir leid. Quietsch weiter, armer Ukrainer, ich will mich bessern.
Abendessen in einem genuin kemenatenähnlich-romantischen Wirtshaus, zur Komplettierung der Idylle fehlt nur das verrauchte Hinterzimmer, in dem sich schlagende Studenten besoffen ihre Fressen mit Schmissen verzieren.
Zum wie gewünscht blutigen Roastbeef wird ein Hügel aus Bratkartoffeln gereicht, ich esse tapfer, aber nicht mehr um jeden Preis, wie früher. Sehe ein, wenn das Gefecht verloren ist. Die Garde lebt und ergibt sich. »Lieber den Magen verrenkt, als dem Wirt was geschenkt« – der eklige Kampfspruch Chiemgauer Bauernfünfer, bevor sie nach Mitternacht in ihre Maßkrüge kotzen.
Nachts auf 3sat ein sehr informativer und berührender Dokumentarfilm über Jörg Fauser, mit Franz Dobler, den ich eben noch in Augsburg getroffen habe, nach langen Jahren wieder. Meine einzige Begegnung mit Fauser, am 8. Mai 1984, war ebenso wortkarg wie magisch. Es gab nur zwei Dialogzeilen. Wir saßen an einer Bar. Er hielt mir seine Schachtel hin. »Zigarette?« – »Danke, hab selber.« Nein, leider falsch, nach seiner Lesung haben wir noch jeweils einen Satz miteinander gewechselt. »Signieren Sie auch Ihre früheren Bücher?« Ich hielt ihm das zerfledderte Exemplar von Alles wird gut hin. »Selbstverständlich.« Im Film erzählt seine Frau Gabriele, daß sie nie Angst um ihn hatte während seiner nächtlichen Sauftouren. »Ich bin ein erfahrener Trinker, keine Sorge, ich komme immer nach Hause«, habe er zu ihr gesagt. Dann kam der Lastwagen, um 4:10 Uhr morgens auf der Autobahn, und schleifte ihn mit, den Dichter, den überfahrenen.
Ich bin im herkömmlichen Sinn nicht religiös, aber ein imaginäres Szenario gibt es und reizt mich so sehr, daß ich mir manchmal wünsche, es gäbe da ein posthumes Nachspiel. Dies ist der Moment der Auferstehung, des individuellen Gerichts, der Augenblick, da man vor Gott gerufen und von ihm beurteilt, liebevoll aufgenommen – oder für immer verstoßen wird. Das wäre solch ein bewegender, feierlicher Höhepunkt der Existenz, ein finales Tribunal von ungeheurer, allem Geschehenen Sinn verleihender Tragweite, begleitet vielleicht von unbeschreiblicher Zeremonialmusik, mit einem kurzen Blick hinter die Ewigkeit verbunden, in seinen Konsequenzen gar nicht vorstellbar, weil man sich weder in Himmel noch Hölle sinnvoll und ohne Kitschkulisse wiederfände. Aber die Sekunde, da man vor einen Schöpfer träte, wenn alles, was man getan oder unterlassen hat, einer Prüfung unterzogen würde, diese Sekunde wäre so sakral und komprimiert, daß man sie zumindest als Motiv der Kunst installieren müßte, als Droge der Vorstellungskraft, als Kulminationspunkt der Sehnsucht, und sei’s nur, damit bald ein Komponist uns diese Musik annähernd erfindet, die uns am Ende doch mehr interessiert als das rasierte Antlitz Gottes oder der Grenzverlauf der Unendlichkeit.
Wenn ein Künstler die Religion benötigt, um seine Kunst zu optimieren, bin ich der Letzte, der ihm Vorwürfe macht. Jedes Hilfsmittel ist erlaubt, wenn das Ergebnis überzeugt.
Es gibt im Soundtrack des Films Hannibal ein Musikstück, Vide Cor Meum, das mir jenes Szenario zumindest nahegelegt hat, auch wenn der Text von Petrarca auf etwas ganz anderes, viel Irdischeres, zielt. Manchmal würdigt ein Text die dazu komponierte Musik herab, sperrt sie ein. Ich dachte, im Kino sitzend, der Text wolle sagen: Sieh dir mein Herz an, Gott, der du darüber richten wirst. Sieh es dir ganz genau an. Mein doch nur halbgraues Herz.
Die alten Meister zu ehren, bedeutet vor allem, sie immer wieder einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Wenn Thielemann beispielsweise behauptet, der Parsifal sei über alle Kritik erhaben, dann muß man sich eben wieder wie ein zwanzigjähriger Revoluzzer hinstellen und laut sagen: Nein, das stimmt nicht, der zweite Akt ist routiniertes Kunsthandwerk, aus der Feder eines Siebzigjährigen kann keine erotische Musik entstehen, die nicht mit jeder zweiten Note nach Viagra ruft. Die Blumenmädchen kannst du vielleicht noch vögeln, komponieren aber nicht.
Freiburg
Hier war ich noch nie, auch sonst hatte die Stadt mit meinen kleinen Kriegen nichts zu tun, nicht mal eine Lesung habe ich je hier gehabt. Was heftig gegen Freiburg spricht, an sich, ein Ort, der anscheinend keine Meinung zu mir hat. Dem ich schnurzwurscht bin. Eine unvoreingenommene Festung, kann man sagen, wenn man so möchte.
Im großen und ganzen ist Freiburg wie Barcelona, besonders die Erzdiözese, und oben im Schloßbergbiergarten bietet ein Klein-Andechs die Aussicht auf Münster und Bächle hie und das Foltermuseum, auch hie. In letzterem gibt es unter vielen kaltlassenden Replikaten einen eiskalt berührenden originalen Florentiner Hängekäfig, in dem tatsächlich einst Menschen gestorben und verwest sind.
Eine Freundin erzählte mir, sie habe ihre Angstschübe durch die Therapie stark reduziert, sie kämen jetzt jede Nacht zwischen 3 und 4 Uhr. Immer ganz pünktlich. Wir waren essen und wurden von der Bedienung etwa fünfzehnmal gefragt, ob alles in Ordnung sei. Am Schluß gab ich keine Antwort mehr, wäre beinahe grob geworden vor Zuwendung.
Frankfurt
In Frankfurt gibt es Cola von Pepsi, Afri und Coca. Einige der Flaschen sind sehr kalt, andere in guten Händen. Aber viel gibt es dazu nicht zu sagen. Es müßte einmal zu einem großen Schaukampf kommen zwischen der Berliner Dampfwurst und der Frankfurter Rindswurst aus der Kleinmarkthalle. Wer würde obsiegen zuletzt? Welche Kampftechniken würden Anwendung finden? Frankfurt wird langsam etwas schöner, anders gesagt, die Häßlichkeit gewinnt an Konsequenz. Doch am Ende der Zeil stand eine laute ältere Dame, die ihrem Schäferhund sagte: »Grauselig! Theoderich, wie grauselig ist das geworden!«
Beinahe wäre ich in ein Restaurant gegangen, das mir »Contemporary Colonial Cuisine« versprach. Spezialität: gegrillte scharfe Ochsenbacken mit Korianderpüree. Die beliebteste Vorspeise dort ist Blutwurst Samosa mit Octopus Tandoori. Ging dann doch lieber mit Freunden beim Toskaner essen. Hätte gerne das Gernhardt-Grab aufgesucht, aber das Zeitfenster war zu eng, außerdem – am Grab eines so frisch Verstorbenen zu stehen, selbst wenn ich es sofort gefunden hätte – zuviel für mein empfindsames Gemüt.
Nürnberg
Stadt meiner Ahnen. Vom Hotelzimmer aus sehe ich ins Neue Museum für Kunst und Design. Mein Agent in Sachen Film ruft an, es gebe ein erstes Gebot für eine Option auf Eros. Auf dem Markt betrügt mich ein Obsthändler. Ich kaufe eine weiße Nektarine und zwei weiße Pfirsiche, er berechnet mir dafür 3,39 Euro, was mir zu spät verdächtig erscheint. Die weißen Pfirsiche stellen sich dann als gelbe heraus.
Kurz in St.Lorenz und St.Sebald gewesen, Kirchen sind der einzige Hitzeschild an diesem Tag, das Thermometer erreicht 39 Grad Celsissimus. Es ist so heiß, daß der Lippenstift auf den Lippen der Mädchen schmilzt. Rot tropft das von den Mundwinkeln herab. Oder haben die beiden Girlies eben derb in die Fresse gekriegt?
Das Germanische Nationalmuseum ist heute wegen einer Veranstaltung schon ab 17 Uhr geschlossen. Drinnen seh ich einen Sektempfang. Gehe ins Cinecittà – ein Multiplex mit sechzehn Leinwänden. Nichts läuft, was mich auch nur lauwarm interessieren würde. Das schwächste Filmjahr seit 1906. Bis auf Das Leben der Anderen und United 93 war kaum was da. Im Burger King klagt eine Rentnerin einem Rentner ihre Wehwehchen, der antwortet knapp: »Wir sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Schnauze jetzt.«
Abends im Fernsehen: Stroszek von Werner Herzog. Habe ich zuletzt mit 20 gesehen. Was für eine faszinierende Scheiße. Was man damals noch alles für Kunst gehalten hat, was alles möglich gewesen ist. Diese Freiheit. Bitte, ich muß dazusagen, daß ich Werner Herzog für einen der besten Regisseure aller Zeiten halte. Er hat drei der Top 40 Filme ever gedreht. Aber Stroszek – das ist nur wenig besser als Wim Wenders. Allerdings gibt es hübsche Sätze, zum Beispiel: »Was ist das für ein Land, das dem Bruno seinen Beo beschlagnahmen tut?«
München
Muß aus beruflichen Gründen noch mal nach München. Schade, Trier, wär gern bei dir, aber im Gasteig läuft um 14:30 die Uraufführung des Handy-Krimis von M+M, denen ich das Drehbuch schrieb. Eine mediale Pioniertat, ein interaktiver Krimi, bei dem der Handybesitzer nach und nach Filmsequenzen zugesandt bekommt sowie SMS und MMS, die Handlung wird immer abstruser, aber man kann in einem Archiv Informationen herunterladen, die der Aufklärung des Sachverhalts dienen, wird selbst zum Detektiv. In Echtzeit geht das über zwei Wochen, aber hier wird es in fünfzig Minuten präsentiert, deshalb nerven die langen, immergleichen Einleitungsjingles der Szenen, auch wackeln das Bild und die Tonspur – und schließlich kommt es zum Fiasko – der Computer ist der Hitze nicht gewachsen, kollabiert und Minute 12 bis 20 fallen aus. Weswegen von der Handlung niemand etwas kapiert und am Ende nur sehr höflicher Applaus ertönt. Ich stehle mich konsterniert davon.
Abends in die Pasinger Fabrik, ein Kellertheater, in dem Dienstag, der erste Teil meines Diptychon, gegeben wird. Sehr gute Aufführung mit drei hochklassigen Schauspielern. Eine tolle Elke, sexy, elegant, autoritär, ein facettenreicher Sohn, eine angsterregend glaubhafte Mutter. Das Publikum schien angetan, bis auf eine Frau in meinem Rücken, die dauernd »Jetzt reichts aber« sagte oder »Nein, jetzt ist es zuviel« oder »Das ist ja ekelhaft«.
Danach weiter in die Halle 7, wo um 22:30 als Abschluß eines Festivals mein neuestes Stück, Roy Bar, in einer »Fassung« aufgeführt wird, also keine offizielle Uraufführung, sondern ein Blick in die Schublade, auf noch nicht ganz fertige Stücke jener Autoren, die in den letzten Jahren hier inszeniert wurden. Ich habe Schlimmstes erwartet – nur etwa die Hälfte des Stückes werde gegeben, hatte ich gehört – und konnte mir nicht vorstellen, wie daraus etwas Brauchbares entstehen soll. Entstand aber doch. Etwas ganz Eigenes, nicht wirklich von mir. Großartig, beklemmend intensiv die Szene zwischen Roy und Alice, die gefährlichste Stelle im Stück, weil es vom Absurden abrupt in Beziehungsaufarbeitungsgerede übergeht. Auch hier fabelhafte Darsteller, die ich prompt als Familienangehörige behandeln möchte.
Später im Taxi, nachts um eins, an der Schrannenhalle vorbei, die erleuchtet ist, in der noch Betrieb herrscht. Nachts wirkt sie so überzeugend wie tagsüber sinnlos. Hundertfünfzigtausend Menschen sind heute gestorben, ich nicht. Sollte man sich um Mitternacht regelmäßig sagen.
Habe bei Dichtung und Wahrheit einen teuren Chardonnay gekauft für die Nacht, namens »Kante 2002«. Ich gebe mir den Kante. Ist sein Geld nicht so ganz wert.
Berlin
Muß meine Pläne ändern und aus Gründen unvorhersehbarer Schweißproduktion frische Kleidung holen in Berlin. Schade, Saarbrücken.
Hier passiert immer was Überraschendes. Wegen des Christopher Street Days nimmt der Bus M 41 vom Hauptbahnhof (der protzgeil geworden ist, ja) eine Ausweichroute durch den Tunnel – und ich glaube meinen Augen nicht zu trauen, der Bus – ein öffentlich-rechtlicher, sozusagen, ein Linienbus, der Verantwortung trägt, also eigentlich dessen Fahrer – rast bei Dunkelrot über die Kreuzung. Und neben mir, so zauberhaft, ein bleiches Mädchen, kaum siebzehn – fängt zu singen an: Ein Bus, ein schneller Bus, der kennt kein Rot, der kennt nur Gelb oder Grün zur Melodie von ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt – da herrscht Atemraub und Blutstillstand, und sofort möchte ich mir das Herz aus dem Brustkasten schneiden, es mit einer Widmung versehen, dem Mädchen überreichen, aber von einem, der 42 ist, käme das bestimmt als Aufdringlichkeit – zudem muß ich Rücksicht nehmen, auf alle, denen dieses Herz längst versprochen ist. Wie limitiert ist meine Existenz.
Köln
Köln ist eine häßliche Stadt, eine, bei der man das sagen darf, denn höchstens ein paar Lokalfanatiker werden widersprechen. Alle, die ich hier mal kannte, sind weggezogen. Dabei sind die Menschen in Köln freundlicher als sonstwo in Deutschland, kein Klischee, man muß sich nur mit dem Stadtplan hinstellen und in drei verschiedene Richtungen sehen, schon fragt jemand, ob man Hilfe braucht.
Fahre mit dem Zug nach Bonn, versuche vergeblich, einige Schauspieler aus der Nibelungen-Produktion anzurufen, rufe auch noch mal, vor Ort, den Triumph jener Uraufführung ab. Was für ein Abend. Welcher Jubel. Das beste denkbare Fest.
Hagen
Hier wird am 26. August die Zweitaufführung von Helle Nächte gegeben. Die Uraufführung im Prinzregententheater 1996 litt an der fehlenden Pause, die Inszenierung war Dreck, alle Hits kamen im zweiten Teil, als das Publikum schon müde war, deshalb, und weil die verbiesterten alten Kritiker des stellenweisen Wohlklangs wegen mißtrauisch reagierten, war dem Werk wenig Erfolg beschieden, das könnte nun anders werden, inzwischen ist man der Melodie gegenüber wieder viel aufgeschlossener. Es ist eines der besten Stücke der letzten fünfzig Jahre. Allerdings wird die Oper in einer neuen Fassung gebracht, mit verkleinertem Orchester – kann das eine Verbesserung sein? Das Theater in Hagen steht, die Türen fest geschlossen, vor mir. Die Stadt als solche könnte ein zweites Recklinghausen sein, hätte sie auch Ruhrfestspiele. Immerhin trägt sie einen wunderschönen Namen, den meiner Lieblingsfigur, des Urahns von Darth Vader.
Wuppertal
Hier spielt ein großer Teil von Eros, und ich gehe die Stationen des Romans ab wie einen Kreuzweg. Hier lebte einst eine Frau, die ich wollte, was sich leider mit ihren Plänen nicht vereinbaren ließ. Ihr zu Gedenken besuche ich erneut den verhügelten Tierpark, eine Elefantin damals litt unter einem Abszeß, Eiter floß ihr aus dem rechten Vorderbein, jetzt ist alles gut, die Elefantin gesund und mittelalt, die begehrte Frau wohl auch schon mittelalt und hoffentlich glücklich.
Auch zu Gelsenkirchen könnte ich einiges beitragen, man merkt sich die Orte, vor allem jene, an denen man erfolglos blieb. So lange ist das her. Es ist schon erstaunlich, immer wieder, daß man soviel zurückliegende Zeit rekonstruieren kann und die Menschheit eine Weile lang begleiten darf, danach aber von allen Entwicklungen ausgeschlossen bleiben soll. Religion ist eine Haltung, die in den allermeisten Fällen dieser erlittenen Beleidigung entspringt. Etwas Trotziges, im Kern aufbegehrend und zornig, aus Schmerz entstanden, das muß man konstatieren.
Der bedeutendste musikalische Beitrag zu den Neunzigern – Michael Nymans Songbook – ist nur noch antiquarisch zu erwerben. Da kann man zum Kulturpessimisten werden. I am an unusual thing – die Vertonung eines Mozartbriefes – ist meiner Meinung nach das ergreifendste Kunstlied, das je geschrieben wurde, und die darauffolgende Rimbaud-Vertonung Allez! – On préviendra les reflux d’incendie walzt jede Depression nieder.
Kaum zu glauben, aber als mir vor zwei Jahren Marcel Hartges vorschlug, einen trinken zu gehen, mit den Worten »So jung kommen wir nie wieder zusammen«, fand ich das eine höchst originelle Formulierung, denn ich hatte sie tatsächlich nie zuvor gehört. So etwas gibt es. Phrasen, die sich zeitlebens irgendwie an einem vorbeigeschlichen haben und eigentlich schöne Sätze sind, zu Phrasen erst geworden durch zu oftmaligen Gebrauch, für den sie nichts können. Eine griffige, spritzige Formulierung, in den Volksmund hinein – und aus dem Volksarsch heraus kommt sie als Platitüde gefurzt.
Bremen
Immer noch schweineheiß. Heute beginnt in Bayreuth der Ring, den ich inszenieren müßte, wäre Wolfgang Wagner gescheit und jung. Stattdessen, vor dem Bahnhofsgebäude: Performance einer Gruppe schwarzer Breakdancer – ich komme mir beim Zusehen so alt vor. Das Beleidigendste ist, daß sie hinterher nicht einmal schwitzen. Bea, am Telefon, meint, um mich zu trösten: »Die kommen bestimmt aus sehr heißen Ländern. Die müssen das tun, um nicht zu erfrieren.«
Ich ziehe mich vor der Hitze in die Kaufhäuser zurück. Besorge neue Hemden. Eigentlich kann ich nicht sagen, ich bin in Pirmasens oder Bremen oder Osnabrück, sondern müßte sagen: Ich bin grad im Kaufhof oder Karstadt – das trifft es doch viel genauer.
Abends im Hotelfernsehen bei einer Riesenschüssel Erdbeeren mit Vanilleeis die Nozze di Figaro, schon eine elend lange Oper, kann man keinem Anfänger empfehlen, den man nicht verderben will. Anna Netrebko singt. Sicher einer der besten hundert Soprane unsrer Zeit. Christine Schäfer singt auch. Zum Heiratsanträge-Formulieren.
Lektüre: Woraus wir gemacht sind. Hettche, die Vergänglichkeit entdeckend, zitiert einen alten Römer:
Bedenke, daß du bald alles vergessen haben und daß du selbst vergessen sein wirst.
Dies schrieb ein gewisser Marc Aurel – der bis heute nicht vergessen wurde.
Lüneburg
Die Opern-Rezensenten hierzulande sind alle so elend schlecht. Nur Eleonore Büning kann man fast blindlings trauen, aber die hat, scheint’s, Urlaub. Ich würde den Ring mit Zagrosek machen, nur adäquat bezahlt, versteht sich. Bayreuth müßte um mich buhlen, um mich werben, dann würde was entstehen, Wagner würdig. Sonst halt nicht. Der geilste Ring der Ringe. Den zu machen, wäre Sache des Anstands. Lustige Kalauer – dem greisen Tankred Dorst wirft man für seine erste Opernarbeit Anfängerfehler vor.
Kleinst-Amsterdam ist im September eine der allerschönsten Städte. Jetzt aber denkt jeder in Deutschland an Selbstmord, egal, wo, denn das ist einfach nicht mehr hinzunehmen, ich kann nicht hinausgehen, die Schwüle legt sich wie Blei aufs Schädeldach – ich lege mich in die Badewanne, in 18 Grad kaltes Wasser, versuche zu lesen, aber die Buchstaben schmelzen vor den Augen, schließlich gleitet mir das Buch aus den Händen, ich werde ein neues kaufen müssen. Abends dann gehe ich zur Mühle, stehe auf der Brücke und sehe in den Fluß. In dieser Stadt ging es mir letztes Jahr sehr gut, ich habe Tag und Nacht recherchiert für das Puccini-Projekt und dauernd etwas Neues gefunden, bei der Arbeit in der wunderbaren Wohnung des Literaturhauses mit Blick auf das örtliche Gefängnis. Hier gibt es Gäßchen, in denen man problemlos romantische Stoffe abdrehen könnte, ohne irgendeine Werbungstafel abhängen zu müssen. Viele der Fachwerkhäuschen stehen schief, weil die darunterliegende Saline sich ab und an bläht oder zusammenzieht. Populär ausgedrückt. Fährt man von hier aus in die Heide, kommt man ins spießigste Terrain des Landes, aber Lüneburg ist klasse, von manchen Eigenartigkeiten abgesehen. Zum Beispiel muß man für eine Wochenkarte der Regionalbahn ein Paßfoto beibringen, und im Zug nach und von Hamburg gibt es einen Zugführer, der die Haltestellen nicht ansagt, sondern quasi singt. Lüüüüne – Terz runter – buurch …
Habe mir 300 Gramm Heidschnuckenfleisch gekauft und oben auf dem Kalkberg ein Feuerchen gemacht – klingt waldbrandgefährlicher, als es war. Der ohnehin nicht allzukalte Wein mußte binnen einer halben Stunde getrunken werden, um nicht als Heißgetränk zu gelten. Im MP3-Player die Stimme Wilhelm Grünings, der eine Arie aus Leoncavallos Rolando di Berlino singt, Aufnahme von 1906. Dreck, aber hat etwas, in diesem Umfeld. Mir ist einsam. Ich will nach Hause. Das Heidschnuckenfragment erweist sich als zähes Stück. Auf dem Portable DVD-Player läuft eine Folge (erste Staffel, die fünfte) der Hesselbachs, in der (schon 1960!) ein Triple-Split-Screen vorkommt, während ich das halbrohe Fleisch aus dem winzigen Gewürzwürfel mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Paprika bestreue. Sonderbar, das alles.
Hamburg
Niederschlagswahrscheinlichkeit weiterhin bei null. Diese Stadt ist mir nicht mehr lieb. Die größte, unverdienteste Niederlage meiner Karriere hab ich hier erdulden müssen: Haltestelle. Geister. – am Schauspielhaus gegeben und verrissen, das nagt noch immer an mir. Ein so tolles Stück. Inzwischen ist es halb rehabilitiert, wurde an hundertzwanzig kleineren Bühnen mit viel Erfolg gespielt, nur eine große Bühne traut sich noch nicht wieder dran. Ich kann nicht an Hamburg denken, ohne an dieser Schweinerei zu leiden. Andererseits ist das Spielcasino auf der Reeperbahn das einzige, in dem ich je Gewinn gemacht habe. In der Umgegend werden haufenweise billige Zimmerchen für 20 Euro die Nacht angeboten, eine Offerte, die ich immer mal annehmen wollte. Um Knut Hamsuns Weltumsegler-Trilogie einmal im passenden Ambiente zu lesen. Aber ich habe doch lieber ein Zimmer in St.Georg gemietet, klimatisiert. Wollte eine der vielen zahnlosen St.-Georgs-Nutten dazu bringen, mir bei Kerzenlicht Hamsun vorzulesen. Traue mich jetzt nicht. Erbärmlich. Außerdem – Kerzenlicht, bei dieser Hitze. Früher – das war die Zeit, wo man vieles einfach gemacht hat. Heute – ist die Zeit, wo es genügt, es sich nur auszudenken. Stimmt natürlich – die Idee reicht hin, und dennoch, man kommt sich feig vor, und zu Recht, der realisierte Feldversuch birgt immer etwas nicht Vorhergesehenes. Genau das aber will man sich mit 42 ersparen.
Bin in den Hamburger Schachclub gegangen, habe ein wenig die Blitz-Sucht befriedigt.
Seltsam – würde nicht gerade in Sachen Puccini-Projekt Stagnation herrschen, ein stuporhaftes Warten, bis der Giftschrank in Italien aufgeht, ich wäre überhaupt nicht fähig, diese Deutschlandreise zu unternehmen. Eine Fügung also. Aber ich weiß mit mir dennoch nichts anzufangen. Sollte vielleicht Leute auf der Straße fragen, wie sie sich in Deutschland so fühlen, nach der WM. Solchen Quatsch. Sollte vielleicht sagen, wie mir Deutschland gefällt oder nicht und warum. Ich setze mich den halben Abend mit der Fliege auseinander, der durchgeknallten Headbangerfliege, die aus irgendeinem Grund alle zwei Minuten gegen meinen Kopf fliegt. Warum tut die das? Was hat sie davon? Kann man einer Fliege Bösartigkeit unterstellen? Ist auch diese Fliege Deutschland? Jetzt läuft sie auf dem Bildschirm des Laptops herum. Diese Fliege ist ein Schwein.
Um halb eins geh ich noch mal hinaus. Mein einziges Lebensziel, das ich spontan benennen könnte, wäre der Tod jener Fliege. Was man mit der Jugend eigentlich verloren hat, ist die Fähigkeit, mit Freizeit immer irgendwas anfangen zu können. Man ist einfach losgezogen und hat irgendwas gemacht, dem man heute keine Träne nachweint, das man damals aber klasse fand. Chopin – zweites Klavierkonzert im Handy-Radio, während ich an der Außenalster sitze. Geht. Gleich Akku aus. Habe mir so viel vorgenommen. Jetzt drängen sich Fliegen als allerletzte weiche Ziele in die Wahrnehmung. Wäre ich ein Serienkiller, könnte ich in aller Ruhe meinen Rekord ausbauen. Gleich muß ich ins Hotelzimmer zurück und diese teuflische Fliege töten, die sich so verdammt wichtig macht, wo sie mir doch womöglich gesandt wurde, um mir zu sagen, wie wichtig ich mich mache. Alles, das lebt, macht sich wichtig, viel wichtiger, als es ist. Sogar ohne Wagner wäre die Welt irgendwie weitergegangen.
Lübeck
Nach dem Aufstehen die Fliege getötet und zur Abschreckung an die Fensterscheibe gequetscht. Dann nach Lübeck. Eine schöne Stadt, ich freue mich sehr, das Heiligen-Geist-Hospital wiederzusehen, eines der erstaunlichsten Gebäude, das ich kenne – eine große, sehr hohe Halle, die ab dem 19. Jahrhundert hundert Kranken Obdach bot. Diese lagen in kleinen, dachlosen Häuschen, containerartig aneinandergeschraubt, drei mal einen Meter breit, geschätzt – Puppenstübchen, halb wirken sie beklemmend, halb rührend. Wär eine tolle Kulisse für einen historischen Stoff. Später wurde die Halle zum Altenheim umgewandelt, aus dessen sogenannten »Kabäuschen« erst 1970 die letzten Insassen entlassen wurden, sehr gegen ihren Willen, sagt man. Aber eigentlich bin ich nach Lübeck nur gefahren, um Thomas Mann zu beleidigen. Dieser Kerl hat als einziger amerikanischer Exilant ein Bittschreiben um ein Visum für Brecht nicht unterzeichnet. Weil Brecht ihn, man denke und staune, einen Verfasser bourgeoiser, eitler und unnützer Bücher genannt hat. Nicht alle meine engen Freunde finden Thomas Mann so entsetzlich wie ich, deshalb verzichte ich auf meine im Stillen vorbereitete Beleidigung im großen Stil, um deren Gefühle nicht zu verletzen. Und genaugenommen ist Thomas Mann nicht mehr zu verhindern. Man muß mit ihm leben. Ein guter Grund, um zu sterben.
Lektüre: Keyserling, Schwüle Tage. In Travemünde war ich auch, habe im Meer die vielen Quallen betrachtet. Tiere, die man nicht essen kann, vor denen man sogar Angst haben muß, stellen die Zivilisation in Frage. Am Ufer sangen vier versprengte Russen wehmütige Lieder. Rudimente irgendeines pleite gegangenen Donkosakenchors, Gemälden von Repin entsprungen, vier Sonntagstracht tragende Wolgatreidler, die mir leid tun.
Wismar
Wismar ist eine der allerschönsten Städte Deutschlands. War außerdem das Ziel des Schiffes mit dem Sarg von Nosferatu aus den gleichnamigen Filmen von Murnau und Herzog. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, eine Erzählung zu verfassen: Die Reise des Grafen Orlok vom schwarzen Meer nach Wismar auf der Demeter.
Der zynische Bericht eines mächtigen, lebensmüden Vampirs über die kommende Fertigstellung Europas auf Kosten des alten Adels. Der angebissene Jonathan Harker reitet über Land, während das Schiff seines untoten Auftraggebers umständlich über Sizilien, Gibraltar, an Frankreich und Holland entlang, zur Ostsee segelt. Die Erinnerungen des Grafen Nosferatu. Eine große Erzählung, die beginnt mit den Worten: Die Verträge sind unterschrieben. Gebe ich hiermit frei zur allgemeinen Ausschlachtung. Alles kann ich nicht machen. Deligieren können, wenn die Lebenszeit es befiehlt. Es werde was draus.
Es gibt Werke, bei jedem sind es selbstverständlich andere, die musikalisch gar nicht besonders komplex sind, aber sich lange spreizen, bevor sie sich schließlich in Bottiche voller Ohrwürmer verwandeln. Menottis Il Console ist so ein Beispiel – nichts wünsche ich mir dringender auf die Spielpläne – außer vielleicht Puccinis Letztfassung der Rondine. Eigentlich absurd, daß ein Theater darauf verzichtet, im Jahre 2006 die letzte mögliche Uraufführung einer Puccini-Oper zu realisieren. Gerade im Fall der Rondine oder des Edgar, mit ihren schwachen, diffusen Libretti, könnte das moderne Regietheater sinnvoll sein, indem es von der Vorlage abweicht, den Text quasi ignoriert und, bei Edgar, ins Groteske zielt, bei der Rondine ins Surreale. Le Villi, schlug Alban Herbst neulich vor, könnte man prima mit Mahlers Klagendem Lied kombinieren – beides postmodern als eine Art expressionistisches Grand Guignol aus der Hinterhand aufgemacht – ergäbe einen sättigenden Abend. Prima Idee.
Kaufe mir ein Dorschleberbrötchen und sitze am Kai, neben einem leeren alten Backstein-Fabrikgebäude, warte darauf, daß die Demeter um die Ecke segelt, mit einem ans Lenkrad gefesselten toten Kapitän und Särgen voller Ratten in transsilvanischer Erde.
Wir liegen vorm schönen Wismar und haben die Pest an Bord – gleich drängt sich die Szene persifliert als Musical auf, nichts kann noch ernst genommen werden.
Dorschleber gehört zu den Lebensmitteln, die mir nur schmekken, wenn sie mit der Garantie verkauft werden, eben erst aus dem Meer gefischt und zerlegt worden zu sein. So was kauft man nicht in der Dose. Glaube ich. Das ist natürlich Quatsch, in fast jedem Supermarkt stehen Dorschleberdosen, also kauft die auch jemand. Wann werde ich das je verinnerlichen? Daß diese meine Welt von anderen Menschen mitbenutzt wird, die ich zum größten Teil nie kennenlernen werde.
Einer der besten Popsongs, die je geschrieben wurden: Mad Man Moon. Wo bekomme ich das um diese Uhrzeit her? In Wismar, kurz vor Mitternacht. Ich öffne, obsessiv verzweifelt, das Kompositionsprogramm auf dem Laptop und rekonstruiere die Melodie von Mad Man Moon, singe dazu. Das dauert bis vier Uhr früh und führt mir letztendlich nur die Vergeblichkeit jeglichen Second-Hand-Daseins vor.
Rostock
Die südlichsten Teile Rostocks wirken überraschend idyllisch bis zur Heimeligkeit. Die Temperaturen sind erträglich geworden, die Reise beginnt wieder Spaß zu machen. Ich komme im Bus mit Einheimischen ins Gespräch und frage, wie es sich hier so lebt und ob man den Dresen-Film Die Polizistin gesehen und das Bild, das darin von der Stadt gezeichnet werde, empörend, weil zu einseitig gefunden habe. Rostock sei im Grunde okay, sagen mir zwei Jugendliche, in Dresden seien sie noch nie gewesen, Polizisten seien immer empörend einseitig. Aha. Habe wohl zuviele Nebensätze gebildet.
Abends im Cinestar Rostock Wolf Creek. Großartig. Ein grausamer Horrorfilm, von etlichen Rezensentinnen als grausamer Horrorfilm verrissen, nicht etwa, weil er schlecht wäre, sondern eben: grausam. Betäubend schöne Bilder, realistische Dialoge, unerwartete Wendungen, ein verblüffender, noch nie so dagewesener Schluß, großartig. Da wünscht man sich eine Fortsetzung, in der irgendwo in den Outbacks Australiens gewisse Rezensentinnen Teil der Handlung werden. Besonders grausam: als der Killer dem geliebten Alphamädchen mit dem Messer das Rückenmark durchtrennt und es zum »Kopf am Stiel« erklärt. Unfaßbar erschütternd. Grenzen gesprengt, Tabus überschritten, aber wahrhaftig und avanciert in der Darstellung dessen, was es bedeutet, Menschen das Leben zu nehmen. Verstörend im besten Sinn. Meilenstein des Slasher-Genres. Spott jeder Konvention. Pädagogische Sternstunde. Filmisch ein Juwel, neben dem die Blair Witch albern wirkt, wie ein überkonstruierter Jungenstreich. Apropos realistische Dialoge – es gibt Kritiker, die ebensolche als platt empfinden, die von Kunst Künstlichkeit verlangen. Verrückt.
Frankfurt/Oder
Zwischenhalt in Berlin. Bea bringt Post und Wäsche. Mittagessen in der Osteria Uno. Nach der Hitze fühlen sich 24 Grad heute beinahe wieder kühl an.
»Hier zieht’s irgendwo«, sage ich.
»Kommt mir nicht so vor.«
»Ich sage dir, daß es hier zieht.«
»Du hast Zugserscheinungen!«
Heute habe ich gelesen, daß im Londoner Stadtteil Shoreditch ein Projekt namens »Neighbourhood-Watching« Erfolge feiert. Das Problemviertel ist fast komplett videoüberwacht, die Einwohner können sich die Kameraeinstellungen live auf einen lokalen Fernsehkanal legen und, wenn sie etwas Verdächtiges sehen, sofort der Polizei Meldung machen. Die Kriminalität ist seither gesunken, der Wert der Immobilien gestiegen. Daß diese unverhüllte Form von Big Brother ausgerechnet in London wahr wird, erstaunlich, aber an sich egal, wo man die Menschen unter Druck setzt, sie stellen bald ihre Sicherheit über ihre Privatsphäre, und ich bin nicht halb so empört darüber, wie ich es vor zehn Jahren noch gewesen wäre. Hier ist eine Entwicklung im Gange, die allein vom Bürgertum entschieden werden wird. Ich hege keine Illusionen darüber, daß in schon naher Zukunft Verbrechen kaum mehr möglich sein werden, weil wir alle mit einem subkutan implantierten Chip nachts durch die Straßen kreuzen.
Die Kritiken zu Dorsts Regie in Bayreuth sind einmütig negativ, aber lesen sich so, als könnten sie vielleicht ganz falsch liegen. Die beiden herausragendsten Inszenierungen der letzten Jahre in Berlin, Vera Nemirovas Fanciulla del West und Dörries Turandot, haben überwiegend auch in die Fresse bekommen. Man darf sich da auf nichts und niemanden verlassen.
Erneut, diesmal im Zug, komme ich mit Einheimischen ins Gespräch und frage, wie es sich hier so lebt und ob man Schmidts Lichter und Dresens Halbe Treppe gesehen und die Bilder, die darin von der Stadt gezeichnet werden, zu trist gefunden habe.
»Wer spielt denn da mit, den man kennt?« War ein schon älteres Paar. Nun gut.
Auf dem Bahnhof hier gibt es ein Gleis, von dem ein Zug binnen nur neunundzwanzig Stunden nach Moskau fährt. Aufregend.
Ich bin noch nie in Polen gewesen und überlege, ob ich das ändern soll. Na klar. Also Deutschlandreise mit Polenausflug. Słubice erreicht man über eine Brücke, die Kontrollen sind lasch. Als Besitzer eines deutschen Ausweises kommt man sich vor wie ausgestattet mit einer MasterCard Platin. Unbegrenzter Kreditrahmen. Man geht in ein Europa zweiter Klasse, mit schlechtem Gewissen, aber nicht ganz so schlechtem Gewissen, weil diesem Teil Europas bald die Versetzung blüht. Zu Recht, weil die polnischen Hooligans von der WM in Deutschland so beeindruckt waren, daß sie komplett zu randalieren vergaßen.
Die Oder bei Frankfurt ist sehr schön. Polen ist auch ein schönes Land und die Einwohner ähneln den unsrigen zum Verwechseln. Die Sprache ist einfach zu lernen, Szyba heißt Scheibe, Apteka Apotheke, Dentalklinik Dentalklinik, kein Problem. Nur Ausgang heißt Wyjście. Das muß man sich eben merken. Polen sieht aus wie Teltow. Polnische Autos halten an jedem Zebrastreifen.
Schon seltsam, in ein Land zu fahren, das die Deutschen vor ein paar Jahrzehnten überfallen haben. Ich war zwar nicht dabei, verhalte mich aber superfreundlich gegen jedermann und demonstriere mit beschwichtigenden Gesten, daß keine Gefahr von mir ausgeht. Beschließe, da es hier um eine Deutschlandreise geht, von all meinen Abenteuern in Polen ein andermal zu berichten. Mit einer Stange Zigaretten und zwei riesigen Würsten schlußendlich heim ins Reich. Ein Reiher, der hinabstürzt und sich einen Fisch krallt, damit fortfliegt. Die Oder führt kaum Wasser, ist gerademal knietief, man könnte den Fluß durchrennen in weniger als einer Minute.
Auf dem Marktplatz in Frankfurt prügeln sich zwei Glatzen. Wundervoller Anblick. Die Stadt braucht noch ein wenig Typberatung, aber sonst … Wie eine Oper von Alfano … Es gibt Stellen …
Cottbus
Hier, am schönen Jugendstiltheater, sollten auch einmal die Nibelungen uraufgeführt werden. Leider verpufften die Verhandlungen, weil ich tausend Euro zuviel verlangte. Aus Osten-Kostengründen gab man dann lieber die Nibelungen von Hebbel.
Zum neuen Almodóvar heute immerhin eine sehr mäßig begeisterte Kritik im Tagesspiegel. Es gibt Hoffnung. Die Zeit rückt alles zurecht. Sie läßt sich manchmal sehr viel Zeit, die Zeit, aber die hat sie ja auch.
Dresden