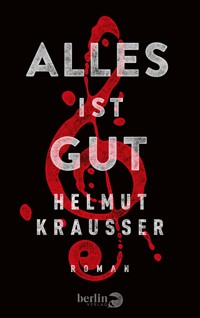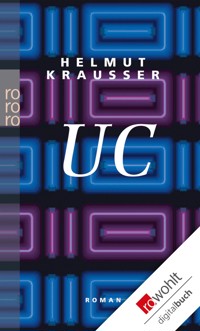10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Ich ficke zu viel« – trotz dieser Selbsterkenntnis tritt Leon, Alpha Player des Teams Berlin, noch einmal mit an zu den 2028 in Kopenhagen stattfindenden Weltmeisterschaften der International Federation for Competition Sex. Gemeinsam will man zum vierten Mal den Titel holen, während draußen vor dem hochgesicherten Veranstaltungsort die Eiferer einer restriktiven neuen Welt demonstrieren. Was aber hatte den unerreichten Superstar seines Sports dazu bewogen, kurz vorher wochenlang vom Erdboden zu verschwinden? Fans und Medien hatten ihn bereits für tot erklärt. Und wie ist sein heimliches Bekenntnis zu verstehen, er sei in Shasha alias Sally Cellar verliebt, seine wichtigste Teampartnerin, mit der er nach sportlichen Kriterien x-mal täglich verkehrt? In einer Welt, aus der aller Rausch der Erotik verschwunden ist und Sex kein Geheimnis mehr hat, muss es zwangsläufig zum Äußersten kommen, um Liebe zu zeigen. Mit dem ganzen Reichtum seiner Mittel entwirft Helmut Krausser eine radikal-romantische Zukunftsgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
ISBN 978-3-8270-7923-7
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic, München
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Dezember
Frühling
Eine Woche vor der WM
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Vierter Tag
Fünfter Tag
Sechster Tag
Siebter Tag
Achter Tag
Neunter Tag
Tag des Finales
Epilog – Juni
Dezember
Ich schlich mich aus den Scheinwerferkegeln, als hätte ich wen umgebracht und müsse untertauchen. Bei Nacht und Spätnovembernebel. Das war geil und aufregend. Plötzlich ein völlig anderer zu sein, mit neu geschnitzten Kulissen um mich her. Ein anderes Schauspiel, eine Premiere, beinahe improvisiert, mit ungewissem Ausgang. Alles wurde bar bezahlt, ich nahm Züge und Fähren, um kein Flugticket kaufen zu müssen. Es gab keine Pressemitteilung, keinen Brief, keine SMS. Niemand wußte Bescheid, nicht mal Helen oder sonstwer aus dem Team. Man hielt mich für tot oder verschleppt, wartete auf den Fund meiner Leiche oder wenigstens auf eine Lösegeldforderung. Viele Zeitungen verzierten sich auf Seite eins mit meinem Bild. Die Welt rätselte.
Anfang Dezember kam ich in Alta an, wo ich beim Gebrauchtwagenhändler einen schrottigen Pick-up abholte. Meine Tarnung bestand aus Brille, Vollbart und platinblond gefärbtem Haar. Die Hütte wie auch der Pick-up waren über einen Strohmann bezahlt, der nicht wußte, wer ihn beauftragt hatte. Alta liegt in Nordnorwegen. Das klingt eisig, aber die Wintertemperaturen dort sind milder, als man gemeinhin vermutet.
Auf meinem Weg dorthin habe ich ein paar Tage in Trondheim verbracht und die Hessdalenlichter beobachtet. Gehen Sie Hessdalenlichter googeln, und fahren Sie im nächsten Urlaub mal hin, es lohnt sich. Noch immer gibt es keine plausible wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen. Für diejenigen, die zu faul sind, um zu googeln: Es handelt sich um Lichter in vielerlei Gestalt, rund, dreieckig oder unregelmäßig, die sich über den Himmel bewegen und manchmal bis zu einer Stunde an einem Punkt verharren. Ein nächtliches Schauspiel, das mich wie Magie berührt hat, und ich meine echte, sakrale Magie, nicht irgendeinen raffiniert ausgetüftelten Taschenspielertrick, der nur auf der Täuschung unsrer Sinne basiert, vulgo auf unserer Tölpelhaftigkeit. Googeln Sie vulgo, wenn Sie der geistigen Unterschicht angehören.
Eine ganze Nacht und die Hälfte der nächsten hab ich im Freien auf meinem Tripod-Klappstuhl gesessen und Lichter angestarrt, von denen manche sagen, es handle sich um Ufos, was Blödsinn ist; andere glauben, es seien die Seelen von Toten, die aus der Unterwelt heraufsteigen, um noch einmal zu tanzen. Das klingt immerhin erbaulich. Physiker reden von Plasmawellen infolge seismischer Tätigkeit, sie sagen, Tal und Fluß könnten wie eine gewaltige natürliche Batterie wirken, blabla – damit kann längst nicht alles erklärt werden. Die Lichter lösten eine feierliche Stimmung in mir aus, feierlich bis euphorisch, aber auch schicksalhaft. Oder was man so nennt. Wie erkläre ich das? Es ist ungefähr so, als ob man mit Napoleonhut am Morgen der Schlacht auf einem schnaubenden Schimmel an den eigenen Soldaten entlangreitet und alle jubeln, obwohl sehr viele von ihnen sterben werden. Über Kopfhörer kamen die Symphonien Anton Bruckners dazu, und ich fühlte mich in meinem Plan entscheidend bestärkt. Weiter nach Norden, ans Ende Europas. In die Einsamkeit.
Jetzt gehen Sie mal für zwanzig Minuten ins Zimmer mit der besten Akustik und hören sich den letzten Satz von Bruckners Neunter an. Die Fingerspitzen von Mensch und Gott berühren sich. Michelangelo hat es gemalt, Bruckner hat’s komponiert. Danach machen wir mit Alta weiter. Los, gehen Sie! Verpissen Sie sich.
Willkommen zurück. Entschuldigung für meine Unhöflichkeit, für meinen Befehlston eben. Das hab ich manchmal, und es geht schnell wieder weg. Oft wird es als Feindseligkeit mißverstanden, aber es ist nur so etwas wie eine Eruption, ein kurzes Zucken, ein Defizit an Kontrolle, man sollte es vielleicht gar nicht erwähnen.
Von Alta aus fuhr ich mit dem Pick-up ungefähr hundert Kilometer in Richtung Wald, wo ich den Wagen stehenließ und noch etwa zwei Kilometer durch Schnee und Gehölz marschierte, bis zur Hütte, die einen guten Eindruck machte. Zwei Tonnen kleingehackte Scheite lagen aufgestapelt im Freien. Damit mußte ich durch den Winter kommen. Die Chance, hier in den kommenden Monaten einem Menschen zu begegnen, schien mir gering. Mein Handy war ein Prepaid-Smartphone, nicht auf meinen Namen registriert oder sonst in irgendeiner Weise mit meiner Identität verbunden. Ich mußte sicherstellen, daß ich mich nicht in einem verrückten oder betrunkenen Augenblick in irgendein Netzwerk einloggen würde. Also hab ich das Handy vergraben und versucht, mir die Stelle nicht zu merken. Das Kabel des Aufladegeräts mit der Schere zu durchschneiden war Rubikon pur. (Googeln Sie Rubikon oder Cäsar.) Selbst im Notfall wäre mir keine Möglichkeit geblieben, die Zivilisation um Hilfe zu rufen. Das war der Kick. Es gab in der Hütte keinen Strom. Wasser mußte auf dem Ofen heiß gemacht werden. Lebensmittelvorräte gab es in Form von Hunderten Konservendosen sowie Säcken mit Reis und Nudeln, die in einem kleinen Schuppen hinter der Hütte lagerten. Ich besaß, um gelegentlich etwas von der Welt zu erfahren, ein Kurzwellenradio und genügend Batterien dafür, aber keine Rückversicherung in Form etwa eines Funkgeräts. Die Hütte mochte einem Jäger gehört haben, ein Gewehr stand herum, mit zwei Kistchen Schrotmunition. Eine Axt. Eine sehr schöne Axt. Falls mir das Holz ausgehen würde, konnte ich neues schlagen. Außerdem besaß ich zwei dicke Thermoschlafsäcke. Hatte auch Medikamente und etliche Kisten Rotwein, sogar ein paar Flaschen Schnaps, auf die ich mich wie ein Trunkenbold freute, gerade weil sie mir in meinem Beruf so streng verboten sind. An frisches Gemüse oder Obst (abgesehen von einigen Zitronen) war nicht zu denken, auch nicht an Fleisch oder Fisch, es sei denn, ich wäre auf die Jagd gegangen oder hätte im nahen Bach geangelt. Daß ich meinem Körper mit der Konservennahrung keinen guten Dienst erweisen würde, machte mir ein schlechtes Gewissen, ein bißchen, ich will nicht übertreiben.
Sehr hat mich gewundert – und wenn ich ehrlich bin, hat es meiner Eitelkeit schon enorm gefallen –, welches Aufsehen mein Verschwinden erregte, als wäre ich jemand, um den getrauert werden muß. Nicht viel hätte gefehlt, und ich hätte meine Nachrufe lesen können. Wer möchte das nicht? Von seiten der Frafls Zuspruch und Trost erfahren am Ende der Existenz, bevor es zurückgeht ins Nichts.
Von nun an, dank des Radios, konnte ich nur noch »wichtige« Nachrichten empfangen. Also nichts mehr über »mich«. Keine Fan-Foren mehr. Kein Handy-Gedaddel. Null Kommunikation, null Bestätigung. Anfangs tat es weh. Die Langeweile hinter der großen Stille würgte mich wie eine Schlange, die zu grausam ist, um mit ihrem Opfer schnell Schluß zu machen, die erst noch spielen und quälen will. Die Tierschützer werden mir jetzt sagen, daß Schlangen weder grausam sind noch mit ihren Opfern spielen. Tja. Nehmen wir statt dessen Würgekatzen. Ab sofort gibt es Würgekatzen.
Nachts versuchte ich, die dicken Bücher zu lesen, auf die ich mich sehr gefreut, die ich mir mein Leben lang vorgenommen hatte, konnte mich aber nicht konzentrieren, mein Blick verirrte sich ständig ins Leere, mein Kopf glich einem Taubenschlag. Umherflatternde Gedanken. Die Sucht nach Bildschirmaction. Selbst ein uraltes Tetris-Spiel wäre mir willkommen gewesen. So stelle ich mir den kalten Entzug vor. Am dritten Tag grub ich nach meinem Handy, fand es auch, aber die Kälte und die Feuchtigkeit hatten es bereits unbrauchbar gemacht. Zum Glück. Auch der Wagen sprang nicht mehr an. Genau, wie ich es geplant hatte. Er knurrte nicht mal. Die Falle war zugeschnappt. Meine Falle. Eine Falle für mich ganz allein. So war das also. Ich würde im Frühling gute hundert Kilometer zu Fuß zurücklegen müssen, um zurückzukehren. Zwei Tagesmärsche samt Übernachtung in einem Zelt im Freien. Es würde die Krönung einer ganzen Reihe von Selbstkasteiungen sein.
Gedanken um zurückgelassene Frafls, die sich aus Sorge um mich die Augen ausweinen würden, machte ich mir keine. Es ist ja so: Viele verehren mich, ohne mich zu kennen. Niemand, der mich kennt, liebt mich, soweit ich weiß. Dabei bin ich kein schlechter Mensch, und meistens, allermeistens, kann man sich auf mich verlassen. Aber bei zehn Milliarden Menschen auf der Welt ist jeder verzicht- und ersetzbar. Das Team Berlin würde mich vermissen, ganz sicher, würde mich betrauern, vielleicht sogar für mich beten – und meine Position neu casten, für den Worst Case. Shasha würde sich an einen neuen Spog gewöhnen müssen.
Würde ich ernsthaft krank werden, ohne Aussicht auf Heilung, konnte ich das Gewehr benutzen, um mich von etwaigen Schmerzen zu befreien. Mein Kopf würde in Fetzen durch die Gegend fliegen. Man würde meinen kopflosen Leichnam finden und ihm – sehr wahrscheinlich – nie einen Namen zuordnen können. Mein Verschwinden würde ein ewiges Mysterium bleiben. Das hatte was.
Nach einigen Tagen begann die große Zeit. Weil mir die Zeit verlorenging oder ich der Zeit, das kann man so und so betrachten. Nach der Langeweile kam ein neues Bewußtsein. Eine neue, überwältigende Klarheit. Es fühlte sich erlösend an, als wäre man einen gewaltigen Brummschädel durch Einnahme von Super-Aspirin losgeworden. Man denkt über sich ganz neu und anders nach. Das Denken erhebt sich über den eigenen Kopf, schwebt drei Meter darüber und betrachtet alles gleichsam von oben, wie bei einer Nahtoderfahrung, wenn die Seele über dem OP-Tisch an der Decke klebt. Ich wurde zum Sieger, dann zum Herrscher. Und endlich kam das Glück. Mit Temperaturen um minus 15 Grad und tagelangem Schneefall. Sobald die Flucht komplett unrealistisch geworden war. Wie ein Leuchten fließt das Glück in einen hinein. Alles, was ist, ist viel mehr als zuvor. Man sieht nie mehr auf die Uhr. Zeit verliert jede Bedeutung. Es gibt nur noch hell oder dunkel. Selbst das wird im Grunde bedeutungslos. Kalte Tage oder nicht so kalte, das macht einen gewissen Unterschied. Sonst nichts.
Das Glück, in einer eisigen Winternacht Geborgenheit zu genießen, wenn das Feuer im Kamin hell flackert und eine Karaffe Rotwein auf dem Tisch steht, während außerhalb der Hütte Wölfe und Bären vor Gier und Hunger grunzen. Dazu ein gutes Buch lesen dürfen und zu wissen, daß irgendwann der Frühling kommt, daß Feuerholz und Lebensmittel ausreichen werden, daß der Weg zur Stadt, in der das Leben wartet, zum Triumphzug wird. So sah es aus, mein Glück der Einsamkeit. Unerträglich der Gedanke, die Hütte, diese kleine feste Burg, mit einem Menschen teilen zu müssen. Selbst wenn es ein wunderschönes, in mich verliebtes Mädchen gewesen wäre.
Es ist Einsamkeit, die eine Form von Macht und Würde darstellt. Sie kommt als Selbstbehauptung und Trotz. Ich suchte nach mir selbst und fand einen ängstlichen Wurm, der viele Windeln übereinander trug, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Die Angst fiel irgendwann von mir ab wie eine getrocknete Schmutzschicht. Ich wurde auf gewisse Weise nackt – nicht nackt wie im Sport, anders nackt.
Dieses Glück war kein Glück der Zufriedenheit, kein karrieristisches Glück, etwas erreicht zu haben, es war Kampf und Bravoura und Lebenswille. Das Glück des ersten Monats. Danach kam es zu Entbehrungen, die mit Recht so genannt werden konnten. Keine Wehwehchen, wie zu Beginn. Mit der Einsamkeit war ich noch immer einverstanden, doch gierte ich nach menschlichen Stimmen, die nicht nur aus dem Radio kamen. Auf einen Körper, der die Hütte mit mir teilte, verzichtete ich weiterhin gern. Eine körperlose Stimme aber wäre mir willkommen gewesen. Man möchte telefonieren. Plötzlich kommt auch der Wunsch, hier und da, an gewissen Stellen, ein Lebenszeichen zu senden. Nicht wie jemand, der im Sarg erwacht, das wäre zuviel gesagt, eher wie ein ausgerissener Jugendlicher, der nach Wochen einsieht, der eigenen Familie mit seinem Schweigen unverhältnismäßig viel anzutun.
Eine Stimme. Vielleicht erschuf ich welche in meinem Kopf. Ich weiß es nicht. Eines Abends sang der Teufel vor meiner Hütte. Ich hätte ihn beinahe hereingebeten, so stimmendurstig war ich. Aber der Teufel unter dem eigenen Dach – sowas hat Folgen. Ich hörte ihm zu, lange, sein Winseln hörte sich berückend an, betörend. Viel sprach dafür, ihm die Tür zu öffnen, er war bestimmt in Geberlaune, und ich war bereit zu nehmen, alles, was mir angeboten wurde. Alles. Beim Sehen ins Feuer schob der Teufel seine Zunge in mein Ohr. Es hört sich jetzt, aus der zeitlichen Entfernung, launig und fast lustig an. Ich sollte vielleicht nicht darüber sprechen, um keinen falschen Eindruck zu erwecken.
Ich habe einen sehr individuellen Teufel. Er sieht mir verdammt ähnlich. Nur meine Mutter könnte ihn von mir unterscheiden, wenn überhaupt irgendwer.
Diese Vollmondnächte. Blau-gelbe Marmorhimmel mit Wolkengespenstern.
Ich erschoß den Weihnachtswolf. Einmal im Leben tat ich etwas Böses. Der Wolf hatte nie etwas Böses getan. Das kann ich sagen, ohne ihn näher gekannt zu haben. Es gab keinerlei Notwendigkeit, ihn zu töten. Es war an Heiligabend, ich stand in der offenen Tür, hatte das Schrotgewehr und klare Sicht auf das Tier. Mein erster Wolf. Seine Augen funkelten rot vom Licht aus meiner Hütte. Er griff mich nicht an, er stand nur da rum, hungrig, neugierig und unvorsichtig. Vielleicht hätte man mit ihm tanzen können, wie in diesem alten Film, wer weiß. Der Schuß traf ihn kraß in den Kopf. Wow. Kein Gewinsel, keine Qualen. Ich ließ den Kadaver tagelang liegen, bis ich mich überwand und ein Stück gefrorenes Fleisch herausschnitt, um es zu braten und zu essen. Gewissermaßen, um meiner Tat nachträglich Sinn zu verleihen. Unterzujubeln. Was natürlich Quatsch war. Das Fleisch schmeckte nicht, und ich spuckte es halbgekaut aus. Der Tod hat immer Sinn, er schafft Platz. Der Tod ist ein Jäger, kein Henker. Wer nie getötet hat, weiß nicht, wie sich das anfühlt. Es kann sich vermutlich so oder so anfühlen. Man wird vom Töten nicht klüger, man lernt nur etwas über sich selbst. Vielleicht. Ich bin mir nicht so sicher, was genau ich über mich gelernt habe. Der Teufel hätte es mir gewiß erzählt. Ich bin nicht besonders religiös, wenn ich sage: der Teufel, meine ich etwas anderes als das Monster mit den Hörnern. Kein Wesen aus der Hölle, sondern etwas, das in jedem von uns wohnt und meistens weggesperrt ist, in die dunkelsten Gewölbe im Keller der Seele. An die Seele glaube ich. Dazu muß man nicht religiös sein. Die Seele ist sowas wie die Summe all dessen, was von uns bleibt und noch eine Weile herumstreunt auf diesem Planeten, bevor es fortgeht, wohin auch immer. Unsterblich ist daran nichts. Der Unterschied zwischen »Seele« und »Restmüll« kann manchmal sehr gering sein.
Manche Idioten sagen, daß wir nichts sind, daß, was immer wir unternehmen, egal ist, nur weil die Sterne in ihrem Lauf nichts von uns wissen. Aber wir wissen nun mal von ihnen, während sie umgekehrt doch null Ahnung haben, welch subtile Kleinigkeiten jenseits ihrer großen Manöver existieren, wenn auch nur kurz.
…
Ich war immer schon, seit ich denken kann, ein Anhänger der Verlierer. Ich mochte die Trojaner, die Griechen aber nicht, obwohl ich bereits wußte, wie das Gemetzel ausgehen würde. Aber jedesmal, wenn ich das Buch aufschlug und zur Stelle kam, an der Achilles mit Hector kämpft, hoffte ich darauf, daß das Buch es sich inzwischen irgendwie anders überlegt haben könnte und der von den Göttern verlassene Hector nicht mehr dem Tod geweiht war. Im amerikanischen Bürgerkrieg ergriff ich Partei für den Süden, weil ich das Grau der Konföderiertenuniform schicker fand als das Tugendblau des Nordens. Dabei wußte ich, worum der Krieg sich drehte, aber die Sklaverei war mir seltsam egal. Ich war ein Kind und noch weitestgehend unbelästigt von Moralkorsetten. Wahrscheinlich fand ich die Sklaverei gar nicht so schlecht. Ein Kind reflektiert nur so weit wie ein Hund. Wie ein Hund und drei Raben vielleicht. Nicht alles muß arithmetisch ausgedrückt werden. Warum kommt eigentlich nie eine Sonderausgabe der klassischen Heldensagen auf den Buchmarkt, in der die Griechen verlieren und vor den Toren Trojas allesamt abgeschlachtet werden? Ich würde das kaufen und lesen, selbst wenn ich auch dieses Mal schon wissen würde, wie die Geschichte ausgeht. So viel späte Genugtuung – dafür würde ich jede Summe hinlegen. Selbst wenn es plumpe Fälschung und Verdrehung wäre. Aber unter uns Würgekatzen: Was ist schon echt, das auf Papier steht?
Ich bin sehr bald zu alt für den Job. Ich weiß noch nicht, was ich danach machen werde. Erst mal viele Drogen nehmen, vermutlich. Mein vor Gesundheit strotzender Körper macht mich ganz krank, macht meinen Kopf glühen und zischen. Ich giere nach Ausschweifung, muß aber Sportler sein. Verrückt. Wer mich ein bißchen kennt, weiß, daß Sport und mein Wesen fast unvereinbare Dinge sind. Aber wenn du dich erst einmal in der Maschine befindest und dein Ego gefüttert wird – Millionen Menschen schauen dir zu und geben dir viel Geld, und schöne Mädchen werfen dir Slips und Fotos ihrer Amateurspogs an den Kopf –, da kommst du nur schwer wieder raus, ganz schwer.
Ich ficke zuviel.
Wenn ich zum Therapeuten ginge, hörte der sich wohl viele Stunden lang mein Geseiere an und würde dann sagen: »Leon, könnte es sein, daß Sie auf dem Zahnfleisch daherkommen, weil Sie zu oft Geschlechtsverkehr ohne emotionale Teilnahme haben?« Und ich dann: »Echt? Menno!« Dann wär ich 10 000 Dollar los. Also diagnostiziere ich mich selbst. Ich ficke zuviel.
Wenn man mein Problem mit drei Wörtern benennen müßte, dann so. Ich meine es nicht kokett und schon gar nicht als Angeberei. Ich habe zum Beruf gemacht, was ich gut konnte und vor einigen Jahren noch recht gerne tat. Ich ficke nicht wild in der Gegend herum, sondern jeden Tag dieselben drei Frauen meines Teams. Und in eine von den dreien bin ich sogar verliebt. Ob sie mich mag, weiß ich nicht. Ehrlich nicht. Darüber haben wir nie geredet. Wenn eine Frau dich hineinläßt, braucht es kein Gerede, wie sonst.
Ich möchte das Wort »ficken« fortan nicht mehr benutzen, denn was ich mache, sieht zwar so ähnlich aus, fühlt sich aber anders an und ist definitiv etwas vollkommen anderes.
Die meisten Menschen ruhen in sich, sind darüber hinaus noch eingebettet in ihre Zeit. Sie sind geerdet. Es kommt selten vor, daß sie wie von weit außen oder aus ferner Zukunft auf sich und ihr Leben blicken, schon aus Selbstschutz, denn wie banal, fast lächerlich würde vieles darin dann wirken. Die meisten Menschen leben in einer Bewußtseinsblase, die sie behütet, die ihre Endlichkeit verdrängt und sie – salopp gesprochen – täppisch in den Tag hinein leben läßt. All das ist mir in der Einsamkeit abhanden gekommen. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen, als ich mich an den Haaren hinauf zum Himmel zog. Mir bot sich auch keinerlei Ausgleich, wie zum Beispiel eine große Gabe, ein gewisses Talent, das die entstandene Leere mit dem Trost füllen könnte, der Menschheit wenigstens einen besonderen Dienst zu erweisen.
Diese Leere gleicht, obwohl man zuerst mit Erhabenheit und sogar Euphorie auf den schmalen hohen Pfad gelockt wurde, einem stummen Entsetzen, ähnlich einer Höhenkrankheit. Der eroberten Erkenntnis folgt das Gefühl, dazu verurteilt zu sein, eine irrelevante Zeitspanne auf Erden absitzen zu müssen. Aus diesen eisigen Höhen wieder hinunter ins Leben führt nur der Pfad der Gelassenheit, die Fähigkeit, seine enthüllte Existenz als heiteres Nachspiel ihrer selbst mit den Augen eines Fremden zu betrachten, der Humor genug hat, über alle Unzulänglichkeiten des Possenspielfigürchens ICH zu schmunzeln und die Welt als Theater zu betrachten. Froh ist, wer nichts mehr begehrt und das bißchen, was er noch besitzt, verschenkt. Mag sein. Aber für einen Stoiker bin ich noch zu wenig weise und abgehärtet und nicht alt genug, auch wenn sich mein Körper dreißig Jahre älter anfühlt, als ich bin. Ich habe die Hessdalen-Lichter gefragt, was ich tun soll. Und ich könnte jetzt sagen, die Lichter hätten mir dies und das mitgeteilt. Haben sie leider nicht. Einen Scheiß haben die. Die flirrten wie besoffen umher, von da nach dort, ohne Plan und Geist. Eine feierlich-schicksälige Stimmung haben sie evoziert in mir, und Bruckner hat ihnen geholfen, mit heftigen Rhythmen, dann war ich allein mit meiner feierlich-schicksäligen Stimmung, und in der Wildnis habe ich geschrien, um eine Stimme zu hören, und ich habe meine Stimme verstellt, um eine andere Stimme zu hören als meine. Half ein bißchen.
Es gibt eines, was ich mit Adolf Hitler gemein habe. Bruckner als bevorzugten Symphoniker. Wenn man Wagner hört, bekommt man Lust, in Polen einzufallen, hat Woody Allen mal gesagt, aber wenn man Bruckner hört, pfeift man auf das verschissene Polen und wendet sich gen Westen.
In der Einsamkeit Nordnorwegens Bruckner zu hören wird dabei ganz unmöglich. Genauso könnte man einem Unterwasserorchester zuhören. Es klingt nicht. Die Stille, die monströse Leere der aufgedeckten Existenz, läßt keinerlei Klang zu. Nur Vibrationen, hart und heftig, die nicht auszuhalten sind.
Es kamen Vögel, um den toten Wolf zu fressen. Das war beruhigend. Weil nur Vögel kamen, kein Bär. In einer der ersten Nächte hatte ich mir eingebildet, einen Bären zu hören, diese Mischung aus Brummen und Grunzen und Schneuzen und Keuchen. Doch anscheinend war kein Bär in der Nähe, sonst hätte ihn das Aas doch angelockt. Oder nicht? Roch der steifgefrorene Wolf nicht geil genug, und nur die Raubvögel entdeckten den Kadaver, weil sie von oben das schwarz gewordene Blut im Schnee erkannten? Keine Ahnung. Ich bin ein Angsthäschen. Aus Angst vor Bären und zufällig umherstreifenden Horrorfilmkettensägenrednecks auf Speed verließ ich in den ersten Wochen die Hütte nur selten. Aber mein Körper hatte sich bald an die Kälte gewöhnt, und wenn es Sonnenlicht gab, täglich bis zu zwei Stunden, trat ich gierig hinaus und bot meine Stirn dem Zentralgestirn dar. Für ein tête-à-tête sozusagen. Geh das googeln, du dumme Drecksau!
Sorry. Später lockte mich die Lust auf Fisch an den Bach. Der Versuch, eine Angel zu basteln, war kläglich gescheitert, kein noch so kleiner Nagel ersetzt einen Angelhaken. Aber das war auch nicht nötig. Die Fische in diesem Bach waren derart naiv, die hatten keinen blassen Schimmer, was ich von ihnen wollte. Die konnte man mit dem Nudelsieb käschern. Ehrlich, das ging. Ich schmiß, vielmehr schaufelte die Fische, sone Art kleine Saiblinge, in den Schnee, wo sie zappelten und ganz neue Perspektiven der Welt entdeckten. Bis ich ihnen mit dem Bowiemesser die Köpfe abschnitt. Damit sie nicht qualvoll erstickten. Für ein Stadtei wie mich war es etwas Besonderes, zum ersten Mal lebende Köpfe abzuschneiden. Die Fische auszunehmen machte Spaß. Das Blut brachte etwas rote Farbe in das dröhnende Weiß. An Gewürzen besaß ich nur Pfeffer und Salz, meine eigene Schuld, hätte ja welche mitbringen können; aber die schon erwähnten Zitronen, in einem kühlen Eck der Hütte gelagert, bekamen einen wunderbaren Sinn. Obwohl sich Fische und Zitronen noch nie zuvor gesehen hatten. Den Gedanken fand ich damals interessant, daß aller Sinn nur eine Leihgabe darstellt, die der Tod dann wieder zurücknimmt. Jetzt, im nachhinein, finde ich die Einsicht etwas banal. Es ist wohl so, daß Schnee und Einsamkeit jedes Sinnsprüchlein etwas gravitätischer daherkommen lassen.
Ein Bär kam in der ganzen Zeit nicht vorbei. Man erinnert sich vielleicht an diesen Film von vor über zehn Jahren, der Leo DiCaprio endlich den Oscar einbrachte, The Revenant. Leo spielt einen ohnehin schon vom Pech verfolgten Trapper, der von einem Bären angefallen wird. Wahnsinnsszene, noch nie zuvor war bärische Gewalt so eindrucks- und wuchtvoll filmisch dargestellt worden. Wegen dieser Szene hatte ich lange gezögert, meinen nordischen Plan umzusetzen. Tinnef. Ich sah auch nie einen Elch. Nur Raubvögel und Fische. Und einen Wolf, den ich ohne Grund erschoß. Wichtig wurden die Bücher. Endlich einmal all jene dicken Schinken zu lesen, die ich mir vorgenommen hatte, unter Umständen, die mir so noch nie zur Verfügung standen, das war eine große Erfahrung.
Obwohl – Tolstoi hat mich enttäuscht. Und Mein Kampf erwies sich als läppischer Schwachsinn. Eine Qual. Ich war auf Hitlers Kampfschrift so gespannt gewesen. Seit wenigen Monaten erst gab es das Buch wieder ohne ellenlange besserwisserische Kommentare zu lesen und ohne Frakturschrift. Und dann das.
Ich hatte mir insgeheim gewünscht, Mein Kampf würde sich als unterschätztes Buch erweisen, als von linker Polemik ungerecht desavouiert, ein Werk, das irgendwie gegen den Strich gelesen werden könnte. Dem war nicht so. Hitlers Buch ist eine Häufung von krankem Unfug und Schwachsinn. Ich hatte Furcht gehabt – Furcht ist zuviel, eher Unbehagen –, in Nordnorwegen von Hitler verführt und zum Nazi zu werden, wie so viele andere derzeit. Das blieb mir schmerzhaft erspart. Toll hingegen Dostojewski. Er wurde mein Schneefreund, mein Eiskumpan, mein neuer Hitler. Wenn auch christlich verseucht und lang nicht so erfolgreich. Googeln Sie Dostojewski! Wie viele Filme wurden über ihn gedreht? Egal. Das Gute ist nicht immer populär. Ich teilte ihn in Dosto und Jewski. Dann hatte ich gleich doppelt viele neue Freunde.
Frühling
Als ich am 10. März zurückkehrte in die Stadt Alta, rasiert und nicht mehr blond, nach einem vierzehnstündigen Gewaltmarsch ohne Pause und Nachtlager, wurde ich wie Lazarus bestaunt. Man hatte mich für tot gehalten. Beinahe schon für tot erklärt. Aber ich war so sehr am Leben wie selten zuvor. Dreieinhalb Monate ohne Sex. Dem Team gegenüber habe ich geschwiegen. Jedwede Erklärung verweigert. Ich hätte gedacht, daß Helen mich nach dieser Eskapade als Unsicherheitsfaktor betrachten würde. Aber man war froh, mich zurückzuhaben, und niemand drangsalierte mich mit Fragen. So problemlos ersetzbar, wie ich mich selbst eingeschätzt hatte, war ich offenbar doch nicht. Natürlich ist menschliches Leben, vom Standpunkt der Sterne aus betrachtet, ein Furz im Wind, ein kurzer, eitler Zeitvertreib, bevor es für immer in die Grube steigt. Andererseits haben wir sonst konkret nicht viel zu feiern, und selbst die größten Sterne werden einmal sterben, auch wenn sie vielleicht, im Gegensatz zu uns, gefährliche schwarze Löcher hinterlassen. Wir Frafls hüpfen auf diesem seltenen Glücksfall Erde herum und versuchen, etwas aus uns zu machen, wollen erfolgreich und beliebt und auf irgendeine Weise besser sein als die anderen. Es ist lächerlich, aber auch verständlich, und Menschen vorzuwerfen, menschlich zu sein, mutet absurd an und überheblich. Als ich am 20. März, beim ersten Aufwärmtraining, in Shasha eindrang, tat ich das ausgesprochen gern und kam relativ schnell. Schon allein dafür hatte sich mein Abenteuer gelohnt. Vielleicht ist es völliger Quatsch, das eigene Leben zu relativieren, indem man es an kosmischen Zyklen mißt. Vielleicht würden die Sterne noch den Geringsten von uns beneiden, besäßen sie ein Gehirn. Wir haben Musik und Bücher, den Wein und die Liebe und schöne Landschaften und Sonnenuntergänge, und selbst die hartschaffenden Dummies mit ihren tausenden Sorgen können zwischendurch mal glücklich sein, zum Beispiel am Wochenende, wenn sie es warm haben und nicht hungrig sind und ins Kino gehen, Eis essen oder, hin und wieder, Sex mit schönen oder weniger schönen Frauen genießen dürfen. Ob schön oder weniger schön – das wird viel zu wichtig genommen. Jeder ist wichtig und wertvoll, und nur die ganz Fetten sollte man aus dem Verkehr ziehen. Haha. Scherz. Natürlich ist kaum jemand wichtig und wertvoll. Deshalb beneiden sie mich. Ja, ich bin privilegiert, und nein, ich bin darüber nicht so begeistert, wie ich es wohl sein sollte. Sex ist nicht mehr, wie bei so vielen jungen Männern, das Größte in meinem Leben. War es noch nie. Sex mit Menschen, die man nicht wirklich kennt, fand ich immer eher anstrengend als aufregend. Ich bin wütend auf alle, die mich beneiden. Ich beneide alle, die auf mich wütend sind. Ich möchte wieder der Junge von vierzehn Jahren sein, der im Grunewald von Annabelle einen geblasen bekam und den Spog vor dem Erguß aus ihrem Mund zog, weil es ihm peinlich gewesen wäre, in ihr zu kommen. Der Junge voller Hemmungen, der von Annabelle für sein zu rücksichtsvolles Verhalten gerügt wurde.