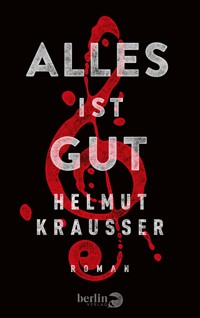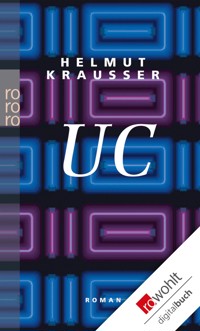5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-Books der Verlagsgruppe Random House
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Die Doppelbiografie zweier exaltierter Musiker und Lebemänner
Baron Alberto Franchetti war Giacomo Puccinis größter Rivale. Mit Opern wie »Asrael«, »Cristoforo Colombo« oder »Germania« feierte er internationale Erfolge und galt als Verdis Nachfolger. Was seine Vorliebe für Automobile und seine Erotomanie angeht, übertraf er Puccini noch um ein Vielfaches. Während dieser mittellos geboren wurde, entstammte Franchetti einer der reichsten Familien Italiens. Seine Duelle, Autorennen und skandalösen Ehen füllten die Klatschspalten der italienischen Presse. Doch während sich Puccinis Ruhm stetig steigerte, sank Franchettis Stern plötzlich ohne erkennbaren Grund. War es das Aufführungsverbot der Faschisten oder waren es die sinistren, an Wagner erinnernden Kompositionen, die ihn ins Abseits führten, während Puccinis luzide Opern noch heute in aller Welt aufgeführt werden? Eine spannende Spurensuche, romanhaft erzählt.
Minutiös recherchiert, stilistisch brillant, intelligent und unterhaltsam erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Ähnliche
Helmut Krausser
Zwei ungleicheRivalenPuccini und FranchettiEdition Elke Heidenreich bei C. Bertelsmann
Die Bücher der Edition Elke Heidenreicherscheinen im C. Bertelsmann Verlag,einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House.1. Auflage© der Originalausgabe 2010by Edition Elke Heidenreich bei C. Bertelsmann, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-05195-2www.edition-elke-heidenreich.de
I
Tod in Venedig
Als am 13. Februar des Jahres 1883 Richard Wagner im Palazzo Vendramin einen Schlaganfall erleidet, bringt dies das Leben der allermeisten Venezianer recht wenig durcheinander. Einer aber, ein noch junger Mann von zweiundzwanzig Jahren, begibt sich ausgerechnet an diesem Tag, ohne vom Schlaganfall etwas zu wissen, zur letzten Adresse des großen Komponisten und bittet um Auskunft über den Gesundheitszustand des verehrten Meisters. Als ihm zu seiner Überraschung dessen Tod gemeldet wird, bricht er ohnmächtig zusammen und wird sich fortan im Leben nie mehr rasieren. Das aber hat mit Wagner gar nichts zu tun, es ist eine zufällige Koinzidenz, denn der junge Mann ist jemand, der Körperpflege vor allem als Zeitverschwendung betrachtet und trotz seines ererbten Reichtums gerne in verlebter Kleidung herumläuft. Noch manch anderes ist an diesem Menschen merkwürdig, zum Beispiel, daß er sich gerade in Venedig befindet, denn eigentlich ist er ja vor zwei Jahren aus dieser Stadt, in der er aufwuchs, geflohen, um in München Musik zu studieren, gegen den Willen seines übermächtigen Vaters, des reichsten Mannes Italiens. Doch der Vater hat dem Erstgeborenen verziehen, und so kam Alberto Franchetti, von dem hier die Rede ist, zwischen den Semestern zu Besuch in seine alte Heimat. Mehr noch als die Sehnsucht nach seinen Eltern, dem Baron Raimondo Franchetti und seiner aus Wien stammenden Gattin, Sara Louise Rothschild, trieb ihn die Aussicht zurück, einmal leibhaftig Wagner zu begegnen, seinem, man muß es so sagen: Gott. Um so härter trifft ihn die Todesnachricht. Unterbewußt macht er sich beinahe Vorwürfe. Ihm ist, als hätte er sich dem Genius zu aufdringlich nähern wollen, und dieser habe sich einer Begegnung nur sterbend entziehen können. Denn es wäre für die Franchettis ein leichtes gewesen, eine solche Begegnung zu arrangieren, und liebend gerne hätte der Jude Alberto Franchetti dem Antisemiten Wagner die Hand geküßt. Dessen Antisemitismus sei, so würde er das rechtfertigen, doch nicht viel mehr als ein boshaftes Gesellschaftsspiel und von sehr theoretischer Natur, keineswegs etwas persönliches.
Am Morgen des 16. Februar, als die Überreste des bedeutendsten Opernkomponisten aller Zeiten vom Palazzo Vendramin in einer Trauergondel zum Bahnhof überführt werden, steht Alberto Franchetti nach einer durchwachten Nacht am Steuer des ersten privaten Dampfschiffs Italiens und fährt dem Kondukt hinterher. Den verehrten Meister nie leibhaftig gesehen zu haben, nicht einmal als Leiche, bedrückt ihn. Vor zehn Tagen noch, am 6. Februar, hätte es dazu eine großartige Möglichkeit gegeben. Wagner war mit einigen seiner Kinder und seinem besten Freund, dem jüdischen (na also!) Dirigenten Hermann Levi, im Karnevalstrubel unterwegs gewesen, danach habe er sich, hieß es, sehr schlecht gefühlt. Alberto hatte über etliche Umwege davon erfahren, womit der Besuch des jungen Barons im Palazzo Vendramin nun hinreichend erklärt ist.
Der Witwe Cosima stellt er sich am Bahnhof kurz vor und drückt ihr sein Beileid aus. Sie nimmt ihn kaum wahr. Auch nicht, als er im Zug, der den Leichnam Wagners nach Deutschland bringt, das gesamte Abteil mietet, das an ihr eigenes angrenzt. Hätte sich Cosima gefragt, wer dieser etwas sonderbar wirkende Jüngling denn sei, wären genügend Italiener vor Ort gewesen, um ihr diese Frage aus dem Stand zu beantworten. Denn »Ricco come Franchetti« ist in Italien eine ebenso häufige Redewendung, wie man sie später in den USA gebraucht, um jemanden »Reich wie Rockefeller« zu nennen. Es ist fast unnötig zu sagen, wer den Sonderwagen bestellt hat, der, dem Zug nach München angehängt, den Sarg Wagners enthält.
Raimondo Franchetti, dem Vater des in Turin am 18. September 1860 Erstgeborenen Alberto, wird zu jener Zeit nachgesagt, er könne von der Toskana aus nach Venedig fahren, ohne zwischendurch seinen Fuß auf Ländereien setzen zu müssen, die ihm nicht gehörten. Das ist zwar eine Übertreibung, trifft die Sache jedoch im Kern ganz gut. Den Franchettis war einige Jahrzehnte zuvor der vererbbare Titel eines Barone (dieser Titel überträgt sich aber immer nur auf den Erstgeborenen der jeweiligen Generation) verliehen worden, und Albertos Großvater Abramo gewann unermeßlichen Reichtum durch den ihm übertragenen Ausbau des italienischen Schienennetzes. Das Vermögen der Familie wird auf, in heutige Kaufkraft umgerechnet, ungefähr zwei Milliarden Euro geschätzt. Die Heirat mit der Bankierstochter Sara Louise Rothschild aus Wien, die kaum Italienisch lernt und mit ihrem Sohn immer nur auf Französisch parliert, war dementsprechend logisch und standesgemäß gewesen und kann doch, Wunder über Wunder, als Liebesheirat gelten, da Raimondo und Louise einander bald schätzenlernten und, das kommt manchmal eben vor, in blühender Harmonie zusammen alt wurden. Wenn auch bei oft weit auseinanderliegenden Wohnsitzen.
Ab 1878 residiert die Familie (nach Alberto wurden zwei weitere Söhne, Edoardo und Giorgio, geboren) durchweg in Venedig, im Palazzo Franchetti (früher Cavalli), der heute noch Touristen aus aller Welt zur Kamera greifen läßt.
Alberto, der zwischendurch ein Faible für Mathematik entwickelt, entscheidet sich für die Musik und studiert zuerst am gleich neben dem Palazzo gelegenen Conservatorio Marcello bei den Lehrern Niccolò Coccon und Fortunato Magi (dem Onkel Giacomo Puccinis). Allerdings ist er am Konservatorium nicht eingeschrieben, sondern genießt bei den erwähnten Lehrern Privatstunden. Seine Begabung, behauptet er später, sei nie sonderlich gefördert worden, das Klavierspiel habe er sich als Autodidakt beigebracht, auf einem auf dem Dachboden versteckten Pianoforte. Seiner Tochter Elena wird er erzählen, es habe dort Myriaden von Wanzen gegeben, aber sie hätten ihn nie gebissen, es müsse sich um sehr musikalische Wanzen gehandelt haben. Es sind die üblichen Geschichten, die man Kindern erzählt, die indes auch eine innere Wahrheit ausdrücken, denn Alberto fühlte sich tatsächlich nie besonders gefördert, obwohl er selbstverständlich eine grundsolide Ausbildung am Klavier erhielt. Sein Bruder, der bekannte Kunstsammler Giorgio, galt sogar als herausragender Pianist, und ein von ihm komponiertes Klavierkonzert kam auch im Ausland zur Aufführung.
Albertos Eltern können ebenfalls für durchaus musikalisch gelten, jedenfalls stiften sie 1880 eine neue Orgel für den Konzertsaal des Conservatorio. Das allein muß natürlich nichts bedeuten, denn irgendwohin müssen sie ja mit ihrem Geld, und Geiz sagt ihnen niemand nach. Raimondo wird von seinem Sohn im Laufe der Jahre zu Wagner bekehrt, aber Albertos angestrebte Künstlerkarriere bleibt ihm, er könnte wohl selbst nicht sagen, weshalb, ein Dorn im Auge. Die Mutter, Sara Louise, die angeblich noch von Chopin persönlich Klavierstunden bekam, zeigt sich aufgeschlossener für Albertos Wünsche. Dank ihrer Unterstützung entwickelt er, gegen den Willen des Vaters, eine eigene Vision seiner Zukunft. Doch gilt es, erste Kompromisse zu schließen. 1880/81 leistet Alberto Franchetti, anders als etwa Puccini, der sich mit einem falschen Attest geschickt darum drückt, seinen Militärdienst ab und stellt danach den Vater vor vollendete Tatsachen, indem er nach München flieht und bei Josef Rheinberger Musik studiert. Seine künstlerische Grundidee besteht darin, aus den beiden großen, einander lange unversöhnlich gegenüberstehenden Vorbildern Wagner und Verdi eine musikalische Symbiose zu bilden. Vorrangig bemerkenswert an diesem damals ziemlich originellen, fast wahnwitzigen Vorhaben ist, daß sich hier ein Künstler von Anfang an nicht etwa selbstsüchtig zu radikal neuen Ufern aufmachen will, sondern sich, voller Demut, in den Dienst zweier anderer Meister stellt. Sein Anliegen wird in einer immer mehr nach Originalität und Tabubrüchen gierenden Zeit bald als reaktionär oder, bestenfalls, als kunstvolles Auf-der-Stelle-Treten gebrandmarkt werden. Wovon er noch nichts ahnen kann. Alberto Franchetti würde sich selbst ja keineswegs als Reaktionär empfinden, im Gegenteil. Für seine Verhältnisse ist er Revoluzzer in mehrfacher Hinsicht, er verrät die italienische Musik nicht nur zugunsten Wagners, er begehrt auch, wenigstens einmal im Leben, gegen die Herrschaft seines Vaters entschieden auf, ist einer jener typischen Italiener, die während des Fin de siècle von einer Sehnsucht nach Deutschland gepackt werden. Aus dem politisch zerrütteten Italien blicken viele Menschen bewundernd, gar neidisch auf das straff geordnete, kulturell blühende Kaiserreich. Es ist die Zeit, da deutsche Schauplätze in der italienischen Oper Mode werden.
An den Vater schreibt Alberto, wohl kein deutscher Komponist käme je auf die Idee, in Italien zu studieren. Umgekehrt täten es etliche und mit hohem Gewinn. Endlich kapituliert Raimondo und gesteht dem störrischen Sohn eine monatliche Apanage von umgerechnet zehntausend Euro zu; damit habe er gefälligst auszukommen. Solange er keine guten Noten vorweisen könne, sei an eine Aufstockung jener Bezüge überhaupt nicht zu denken.
Während Alberto sozusagen auf dem Sarg Wagners zurück nach München fährt, plant die Familie Franchetti, ihren Hauptsitz von Venedig nach Reggio Emilia zu verlegen. Raimondo gefällt es dort aus irgendeinem Grund, vielleicht hält der Rheumakranke die Feuchtigkeit Venedigs nicht mehr aus, auch heißt es, er habe sich in die Reggianer Berge verliebt, man weiß es nicht genau. Seine Gattin, Sara Louise, kann die als etwas farblos geltende Stadt offensichtlich nicht so sehr leiden und residiert von nun an, mit einer eigenen vielköpfigen Dienerschaft, vornehmlich in Viù bei Turin. Giorgio bleibt in Venedig, Edoardo lebt in Paris, Alberto in München. Binnen weniger Jahre haben sich die Franchettis über den Kontinent verteilt und verkehren vor allem brieflich miteinander. Zu fünft zusammenkommen werden sie nie wieder.
Reggio Emilia jedenfalls freut sich über den prominenten neuen Bürger. Raimondo wird baldmöglichst zum Patrizier ernannt. Die Franchettis besitzen zu jener Zeit in Norditalien etwa vierzehn große und kleinere Villen, die kleinste in Florenz mit nur vierhundert Quadratmeter Wohnfläche.
Edoardo Franchetti, der als verschwendungssüchtig gilt, bekennt sich im Familienkreis als homosexuell. Paris ist für einen wie ihn die einzige passende Zuflucht, um seine Andersartigkeit ungestraft auszuleben und – das kommt erschwerend hinzu – Schauspieler zu werden. Für den Vater mehr als zuviel. Edoardo gilt fortan als das schwarze Schaf der Sippe und wird enterbt. Folgerichtig erhöht sich die Bindung zwischen Raimondo und dem Erstgeborenen Alberto, vor allem weil auch der jüngste Sohn, Giorgio, sich vom Elternhaus entfremdet und auf eigene Faust sein Glück in der Welt sucht. Es sind für die an sich so harmoniebedürftige Familie Franchetti recht bewegte Jahre. Und dann, womit ja niemand rechnen konnte, mischt sich auch noch Agathe Haggenmüller ein, die Hausdame aus der Brienner Straße 46 in München, bei der Alberto bis vor kurzem gewohnt hat.
Giacomo Puccini hat, im Gegensatz zu Franchetti, keinen Vater mehr; der ist gestorben, als er selbst fünf Jahre alt war. Zwanzig Jahre später, 1883, arbeitet er mit dem Librettisten Ferdinando Fontana an seiner ersten Oper Le Willis, einer Gespenstergeschichte frei nach Heine, die – natürlich, möchte man fast sagen – in Deutschland spielt. Puccini hat nicht nur keinen Vater und keine feste Freundin, er hat auch kein Geld, im Gegenteil, nur Schulden, und obschon er einer Familie entstammt, die in den fünf zurückliegenden Generationen etliche lokal bedeutende und ganz gut besoldete Komponisten hervorgebracht hat, ist seine aktuelle Situation nur mit zartbitterer Armut zu umschreiben. Daß er sich mit dem befreundeten Kollegen Pietro Mascagni während der Ausbildung in Mailand jemals eine Wohnung geteilt hätte, ist allerdings Legende, mehr nicht. Giacomo und sein jüngerer Bruder Michele erhalten ihre musikalische Ausbildung am Mailänder Konservatorium, doch während Giacomo den Titel eines Maestro erlangt und an seiner ersten Oper schreibt, hält der etwas weniger talentierte Michele bald nichts mehr von den beengten italienischen Verhältnissen und bricht das Studium ab. Es gelingt ihm einfach nicht, im Musikbetrieb Fuß zu fassen, und wenn er sich auch noch ein paar Jahre mehr schlecht als recht durchschlägt, wandert er schließlich, um der Familie nicht länger zur Last zu fallen, nach Argentinien aus, wo er als Klavierlehrer arbeitet und zu seiner Überraschung noch viel beengtere Verhältnisse vorfindet.
Giacomo aber hat, auf die Empfehlung seines Lehrers Ponchielli hin, Fontana getroffen. Ferdinando Fontana, der damals vierunddreißig Jahre alte Journalist mit breitem Schnurrbart, ein immer am Rand des Existenzminimums hausender Bohemien, gilt als etwas bizarrer, politisch sehr engagierter, in der Debatte oft geistreicher Mensch von durchaus eigenem Charme. Von einem scharfsinnigen, aber ungeordneten Talent ist die Rede. Manche nennen den erklärten Sozialisten auch einen Wirrkopf. Legendär ist seine Begabung, in den Mailänder Trattorien anschreiben zu lassen. In einer davon hat sich dies sogar als Gedenktafel erhalten:
FERDINANDO FONTANA HAT ES GESCHAFFT, IN DIESEM LOKAL ACHTUNDFÜNZIG AUFEINANDERFOLGENDE MAHLZEITEN EINZUNEHMEN, OHNE JE DIE RECHNUNG ZU BEZAHLEN.
Sein Œuvre ist zu diesem Zeitpunkt bereits beträchtlich: zehn Opernlibretti, unzählige Zeitungsartikel und drei recht erfolgreiche Komödien im Mailänder Dialekt. Was ihn vor allem einnehmend macht, ist die leidenschaftliche Begeisterung, die er spontan für eine Sache entwickeln kann und die sich auch auf andere schnell überträgt. Sein Libretto der Willis ist von einem Meisterwerk weit entfernt, aber immerhin inspiriert es Puccini zu größtenteils mitreißender Musik, beide sind mit dem Ergebnis überaus zufrieden. Giacomo reicht das fertige Manuskript der Willis im allerletzt möglichen Moment bei einem Wettbewerb, dem Concorso Sonzogno, ein und gewinnt den Preis, so die Legende, nur deshalb nicht, weil die fünf Juroren aus seinem eiligst hingeworfenen Gekrakel einfach nicht schlau werden. Dabei gehört die Partitur zu den noch am leichtesten lesbaren Puccinis, und es kann sein, daß die Juroren zu einer Schutzbehauptung greifen, um ihr Fehlurteil zu kaschieren. Die Enttäuschung der Künstler ist groß. Aber es geschieht ein kleines Wunder. Mehrere Freunde, denen Giacomo aus seinem Werk vorspielt, lassen buchstäblich den Hut herumgehen und sprechen potentielle Investoren an. Über vierhundert Lire kommen so zusammen, dank derer die Stimmen (hand)geschrieben werden können. Relativ schnell findet sich ein Theater, das an der Oper Interesse zeigt, und so kann Giacomo seiner geliebten Mama Albina, die seit Wochen an einer falsch diagnostizierten und daher fast unbehandelten Krankheit leidet, schreiben, daß die Willis am 31. Mai 1884 uraufgeführt werden, immerhin am zweitbesten Opernhaus Mailands nach der Scala, dem Teatro Dal Verme. Der Gesundheitszustand Albinas läßt eine Reise nach Mailand nicht zu. Auch keine der fünf Schwestern Giacomos ist bei der Premiere anwesend, nicht einmal die Lieblingsschwester Ramelde. Zugfahrten sind damals noch teuer, Hauptgrund aber könnte Giacomos merkwürdiger und in den kommenden Jahren noch verfestigter Aberglaube gewesen sein, Verwandte würden bei Premieren dem Künstler Unglück bringen. Michele Puccini indes ist so gut wie sicher Zeuge der Uraufführung gewesen, und bei allem Stolz, den er für die Leistung des Bruders entwickelt haben dürfte, wird ihm, wenigstens unterbewußt, wohl klargeworden sein, daß er fortan immer zu seinen Ungunsten an diesem Bruder gemessen werden wird. Dabei ist die Sache gar nicht so klar, denn über Begabung verfügt Michele sehr wohl. Ein viel wichtigerer Bestandteil künstlerischen Erfolgs geht ihm ab: der unbedingte Wille, aus dem Vorhandenen, wie reich oder dürftig es auch immer ist, das Bestmögliche zu schaffen. Sein melancholischer Wesenszug läßt ihn oft zu früh aufgeben, wo einfach nur der innere Schweinehund besiegt werden müßte, in einem Kraftakt, zu dem ihm die Kraft fehlt.
Die Reaktionen auf die Uraufführung der Willis sind beinahe einhellig. Die Kritiker äußern sich begeistert, und das Publikum erzwingt unter anderem eine dreimalige Wiederholung des sinfonischen Zwischenspiels, das den ersten Akt der Oper beschließt. Im Dal Verme, heißt es, habe man noch nie einen jungen Komponisten derart frenetisch gefeiert wie Giacomo Puccini. Die Juroren des Concorso Sonzogno sehen sich dem öffentlichen Spott ausgeliefert. Italiens bedeutendster Musikverleger, Giulio Ricordi, damals vierundvierzig Jahre alt, ein intimer Freund Giuseppe Verdis, wird auf das junge Talent aufmerksam. Er kommt seinem ständigen Konkurrenten, Edoardo Sonzogno, wieder einmal zuvor und nimmt die Willis unter Vertrag, bindet Puccini an sein Haus, mit einem Vorschuß auf die nächste Oper, ausgezahlt in Form einer auf zwei Jahre hin laufenden monatlichen Dotation von zweihundert Lire, umgerechnet etwa vierhundert Euro. Giacomo leistet sich den Scherz, in der Osteria, in der er oft anschreiben lassen und von dünner Minestrone leben mußte, seine angestauten Schulden mittels eines Tausend-Lire-Scheins zu bezahlen, den natürlich niemand wechseln kann. Alles wäre großartig, würde es der Mutter Albina nur besser gehen. Sie ist glücklich über den Triumph des Sohnes – und doch dem Tod geweiht. Ein Telegramm Rameldes ruft Giacomo nach Lucca, wo er gerade noch den letzten Kuß der Mutter empfängt, bevor diese, am 17. Juli 1884, stirbt. Es dauert Wochen, bevor er sich für imstande hält, mit Giulio Ricordi zu korrespondieren und mit ihm sein weiteres berufliches Procedere abzustimmen.
Ricordi findet Le Willis gut, aber verbesserungswürdig, möchte Änderungen, setzt diese auch durch. Von nun an soll die Oper Le Villi heißen, unter anderem aus dem etwas albernen Grund, weil das W im italienischen Alphabet fast nicht benutzt wird. Puccini befolgt die Ratschläge Ricordis, und bald schon wird ihm der Verleger eine Art neuer Vater sein, zumindest eine Art väterlicher Freund, dem er bedingungslos vertraut. Der Tod der Mutter trägt sicher einiges zur Intensität jener Wahlverwandtschaft bei. Michele ergibt sich seinen Depressionen. Giacomo hingegen hat ein Ziel. Er muß den Erwartungen, die auf ihm lasten, entsprechen. Eine neue Oper. Wieder soll Fontana das Libretto schreiben, und während Le Villi mit siebzig Minuten kaum abendfüllend gewesen waren, soll der Nachfolger nun eine große, vieraktige Oper werden, für den endgültigen Durchbruch.
Die Villi werden in den kommenden Jahren von fünfzehn italienischen und auch ein paar ausländischen Theatern nachgespielt, fast immer mit Erfolg. Das hört sich für heutige Verhältnisse nach viel an, hätte damals aber kaum zum Überleben gereicht. Nur Ricordis mutige Investition in Puccinis Zukunft läßt den jungen Komponisten einigermaßen ungestört arbeiten. Der alte Mäzen Cerù, der Giacomo lange finanziell unter die Arme gegriffen hat, wird 1890 von Puccini sein Darlehen zurückfordern; er glaubt, daß sein ehemaliger Protegé reich geworden sei und mit den Villi mindestens vierzigtausend Lire verdient haben müsse. Puccini kann ihm nachweisen, daß es nur sechstausend waren. Seine finanziellen Verhältnisse werden noch über etliche Jahre ärmlich bleiben. Als Fontana 1885 sein fertiges Libretto zur neuen Oper präsentiert, glaubt Giacomo, es sich nicht erlauben zu können, daran übertrieben herumzumäkeln, und beginnt alsbald mit der Vertonung. Edgar ist das vielleicht idiotischste und verworrenste Libretto der Operngeschichte*, aber Giacomo wischt vor sich selbst alle Zweifel an dem Sujet beiseite. Viele gute Opern seien auf der Basis mangelhafter Libretti entstanden, er glaubt, seine Musik könne Fontanas Nonsens adeln oder zumindest vergessen machen. Aus diesem Fehler wird er bittere Lehren ziehen und sich fortan, wenn auch nicht immer erfolgreich, skrupulös um lohnende Textbücher bemühen.
* Die folgende Zusammenfassung der Handlung ist – warum hätte ich sie mit ein wenig anderen Worten plagiieren sollen? – aus Dieter Schicklings grandioser Puccini-Biographie, erschienen im Carus-Verlag, übernommen, mit freundlicher Erlaubnis des Autors. Er schreibt:
»Aus Mussets romantisch verstiegenem Lesedrama La coupe et les lèvres (Der Becher und die Lippen) über einen faustischen Helden mit Erlösungssehnsucht hat Fontana nichts weiter übernommen als ein paar szenische Motive und dabei vor allem das Spektakel gesucht. Die übrigbleibende Handlung ist von einem so absurden Unsinn, daß es fast nicht möglich ist, sie auch nur nachzuerzählen. Eine Inhaltsangabe muß dennoch gewagt werden, und sei es nur der historischen Wahrheit wegen. Sie ist keineswegs als Parodie zu verstehen. Edgar, der Held, steht zwischen zwei Frauen, deren Namen schon alles sagen: Zur unschuldig reinen Fidelia fühlt er sich scheu hingezogen, aber die verworfene Tigrana sucht ihn für sich zu gewinnen. Komplizierterweise ist Fidelias Bruder Frank der schlimmen Tigrana verfallen, die ihn jedoch zurückweist. Tigrana, vor fünfzehn Jahren als von durchziehenden ›Ungarn und Mauren‹ zurückgelassenes Kind ins Dorf gekommen, provoziert mit allzu weltlichen Gesängen die frommen flandrischen Landbewohner, die sie deshalb bedrohen. Edgar verteidigt sie und kommt in diesem Zusammenhang auf die wenig begreifliche Idee, sein eigenes Haus anzuzünden. Frank sucht ihn vergeblich davon zurückzuhalten, was beinahe zu einem Duell zwischen beiden führt. Gualtiero, Fidelias und Franks Vater, wirft sich dazwischen, und Edgar entflieht zusammen mit Tigrana.
Im zweiten Akt befinden wir uns am Rand einer ›Orgie‹, die im ›prächtigen Palast‹ Edgars stattfindet, ohne daß wir erfahren, wie er zu diesem gekommen ist. Tigrana besingt in einem Trinklied mit Chor den Becher (den Rausch also) als Symbol des Lebens und stellt ihn den Lippen (also der Liebe) gegenüber. Edgar aber ist dieses Treibens müde und läßt sich auch von der lockenden Tigrana nicht mehr halten – erst recht, als überraschend Frank mit einem Trupp Soldaten erscheint und Edgar nicht weniger überraschend seiner Sympathie versichert. Edgar erkennt seine geistig-moralische Rettung im Kampf für das flandrische Vaterland gegen den Angriff Philipps von Frankreich und begibt sich in denselben, während die zurückbleibende Tigrana schwört, daß Edgar entweder ihr oder dem Tod gehören müsse.
Der dritte Akt spielt zwei Tage nach der Schlacht von Courtrai im Jahr 1302, wo die Flamen ein französisches Okkupationsheer schlugen. Er beginnt mit einem Trauerzug für den angeblich als Held gefallenen Edgar, den Frank (rühmend), Fidelia (trauernd) und das Volk (überhaupt) lobpreisen. Aber ein Mönch mischt sich ein: Habe Edgar nicht sein Haus angezündet, sei er nicht mit Tigrana auf und davon gegangen, sei er nach göttlichem und menschlichem Gesetz nicht ein Verworfener? Das wankelmütige Volk bestätigt das und ist sofort bereit, den gerade gerühmten Helden nun zu verdammen. Allein Fidelia verteidigt ihn, weil sie ihn liebt. Und damit rührt sie wiederum die Herzen der Menge zugunsten ihres Edgar. Dann aber tritt Tigrana auf, beschreibt ausführlich ihre Schönheit und ihre Freude darüber, daß sie lebt, während der treulose Edgar tot ist. In einem anschließenden, ziemlich zusammenhanglosen Terzett mit Frank und dem Mönch wird die Frage erörtert, ob Edgar gar das Vaterland für ein Schmuckstück verraten habe. Voller Wut reißen die Soldaten den Sarg des entzauberten Helden auf und finden ihn leer, worauf der Mönch sich als lebendiger Edgar zu erkennen gibt und als erlöst empfindet: Man fragt sich einigermaßen ratlos, wovon, wozu oder weshalb erlöst. Fidelia zeigt nun unbegreiflicherweise noch immer ihre Liebe zu Edgar, der aber flieht vor der empörten Menge.
Im vierten Akt trauert Fidelia ihrem erneut entschwundenen Liebsten nach und spricht sich darüber des längeren mit Vater und Bruder aus. Plötzlich jedoch kehrt Edgar zurück, erklärt ihr nun endlich seine Liebe und seine Absicht, ordentlich zu heiraten. Als er Fidelia nach einem ausführlichen Duett verlässt, um den Plan sofort in die Tat umzusetzen, taucht Tigrana auf und tötet Fidelia, die bei Edgars Rückkehr mit dem Hochzeitszug nur noch ›Mein Edgar!‹ singen kann und ›Ich liebe dich!‹, bevor sie stirbt. Während Edgar, Frank und Gualtiero verzweifelt sind, schleppt das Volk Tigrana zum Schafott.«
II
Lehrjahre des Herzens
Raimondo Franchetti wäre kein typischer italienischer Vater jener Zeit, wenn er seinem Erstgeborenen nicht auch aus der Ferne eine diskrete und stets gutgemeinte Überwachung zukommen ließe. Gerüchte sind zu ihm gedrungen, denen zufolge sich Alberto verliebt habe, weit unter seinem Stand. Das läßt in dem Baron die Alarmglocken läuten, er schickt seinen Sekretär Manetti in die bayerische Hauptstadt, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Offenbar hat den Baron ein wohl anonymes Schreiben erreicht, das den Sohnemann anschwärzt und ihm allerhand Ausschweifungen nachsagt. Raimondo Franchetti hatte zuvor einen seiner Domestiken, Gregorio, beauftragt, Alberto in München zu bedienen und ihm auf die Finger zu schauen, doch es scheint, als hätte Alberto jenen Gregorio entweder auf seine Seite ziehen können, denn Gregorio berichtet nur Positives, oder aber Alberto führt tatsächlich ein mustergültiges Studentenleben. Manetti, der Sekretär, kommt ein paarmal überraschend zu Besuch in der Brienner Straße 46, wo Alberto mehrere Zimmer in Untermiete bewohnt, zusammen mit zweien seiner Lieblingshunde. Und jenem Gregorio. Und, wie Manetti leider feststellen muß, einer Frau. Wir wissen nicht, wie jene Frau hieß, nur ihr Vorname, Lina, ist bekannt. Sie muß ein einfaches Mädchen gewesen sein, angeblich eine Mützenmacherin. Alberto, zur Rede gestellt, wiegelt ab. Nein, Lina übernachte so gut wie nie bei ihm, sei nur manchmal tagsüber hier, eine Bekannte sei sie, mehr nicht. Und als Manetti daran nicht recht glaubt, gesteht Alberto ein, sie sei, nun ja, eine Frau für gewisse Bedürfnisse, die dafür auch regelmäßig bezahlt werde. Dieses Eingeständnis überzeugt Manetti; er telegrafiert am 8. Oktober 1883 an seinen Auftraggeber:
Sache von keinerlei Bedeutung. Pietro willigt ein sofort zurückzukehren. Extravaganz. Von seiten der Familie der Virginia keine Komplikationen möglich. Bleibe bis morgen um mich von der Beendigung zu überzeugen. Manetti
Noch am selben Tag schickt er ein weiteres Telegramm, offensichtlich auf eine genauere Nachfrage Franchettis hin:
Paolo versichert dass es bei der vorübergehenden Extravaganz Virginia mehrmals zu Zahlungen gekommen sei. Pietro ist keine Verpflichtung eingegangen keine Beziehung kein Gefühl. Er zahlt wie andere bezahlen und bezahlen werden. In zwei Tagen ist diese Angelegenheit erledigt. Manetti
Für alle Beteiligten werden Decknamen verwendet. Alberto ist »Pietro«, der Diener Gregorio ist »Paolo«, Lina wird mit »Virginia« umschrieben. »Extravaganz« ist offenbar ein Euphemismus für den Umgang mit einer Prostituierten.
Alberto sieht sich veranlaßt, selbst an seinen Vater zu schreiben.
München, 9. Oktober 1883
Mein lieber Papa,
Du mußt ein paar unruhige Tage gehabt haben, und ich hatte meinerseits nicht weniger Kummer dank einer bösartigen Person, die glaubte, Deine Sympathie zu gewinnen, indem sie Dir alarmierende Dinge über mich schreibt, die jeder Grundlage entbehren. Ich glaube, Du weißt, wieviel Du mir bedeutest, ich glaube auch, daß Du mich gut genug kennst, um zu wissen, daß ich nicht dazu fähig wäre, die Last einer Lüge mit mir herumzuschleppen. Folglich kannst Du sicher sein, daß ich, wenn ich, aus welch seltsamen Umständen auch immer, irgend etwas täte, was schwere Konsequenzen nach sich zöge, ich es Dir beichten würde, ohne die Hilfe Dritter zu beanspruchen. Im vorliegenden Fall überlasse ich Manetti die Aufgabe, Dir zu erklären, was vorgefallen ist. Ich selbst begnüge mich damit, Dir für den Beweis Deiner Zuneigung zu danken, und daß Du mir einen Menschen wie Manetti geschickt hast, um mich aus einem Schlamassel zu retten, in den Du mich verwickelt glaubtest, und welcher, zu meinem Glück, gar nicht existiert. Ich komme nicht umhin, Dir zu gestehen, daß ich leichtsinnig war und von daher zugeben muß, doch ein wenig Ärger zu haben. Du wirst mir verzeihen, hoffe ich, daß ich nun nicht sofort zu Dir aufbreche, wenn du erfährst, daß man am Mittwoch hier den Tannhäuser gibt und morgen eine Vorlesung Rheinbergers stattfindet, bei der meine Anwesenheit absolut notwendig ist.
Verzeih mir, ich bitte Dich, für jenen Teil der Sache, den ich verschuldet habe, für die Besorgnis, die ich verursacht habe, und empfange einen Kuß der Liebe von Deinem Sohn Alberto
Am selben Tag trifft bei Raimondo ein weiteres Telegramm Manettis ein:
Virginia abgereist mit 500 Mark bezahlt. Morgen abend Tannheuser unmöglich Pietro von hier wegzubringen. Er wird eine Fastenkur machen. Manetti
Danach hat Alberto erst einmal seine Ruhe. Er drückt sich in den kommenden Wochen dank immer neuer Vorwände erfolgreich darum, nach Italien zu reisen. Lina, die sich von Manetti eine einmalige Abfindung von fünfhundert Mark hat zahlen lassen, ist aufs Land zu Verwandten gefahren und kehrt zurück, sobald Franchettis Sekretär den Abendzug nach Verona bestiegen hat. Eine Prostituierte oder auch nur Gelegenheitsprostituierte ist sie sicher nicht gewesen. Alberto wird, viele Jahrzehnte später, seiner Tochter Elena erzählen, daß die junge Mützenmacherin aus München vielmehr die einzige wahre Liebe seines Lebens gewesen sei. Und er wird noch oft seine Zeit, seine noble Herkunft und seinen Vater verfluchen, die ihn alle dazu zwangen, jene nicht standesgemäße Liebe vor der Welt zu verleugnen. Erst sehr spät, zu spät, gibt er sich endlich selbst die Schuld. Anders als seine jüngeren Brüder, die mutig mit dem Vater und den lästigen Konventionen ihrer Ära gebrochen haben, kann er sich nie dazu durchringen, das Familienband zu durchschneiden, den Schatten des Vaters abzustreifen. Andererseits wird er bei weniger romantischen Gemütern zum Teil auch Verständnis finden. Er ist, unter anderem, ein standesbewußter italienischer Baron, der künftige Erbe eines riesigen Vermögens und, nebenbei, ein junges musikalisches Genie im Werden. Bei aller Liebe – Lina muß im System jener monetären/gesellschaftlichen/karrieristischen Abhängigkeiten auch als Störfaktor empfunden worden sein. Irgendwann in dieser Zeit wird sie zudem noch schwanger. Viel mehr ist nicht überliefert, die erhaltenen Dokumente sprechen nur an einer Stelle von dem »Problem mit dem Münchner Mädchen und ihrem Kind«. Doch es läßt sich leicht ausmalen, wie Alberto reagiert haben muß, weil er aus seinem Denken heraus gar nicht anders reagieren konnte. Er wird Lina gesagt haben, daß sie stets auf seine Unterstützung vertrauen könne, undenkbar aber sei, daß er jemals ihr Kind als seines anerkennen werde, ansonsten er vom Vater sicher enterbt und verstoßen werden würde. Der Mützenmacherin Lina bleibt objektiv nicht viel anderes übrig, als sich mit diesem Schicksal zufriedenzugeben. Immerhin werden sie und ihr Kind, manches spricht dafür, daß es eine Tochter war, zwar gesellschaftlich geächtet, aber durchweg gut versorgt sein. Denkbar ist, daß Alberto Lina einige Jahre später eine Passage in die USA bezahlt hat, wo sie, als junge Witwe deklariert, ein ganz neues Leben beginnen konnte. Für vermögende Männer war dies damals ein sehr beliebter Weg, sexuelle Fehltritte zu kaschieren und aus der (Alten in die Neue) Welt zu schaffen. All das bleibt Spekulation. Fakt hingegen ist, daß Alberto und Lina ihre frische Liebe noch einige Wochen genießen durften. Sehr zum Mißfallen von Agathe Haggenmüller, Albertos Hauswirtin. Darüber, was Ende November in München genau vorfällt, gehen die Berichte auseinander.
Alberto schreibt an seinen Vater am 26. November 1883:
Mein lieber Papa,
ich danke Dir aus vollem Herzen für Dein Telegramm, das mir so gutgetan hat. Wahrscheinlich war es nur eine Drohung, in jedem Fall, wenn Du den Brief, den Dir meine Hauswirtin möglicherweise schreiben wird, weiter zur Münchner Polizeibehörde sendest, soll sich diese damit beschäftigen, um die Angelegenheit klarzustellen. Ich ziehe heute für einige Tage ins Hotel Marienbad, weil jene Hauswirtin die Wohnung noch nicht verlassen hat, danach werde ich die Wohnung direkt vom Hauseigentümer mieten, und dann wird Schluß sein mit all den Belästigungen durch jene Dame. … Ich danke auch tausendfach für die schöne Pfeife, die Du mir geschenkt hast, und ich werde mein Möglichstes tun, sie anständig anzuschwärzen. All die Dinge in letzter Zeit haben mich mein Studium etwas vernachlässigen lassen, aber nun, da ich mir Deiner Unterstützung sicher sein kann, werde ich alles gewissenhaft nachholen. Tausend Küsse von Deinem Alberto
Und zwei Tage später schreibt er nach Canedole:
… Ich wohne provisorisch noch immer im Hotel Marienbad, aber wahrscheinlich kehre ich am siebten Dezember zurück in jene Wohnung, die meine ehemalige Hauswirtin nun endgültig verlassen muß, nachdem ihr vom Eigentümer gekündigt wurde. Danach gibt es keine Padrona mehr für mich, und billiger wird es auch. Ich danke sehr dafür, daß Du meine ausstehenden Rechnungen bezahlt hast. Ich habe momentan keine anderen Schulden als die bei einem Schneider, bei dem ich einen Anzug bestellt habe. Könntest Du das bitte noch übernehmen? Ich hoffe, in Bälde mein Oratorium zu beenden, das dann noch in diesem Jahr im Konservatorium aufgeführt wird. Rheinberger lobt mich in den höchsten Tönen.
Am 29. November erhält Raimondo Franchetti tatsächlich einen Brief von Agathe Haggenmüller:
Eure Exzellenz,