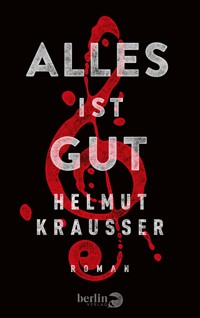7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
UC, Ultrachronos, bezeichnet eine Wahrnehmung, die angeblich unmittelbar vor dem Tod eines Menschen geschieht: Das ganze Leben läuft wie ein Film in extremem Zeitraffer vor einem ab. Darum geht es in diesem Buch: um den Erinnerungsfilm eines Mannes, der nur noch wenige Augenblicke zu leben hat. Ein Dirigent von vierzig Jahren, reich verheiratet, mit glänzenden Karriereperspektiven, wenige Monate zuvor noch eine scheinbar unerschütterliche Existenz. Vielleicht. Vor neunzehn Jahren. Aber daran erinnert er sich nicht mehr. Er trifft auf einen Mann, der merkwürdig genau über ihn Bescheid weiß. Es ist ein Schriftsteller, und in dessen neuestem Werk ist dem Dirigenten eine unheimliche Rolle zugedacht ... Helmut Kraussers «UC» arbeitet mit den Mitteln des Kriminalromans, führt aber auf seinen verschlungenen Pfaden viel weiter, nämlich in die Grenzbereiche unserer Existenz. «Mit ‹UC› hat Helmut Krausser die Grenzen von Sein und Dasein ebenso gesprengt wie jene der Dimensionen.» (Der Spiegel) «Mehr kann man von Literatur nicht verlangen.» (Frankfurter Rundschau) «Ein gut abgehangenes Meisterwerk.» (Walter Moers) «Ein brillantes Vexierspiel von enormer Größe.» (Bayerischer Rundfunk) «Ein Mann, der gleich stirbt, sieht seinen Lebensfilm. Tiefgründig geschrieben, spannend.» (Bild am Sonntag) «Hochintelligent!» (Süddeutsche Zeitung) «Ein phantastischer Roman – ein großer Wurf.» (Focus)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Helmut Krausser
UC
Roman
Unter Zuhilfenahme eines Märchens von H. C. Andersen
Preludio/Postludio
6.30 Der Morgen überzieht die Hausmauern mit Pink-, Orange- und Kupfertönen, breitet blinde Spiegel auf dem Wasser aus. Unbewegtes Wasser, das am Horizont bläut, in der Bucht noch schwarz ist. Die erloschenen alten Straßenlaternen gleichen Urnen, zur Warnung auf eiserne Masten gespießt.
Ich sitze im Fensterkreuz meines Hotelzimmers und rauche, tippe Asche zwei Stockwerke hinunter, habe seit Stunden den Wein dieser Insel aus einem Zahnputzglas getrunken und fühle mich zu nichts verpflichtet, als sei das Wichtigste erledigt.
6.49 Die Steinplatten des Hafenkais grenzen sich langsam voneinander ab mit Furchen, in denen der Rest der Nacht versickert. Ein alter Mann nimmt Platz auf einer der Bänke, blickt aufs Meer hinaus. Er wiegt den Kopf, betrachtet den heraufkommenden Tag nickend, als Geschenk.
Ich habe ihn nicht kommen sehen. Plötzlich war er da, wie aus dem Nichts. Er muß mit diesem Ort sehr vertraut sein und im Lauf seines Lebens überallhin Abkürzungen entdeckt haben. Seine Existenz und mein Sehen müssen sich in diversen Frequenzen bewegen, die sich erst dann überlagern, wenn Stillstand im Bild erreicht wird.
War sein Leben die Suche nach der günstigsten Abkürzung? Oder die nach dem längsten Schleichweg? Ich fühle, wie alles in mir den dösenden Greis bewundert und verachtet.
7.01 Katzen schleichen über das Pflaster. Bewegung gewordene Erwartung. Metallene Bootsböden knirschen auf dem Strand, fette Männer laden Fischkisten aus. Junge Männer schütten aus Eimern zerstoßenes Eis auf die glitzernden Leiber.
Ich bin an fast jedem Morgen zu diesem kleinen Markt gegangen und habe etwas gekauft. Obwohl mir keine Feuerstelle zur Verfügung steht. Ich wollte das Meeresgetier sorgfältig betrachten, ohne die Händler danach zu enttäuschen. Ich spreche kein Griechisch, und vermute hinter jedem härter klingenden Wort einen Fluch.
Ein Kellner wischt mit einem Handtuch die Tische des Cafés ab, und zwischen den Dächern und Fensterläden verschwinden die letzten kupferfarbenen Schatten.
7.08 Erstmals beginne ich mit dem Gedanken zu spielen, selbst beobachtet zu werden.
Von einem der anderen Hotelfenster vielleicht. Durch die Ritzen der Rolläden. Verändert sich dadurch mein Habitus? Ja. Ich zittere. Endlich möchte ich die Dinge abgetrennt von Wirkung und Bedeutung sehen.
7.30 Die dünnen, hart aufgetragenen Lichtschichten der Morgendämmerung dringen in die Hauswände ein, wie Salbe in Haut. Einen kurzen Moment noch glänzen die Mauern, bevor ihr makelloses Weiß matt wirkt und für den Rest des Tages die Last der Sonne stemmen muß.
7.45 Jede Summa ist Selbstbetrug, auch jede Momentaufnahme ist banal. Nichts taugt als Gleichnis eines Lebens. Das Große stirbt, wenn wir sterben.
In der Ferne steht, an der Hafeneinfahrt, ein Leuchtturm, am Ende des längsten Piers, dort wo bald die ersten Angler hocken werden. Seine Scheinwerfer wurden vor Jahren schon abmontiert. Und er leuchtet doch.
Schimmernd feuerfarben steht er da und fängt den Blick. Das einzige wehrhafte Gebäude weit und breit. Sein Fundament ist dick ummauert und fensterlos. Vielleicht haben fünfzehn bis zwanzig Personen darin Zuflucht gefunden. Der schlanke Turm hebt sich daraus hervor und mündet, sein Inneres muß aus einer engen Wendeltreppe bestehen, in einen winzigen Signalraum. Ganz oben hängt, in einem Käfig, der an eine Volière erinnert, eine verrostete Glocke.
Fünfzehn bis zwanzig Personen. Die wichtig sind. Mehr braucht kein Leben. Tragende Rollen. Ich zähle auf. Vier, fünf Namen fallen mir sofort ein. Die anderen mit Vorbehalt. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sie beurteilt, waren sie wichtig. Oder auch nicht. Einige waren überaus wichtig, obgleich sie gestorben sind, lange bevor ich geboren wurde. Zählen die auch? Hab ich sie mißbraucht? Sie luden dazu ein.
Der Leuchtturm. Ich nehme ihn als Sinnbild. Das Fundament. Der Raum, oben. Die Glocke. Die Angler. Das gefällt mir. Bravo! Ich öffne die letzte Flasche. Bravo!
8.12 Fangen wir an mit dem Anfang. Wo ist der?
Der Anfang ist da, wo das Banale aufhört. Ist somit Ansichtssache, und womöglich nicht vorhanden. Ich wäre jetzt so gern betrunken. Gott, o Gott, ich wärs so gern. Fünf Meter unter mir liegt das Zahnputzglas. Zersplittert. Es ist mir aus der Hand geglitten. Ich habe seinen Sturz hinab über Stunden beobachten dürfen.
Hinter mir, im Hotelzimmer, stehen fünfzehn bis zwanzig Personen. Einige sind tot. Sicher beobachtet man mich.
Erstes Buch
Es gibt unzählige dunkle Körper neben der Sonne zu erschließen, – solche, die wir nie sehen werden. Das ist, unter uns gesagt, ein Gleichnis; und ein Moral-Psychologe liest die gesamte Sternenschrift nur als eine Gleichnis- und Zeichensprache, mit der sich vieles verschweigen läßt.
Jenseits von Gut und Böse
1
Irgendwo muß man anfangen. Es ist leicht. Irgendwann, mit irgendwas. Man kann den Anfang später streichen, wenn sich die Geschichte erklärt hat.
Irgendwo, mitten im Leben. Meinem.
Manche sortieren ihre Vergangenheit nach Städten, in denen sie lebten, nach Projekten, die sie betrieben, oder nach Stufen eines inneren Reifeprozesses. Wenn ich an irgendeine zurückliegende Zeit denke, ist sie stets mit dem Namen der jeweiligen Frau verbunden, mit der ich zusammen war, zusammen sein durfte. Einige haben mich geliebt, einige habe ich geliebt.
Das Ausmaß der Schnittmenge entscheidet über so vieles.
Erste Symptome? Vieles kommt dafür in Frage. Es gab eine zeitliche Grauzone nicht eindeutiger Phänomene. Das Meiste von dem, was in Frage kommt, habe ich vergessen, oder kann es nicht mehr nachvollziehen; es ging zu unscheinbar vor sich. Beweisbar ist nichts. Meinem Gefühl nach läßt sich der große Umbruch kaum auf einen Zeitpunkt festlegen, er kam schleichend. Lange noch konnten die Symptome mit Vernunftkonstrukten erklärt und aufgefangen werden.
2
Für mein Londoner Debut standen Strauss’ Metamorphosen und Bruckners Neunte auf dem Programm. Entrückungsmusik, mit mehr als einem Bein im Jenseits. Ich hatte mich vehement gegen eine Pause zwischen den beiden Stücken ausgesprochen, erfolglos.
Die Pause sei angeblich schon deshalb nötig, um jenen, deren Aufnahmefähigkeit für beide Programmpunkte nicht ausreiche, eine Möglichkeit zu geben, den Konzertsaal ohne Störung zu betreten bzw. zu verlassen. Meine Forderung, die Türen während des Konzerts geschlossen zu halten, wurde als anachronistisch empfunden, gelangte durch eine Indiskretion in die Tagespresse – und einige Kritiker bereiteten sich darauf vor, mich energisch abzustrafen, schilderten in den Vorabberichten meine Taktführung als romantisch verbrämt, elegisch bis schwülstig, dann wieder nordisch-arisch-karajanisch (was immer das sein soll), Attribute, die mir allesamt fern liegen. In gewissen majuskelverliebten Schmierblättern wurde sogar vor dem gefährlichen Sauerkraut-Mystagogen gewarnt, der Strauss und Bruckner den Briten in einer Art neogroßdeutscher, in den Grenzen von ’42 angesiedelten Interpretation nahebringen wollte. Erstaunlicher Vorwurf ausgerechnet bei einem zart-tristen Werk wie den Metamorphosen, geschrieben im Herbst ’45 quasi auf dem Schuttberg der deutschen Kultur. All dieser Wahnsinn, nur weil ich dringend, doch höflich, darum gebeten hatte, auf eine Pause zu verzichten, Pausen zerstören meine Konzentrationsfähigkeit – und beide Werke zusammen erreichen gerade einmal Spielfilmlänge, also bitte.
Das Londoner Orchester empfing mich kühl, wie einen Parvenü, der sich mit chauvinistischen Provokationen nach oben fuchteln wollte. Über den Proben lag ein irrationales, unausgesprochenes Mißtrauen. Als ich die Entfernung eines Posaunisten forderte, der meinem Gehör nach nur über eine Lotterie seinen Platz im Bläsertrakt ergattert haben konnte, glitt die Diskussion mit dem Konzertmeister in gewerkschaftliche Dimensionen ab, mir wurde vorgeworfen, den Halbgott im Frack zu geben, die Zeiten eines Toscanini seien passé. (Ich dirigiere so gut wie nie im Frack, das nebenbei.) Der wohl nie mehr zu tilgende Minderwertigkeitskomplex mancher, ich sage mancher Briten, über zuwenige Komponisten von Wert zu verfügen, schlug sich bis in die zweiten Geigen nieder. Möglicherweise habe ich mich hier und da ungeschickt benommen. Wie dem auch sei, die Proben verliefen nicht nur in klanglicher Hinsicht unharmonisch. Ich setzte mir, schlimm eigensinnig, eine hübsche Klarinettistin in den Kopf, es kam zum großen Krach. Eine aktualisierte, unbanale Deutung von Strauss’ und Bruckners Werken erschien nicht länger realisierbar, und ich erschien nicht mehr zur fünften Probe, trieb mich stattdessen in einem Sohoer Pornokino herum. Was gleich darauf die Presse durch mich selbst erfuhr. Wenn schon Skandal, dann richtig. Ich posierte für die Kameras mit einer fast zahnlosen Stripperin im Arm. Gab ein Interview, in dem es hieß, daß die zahnlose Stripperin blasfertiger sei als etwaige Posaunisten gewisser ortsansässiger Orchester. Man kündigte prompt meinen Vertrag, die Medien schenkten mir enorme Aufmerksamkeit, mein Publikum würde fortan vermutlich jugendlicher sein, ich war frei. Nahm an, daß der Skandal meiner Reputation nicht schaden würde, im Gegenteil. Derlei Konflikte besitzen ihre eigene Dynamik, jedenfalls war alles besser, als das geplante Konzert Wirklichkeit werden zu lassen. London lag mir auf gewisse Art zu Füßen, auch wenn sich dadurch die Bißspuren in meinen Waden vervielfachten. Na gut. In einer Neidgesellschaft gilt bloßes Können bereits als Arroganz. Vom Mittelmaß exzentrisch genannt zu werden, ist natürlich. Ich würde mich selbst eher experimentierfreudig nennen.
Obwohl mir viel daran liegt oder lag (man muß inzwischen zum Imperfekt greifen), Musik, die ich liebe, der Welt so zu präsentieren, wie niemand sie ihr zuvor präsentiert hat, lag mir fast genausoviel daran, beachtet, gefeiert und von schönen Frauen sexuell umsorgt zu sein. Die Gleichzeitigkeit künstlerischer Seriosität wie hemmungsloser Triebkraft stellt in den Augen manch sonderbarer Zeitgenossen noch immer einen Widerspruch dar, mir unbegreiflich. Einige Kommentare kanzelten mich als geil-arroganten Prussian Herrenmensch ab (ich komme aus München), andere, wohlwollendere, erinnerten an Klaus Kinskis Eskapaden, damit war die Sache bereits so gut wie gerettet, meine Zukunft schien gesichert.
Die erwähnte Klarinettistin habe ich schließlich auch noch bekommen, es kostete 20000Pfund, nie war ein tiefgefrorener Fisch überbezahlter, weißgott. Egal. Ich dachte darüber nach, ob ich vielleicht doch in Talkshows gehen sollte, legte mir ein künftiges Programm zurecht, das besser zu meinem neuen Image passen würde, eruptiver, erotischer. Strawinskys Sacre zum Beispiel.
Bruckners Neunte und Strauss’ Metamorphosen standen meinem Herzen viel näher, konnten indes noch auf mich warten. Solche im Ruch des Vergeistigten stehende Werke nimmt das Publikum älteren Interpreten viel kritikloser ab. Ich hatte einen tollen Beruf. Unabhängig davon, wie ich mich geistig fühlte, war meine irdische Hülle für die eines Dirigenten geradezu jünglingshaft. Mit knapp Vierzig wird man in diesem Betrieb kaum ernstgenommen, und egal auf welche Weise man Bruckners Neunte dirigiert – sollte es vom Gehörgängigen nur minimal abweichen, wird man als jugendlicher Revoluzzer gehandelt. Jetzt wollte ich nichts weiter, als drei Wochen Ruhe und Rauschmittel genießen, wollte wehmütig dabei an Claudia denken, die mir verlorengegangen war – und machte mich in Annabelles Apartment breit, das direkt im Herzen South Kensingtons liegt.
Annabelle – lesbischer Sopran, unsere Freundschaft basierte auf gegenseitigem beruflichem Respekt – sang noch den Rest des Monats in New York. Ich mochte ihre verwinkelte Wohnung. Ein süßes kleines, weiß und rot und mit viel Art Deco (aber auch mit Lavalampen) eingerichtetes Apartment, erster Stock Altbau, zwei Gehminuten vom Park entfernt. Ich fütterte Grauhörnchen, die einem dort an den Hosenbeinen hinaufklettern, gönnte mir alle drei Tage eine Luxusnutte vom Escort-Service, ließ indisches oder vietnamesisches Essen kommen, studierte ein wenig Partitur. Kokain nahm ich in diesen Wochen keines. Kokain alleine zu nehmen, bringt nicht viel mehr als eine starke Tasse Kaffee. Meiner Laune nach wäre die Reihe der noch auszuprobierenden Genußgifte am Opium gewesen, aber ich kannte niemanden in London, der mir welches besorgen konnte. Also trank ich exzellenten Rotwein und las Rilkes Duineser Elegien. Die meiste Zeit war ich nüchtern, um das nur klarzustellen. Gesundheitlich ging es mir gut, von leichten Problemen mit dem Rücken abgesehen, ich bin von robuster Natur; mit meiner Frau Laura telefonierte ich jede Woche, fast ohne zu streiten, entdeckte sogar eine gewisse Sehnsucht wieder, mit ihr von unserem Kanapee am Las Canteras aus das kanarische Meer zu betrachten, vorausgesetzt, daß Laura still bliebe. Von Einems Dantons Tod, eine der besten, dramatischsten und unterschätztesten Opern des zwanzigsten Jahrhunderts, hätte meine nächste Verpflichtung werden sollen, zur Saisoneröffnung in Stuttgart, aber dazu kam es nicht mehr.
Ich hatte ausnahmsweise viel Zeit, über meine Wünsche, meine Karriere, mein Älterwerden und das Älterwerden der Welt überhaupt, nachzudenken. Vielleicht genügte allein schon dieser Umstand, um die folgenden Geschehnisse ins Rollen zu bringen. Es hieße im Umkehrschluß, daß der übliche Arbeitstrott als betäubender Mechanismus womöglich ausgereicht hätte, um Dinge, die weit weg von mir ihren Lauf nahmen, gar nicht erst geschehen zu lassen. Das klingt irrational, aber ich will es nicht völlig von der Hand weisen. Ich bin nicht mehr in der Position, um irgendetwas von der Hand zu weisen.
3
Märchenhaft fern, doch im Saum, den die Erinnerung streift, den nur sie allein zugleich zärtlich und distanziert abzutasten weiß, in dieser scheuen, stupsenden Berührung so nah und intensiv wie wenig sonst. Eine zu Grabe getragene Welt steht auf, habe ich wirklich so lange gelebt, daß mumifizierte Welten in mir Platz gefunden haben? Mit einem Arom, mit dem Stützrad einer Lichtstimmung, wird im Bruchteil einer Sekunde so viel abgerufen, angedeutet, neu zum Leben erweckt. Und bleibt diffus, sperrt sich gegen die Begehung, als gäbe es eine Pietät, die das verbietet.
Als wäre da etwas gewesen, archiviert in einer Wabe, deren Membran man mit dem Finger nur streicheln, nicht durchstoßen kann. Was in dieser Wabe eingeschlossen liegt, muß ungeheuer groß gewesen sein. Da war ein anderes Ich, das so und so gewesen ist, so und so gehandelt hat. Und Menschen hat es gegeben, deren Leben mit jenem Anderssein einmal verknüpft war, die man fragen müßte, wie das alles genau vonstatten ging, mit ihnen und mir. Sie würden mich allerdings belügen, weil sie vom Geschehenen genauso wenig wüßten wie ich selbst.
4
Zum Beispiel, als ich vor drei Jahren – ausgerechnet in London – eine Telefonzelle betrat. Nicht in erster Linie, um zu telefonieren. In Londoner Telefonzellen pinnen an den Wänden Werbepostkarten von Nutten, die darauf ihre körperlichen Vorzüge, ihre Spezialitäten und Telefonnummern mitteilen. Diese Karten werden manchmal, immer seltener allerdings, von der Polizei entfernt, jedoch sofort durch neue ersetzt. Die meisten Nutten halten sich bezahlte Kartenpinner, oft Jugendliche, die so ihr Taschengeld aufbessern und damit sicher mehr verdienen als beim Zeitungaustragen.
Ich telefonierte gerne in Londoner Telefonzellen. Steckte nebenbei ein paar der Karten ein, Bilder von Frauen, die mir gefielen. Im Lauf der vier Wochen, die ich auf der Insel verbrachte, war eine kleine Sammlung entstanden. Es war Februar, ein sehr milder Februar, ich betrachtete, während mir ein Besetztzeichen im Ohr klang, die zwei Dutzend Karten, die da hingen – eine junge Frau versprach zärtliche Zuwendung, zeigte sich als Krankenschwester verkleidet, was sexy aussah und einer meiner liebsten Phantasien entgegenkam. Als ich das Foto näher betrachtete, fiel mir auf, daß das Gesicht dem eines Mädchens glich, eines Mädchens aus meiner Schulzeit, Iris, die Ähnlichkeit war verblüffend. Die Nutte sah exakt so aus, wie Iris vor zwanzig Jahren ausgesehen hatte, in der Parallelklasse unsres Abiturjahrgangs. Iris galt als kühl und zickig und streberisch, würdigte mich nie eines einzigen Blickes. Ich nahm die Karte und rief an, wollte Iris ficken, endlich, nach zwanzig Jahren, wenn auch nicht Iris direkt, so doch jemanden, der ihr verteufelt ähnlich sah. Ich fürchtete, enttäuscht zu werden, denn nicht immer – eigentlich eher selten – ähneln die Telefonzellenphotos tatsächlich der Frau, die man bei einem Treffen zu Gesicht bekommt. Eine Stimme meldete sich mit Nancy. Ich sprach mit Nancy und ließ mir ihre Adresse geben. Sie sprach mit leichtem Akzent, ganz leichtem Akzent, konnte niederländisch, konnte aber auch deutsch sein. Und dieser leichte, winzige Akzent trieb mich zu der völlig blödsinnigen Phantasie, Nancy könnte vielleicht Iris sein. Was Unsinn war, Iris mußte so alt sein wie ich, mindestens achtunddreißig – und das Photo zeigte eine Frau von höchstens fünfundzwanzig. Mit Kosmetik und günstigem Licht läßt sich einiges glätten und mildern, soviel aber definitiv nicht, und überhaupt: Iris hatte, das war das Letzte, was ich von ihr gehört habe, ein Medizinstudium begonnen – wie sollte ihr Weg nach London und auf den Strich geführt haben? Nur: vorstellbar war eben alles, und ich wollte mir ja unbedingt, mit aller Kraft, vorstellen, gleich, in zehn oder fünfzehn Minuten, nicht Nutte Nancy, sondern Zicke Iris zu vögeln, die stolze, hochnäsige Iris mit den langen blonden Haaren.
Ich klingelte an der Tür im dritten Stock eines schönen alten Hauses nahe der Bayswater Road, Notting Hill, teuerste Gegend, Nancys Preise lagen dementsprechend hoch, Minimum, das hatte sie mir am Telefon gesagt, hundert Pfund für die halbe Stunde. Sie machte auf, winkte mich herein. Ihre Haare waren lang, länger als – damals, hätte ich beinahe gesagt, aber die Ähnlichkeit war nicht nur vorhanden, sie war sogar größer, als es das Photo versprochen hatte. Nancy war schön, hinreißend schön, Ende Zwanzig, elegant, hochklassig wie die Einrichtung ihres Apartments, fast alle Möbel in Pastellfarben oder Weiß, passend zu den Krankenschwesteraccessoires.
Ich folgte Nancy ins Schlafzimmer und fragte, auf englisch, ob ich sie Iris nennen dürfe. Sie sah mich an, erschrocken, verstört, verärgert, etwas dazwischen, und sagte: «No.»
«Why not?»
«You have to go now.» Sie zischte es in einem ganz bedrohlichen, völlig unangebrachten Ton.
Ich zeigte ihr Geld. Das Doppelte von dem, was sie für einen Standardfick hatte haben wollen.
Sie wiederholte, daß ich gehen müsse. Sah mich nicht an dabei.
Und ohne lang zu überlegen, fragte ich sie auf deutsch:
«Bist du Iris? Aus München?»
Und blitzschnell, und ich meine wirklich sehr sehr schnell, voller Wut und Wucht, ohne mir die geringste Möglichkeit einer Abwehr zu lassen, schlug sie mit der flachen Hand zu, es klatschte laut, es knallte, beides zugleich, das rechte Ohr nahm ein Klatschen wahr, das linke, getroffene Ohr ein Knallen, und in diesem Moment, einem furchtbar peinlichen Moment, wußte ich, daß Iris, jene Iris aus der Parallelklasse vor mir stand.
Ich wußte es einen Moment lang, dann wandte ich mich um, stürzte über die Treppe auf die Straße, und da bereits war jener Moment Vergangenheit und unhaltbar geworden, hatten sich alle verfügbaren Zweifel auf ihn gestürzt und ihn zerpflückt. Sie konnte es doch nicht sein. Dieses Gesicht, dieses allerhöchstens dreißig, beim besten Willen nicht achtunddreißig Jahre alte Gesicht, es konnte nicht jener Iris aus München, aus der Parallelklasse am Siegfried-Gymnasium gehören, das war praktisch undenkbar. Schon bastelte ich mir eine erste, notdürftige Erklärung: Nancy hieß wahrscheinlich, aus einem dummen Zufall heraus privat tatsächlich Iris – und fühlte sich verfolgt oder bedrängt, und vermutlich verstand sie gar kein Deutsch, hatte geglaubt, ich hätte etwas Unflätiges zu ihr gesagt, deshalb die Ohrfeige. Solche Sachen kommen vor.
Ich dachte drei oder vier Nächte lang darüber nach, beschloß dann, der Sache nicht weiter auf den Grund zu gehen, es gab ja nur diese eine sinnvolle Erklärung, und ich war ein strikt rationaler Mensch, der in präzisen Konstrukten dachte, von dessen Präzision auch beruflich einiges abhing. Bald fühlte ich nichts weiter als glimmenden, lodernden Zorn auf Nancy, die mir eine schöne Phantasie, einen späten Triumph, aus irgendeinem idiotischen Grund verdorben hatte. Mit einer Nutte, die mich mal geohrfeigt hat, kann ich nicht mehr entspannt schlafen, also wozu mir unnütz Gedanken machen. Ich vergaß, verdrängte sie.
Das geschah, wie erwähnt, vor gut drei Jahren. Vor ein paar Monaten habe ich versucht, Iris – bzw. Nancy – wiederzufinden. Aussichtslos natürlich, in einer Metropole wie London. Als ich jemandem aus der Rotlichtszene erklärte, daß ich eine Nutte namens Nancy oder Iris suche, die vor vier Jahren einmal in der Bayswater Road residiert hat, lachte er mich aus, zu Recht.
Iris, wenn sie es denn doch gewesen sein sollte, hätte mir bei meiner Suche nach der Wahrheit wohl kaum helfen können. Aber sie konnte mein Gesicht inzwischen vergessen haben, mich tarnt seit neuestem auch ein Bart – und ich hätte Iris wenigstens noch vögeln können. Das schon. Selbst wenn sie nur Nancy gewesen sein sollte. Warum nicht noch alles Schöne, das auf dem Weg liegt, mitnehmen? Selbst im Zustand der Verzweiflung. Gerade dann.
Dabei fällt mir Marita ein. Ich schreibe auf, was mir gerade einfällt, ohne Ordnung, aber vielleicht liegt dahinter ja doch eine Ordnung, die ich nicht kenne, ich schreibe hier und sehe aufs Meer hinaus und man könnte von mir Ordnung erwarten, eine Chronologie der Geschehnisse, eine Biographie, einen Werdegang, Daten, Verdienste, aber das entspräche nicht dem, was ich aufzeichnen will. Nicht daß ich wüßte, was ich aufzeichnen will. Es ist alles lächerlich geworden und das Gegenteil davon. Geht es darum, etwas festzuhalten? In einem ganz maßlosen Sinn geht es wohl darum.
5
Die Klarinettistin. Nur um das abzuhaken. Sie saß da, in Klarinettistinnenhaltung, mit steifem Kreuz und hohem Hals, alle Finger über ihr Instrument verteilt. Ein blasses Gesicht mit dünnen Lippen und blauen, leicht glasigen Augen. Das dunkle Haar zum langen Pferdeschwanz gebunden. Kombination, die mich wehrlos zurückläßt, was tragisch ist insofern, als sich dahinter selten entgegenkommende Geilheit verbirgt. Ich verschaue mich gern in Mauerblümchen, Graumäuse, Seelchen, Landschulfräulein und leicht unterernährte Strohhalmkauerinnen, deren gewagteste erotische Phantasie bereits aus Sex bei Licht besteht. Eine unsinnige Marotte, die mich hin und wieder heimsucht. Meine eigene Triebbefriedigung ist dabei nachrangig, es bereitet mir Genuß, solche leicht sächlichen Wesen zu verführen, der höchste Triumph besteht darin, ihnen Laute der Wollust zu entlocken.
Meine Strategie war bewußt geradlinig und simpel. Keine Kerzenlichtdiners, keine Rosen, keine Geschenke, keine selbstgeschriebenen Gedichte, nein. Dergleichen Umgarnungsscheiße finde ich clownesk und auf gewisse Weise respektlos. Sie macht beide Parteien zu Idioten, verbrämt ein Tauschgeschäft zur schwülstigen Abfolge klischierter Zeremonien. Ich bot ihr schlichtweg Geld. Ich sagte dieser Klarinettistin nach der Probe, im Dirigentenzimmer, unter vier Augen, aber mit zwei Körperlängen Abstand, daß sie einen enormen Reiz auf mich ausübe – fragte, klar und deutlich, wieviel es kosten würde, wenn sie mit mir ins Bett stiege. Sie sagte nichts. Ich meine, sie sagte nicht: nichts – sie sagte überhaupt nichts, sie schwieg und verließ das Zimmer.
Wer will, soll mich ein Schwein nennen. Gezwungen habe ich niemanden zu etwas.
Bald lagen auf ihrem Stuhl oder in ihrem Briefkasten kleine Zettel, mit Zahlen darauf und einem Pfund-Signet dahinter. Ich habe sie nie wieder angesprochen, es sei denn, als Leiter des Orchesters, und das nicht so oft, wie ich es hätte tun sollen, denn sie war keine besonders gute Klarinettistin. Wäre dieses blasse Mädchen zu mir gekommen und hätte sich die kleinen Zettel als sexuelle Belästigung verbeten, hätte ich sofort aufgegeben. Doch ab einem gewissen Punkt, das bilde ich mir wenigstens ein, war sie bereits neugierig, in welche Höhen die Zahlen auf den Zetteln noch klettern würden, von diesem Punkt an spielten wir ein Spiel, es fand zwischen Geilheit und Eitelkeit ein Ballwechsel statt.
Ist es denn so verdammungswürdig, Menschen zu testen, zu taxieren, ihre Korrumpierbarkeit auf der Geldskala festzulegen? Eine privilegierte Situation verpflichtet zu besonderen Formen der Ausschweifung. Es wäre Schlimmeres – auch Interessanteres – denkbar als meine eher sanften Experimente, indes fehlt mir dazu jede sadistische Neigung.
Eines Abends, mein Angebot belief sich mittlerweile auf 20000Pfund, kam die Klarinettistin in mein Apartment. Klopfte, ich machte auf, sie ging wortlos hinein und zog sich aus. Legte sich auf mein Bett. Hat nicht mal nach einem Scheck gefragt oder Bargeld, das gefiel mir, sie hielt mich offensichtlich für ein Schwein, aber zweifelte nicht daran, daß ich bezahlen würde. Vielleicht hatte das viele Nachdenken darüber, ob sie es mit mir machen sollte, einen gewissen dynamisch-erotischen Effekt gehabt, und sie hätte es zuletzt sogar umsonst mit mir gemacht.
Aber nicht sie lag auf meinem Bett, nur ihr Körper lag da, kein sehr begehrenswerter Körper, mit herausstehenden Rippen, ein schlecht frisiertes Gebüsch zwischen den Beinen, und die Augen dieses Körpers starrten an die Decke, verächtlich, ihr Blick versuchte sogar, sich gelangweilt zu geben. Doch ihre Knie zitterten leicht, alles in ihr war angespannt, ihr Körper glich einem festverschraubten Sarg, mit einer Scheintoten darin.
Neugier darauf, wieviel Geld es benötigt, diesen oder jenen Menschen zu kaufen, hat jeder, der Phantasie besitzt und um sein Gehirn keinen Bretterzaun hochgezogen hat. Die Demütigung ist keine Demütigung mehr, sie wird vom Preis nivelliert, den ganz allein die Probandin festsetzt.
Man mißverstehe mich nicht: Eine arme Klarinettistin im sauteuren London finanziell zu überreden, dazu gehört nichts, und ich würde Menschen verachten, die aus einem billigen Machtrausch ihre Erektion bezögen – aber ein solches Geschöpf zum Stöhnen und Keuchen zu bringen – das setzt Ehrgeiz voraus. Ich will mich nicht schönreden oder entschuldigen, nein, bestimmt lag mir unter anderem daran, diese Frau dafür zu maßregeln, nicht einfach mit mir geredet zu haben, sachlich-geschäftlich, insofern ist mein Verhalten ekelhaft gewesen. Doch an jenem Abend war ich mir keiner Schuld bewußt, genoß den Moment der Grenzerfahrung, der Grenzüberschreitung. Nicht ich – sie hatte die Grenze überschritten, hatte sich einen Preis gegeben und ausgeliefert. Einer meiner vielen öden Abende war plötzlich nicht mehr öde, war spannend und komplex geworden. Für zwanzigtausend Pfund hätte ich viele befriedigende Abende haben können, aber keinen solch spannenden.
Und dann – von einem Moment auf den anderen… Manchmal kann man den Tag exakt benennen, da die eigene Persönlichkeit einer anderen weicht und alles Bisherige in Frage stellt. Sobald diese Klarinettistin nackt auf meinem Bett lag, hatte ich keine Lust mehr, Ehrgeiz zu entwickeln. Nicht den geringsten. Wollte ich denn, daß sie daliegt, wie ein Kind Gedichte aufsagt? Das Ganze kam mir so albern und dekadent vor, wie es wohl auch die Male zuvor gewesen war, und so peinlich und widerlich, wie es vorher nie gewesen war. Ich schickte sie fort, bat sie um Verzeihung, gab ihr den Scheck, den sie wortlos akzeptierte (Wofür eigentlich? Aber gut) – und empfand im Verzicht eine fast kindliche Freude, trank danach ganz allein eine Flasche ’75er Petrus und ging zu Bett, sogar ohne onaniert zu haben.
Ich verdanke mein Geld übrigens nicht meinem Beruf, obwohl man als Dirigent vergleichsweise üppig verdient. Reich bin ich geworden, weil ich Feuers Tochter geheiratet und ihn selbst überlebt habe.
6
Am Morgen des 20.August rief Frank in meiner/Annabelles Londoner Wohnung an, keine Ahnung, woher er die Nummer hatte, er sagte, daß Maritas Gebeine im Wald gefunden worden seien. Er schien es eilig zu haben, sprach gehetzt und legte auf, bevor ich in meiner Schlaftrunkenheit angemessen reagieren konnte. Ich habe danach oft versucht, mir das kurze Gespräch in Erinnerung zu rufen. Den exakten Wortlaut zu rekonstruieren. Warum rief er mich an?
Rief er jeden aus der alten Klasse an, dessen Nummer er auftreiben konnte? War Maritas Tod von so allgemeinem Interesse? Warum redete er von Maritas Gebeinen, warum nicht von ihrer Leiche? Und die Todesursache? Er sagte darüber kein Wort. Wartete auch keine der Fragen ab, die mit einer solchen Nachricht gewöhnlich verknüpft werden. Behandelte er mich nicht genauso, wie man einen Mitwisser in Kenntnis setzt?
«Hallo?»
«Hallo, hier ist Frank.»
«Frank? Woher hast du diese Nummer? Wieviel Uhr ist es?»
«Hör zu: Man hat Maritas Gebeine gefunden im Wald. Irgendein Sondengänger hat sie entdeckt. Hat nach keltischem Zeug gegraben.»
«Marita? Keltisch? Was willst du mir sagen?
«Ich muß Schluß machen. Wollte nur, daß dus weißt.»
«Hallo?»
So etwa war das Telefonat verlaufen. Es war keine fünf Wochen her gewesen, daß ich Marita noch leibhaftig und lebendig, wenn auch reichlich abgelebt, gesehen hatte. Nun redete er von ihren Gebeinen, redete davon, daß man sie offenbar sehr zufällig unter der Erde gefunden hatte. Verlor kein Wort darüber, wie sie umgebracht wurde, als ob ich das bereits wissen müsse. Ja, nicht einmal die Wörter umgebracht oder ermordet hat Frank verwendet. Aber wer im Wald verscharrt gefunden wird, hat sich nun mal selten selbst dort abgelegt.
An jenem Morgen trat ein Rätsel in mein Leben, es saß an meinem Frühstückstisch, bedrohlich und seltsam, sah mich an, fremd und exotisch, böse lächelnd – und ich ließ es da ruhig sitzen, weil es mich nicht zu kümmern schien. Marita tot? Durch Gewaltanwendung? Nun, schade. Eine halbe Stunde lang dachte ich an sie zurück, melancholisch, ohne echte Trauer, gerade so berührt, wie mich jede Todesbotschaft einer entfernt bekannten Person berührt. Die üblichen Vergänglichkeitsmeditationen. Elegische Orgelmusik schwingt in den Schläfen. Ich versuchte mich zu erinnern, wie Marita ausgesehen hatte, damals, als sie zwei Schulbänke links von mir saß. Aber ihr junges Gesicht blieb verschwommen, kam hinter der ausgezehrten, vernachlässigten Marita des Klassentreffens nicht mehr hervor.
Ein Tag verging, wie er im Groben wohl ohne jenen Anruf genauso vergangen wäre. Dann, mehr aus einer Laune des Müßiggangs heraus denn aus Besorgnis, kaufte ich mir an der Victoria Station Münchner Lokalzeitungen.
7
Problem: Die Verwüstung, so groß und schön sie ist, wird zugebaut werden. So sind die Menschen. Geben sich nie verloren, geben sich nie die Kugel auf den Ruinen. Selbst wenn man sie in Höhlen zurücktreibt, werden sie wieder die Wände bemalen. Also Architektur. Den Menschen etwas bauen, worin sie einige Zeit lang hausen müssen. Architektur verändert das Stadtbild. Architektur verändert die Seelen der Menschen. Kann bedrücken oder erheben. Ich wollte ursprünglich Architekt werden. Meine Bauten wären erhebend gewesen. Für erhebende Bauten wird auch mehr bezahlt. Jedwedes Phänomen betrachte ich auf seine Statik hin. Labile Dinge erzeugen meinen Abscheu, machen mir Angst. Ich analysiere Partituren auf ihre akustische Statik hin. Klanggebäude. Drei- bis vierdimensionale Musik. Mein Weltbild ist konsequent positivistisch. Man könnte mich einen flachen Menschen nennen, aber als gesuchtem Könner auf meinem Gebiet sind mir solche Vorwürfe egal. Ich habe seit dem fünfzehnten Lebensjahr einen Plan verfolgt. Einen simplen Plan. Ich wollte respektiert werden und wenig leiden, so wenig wie möglich. Wollte ein genußreiches Leben führen, ohne mich zu früh zu verausgaben. Wollte diszipliniert arbeiten und Anerkennung ernten und Geld genug haben für Sex in Hotelzimmern. Ich mag Sex in Hotelzimmern. Neutrale Zonen, in denen man nicht dauernd durch Geschichten unterbrochen wird, die an den Wänden hängen und erzählt werden müssen. Ich trinke kontrolliert trockenen Rotwein am Abend, so guten, daß ich morgens nie an Kopfweh leide. Ich betreibe Sex nicht mehr als Sport. Lutsche alle zwei bis drei Tage an einer Möse, etwa eine Viertelstunde lang, und schließlich hole ich mir einen runter. Das beruhigt mich. Beim Penetrieren einer Frau hasse ich meine Schweißausbrüche. Ich neige dazu, leicht zu schwitzen, obwohl ich nicht dick bin. Es gibt einen Fachausdruck dafür, den ich vergessen habe. Ich bin in dem Alter, wo man sich an das allmähliche Vergessen von Fachausdrücken noch nicht richtig gewöhnt hat. Weshalb man sich, ohne schwerwiegende Gründe, ein bißchen vorausgreifend greisenhaft benimmt und hypochondrisch. Das vergeht, sagen mir meine älteren Bekannten. Irgendwann rafft man sich auf und beschließt, aus dem Rest noch das Beste zu machen. Man beginnt zu joggen. Man tut etwas für den Rücken. Hört mit dem Rauchen auf. Legt sich eine Dauergeliebte zu, oft ein viel zu junges Ding, mit dem zu reden eine Qual darstellt. Man gibt sich den Nutten gegenüber nicht mehr so höflich wie früher. Man will etwas haben für sein Geld. Kauft teures Zeug, sammelt Uhren, Gemälde, spendet für die Krebsforschung oder adoptiert halbverhungerte schwarzafrikanische Babies. Es gibt etliche Möglichkeiten. Ich bin noch nicht ganz Vierzig. Bin einer der vielversprechendsten Dirigenten Europas. Von durchschnittlichem Aussehen. Verheiratet, keine Kinder. Gebildet, aber nicht spezialisiert. Höchstens Symphonien. Das schon. Man kann mir irgendeine hinlegen, oder sogar nur einen Ausschnitt davon, ich weiß sofort Komponisten, Opuszahl und Entstehungsjahr zu nennen. Mein offizieller Wohnsitz, eine Villa mit acht Zimmern, in der Laura Feuer-Hermannstein zur Zeit alleine nicht wohnen will, liegt in Italien, am Lago Bracciano oberhalb Roms. Die Landschaft Lazios ziehe ich der regnerischen Toskana tausendmal vor.
Apartments besitze ich auf Kreta, in Paris und Las Palmas, wo Laura auf mich wartet, sie umgibt sich ab und zu mit Salzluft, gegen ihr Asthma. Freunde besitze ich nicht so viele. Ich bin ein Erfolgsmensch. Und werde international wegen eines Mordes gesucht, der vielleicht niemals begangen worden ist. Über die Zeitungsmeldung, daß der Kosmos wider Erwarten nur ein primitiver euklidischer Raum ist, hat sich mein geometrisches Denken sehr gefreut, bevor es fluchtartig aus meinem Kopf verschwand.
8
Die Überreste der seit zweiundzwanzig Jahren vermißten Schülerin Marita S. seien in einem Wald nahe Gauting gefunden worden, in der Nähe der alten Keltenschanze, von einem Sondengänger, dessen Detektor auf ihr silbernes Medaillon angesprungen war, durch welches sie auch identifiziert werden konnte. Die Eltern hätten zuvor über zwei Jahrzehnte in quälender Ungewißheit verbracht. Man habe damals angenommen, daß Marita S. aufgrund ihrer schulischen Situation von zu Hause ausgerissen sei. Nach Obduktion der Leiche wurde zweifelsfrei ein Gewaltverbrechen festgestellt. Der Fall werde nun neu aufgerollt.
Ich saß in einem Café und starrte diese wenigen Zeilen wohl stundenlang an. Nicht stundenlang, nein, aber bestimmt zehn, fünfzehn Minuten, und das ist viel.
Es mußte eine Verwechslung vorliegen. Diese Marita S. konnte nicht identisch sein mit meiner alten Klassenkameradin, denn die hatte ich ja vor nicht allzulanger Zeit noch gesehen, wenn auch nicht gesprochen, nein, Marita hatte nicht das Wort an mich gerichtet, hatte verloren am Eck der allerletzten Bierbank gesessen, isoliert, in sich versunken. Wie jemand, der sich schämt. Sollte ich ein Gespenst betrachtet haben? Merkwürdigerweise war dieser Einfall der erste Versuch einer Erklärung, obwohl Gespenster in meinem Weltbild wahrhaftig keine Rolle spielen. Es war vielleicht nur die poetischste Erklärung. Die viel banalere: Frank mußte sich einen schlechten Scherz mit mir erlaubt haben. Er hatte von jener unglücklichen, namensgleichen Marita S. gelesen, hatte mich angerufen und skrupellos originell sein wollen. Andererseits kannte ich jenes Wäldchen bei der Keltenschanze. Marita hatte nicht weit davon gewohnt. Und auch die Irish-Coffee-Party, bei der sie auf dem Tisch tanzte, fand nur einen guten Kilometer Luftlinie von diesem Platz entfernt statt. Vor zweiundzwanzig Jahren. Als dritte Möglichkeit zog ich endlich in Betracht, daß ich verrückt geworden sein könnte. Das war aufregend, aber nicht sehr poetisch, ich glaubte keinen Moment ernsthaft daran. Weil all das ohne elegante Lösung blieb, zwang ich mich irgendwann aufzustehen, ließ die Zeitungen auf dem messingumrandeten Tisch liegen, ging heim und versuchte mich auf eine komplizierte zeitgenössische Partitur zu konzentrieren. Spätnachts telefonierte ich mit mehreren Bekannten in München und erfuhr, allerdings aus dritter Hand, daß Frank sich erhängt hatte. Erhängt haben sollte. Oder auf andere Art zu Tode gekommen war.
9
Ich laufe durch die Straßen Londons und glaube mich beobachtet. Ich halte mich in Bewegung, weil meine Angst so besser verteilt, in weitem Umkreis verstreut wird.
Meine Angst, meine Asche. Alles ist möglich geworden. Ich bin mir keiner Schuld bewußt, aber vielleicht gibt es eine Schuld, die sich meiner bewußt wird, die mit jeder Stunde mehr von mir Besitz ergreift. Die mich ansieht und sagt: In dem ist noch Platz, der blieb bislang verschont. Alles spricht dafür, daß ich verrückt bin, aber wenn man mal nachhakt: was heißt denn schon alles? Wirklichkeit ist die Übereinkunft einer Mehrheit der in ihr anwesenden lebenden Zeugen. Sollten sie sich verschworen haben, um mir etwas unterzuschieben?
Die neuformierte Sonderkommission– Gauting ist ein reicher Vorort Münchens, in dem ungeklärte Todesfälle den Steuerzahler etwas länger beschäftigen, auch wenn sie zweiundzwanzig Jahre zurückliegen – setzte sich zum Ziel, die letzten Stunden der Marita S. noch einmal gründlich zu durchleuchten. Hoffnungsloses Unterfangen. Die Gedächtnisse der Beteiligten sonderten sogar höchst unterschiedliche Versionen dessen ab, was zuvor als sicher galt. Klar war am Ende nur, daß es diese Party gegeben hat, von der sich Marita irgendwann zwischen drei und vier Uhr früh verabschiedete, schwer betrunken, soviel stand fest. Damals, als es nur um eine Vermißtenanzeige gegangen war, nahm man an, sie sei, zwar betrunken, aber doch noch irgendwie, zu Hause angekommen, hätte einige Sachen zusammengepackt und ihrem Reihenhaus den Rücken gekehrt. Aus schulischen Gründen. Jedenfalls tendierten ihre Eltern zu jener Version, die ja auch die erträglichste war. Sie behaupteten, von Marita Monate später eine Postkarte aus Amsterdam erhalten zu haben. Sie hätten die Postkarte für authentisch erachtet. Deswegen, und weil Marita bald volljährig, also für sich selbst verantwortlich war, geriet ihr Fall in Vergessenheit, wurde nicht weiter untersucht.
Nun, gut zwei Jahrzehnte später, erreichte mich, nicht mich direkt, aber meinen Agenten in Rom, der Brief der Sonderkommission mit der Bitte um eine erneute – schriftliche – Aussage. Ich legte das Schreiben beiseite, fühlte mich schlicht nicht zuständig, wollte damit auch nichts zu tun haben. Unternahm lange Spaziergänge durch die nächtliche Londoner City. Gab ein paar Pennern Dosenbiere aus und erzählte ihnen von Bruckners Ringen um die symphonische Weltherrschaft. Sie nahmens mit Humor. Am Hyde Park kaufte ich Amphetamine gegen die Müdigkeit, bekam Herzrasen davon. Mietete mich für eine Nacht im Savoy ein, in jenem Hotel, in dem Puccini seine große Liebe Sibyl Seligman getroffen hatte, wo es zwischen den beiden, vielleicht zum einzigen Mal, zu körperlichen Zärtlichkeiten gekommen sein soll. Ich habe sehr gerne Puccini dirigiert. Daß es davon kaum Einspielungen gibt, nie mehr geben wird, macht mich traurig. Die meisten anderen Niederlagen fallen weniger ins Gewicht.
10
In deutschen Zeitungen heute steht zu lesen, daß ich verschollen sei. Zum ersten Mal wurde mein Name in Verbindung mit der Sonderkommission Marita genannt. Man hat Blut geleckt.
Ich flüchtete sofort. Etwas Kaltes, Amorphes schwappte über mir zusammen, das ich nicht verstand, das mich hinabzog, mir die Luft nahm, ich glaubte, durch die Flucht den Kopf frei zu bekommen. Es war die falsche Entscheidung. Wäre mir daran gelegen gewesen, die Sache sofort zu klären, mich in eine überlegene Position zu setzen, hätte ich selbstbewußt auftreten müssen, belästigt, empört, arrogant.
All das stand mir in dem Moment leider nicht zur Verfügung. Obgleich ich selbst wider meine Vergangenheit keine gravierenden Vorwürfe zu formulieren wußte, war mein Gemütszustand einer, der plötzlich an sich als Ganzem zweifelte. Der Verdacht, daß mein Leben völlig anders verlaufen sein konnte, als ich es mir einmal vorgenommen hatte, wuchs sich zu einer Unsicherheit aus, die aber nicht mit Panik gleichzusetzen ist. Ich begriff, was vorfiel, als eine Art bizarre Katastrophe, die im Detail absurd, als Phänomen jedoch entweder sinnvoll oder sehr komisch sein mußte. Zu fliehen war ein Spiel. Auf der Flucht zu sein, ist, solange man weiß, wovor man flieht, ein Spiel, ungeachtet etwaiger Depressionen oder Ängste. Nicht alle Spiele sind lustig. Spiele haben mir stets gelegen. Ich wüßte nur gerne die Regeln. Und den Einsatz. Worum geht es? Um alles? Das wäre doch besser als nichts.
Etwas sagte zu mir: Du mußt da durch, es ist eine Prüfung. Und etwas anderes, weitaus Vertrauteres, sagte: Du bist Prüfungen stets aus dem Weg gegangen, stets mit Erfolg, mach weiter so. Ich war neugierig, nicht auf die Umstände, die mich verfolgten, eher neugierig auf mich selbst, auf das Ergebnis meiner Gedanken. Ich nahm den ersten Flieger nach Berlin, hatte dort noch bis zum Jahresende eine Wohnung gemietet, in der vor wenigen Wochen eine Winterliebe zu Ende gegangen war. Der Gedanke, mich in einer Wohnung zu vergraben, zu verschanzen, die außer einer Matratze und einem leeren Kühlschrank wenig Komfort versprach, besaß etwas Asketisches, Meditatives; auf dem Weg dorthin besorgte ich Kerzen, die ich auf dem Parkett aufstellen wollte, damit sie mir heimleuchteten. Und abgesehen von Zigaretten, die ich an den Kerzen entzünden und so bewußt rauchen wollte, wie ich bewußter nie geraucht hatte, betrat ich diese Wohnung beinahe unbewaffnet.
Es war Anfang September, niemand hatte das Zimmer seit Mai betreten. Der schon abgestandene Duft des Sommers, Bouquet zusammenhangloser Details.
Genug, um eine Brücke zu schlagen in der Zeit. Als läge Claudia noch immer auf dem Bett, rauchend und nackt, schamhaft das Laken über Beine und Unterleib gezogen. Neben der Matratze, auf den Bohlen, die zwei kleinen, aber schweren Gläser, aus denen wir meist Frascati oder Chardonnay tranken, Rotwein nur, wenn wir traurig sein wollten. Einmal hatten wir den Flug zweier Falter beobachtet, die an der Zimmerdecke taumelten, die sich manchmal metertief herabfallen ließen, aufflatterten, gegen das Fensterglas knallten, irgendwo benommen liegen blieben. Dabei immer noch zu flink, um mit Händen gefangen zu werden. Claudia wollte die beiden in eine Tupperschüssel sperren, um sie ein wenig zu beobachten, wollte sie danach draußen aussetzen, in der Nacht. Wollte sehen, ob sie sich bekämpfen oder lieben würden. Sie nahm, was immer geschah, als Omen wahr. Wo die Welt für andere Menschen aus Staffage besteht, suchte sie nach unverstandenen Zeichen, die ihr Winke geben konnten.
Für Claudia symbolisierten die zwei Falter uns beide, eingesperrt in einem hellen Zimmer, gefangen vom Licht, angezogen vom Licht. Die Falter waren zu zweit, wir waren zu zweit, diese Analogie genügte ihr bereits für weitreichendste Schlüsse. Daß die Falter nicht so blöd waren, um wie kleinere Insekten ihr Leben direkt an einer heißen Glühbirne zu verhauchen, hob sie in Claudias Augen zu beinahe menschlichen Kreaturen. Sie haßte an sich ihre Unentschlossenheit, ihr Zweifeln, Zögern. Wenn wir im Restaurant saßen, entschuldigte sie sich beim Studium der Speisekarte dutzendfach, daß es mit ihr leider ein wenig länger dauere. Dreimal im Durchschnitt wurde der Kellner vertröstet, sie brauche noch ein wenig.
Die Erinnerung ist in Schichten geteilt. Solche, die einfach zugänglich sind, abrufbar, andere, darunterliegende, erreichen mich nur noch mit ihrem Duft, mit Geräuschen. Wieder andere sind wie poröse Gesteinsplatten durch den Druck zerbrochen, sind zerquetscht worden, und nur wenn man Schichten darüber abmeißelt, treten Fragmente ans Licht. Manchmal kehren seltsame Einschlüsse zurück, erzählen eine Geschichte, die sie sich in der Zwischenzeit ausgedacht zu haben scheinen. Ich weiß um die Zerbrechlichkeit der Zeit. Nicht nur der Dinge, die in ihr geschehen und verlorengegangen sind, auch der Zeit selbst. Man kann einen Tag erleben oder ihn erinnern. Und ist doch in beiden Fällen in ihm, mit seinem Körper, seinem Geist, beheimatet, ist ihm ausgeliefert. Die Erinnerung an die Gegenwart, die Erinnerung in die Gegenwart hinein, wird, weil es kein Wort dafür gibt, meist der Traumtänzerei gleichgesetzt, einer Flucht vor äußeren Faktoren. Der seltene Zustand, in dem Ereignis und Reflexion zusammenfallen, eins werden, ist von viel höherer Natur. Er tritt ein, wenn die äußeren Ereignisse gewohnt und unspektakulär, Geist und Wahrnehmung aber wach und gelangweilt sind. In meinem Fall schien alles umgekehrt zu sein, die Ereignisse schnitten Äxten gleich in meine Wahrnehmung, die darauf abwehrend, ja ablehnend reagierte. Ich sah gefaßt und beinah amüsiert zu, wo andere in Panik verfallen wären. Daß ich es als vernünftig empfand, mich den direkten Folgen jener äußeren Ereignisse, nämlich dem Zugriff durch staatliche Gewalt zu entziehen, verdankte ich dem merkwürdigen Glauben, ich wäre bereits überführt und verurteilt, könne die langen Jahre der Haft nurmehr hinausschieben.
Allen Ernstes dachte ich, das Opfer einer Verschwörung oder Verwechslung geworden zu sein, dachte aber gleichzeitig: ja, na schön, dergleichen passiert, warum nicht?
Die Aufgewühltheit machte einem sonderbaren Gleichmut Platz.
11
Sie lehnt an der Spüle. Es ist früher Morgen, im Treppenhaus hallen Schritte, knarzen auf schiefgelaufenen Stufen. Das Fenster wird blind zwischen Aprilfrost und dem Dampf der Kaffeemaschine. Ich betrachte Claudia, ihre nackten dünnen Arme, die im Schrank nach Zucker kramen. Von der Decke hängt eine 100-Watt-Birne, es ist kühl in der Küche, im Aschenbecher liegen zwei Zigaretten Glut an Glut gegenüber. Brennen ab, brennen auseinander. Die Tassen werden gefüllt. Zwei kreisrunde Scheiben Schwarz auf dem weißlackierten Holz des Tisches. Über der Heizung steht ein Radio. Ich bitte Claudia, Musik zu suchen. Sie will die Stille nicht zerstören. Als würde diese Stille viel bedeuten. Wir greifen gleichzeitig nach unseren Zigaretten. Ziehen.
Es ist vorbei.
Kleine Dinge mögen, für sich betrachtet, banal sein. Ihre Summe ist ungeheuerlich.
Lange hat mich mein Schaffensdrang davon abgehalten, einen Blick auf diese Summe zu werfen. Wichtig war, die Welt mit Zeugnissen meiner Kreativität zu bereichern. Ich hätte nie gedacht, daß ein erfolgreich realisiertes Projekt mir keine Ekstase mehr bieten könnte. Aber irgendwann begreift man, daß man nicht genau das tut, was man einmal vorgehabt hat, erkennt die vielen kleinen Kompromisse, die einen davon abbrachten, jeder für sich nachvollziehbar, vernünftig, albern fast. Doch in der Summe ungeheuerlich.
So ist die Lage. Ich bin ein privilegierter Mensch, der aus seinem Dasein scheinbar viel mehr gemacht haben könnte als irgendjemand sonst. Und tauge nicht einmal als tragische Figur.
In meiner Situation begeht man Selbstmord, langsam, mit Drogen, oder schnell, mit einem Revolver. Oder man ist lächerlich. Vielleicht bedurfte es einer solchen Ausgangslage, damit geschehen konnte, was geschah. Wenn ich nur wüßte, was geschah und geschieht. Ich glaube, alles was geschehen wird, ist bereits geschehen und wartet darauf, daß ich es wahrnehme.
Wir essen. Ein Paar am Nebentisch küßt sich schmatzend. Es hört sich ekelhaft an. Ebenso unerträglich wie jemand, der mit offenem Mund Kaugummi kaut und dabei auf mich einredet. Laura Dern in Wild At Heart zum Beispiel wirkte im Kino, bei einer guten Soundanlage, abstoßend auf mich, ihr Gekaue und Geschmatze war noch widerwärtiger als das berüchtigte Ekelgeräusch in der finstersten Szene des Films, wenn das weibliche Unfallopfer sich am Kopf kratzt und ihre Finger in der eigenen offenliegenden Gehirnmasse wühlen.
Beide Mitte Zwanzig. Sie hängen über dem Tisch und saugen einander die Spucke aus den Rachenhöhlen. Ihre Zungen verschlingen sich, sie schnaufen und lecken. Ich verdrehe die Augen leicht, Claudia soll meinen Widerwillen bemerken. Um laut zu protestieren fehlt mir der Mut. Ich will nicht als verklemmt gelten. Wahrscheinlich ist das die wahre Verklemmtheit – nicht als verklemmt gelten zu wollen. Andererseits muß die eigene PR-Maschinerie auf die emotionale Gemengelage der Mehrheit achten, und die Mehrheit der Menschen würde sich an diesem Schmatzgeräusch vielleicht nicht stören. Ich weiß es nicht. Muß es bei Gelegenheit herausfinden, durch eine Umfrage im weiteren Bekanntenkreis. Soviele unvollendete Experimente. Aber wenigstens Claudia soll mich bestätigen, soll mit mir fühlen. Wenn sie gar einen Weg fände, dem Pärchen unseren gemeinsamen Unmut mitzuteilen, auf eine stilvolle Weise, oder die beiden gar zum Schweigen brächte, ohne daß danach eine bedrückende Situation entstünde, ich würde sie dafür lieben, ehren und achten. Claudia unternimmt nichts. Sie grinst ein bißchen, aber sehr gnädig, tolerant. Fast amüsiert. Das führt nirgendwohin.
Ich glaube, etwas loszulassen kann mindestens so erregend sein wie es erobert zu haben, glaube, daß höchste Befriedigung in einer Sache nicht darin besteht, sie zu beherrschen, sondern sie, nachdem man sie endlich beherrscht hat, weiterzugeben, zurück in den Kreislauf der Zeit. Das Gönnerische dabei ist nicht aus eitlem Stolz gespeist, nicht aus der Beleidigung durch den zu erwartenden Tod, sondern aus tiefstem Einverständnis mit dem Prinzip der Vergänglichkeit, die alles, was entstanden ist, entwertet, einer Zukunft zuliebe, die sich erst beweisen muß, und sich beweisen wird. Schon weil sie keine andere Wahl hat.
So zu gehen, groß, im Bewußtsein, das Beste geleistet zu haben, was einem möglich war, stelle ich mir, wie armselig die äußeren Umstände auch sein mögen, als inneren Triumphzug vor. Der rote Teppich ins Jenseits, geknüpft aus Verdiensten.
Der Moment, da man auf eine Bühne treten möchte, um vor einer gewaltigen Menge alle Hits und Highlights seines Lebens zu spielen, Beifall zu erhalten, dann abzutreten. Ein erledigter Fall zu sein ist nicht schlimm, wenn es zuvor nur ein paar Sekunden des Respekts gab, wenn man wahrgenommen und verstanden wurde, wenn die Tragik des eigenen Gehenmüssens sich in allgemeines echtes Mitgefühl verwandelt hat.
Dann kann das letzte Konzert zum Triumph werden, zur Feier eines Lebens, mit allem, was dazugehört, wenn man dem Tod sagen kann: Na gut, jetzt du – ich bin fertig, und du bloß ein Müllmann.
Wenn aber um einen her Schweigen herrscht, feindseliges Schweigen, verständnis- und gefühllos… Die Bühne eine Hinrichtungsstätte, mit aufgebautem Galgengerüst, keine Zuschauer davor. Und tiefe Nacht. Bei Eiseskälte…
12
Der Wächter ist in meiner Nähe. Ich kenne ihn nicht. Er sieht mir zu und denkt über die Sekunde seines Einschreitens nach. Viel wird er mir nicht mehr durchgehen lassen. Ich hatte zuviel von den Früchten. Ich bin ein Experiment, anders nicht begreifbar.
Ich schreibe auf, was war. Was geschah. Schreibe auf, was mir geschah.
Was ich gesehen habe. Was ich erlebt habe, was ich zu erleben glaubte, oder was mich erlebt hat und noch immer erlebt.
All diese Formulierungen klingen labil, halten gründlicheren Betrachtungen nicht stand.
Ich schreibe auf. Werde aufgeschrieben. Auch das ist möglich.
Jemand sucht mich. Und es ist nicht nur die Polizei.
Wichtig wäre mir, zu erfahren, ob das, was mir geschehen ist, auch anderen widerfuhr und widerfährt, ob es eine Art Krankheit ist, die in jedem schlummert, aber nur bei wenigen ausbricht. Ob die Welt ähnliche Fälle bemerkt und dokumentiert oder immer nur als Irrsinn abgetan hat. Ich vermute, daß ich es nie erfahren werde.
Vielleicht ist es Irrsinn. Das wäre für alle, auch für mich, am bequemsten.
13
Ich weiß doch noch so genau, wie das war: die Schwaden von Kaffeedampf, der billige Whisky, der sich gegen die Magenwände presst, und der klebrige Zuckergeschmack in den Backen, die schlechte Luft, weil Kerzen brennen und Mädchenhände mit den Flammen spielen, heißes Wachs zu Figuren formen. Kerzen verlöschen, werden wieder und wieder angezündet, schlanke Rauchfahnen schlängeln sich an die Zimmerdecke, und in Papas Stereoanlage spielt die Musik der frühen Achtziger, der Plattenspieler eiert, man hockt herum im Schneidersitz, die Mädchen in ihren pseudoindischen Schlabberklamotten werden betrunken, aber haben sich noch soweit unter Kontrolle, Angrapschversuche zu unterbinden, mit einem festen Griff und einem Zischen, ganz brutal, wie sie ständig auf sich acht geben und auf etwas Harmloses reagieren, als ginge es um ihr Jungfernhäutchen. (Bei einigen geht es darum). Den anderen geht es nur um ihr Seelenheil. Sie haben Mordsangst, sich auszuliefern, dem Falschen zu opfern, sie sind fast alle noch dumm wie Bratfett, aber manche sehen bereits anbetungswürdig aus. Vom mutigsten, großmäuligsten der jungen Männchen wird ein schlüpfriges Gespräch in Gang gebracht, manch eines der korrekten Gefrierhühnchen wechselt daraufhin angewidert das Zimmer, andere, etwas heißere Hennen scharen sich um den labernden Helden, willig, auf sein Spielchen einzugehen, weil sie, ohne es genau zu wissen, nichts lieber täten als endlich gut zu ficken, ihre Unsicherheit, ihren Frust im Orgasmus aus sich heraus zu schreien. Die Luft ist so schlecht, daß die Wohnzimmertür geöffnet wird. Der kalte Schwall nächtlicher Herbstluft treibt ein paar verfrorene Weibchen in die Arme bereitlümmelnder Männchen. Zum Küssen geht man raus, damit vielleicht ein bißchen mehr draus werden kann. Es ist alles so ungeheuer spießig und verklemmt, zum Gotterbarmen, der Brandfleck einer Zigarette im Teppich löst den Nervenzusammenbruch des Gastgebers aus. Und inmitten all dieser pubertären Angst und Geilheit steigt ein angeschickertes Mädchen namens Marita mit ihren Cowgirlstiefeletten auf den breiten Erlentisch, fegt mit ihren Absätzen Strickzeug und Fernsehprogramm in die Ecke und tanzt. Welch Sensation. Sie tanzt zu irgendeiner verfeinerten Discoscheiße, hebt ihren Karofaltenrock, wird angefeuert, die Jungs klatschen in die Hände; eine Geschlechtsgenossin – widerlicher Begriff, doch völlig zutreffend, weil nicht mehr Mädchen, noch nicht Frau und halb schon Hexe – will Marita vor Schande bewahren, stellt sich neben sie, redet ihr gut zu, aber Marita, nunmehr unsre strahlende Heldin, wischt deren dümmliche Hilfsbereitschaft weg mit einer Handbewegung, hebt den Rock noch höher, zeigt den langsam in Ekstase übergehenden Männchen ihren cremefarbenen Slip, schiebt den kurz ganz kurz ein paar Zentimeter zur Seite, wir können Schamhaar erkennen, die Party ist prompt legendär geworden für alle Zeit. Marita tanzt.
MARITA TANZT.
Ich erinnere mich, wie Frank johlte und begann, Luftgitarre zu spielen.
Das Gesicht Maritas, erfreut und erschrocken über soviel Aufmerksamkeit. Sie wußte in dem Moment nicht, was sie wollte, überließ das Nachdenken darüber uns. Dann bricht das Bild ab, ich weiß nicht mehr, was dann geschah. Nur die Musik – es war Earth, Wind & Fire – empfand ich als unangebracht, Markus dominierte den Plattenteller, wir stritten uns die ganze Zeit über Musik, das weiß ich noch, ausgerechnet das.
Marita zeigt uns ihre blondbehaarte Möse, lacht, tanzt, lacht, genießt ihre Wirkung, ihre Macht, zieht den Slip ganz herab, wem wird sie den schenken? Sie schmeißt ihn durchs Zimmer, der Moment ist trotz seiner Größe noch peinlich genug, daß niemand dem Stofffetzen nachrennt. Wir sitzen auf dem Wohnzimmerteppich und sehen Marita tanzen, wir wissen, sie trägt unter dem Bundfaltenrock nichts mehr, wir können aus diesem Winkel fast bis zum Gipfel ihrer Oberschenkel sehen, dann ein schemenhaftes Dunkel. Marita wird fortan die göttliche Schlampe unsrer Träume sein, sie wirft, indem sie sich nach vorne oder hinten beugt, den Rock hoch, zeigt uns ihren Hintern. Lacht laut. Aber nun wird die Erinnerung schwarz, ich weiß nichts mehr, kann mir demnach auch nicht vorstellen, daß danach noch Erwähnenswertes vorgefallen sein soll. Ich weiß allerdings auch nicht mehr, ob ich in dieser Nacht noch onaniert habe, was als Konsequenz einer solchen Situation ja das Mindeste gewesen wäre, von daher kann ich nicht mit Sicherheit behaupten, daß die Nacht harm- und folgenlos verlaufen ist, ich kann mich einfach nicht erinnern.
Doch. Die Avocadoform ihrer Möse, die sie uns zeigte, ich weiß, wie betrunken ich war von diesem Scheiß-Irish-Coffee, und daß meine Hand kurz ihr rechtes Knie streifte, und nach weiter oben wollte, ich weiß, daß ich eine Erektion hatte, und daß wir sie alle vögeln wollten, es vielleicht auch getan hätten, aber da waren, wie gesagt, noch andere Mädchen im Zimmer, die Marita behüteten, die sich vor sie hinstellten und Blicke verteilten, Peitschenhiebe auf unsere Phantasien, und ich glaube mich ganz dunkel zu erinnern, daß Marita sich wieder anzog und nach Hause ging, daß wir Jungs noch Karten spielten und lachten, aufgegeilt, aber unschuldig. Was ich nicht mehr weiß: Wie ich selbst nach Hause kam, ob ich nach Hause kam, wo ich am nächsten Morgen erwachte, was in der Zwischenzeit geschah, das alles weiß ich nicht. Von daher ist einiges möglich, doch wenig wahrscheinlich. Wenn aber meine Erinnerung ein Trugbild sein sollte, Staffage, um etwas Schreckliches vor mir zu verbergen: wozu denn?
Ich bin, behaupte ich, kein besonders böser oder stumpfer Mensch, aber der Tod, selbst der von mir verschuldete Tod eines so marginalen Wesens wie Marita wäre mir auf Dauer ziemlich egal gewesen. Damals. Das klingt jetzt sehr grausam, ist aber gar nichts besonderes, ist, wie es ist, ich will einfach nur sagen, daß ich irgendwie damit hätte leben können, sie getötet zu haben, daß mich die Schuld und das schlechte Gewissen bestimmt nicht in den Beichtstuhl getrieben hätten oder in den Selbstmord. Nein, gerade, weil ich, unter gewissen Umständen, genau wie viele andere in diesem Alter dazu fähig gewesen wäre, scheint mir eine Verdrängung äußerst unwahrscheinlich. Also habe ich mir nichts vorzuwerfen.
Es könnte sein, daß sich manches, was nie geschehen ist, als virtuelle Variante meiner Existenz konstituiert. Das ist vielleicht die Lösung: Alles, dessen ich irgendwann einmal fähig gewesen wäre, ist nachträglich faktisch geworden, gleichberechtigt mit dem tatsächlich Geschehenen.
14
September. Berlin. Der Nachbar hört Musik. Dancing In The Dark – Bruce Springsteen. Fast vergessene Musik aus der Kampfzeit.
Der Song hört sich jetzt viel größer an, als er damals war. Was Legende geworden, was Wirklichkeit gewesen ist, wird bald niemand mehr auseinanderhalten können. Alles vermischt sich, verwischt sich, jede Spur in die Vergangenheit geht verloren. Ein Sturm weht Blätter vom Baum, jedes trägt ein Gesicht, keines einen Namen. Und zum ersten Mal begreife ich, wie schön es sein kann, haltlos in den Bildern zu verschwinden. Der Weg dorthin ist aber auch sehr schön, und es spricht nichts dagegen, ihn um ein paar Umwege zu verlängern.
Ein Traum. Wie nach einer durchfrorenen Nacht Licht durch ein Butzenscheibenfenster auf die eigene Gänsehaut fällt. Und mysteriöse Musik spielt dazu. Als läge man aufgebahrt, hätte unbemerkt die Welten gewechselt. So ockergelb und endlich warm war das im Traum. Real. Und feucht. Und knochig. Genaugenommen roch es streng, ohne daß man sagen konnte, wonach. Aber wenn der Geruch sich verlor – und manchmal verlor er sich für Minuten – war es sehr schön, ein wenig pompös, so wie ich als Kind in einer alten Kirche mit hervorragender Akustik Musik gehört habe, die ich nicht verstand, die dennoch großen Eindruck auf mich machte. Eine Feierlichkeit, eine muffig feuchte Kälte, die von der Musik überwunden wird. Und der Blick verfängt sich in den Kerzenlichten. Bis die Augen schimmern und ein wunderbarer Glanz die Lichter verbindet. Das feuchte Spinnennetz vor der Netzhaut. Und die Eltern sitzen neben mir und freuen sich, sind stolz, weil ich so brav und gebannt zuhöre. Der Dirigent im schwarzen Frack ist ein alberner Magier, jongliert mit flüchtigen Tönen. Es roch nach Katze. Jetzt weiß ich es, eine Katze schnurrte an meinem linken Ohr vorbei. Vielleicht auch ein versehentlich zu tief gestimmtes Insekt. Und ich wurde jünger, immer jünger, wehrloser. Der Raum war kein Zimmer, kein Saal, weder Gebäude noch freie Natur. Der Raum lag seltsam außerhalb von allem, war stellenweise heller oder dunkler, ohne daß die Beleuchtnisse den Dingen um mich her eine Form nahelegten. Ich fühlte mich geborgen an diesem Ort, an dem ich nie zuvor gewesen war. Und die Musik war nicht kirchlich, orgelschwer und voller Hall. Es war schlanke, feingesponnene Musik, hölzern, mit der Resonanz, die dem Korpus eines Cellos oder einer Viola da Gamba innewohnt. Intensiv. Ächzend, con sordino.
Die Musik war Atem. Etwas atmete mich an. Und etwas atmete mich ab. Saugte Luft aus meinen Lungen. Zärtlich. Zog mich zu sich.
Zum Beispiel an einem kühlen Sommermorgen, bevor noch der Hahn kräht, hinauszutreten ans Meer und seinem Wellenspiel zusehen, über dem dünn die Sonnenlava quillt. Wenn alles noch sehr still ist, wenn die glatten Felsen sich kalt anfühlen, und die anschwappende See kaum ein Geräusch macht, oder überhört wird, weil die Sinne taub sind von der Nacht, dem Wein, den Träumen. Das ist ein solcher Moment. Oder wenn man, kurz bevor man angetrunken einschläft, eine Schneise in die Geheimnisse des Weltalls entdeckt, seine Augen hinein wirft, aber nichts vom Gesehenen in Worte zu fassen weiß. Dann steht man still, in einer sonderbaren Mischung aus Demut und Triumph. Und schläft ein.
Ich aber lag wach und sah aus diesen runden gelben Fenstern hinaus wie bei Regen aus den Fenstern unsres Autos, wenn meine Eltern, als ich Kind war, mit mir hierhin oder dorthin fuhren und zwei Stunden Fahrzeit sich so maßlos dehnten, daß sie wie ein Tag empfunden wurden. Nie zuvor habe ich in einem Traum einfach stillgelegen und Ewigkeiten darauf gewartet, daß er vorbeigeht. Nie habe ich in einem Traum quasi wachgelegen und um mich herum Stillstand konstatiert. Wiewohl das Ganze nicht unangenehm war und ich nicht weiß, wie und wieso es endete.
Sie sitzen an einer Reihe von sechs gelben Biertischen. Die Stimmung scheint gelöst, man prostet sich rundherum zu. Fast alle erkenne ich sofort. Mehr noch, die meisten wirken kaum verändert. Ihre Gesichter waren fast fertig geschnitzt, als wir uns zuletzt gesehen haben, sie zeigen erste Patina, Verwitterung, nicht viel, nicht schlimm. Einige sind feist geworden, andere ein bißchen kahl, die Mehrheit hat sich gut gehalten. Sie sitzen unter breiten Kastanien, leger, frühsommerlich gekleidet, die Frauen haben sich was Besseres angezogen, nichts Glamouröses, was eine Frau eben so tragen kann, ohne im Biergarten zu sehr aufzufallen. Ich bleibe einen Moment stehen und sehe mir diese Idylle an. Ein schöner Garten, voll lärmender Menschen. Im Hintergrund knickt eine mit wildem Wein überwachsene Steinmauer das Sonnenlicht ab. Ich zögere. Man hat mich bemerkt, man winkt mir zu. Von diesen Menschen haben mir etliche etwas bedeutet. Mein Blick wandert durch das lange Oval der ehemaligen Mitschüler. Ich spüre ihre Neugier, tauche schnell ein in die Menge, ducke mich am Tisch, tue so, als träfen wir uns jede Woche.
«Hätte nicht gedacht, daß du hier auftauchst.»
Was will Frank damit sagen? Weshalb bekräftigt er vor allen Leuten meinen vermeintlichen Ausnahmestatus? Oder hab ich etwas ausgefressen, was mich am Kommen hätte hindern sollen? Ich seh ihm ins Gesicht.
Er hat es einfach nur so dahingesagt, in netter Absicht. Er grinst. Sprüchemacher, der erst redet, dann nachdenkt. Frank sitzt bei Markus, Christoph und Andreas. Die Clique von damals. Ein Jahr meines Lebens.
Sibylle.
Wir saßen im Unterricht kurz einmal zusammen, unfreiwillig, es hatte für mich keinen anderen Platz mehr gegeben. Sibylle. Ein freches, kurzhaariges, kurzgewachsenes Gör, mit Ratte im Ärmel und Strickzeug in den Fingern. Ich nahm sie nie als Sexobjekt wahr, verhielt mich dementsprechend grausam zu ihr. Machte eine sarkastische Bemerkung zuviel, darauf sie: «Du wirst nicht mein Freund!» Sibylle, absolute Außenseiterin, Lieblingsfarbe Grau, Stupsnase und Irokesenschnitt, hatte es ernsthaft in Erwägung gezogen, mit mir was anzufangen. Das berührte mich damals sehr, obwohl ich sie keineswegs anziehend fand. Und je mehr ich im Lauf der Jahre darüber nachdachte, umso niedlicher, begehrenswerter wurde Sibylle. Bis sie sich in eine etwas eigenartige, vorlaute Kindfrau verwandelte, die irgendwann zum Entsetzen aller Mädchen unsrer Schule mit dem Klassenschönling Markus zusammen war. Mit dem wiederum ich Poker und Billard ohne Ende spielte, der mir auch stets unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählte, welche Praktiken Sibylle zuließ und welche nicht. Sie und ich haben nie mehr ernsthaft miteinander geredet, aber immer, wenn sie damals als Markus’ Anhängsel zugegen war, sie mochte Spiele nicht, blitzte zwischen uns, unausgesprochen, latent, die verpaßte Möglichkeit auf, eine seltsam haßerfüllte, sexgeladene Energie. Jetzt, mit achtunddreißig, war sie eine überaus attraktive Frau geworden, ich versuchte, sie auszufragen, was aus ihr sonst noch geworden sei. Kein Mann, keine Kinder, Leiterin eines Reisebüros.