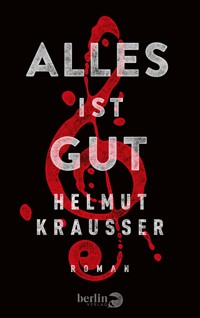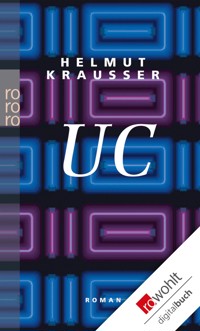7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Das heutige Pompeii ist eine Hundekippe. Lästige Welpen aus der Umgebung werden nächtens über die Zäune der antiken Stadt geworfen. Zu ihnen gehört auch der kleine Mischling mit dem eigenartigen Namen Kaffeekanne, der es nicht leicht hat in der neuen Umgebung. Unter den vielen Streunern hier gibt es solche und solche: von der liebreizenden Calista, die mit einer Blume im Maul Touristen anbettelt, bis hin zu Ferox, dem bösartigen Anführer der Outlaws. Wir lernen die wilden Hunde Pompeiis in ihrer Vielfalt kennen: die unscheinbare, mit einem Liebeszauber belegte Grippi, den gefräßigen Saxo, den toten Max. Wir lesen vom Lehrmeister Plin, vom Geheimniskrämer Valta und von etlichen anderen Gestalten zwischen Himmel und Unterird – wie der ehemalige Hades inzwischen heißt. Dort, unterhalb des Vesuvs, gab es jüngst aus dem Magmabecken verdächtige Rumpelgeräusche zu hören. Droht ein neuer Vulkanausbruch? Und was könnte ausgerechnet ein Hund namens Kaffeekanne dagegen unternehmen? Helmut Krausser erzählt eine phantastische Abenteuergeschichte und erschafft eine ganz eigene Welt. «Diese Hundegeschichte ist geradezu eine Eruption vulkanischer Phantasie.» (Deutsche Presse-Agentur) «Der Leser wird von dieser Geschichte ergriffen wie vom Anblick eines Hundes, der als ausgebeulter Pneu daliegt und sein Herrchen schräg von unten ansieht.» (Süddeutsche Zeitung) «Eine hinreißende Fantasy-Fabel: ein herrliches Vergnügen.» (Magazin)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Ähnliche
Helmut Krausser
Die wilden Hunde von Pompeii
Eine Geschichte
Nichts, was Gestalt hat, behält sie. Aus Liebe zum ständigen Wandel formt die Natur alles um. Entwirft es stets neu, zwar verändert – doch in der Weite des Kosmos, glaubt mir, geht nichts je verloren.
Ovid; Metamorphosen
Erster Teil
I
Pompeii ist eine Hundekippe. Regelmäßig werden unwillkommene Welpen aus umliegenden Dörfern und Städten über die Zäune Pompeiis in eine ungewisse Zukunft geworfen. Man muß dankbar darum sein. Früher wären im rauhen Neapel unwillkommene Welpen ohne viel Aufhebens erschlagen oder im nächsten Teich ertränkt worden.
Pompeii genießt den Ruf, die meisten seiner Hunde zu ernähren. So ungefähr stimmt das. Jene Welpen, die den Wurf über den zirka zwei Meter hohen Zaun überleben, längst nicht alle – finden sich im Museum einer von Staub und Asche konservierten Stadt wieder, die vor zweitausend Jahren luxuriös, lärmig und voll Leben war. Aus der ganzen Welt kommen Touristen, um sich auf Zeitreise zu begeben. Um sich in der Betrachtung der Ruinen einen Begriff von der damaligen Zeit zu machen und von der Zeit allgemein. Viele Besucher begreifen erst in Pompeii, wie wenig Zeit jedem einzelnen zusteht.
Menschen werden schnell melancholisch auf diesem Areal, werden infolgedessen sonderbar freigebig, suchen Halt. Etwas treibt sie, was an Leben rundherum vorhanden ist, zu kraulen und zu füttern.
Genau davon leben die herrenlosen Hunde Pompeiis. Meist gar nicht schlecht. Einige liegen herum, geben sich niedlich und verlassen sich darauf, von irgendwem mit irgendetwas gefüttert zu werden. Andere übernehmen mehr Initiative. Können sogar aufdringlich werden und unangenehm. Es ist wie überall: Es gibt solche Hunde und solche. Neapels Stadtrat findet, es gäbe zuviele Hunde in Pompeii. Womit Neapels Stadtrat möglicherweise recht hat.
Man muß zu ihren Gunsten sagen, daß die Menschen abgewartet haben, bis ich entwöhnt war und mich einigermaßen auf meinen vier Beinen bewegen konnte, ohne dauernd hinzufallen. Dann aber war es soweit. Ich kann mich lebhaft erinnern, wie man mich am Nacken gepackt und eines Nachts mit dem Auto vor die Stadt gefahren hat. Von der Welt hatte ich bis dahin wenig gesehen, nur das bißchen, was man von dem kleinen Balkon im dritten Stock hatte erkennen können.
Häuser, Dächer und Straßen, und, in einiger Entfernung, eine glatte dunkelblaue Fläche, die sich aus irgendwelchen Gründen für die Bebauung mit Häusern und Straßen nicht eignete.
Um genau zu sein, es gab schon Häuser dort unten im Blau, aber von sonderbarer Form – und sie bewegten sich, bis sie am Horizont verschwanden. Üblicherweise verhalten sich Häuser ganz still. Außer bei Erdbeben natürlich, oder wenn sie zu schlampig gebaut sind.
Beides kommt vor, in der Gegend, aus der ich stamme. Ich sei, erklärte meine Mutter mir, ein italienischer Hund, und noch mehr, nämlich ein neapolitanischer Hund.
Ob das gut sei oder schlecht?
Das käme darauf an.
Worauf denn?
Nun, sagte sie, zuallererst sei ich ein kleiner Hund – der Rest würde sich ergeben mit der Zeit.
Ich weiß nicht, ob sie mir etwas verschweigen wollte. Vielleicht hat sie geahnt, was kommen würde. Wir Hunde haben ein eher schwaches Gedächtnis; die Tage meiner Kindheit liegen weit zurück, und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich meiner Mutter nur mehr schemenhaft entsinnen. Ein weißes glattes Fell besaß sie und schwarze Ohren, so wie ich.
Montag ist Hundefängertag. Der Hundefängertag beginnt um sechs Uhr morgens und endet um neun Uhr morgens, wenn es dem Hundefänger zu warm wird und erste Touristen auf das Areal strömen. Pompeiianische Hunde haben berechtigte Angst vor Montagmorgen. Dennoch begreifen die einsichtsvolleren unter ihnen durchaus, daß dem Hundefänger eine wichtige und sinnvolle Aufgabe obliegt. Stiege die Zahl der schnorrenden Köter zu stark an, fände kein Tourist sie länger niedlich.
Nur einige Sturschädel und Wirrköpfe planen ab und an gezielte Widerstandsaktionen gegen den Hundefänger, die strategisch hin und her gedacht, mit großmäuligem Knurren angekündigt, aber nie realisiert werden.
Es gibt auf dem viele Quadratkilometer umfassenden Gelände von Pompeii etliche hervorragende, vielmehr ganz unscheinbare Verstecke. Der Hundefänger und sein Gehilfe haben dennoch hin und wieder Erfolg, was an etlichen Tricks liegen mag, die sie in schlauen Büchern nachgelesen haben. Jedoch kursiert das Gerücht, es gäbe Spitzel und V-Hunde in der wilden Meute, die Verrat an der eigenen Spezies übten, um selber sorgenfrei die Sonne zu genießen. Es sind üble, unbewiesene Gerüchte, die dennoch regelmäßig an jedem Sonntagabend das Klima vergiften. Sonntagabende sind von Furcht und Mißtrauen geprägt.
Was mit eingefangenen Hunden geschieht, weiß kein Hund Pompeiis, und das ist ganz bestimmt besser so.
Meine erste Fahrt in einem Auto habe ich noch deutlich in Erinnerung. Mir wurde übel, ich wimmerte auf der Rückbank, und es war Nacht, und es regnete, und das Auto hielt an, und der Fahrer, den Mama immer das «Herrchen» genannt hatte, packte mich im Genick, und dann – dann flog ich.
Ja, es war, als könne ich fliegen, er warf mich hoch, in die Nacht, in den Regen – und plötzlich ging es nicht weiter nach oben. Es schlug sofort ins Gegenteil um. Hart prallte ich auf dem Boden auf. Das tat weh. Ich hörte, wie das Auto wegfuhr, kläffte ihm hinterher, rannte ihm nach – aber da war dieser hohe Zaun im Weg, aus sehr, sehr festen schwarzen Stäben, nicht durchzubeißen. Es war kühl und windig. Wenigstens hatte sich der Regen abgeschwächt.
So bin ich nach Pompeii gekommen. Ohne jede Ahnung, wo ich nun war und weshalb.
Sicher würde mein «Herrchen» wiederkommen, um mich abzuholen. Mama hatte mir erklärt, daß Menschen sich aus einem natürlichen Antrieb heraus um Hunde kümmern, und Hunde sich die Fürsorge der Menschen gerne gefallen lassen, ja ohne Menschen wohl gar nicht existieren könnten.
Ich sah mich um. In der Finsternis gab es nicht arg viel zu sehen. Keine Lichter außer den Straßenlaternen, deren Lichtkegel nicht weit in das umzäunte Areal hineinreichten. Nachdem sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich Häuser, aber sie unterschieden sich völlig von denen, die vom Balkon aus zu sehen gewesen waren. Wirkten seltsam kaputt und leblos. In ihren Fenstern war kein Glas und es gab auch nirgends bunte Lichterketten wie in der Stadt, die ich gekannt hatte. Viele Büsche gab es und neue, ungewohnte Gerüche.
Die feuchte Erde schwappte über von Gerüchen. Ich bekam Hunger, und die Kälte ließ mich zittern.
Das alles geschah in einer Jahreszeit, die von den Menschen Weihnachten genannt wird. Nicht einmal das hab ich damals gewußt. Stundenlang wartete ich am Zaun auf das Auto des «Herrchens», wartete darauf, an den warmen Bauch meiner Mama zurückzukehren, meinen Kopf an sie zu lehnen und einzuschlafen.
Draußen vor dem Zaun fuhren tatsächlich Autos vorbei, sogar sehr viele, und jedesmal wedelte ich mit dem Schwanz und kläffte, um auf mich aufmerksam zu machen. Genutzt hat es nichts. Die Nacht wurde lang. Was hätte ich tun sollen? Ganz still und in mich gekauert wartete ich darauf, daß sich mein Zustand in irgendeiner Weise änderte. Und schließlich änderte sich auch was. Es wurde hell.
Als neu eingetroffener, soeben die brutale Über-den-Zaun-Geworfenheit überlebt habender Welpe hat man es in Pompeii keineswegs leicht. Es kommt vor, daß gewisse radikale Hundegruppen frisch ausgesetzte Welpen durch Genickbisse töten und sich dafür gar noch feiern lassen. Weil das Boot Pompeii randvoll sei und keine weiteren Mitesser vertrage. Das ist so leicht nicht von der Pfote zu weisen.
Im Allgemeinen aber siegt die Hundlichkeit, jener Instinkt, der auf dem Respekt vor Artverwandtheit beruht. Immerhin, das muß gesagt sein, ist Pompeii ganz und gar katzenfrei. Mögen Katzen Italien besetzt haben bis in den letzten Hinterhof – in Pompeii kommen sie nicht vor, nicht in vertrauter Gestalt jedenfalls, höchstens als scheue Geisterkatzen, um die sich ein anständiger Hund nicht zu scheren braucht.
Ja, die Häuser hier sahen äußerst merkwürdig aus. Viele waren mit Gebüsch überwachsen, manche besaßen nicht mal ein Dach, noch waren ihre Mauern bemalt oder mit Reklame beklebt. Die Straßen dazwischen wirkten sehr eng. Nirgendwo Verkehrsschilder oder Ampeln.
Vor dem Zaun blieben Fußgänger stehen, deuteten auf mich, legten die Köpfe schräg und machten alberne Schnalzgeräusche. Aber nach einer Weile gingen alle weiter. Ich wagte mich noch immer nicht zu rühren, wollte an dem Platz sitzen bleiben, wo das Herrchen mich abgesetzt hatte. Damit es mich leichter finden würde, wenn es wiederkäme. Schließlich war es der Hunger, der mich zwang, meinen Posten zu verlassen. Ich tapste ein Stück weit auf die Ruinen zu, blieb stehen, jaulte, wie ich selber fand, herzzerreißend – und sah endlich ein, daß ich von nun an auf mich allein gestellt war, in einer trostlosen Landschaft, in einem offenbar menschenleeren, von der Stadt abgetrennten Gebiet.
Es muß wohl acht Uhr morgens gewesen sein. Sonne brach durch die Wolken.
Wenigstens fror ich nicht mehr so stark. Müde, entkräftet, kauerte ich mich auf den Boden.
Und plötzlich schob sich ein Schatten in mein Sichtfeld. Der Schatten eines großen, grauen Hundes.
Nicht jeder Hund in Pompeii ist als Welpe über den Eisenzaun geworfen worden. Es gibt auch solche, die in Pompeii gezeugt und geboren wurden. Manche geben damit bei jeder Gelegenheit an und grenzen sich von Zugeworfenen hochnäsig ab, als wären sie etwas Besseres. Andererseits gibt es auch Zugeworfene, die damit prahlen, der Großstadt Neapel zu entstammen. Die es für eine Zumutung halten, quasi auf dem Land, zwischen Ruinen und Gebüsch, aufzuwachsen. Die später beschließen, Pompeii zu verlassen, um ihr Glück in der Stadt zu suchen. Von solchen hört man nie wieder was.
Er schnupperte an mir. Tat verwundert, als könne er mich nicht einordnen. Schwenkte seine schlappen Ohren, die, wie alles an ihm, graubraun waren. Ein alter, leicht schmerbäuchiger Hund, der die Augen zusammenkniff, der wohl nicht mehr gut sehen konnte und merkwürdig abwesend wirkte.
«Wieder ein Neuer», sagte er vor sich hin. «Hat schön geregnet, was? Komm mit.»
Er wandte sich um, und nach kurzem Zögern trottete ich ihm hinterher.
«Knochen gebrochen? Nein? Das nenn ich Glück. Wie heißt du denn?»
«Söhnchen», sagte ich.
«Das ist doch kein Name.»
«So nennt mich meine Mutter aber.»
«Wo ist denn deine Mutter?» Er hielt an und schnüffelte erneut an meinem Fell.
«Ich weiß es nicht.»
«Immer dasselbe. Hast du ’ne Wurst mitbekommen?»
Ich verneinte, und er brabbelte was in seine ausgeleierten Lefzen, über die Zeiten und die Sitten und keine Wurst.
«Mein Name ist Plinius. Alle nennen mich Plin. Wahrscheinlich hast du Hunger?»
Ich nickte. Heilfroh, daß sich jemand um mich kümmern wollte. Mein Gegenüber machte einen altersschwachen, dabei gutmütigen Eindruck.
«Einen Namen für dich findet der Wind. Man muß nur horchen. Sperr deine Ohren auf.»
Es war jedoch ganz still. Plin seufzte und schabte mit den Vorderpfoten im Sand. Keine Ahnung, was er suchte. Er stieß ein leises Knurren aus, und wir gingen weiter in Richtung der Ruinen. Nirgendwo ein Lebewesen. Außer uns beiden natürlich. Leichter Nebel senkte sich auf die leeren Häuser, von denen wir wider Erwarten keines betraten. Hinter den Häusern erstreckte sich ein wildbebuschtes Gelände. Mauersteine, die es auch hier gab, waren so stark überwachsen, daß sie kaum noch an Reste von Behausungen erinnerten, mehr an wilde Gärten, voller Lauben, die eng wie Bienenwaben aneinander lagen. In einer schwach sonnenbeschienenen Ecke ließen wir uns nieder, auf trockenem, vergilbten Wintergras.
Plin nahm die Witterung von etwas auf, befahl mir, leise zu sein, verschwand um die Ecke und kam danach mit einem Stück Wurst im Maul wieder, warf es mir hin und brummte auffordernd. Ich verschlang es in einem Haps, es war scharfe Paprikasalami, eine neapolitanische Spezialität und dennoch völlig ungewohnte Nahrung für mich. Plin hatte sichtlich Spaß an meinem Hecheln. Dann hob er den Kopf, dachte über etwas nach, zog die Stirn in Falten und schien mich bald völlig vergessen zu haben. Meine Kehle brannte.
«Gibt’s hier auch was zu trinken?»
Plin seufzte und deutete mit der Schnauze auf eine steinerne Kuhle, in der sich Regenwasser gesammelt hatte. Während ich meinen Durst löschte, legte sich der sehr alte Hund ins Gras und schlief ein. Sein Fell war an vielen Stellen dünn geworden und seine Augen tränten ununterbrochen, selbst wenn er sie geschlossen hielt. Sollte ich zu so einem Vertrauen haben?
Was blieb mir übrig? Ich kauerte mich an ihn und versuchte, zu schlafen. Und plötzlich schmerzten meine Trommelfelle, von einem wütenden Kläffen, ganz nah in meinem Nacken; ich schnellte herum und sah zwei Reihen gefletschter Zähne.
«Ich riech’s! Du hast die Salami gefressen! Du kleiner Scheißer!»
Abhauen, dachte ich, bloß abhauen, aber der Hund sprang mir auf den Rücken, drückte mich zu Boden, rammte mir seine Krallen ins Fell, knurrte mir ins Ohr, ich dachte: das war’s.
«Saxo! Laß ihn los!»
Der Satz wurde gar nicht sehr laut geäußert, doch zu meiner Überraschung ließ der kleine, gedrungene Terrier sofort von mir ab. Was heißt klein? Doppelt so groß wie ich war er schon.
«Er hat die Salami gefressen!»
«Er hatte sie nötig.»
«Die GANZE SALAMI?»
«Ja, sieh doch nur! Er ist halb verhungert. Hat die Nacht im Regen gesessen.»
Mit ziemlich übertriebenem Mitleid gaffte mich dieser Saxo jetzt an. Ich lernte, was Sarkasmus bedeutet. Dann schien er sich zu beruhigen, legte die Ohren an und zwinkerte mir zu.
«Hab’s nicht so gemeint, Kleiner. Hätte dich schon am Leben gelassen. Bist frisch übern Zaun geflogen?»
Sein Tonfall ging mir auf die Nerven. Bevor mir eine angemessene Antwort einfiel, nahm Plin ihn zur Seite.
«Du hast ihn beinah zu Tode erschreckt. Schau, er zittert ja immer noch. Es ist so leicht, auf Schwächere loszugehen. Ist dir klar, Saxo, was du damit anrichten kannst?»
Jetzt war ich beleidigt. Erschrocken hatte ich mich wohl, aber Plins gutgemeinte Worte machten ein hilfloses, schreckhaftes Bündel aus mir – und selbst wenn das der Wahrheit entsprach, entsprach es nicht meinem durchaus schon vorhandenen Stolz.
Ich drehte mich um und wollte die beiden nicht mehr sehen.
«Wie heißt er denn überhaupt?» Saxo besaß eine voluminöse, röhrende und etwas schrille Stimme, die sich in den oberen Lagen leicht überschlug. Er wirkte sehr quirlig, überdreht, hechelte fortwährend, genaugenommen gab er eine ziemlich komische Figur ab.
«Einen Namen hat er noch nicht.»
«Oh, schön! Darf ich ihn benennen? Wie wärs mit Minimus? Oder Parvenus?»
Das ging endgültig zu weit.
«Du kannst mich mal! Hau ab und rasier deine stinkenden Zähne!»
«Oho! Plin! Hast du gehört? Keinen Namen, aber schon solche Sprüche!»
Ich hatte den Spruch des öfteren gehört, wenn Herrchen und Frauchen sich mal wieder nicht grün gewesen waren.
Plin trat zwischen uns, schmunzelnd, beschwichtigend, und meinte, daß wir sicher Freunde würden. Woraus er diesen nicht gerade naheliegenden Schluß zog, weiß nur er und niemand sonst, aber es stimmte. Saxo wurde mein erster – und bester Freund.
«Der alleswissende Wind wird ihm einen Namen geben.» Plin versank in tiefe Meditation. Saxo hob, hinter Plins Rücken, die rechte Pfote an die Stirn, es meinte soviel wie ‹gaga›, und ich mußte lachen. Saxo knuffte mich, seitdem mochten wir uns.
II
Ein Hundeleben in Pompeii verläuft in geregelten Bahnen, keineswegs so wild und zügellos, wie Romantiker sich das vielleicht vorstellen. Einzelgänger kommen in der Regel nicht weit. Man muß sich einer Gruppe anschließen, um ausreichend Futter zu finden.
Finden ist nicht ganz richtig. Gefundenes Futter sollte lieber nicht gefressen werden. Zu groß ist die Gefahr, einem der Todeskuchen zum Opfer zu fallen, die der Hundefänger regelmäßig auslegt. Früher haben Hundenasen so gut wie jedes Gift gerochen. Die Hundenasen sind nicht arg schwächer geworden, aber die Gifte um einiges tückischer.
Futter muß erbeutet beziehungsweise erbettelt werden, und weil nicht jeder Hund gleich viel erbeutet/erbettelt, wird von denen, die etwas süßer aussehen, ein wenig auf die Seite gelegt für jene, die etwas weniger süß aussehen. Das ist vernünftig und nett, wird aber nicht bei jeder Gruppe so gehandhabt. Bei den Outlaws, einer sehr berüchtigten Gruppe, ist der einzelne strikt auf sich selbst angewiesen, und wenn er Pech hat, muß er seine Nahrung in der Natur suchen. Die Natur bietet nicht viel in Pompeii. Wenn von einem Hund gesagt wird, er müsse Eidechsen fressen, dann ist von einem wirklich auf den Hund gekommenen Hund die Rede.
Die Gruppe (Familie wäre zuviel gesagt), der ich angehörte, bestand aus fast zwanzig Hunden, von denen anfangs fünf, später sieben in meinem Alter waren und mit mir zusammen jeden Morgen Unterricht bekamen.
Der Unterricht teilte sich auf in Draußenkunde, Menschenkunde, Ortskunde, Futterkunde und Hundekunde. Das Meiste war langweilig. Später kamen Früherkunde und Ganzfrüherkunde hinzu. Da wurde es ziemlich unverständlich.
Plin erklärte mir, was Touristen sind und was sie hier angucken wollten, warum sich die Ruinen so gut erhalten hatten unter der Lavaasche, er erklärte mir sogar, was Lavaasche ist, zeigte mir den Vesuv und ließ sich lange über die Wirkungsweise von Vulkanen aus, wobei er leider versäumte mir die Funktionen von ganz normalen Bergen zu erläutern. Ich hatte ja nicht mal eine Ahnung, wozu die Menschen diese großen Dinger in die Landschaft gestellt hatten. Um ehrlich zu sein: ich war damals der Meinung, daß alles, was es auf der Welt zu sehen gab, in irgendeiner Form von Menschen entworfen sein müsse. Oft seufzte mein Lehrmeister auf, als habe er es mit einem völlig Ahnungslosen zu tun. Und weil das gegen meinen Stolz ging, beschloß ich, keine einzige Frage mehr zu stellen. Mein Weltbild setzte sich bald aus ziemlich schrägen Vorstellungen zusammen. Demnach hatten die Menschen Berge aufgeschüttet, um darin Bergwerke anzulegen und das Angehäufte nach und nach wieder abzubauen. Beim Vesuv war irgendetwas schiefgegangen, das Bergwerk explodierte und es regnete glühendes Zeug auf die Stadt Pompeii. Das muß einige Zeit hergewesen sein, bestimmt zwanzig Jahre oder so. Danach hatte man die unter der Asche begrabene Stadt wieder ausgegraben, aber nicht etwa neu gebaut, sondern stehengelassen. Warum?
Keine Ahnung, aber die Besucher bezahlten sogar Eintritt. Gaben dem Pförtner Geld. Geld war eine Art Futter, nur nicht so direkt.
Mein Lehrmeister seufzte sehr sehr oft. Ich hätte viel zu lernen.
Wie bereits erwähnt, erstrecken sich die Ruinen von Pompeii über etliche schwer überschaubare Quadratkilometer. Ein Drittel der ehemaligen Stadt befindet sich noch unter der Erde, um es auszugraben, ist kein Geld vorhanden. Die Touristen können nicht flächendeckend überwacht werden, dafür ist ebenfalls kein Geld vorhanden. Manche Touristen sind gar keine Touristen, viel eher dreiste Plünderer, sie bringen heimlich Grabungsgerät im Rucksack mit und wühlen in der Erde nach antiken Schätzen– Münzen, Statuetten, Scherben, Mosaiken. Besonders dreiste bringen sogar Metalldetektoren mit und graben – am hellichten Tag – mit schweren Schaufeln nach Beute. Einige kommen auch nachts. Man müßte dagegen einschreiten. Wäre nur Geld vorhanden.
Die meisten Outlaws unterscheiden nicht zwischen braven Touristen und dreisten Plünderern. Sie sehen Menschen als bewegliche Futtermaschinen an, die man nur lang genug triezen muß, bis sie Futter ausspucken. Einigen Plünderern ist es offenbar unangenehm, nachts von einer Meute Outlaws verbellt zu werden. So hat sich eine Art Beschwichtigungssystem entwickelt: Plünderer erkaufen sich ihre Nachtruhe durch mitgebrachtes Futter.
Wäre der Hundefänger raffinierter oder fleißiger, würde er sich als Plünderer verkleiden und die Outlaws mit Todeskuchen beschwichtigen. Zum Hundeglück ist der Hundefänger weder raffiniert noch fleißig und besteht auf seinen gewerkschaftlich zugesicherten Arbeitszeiten.
Manche Outlaws gehen so weit, Touristen zu bedrohen, die sich tagsüber in der Weite des Areals verloren haben oder friedlich Picknick im ehemaligen Atrium einer ehemaligen Villa machen. Derlei rabiate Nichtsnutze kläffen und knurren, scharren an der Grenze des Erlaubten. Zu Bissen kommt es jedoch nie. Völlig verblödet sind nicht einmal Outlaws. Käme es zu Bisswunden, würde die Stadt Neapel noch einmal mit der Gewerkschaft verhandeln, die wiederum mit dem Hundefänger, der daraufhin vielleicht doch ein wenig fleißiger und raffinierter vorginge. Die braven, von Outlaws bedrohten Touristen haben nur leider keine Ahnung, daß es nie zu Bissen kommt. Fühlen sich bedroht und erpreßt, werfen mit Leckereien, um in Ruhe gelassen zu werden. Aus diesem Grund wird mancher Outlaw fetter und selbstzufriedener als jeder Bettelhund. Auf Bettelhunde sieht ein Outlaw mit Häme und Verachtung herab. Mehr noch, er macht sich lustig über sie und behauptet, Bettelhunde besäßen keinen Stolz, keine Würde, dienten sich den Menschen an, als Kraulvieh, als rückgratslose Kuscheltiere und Schoßhündchen.
Outlaws jaulen oft Lieder in die Nacht hinaus, in denen sie sich als freiheitsliebende Revoluzzer stilisieren. Bei unerfahrenen, moralisch noch ungefestigten Welpen schinden solche Gesänge mächtig Eindruck, vor allem wenn sie in baßschwangeren Chören über die Ruinen wehen, unterlegt von Rhythmuseulen und Heuschreckentremolo.
Saxo war ein nahezu reinrassiger Terrier – und kräftig.
Ich war ein Irgendwas. Ob, und wenn, welche Kräfte in mir schlummerten, konnte ich nicht ahnen.
Plin tat leider rein gar nichts, um mein Selbstbewußtsein zu heben. Im Gegenteil, er brachte mir bei, mein Welpentum effektiv einzusetzen. Er brachte mir bei, wie ich tapsen konnte, als ich längst schon einen festen Schritt erlernt hatte. Er brachte mir bei, die Augen groß zu machen und zu gähnen. Und wie ich mich auf den Rücken legen mußte, um höchstmögliche Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Richtig winseln will gelernt sein. Betteln, sich aber erst nach so und soviel Futter streicheln lassen. Ich war ziemlich gut. Und effektiv. Die Menschen liebten mich. Gaben mir zu fressen, mehr, als ich vertragen konnte. Das Meiste lieferte ich ab, in die, nennen wir’s: Gemeinschaftskasse. Brot, Käse, Fleisch. Auch Süßkram. Schokolade, sagte Plin, sei Gift für junge Hunde. Popcorn genauso. Offenbar wollte er Schokolade und Popcorn selber fressen, mit dem schwachen Argument, ihm könne das nicht mehr schaden, er sei schon alt.
Es gibt, gleich neben dem gar nicht so üblen Schnellrestaurant, einen Kiosk auf dem Gelände. Im Kiosk sitzt Mario. Mario ist sehr fett, und sein Nackenschweiß zieht seltene Schmetterlinge an. Er verkauft an Touristen zu überteuerten Preisen Schokolade, Wasser, Reiseführer, Popcorn und Farbfilme. Die Outlaws haben ein Auge auf Mario. Sie fühlen instinktiv, daß es nicht ratsam wäre, ihn zu überfallen. Aber sie beobachten sehr genau, was er an wen verkauft. Einmal ließ Mario die Hintertür seines Kiosks offen stehen. Ein Pinscher drang in Marios Reich ein, stahl eine Packung Puffreis. Mario, in all seiner Fettigkeit, griff zum Schrotgewehr und erschoß den Pinscher, dessen Name nicht überliefert ist. Verlierer verlieren alles. Auch ihre Namen.
Lange bin ich namenlos gewesen. Alle riefen mich Kleiner. Ärgerlich und untragbar.
Plin ließ dem Wind zuviel Zeit, einen Namen für mich zu wählen. Ich wollte endlich einen Namen haben, ganz ohne windisches Zutun, einen klangvollen, passenden, nur für mich. Denn ich war über den Frühling hin groß genug geworden für einen eigenen Namen. Ich drohte, murrte, bettelte, machte sogar die Augen groß und gähnte. Als es eines Morgens soweit war, wünschte ich mir, ich hätte meine vorlaute Klappe gehalten. Plin trat grummelnd vor mich hin, mit einem Blick, der nichts Gutes bedeuten konnte.
«He, Kleiner, der Wind hat deinen Namen genannt.»
«Ja?»
«Ja. Ich habe eine Vision gehabt und den Urahn deines Urahns gesehen, und der allwissende Wind zischelte seinen Namen. Du heißt ab sofort–» Er atmete nochmal tief ein.
«Wie denn?»
«Nun…»
«Nun?»
«Kaffeekanne.»
«Was?»
«Kaffeekanne. So lautet dein Name.»
«Das ist doch kein Name! Das ist –…» Mir fehlten die Worte.
«Beschwer dich beim Wind!» Plin wandte sich ab und senkte den Kopf. Er gab zu, daß er schwerhörig war, daß er den Wind möglicherweise schlecht verstanden hatte. Aber der allwissende Wind, hieß es, äußere sich eben nur einmal, und auf Nachfragen reagiere er nicht. Kaffeekanne kam dem am nächsten, was Plin verstanden hatte, und damit basta.
Um mich her wälzten sich Hunde im Gras, die vor Lachen kaum Luft bekamen.
Wochen vergingen. Pompeii gefiel mir langsam besser. Viele der uralten Häuser sahen innen sehr bunt aus. Betrachtete man das Bunte auf den Mauern genauer, entdeckte man Bilder darin und Geschichten. Geschichten hatte ich gern. Selbst die komplizierten.
Einmal fand ich beim Spielen einen Laib Graubrot im Sand, scharrte ihn frei und erwartete, gefeiert zu werden. Plin wirkte nicht sehr beeindruckt.
«Dieses Brot ist zweitausend Jahre alt. Verkohlt und versteinert.»
Ich glaubte ihm kein Wort. Ich wußte, wie zehn Tage altes Brot aussieht. Es wird grün.
Um ihm zu beweisen, daß das Brot noch gut war, biß ich hinein. Es hätte mich beinahe ein paar Zähne gekostet.
«Das ist – totes Brot?»
«Genau.»
«Geisterbrot?»
«Ich glaube kaum, daß dieses Brot je Geist besaß.»
«Wie sehen Geisterhunde aus?»
Das, meinte Plin, wisse niemand. Wo er mir ausnahmsweise mal etwas Interessantes hätte erzählen können, überließ er mich meiner Vorstellung.
Es wurde Sommer, wurde warm, selbst nachts, immer mehr Touristen kamen, das Nahrungsangebot wuchs. Ich auch. Mit meiner Gruppe kam ich aus. Ein paar Mädchen– Clio, Chloe und Calista – behandelten mich von oben herab, verulkten mich, immer zu dritt, nannten mich statt Kaffeekanne einfach nur Anne, blöd und niveaulos, aber sie ernteten auf meine Kosten einige Lacher. Ansonsten wurde ich gemocht. Nach einiger Zeit hörten sogar die Witzeleien um meinen Namen auf. Warum der angeblich allwissende Wind sich den für mich ausgedacht hatte, blieb ein Rätsel. Ich lernte Heuschrecken zu fangen, ließ sie aber jeweils laufen und hoffte darauf, daß der Tag nie kommen würde, an dem ich sowas essen müßte.
Einmal hab ich eine Katze erwischt. Das Vieh sah schließlich so aus, wie man mir eine Katze beschrieben hatte: sehr schnell, vier Füße, langer Schwanz und dennoch kein Hund. Aber die doofe Eidechse konnte nicht mal sprechen. Beim Gedanken, sie in den Mund zu nehmen und zu zerkauen, ist mir speiübel geworden.
Den Outlaws gingen wir aus dem Weg. Plin schärfte uns ein, lieber feige zu sein, als auf Provokationen zu reagieren. Dabei gab es kaum Provokationen. Die Outlaws waren bevorzugt nachts unterwegs oder durchstreiften bei Tag die Außenbezirke, überließen den Schoßhündchen, wie sie uns nannten, das Hauptrevier rund um den Marktplatz. Plin nannte den Marktplatz Forum. Er fand für alles sonderbare Begriffe. Woher er die hatte, wissen Kuckuck und Geier. Er beschäftigte sich oft mit Schildern, die überall herumstanden, versuchte, auch mich dafür zu interessieren. Aber auf diesen Schildern gab es nur schwarzweiße Bilder, alle so ähnlich gezeichnet, keine Geschichten, nicht mal richtige Bilder, so Ornamente in waagrechten Linien, das sah nach nichts aus. Er sagte, ich müsse ganz genau hinsehen, das seien sehr wohl Geschichten. Jaja, dachte ich, du magst mich für dumm halten, aber blind bin ich nicht und Geschichten erkenne ich, wenn ich sie sehe.
Plin sagte, es gebe einen Unterschied zwischen Sehen und Erkennen.
Weshalb bloß wollte er immer so spitzfindig klingen?
Montagmorgens zogen wir uns in ein schattiges Plätzchen zurück, bekamen von den Hundefängereien kaum etwas mit. Wir Junghunde wuchsen so behütet auf, daß wir nicht einmal wußten, warum der Montagmorgen gefährlich war. Nur daß er gefährlich war, wußten wir. Und daß überall neue Kuchen ausgestreut wurden, die wir nicht einmal beschnuppern durften. Plin hätte meiner Meinung nach drastischer sein können. Er wollte uns nicht unnötig in Angst versetzen, wollte die Realität so lang wie möglich von uns fernhalten. Dabei erreicht nichts auf dieser Welt die Geschwindigkeit finsterer Gerüchte. Was uns Plin vorenthielt, das erfuhren wir von älteren Hunden, die jede Gelegenheit wahrnahmen, sich vor uns aufzuplustern. Daß Montagmorgen ernsthaft gefährlich sind, haben wir dank solcher Wichtigtuer begriffen. Ich möchte Plin deswegen keine Vorwürfe machen. Naja. Doch. Ich würde ihm Vorwürfe machen. Aus heutiger Sicht, wenn es noch irgendeinen Sinn ergäbe, würde ich dem alten Plin gern sagen, daß er manchmal an den falschen Stellen Rücksicht nahm.
Eines jener schattigen Plätzchen lag hinter dem Odeon, dem runden Theater mit den steil aufragenden Zuschauerrängen. Das war mal so eine Art Zirkus. Ich wußte nicht, was Zirkus bedeutet. Plin erklärte uns das näher. Ich kann mir Plin nicht anders denken, als näher erklärend, was bei ihm eine sehr weitschweifige Sache war.
Daß es im antiken Zirkus neben wetteifernden Sängern, Komikern und Poeten auch Gladiatoren gegeben haben soll, die mit Waffen aufeinander losgingen, bis einer den anderen totgeschlagen hatte, erfand er wohl nur, um ein wenig Interesse zu ernten.
Gruselgeschichten. Menschen, dachte ich, sind insgesamt recht harmlose Geschöpfe. Der Hundefänger tat nur seine Arbeit. Selbst Mario, der stiernackige Kioskbetreiber, der einen Pinscher erschossen haben sollte (Gruselgeschichte, was genau bedeutete: erschossen?), strich Welpen gerne mal übers Fell. Kein Mensch wäre je auf die Idee gekommen, mich Kaffeekanne zu nennen. Hunde dagegen können tückisch sein, selbst solche aus der eigenen Gruppe. Es gab da so ein Exemplar, das gerne mit mir in Konkurrenz trat, wenn es darum ging, die Aufmerksamkeit der Touristen zu erregen. Arroganter Bursche. Sein Name war Cinna. Er nannte mich Kaka. Weil ihm Kaffeekanne zu lang war.
Cinna war sehr dünn und sah mit den braunen Flecken auf dem sandfarbenen Fell recht drollig aus, das muß ich zugeben. Ob er von mir dasselbe dachte? Er mißgönnte mir den Erfolg. Von ihm bekam ich meinen ersten Biß. Ohne nennenswerten Grund, nur weil eine Touristin mir getrocknete Datteln geschenkt hatte, ihm aber nicht. Danach machte er sich feige aus dem Staub, ging, viel flinker als ich, jeder Revanche aus dem Weg.
Eines Nachmittags nahm ihn ein junges Menschenmädchen auf den Arm und zeigte ihn einem älteren Menschenmann. Sie diskutierten ein bißchen, dann streichelte der Mann dem Mädchen den Kopf, beide streichelten Cinna den Kopf, sie steckten ihn in eine Decke und nahmen ihn mit. Ich sah, fasziniert und hämisch lächelnd, zu, wie sie Cinna durch den Ausgang trugen und erst dann, als es schon viel zu spät war, rannte ich zu Plin und schlug Alarm: «Cinna wird entführt!»
«Von wem?»
«Von einem Menschenmädchen und einem Menschenmann!»
«Der Glückliche!» Plin schwenkte summend die Lefzen, hob seine gelben alten Augen zum Himmel, prompt begriff ich, daß ich weder traurig noch froh, sondern neidisch sein mußte auf Cinna. War ich traurig? Nein. Neidisch? Ach was. Froh? Naja.
Und war das in Ordnung?
Lange darüber nachzudenken lohnte nicht. Am nächsten Morgen kam Cinna wieder über den Zaun geflogen.
Der einzige Outlaw, den wir persönlich kannten, war gar kein richtiger Outlaw, wenigstens nicht, wie wir uns einen vorstellten. Valta war eine Art fahrender Hund, ein Geheimniskrämer, der umherzog und Geheimnisse feilbot.
Man gab ihm eine Kleinigkeit, und Valta, der Geheimniskrämer, erzählte ein kleines Geheimnis, man gab ihm ein bißchen mehr, und er erzählte ein mittleres Geheimnis.
Für Marzipanschokolade, sagte er, hätte er die tiefsten Geheimnisse des Weltalls offenbart. Wir besaßen nur leider keine Marzipanschokolade. Wußten nicht mal, was das ist.
«Was habt ihr denn?»
Wir legten zusammen. Ein paar Scheiben roter Paprika und Puffreisreste. Einige Popcornbröckchen und Weißbrotkrusten.
Dafür, sagte Valta, gäbe es ein Geheimnis von der Schwere Drei auf der nach oben offenen Dichterskala. «Worauf habt ihr Wissensdurst?»
Ein leichter Erdstoß, wie er in der Gegend um Neapel häufig vorkommt, hatte uns in der Nacht verängstigt. Es war unser erster gewesen, muß man dazusagen.
«Das ist eigentlich ein Geheimnis von der Schwere Vier», meinte Valta, «aber weil ihr noch wachsen werdet, mache ich das Geheimnis ausnahmsweise etwas kleiner, als es ist. Hört her!»
Er sprang auf die Bühne des Odeons, wir hockten im Halbkreis um ihn herum und lauschten. Das Geheimnis hieß:
Vesuvius und Vesuvia
«Es war einmal und ist immer noch: ein Riese, den man Vesuvius nennt.
Er stammt aus der Zeit, als die Riesen noch wirklich riesig und aus Stein waren, als sie die Erde beherrschten, mit Bergen um sich warfen und allein mit ihrem wilden Geschrei die Kontinente spalteten.
Vesuvius aber war der wildeste unter ihnen. Er trampelte durch die Welt und zertrümmerte andere Riesen mit nur einem einzigen Hieb seiner mächtigen steinernen Faust. Er trank Gewitterwolken und fraß Blitze, und wo er hintrat, da entstanden Täler und Seen.
Eines Tages kam er in die Gegend des Golfes von Neapel, da sah er eine Riesin, die in der Sonne lag und schlief.
Ihr Name war Vesuvia.
Vesuvius schrie und tobte, wie er noch nie getobt hatte, denn er hatte sich in Vesuvia verliebt, und wenn Riesen sich verlieben, nun, dann schreien und toben sie.
Von dem Lärm erwachte Vesuvia, sie setzte sich auf – was ein paar mittlere Steinlawinenabgänge verursachte–, sie sah Vesuvius an und fragte schlaftrunken: ‹Was machst du denn hier für einen fürchterlichen Lärm?›
Da wurde Vesuvius ganz still und verlegen. Er konnte Vesuvia schlecht mit einem einzigen Schlag seiner mächtigen steinernen Pranke zertrümmern, weil sie eine Riesin und kein Riese war – denn das tat man nicht. Daher wußte er mit dieser Situation nichts rechtes anzufangen, er lief unentschlossen ein bißchen hin und her, zertrampelte ein paar kleinere Städte und Dörfer und schuf Täler und Seen. Dann blieb er endlich stehen und sagte: ‹Äh.›
‹Äh?› fragte Vesuvia. ‹Das ist alles, was dir einfällt?› Sie wischte sich etwas Schlafdreck aus den Augen, der wie mächtige Findlinge herabstürzte und tiefe Löcher in die Erde bohrte.
‹Äh›, sagte Vesuvius, und er überlegte, ob er nicht lieber wieder anfangen sollte zu schreien und zu toben – aber da fiel ihm etwas ein. Er kniete vor Vesuvia nieder, riß einen Wald aus Olivenbäumen aus der Erde und reichte ihn der Geliebten.
‹Du bist schön›, sagte er. ‹Du bist so schön wie ein schneebedeckter Gipfel in der Morgensonne, umweht von Schleiern aus Nebel. Du bist so rein wie ein Gebirgsbach. Deine Augen sind wie Kristalle im Herzen der Berge. Nein – so strahlend wie erdgepreßte Diamanten im Magmalicht!›
Jetzt war es an Vesuvia, verlegen zu werden.
‹Willst du mit mir schlafen?› fragte sie schüchtern.