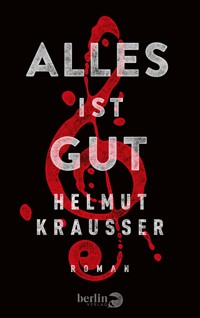11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zwölf Monate aus zwölf Jahren, von 1992 bis 2004: Helmut Kraussers Tagebücher sind ein einzigartiges literarisches Dokument. Sie sind viel mehr als das ungewöhnliche Selbstporträt des facettenreichsten Autors seiner Generation. Sie legen Zeugnis ab von Gesellschaft, Politik und Kultur unserer Zeit – stets getrieben von rastloser Neugier. Voller Sprachwitz und Poesie bilden sie ein kluges, scharfsinniges, gnadenloses Journal. Die Tagebücher erschienen zwischen 1993 und 2005. Helmut Kraussers brillante Aufzeichnungen sind nun auf ihre Essenz konzentriert – zwölf Jahre Gegenwart in einem Band.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
HELMUT KRAUSSER
SUBSTANZ
Das Beste aus den Tagebüchern
Von Helmut Krausser sind im DuMont Buchverlag außerdem erschienen: Aussortiert. Kriminalroman Die kleinen Gärten des Maesteo Puccini. Roman Die letzten schönen Tage. Roman Einsamkeit und Sex und Mitleid. Roman Eros. Roman Nicht ganz schlecht Menschen. Roman Plasma. Gedichte Helmut Kraussers Tagebücher erschienen zwischen 1993 und 2005 im Belleville Verlag. Für diese Auswahl wurden sie vom Autor durchgesehen. eBook 2012 © 2010 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten
Es ist, als ob eine Schlange ihre Häute sammeln wollte, statt sie den Elementen zurückzugeben. Aber man sieht doch einigermaßen, wie man war, und das ist sehr notwendig, wenn man erfahren will, wie man ist. Das ganze Leben ist ein verunglückter Versuch des Individuums, Form zu erlangen; man springt beständig von der einen in die andere hinein und findet jede zu eng oder zu weit, bis man des Experimentierens müde wird und sich von der letzten ersticken oder auseinanderreißen läßt. Ein Tagebuch zeichnet den Weg.
MAI 1992
1. Mai, Freitag Der Mai begann fürchterlich. In einem heroisch zu nennenden Anfall von Aktionismus war ich um 11:30 aufgestanden und hatte, seit sieben Jahren zum ersten Mal, die beiden Fenster geputzt und deren Vorhänge gewaschen. Es kostete mich einige Überwindung, aber danach war ich vom Ergebnis begeistert, legte eine Platte auf und staunte, wieviel Licht nun in mein Zimmerchen drang; ich entfernte auch einige Spinnweben, die offensichtlich schon lange nicht mehr zum Fliegenfang benutzt wurden.
Plötzlich tat es einen lauten, dumpfen Schlag, der mich zusammenzucken ließ, dessen Ursache ich nicht sofort begriff. Ich trat vor die Tür. Unter dem blitzblank in der Sonne glänzenden Fenster lag eine junge Amsel, kaum ausgewachsen, gerade mal flügge geworden, rücklings auf dem Boden. Sie war gegen das Fenster geflogen, war aus vollem Flug gegen das Glas geschmettert. Sie lag da, öffnete im Takt eines langsamen Pulses den Schnabel, wie um zu schreien, brachte jedoch keinen Laut hervor; wie ein Erstickender nach Atem ringt, mit weit geöffneten Augen, bewegte das Tierchen nichts als den Schnabel, auf und zu, auf und zu, immer wieder, minutenlang. Es war kein Tropfen Blut zu sehen, auch schienen die Flügel nicht gebrochen.
Ich empfand zuerst eine starke Scheu, den Vogel zu berühren, stand erstarrt und tölpelhaft daneben und wartete, ob sie (ich denke, es war ein weibliches Tier) sich wieder erholen würde. Es ging aber zu Ende; ich bettete die Amsel in meine Hand und trug sie aus dem Schatten in die Sonne, legte sie in der obersten Schale des alten, trockengelegten Springbrunnens ab, so daß keine Katze sie erreichen konnte. Ich hatte nie zuvor etwas Sterbendes in der Hand gehalten; es war entsetzlich. Schuldgefühle, Hilflosigkeit, stummes Alleinsein mit der verendenden Amsel. Später begrub ich sie und zog sofort neue Vorhänge auf, damit sich ein Unglück dieser Art ja nicht wiederhole.
Meine Vermieterin hatte auf die Säuberungsaktion gedrängt, hatte vehement das Purgatorio gefordert, hatte mir sogar unterschwellig mit Rausschmiß gedroht. Sie kam vorbei und sah mich mit der Amsel in der Hand, hatte kein Verständnis für meine Trauer, sah mich sogar ein wenig schief an und wollte die noch Lebende auf den Komposthaufen werfen. Ihr bäuerisches Benehmen machte mich rasend. Scheißfenster! Wieder bekam ich Lust auf die Straße. Sauberkeit und Tod sind so nahe verwandt.
*
In alten Illustrierten geblättert. Gute Funde, z. B.:
»Alle maßgeblichen Instanzen in der ganzen Welt sind sich darüber klar, daß der Tonfilm zwar die Weltherrschaft des belichteten Zelluloids beeinflussen kann, daß aber der stumme Bildstreifen nie ganz verdrängt werden wird. Man sollte nicht vergessen, daß die stumme Sprache der Leinwand in der ganzen Welt verständlich ist und daß die rein pantomimische Wirkung des Flimmerspiels seine spezifischen und speziellen Wirkungen hat, die immer Auge und Geist packen und beschäftigen.«
(ein gewisser AROS, in Scherl’s Magazin, Berlin, Februar 1929)
Soweit zu den »maßgeblichen Instanzen«, unter denen jede Zeit in gleichem Maße leidet. Exemplarisch hier die Unfähigkeit, zu einer so großen Erfindung wie dem Tonfilm eine so kleine, stringente Erfindung wie die Synchronisation hinzuzuimaginieren. Phantasielosigkeit – das Merkmal des Experten, er weiß alles über das Ding selbst, aber nichts über dessen Potential. Deshalb liegen die Experten mit ihren Voraussagen auch so oft falsch – und die Künstler so oft richtig.
2. Mai, Samstag Anderes Problem der Sauberkeit: Heute mittag ging ein Mann an meinem Fenster vorbei und sah frech hinein.
*
Nachmittags traf Beatrice ein, wir gingen spazieren am Weßlinger See – und welches Schauspiel bot sich!
Auf einer Uferwiese wurde eine Ente von fünf Erpeln verfolgt, eingeholt und vergewaltigt. Das Erstaunliche: Die Erpel machten gemeinsame Sache, halfen einander. Jeweils zwei hielten die Ente fest (klingt komisch, aber so war es), zwei standen unbeteiligt links und rechts herum, und einer sprang auf. Wenn er fertig war, nahm er den Platz eines der beiden Unbeteiligten ein, dann kam der nächste an die Reihe; das Ganze ging äußerst diszipliniert vor sich wie in einer britischen Busqueue. Kein Gerangel, kein Streit, ein absolut koordiniertes Vorgehen, perfekter Teamgeist. Nach jeder Vergewaltigung schaffte es die Ente, ein paar Meter zu flüchten, bevor sich die Prozedur wiederholte – und erst als alle fünf befriedigt waren, zerstreuten sich die Erpel in verschiedene Richtungen, ließen ihr zerzaustes Opfer einfach stehen. Es war phantastisch, unglaublich, besser als jedes Kino und vom Zoologischen her doch überraschend. Ich hätte natürlich vermutet, die brünftigen Erpel wären von striktem Konkurrenzdenken geleitet, nur daran interessiert, die eigenen Gene weiterzugeben und auf Nebenbuhler einzuhacken. Ganz falsch. Vor allem war es verblüffend, daß jene Erpel, die schon abgespritzt hatten, nicht desinteressiert von dannen zogen, sondern den »Gesellschaftsvertrag« einhielten und, nach einer postkoitalen Pause, ihrer »Pflicht des Festhaltens« nachkamen. Die Ente übrigens drehte sich am Ende der Orgie zweimal im Kreis und rannte danach einem der Erpel hinterher, folgte ihm auf Schritt und Tritt. Das muß der gewesen sein, der es ihr am besten besorgt hat.
*
Ein Geschäftsmann, der mit dem Aufstellen von Kaffeeautomaten sein Geld verdiente, regte in den sechziger Jahren an, daß die Plastikbecher in seinen Geräten um ein Geringes verkleinert würden, die Füllmenge Kaffee aber gleich bleibe. So ergab es sich, daß die Automatenbenutzer, jedesmal wenn sie den gefüllten Becher der Halterung entnahmen, beim Zusammendrücken des Becherrandes von ein paar Tropfen heißen Gebräus verbrüht wurden. Die Angestellten des Geschäftsmannes schüttelten den Kopf, verstanden die Verkleinerung des Plastikbechers als skurrile und völlig uneffektive Sparmaßnahme, konnten sich keinen anderen Sinn der Aktion denken, als drei Quadratzentimeter Plastik zu sparen. Doch der Geschäftsmann hatte nichts beabsichtigt als eben jene kleine Verbrühung. Größere Becher gleichen Inhalts, so führte er aus, würden die Kunden glauben machen, ihnen würde schlecht eingeschenkt. Nein, sagte er, die Becher müssen randvoll sein, man muß den ÜBERFLUSS SPÜREN! Der geringe Schmerz muß dem Kunden Signal werden, hier preiswert und gut gekauft zu haben!
Tatsächlich verdrängte er bald alle anderen Getränkeautomatenaufsteller aus dem Geschäft.
3. Mai, Sonntag – Abbazia Pomposa Widerlicher Traum: Ich lag auf einer Luftmatratze im Hinterhof einer Mietskaserne und hatte plötzlich Lust, von einer der streunenden, verlausten Katzen zu kosten. Zu diesem Zweck stellte ich Fallen auf. Als endlich eine Katze gefangen war, eine scheckige, genügte sie mir nicht; ich fing weitere fünf und schlachtete sie nacheinander ab, mit Hammerschlägen auf den Kopf. Die Felle warf ich fort, das Fleisch, in einer riesigen Pfanne gehäuft, trug ich hinauf in meine Wohnstatt – ein ausgebauter Speicher, oder ähnliches. Ich begann die Katzen zu braten; drauf von weit drunten die Stimme meiner Mutter: »Brätste wieder Katzen?« Ich: »Jaja …« – und mir drehte sich der Magen um.
*
Ich erwachte mit starker Übelkeit, schluckte ein Aspirin, dann lud mich Beatrice ins Auto. Die sechs Stunden bis Mantua verliefen problemlos, danach einige Staus, besonders auf den letzten zehn Kilometern vor Pomposa.
*
Ich überstieg das Seil und ging in die Krypta, in der heute eine Heldengedenktafel steht. Die Krypta ist nur noch eine flache Aushebung und machte den Eindruck einer dunklen Bauernstube – in der aber alle Möbel aus Marmor sind. Ich setzte mich auf einen Schemel und träumte vor mich hin. Höhle voller Fratzen. Nachttiere. Aus dem Fels gähnen Schlünde, feucht und gerillt, Röhren im Gestein, klaffend wie Blüten der Fleischfresserflora. Tropfsteinhöhle voller Gaumenzäpfchen. Der Rachen eines versteinerten Kriegers. In unzugänglichen Felsspalten haben sich Reste des Schreis abgelagert, mit dem er hier zu liegen kam.
*
Vor der Abbazia gab es einen Trödlermarkt, mit viel Kitsch und Nippes, aber auch brauchbaren Ständen. Ich kaufte eine wundervolle, große, schwarze, gußeiserne Pfanne, zehn Kilo schwer, mit einem Griff aus gelacktem Holz, der in einer silbernen Schlaufe endet. Ich war hingerissen von diesem wuchtigen, klobigen, archaischen Ding, es fühlte sich weich an. Der Deckel wiegt etwa vier Kilo und macht ein schönes, tiefes Geräusch, wenn man ihn aufsetzt.
Beatrice meinte schelmisch: »Gib’s zu – die Pfanne hast du für die Katzen gekauft!«
*
Die Salzseen im Abendrot. Finnischer Anblick; ein Farbenrausch, der sich mit der Dämmerung abkühlt, bis nur noch Kobaltblau und Purpur bleiben. Und dann, innerhalb eines Moments, wenn man gerade nicht hinschaut, schwappt schwarze Nacht drüber weg.
Die Meeresküste dagegen banal bis häßlich. Südlich Pomposa beginnt die Touristenadria. Während der Fahrt Meditation über verschiedene Verb-Automatismen.
er- innern
re- member
sou- venir
ri- cognoscere
Wenig Ergebnis, da ich nicht methodisch werden kann an solchen Fragen. Ich denke immer, das kann auch ein anderer tun und hat es bestimmt schon. Ja, sicher, aber das gilt eigentlich für alles. Strenggenommen gibt es keine Entschuldigung für meine Arbeit.
4. Mai, Montag – Gesualdo/Avellino Gegen 17 Uhr trafen wir in Gesualdo ein. Das Wetter war trübe, düster, dem Ort angemessen. Die dunklen Hügel geben der Landschaft einen melancholischen, depressiven Anstrich; es war in etwa, wie ich es mir vorgestellt hatte. Gesualdo ist ein größeres Dorf, rund um die Burg gebaut, die noch bewohnt ist, dennoch stark verfallen. Der Geist Don Carlos war zu spüren, überall. Die Kirche, die er hat bauen lassen, war wegen Totalrenovierung geschlossen. Ein Arbeiter erzählte uns, das (einzig authentische) Porträt Carlos, wegen dem wir die Kirche aufsuchen wollten, sei ins Museo Civico von Avellino ausquartiert.
Gerne hätte ich die Burg besichtigt, doch war das nicht möglich, man hätte brieflich anklopfen müssen. Mein Fehler.
Als wir so untätig auf der Dorfpiazza, unterhalb der Burg, herumstanden, trat ein alter Mann auf mich zu. Er fragte, ob wir die Kapelle besichtigen möchten? (Welche Kapelle?) Ich sagte ja, gerne. Er holte aus seinem Zeitschriftenladen einen riesigen Schlüssel und führte uns quer über die Piazza, wo im Eck eines Häuserkarrees wirklich ein winziges Kapellchen stand. Der Mann schloß auf und winkte uns hinein. Ich hatte alles mögliche erwartet, aber das nicht: Die Kapelle war von strahlendem Weiß, jedoch – leer. Völlig leer! Nichts darin, kein Stuhl, keine Bank, kein Kruzifix, keine Madonnenstatuette, NICHTS! Der alte Mann verbeugte sich und lächelte. Ich war unfähig zu sprechen; die Szene war mehr als gespenstisch. Ich drückte dem Mann einen Zweitausendlireschein in die Hand, worauf er noch mehr lächelte, mit einem Gesicht, das sagte: Wäre doch nicht nötig gewesen … Ja, er hat uns nur eine Kapelle gezeigt mit NICHTS darin, bzw. sehr viel Weiß. Ein leerer Raum voll – Weißheit, würde Krantz sagen. Ich war noch Stunden danach völlig perplex ob dieses Vorfalls.
5. Mai, Dienstag – Neapel Um elf in Napoli, direkt zur Gesù Nuovo. Dort suchten wir die (rekonstruierte) Grabplatte Carlos, fanden sie aber erst mit Hilfe eines Priesters. Dieser fragte, ob wir Verwandte seien?
Die Schrift der Grabplatte ist noch gut zu lesen; sie berichtet von dem großen Beben, durch welches 1688 der Sarkophag des Fürsten spurlos im Erdboden verschwand. Diese metaphorische Höllenfahrt, das ist wieder so ein Detail aus den Melodien, das mir kein Mensch glauben wird.
Beim Einkaufen pries man uns den formaggio di oggi an, ganz jungen Käse, der wirklich vorzüglich schmeckt. Dann in die San Domenico Maggiore, wo Carlo geheiratet hat, wo die von ihm getötete Maria D’Avalos aufgebahrt war und sich angeblich ein Franziskaner an der schönen Toten verging. Neapel scheint für seine Touristika wenig übrig zu haben. Die Kirche war in einem jämmerlichen Zustand. Seltsam, wo doch sogar Thomas v. Aquin in einem ihrer Nebengebäude gewohnt hat. Hinweisschilder – so etwas gibt es hier nicht. Selbst die Broschüren im Fremdenverkehrsbüro, meist von irgendwelchen Professoren unterzeichnet, sind völlig oberflächlich oder bringen sogar falsche Daten.
Wir gelangten danach in das Innere jenes Palazzo (Severo), in dem die Morde geschahen. Er läßt sich heutzutage kaum von irgendeinem modernen Mietshauskarree unterscheiden. Wir fragten mehrere Bewohner, klingelten an mehreren Wohnungen – die meisten Befragten wußten nicht einmal, wer Carlo gewesen ist. Schließlich trafen wir so etwas wie einen Hausmeister, dem wir erst lang und breit erklären mußten, was wir hier wollten. Der Palazzo wurde in den vierhundert Jahren, die seit dem Doppelmord vergangen sind, so oft umgebaut, daß man höchstens noch die grobe Richtung des Tatortes angeben kann. Und selbst die scheint zweifelhaft. Ich erinnerte mich eines Textes von W. Hildesheimer, aus den siebziger (oder sechziger?) Jahren, in dem er den Palazzo schildert, das Stockwerk und die Räume der Bluttat und am Ende behauptet, im Bett des Mörders übernachtet zu haben. Mumpitz.
Hesses allerletztes Gedicht galt Gesualdo.
Ich fand, es sei für heute genug Feldforschung. Wir gingen hinunter zum Meer, kauften Kokosnußscheiben, gingen nach Santa Lucia, der reinste Kitsch, Ansammlung von einem Dutzend blitzblanker »Fischerhäuser«, in denen sauteure Restaurants stecken. Eine Hochzeit fand statt, zwei gemietete Rolls Royce fuhren vor. Albern.
Wir gingen dann Luftlinie retour zur Gesù Nuovo, ein ziemlich übles Viertel hindurch, die herumlungernden Kids musterten einen unverhohlen wie eine Beute ab. Ich habe deren Flinkheit unterschätzt, habe den Dieb nicht kommen gehört, obwohl ich dauernd wachsam die Gegend rasterte. Eigentlich unglaublich. Plötzlich hing er an Beas Handtasche – es war wohl ein Zufall, daß sie sie fest um das Handgelenk geschnürt hatte. Ein Riemen riß – der Dieb ergriff die Flucht, noch bevor ich ihn packen konnte, das war gut so, ich hätte ihm den Hals umgedreht in jenem Moment. Seine Geschwindigkeit war verblüffend. Nach fünfzig Metern (in fünf Sekunden) blieb er stehen und starrte uns herausfordernd an. Wozu? Ich machte das Zeichen des Kehlendurchschneidens, daraufhin verschwand er in einer Seitengasse, zusammen mit einigen Kumpanen, die während des Überfalls dort an der Wand gelehnt herumstanden, die mir im Falle einer Verfolgung sicher Probleme in den Weg gelegt hätten.
Beatrice überraschte mich. Sie war völlig ruhig und gefaßt, beinah unnatürlich ruhig, kaltblütig. In der Tasche waren 400 Mark, eine Menge Ausweise, der Autoschlüssel und und und … Eine alte Dame auf dem gegenüberliegenden Gehsteig schlug die Hände über dem Kopf zusammen, schien sich bei uns für ihre Landsleute entschuldigen zu wollen. Meine Wut verflog rasch.
Ich habe zu lange auf der Seite der kleinen Gesetzlosen gelebt, außerdem ist keine grobe Gewalt im Spiel gewesen. Dennoch: Wäre der Überfall geglückt, würde ich dem Täter jetzt Tod und Verderben (besser umgekehrt) wünschen, ich weiß es. Die Violenz meiner Emotionen im Moment nach dem Überfall machte mich sehr nachdenklich. Wer meine Frau angreift, gegen den kenne ich keine Hemmungen.
Beatrice hatte keinen Zuspruch, keine Beruhigung nötig. Sie nahm das Geschehene hin wie eine Anekdote am Rand. Mehr war’s ja auch nicht.
6. Mai, Mittwoch – Pompeii Dreckige Viertel. Slums am Fuß der roten Berge.
Dank sei dem Dreck, der mich lehrte, die Dinge nie rein zu betrachten, reduziert, abseits des Fettfilms und Rußes und Eiters. Das Blut, das am Marmortorso klebt, die Galle im Nacken, die Scheiße, durch die der Heros waten mußte. Zeigt mir ein Denkmal – ich seh es bepißt, zeigt mir die Schönheit selbst, ich geh die Würmer kraulen, die dran nagen. Dank sei dem Dreck, der mich überzieht und allem Schrubben trotzt. Ich rieche das schwärende Gedärm im Inneren des Porzellanprinzenpaars. Jede Hoffnung ist von Anstandsdamen bewacht, die heißen: Mißtrauen, Zweifel, Erfahrung, Erinnerung und Angst.
7. Mai, Donnerstag – Pompeii Idee für Objektkunst: Eine kleine Glastruhe, völlig durchsichtig, mit einem Schloß aus Stahl. Der Schlüssel steckt aber von innen; die Truhe (eher ein Kästchen) ist abgesperrt, man kommt nicht an den Schlüssel ran. Titel: Der Käfig (der Sarg?) des Universums.
Vorher dachte ich mir eine Geschichte aus, die im Plot noch Probleme stellt. Es geht um einen chinesischen Weisen, der von bösen Dompteuren in einem Käfig gefangengehalten wird. Der Weise macht keine Anstalten zu fliehen, im Gegenteil, er erklärt sich zum Wächter des Universums, nennt alles Außen Innen, behauptet, die Flächen seines (würfelförmigen) Käfigs schlössen das All nach allen Seiten hin ein, und er bewache die Tür, damit keiner über die Schwelle trete, in den einzig freien Raum, der von den (Außen-) Flächen seines Käfigs nicht umschlossen werde.
Was ist ein Käfig? Etwas, das ein anderes umschließt. Keineswegs muß immer ein Größeres ein Kleineres umschließen. Etwas Unendliches kann nur von einem Ding umschlossen werden, von jedem in sich geschlossenen Objekt. Denn jedes solches Objekt teilt das Universum in sich und den Rest, in Innen und Außen – wobei Außen und Innen austauschbar (eintauschbar) sind.
8. Mai, Freitag – Neapel; später Beatrice Nacht. Ein etwas saurer Soave.
Es gibt in der gesamten Erscheinungswelt nur eines, das wesenswirklich zweidimensional existiert: den Schatten.
Ein von der Sprache belebtes Fehlendes, dabei Unabstraktes, das ist und doch, hehe, »Geworfenheit« bedingt durch ein Ding, das sich zwischen es und einen Lichtquell stellt. (Bin schon total betrunken …) Der Schatten, das Schattenspiel – die Urmutter des Films. Der Filminhalt existiert, im Unterschied zum Schatten, nicht; er reproduziert nur zweidimensional ein ehemals Geschehenes.
Was sich gleich wiederholen läßt, existiert nicht per se. (Natürlich existiert auch der Schatten nicht in sich, doch ist an jedem Punkt seiner merkwürdigen Seinszwischenform, seines »Schattendaseins«, die Einmaligkeit gewährleistet. Die Griechen wußten, warum sie die Seelen ihrer Toten als Schatten dachten.)
Der Schatten ist das aus der Sicht der Sonne Verdeckte, ist toter Winkel, ist der Freiraum, den die Existenz eines im Licht Vorhandenen hervorruft. Man spricht von Windschatten, Tonschatten. Man sagt: Er ist ein Schatten seiner selbst, was meinen müßte: Etwas ihm eigenes Wesentliches hat sich vor (außer) ihn gestellt und fängt das Licht ab, das ihm zusteht. Kann mich erinnern, hatte diesen Gedanken so ähnlich schon mal, im Munch-Museum in Oslo.
9. Mai, Samstag – Pompeii Fuhren ziellos durch die Gegend, Lust auf Besichtigungen sank gegen Null. Fanden einen idyllischen Olivenhain, aßen, lasen, schmusten, spielten Backgammon. Nichts mehr ist wichtig. Fühlte mich herrlich gelöst. Ein Rotkehlchen posierte vor uns, Omen der Liebe.
Als wir um acht Uhr abends zu unserem Campingplatz zurückkehrten, stand vor den Bungalowanlagen eine Schlange von sieben, acht Autos, alle mit jungen Pärchen bestückt. Die Bungalows werden, sofern sie frei sind, an Samstagabenden stundenweise vermietet. Kann man gut verstehen, eine Beischlafkultur unter freiem Himmel ist in dieser Landschaft kaum möglich.
(Beim Anblick der Autoschlange notiert: »Bemannte Frauen; stahlummantelt«)
Eines fiel mir schon lange auf, habe seither darauf geachtet und fand meine Wahrnehmung untermauert: Italienische Hunde bellen nur, wenn es wirklich einen Grund gibt. Kaum ein Kläffer. Die Mentalität des Landes schlägt sich bis zum Haustier durch.
*
Gedanke: Glaube, ich bin ein sehr moralischer Autor – aber immer durch die Hintertür; halte niemandem den Zeigefinger an den Kopf und drücke ab. Der Vorwurf des Zynismus trifft mich hart.
*
Ich kam dahinter, woran mich in Jüngers Spätschriften, insbesondere »70 Verweht«, seine Erwähnungen von Schlachten – Orte und Daten des ersten Weltkriegs – erinnern: an sich nach langer Zeit wieder treffende ExPaare, die da und dort einmal miteinander geschlafen haben und sich gleich nostalgisch die speziellen Umstände ihrer Liaison in Erinnerung rufen: »Da und dort sind wir zusammen gewesen … und wir haben es so und so gemacht …«
*
Die ganz großen Widersacher einer Epoche umarmen, ergänzen einander im nachhinein, so Nietzsche und Wagner, so auch Jünger und Céline, die nebeneinander zu lesen ein fast vollständiges Bild des Jahrhunderts liefert. Solchen posthumen Umarmungen entspricht im Leben oft ein Haß, der der Ehrfurcht gleichzusetzen ist an Intensität. So verweigerte Jünger bis dato stur jede Auskunft über »Merline« Céline. Dies soll sich in letzter Zeit geändert haben. Jünger bezeichnet seine Abneigung gegen Céline inzwischen als übertrieben. Sieh an.
*
Eine Zeile nur, still und tief, die aller Sehnsucht Ausdruck gäbe, eine Zeile nur, sechs bis acht Zentimeter breit –
10. Mai, Sonntag – Rom Im Abruzzi einlogiert, wie schon in der Flitterwoche. Liegt dem Portal des Pantheons gegenüber. In den höheren Stockwerken Aussicht auf Berninis Elefanten. Schön schmuddelig, dennoch ein Hotel mit Ausstrahlung. 75 000 Lire. Beim ersten Spaziergang sahen wir einen Gehsteigmaler, der mit Caravaggios Vocazione di S. Matteo beschäftigt war, dem Gemälde, das in den Melodien eine gewisse Rolle spielt, und wegen dem wir, unter anderem, hierhergekommen sind. Seit Beginn der Arbeit an Melodien haben sich so viele Koinzidenzen ereignet, daß es schon unheimlich wird. Immer, wenn ich eine Information gebraucht habe, flog sie mir zu, ohne daß ich lange suchen mußte. Picos Neffen nannte ich im ersten Entwurf Galeotto – dann stellte sich heraus, er hieß wirklich so. Castiglios Porträt war genau dort, wo ich es beschrieben hatte. Das Höchste war neulich die Italienische Messe von Gasparo Alberti. Fast im selben Jahr geboren wie Castiglio, hat jener Alberti im Messetext einen Gruß an Alban hinterlassen. (Nulla Albane tuum delebunt saecula nomen/ sed tibi magnanimo fama perennis erit.)
Das MUSS in den Roman!
*
»Das grundlegende Kriterium des Zufalls ist, daß man seine Möglichkeit nie hundertprozentig ausschließen kann.«
Der Satz ist gar nicht so banal, wie er im ersten Moment klingt.
11. Mai, Montag – Rom Am Fenster. Der Moment, da Hannibal Lecter zuschlägt: Langsam auskostend, bewußt, verzückt, die Goldberg-Aria im Hintergrund – eine kultische Handlung, in kontrollierter Ekstase. Man kann hier von einem Typus des Magiers sprechen, der mit jeder Leiche an spiritueller Kraft gewinnt. Silence of the Lambs war, das kann jetzt niemand mehr bestreiten, der zeichensetzendste Film seit Kuckucksnest. In der Oscarnacht saß ich bis halb acht Uhr morgens vor dem Fernseher und erlebte den Triumph mit, toll, ich empfand, als würde man jeden dieser Oscars mir geben. Das kam, ich empfahl (und verteidigte) ihn mit äußerster Leidenschaft gegen viele dumme, falsche, nichtsahnende Beurteilungen. Das deutsche Feuilleton hatte wieder mal wie eine zickige, weltfremde Mutti reagiert. Selbst in meinem Freundeskreis wurde der Film oft billig herabgewürdigt, mit dämlichen Anti-Hollywood-Sprüchen. Auch M. F. hat, auf seinem ureigensten Gebiet, krass versagt. In Lettre war ein hochinteressanter Artikel zum Thema, Verweise auf Bild-Archetypen, noch eine Brücke geschlagen zu Caravaggio, der mir zur Zeit andauernd über den Weg läuft, egal, jedenfalls: Hannibal Lecter – Die Sucht nach Thrill und Gewalt, der Ekel an der Ödnis der demokratischen Stagnation und Korrumpierung, der Wunsch, jenseits der Norm dem Leben ein Stück vom großen Fest wiederzugeben, macht den Serial Killer zum Heldentypus Nummer Eins der neunziger Jahre, nicht nur in USA, bald auch bei uns. Wenn man dann (im Gegensatz zu Henry – Portrait of a Serial Killer) das Monster noch mit Intellekt, Bildung und Charme, sogar mit einem gewissen Sex Appeal ausstattet, ist eine Ikone geschaffen.
*
Melodien – anfangs sind die Sätze simpel, ehrlich, ohne doppelten Boden. Sie sagen genau das, was sie meinen, und lassen nirgends den Verdacht von etwas anderem aufkommen. (Merkwürdig: Indem sie ehrlich sind, wirken sie manchmal manieristisch. Kennzeichnend für die Décadence.)
Mit der Entwicklung des Melodienmythos ändert sich peu à peu auch der Grad der Naivität in der Sprache, bis hin zum 6. Buch, dem anderen Extrem: Pasqualini. Dort meint kein einziger Satz mehr, was er sagt, die totale Umwertung hat stattgefunden, die Umwortung aller Worte.
12. Mai, Dienstag – Rom/Peschiera Heimwärts. Toskana – hier hocken, versteckt in den Büschen, wilde Kilometer. Wenn man nicht aufpaßt, mischen sie sich unter die Straßen, verlängern die Reisestrecke.
*
Am Gardasee läßt sich außerhalb der Saison spottbillig wohnen. Letztes Jahr fanden wir von Privat ein halbes Palais, für grade 40 Mille.
Klar, die Gegend ist touristenverseucht, ist Karikatur geworden, dennoch, im Spätherbst oder im März muß es hier ganz angenehm sein. Pizzaessen in Peschiera – war fasziniert vom neuerrichteten Dorfkern, steril, hochglanzpoliert, deutsch-englisch-niederländisch. Eine Mixtur aus Fischerhafen, Burgmauer, Kleenex und Fertighäusern. Nichts ist echt, nur Kulisse und Klischee, Disneyland.
Hier in der Nähe, auf einem Campingplatz, habe ich beachtliche Teile meiner Kindheit abgeleistet. Hatte das Bedürfnis, auf die Straße zu pissen. Hab’s auch getan. Auf dem Mittelstreifen.
*
Würde meine Geliebte mir nicht immer wieder sagen: Ich liebe dich TROTZDEM – diese Liebe würde erheblich an Wert verlieren. Etwas Liebenswertes zu lieben ist ja nun wirklich nichts Besonderes.
13. Mai, Mittwoch – Gilching Einladung zur L.-Party. Werde hingehen, glaub’ ich, obwohl es meist langweilig war. Er versammelt haufenweise unnatürliche (skurril ist als Wort zu schade) Leute, in deren Sonderbarkeit keine besondere Qualität zu finden ist, die nichtmal phantasieanregend wirkt. Außerdem geht mir seine Flippigkeit auf den Sack. Wann hätte er je mit mir ernsthaft über etwas geredet? Ein Pop-Junkie, zuviel mit banalem, modischem Firlefanz beschäftigt. Ein Trenddackel.
14. Mai, Donnerstag Ein Mädchen redete sehr allgemein über filmische Ästhetik, ließ ein Klischee nach dem andern los und das in rasender Eile, breitete vor mir alle denkbaren Gemeinplätze aus, derer sie sich erinnern konnte. Ich sagte immer jaja, schon, aber – weiter kam ich nie, da ihr wieder etwas Neues eingefallen war. Nach einiger Zeit machte ich nur Hmmm und Hmhmmm, und dann, nach zwanzig Minuten Monolog, stand sie auf, sagte: »Ich will dich ja nicht belabern!« – und ging. Was das Schlimme dran war – ich kam mir fast schuldig vor, einen Disput nicht wirklich angestrebt zu haben, wieder arrogant gewesen zu sein. Bin viel zu freundlich in letzter Zeit, hätte die Tussi einfach stehenlassen sollen.
*
Kurz mit T. M. geplaudert und ihn endgültig abgeschrieben. Zu allem, was ich erzählte, meinte er entweder – »Ooh, das ist aber doch guuut –!« oder »Nein, das ist schlecht, neinnein!« Es beeindruckt mich, jemandem gegenüberzusitzen, der soviel weiß, der immer, fast ohne zu überlegen, ein Urteil bei der Hand hat.
Wie man munkelt, sprach er mal beim städtischen Verkehrsamt wegen einer Festanstellung als Straßenschild vor und erhielt nur aufgrund seiner Frostanfälligkeit eine Absage.
Ich finde, lang hingestreckt, hätte er zu einem passablen Pannenstreifen getaugt.
*
Als ob der Freaks noch nicht genug sind: Spät in der Nacht noch mit I. telefoniert. Sie kokettiert wieder mit dem Gedanken, sich umzubringen, und weist hundert aberwitzige Gründe nach. Sie hat sich in den vergangenen Jahren wegen so vieler Dinge umgebracht … Ein Hypochonder, wie er im Buch steht. Meist steht in ihren Briefen: »Die Treppe stürzte mich hinab«, oder: »Das Messer hat mich geschnitten« oder »Die Sonne hat meinen Rücken verbrannt, als ich gerade schlief …« (Wie heimtückisch!)
Nie zeichnet sie selbst verantwortlich. Und den Suizidgedanken, den wird sie niemals in die Tat umsetzen, es wäre in der Tat zuviel Aktivität erforderlich. Irgendwann wird das Gras in sie beißen.
16. Mai, Samstag Wolfgang ruft an, verweist etwas schelmisch darauf, daß bald wieder ein Fest auf der Praterinsel stattfindet. Ich hatte die Geschichte schon fast vergessen, wahrscheinlich, weil ich damals kein Tagebuch geführt habe und die Geschichte zwar sehr witzig ist, aber alles, das ich nicht für irgendeinen Text verwenden kann, bald von mir vergessen wird.
Ich lief mit Beatrice am Isarufer entlang, es war ein warmer Samstagabend im Juni, und wir hatten uns um acht mit Wolfgang auf der Praterinsel verabredet. Uns war langweilig gewesen; Wolfgang, der überall und immer dabei ist, der sich auskennt, erzählte uns, auf der Praterinsel sollte ein großes Fest sein. Absolventen der Kunstakademie feierten. Das Völkchen war mir egal, aber ich hoffte darauf, daß es bunte Lampions gab, denn ich hatte plötzlich eine unerklärliche Lust, Reihen bunter Lampions zu sehen. Als wir hinkamen, war da auch ein Fest – nur durften wir nicht hinein. Der Türsteher verlangte unsere Einladungskarte, wir hatten keine, standen noch eine Weile herum und warteten auf Wolfgang. Um halb neun hatte er sich immer noch nicht blicken lassen – und wir gingen Billard spielen.
Am nächsten Tag rief Wolfgang bei mir an. Sein Tonfall klang leicht säuerlich, er fragte, warum wir denn nicht auf das Fest gekommen seien? Ich antwortete, wir seien schon dort gewesen, aber es hätte einer Einladung bedurft – woher er denn eine gehabt hätte?
Da lachte er lange, lange und dreckig, und kriegte sich kaum mehr ein. »Ich hab’ dem Türsteher gesagt, ich bin ein Freund von Helmut Krausser, dem Schriftsteller – schon war ich drin!«
München …
19. Mai, Dienstag Ich erzähle überall laut herum, daß ich zur Zeit ein Tagebuch führe, und ich betone, ein überaus präzises. Sofort verhalten sich die Leute um einiges freundlicher, höflicher, vorsichtiger. Die Zeugenschaft schreckt sie auf.
*
Ein Ehepaar – beide über 80 Jahre alt, sie sterbenskrank – wollte sich mittels Auspuffgasen gemeinsam töten im Wald.
Der Kerl, der dreist dazukam und beide mit Gewalt aus dem Auto zerrte, wird von der Presse als Held gefeiert.
Die Unverschämtheit gegenüber dem Freitod hat beängstigende Formen angenommen.
20. Mai, Mittwoch Mir fällt grad’ ein, heute ist es in etwa ein Jahr her, seit P. an den Baum gerast ist. Er wird mir immer in Erinnerung bleiben, aufgrund einer Szene bei der T.-Party. Ich hatte damals wohl etwas reichlich mit seiner Frau geflirtet, obwohl ich funktionierende Beziehungen niemals störe, aus Prinzip nicht, egal, jedenfalls bat P. mich auf den Balkon und sagte dort, wörtlich: »Wir sind zivilisierte, gebildete Menschen und haben gelernt, einige der vielen Zeichen zu deuten. Deshalb sag ich dir jetzt, ruhig und sachlich, als eine simple, sehr konkrete Feststellung: Wenn du weiter meine Frau anmachst, schlag ich dich zum Krüppel. Hast du den Informationsgehalt dieses Satzes in seinem gesamten Ausmaß erkannt und aufgenommen? Gut. Dann gehen wir jetzt wieder hinein.«
Das fand ich echt stark.
*
Könnte eigentlich mal seine Witwe anrufen.
*
Es ist nichts einfach, und wenig kann mit kurzen Worten abgehandelt werden. Deshalb muß, wo nicht genügend Zeit vorhanden ist, etwa im Fernsehen, auf knifflige Fragen nicht jene Antwort gegeben werden, die der Wahrheit am nächsten kommt, sondern diejenige, die am wenigsten Schaden anrichten kann durch tendenziöse Auslegung oder einfaches Mißverständnis.
Ich bin doch ein Moralist, zweifellos – allerdings weiß ich, daß es ziemlich egal ist, was man sagt; die Boshaftigkeit hat ihre eigenen Wege, zu lesen und zu hören, den Satz nach ihrem Geschmack zu rezipieren. Eindeutig sein, das kann man höchstens – wie Brecht in seinen entsetzlichen Lehrstücken – auf Kosten der Magie. Aber die Magie allein erhält ein Werk am Leben.
22. Mai, Freitag Nachmittags um drei in den Club gefahren, die S-Bahn war ziemlich voll, bis auf ein einziges Abteil, in dem saß nur ein Pärchen mit einem sieben, acht Jahre alten Jungen. Ich setzte mich da hinein und begann im Heidegger zu lesen, als ich plötzlich eine Ahnung bekam, warum das Abteil derart leer war. Der Junge preßte sich nämlich eine blecherne Mundharmonika zwischen die Zähne und entlockte ihr fürchterliche Geräusche. Das ging durch Mark und Bein, ich ertrug es stumm zwei Minuten lang, dann drehte ich mich um und bat den Jungen, er möge doch bitte damit aufhören. Er ignorierte mich einfach. Nach weiteren zwei Minuten, in denen ich erfolglos probierte, mich mit verschiedenen Selbsthypnosetechniken vor dem grauenhaft knirschenden Lärm zu retten, wendete ich mich an die Eltern, die stumm wie Ölgötzen neben ihrem Balg saßen und keine Miene verzogen, geschweige denn irgend etwas unternahmen. Ein Ökopärchen; Bart er, Zöpfe sie, Latzhosen beide, Häßlichkeit pur.
He, sagte ich, hab’ ich nicht freundlich um ein bißchen Ruhe gebeten – können Sie Ihrem Kind nicht diese Folterharmonika abnehmen?
Das Kind sah mich haßerfüllt an, und die Eltern – sie ignorierten mich einfach, sahen aus dem Fenster. Jetzt platzte mir der Kragen, ich stellte mich vor die Eltern hin und wiederholte meine Bitte, in etwas harscheren Worten vielleicht. Da sieht mich der Müslipapa an (sein Fratz röhrt unterdessen unvermindert weiter) und sagt wörtlich: »Der Junge soll doch einmal kein Faschist werden!« Ich: »Wie bitte?« Er: »Ja, das ist doch bewiesen, daß autoritär erzogene Kinder zum Faschismus neigen!« Ich: »Sie können ihm ruhig ein bißchen Demokratie beibringen! Leben und leben lassen, das muß er zuerst kapieren!« Da unterbricht mich Müslimama (Nickelbrille, Schlabberklamotten, spröd-fransige Haare) und sagt: »Bitte – wenn Sie mit Kindern nicht umgehen können, dann gehen Sie doch!« (Mundharmonika quietscht fortissimo im Triumph)
Und ich ging tatsächlich, ich Schwächling wechselte in Geisenbrunn das Abteil, vertrieben von bärtigen Schlabberfaschisten und ihrem kleinwüchsigen Musikkorps. War sicher das beste so, dennoch: Ich hätte so gern dieses kleine Monster gepackt, mitsamt seiner Mundharmonika aus dem Fenster geschleudert und seine Erzeuger gleich hinterher … ich half mir mit einigen Phantasien. Es gibt Tage, da kann ich mir einen Fratz wie den einfach nicht ästhetischer vorstellen als mit zerschmetterter Schädeldecke an die Wand gepappt. Ich hätte es tun können. Im ganzen Abteil waren nur die drei und ich, niemand sonst. Keine Zeugen. Ich wäre in Germering ganz seelenruhig ausgestiegen – und wieder wäre eine Wohnung frei.
23. Mai, Samstag Endlich einmal Emil und die Detektive gesehen – ich war ziemlich entsetzt. Ein durch und durch kryptofaschistischer Film. Hier ist nichts anderes dargestellt als die Hitlerjugend, bzw. die Volksgemeinschaft, die den Volksschädling in einer großen Treibjagd zur Strecke bringt, durch Bespitzelung, Denunziation, polizeiliche Organisation. An diesem Film (1931) wird wieder deutlich – das Zeitklima war lang vor der Machtergreifung faschistoid, geprägt von der Sehnsucht nach Führung, nach staatlicher Sinngebung. Die Nazis kamen an die Macht, weil sie der Zeitströmung am ähnlichsten waren. Wirtschaftliche Faktoren nur Zuträger, nicht eigentlich Ursache. Mythische Prägung? Sehr schwierig.
In diesem Sinne noch einmal über den Disput mit M. F. nachgedacht, der in M – eine Stadt sucht einen Mörder ähnliche Tendenzen erkannte und dafür heftigen Widerspruch erntete; niemand wollte Fritz Lang in Faschistennähe rücken, man reagierte wie eine betuliche Tante des deutschen Feuilletons. Natürlich hat M. F. recht. Den Langschen Film durchzieht eine faschistoide Ästhetik, ganz klar, man denke nur an die langen, ledernen (Gestapo-)Mäntel, die hier zum ersten Mal filmisch auftauchen und ungeheure Wirkung hinterlassen. Und das Grundthema ist wieder gleich: Über alle »Parteien« hinweg wird ein Notkonsens getroffen, um die »Ratte« aus dem Volksorganismus zu entfernen. Langs Größe ist darin zu sehen, daß er unvermutet Mitleid mit dem Mörder zuläßt; der Monolog Peter Lorres vor seinen selbsternannten »Richtern« macht alles Vorangegangene vergessen, rettet den Film nicht nur, sondern heiligt ihn.
*
15 Uhr. Beatrice. Woge der Leidenschaft, prompt saturiert, zweimal – dann hatte ich rasendes Kopfweh, aber es ergab sich ein herrlicher Dialog.
Ich: Hab’ Kopfweh!
Sie: Oh …
Ich: Ja. Der Wein gestern … war ziemlich schwer …
Sie: Oh … Hat dich das Trinken wieder zu sehr angestrengt?
Ich: Konnte das Glas kaum heben, so schwer war der …
Sie: Hängst du deshalb so rum jetzt, du Senkblei?
Ich: Genau. Laß mich in Ruh … mir platzt der Schädel.
Sie: Geh endlich runter von mir, du Faultier!
Ich: Uff …
Sie: Faultiere bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von anderthalb bis zwei Kilometern in der Stunde. Aber wenn sie den Hilferuf ihres Jungen hören, können sie ihre Geschwindigkeit auf bis zu vier Stundenkilometer steigern.
Ich: Echt? Was willst du mir damit sagen?
Sie: Du kannst mir die Schokolade aus dem Kühlschrank holen. Du kannst es. Wenn du dich ganz fest konzentrierst und es wirklich aus der Tiefe deines Herzens willst, dann schaffst du es.
Ich: Meinst du?
Sie: Bin mir ganz sicher.
Ich: Und wenn mir unterwegs was passiert?
Sie: Behalt ich dich in ehrendem Angedenken.
Und fünf Tonnen schwer vor Glück machte ich mich auf zu den eisigen Zonen des Kühlschranks.
*
Habe telefonisch El Conde nach dem pathetischsten Moment seines Lebens befragt, für die Neufassung von Durach. Er nannte sofort das Cramps-Konzert, ’86 in München, als er in der ersten Reihe stand. Lux Interior beugte sich zu ihm hinab, packte ihn beim Schopf und sang ihm ins Gesicht: »YOU’RE THE MOST EXALTED POTENTATE OF ROCK!«
Für einen Gitarristen sicher ein divinatorisches Erlebnis. Mir fiel wieder ein, daß ich damals keine Karte mehr bekommen hatte und dreist zur Abendkasse marschiert war, um die Pressefreikarte für Andreas B. zu verlangen. Alle drei? fragte die Kassiererin. Klar, sagte ich, fast ohne nachzudenken. Und sie gab sie mir! Das war toll. Zwei der Karten verhökerte ich für 50 Piepen pro Stück, mit der dritten ging ich hinein. Eins der besten Rockkonzerte, an die ich mich erinnern kann. Ich mußte nichtmal ein schlechtes Gewissen haben, denn Andreas B. und Begleitung wurden trotzdem reingelassen, nach einem kurzen Donnerwetter.
24. Mai, Sonntag Was mich an Typen wie Perceval so maßlos aufregt, ist die fehlende Demut, Ehrfurcht, wie man’s auch nennen mag, vor jeder Art Tradition in der Kunst. Eine Beleidigung, eine Herabsetzung aller gewesenen Menschen. Ob es nun Boccaccio, Monteverdi, Mussorgski, Hercules Seghers oder sonstwer ist – von jedem liest er, wenn man ihn dazu auffordert, ein paar Seiten, hört sich eine halbe Platte an, betrachtet ein, zwei Bilder – um dann ein für allemal ein und dieselbe unbeirrbare Meinung darüber zu haben, und, was viel schlimmer ist, gleich am nächsten Tag diese Meinung in irgendeiner Zeitung der Welt zu verkünden.
25. Mai, Montag Weiter in Melodien gelesen. Alptraum. Bin am Boden zerstört. O je … Das 5. Buch – totale Kacke – geschludert, hingeworfen. Dreck. Muß es nochmal schreiben – ganz neu, darf mich nicht von ein paar gelungenen Sätzen zu einer bloßen Korrektur verleiten lassen. Das ist sehr deprimierend. Ganz neu … 160 Seiten. Zeit: fünf Wochen. Das wird, in meiner momentanen, müden, saturierten, ›fertig‹ geglaubten Stimmung, problematisch. Dazu noch der Ovid. So eine Scheiße … Ich hatte mich so auf den reinen Genuß des Sommers gefreut. Komme mir nun vor wie ein Fabrikarbeiter. Wo ist meine Faul- und Freiheit hin? Schachturnier ist gestrichen. Die gesamte Personenkonstellation Nicole – Täubner – Mendez – Stancu muß anders strukturiert werden, so wirkt es nicht logisch genug.
Werde versuchen, T. P.s Essay Im Trickstudio einzubauen, obwohl – es ist zu lang für ein Motto. Was tun? Wem es in den Mund legen? Alles Scheiße. Hätte Lust, den ganzen Kram hinzuschmeißen und Kritiker zu werden.
*
Das narrative Schreiben kommt mir manchmal so hofnärrisch vor. Dabei – ich wollte immer Hofnarr werden … Aber die nehmen nur Zwerge.
26. Mai, Dienstag Scheußlich langweiliger Tag. Kurz mit M. F. telefoniert; vereintes Schimpfen auf Alles und Jeden. Hab Lust, mir ein Gewehr zu kaufen und in Darmstadt ein wenig herumzuwüten, das würde Spaß machen, das korrupte Viehzeug vom Literaturfonds einzeln abzuknallen. Gespräch lief ungefähr so: Die Demokratie wird zunehmend dirigistisch; weil allen verboten ist, was nur auf viele schädlich wirkt, werden die kreativen Freiräume der Eliten gekappt, eine große Nivellierung findet statt, aus der für alle Unheil droht. Am erfolgreichsten beschneidet man die Freiheit unter dem Vorwand, irgendwas beschützen zu wollen. Auf der Suche nach einem kämpferischen Lebensinhalt, einer ideologischen Beschwichtigung der Seins-Ödnis, schießen Verbände jeden denkbaren Zwecks aus dem Boden – und schützen Spatzen mit Kanonen. Überall liegen die Scharfschützer im Hinterhalt. Stichwort: Gesundheitsfaschisten. Sowie ausgereiztes Pflichtprogramm: Meldepflicht, Schulpflicht, Wehrpflicht, Versicherungspflicht, sogar die Pflicht, auf einem Friedhof begraben zu sein. Die Zensur, getarnt als »Jugendschutz« (zensiert sind aber meist Werke, die trotzdem erst ab 18 freigegeben sind …). Angeblich soll, ich würde mich krank lachen, wenn das geschieht – die Mutzenbacherin wieder auf den Index kommen. M. erzählt vom Ärger, den Buttgereit in Berlin mit einer schrecklich betroffenen Richterin erlebt. Die arme Schockierte will seinen Film PHYSISCH vernichten, will alle Exemplare EINSTAMPFEN. Ich finde, wenn es dahin kommt, muß auch sie eingestampft werden, dann sind Fanale nötig. Wir werden zu Tode geschützt. Neues Beispiel: Vergewaltigung des Ehepartners soll strafrechtlich genau wie jede andere Vergewaltigung verfolgt werden. Absurd. Das kommt einer Abschaffung der Ehe gleich. Neinnein, keine Verharmlosung des Tatbestands, Quatsch – aber die Ehe, das war von jeher ein Stück Freiraum gegenüber der Staatsgewalt, z. B. wird das archaische Recht hinfällig, gegen seinen Ehepartner nicht vor Gericht aussagen zu müssen. Verdammt nochmal, wer den Fehler begeht, einen potentiellen Vergewaltiger zu heiraten, hat eben einen Fehler begangen, traurig, kann den Täter ja verlassen, basta, sollen sich halt länger prüfen, die sich fesseln. Was ist daran falsch? Hauptproblem: Beweislast. Die Basis des demokratischen Strafrechts, das in dubio pro reo, gilt anscheinend nicht mehr. Indizienherrschaft. Und die Nazi-Feministinnen (»Kauft nicht bei Männern!«) johlen begeistert. M. Tyson muß sechs Jahre in den Knast, Desirée Washington konnte vor Gericht überzeugender heulen als er, das ist der einzige Grund. Bloß weil Tyson ein Arschloch ist, soll dieser Fakt hinweggewischt werden? Und ich kenne Frauen, die nennen sechs Jahre noch zuwenig! Das ist der Moment, von dem ab ich für die weibliche Empfindsamkeit wirklich kein Verständnis mehr aufbringe. Sechs Jahre! Die sollten sich mal eine Woche lang in die Zelle setzen, um ein Gefühl für Gitterzeit zu bekommen. Höhepunkt der Perversität: Desirée werden 15 Millionen Dollar Schmerzensgeld verschrieben; jetzt suchen natürlich jede Menge Nachahmer nach ihrem prominenten Vergewaltiger. Ich wette, das wird der neue Sport werden: Fuck&Cash. Am besten: Sich vor dem Fick eine Beischlafseinverständniserklärung unterschreiben lassen.
*
Telefonat tat gut, hab es in Stichpunkten notiert – und denke mir: Das gleiche würde ich so keiner Zeitung sagen, das wäre unklug – was wiederum zeigt, welches Labyrinth aus Tabus über die öffentliche Diskussion gestülpt ist. In Deutschland existieren extreme Unterschiede zwischen dem Jargon im Freundeskreis und dem im Medium. Bedenklich. Natürlich nimmt man am nächsten Tag immer viel von dem zurück, was man im Zorn hinausposaunt hat, ganz klar; die Frage ist aber vielmehr, ob durch das Kondom der Vorsichtigkeit der Gesellschaftstalk nicht so verlangweilt und geglättet wird, daß dadurch weit größerer Furor entsteht – Verdrossenheit an der Glätte und Raffinesse, am Understatement, an dämpfenden Präambeln. Zu jeder Aussage wird gleich eine Abwertung derselben mitgeliefert. Niemand will mehr Feinde haben. Viel Feind, wenig Geld.
30. Mai, Samstag Laut Beschluß des obersten Gilchinger Revolutionstribunals ist der Mai von diesem Jahr an nur noch dreißig Tage lang. Der ehemals 31. Mai wird ab sofort dahin verlegt, wo Mai am dringendsten benötigt wird – Ende Februar. Habe keine Lust mehr auf Tagebuch. Ist Blödsinn, so ein Tagebuch, hab’ auch keine Zeit dazu. Und am Ende siegen die Bakterien, wenn überhaupt irgendwer …
JUNI 1993
1. Juni, Mars Intensiver Traum ohne Menschen, noch auffällige Dinge: Schillernde Netze, die die Sonne auf dem blaugekachelten Grund des Bassins auswirft. Tanzende Lichtseile, glitzernde Schlangen. An der Wasseroberfläche dagegen: Sonnenölfilme, fette Schlieren, treibende Kastanienblätter.
*
Heute ist der letzte Tag von Beas Urlaub. Um 15 Uhr unterzeichneten wir den Mietvertrag unserer ersten gemeinsamenWohnung. Die Nebenkosten waren plötzlich um 300 Mark höher als vorher annonciert. Ich war ziemlich sauer deswegen, es gab einen kleinen Streit, ich wollte dem Immobilienhai schon an den Kragen. Dann, notgedrungen, beruhigte ich mich, es hilft ja nichts, es wäre äußerst lästig, jetzt noch nach was anderem zu suchen. Und Beatrice muß endlich zu Hause raus.
Der Makler war so widerlich … Ich tat ihm Weisheit aus der Zukunft kund, daß dereinst ein wütendes Volk ihn aus dem Bett zur Laterne tragen werde, wo er dann hinge und verfaule. Allein, er tat das sehr gelassen ab, der Tag sei lang noch nicht gekommen.
*
Ich: Ich hab’ doch gar nichts gesagt.
Bea: Dein Gesicht hat gesprochen. Du hast mal wieder dein Gesicht nicht halten können.
*
Die CDs im Schließfach abgelegt. Um 20 Uhr in der Riemer Charterhalle, Konzert meiner alten Lieblingsband, des Gun Club. Das neue Album (Lucky Jim) ist allerhöchstens ordentlich. M. Fuchs-Gamböck erzählt mir von seinem Interview mit Jeffrey Lee Pierce, er soll erschreckend aussehen, ausgelutscht und abgewrackt. Ich entgegne, daß er so schon seit 10 Jahren aussieht. Und wirklich springt Jeffrey mit einer ungeheuren Energie auf die Bühne, I hear your Heart singing, er trägt Nickelbrille und Maoistenkappe, geriert sich wie ein Derwisch. Das Konzert ist längst nicht ausverkauft, im Gegensatz zur großen Nachbarhalle, wo INXS spielen. Eine nostalgische Mücke schwirrt um meinen Hals. Es gibt Unmut im Publikum, wenn Songs der neuen Platte gespielt werden, kaum wird dann geklatscht. Jeffrey macht seinem Ärger darüber mit obszönen Gesten Luft, kündigt die alten Fetzer in verächtlichen Worten an (»Here’s for you, suckers …«). Die letzte Zugabe, den Titelsong des neuen Albums nennt er: »The best song I’ve ever wrote«. Das hat etwas rührend Trotziges, Junggebliebenes, und natürlich stimmt es nicht, aber das macht nichts, er hat trotzdem recht.
*
Gedanke: Es wird eine Musik geben aus elektrisch-chemischen Impulsen, die direkt ›ins Blut‹ geht, die nicht nur auditiv, sondern auch, und vor allem, neuronal funktioniert, eine Mischung aus Musik und Nervendroge, eine interaktive Giftsymphonie.
2. Juni, Merkur
(seltsam, daß so viele Geschäfte am Mittwoch Nachmittag geschlossen sind)
Mythos – ein von der Linken sehr mißtrauisch beäugtes Wort, bedeutet bei mir einfach nur: die Wirkung des Gewesenen auf die Rezeption des Gegenwärtigen.
Ein Küchenmesser des späten neunzehnten Jahrhunderts gewänne stark an Wert, wüßte man, daß es sich um das von Jack the Ripper handelt. Die Bedeutung, die ein Objekt nach Bekanntgabe seiner ›Prominenz‹ (finde grad kein besseres Wort) hinzugewinnt, nenne ich dessen Mythosgehalt. Mythos ist die Differenz von Ding und Sprache, von Sein und Sage, ist immer etwas Zugetragenes. Lange Meditation über die Verbbildung ›sich zugetragen haben‹ für ›geschehen sein‹, ›passiert sein‹.
*
Hänge viel herum und träume. Der Trubel war so groß, daß ich jede Minute Ruhe ausnutzen muß. Morgen nach Leipzig, kotz auf Leipzig, die Lesungen werden immer unerträglicher, aber darf man sich beschweren? Von den bisher geplanten 40 Terminen sind erst 17 abgeleistet. Die ersten 10 haben Spaß gemacht. Andere Städte, in die es einen nie verschlagen hätte, Menschen, viele verwertbare Anekdoten. Noch habe ich nichts von dem Bielefelder Freak gehört, seltsam; ich sandte ihm Fette Welt, und noch nicht mal ein Dankeskärtchen kam zurück. Wir waren mit Günther Butkus flippern, dort war ich mit ihm ins Reden gekommen, er erzählte von seiner Freundin, die er, welch grandioser Zufall, schon in seinem letzten Leben gekannt und schmählich an die Nazis verraten hätte – weshalb er ihr im jetzigen Leben dienen müsse, um ein wenig seiner Schuld abzutragen. Er selbst, sagte er, könne sich an jene Sache nur noch sehr undeutlich erinnern, aber seine Freundin, die wisse alles noch ganz genau, naja, schließlich sei sie ja damals ins KZ gekommen, nicht er, und was sie davon vergessen hatte, das sei ihr nach Rückführungshypnose wieder eingefallen. Dies alles erzählte er mit traurigem Ernst. Günther und ich hatten uns angesehen, und, obwohl wir schon reichlich getrunken hatten, zusammengerissen. Erst später, als sich die Runde aufgelöst hatte, brach das Gelächter aus uns hervor, wie aus berstenden Deichen, und wir tranken noch einen auf die Frauen der Welt.
3. Juni, Jupiter Der erste Tag der Messe. Am Abend finden in Leipzig 22 Lesungen statt, dennoch ist die kleine Buchhandlung im Messebau gefüllt bis auf den letzten Platz, was heißt: 24 Hörer. Ich lese eine Pasqualini-Passage, danach ergibt sich eine politische Diskussion mit dem Publikum, die Ch. für mich beendet, weil sie Hunger hat und in Auerbachs Keller ein Tisch reserviert ist. Die Jungs von Wist & Ressel stellen sich vor, bei denen, in Potsdam, les’ ich irgendwann im September. Nette Kerle.
Auerbachs Keller – wohl unvermeidlich. Wie vieles ›Unvermeidliche‹ eher enttäuschend. Gutbürgerliche Küche in leicht morbidem, feintuendem Herrensaal. Biedermeierlich, doch wie mit zarten schwarzen Schleiern verhängt; es wirkt einfach merkwürdig, wenn ein befrackter Kellner, die Serviette schulmäßig über dem angewinkelten Arm, einen Teller Gulasch an den Tisch bringt.
Rauchen ist Liebe.
Je unglücklicher ich bin, desto kitschiger werd’ ich.
Sie fragten den Verurteilten, ob er noch etwas sagen möchte. Er antwortete ja, etwas, das er schon sein ganzes Leben lang einmal hätte sagen wollen – aber ausgerechnet jetzt fiel es ihm ums Verrecken nicht ein.
M. versteht übrigens nicht, wie ich mich entschließen konnte, nach Klagenfurt zu fahren. Meine Begründung ist äußerst simpel: Neugier. Wenn ich nicht fahren würde, würde ich mich ein Leben lang fragen, wie das wohl geworden wäre. M. stimmt schließlich zu: Klagenfurt könne niemandem ernsthaft schaden.
4. Juni, Venus Anruf bei einer Wiener Theaterdirektorin. Höre eine laszive Stimme: »Ich bin die Anrufbeantworterin. Sprechen Sie auf mich drauf …« Hab vor lauter Lachen aufgelegt.
*
Hier in Gilching gibt es kaum noch eine junge Frau, die nicht durch ein Kind entstellt ist. Tatsächlich steht in der Zeitung, es wäre die gebärfreudigste Gemeinde im ganzen Landkreis. Furchtbar … Überall Kinderwägen, kreischende Bälger, abgestempelte Frauen, nur noch Mütter gibt es hier, Mütter, es ist widerlich. Für das ganze Gewürm braucht es Kindergärten, Schulen, Supermärkte, Häuser – und irgendwann Friedhöfe. Vielleicht nehm’ ich mir bald wieder ’ne Stadtwohnung.
*
Mit einem meiner Schachschüler diskutiert über Elitarismus und Demos. Es störe ihn an der Demokratie, daß jeder Idiot genau wie er eine Stimme habe, die er bei Wahlen abgeben dürfe. Diese Auffassung von Egalität hielt er für bedenklich, ja fatal und stellte ein Ständewahlrecht in den Raum, das die Zahl der abzugebenden Stimmen nach Bildungsgrad differenziert, z. B. bei Hauptschulabschluß eine, bei mittlerer Reife zwei, bei Abitur drei, bei einem akademischen Grad vier Stimmen o. ä. Diese Gedanken hatte ich als Sechzehnjähriger auch. Ich antwortete ihm, er dürfe nicht übersehen, daß numerische Egalität nur formal bestünde, daß gebildete Menschen auch über die viel größeren Möglichkeiten verfügten, andere zu beeinflussen, daß von daher alles schon ganz in Ordnung sei, solange sich die Gebildeten nur engagieren.
*
Man geht an der Öffentlichkeit zugrunde wie ein an Land gezerrter Fisch. Es sei denn, man gehört zur seltenen Gattung, die sowohl über Lungen wie über Kiemen verfügt (Beatrice: »Dipnoiformes«).
5. Juni, Saturn Beatrice betreibt magische Hypochondrie, indem sie nämlich eine ihrer kleinen Magenverstimmungen nacheinander für ein Sympton von Mumps, Gelbsucht, Salmonellenvergiftung, Schwangerschaft etc. hält. Sie meint, wenn man alles Mögliche in Erwägung zieht, tritt alles das nicht ein. Sehr schlau. Übrigens ein Glaube, dem man häufig begegnet. Die Vorgehensweise des Schicksals wird für ziemlich hinterfotzig gehalten, wo es uns doch sowohl mit dem Erwarteten als auch dem Unerwarteten in die Pfanne hauen könnte.
*
Opferstellen der Zensur (Folge I):
Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. (Und Gott fesselte die Schlange und hieb ihr mit einer scharfen Axt beide Beine und Arme ab. Und er sagte:) Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang.
(1. MOSE 3,14)
*
Schattenspiele: Wand wird in Leinwand verwandelt.
6. Juni, Sol Beatrice erzählt einen Satz, den sie aufgeschnappt hat: Die Zeit gibt es, damit nicht alles im selben Moment geschieht. Sie sagt, das leuchte ihr ein. Mir, widerstrebend, auch.
7. Juni, Luna Heute 150. Todestag Hölderlins. Vor zwei Wochen las ich in Tübingen, besuchte zum ersten Mal den Turm, schrieb auch einen Gruß ins Buch. Gedanke: Starke Vision entsteht aus starkem Unbehagen an der jeweiligen Gegenwart.
Zu spät Geborene, die man ›später‹ zu früh Geborene nennt, weil ihre Energie reichte, die Zeit in ihre Richtung zu ziehen.
Umwertung oder Abwertung. Ist der u. der zurückgeblieben? Oder steht er kurz davor, die anderen Läufer zu überrunden?
Habe im Wald ein Glas auf den Jubilar getrunken.
Auf dem Steinberg. Landschaft, menschenleer. Inhuman schön. Die heftigen Märzstürme haben mehr als die Hälfte der Bäume geknickt. Der Wald bietet ein Bild völliger Verwüstung. Allerdings werden durch die kreuz und quer liegenden Stämme auch viele Spaziergänger abgehalten. Man muß in allem Positives sehn.
Ich kämpfte mich mühsam durch den Fichtenfriedhof, die Augen auf den Boden geheftet. Plötzlich standen drei Rehe vor mir. Hier, fünf Kilometer von der Stadtgrenze, sind Rehe ziemlich selten. Nun gleich drei auf einmal. Keine fünf Meter entfernt. Rehe sind sehr feige Tiere. Diese drei aber standen da und sahen mich an und liefen nicht weg. Ich machte einen Schritt auf sie zu. Möglicherweise hatten sie das veränderte Ambiente noch nicht realisiert, oder wollten es einfach nicht wahrhaben. Die Bäume, die ihnen vorher als Deckung gedient hatten, streckten ihr nacktes Wurzelwerk in den Himmel. Vielleicht hatten die Rehe die Schnauze gründlich voll vom Verstecken und Weglaufen.
Wir sahen einander eine Zeitlang an.
Dann endlich sprangen sie fort. Zierlich, ästhetisch, wie man das so kennt.
Ich bin beinahe froh, daß sie mich nicht angegriffen haben.
Lustig: die Jägerstände sind durchweg unbeschädigt. Die Förster haben sie alle an gesunde Bäume montiert.
Schlaue Kerlchen sind das. Es sieht wirklich sehr komisch aus. Der ganze Wald besteht aus Jägerständen.
8. Juni, Mars Abends sehr unerfreuliches Treffen mit R. K. in den Fraunhoferstuben. Wirkte violent und gefährlich (»… jetzt mußt du ganz vorsichtig sein …« »Wieso – schlägst du mich sonst?« »Ach …« Ich hatte das Gefühl, daß er die Idee erst verwarf, als ich sie zur Diskussion stellte.). Wir sprechen nicht die gleiche Sprache. Ich bot ihm von meinem Wein an, er tat, als wär’ das ein Affront gegen den Antialkoholiker in ihm (»… warum versuchst du, mich zu verändern?«). Bernhard kam und erlöste mich. Wir ließen K. sitzen und gingen. Er rief uns nach: »He – ich kann aber nicht für euch mitbezahlen!« – dabei hatten wir längst bezahlt. Und für ihn mit.
*
Ein Buch, das mir viel gegeben hat, als ich sechzehn war, ist nicht deshalb schlechter geworden, weil ich heute achtundzwanzig bin. Sich nachträglich für einen überwachsenen Jugendgeschmack zu entschuldigen ist ein häufiges wie dummes Unternehmen. Nicht die Zeit des Buches, meine Zeit für das Buch ist vorbei. Im Zweifelsfall leben die Bücher immer länger als ihre Bestatter. Ein Buch, das mir einmal wichtig war, behalte ich in ehrendem Angedenken. Wenn es mir beim Wiederlesen mißfallen sollte, trage ich die Schuld, niemand sonst. Beschämt stelle ich es ins Regal zurück und lasse es in Ruhe.
*
Anders verfahren viele Feuilletonkritiker, die ihre Ranglisten oft aus einer etwas überreifen Haltung heraus kreieren, welche sich klüger glaubt, wo sie nur älter ist.
9. Juni, Merkur Ich war freitags vom Flughafen zurückgekommen, hattte die S-Bahn genommen und war am Hauptbahnhof umgestiegen. Weil mir ein paar Minuten Zeit blieben für den nächsten Zug, schlenderte ich durchs Bahnhofsuntergeschoß. Plötzlich sah ich den Lottokiosk und begriff, daß ich zu spielen vergessen hatte. Freitag, 18:59. Tja, scheiße. Dann begriff ich, daß jener Kiosk Münchens einzige Annahmenstellenausnahme bildet und man dort bis 19 Uhr seinen Schein abgeben kann. Ich griff mir einen, füllte ihn in rasender Eile aus und stellte mich in die Schlange, war der letzte, der, Punkt 19 Uhr, drankam. Am nächsten Tag sagte ich zu Beatrice: »Wenn wir heute was gewinnen, wär’s eine echte Anekdote.« Und wir hatten einen Fünfer, einen hochdotierten dazu: 11 000 Mark. Ich saß die ganze Zeit still im Sessel und dachte, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht, zufällig, am Bahnhof … Unglaublich: seit Jahren dieselben Zahlen gespielt, niemals einen Termin vergessen, ich wäre am Boden zerstört gewesen, ausgetrickst und ausgelacht. Ich bin dem entgangen, das zählt, viel mehr als das Geld.
*
Wollte man die deutsche Literaturkritik grob in zwei Hälften zerteilen, und wer wollte das nicht, so könnte man von einer Popfraktion und einer Klassikfraktion sprechen. Die eine, die Popfraktion nämlich, versucht, immer hip und up to date zu sein. Süchtig nach Neuem, durchsucht sie die Zeitgeistmagazine nach Trends und Symptomen von Trends. Diese Fraktion hat schreckliche Angst, alt zu werden, sie bebt vor dem Moment, an dem sie sich eingestehen muß, daß sie irgendeinen Trend der Folge-Generation nicht mehr nachvollziehen und assimilieren kann. Das wichtigste Kriterium, das sie an Literatur legt, ist das des Originären, schnell ereifert sie sich, begeistert über den größten Quatsch, solang er ihr tricktechnisch vorgaukelt, formal neu zu sein. Und es gibt die andere Fraktion, die Klassikfraktion, die Goethe- und Thomas-Mann-Liebhaber, die im Grunde nichts lieber möchten als immer neue Thomas-Mann-Romane. Ihr Geschmack ist eingefroren, 30 bis 40 Jahre aufholbedürftig, dünkt sich aber zeitlos. Sie hält viel auf Tradition, weil nur die Tradition ihr eine Stellung gibt, ihr ein Überleben ermöglicht. Die Klassikfraktion ist unfähig, über junge Literatur zu schreiben, geschweige denn zu urteilen. Wenn sie dennoch einmal dazu gezwungen ist, kommt es regelmäßig zu den unglaublichsten Peinlichkeiten.
10. Juni, Jupiter Anruf bei Biller: ob er meine Erzählungen schon gelesen hat? Er will erst gar nicht reden, wir hatten zuletzt, wie jedesmal, über Wagner und Jünger gestritten. Biller gibt sich sehr, sehr ermüdet. Wenn man mit ihm über Antisemitismus spricht, kommt regelmäßig ein Satz wie: »Du, ich erleb’ das nun seit 2000 Jahren …«
Diesmal gab ich ihm ziemlich scharf Kontra, um rechtzeitig vor Klagenfurt die Positionen zu klären, aber alles blieb merkwürdig unbestimmt, so als wäre da etwas, von dem ich nichts weiß. Um 17 Uhr dann ruft Biller zurück: Er habe inzwischen die Erzählungen gelesen; Wege des Brennens gefalle ihm sehr, sei ganz großartig, das müsse ich unbedingt nehmen. Selbst hatte ich eigentlich zu Fragen – Fragment einer Arbeitsunfähigkeitserklärung tendiert.
11. Juni, Venus Ich rufe Michael an, teile ihm mit, daß die Wahl auf Wege des Brennens gefallen ist. Er hält die Geschichte für ein wenig zu komplex; in Klagenfurt liebe man einfache Sachen, die etwas Überschaubares focussieren, und sich im zentralen Detail verlieren. Er hat schon recht, Wege … ist eigentlich ein 20-Seiten-Kurzroman. Was soll’s? Viele Alternativen gab es ja gar nicht. Kuppelgeschoß geht nicht, wegen der Rückgriffe auf einen anderen Text, Rekontraktach und Die Auswahl … sind schon veröffentlicht. Der Förster, der Mörder & Ich ist der mir vielleicht liebste Text, aber von dem rät mir jeder ab, Klagenfurt habe für Symbolismus nichts übrig, die Ironie darin würde bestimmt auch keiner verstehen. Ja, aber – wenn das so ist – alle meine Sachen sind doch ironisch … Vielleicht ist es wirklich ein Fehler, dahin, nein, dorthin zu fahren.
*
Neuen Term entworfen, sowohl im Deutschen wie im Englischen einsetzbar: UNID (= Unnatürlicher Informativdialog).
Das ist, wenn zwei Schauspieler zur Aufklärung des Zusehers ein Faktum erwähnen, welches sie in realiter nie erwähnen würden, weil es ihnen selbstverständlich ist.
Beispiel:
Mike: Er ist mein bester Freund, und er steckt tief in der Klemme …
Donna: Falls du es nicht weißt, Laura war meine beste Freundin …
(Dialog aus Pilotfilm Twin Peaks)
Oder:
»Dich mag dein Job im Hospiz vielleicht nerven, aber mich kotzt meine Arbeit als Krankenpfarrer regelrecht an.« (Mann im Bett zu seiner Frau; in Chabrols Alle Vöglein sind schon da)
*
Oft entscheidet über das Urteil, das man sich über ein Buch bildet, die Musik, die beim Lesen im Hintergrund läuft. Wenn sie paßt, unterstützt, ergänzt, Fehlendes ausgleicht – gewinnen die mittelmäßigsten Werke. Wenn sie stört, dazwischenschreit, ametrisch pulst, wirkt das Beste oft schräg. Selbst wenn man bei absoluter Stille liest, klingt noch die Musik von gestern nach.
Die Welt ist der Torso des Gesamtkunstwerks.
*
Feintaktil, wie der Jagdgang eines Insektes auf der Haut, haptisch nur zu ahnen, kleinste Einheit des Unangenehmen.
Bin auf eine fiebrige Weise apathisch, verplempere die Tage, weiß das und kann die Verschwendung nicht einmal genießen. Bin wie ausgedünnt von feinen Sieben.
Warum mir bloß alles so gleichgültig ist? Äußerlich merkt es mir bestimmt niemand an. Auf meinem Hemd steht ›Hektik‹, auf dem Schal ›Passion‹, auf dem Hosenlatz ›Inbrunst‹ – mehr und mehr vorgeschützte Begriffe. Habe schreckliche Angst, weil mein Gedächtnis immer öfter aussetzt, weil mir Wörter nicht einfallen wollen, weil ich irgendwann wieder zu Drecksjobs gezwungen sein könnte, Beatrice nicht frei sein würde etc.
Und dann – ist mir wieder alles so egal, blick ich kühl in meinen Abgrund, leiste eine Libation, sage: Fallen ist ein Flug ins Gewisse, mehr nicht.
*
In sich eingekrümmt, zum Zehennägelkauen biegsam – gebogen, Kopf auf dem linken Knie, die Hände auf dem rechten, in hoheitsvoller Ruhe, die eine Begnadigung des Delinquenten aussprechen könnte, aber es nicht tut, in schroffer, unbestechlicher Dunkelheit. Warten auf die Erkaltung des Körpers, es müssen, so stellt er sich vor, Zehen und Fingerkuppen zuerst absterben, taub müssen sie werden, pelzig und grau, und auch in der Bauchmitte, glaubt er, erschiene solch ein grauer, kalter Fleck und wanderte auf- und abwärts. Das Hirn wird zuletzt einfrieren, das Hirn ist stark und wehrt sich, schaut traurig auf den verlorenen Körper, wähnt sich unabhängig von ihm, bereitet die Flucht der Seele vor, das Exil – und plötzlich bricht die Kälte auch ins Heiliggeglaubteste ein, Koffer werden fallen gelassen, das Entsetzen im Moment des Todes beschwört ein verlogen diabolisches Gelächter herauf, selbst die letzte Wahrnehmung ringt sich nicht durch zu jämmerlichem Geschrei.
Türen werden geöffnet, Licht bricht ein und durchsucht den Raum nach Stehlenswertem. Ihm folgen Müllentsorger nach, reinigen den Boden vom gekrümmten Kadaver und bereiten das karge Bett für den Neuen, der nichts weiß von dem, was geschah, aber Zeit haben wird zu ahnen, genug.
12. Juni, Saturn Mir sind starke Epigonen allemal lieber als schwache Originäre. Warum gerade heute in der Kunst das technische Fortschrittsprinzip so brachial Geltung sucht, ist mir unklar. Es gibt Zeiten, da Originäres nicht nur nicht erwünscht, sondern auch von Nachteil ist, indem es nämlich zur Unzeit Verwirrung in nichtausgestandene Prozesse trägt. Antizipation ist manchmal sinnlos. Beispiel: Was hätte sich geändert, hätte Büchner seinen Woyzeck fünfzig Jahre später geschrieben? Nichts, höchstens, daß der Autor um einiges glücklicher hätte werden können.
*
Im Autor findet der Konvent seiner Ahnen statt, für die er, im günstigsten Fall, Zeremonienmeister spielen darf. Der Dichter ist immer ein Anachronismus; wenn er Glück hat, zu beiden Seiten der Zeit hin.
14. Juni, Luna Habe Ch. das Wort ›Rekontraktach‹ erklärt. Eines Tages war ich blau und hatte eine Vision. Ein Engel erschien mir und sagte: »Rekontraktach. Schreib das.« Und ich fragte: »Na schön, aber was soll das?« Und er sagte: »Ist völlig egal. Schreib das, und alles wird gut.« Daraufhin mußte ich das Wort irgendwo unterbringen, hab einen Roman mit Französin geschrieben – Melodien –, dort brachte ich es unter, Seite 545 (»Ich dacht’, du würdest dir haben letzte Anstand bewahrt und unsre Kontrakt achten!«).
Manche Romane haben wirklich eine merkwürdige Konstruktionsgeschichte.
*
Jussi Björling zu hören heißt mit den Ohren zu schlürfen.
Es ist wieder mal Zeit, zu begreifen, welche Gnade es ist, nur auf zwei Knöpfe drücken zu müssen, und Musik nach Wahl erklingt, Stimmen, deren Lungen längst zu Staub zerfallen sind.
*
Wege des Brennens fertig getippt. Wenn dieser Text gewinnen sollte, wäre es ein Wunder, wenn er nicht gewinnt, die übliche Frechheit.
*
Vision fußt auf Tradition. Da halt ich es mit den Romantikern. Ich liebe den Dichter, der der Tradition Tribut zollt, ohne sich restaurativ in ihr abzuschotten. Ich liebe auch den Visionär, wenn er mir wirklich Neues unter der Sonne zeigt und mir nicht irgendwelches verkrümmte Gewäsch, formale Attitüden, verquaste Bauchspiegelei als originären Meilenstein verkaufen will.
Noch einmal, in aller Deutlichkeit: Alles, was heute in den Literaturen der abendländischen Kultur entsteht, ist zwangsweise epigonal; was nicht epigonal scheint, das ist nur eine besonders raffinierte Mixtur des Gewesenen, und was tatsächlich nicht epigonal ist, das ist unnötiger, verkrampfter Mist. Es wird bald wieder Zeiten geben, die originäre Schübe ermöglichen, doch treten die eben nur periodisch auf. Zwischen ihnen liegen Phasen des Manierismus. In diesen hat es der Literat am schwersten, Gutes und Bleibendes zu schaffen. Er muß die bisherigen Mittel vollständig adaptieren und die Ergebnisse seiner Vorgänger, unangreifbar musealer Spötter, noch übertreffen, muß sie alle in sich haben und aufeinanderprallen lassen, die beste, aufregendste Mixtur finden aus der Kollektion der Duftstoffe. »Das Parfum« ist ein symptomatischer Buchtitel.
*
Die Avantgarde war, von wenigen Großen abgesehen, zu lange eine Kolonie von Künstlern, die aus ihrer Mittelmäßigkeit in die Unüberprüfbarkeit geflohen sind. Sie haben Stäbe ohne Maßeinheit gesetzt, wollten nicht mehr Beste sein, nur Erste. Das krampfhafte Originalitätsprinzip unseres Jahrhunderts hat zu einem starken Qualitätsverlust geführt. Jetzt, im Manierismus, wird Tradition zum Schlüsselwort. Alle Mätzchen sind durchprobiert. Avantgarde ist Mundgeruch.
17. Juni, Jupiter Wahrheit hat in der Kunst nichts zu suchen. Ein Synonym für Wahrheit wäre: keine Kunst, nicht die geringste. Wenn einer über seine schlechte Geschichte sagt, so sei es eben passiert, heißt das nur, daß die Realität meist unerträglich ist. Wenn die Literatur ein Spiegel der Realität sein sollte, müßte sie kitschig, grausam, absurd und unglaubwürdig sein und enorm sexuell.
Zur Zeit ist die Literatur allerdings ein Stück zu weit von der Realität entfernt.
*
In Deutschland parodistisch zu arbeiten, mit leiser Ironie, das ist ein Kreuz, da kann man eingehen dran. Für sowas gibt es in Deutschland keine Tradition, die Kritiker verstehen keinen Spaß. Aber ich auch nicht. Wer mich schlecht rezensiert, der stirbt. Früher oder später.
19. Juni, Saturn Die Heisenbergsche Unschärfe-Relation (daß die Messung eines Phänomens das Phänomen bereits verändert) gilt auch für das Schreiben eines Tagebuchs. Im Moment der schriftlichen Aufzeichnung ist das Gefühl des erzählten Momentes schon nicht mehr rekonstruierbar, längst haben sich dem Eindruck Mechanismen zur Nutzbarmachung des Geschehenen aufgestülpt. Bezugnahme und Auswertung heißen die Phasen II und III