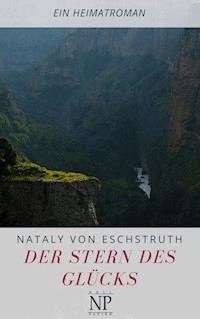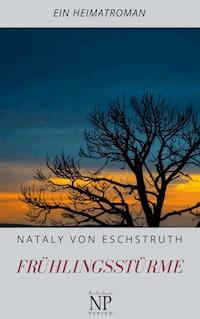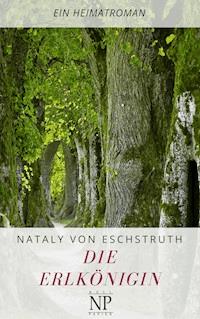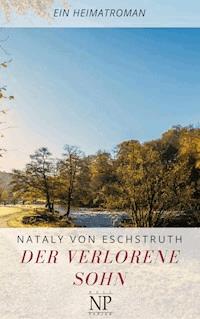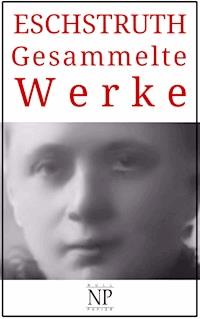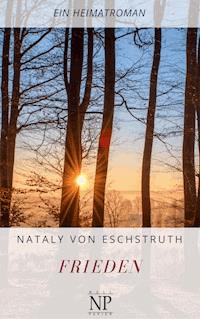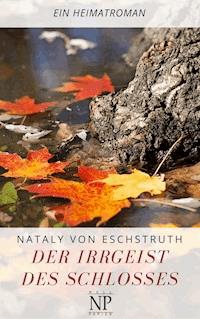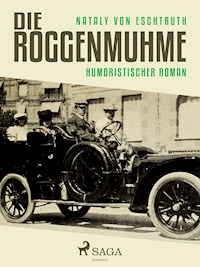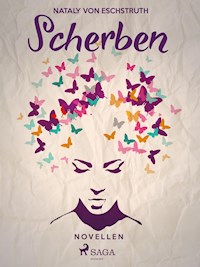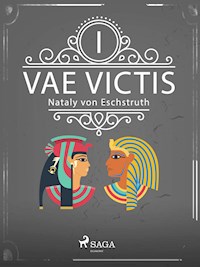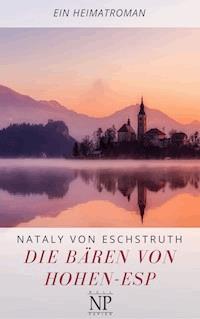
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Nataly von Eschstruth war eine deutsche Schriftstellerin und eine der populärsten und berühmtesten Erzählerinnen der Gründerzeit. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Die Bären von Hohen-Esp
Heimatroman
Nataly von Eschstruth
Die Bären von Hohen-Esp
Heimatroman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962810-74-0
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
I.
»Wenn ein Mädchen einen reichen Mann bekommt, ist es immer glücklich verheiratet«, hatte der alte Kammerherr von Wahnfried gesagt und dabei die weißbuschigen Augenbrauen noch grimmiger zusammengezogen als sonst. »Gundula kann Gott danken, dass der Bär von Hohen-Esp sie zum Weib begehrt! Ist wohl kein Nest so weich gepolstert wie das seine, und wenn man den Grafen ansieht, lacht selbst solch altem Kerl wie mir das Herz im Leibe, wie viel mehr meiner jungen Tochter.«
Die alte Dame, die dem Sprecher gegenübersaß, richtete sich noch straffer empor und legte die großen, kräftigen, schneeweißen und ungeschmückten Hände im Schoß zusammen.
Ihre klaren, durchdringend ernsten Augen hefteten sich ruhig auf die hünenhafte Gestalt des Bruders, der, auf seinen Krückstock gestützt, vor ihr stand und sie herausfordernd anblickte.
»Jung, schön und reich«, sagte sie langsam, »ja, das ist er, aber er ist noch mehr! Graf Friedrich Carl ist leichtsinnig. Er ist durch und durch Lebemann; die große Welt, in welcher er, der Frühverwaiste, so jung schon selbstständig ward, droht sein Verderben zu werden.«
»So! Inwiefern, wenn man fragen darf?«
»Weil er sich ruiniert, weil er über seine Verhältnisse lebt.«
Der Kammerherr lachte hart auf.
»Ein Hohen-Esp sich ruinieren! Ein Hohen-Esp über seine Verhältnisse leben! Ahnst du, wie reich der Mann ist?«
»Man kann in einer einzigen Nacht Hunderttausende verspielen! Der Graf ist ein leidenschaftlicher Spieler. Möglicherweise hat er bis jetzt Glück am grünen Tisch gehabt; wenn das aber einmal aufhört, wird er sich und die Seinen rücksichtslos an den Bettelstab bringen!«
»Lächerlich! Verlangst du etwa, dass ich ihm einen Korb geben soll, lediglich, weil er mal in fideler Gesellschaft ein Spielchen macht?« Herr von Wahnfried nahm seine Promenade durch den Salon wieder auf, dass der Krückstock auf dem Parkett dröhnte. »Das wäre mir freilich das liebste, denn das ganze Lebensglück unseres Lieblings einem Spieler anvertrauen …«
»Blödsinn! Infamer Blödsinn! Du bist eifersüchtig, du willst das Mädel überhaupt nicht fortgeben …«
»Einem Mann, der mir eine glückselige, sorgenfreie Zukunft garantiert – sofort! Aber dem Grafen von Hohen-Esp? Nein! Wenn du mich fragst, sage ich tausendmal nein, denn ich weiß, dass sie einem namenlosen Elend entgegengeht!«
»Sieh mal an – namenloses Elend! Nette Zukunftsmusik! Haha! Na, und was sagt Gundula selbst dazu?«
Da seufzte die große resolute Frau zum ersten Mal schwer auf, und über das ernste Gesicht zog es wie tiefe Schatten.
»Gundula ist verblendet«, sagte sie leise, »sie ist ebenso wie alle anderen von der Schönheit und Liebenswürdigkeit dieses glänzendsten aller Kavaliere eingenommen!«
»Gut! Warum also diesen schönen Wahn zerreißen?«
»Weil es nicht immer bei einer Flitterwochenliebe bleibt! Wenn sie ihr Unglück erst einsieht und begreifen lernt, ist es zu spät.«
»Hast du dich von all dem Unglück, welches dich im Leben getroffen hat, zu Boden schlagen lassen?«
»Nein, ebensowenig wie du; aber Gundula …«
»…ist unser Fleisch und Blut, ist eine Wahnfried reinster Rasse. Komm einmal her, sieh mal da hinab! Na, gäbe es wohl auf der ganzen Welt eine bessere Bärin von Hohen-Esp, die mit stolzen, wehrhaften Pranken um ihr Glück kämpfen wird?«
Tante Agathe hatte sich erhoben und war hinter den Bruder getreten; ihr Blick flog hinab in den großen Hof, in dessen Mitte sich ihren Augen ein Bild zeigte, wahrlich dazu angetan, ihr besorgtes Herz zu beruhigen.
Baronesse Gundula kehrte vom Reiten heim. Sie hatte ihrem kleinen Groom die Zügel zugeworfen und verabschiedete sich eben noch von dem Rittmeister von Hammer und dessen Gattin, welche sie begleitet hatten, als eine hohe Leiter, welche seitlich an dem Hausflügel lehnte, ins Wanken geriet und mit lautem Krach neben dem Pferd niederschmetterte.
Der Goldfuchs stieg kerzengerade empor und brach in jähem Schreck wild aus, das Hoftor zu erreichen; machtlos hing der Groom am Zügel und ließ sich schleifen, während er voll verzweifelter Angst nach dem Kutscher schrie.
Schon aber war Gundula dem erregten Tier entgegengeeilt. Mit kraftvoller Hand griff sie zu und drängte den schnaufenden Fuchs zurück. Ihre hohe, wundervolle Gestalt, von dem knappen Reitkleid eng umschlossen, schien aus Stahl und Eisen; energisch, sicher und doch bei aller Kraft voll schmiegsamer Grazie stand Gundula neben dem Durchgänger und zwang ihn zum Gehorsam. Leuchtend rot stieg das Blut in ihre Wangen, die großen, stahlgrauen Augen blitzten einen stummen Befehl, und das Pferd schäumte ins Gebiss und fügte sich gehorsam der Gebieterin.
»Bravo, mein gnädiges Fräulein!« applaudierte der Rittmeister, und Gundula lachte ihm heiter zu und rief ein paar siegesfrohe Worte.
Wie sie so dastand in dem hellen Sonnenlicht, zeigte es sich besonders auffallend, wie ähnlich sie in Gestalt und Wesen ihrem Vater und ihrer Tante Agathe war, von welchen die Welt sagte, dass sie energisch bis zur Starrköpfigkeit, klug und zielbewusst bis zur Rücksichtslosigkeit seien.
»Und die sollte nicht ihren Weg gehen und sich von ein paar Kartenblättern um Glück und Existenz bringen lassen?« Wieder lachte der Kammerherr sein dröhnend tiefes Lachen. »Unbesorgt, Agathe! Ich frage jetzt das Mädel; will sie ihn, so bekommt sie ihn!«
»Ein wildes Pferd zu bändigen, ist wohl leichter, als einen leichtsinnigen Menschen im Zügel zu behalten! Wenn ein Weib liebt, so ist es schwach und ohnmächtig – und Gundula wird ihren Gatten lieben! Sie wird auch an seiner Seite so selbstlos und uneigennützig sein, wie sie es jetzt ist, und das öffnet dem Bankrott Tür und Tor.«
Herr von Wahnfried starrte mit wunderlichem Lächeln gradaus. »Sie wird ihren Gatten lieben, ja. Aber nur so lange voll blinder Nachsicht, bis ein anderer kommt, den sie noch mehr liebt.«
Beinahe entsetzt blickte Agathe auf. »Wie soll ich das verstehen? Wen könnte sie je mehr lieben als den Mann ihrer Wahl?«
»Ihren Sohn!« antwortete der Kammerherr langsam, voll schweren Nachdrucks, und in seinen tiefliegenden Augen glomm es wieder so seltsam wie zuvor. »Eine Bärin ist das gutmütigste Geschöpf der Welt, welches sich geduldig den Pelz zausen lässt, solange sie nichts anderes hat als ihren Meister Petz. Wenn aber erst die junge Brut in der Höhle liegt, dann wird aus dem sanftmütigen Weibchen eine gar wilde, leidenschaftliche Mutter, welche die wehrhaften Pranken hebt und zerbeißt und zerreißt, was das sichere Nest ihrer Jungen gefährdet. Je nun! Auch Gundula wird eine Bärin von Hohen-Esp sein, und wenn sie zuvor nicht für sich selber kämpfte, für ihre Söhne tut sie es so wahr und sicher, wie es mein Blut ist, welches in ihren Adern kreist.«
Gundula von Wahnfried stand im Brautkleid und harrte ihres Verlobten, der sie in seiner glänzenden Equipage, mit dem elegantesten Viererzug, den die Residenz aufwies, zur Trauung abholen wollte.
Jungfer und Modistin hatten noch geschäftig an Schleppe, Kranz und Schleier geordnet, als Tante Agathe einen Blick auf die Uhr warf und den Diensteifrigen in ihrer kurzen, energischen Art bedeutete, das Zimmer zu verlassen.
Auch Gundula schien noch ein letztes Alleinsein mit ihrer geliebten Pflegemutter, die sie voll strenger, aber zärtlicher Sorge großgezogen hatte, zu ersehnen.
Sie legte ihre Arme um den Nacken der alternden Frau und blickte ihr mit leuchtenden Augen in das ernste Antlitz.
»Tante Agathe«, flüsterte sie, »ich weiß, dass du meine Verlobung mit Friedrich Carl nicht sehr gern zugegeben hast! Du liebe, treue Seele hast so schwarz gesehen und die kleine, harmlose Passion meines Herzliebsten zu einer wüsten Leidenschaft gestempelt, die uns nach deiner Ansicht ruinieren muss! Hast du auch jetzt noch keine bessere Meinung von Friedrich Carl bekommen, wo er es doch auf meinen Wunsch über sich vermocht hat, während unserer ganzen Verlobungszeit keine Karte anzurühren?«
Fräulein von Wahnfried blickte mit wunderlichem Ausdruck in die verklärten Augen der reizenden Braut, welche so gar nicht stolz, stark und energisch, sondern weich, lieblich und hold erglühend wie das verliebteste und schwächste aller Weiber vor ihr stand.
Ein feines Zucken ging um ihren herb geschlossenen Mund.
»Ich sehe, dass du glücklich bist, mein Liebling«, sagte sie, ihre Lippen auf das wunderschöne Antlitz der Braut drückend, »und es sei fern von mir, dir diesen sonnigen Tag durch meine Angst vor dräuenden Wolken zu verdunkeln. Du hast Zeit gehabt, um zu überlegen, was du tust; ich hoffe, du wirst den Anforderungen, die das Leben an dich stellt, gewachsen sein.«
»Ich bin es, Tante! Ich fühle die hohe, heilige Kraft der Liebe in mir. Du fürchtest, Tante, dass ich einst Mangel an Geld und Gut leiden werde! Was frage ich danach? Wäre Friedrich Carl der ärmste aller Männer gewesen, ich würde ihn ebenso geliebt haben, ihm ebenso überglücklich meine Hand gereicht haben wie jetzt! Du weißt, dass ich niemals viel Sinn für Glanz, Pracht und Wohlleben gehabt habe. Dazu hast du mich zu ernst und solid erzogen, hast mich bessere und höhere Werte des Lebens kennen gelehrt. Doch ist es denn ein Unrecht, wenn Friedrich Carl sich seines Lebens freut, es gern in möglichst glänzendem Rahmen genießt? Gewiss nicht, das ist nur Geschmackssache; und da er die Mittel besitzt, um in der großen Welt zu leben und gewissermaßen auch die Verpflichtung hat, seinen Namen zu repräsentieren, so lasse ich es sehr dahingestellt, ob seine Geschmacksrichtung nicht viel natürlicher und richtiger ist als die meine.«
»So wirst du dich bekehren lassen?«
Gundula neigte das schöne Antlitz so tief, dass die duftigen Wogen des Brautschleiers darüber hinflossen.
»Das dürfte schwierig, aber nicht unmöglich sein. Ich werde mich gern dem Geschmack meines Mannes anpassen …«
»Auch wenn dich derselbe in Widerspruch zu deinen Pflichten setzt?«
Die junge Braut blickte erschrocken, beinahe verständnislos empor. »Wie könnte das möglich sein?«
»Wirst du blindlings alles gutheißen, was dein Gatte tut? Als Frau lernt man oft sehr viel schärfer und weitsichtiger urteilen wie als Mädchen!«
Das rosige Antlitz war jählings erbleicht, Gundula hob ihr Haupt und schaute der Sprecherin starr in die prüfenden Augen. Ein seltsam fremder Zug schlich sich plötzlich um die lächelnden Lippen, fest und energisch, ein Gemisch von Stolz und Unwillen.
»Wenn Friedrich Carl jemals unedel oder frevlerisch handelt – was Gott verhüten möge –, werde ich nicht derselben Meinung sein wie er, sondern so handeln, wie ich es für recht und gut erachte!«
Sie atmete schwer auf und senkte wieder, wie erschreckt über ihre eigenen Worte, das Köpfchen.
»Aber wie sollte das geschehen?«
Agathe presste die Lippen zusammen und kämpfte sekundenlang einen schweren Kampf. Dann schüttelte sie seufzend den grauen Kopf und strich liebkosend über das blonde Haupt ihres Lieblings, um das sich die blühenden Myrten rankten.
»Nein, Kind, ich will dir deinen Glauben und dein Vertrauen nicht nehmen, ich will in dieser Stunde nicht mit Möglichkeiten rechnen, die vorläufig noch in Gottes Hand stehen. Nur eine Bitte möchte ich noch aussprechen, eine ernste, innige Bitte. Dein Vater hat am gestrigen Tag sein Testament gemacht und dich nach seinem Tod zur Erbin eingesetzt, er hat auch keinerlei Bedingungen mehr gestellt, obwohl er weiß, dass du mit deinem Gatten in Gütergemeinschaft leben wirst. Du selber, Gundula, bist in Geldangelegenheiten und Geschäftssachen leider Gottes unerfahren wie ein Kind, darum kann ich dir kaum klarmachen, welche Gefahr dieses Testament für deine Zukunft birgt! Um so berechtigter ist aber meine Bitte, welche du hoffentlich nicht abschlägst, auch wenn du dieselbe in diesem Augenblick noch nicht verstehst.«
»Sprich, Herzliebe!«
»Du weißt, dass dir Tante Margarete ihr ganzes Vermögen vermachte, allerdings mit der Klausel, dass ich, solang ich lebe, die Nutznießung des Kapitals habe.«
»Ja, Tantchen. So Gott will, wirst du dich noch viele lange Jahre dieser Renten freuen!«
Agathe überhörte diese Worte, sie blickte mit sorgenvoller Stirn geradeaus ins Leere und fuhr beinahe hastig fort: »Von diesem Erbe, das dir zusteht, weiß niemand etwas. Dein Vater hat es selbst mir gegenüber nie erwähnt, er wird auch ganz bestimmt bei Friedrich Carl nichts davon gesagt haben. Auf dieses Kapital bezieht sich meine Bitte, Herzensliebling. Gelobe es mir in dieser Stunde mit heiligem Eid, nie und nimmer deinem Gatten gegenüber von diesem Erbe zu sprechen. Gelobe es mir! Schwöre es mir, wenn dir die Ruhe meiner Seele wert ist! Sieh mich nicht so fragend, so erstaunt an! Ich kann und will dir nicht die Gründe sagen, die mich zu dieser Forderung bewegen. Ich beschwöre dich nur mit all der innigen Liebe, die ich dir seit langen Jahren gezeigt habe, ich flehe dich an als Stellvertreterin deiner teuren, verewigten Mutter: Schwöre mir, Gundula, nie und nimmer zu Friedrich Carl von diesem Geld zu sprechen!«
In den Augen der jungen Braut glänzten Tränen. Sie warf sich an die Brust der Sprecherin und schluchzte leise auf: »Obwohl ich nicht den Grund für diese seltsame Bitte einsehe, Herzenstante, will ich dir dennoch ewiges Schweigen geloben, dir zur Beruhigung!«
Unten auf der Straße klang ein jubelndes Hurra, brausende Hochrufe aus unzähligen Kinderkehlen ertönten.
Der Bräutigam nahte, die Braut zu holen. Ein Zittern banger Glückseligkeit rann wie erlösend durch die Glieder des jungen Mädchens. Im nächsten Augenblick ward die Tür stürmisch geöffnet, und voll jubelnden Entzückens, schön und strahlend wie ein junger Siegesgott, breitete der Graf von Hohen-Esp seine Arme nach der Geliebten aus.
Diese Augenblicke gehörten dem jungen Paar; Tante Agathe trat schweigend in den Erker und blickte auf die Straße hinab. Drunten drängte sich eine neugierig erregte Menge um die prunkende Galakutsche der Bären von Hohen-Esp.
Der Kammerherr war eingetreten. Er trug seine elegante Hofuniform, welche seiner markigen Gestalt so besonders kleidsam war. Trotz des Krückstocks ging er hoch und stolz aufgerichtet, und ein Ausdruck großer Genugtuung lag auf den strengen Zügen.
»Ich bin froh, dass ich diesen Tag noch erlebe«, hatte er am Morgen gesagt, »er gibt meinem Leben einen guten Abschluss.«
Jetzt streifte sein Blick aufleuchtend das junge Paar, ein schmunzelndes Nicken – und dann bot er seiner Schwester Agathe den Arm.
»Komm, du treue Pflegemutter, unser Wagen wartet.«
Die beiden Alten gingen, und Friedrich Carl legte den Arm noch inniger um die reizende Braut, die in der Residenz als gefeiertste Schönheit galt. Er blickte ihr tief in die ernsten blauen Augen, die ihm wie verklärt in Glückseligkeit entgegenstrahlten.
»Nun bist du mein, Gundula«, flüsterte er, und sein frisches, hübsches, so lebenslustig lachendes Antlitz färbte sich tiefer.
II.
Der Graf von Hohen-Esp und seine junge, liebreizende Frau galten für das glücklichste Paar im Land. Nicht deshalb, weil Pracht und Glanz sie umgaben, weil Sorge und Kummer unbekannte Gäste in ihrem Haus waren, weil sie alles besaßen, was dem Herzen Freude und dem Leben Reiz verleiht, sondern weil sie einander aus heißer, inniger Liebe geheiratet hatten. Auf Gundulas Wunsch hatte das junge Paar die Flitterwochen auf Burg Hohen-Esp verlebt, und ein paar Damen und Herren der Gesellschaft, die, auf weiterer Fahrt durch das Land begriffen, für etliche Stunden in dem wunderlichen alten Strandschloss Rast gehalten hatten, konnten gar nicht genug erzählen, wie wahrhaft verklärt in unaussprechlicher Glückseligkeit die junge Gräfin dreingeblickt habe. Ihr sei die Stille und Einsamkeit dieses Aufenthalts sichtlich sehr sympathisch, während der lebenslustige Gatte wohl nur aus Galanterie und im Rausch des Honigmonats in diesem freiwilligen Exil aushalte.
Selbstredend werde das junge Paar den Winter in der Residenz verleben. Graf Friedrich Carl habe das heilig gelobt und sehr vergnügt dabei ausgesehen, auch Gundula habe sehr liebenswürdig gelächelt, aber doch heimlich geseufzt.
Währenddessen träumte das junge Paar eine zauberhafte Spätsommeridylle auf Hohen-Esp, der einsamen, uralten Burg, die sich auf bewaldeter Bergkuppe am Ufer der Ostsee erhebt und weithin über die blauwogende Unendlichkeit schaut. Sie gehört zu dem ältesten Grundbesitz der Familie, ein düsteres, altes Gemäuer, ein Krähenhorst, den die kokette Laune ehemaliger Bewohner gar eigenartig ausstaffiert hatte. Die Bärenburg gleicht in Wahrheit der Höhle eines Bären, denn die plumpen, massigen Mauern, der graue, stumpfe Turm sind im Inneren und Äußeren mit lauter Dingen ausgestattet, die an den Bären und seine wehrhaften Pranken erinnern.
Gundula war im ersten Augenblick erschrocken, als ihr die beiden riesenhaften Bären, die am Eingang des Burgtores Wache halten, aus grimmig offenen Rachen die Zähne entgegenfletschten, als ihr überall auf Schritt und Tritt in der ganzen Burg, wohin sie nur blickte, Bären in allen Größen und Arten entgegenschauten, als jedes Möbel oder jedes Gewebe ihr in Schnitzerei oder Muster das nämliche Motiv zeigten – Bären! Bären überall! Bald aber gefiel ihr diese absonderliche Eigenart, und je mehr sie sich in die Traditionen der Familie und den Gedanken hineinlebte, dass sie nun selber eine Bärin von Hohen-Esp geworden, eine jener seelen- und nervenstarken, stolzen, gewaltigen Frauen, welche seit vielen Jahrhunderten hier gehaust, wahrhafte Herrinnen der alten Zwingburg zu sein, da schlug ihr Herz hoch auf im stolzen Selbstbewusstsein, und beinahe zärtlich haftete ihr Blick auf den braunzottigen Gesellen, welche in dieser verzauberten alten Herrlichkeit die neue Gebieterin auf Schritt und Tritt begrüßten.
»Ich begreife eigentlich deinen Geschmack nicht, Herzlieb«, lachte Friedrich Carl, als sie eines Abends auf der Zinne des Turmes standen, um weit hinab über die Wipfel des Buchenwaldes auf das ferne, blaue Meer zu schauen, in das der glühende Sonnenball langsam, durch violette Dunstschleier tauchend, niedersank. »Ich begreife dich nicht, dass es dir hier in der entsetzlichsten aller vermoderten und verräucherten Bärenhöhlen so gut gefällt. So schön, wie Hohen-Esp seinerzeit als Sitz der Ersten unseres Geschlechts gewesen sein mag, so völlig überlebt hat sich sein mystischer Zauber in unserer heutigen Zeit voll Komfort, Eleganz und Leichtlebigkeit. Ich hatte im stillen eigentlich gehofft, Gundula, du würdest beim Anblick all der grausigen Untiere, die einen schier zudringlich hier auf Schritt und Tritt verfolgen, schleunigst Reißaus nehmen. Was zu viel ist, ist zu viel! Unsere Altvorderen sind mir mit diesem Bärenkultus schließlich langweilig geworden.«
Beinahe erschrocken sah die Gräfin den Sprecher an. »Langweilig? Und das sagst du, Friedrich Carl, der Nachkomme dieses herrlichen Geschlechts, für den jeder Zoll dieses Grund und Bodens heilig sein sollte? Sieh, ich trage erst seit wenigen Wochen den Namen Hohen-Esp – und doch ist es mir, als sei mein Herz und Sinn schon ganz und gar verwoben mit ihm. Ich kann nicht satt werden, durch Räume zu schreiten, wo ringsum die Andenken von Vätern und Ahnherren sprechen, wo alles davon zeugt, was sie einst waren und was wir Glückseligen jetzt sind, wo uns ihr Geist umweht und ihre Namen zu uns sprechen! O du lieber Mann, ich habe zuvor nie darüber nachgedacht, wie schön es wohl sein müsse, die Mutter eines Sohnes zu sein; hier aber, in der Burg deiner Väter, da überkommt es mich wie eine heiße, ehrfurchtsvolle Sehnsucht, wie eine jauchzende Begeisterung bei dem Gedanken, dass ich berufen sein möchte, diesem alten, trotzigen Bärengeschlecht einen Erben zu schenken, es fortzupflanzen in einem Sohn, der dereinst so edel, so ritterlich sein wird wie alle jene heldenhaften Männer, die ehemals in diesen Räumen gehaust, die ihren Wahlspruch in die grauen Quadersteine gemeißelt, ihn hoch auf ihr Banner geschrieben haben und in seinem Sinn lebten und starben.
›Christe Kyrie … Zu Land und See, Schirmherr der Not – Das walt’ Herre Gott!‹«
Mit entzücktem, staunendem Blick sah Graf Hohen-Esp auf die Sprecherin. Wuchs sie tatsächlich neben ihm empor, oder täuschte ihn sein Auge, dass er ihre schlanke Gestalt plötzlich so hoch und stolz neben sich sah? Und dieses schöne, begeisterte Angesicht, diese leuchtenden Augen … Gehörten sie wahrlich seiner ernsten, träumerisch stillen Gundula?
Fester schlang er den Arm um sie, heißer noch küsste er ihre Lippen.
»Schade, dass mein guter Vater dich nicht sprechen hören kann, du wärest wahrlich eine Schwiegertochter nach seinem Herzen! Ja, der alte Herr war in der Tat noch der alte Schirmvogt der Not und Schwachheit, wie ihn der alte Wappenspruch verlangt, er hat viel Gutes getan, und wenn auch nicht mit gewappnetem Arm gegen die Seeräuber hier von dem Bärenhorst aus, so doch als moderner Mann im Reichstag und von der Ministerkanzel aus; du weißt, wie man sein Andenken in Ehren hält. Ja, ein moderner Mann! Hohen-Esp bewohnte er selten, fast nie; es lag ihm zu abgelegen. Da hatte er sich Schloss Walsleben für den Sommeraufenthalt zurechtmachen lassen, auch ein von den Vätern ererbter ›heiliger‹ Boden, aber doch etwas behaglicher und komfortabler als hier die alte Bärenhöhle. Und siehst du, Herzlieb, diesem hübschen Besitz möchte ich mein wonniges Weib auch einmal zuführen. Wir waren nun drei Wochen hier, die Walslebener dürfen doch nicht eifersüchtig werden!«
Wie innig er sie an sein Herz drückte, wie schmeichelnd seine Stimme klang, wie unwiderstehlich der strahlende frohe und heitere Blick seiner Augen, die in letzter Zeit oftmals recht müde und gelangweilt in die Waldeinsamkeit hinausgeschaut hatten.
Ein Gefühl tiefer Wehmut beschlich Gundulas Herz, wenn sie ans Scheiden dachte, wie unaussprechlich glücklich war sie hier gewesen! Wie redete jedes Zimmer, jedes Plätzchen im Park von einer Zeit berauschend seliger junger Liebe! Nie und nimmer würde sie sich in Hohen-Esp langweilen, und müsste sie ihr ganzes Leben hier zubringen!
Aber was galten ihr die eigenen Wünsche, wenn Friedrich Carl andere Pläne hegte? Ein einziger Blick in sein lachendes Gesicht, ein Kuss von seinem Mund, und die Bärin war wieder die willenlose Taube, die mit demütigem Lächeln nickt. »So bring mich nach Walsleben, Liebster! Die Welt ist ja überall schön, wo du bist!«
»Gut, sagen wir vierzehn Tage noch nach Walsleben! Das genügt, dass du dein neues Heim, die Umgegend und Menschen kennenlernst, und dann … dann machen wir doch noch unsere Hochzeitsreise, Liebchen?«
»Hochzeitsreise? Ich glaubte, die machten wir schon jetzt!«
»Hierher nach Hohen-Esp?« Er lachte beinah übermütig. »Nein, meine kleine Schirmvogtin, diese Extratour war nur ein Beweis meines unbedingten Gehorsams! Du wünschtest, die Bärenburg kennenzulernen, und ich war Wachs in deinen Händchen, wie ich stets im Leben sein werde. Nun aber kommt die Belohnung für diesen Separatarrest, obwohl derselbe so süß und wonnig war, dass er seinen Lohn schon reichlich in sich selber trug! Aber wir Menschen sind nun mal unbescheiden und nimmersatte Kreaturen. Auf das schöne Exil in Hohen-Esp folgt ein noch schöneres in Walsleben, und wie man nach der süßen Speise noch Konfekt und Früchte verlangt, so lassen wir uns noch eine kleine Spritztour gen Nizza, San Remo, Monte Carlo usw. servieren.«
»Alles, was du willst! Die Zwingherrin ist ihrem Herzliebsten gegenüber Sklavin!«
In Walsleben fand Gundula alles, was wohl sonst jedes Frauenherz entzückt und hoch befriedigt hätte: gediegene Eleganz, Behaglichkeit und die Erfüllung eines jeden, selbst des anspruchsvollsten Wunsches. Es würde die junge Frau auch beglückt haben, wenn sie mehr Wert auf äußeren Glanz gelegt und Sinn für all die vielen hübschen Nichtigkeiten gehabt hätte, mit denen sich das moderne Wohlleben ausstattet und die einer Reihe von müßigen Tagen einen scheinbaren Inhalt verleihen.
Gundula hatte aber seit jeher wenig Passion für Geselligkeit und alles, was mit derselben zusammenhing. Die reinste Freude, die sie empfinden konnte, war die an einer schönen Natur mit all dem stillen Zauber und den unerforschlichen Wundern, die ihrem Schöpfer Preis und Ehre geben.
Das Walslebener Schloss mit seinem eleganten Leben und Treiben entsprach nicht ihrem Geschmack. Dennoch verriet nicht das kleinste Wort, nicht der leiseste Seufzer, wie ungern sie hier weilte. Sie sah es ja dem glücklichen Gesicht ihres Mannes an, dass er sich außerordentlich wohlfühlte, und was hätte der selbstlosen und anspruchslosen Seele Gundulas mehr Befriedigung geben können, als den Geliebten froh und zufrieden zu sehen?
Man fuhr schon am zweiten Tag, als die junge Herrin kaum den eigenen fürstlichen Besitz in Augenschein genommen hatte, in die Nachbarschaft, um Besuche abzustatten. Da man nur so kurzbemessene Zeit in Walsleben weilte, drängten sich die Einladungen; man besuchte Feste und sah wiederum Gäste bei sich, und Gundula empfand es bei all ihrem Widerwillen gegen eine derartige Vergnügungshetze doch mit unendlicher Wonne, dass Friedrich Carl eine stolze Genugtuung darin fand, der Welt sein junges Weib zu zeigen, dass er sich beneidenswert und glücklich in ihrem Besitz fühlte. Zwischen all dem Trubel fanden sich doch noch schöne, stille Stunden, in denen der Geliebte ihr allein gehörte, in denen er sich ihr voll zärtlicher Ritterlichkeit auch ausschließlich widmete. Dafür dankte sie ihm durch eine stets liebenswürdige Bereitwilligkeit, ihm hinaus in das laute, bunte Leben zu folgen, und als die für Walsleben festgesetzte Zeit abgelaufen war und der junge Graf voll ungeduldiger Sehnsucht nach neuen Zerstreuungen verlangte, da gab sie gern Befehl, die Koffer zu packen.
Welch ein ruheloses Hin und Her, Kreuz und Quer durch die Welt! Dann kam Monte Carlo!
Anfänglich hatte Gundula gar nicht geahnt, welch ein Höllenabgrund in diesem Paradies gähnte. Sie sah voll naiver Verständnislosigkeit dem Spiel zu, bis es ihr allmählich klarwurde, was dasselbe eigentlich bedeuten wollte. Da erschrak sie zum ersten Mal bis in das tiefste Herz hinein. Sie stand hinter ihrem Gatten und sah, wie die Glut fieberischer Erregung immer dunkler und heißer in sein schönes Antlitz stieg, wie die Banknoten in seiner Brieftasche mehr und mehr zusammenschmolzen.
»Herzlieber«, flüsterte sie in sein Ohr, »lass uns gehen! Ich sterbe vor Müdigkeit.«
Er sprang sofort auf, raffte noch ein paar Goldstücke zusammen und bot ihr den Arm.
»Vergib mir, Darling! Es ist in der Tat sehr spät geworden. Aber im Eifer des Spiels … ich habe gar nicht daran gedacht, dass du in letzter Zeit immer so spät ins Bett gekommen bist.«
Am folgenden Tag verspielte er noch eine weit größere Summe.
»Ich muss an meinen Bankier telegrafieren«, sagte er, »unser Reisegeld ist auch schon futsch!«
Da fasste sie flehend seine Hände, und ihre blauen Augen schauten voll Angst in sein schönes, sorgloses Antlitz.
»Friedrich Carl«, flüsterte sie, »ach, lass uns fort von hier!«
Er lachte hell auf und küsste sie. »Ich glaube, du hast Angst, dass ich uns hier bankrottspiele«, scherzte er. »Unbesorgt, du liebes Närrchen! Die paar tausend Franken reißen noch kein Loch in unseren Geldbeutel, und einmal muss ich doch auch wieder gewinnen!«
Er gewann aber nicht, sondern verlor auch in den nächsten Tagen unaufhörlich. Die namhafte Summe, die ihm sein Bankier angewiesen hatte, schmolz dahin wie der Schnee im Sonnenschein. Der junge Graf lachte noch immer, aber es war ein etwas gewaltsames und nervöses Lachen.
»Friedrich Carl, lass uns fort von hier«, flehte Gundula abermals, und diesmal rollten ein paar große Tränen über ihre Wangen und netzten seine Hand. Er zuckte zusammen.
»Wenn du befiehlst, sofort, mein Liebling! O du glaubst doch nicht etwa, der Spielteufel habe mehr Gewalt über mich als dieser süße Engel, den ich mir selbst zum Wächter meines Glückes gesetzt habe?«
Er schellte seinem Kammerdiener und teilte ihm mit, dass mit dem Kurierzug am nächsten Vormittag weitergereist werden soll. So unbeschreiblich glücklich wie in dieser Stunde war Gundula nie wieder.
Die nächstfolgenden Jahre verlebte das junge Paar in Saus und Braus in der heimatlichen Residenz. Graf Hohen-Esp machte ein glänzendes Haus, und da er nie im Leben gefragt hatte: »Kann ich mir dies oder jenes gestatten«, so fragte er auch jetzt nicht danach, sondern war sehr erstaunt, als ihm sein Administrator eines Tages eröffnete, er sei nicht in der Lage, noch mehr Gelder zu zahlen, da die zuständigen Revenuen bereits an die Adresse des Herrn Grafen abgeführt seien.
»Was? Ei zum Teufel! Wir haben ja das neue Quartal kaum angefangen!«
»Herr Graf vergessen, dass das Kapital sehr abgenommen hat; die Summen, die nach Monte Carlo geschickt wurden, die Ehrenschuld, die an Herrn von X., und diejenige, welche nach Wiesbaden abgesandt wurde …«
»Donnerwetter! Ist das so ins Geld gelaufen?« wunderte sich der junge Mann sehr gelassen. »Das ist ja fatal. Aber ich muss doch momentan was haben! Vom nächsten Quartal an können wir ja manches sparsamer einrichten. Aber gerade jetzt muss ich so mancherlei berappen. Was fangen wir da an?«
Der Beamte zuckte etwas besorgt die Schultern.
»Können Sie keinen Wald schlagen lassen?«
»Da ist in den letzten Jahren schon so viel rasiert worden, Herr Graf, dass da nichts mehr weg darf! Höchstens die Buchenwaldung um Hohen-Esp herum. Da sind starke Stämme, die würden einen guten Ertrag geben.«
Friedrich Carl grub die schlanke Hand in sein lockiges Haar. »Meine Frau hat eine Leidenschaft für das alte Bärennest und den schönen Hochwald. Sie will jeden Sommer ein paar Wochen da zubringen. Also ganz herunter darf das Holz nicht!«
Ein Jahr verging, und im Haus des Grafen von Hohen-Esp klangen nach wie vor die Flöten und Geigen, klimperten fernab im Zimmer des Hausherrn die Goldstücke auf dem Spieltisch. Friedrich Carl amüsierte sich, reiste, rauchte, spielte und war nach wie vor ein aufmerksamer und ritterlicher Gatte, wenngleich die immer blasser werdenden Wangen und der müde, resignierte Ausdruck im Gesicht seiner Frau immer deutlicher hervortraten.
Gundulas Vater war sehr unerwartet an einem Herzschlag gestorben, und während des Trauerjahres, in dem man doch nicht gut die Saison mitmachen konnte, unternahm Graf Hohen-Esp in Begleitung seiner Gemahlin eine Reise um die Welt.
»Du hast ja jetzt ein recht nettes Kapital geerbt, Liebchen«, sagte Friedrich Carl in seiner leichten, fröhlichen Art, »da könntest du mir eigentlich einen Gefallen tun. Es ist momentan schwer für mich, Geld flüssig zu machen; du weißt, dass das bei Grundbesitz immer seinen Haken hat. Darum wäre es mir sehr lieb, du rücktest ein bisschen von deinem Mammon heraus, um die Reisekosten zu decken. Ja? Willst du? Wärest auch die beste Frau der Welt!«
Er küsste ihre Wangen und Hände, und sie lächelte ihr stilles, müdes Lächeln, schmiegte sich an ihn und nickte. »Nimm, soviel du willst! Was soll ich mit dem Geld?« Und er nahm Geld, soviel er wollte, denn die Reisekosten waren nicht gering.
Ach, wie hatte Gundula gehofft, dass sie das Trauerjahr still und behaglich in der schönen Einsamkeit von Hohen-Esp verleben würden, endlich, endlich einmal wieder glücklich zu sein wie zu Anbeginn ihrer Ehe. Statt dessen hub wieder ein ruheloses Wandern an, ein stetes Zusammenleben mit fremden Menschen, deren Mittelpunkt der schöne, liebenswürdige Graf ja ständig war! Reiche Engländer und Amerikaner schlugen ein Spielchen vor; und um die Langeweile der endlosen Seefahrten zu lindern, spielte Friedrich Carl; manchmal mit Glück, meist mit recht erheblichen Verlusten. Und als man nach Jahr und Tag heimkam, teilte er seiner blassen Frau so en passant einmal mit, dass die Reiserei doch infam teuer gewesen sei und ein Heidengeld verschlungen habe. Das ererbte Kapital sei beinahe draufgegangen. Na, allzu viel war es ja nicht! Und da keine Kinder da sind, für die man zu sorgen hat, ist es ja gleichgültig, wo es bleibt! Gundula hatte ohne ein Wort still vor sich hingenickt.
Nein, es waren keine Kinder da, für die man hätte sparen und sorgen müssen. Was ihr Mann achselzuckend und mit lachendem Mund als eine ja wohl fatale, aber doch nicht zu ändernde Tatsache aussprach, das fraß ihr seit Jahren schon wie nagendes Todesweh am Herzen, das lastete auf ihr wie ein grausames Schicksal, wie eine Bürde, unter der sie freud- und trostlos daherschlich.
Ein Sohn! Ach, dass sie einen Sohn hätte! Wenn sie zurückdenkt an jene ersten traumseligen Wochen in Hohen-Esp, mit welch einer stolzen Glückseligkeit sie zu den gedunkelten Bildern an der Wand emporgeschaut und ihnen zugeflüstert hatte:, »Einen Sohn will ich euch einst zuführen, einen jungen Bären, furchtlos, brav und rechtschaffen, ein Schirmvogt der Schwachen, ein Retter der Gefährdeten, ein Edelmann in Tat und Wort, so wie ihr es gewesen seid!«
Wie glühte ihr damals das Herz in der Brust voll stolzer Begeisterung, wie träumte sie mit offenen Augen einen herrlichen, goldenen Traum! Weh ihr! Es ist nur ein Traum gewesen und geblieben! Kein Kind im Haus! Nur ein graues Gespenst schleicht darin herum, das klimpert mit Goldstücken und schlägt klatschend die Karten auf!
III.
Die Zeit verging, für Gundula schleichend, mit bleiernen Flügeln, für ihren Gatten in wirbelndem Tanz.
Da es der Gräfin in das Herz schnitt, unter so gänzlich veränderten Verhältnissen auf Hohen-Esp zu weilen, so hatte sie eigentlich darauf verzichten wollen, in diesem Jahr zu kurzem Sommeraufenthalt nach dort zu reisen, da trat jählings ein Ereignis ein, das das bleiche Antlitz der müden jungen Frau in Sonnenhelle tauchte.
Anfänglich wagte sie es kaum, an ihr verspätetes Glück zu glauben, ihr Herz zitterte in bangen Zweifeln, ihre Seele jauchzte in Hoffnung, und auf ihren Wangen blühten wieder Rosen auf, ihre Lippen lächelten wie im Traum. Friedrich Carl beobachtete überrascht und erfreut die sichtliche Veränderung seiner sonst so resignierten Frau, und als er sich eines Tages sogleich nach dem Dinner mit scherzenden Worten und einer kleinen Galanterie über ihre leuchtenden Augen und blühenden Wangen zurückziehen wollte, da hielt sie sanft seine Hände fest, führte ihn nach ihrem dämmrig stillen Salon und warf sich voll bebender Erregung an seine Brust.
»Das alles siehst du und bemerkst du, Geliebter, und fragst doch nicht nach der Ursache, die mich neu aufleben lässt in übergroßer Seligkeit?«
Überrascht schaute er sie an, nahm an ihrer Seite auf dem Diwan Platz und murmelte betroffen: »Ich verstehe dich nicht, Gundula … Hast du etwa das große Los gewonnen?«
Sie lachte unter Tränen. »Nur das große Los? Ach, was bedeutet alles Geld und Gut der Welt gegen unser Glück!«
Seine Hand zuckte unruhig auf ihrem schönen Haupt. »Sprich, Liebling … Foltere mich nicht!«
Da schmiegte sie sich fest, ganz fest in seinen Arm und flüsterte ihm ein paar Worte ins Ohr.
»Gundula«, schrie er beinahe auf, »Gundula, ist das Wahrheit? Uns sollte ein Erbe geboren werden. Ich sollte noch ein Kind auf den Armen wiegen?«
Er sprang empor, er stürmte im Zimmer auf und nieder, und dann bedeckte er ihre Hände, ihr verklärtes Gesicht mit Küssen.
»Ja, das ist ein unerwartetes Glück, Gundula«, jubelte er, »nun ist ja dein heißester und sehnlichster Wunsch erfüllt!«
»Und der deine nicht auch?«
Wie ein Erbleichen ging es über sein erhitztes Gesicht, er sah sie nicht an, sondern presste die Wange gegen ihre Hand.
»Wie kannst du da fragen, Liebste? Als ob es mir gleichgültig sei, ob die Hohen-Esps aussterben oder nicht! Neun Jahre lang hatte ich mich freilich an diesen Gedanken gewöhnt. Ich rechnete mit jeder Möglichkeit, nur nicht mehr mit der, einen Erben zu bekommen.«
»Und wenn es eine Bärin ist?«
»Um so kostbareren Schatz hat die Burg zu hüten«, lächelte er galant, und dann küsste er die Lippen seiner Frau und zog die Klingel, um dem Diener zu sagen, dass er heute Abend zu Hause bliebe, es solle ein Bote nach dem Klub gesandt werden mit der Meldung, dass der Herr Graf heute verhindert sei, zu kommen.
Gundula aber faltete die bebenden Hände und schloss lächelnd die Augen. Kam es noch einmal zurück, das Glück, das große, märchenhafte Glück von ehemals?
Als sich der Gräfin lächelndes Antlitz zum Schlaf in die Kissen geneigt hatte, wanderte Friedrich Carl ruhe- und rastlos in seinem Zimmer auf und nieder. Er hatte einen Brief per Eilboten abgesandt, einen Brief, der den Administrator anwies, sofort dem Abholzen der Hohen-Esper Waldungen Einhalt zu tun. Er hatte sich in sehr misslicher Lage befunden und nach kurzem Kampf den Befehl gegeben, die herrlichen Buchenwaldungen um die Burg herum schlagen zu lassen; hatte doch Gundula geäußert, dass sie keinen Aufenthalt wieder in Hohen-Esp nehmen wolle. Sie schämte sich vor all den Ahnherren im Saal, dass sie ihnen noch immer keinen Stammhalter zuführen könne. Das war nun anders geworden. Jetzt, nach neunjähriger Ehe! Wer hätte das gedacht? Nun war Gundulas Liebe für den alten Ahnensitz neu entflammt, und auf keinen Fall durfte sie die Verwüstungen in ihren geliebten Wäldern erblicken. Das war ein recht fataler Zwischenfall! Was sollte er nun beginnen? Seine Lage war von Jahr zu Jahr schlechter geworden, ach, Gundula ahnte es nicht, wie schlecht! Er musste absolut eine bedeutende Summe flüssig machen, um eine Spielschuld zu bezahlen. Infam! Er hatte während der letzten Zeit so viel Pech gehabt, und wenn er einmal gewann, so rannen die Dukaten wie die Wassertropfen durch die Finger. Es ist seltsam, dass in Spielgewinnen so gar kein Segen steckt.
Walsleben, Mönchhagen und Gottern sind bereits derart belastet, dass er mit diesen Gütern kaum noch rechnen kann, und das Kapital ist lang verbraucht, ebenso das Erbe seiner Frau.