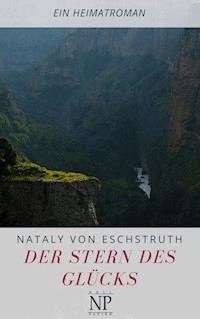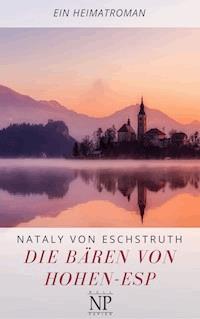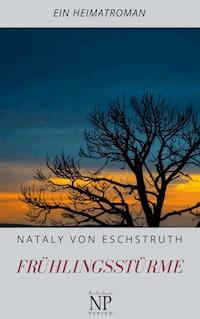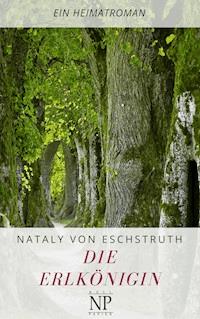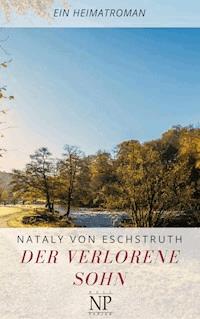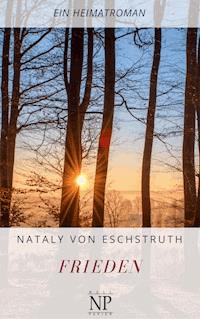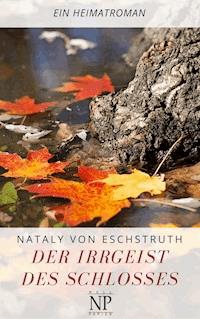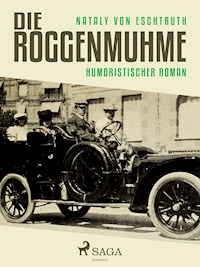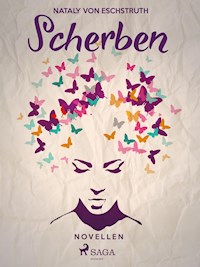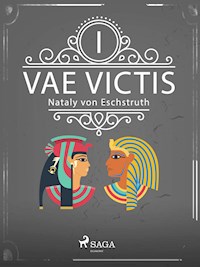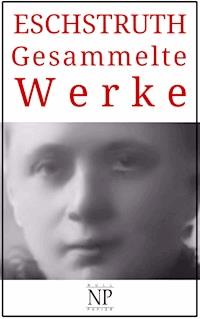
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Nataly von Eschstruth war eine deutsche Schriftstellerin und eine der populärsten und berühmtesten Erzählerinnen der Gründerzeit. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 5349
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Nataly von Eschstruth
Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-01-3
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Der Irrgeist des Schlosses
Der Stern des Glücks
Der verlorene Sohn
Die Bären von Hohen-Esp
Die Erlkönigin
Frühlingsstürme
Gänseliesel
Hazard
Hofluft
Jung gefreit
Katz’ und Maus
Frieden
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Der Irrgeist des Schlosses
Widmung
Meiner lieben Freundin Fräulein Natalie Kalnass von Kalnassy zur Erinnerung an fröhliche, in einem alten »Gespensterschloss« verlebte Stunden
Die Verfasserin
1.
Die Blüte fiel, mir blieb der scharfe Dorn, Noch immer aus der Wunde quillt das Blut; Es sind das Weh, die Sehnsucht und der Zorn Mein einzig Gut.
Geibel.
Es war im Juni. Blendende Sonnenglut lag auf dem weit gedehnten Häuserkomplex der Kadettenanstalt, flimmernd, wie ein unabsehbares Strahlennetz, welches mit tausend feinen Goldmaschen Himmel und Erde umsponnen hält. Die jungen Gartenanlagen standen matt und welk, einzelne Schmetterlinge hingen an den Blumen, und die Fliegen blitzten wie übermütige Gedanken durch die Luft, ebenso bunt und schillernd wie der Sonnenstaub, in welchem sie sich tummelten. Hinter dem Hauptgebäude dehnte sich der Reitplatz aus, da war Schatten.
»Durch die Mitte der Bahn changiert!« klang die Summe des unterrichtenden Kavallerieoffiziers. Er ließ die Reitpeitsche sinken, stemmte die Arme in beide Seiten und ließ die erhitzten Pferde an sich vorüber defilieren. Mit glühendem Gesicht führten die jungen Reiter das Manöver aus, mit fast peinlicher Genauigkeit, und dennoch war kein einziger bei der Sache. Zur Seite des Platzes nämlich, dicht an der Barrière, stand ein kleiner Kreis sehr eleganter Zuschauer; die hohe, imposante Gestalt eines Herrn mit dem Band des eisernen Kreuzes im Knopfloch, mit weißem Schnurrbart und hellen Handschuhen, und ihm zur Seite die Frau Majorin, seine Gemahlin, klein, korpulent, mit der Lorgnette vor den Augen.
»Dagmar!« wandte sie sich plötzlich mit strengem Blick zur Seite, »geh’ von dem Geländer herunter! Du bist nicht allein hier!«
Dagmar war ein Backfischchen, graziös, kokett, von Kopf bis zu Füßen rosa. Die kleine Nase mit ihrem kecken, aufwärts strebenden Spitzchen wandte sich halb zur Seite. »Da unten sehe ich nichts, Tante!« rief sie mit leicht gefaltetem Mündchen, »und Frieda und Herr von Sangers stehen ja vor mir!« Und ohne nur die mindeste Notiz von dem missbilligenden Gesicht der Majorin zu nehmen, rückte sie sich noch übermütiger auf ihrem Sitz zurecht und warf die wilden Kraushaare in den Nacken zurück.
»Sagen Sie mir doch, Herr von Sangers, wer ist jener entsetzlich hässliche Mensch dort auf dem Schimmel!« lachte sie plötzlich laut auf, ihre tiefdunkeln Augen zu dem jungen Kürassieroffizier hebend, welcher lächelnd mit dem Blick der Richtung folgte, die ihm die kleine Hand ungeniert angab, »nein, das ist ja haarsträubend! Wie eine Leiche sieht er aus und hängt auf dem Pferde wie ein Hampelmann! Hahaha! Fritz!« Und sie wandte sich jäh zu einem rotwangigen, zehnjährigen Knaben zurück, welcher dicht hinter ihr stand: »Dass Du mir niemals solch einen Ritter von der traurigen Gestalt abgibst, sonst verleugne ich Dich bei Gott vor aller Welt!«
»Da kannst Du ruhig sein, Dagmar!« schüttelte Fritz mit wegwerfendem Naserümpfen den Kopf, »ich glaube, wir Beide reiten jetzt schon besser wie all’ die Kerls da zusammen!«
»Aber Kinder, bitte, menagiert Euch!« wandte sich die Majorin mit strafendem Blicke um, und auch Frieda schüttelte ganz verlegen ihr achtzehnjähriges Blondköpfchen und sagte in entschuldigendem Flüsterton zu Herrn von Sangers: »Die beiden Kleinen sind gar zu wild, das kommt von dem ewigen Landaufenthalt bei uns; ich bin recht bange, wie Fritz sich hier einleben wird!«
Der schöne Offizier strich lächelnd seinen glänzenden Schnurrbart. »Unbesorgt, mein gnädiges Fräulein, lassen Sie den kleinen Vetter erst ein paar Monate bei uns sein, und Sie werden Ihre Freude erleben, welche Wunder das Kadettenkorps bewirkt. – Wie befahlen Sie, Fräulein Dagmar?«
»Ich befahl, dass Sie mir nun endlich sagen, wer jenes junge Scheusal auf dem Schimmel ist!« klang es mit grausamer Betonung von den frischen Lippen und Dagmar zupfte kokett an der dunkelroten Rose, welche, weithin leuchtend, in ihrem Knopfloch stak, »jetzt kommt er eben hier angeritten, der dritte – heiliger Laurentius, wenn er doch einmal herunterfiele!« Und mit hellem Gelächter strich sie das schwere Haar aus der Stirn und hämmerte ausgelassen mit dem spitzen Stiefelhacken gegen die hölzerne Barrière.
»Bitte, nicht so laut, Fräulein Dagmar!« raunte ihr Sangers mit leichtgefalteter Stirn zu, »Graf Echtersloh ist unser zukünftiger Moltke, klug, strebsam, sehr brav und tüchtig.«
»Aber hässlich! Hässlich über alle Begriffe!« Laut und scharf klang die Stimme Dagmars über den Platz, ein spöttischer Ausdruck umspielte ihre roten Lippen, fest und groß hafteten ihre Augen auf dem Gesicht des Kadetten, ein fast herausfordernd trotzig moquanter Blick, welcher jedoch den Zauber des pikanten Gesichts eher erhöhte als vernichtete.
Wie von einem Dolch getroffen schrak Graf Echtersloh empor, momentan ruhte Auge in Auge, jeder Blutstropfen wich aus seinen an und für sich schon sehr bleichen, großgeschnittenen Zügen, starr wie das Antlitz eines Toten schaute er zu ihr herüber.
»In abgekürztem Tempo Galopp – Marsch!« klang das Kommando des Offiziers dicht neben ihm. Der Schimmel zuckt auf, mit jäher Bewegung setzt er sich in das rasche Tempo seiner Vorgänger, und Graf Echtersloh, überrascht, verwirrt, wie aus tiefem Traum erwachend, sucht schwankend die Balance zu halten – umsonst, mit schneller Wendung kündigt der Schimmel den Gehorsam und sein Reiter fliegt vornüber in schwerem Sturz aus dem Sattel.
»Nun haben Sie ja Ihren Willen gehabt, Fräulein Dagmar«, flüsterte Sangers zwischen den Zähnen, und ein fast finsterer Blick streift die Kleine, welche momentan leicht erbleichend auf das herrenlos dahintrabende Pferd starrt. »Das hätte leicht recht schlimm ablaufen können. Aber Gott sei Dank, unser braver Selektaner scheint sich nicht erheblich verletzt zu haben! Sie scheinen sehr viel Gewicht auf das Äußere zu legen, Fräulein von der Ropp, für Sie existiert nur die Schönheit?«
»Natürlich!« Dagmar warf ihr reizendes Köpfchen in den Nacken: »Es gibt drei Dinge auf der Welt, welche mir verhasst sind: Kälte, Dunkelheit und hässliche Gesichter, und wenn Ihr Graf Echtersloh auch ein wahrer Ausbund von Klugheit und Geist wäre, er ist für meine Begriffe ein Monstrum von Hässlichkeit, und das genügt, um ihn für mich aus dem Register der Existierenden zu streichen!«
»Du übertreibst, Dagmar«, warf Frieda mild ein, »es ist nur seine auffallend bleiche Gesichtsfarbe, welche ihn auf den ersten Blick unschön erscheinen lässt, seine einzelnen Züge sind nicht hässlich, im Gegenteil, sie sind fast zu regelmäßig ausgeprägt für das hagere Gesicht!«
»Gesicht! Wie kann man einen solchen Totenkopf nur Gesicht nennen!« zuckte die Kleine geringschätzend die Achseln, »wenn nicht seine zwei großen Räderaugen darin flammten, wäre es eine Wachsmaske, puh, und diese Augen, ich finde sie schrecklich, seht doch, wie er jetzt wieder hierher starrt, als ob er mich verschlingen wollte!«
»Ist Graf Echtersloh leidend?« fragte Frieda teilnehmend.
»Nein, mein gnädiges Fräulein, aber zu übertrieben fleißig«, nickte Sangers mit freundlichem Blick auf den Genannten, »die jungen Leute präparieren sich für das Offiziersexamen, und ich hoffe, dass die unermüdlichen Studien Echterslohs alsdann ihre glänzenden Früchte tragen!« –
Major von der Ropp besichtigte mit viel Interesse die innere Einrichtung der gewaltigen. Gebäude; er schritt an der Seite des Kommandanten, und es drehte sich die Unterhaltung der Herren hauptsächlich um den angemeldeten Kadetten Fritz, welcher heute von seinem Vormund mit dem zukünftigen Aufenthalt bekannt gemacht wurde.
Dagmar und Fritz von der Ropp waren Geschwister, früh verwaist und bei dem Onkel Major auf einsamem Landgut erzogen, beide aufgewachsen in zügelloser Freiheit, welche sich hartnäckig gegen alles sträubte, was nur im mindesten einem Zwange ähnlich sah.
»Nun sieh Dir mal an, Dagmar, Rettige, Brot und Bier gibts hier zum Abendessen!« raunte Fritz ins Ohr der Schwester, mit fast feindseligem Blick den gewaltigen Saal überfliegend, in welchem, eng gedeckt, Tafel an Tafel zusammenstand, »das ist ja scheußlich, das esse ich nicht, und wenn sie sich auf den Kopf stellen!«
Dagmar war neugierig an die langen Esstische getreten. »Wer sitzt denn hier unten vor, Herr von Sangers?« rief sie über die Schulter.
»Ein Selektaner, um die jüngeren zu überwachen!« war die kurze Antwort.
»Von denen, die vorhin ritten?«
»Ja!«
Ein jäher Gedanke blitzte durch das Köpfchen der kleinen Dame, ebenso übermütig und keck wie all seine tollen Geschwister. Unbemerkt blieb sie ein paar Schritte zurück, löste schnell die Rose aus ihrem Knopfloch und legte sie heimlich unter die erste beste Selektanerserviette. »Der soll sich mal wundern, der dieses Abendessen findet!« dachte sie, »ich wette, er macht ein sentimentales Gedicht darauf! Wenns nur nicht das Monstrum ist, dessen Verse würden gewiss ebenso hässlich sein, wie sein Gesicht, pfui, wenn ich nur an den Menschen denke!« Und Dagmar drehte sich auf den Hacken um und zog das Näschen kraus; im nächsten Augenblick gab es schon wieder anderes zu sehen und zu denken. Und als nach einer halben Stunde die Equipage mit Majors nach Berlin zurücksauste, da träumte Dagmar bereits von dem Vergnügungsregister der nächsten Tage, und hatte Rose und Kadettenkorps längst vergessen.
Droben an einem Fenster des Korpsgebäudes aber lehnte ein bleiches, schmerzbewegtes Antlitz und murmelte mit zuckenden Lippen: »Hässlich! Hässlich über alle Begriffe!« Und an den dunkeln Wimpern zitterte es feucht und rollte langsam, fast unbewusst über die eingefallene Wange. Eine rote Rose lag in seiner Hand und stets von neuem kehrte sein Blick zu ihr zurück, dann wars wie ein seliges Aufflammen in dem ernsten Gesicht und er nickte leise und träumend vor sich hin, »und dennoch ist es ihre Rose, ich kenne sie ja aus Tausenden heraus! Warum hat sie mir gerade diese Blüte auf den Teller gelegt? Aus Mitleid! Es tut ihr leid, dass ich weiß, wie bitter hässlich sie mich findet!« – Und der Mondschein huschte durch die Scheibe und küsste die rote Blume in seiner Hand, da sah sie so mild und lieblich aus, und tat dem Auge nicht mehr so weh wie im hellen Sonnenbrand auf dem Reitplatz draußen.
»Wie kann ich Dich ewig so frisch und schön erhalten, kleine Rose?!« flüsterte der Jüngling, »dass Du nicht stirbst und vergehst wie Deine Schwestern?« – –
»Bist Du schon fertig mit Deinen Arbeiten, Echtersloh?« fragte jemand hinter ihm.
Er schaute wirr auf. »Arbeiten? Ich arbeite nicht!«
»Du wolltest ja Deine Mathematik heute Abend noch vornehmen!« fuhr der Andere erstaunt fort. Wie geistesabwesend starrte ihn Echtersloh an.
»Das hat ja Zeit! Mathematik? Was ist Mathematik? Zähle zusammen wie viel Wunder ein Rosenkelch birgt, wie viel grausame Worte zwei rote Lippen sagen können, wie viel Elend schon ein hässlich Gesicht in der Welt gestiftet hat, dann hast Du die Mathematik, und wenn Du sie nicht hast, dann vielleicht etwas Anderes, den Wahnsinn!« Und Echtersloh lachte gell auf, und schritt hastig aus der Tür.
Monate vergingen.
»Echtersloh ist verrückt geworden!« flüsterten sich die Kadetten in die Ohren, wichen ihm scheu aus und nickten sich nur verständnisvoll zu, wenn der junge Mann, schwankend wie in tiefem Traum, einsam einherschritt, leise vor sich hinlächelnd, oder die Stirn in schwere Falten gelegt, als grüble er über Unergründliches. – Echtersloh arbeitete nicht mehr, er sah seine Bücher nicht mehr an, er lachte geheimnisvoll, wenn seine Kameraden fragten, was er oft so heimlich an dem Fenster treibe. »Ich finde mich selber!« antwortete er kurz.
Die Lehrer schüttelten die Köpfe und redeten ihm ernst in das Gewissen: »Arbeiten Sie, Echtersloh, es sind nur noch wenige Wochen bis zu dem Examen!« Aber der Graf hörte nicht. Sangers nahm ihn bei Seite und beschwor ihn, Aufschluss über sein seltsam verändertes Wesen zu geben. Er meinte es gut mit ihm, er hatte ihn aufrichtig lieb. Der junge Mensch ward rot und verlegen, redete wirres Zeug, und stotterte mit angstvollem Blick: »Ich kann nicht Offizier werden, ich weiß es jetzt!«
»Sollte ihm der Sturz von dem Pferde geschadet haben, ist es möglich, dass der Unglückliche eine Gehirnerschütterung erlitten hat?« fragte man den Arzt. Dieser untersuchte den vermeintlich Kranken, beobachtete ihn scharf und entgegnete kopfschüttelnd: »Er ist ebenso gesund wie früher, aber dennoch scheint er an der fixen Idee zu leiden, kein Offizier werden zu wollen!«
Das Examen kam; Echtersloh, der Stolz des ganzen Korps – fiel durch. Er lächelte und atmete auf: »Ich muss heim!« rief er mit ausgebreiteten Armen. Wohin? Zu seiner Stiefmutter in die Residenz? Nimmermehr! »Nach Casgamala, in das liebe Ruinenschloss! Da ist’s still und ruhig, da gibt es weite wunderliche Gärten voll blühender Rosen, zerfallene Säulen und modernde Pracht, da bin ich ganz allein, nur das Mondlicht huscht durch die bunten Scheiben und leuchtet mir, da will ich arbeiten!«
2.
Und Nebelbilder steigen, wohl aus der Erd’ hervor. Und tanzen lust’gen Reigen in wunderlichem Chor, Und blaue Funken brennen, an jedem Blatt und Reis, Und rote Lichter rennen, in irrem, wirrem Kreis.
Aus dem Lied: Aus alten Märchen winkt es.
»Zum Teufel, Laubmann, man sieht nicht die Hand vor Augen in dieser Dunkelheit! Das ist ja ein Geholpere und Gestoße, als führen wir auf einer Wüste von Felsblöcken, anstatt auf königlicher Chaussee! Wo sind wir eigentlich? Ich glaube, Alter, überall anders, nur nicht auf dem richtigen Wege!«
»Auf dem Wege sind wir schon, Ew. Gnaden, aber ’s geht hier halt ein bissel übers Geröll, eh’ wir in die Haide kommen, und da ist’s halt schon besser, ein bissel vorsichtig zu fahren, denn wenn man in solch’ stockdunkler Nacht lustig drauf los kutschiert, dann könnt’s halt ein bissel umkippen, Ew. Gnaden!«
Ein leiser Fluch war die Antwort, dann herrschte abermals Stille.
Erde und Himmel verschwammen im schwarzen Dunkel, kein Stern, kein Mondstrahl beleuchtete den Weg, nur die letzte, halb erloschene Laterne, welche Laubmann an die Deichselspitze des leichten Cabriolets gebunden hatte, warf hie und da einen unsichern Flackerschein über den tief ausgewaschenen Feldweg, dessen steinbesäete Furchen das Gefährt wie auf Meereswogen schwanken ließ. Zu beiden Seiten dehnte sich flache Ebene aus, sehr selten unterbrochen durch eine verwilderte Brombeerhecke, welche, wie ein schwarzer Klumpen, mit abenteuerlichsten Formen im Nebelmeer auftauchte.
Im Wagen blitzt ein Streichholz auf, eine weiße, ringgeschmückte Hand hebt es empor, um eine neue Cigarre in Brand zu stecken.
Es ist ein schönes Männergesicht, welches die rote Flamme momentan beleuchtet. Ein schwarzes Bärtchen kräuselt sich keck auf der Oberlippe, zwei große stolze Augen leuchten unter regelmäßig gewölbten Brauen, Wangen und Kinn sind halb verdeckt durch den emporgeschlagenen Kragen eines Offizierpaletots.
»Jetzt sind wir halt auf der Haide, Herr Graf«, wandte sich Laubmann von seinem hohen Kutschersitz zurück, »nun braucht’s noch ein bissel Geduld, und wir sind wieder auf der Chaussee, dann ist’s halt noch ein’ Pfeif Tabak lang und wir sehen Casgamala vor uns!«
Der junge Offizier strich ein zweites Streichholz an und sah nach der Uhr.
»Dreiviertel auf elf schon! Wir kommen nicht vor Mitternacht an, Alter!« antwortete er ungeduldig, »hol’ der Satan Eure verdammten Steppen hier, die kaum einen Fahrweg, geschweige eine Eisenbahn aufzuweisen haben!«
»Bscht! – wenn der Herr Graf so gnädig sein wollten und lieber nicht so laut hier fluchen!« wandte sich der Kutscher mit scheuem Flüsterton zurück, »wir sind halt auf der Haide jetzt, Ew. Gnaden, und da muss man ein bissel vorsichtig sein, möchte auch Ew. Gnaden gar nicht raten, sich hier so scharf umzuschauen; man sieht oft mehr, als man halt wünscht und ei’m lieb ist!«
Graf Echtersloh lachte laut auf. »Ich glaube bei Gott, alter Maulwurf, Er will mich ein bissel graulich machen!« rief er, übermütig die Arme auf die Barrière des Kutscherbockes legend, »es spukt wohl hier, Laubmann, he?« Der Alte nickte geheimnisvoll.
»Und was für ein gespenstiges Wesen hat sein Reich auf dieser Haide aufgeschlagen, wenn man fragen darf? Wenn es eine ideale Fee voll Zauber und Schönheit ist, soll sie mir jederzeit auf meinem Boden willkommen sein, der Frau Venus erlasse ich sogar Steuer und Mietzins!« Sein helles Lachen hallte laut über die Haide und weckte fern über dem Moor ein paar melancholische Unkenstimmen, der Wind pfiff durch das struppige Ginsterkraut und raschelte in den langen Schlehdornzweigen, welche am Straßenhang in dichten Büschen wucherten.
Laubmann zog den Mantel hoch über die Ohren und schaute nicht rechts noch links.
»Was es für ein Spuk ist, der hier umgeht, weiß halt kein Mensch zu sagen, Herr Graf«, murmelte er fast grimmig in den Bart, »aber sie nennen ihn den Irrgeist von Casgamala!«
»Alle Wetter! Irrgeist von Casgamala! Wenn der Träger dem Namen entspricht, so ist es wenigstens ein poetisches Ungeheuer, das etwas auf wohllautende Visitenkarten gießt! Hm – und in welcher Weise macht sich besagtes Wesen ohne Fleisch und Blut bemerklich?«
Der Alte schauderte unter dem Klang der leichtfertigen Männerstimme neben ihm.
»Der Irrgeist von Casgamala ist halt nur ein Licht, Ew. Gnaden!« flüsterte er.
»Ein Licht?!«
Laubmann bejahte. »Eine grellrote Feuerflamme, welche urplötzlich vor einem auftaucht und Augen und Sinne blendet; das Vieh ist tagelang wie im Dusel hinterher, wenn’s sie gesehen hat, und die Menschen – ja, die zittern halt an allen Gliedern, weil es stets ein Unglück gibt, wenn sich der Geist blicken lässt!«
»Hol ihn der Henker! Na, und?« Er fragt, »Laubmann, hier auf der Haide treibe sich der freche Geselle herum?«
Der Gefragte neigte sich dicht zu dem Ohr seines jungen Herrn. »Nicht allein hier, Herr Graf, überall spukt er herum! Im Schlosse selber, im Park, auf der Haide hier, und vornehmlich bei recht dunkeln stürmischen Nächten in der Nähe der Marmorbrüche. Dort links, wir werden gleich hinkommen! Es war eigentlich lange Jahre Ruhe, man kannte den Irrgeist von Casgamala halt nur wie eine Sage im Dorf, denn seit der alte Herr Graf gestorben waren und deren Frau Mutter sich nie mehr um das Schloss bekümmert hat, von der Residenz aus, da ist alles zerfallen und vermodert bei uns, und wenn nicht der lahme Christoph, der Kastellan, den die Frau Exzellenz-Gräfin ins Schloss gesetzt hat, hie und da in den Spinnstuben die Geschichte von dem gespenstigen Lichte erzählte, dann hätte halt keine Seele mehr an den Spuk gedacht, Ew. Gnaden! Wie aber eines schönen Tages dero gnädigster Herr Bruder aus dem Kadettenkorps zurückkam und sich in den alten zerfallenen Turm im Park einlogierte, und kein Mensch aus dem sonderbaren Wesen des Herrn Grafen klug wurde, da fing urplötzlich auch wieder der Spuk an, und seit den sieben Jahren ist wohl kaum eine Woche oder höchstens ein Monat vergangen, dass nicht die rote Flamme überall umhergehuscht wäre!«
»Mein Bruder Desider wohnt also nicht im Schlosse selbst?« fragte Graf Echtersloh nachdenklich.
»Nein, Ew. Gnaden; wie schon gesagt, er kam eines schönen Tages an, suchte sich den alten Lebrecht, seines Vaters ehemaligen Kammerdiener im Dorfe auf, ließ sich das Schloss aufschließen und durchwanderte schweigend alle Zimmer, dann streifte er mit dem Lebrecht kreuz und quer durch den Park, ließ sich den alten Turm oder Kiosk, wie man’s heißt, öffnen und blieb wohl eine halb Stunde lang darin. Dann wurden ein paar Zimmerleute aus dem Dorfe geholt, die haben einen Tag lang darin umher rumort und hierauf ist keine Menschenseele wieder in den Park gekommen. Der Graf hat ein Gitter mitten durch ihn hingezogen, das die Anlagen samt dem Kiosk von dem modernen Schlossgarten trennt und dahinter hat er nun gehaust, Tag für Tag mit dem alten Lebrecht zusammen, ohne dass ein Menschenauge mal bei ihm hätte hinein schauen dürfen.«
»Seltsam! Mein Stiefbruder ist eben verrückt! Er hatte das Unglück im Cadettencorps von dem Pferde zu stürzen und sich das Gehirn zu erschüttern –«
»Halten zu Gnaden, Herr Graf, er redet aber ganz vernünftig und bei Sinnen. Hie und da ist er mal ein paar Arbeitern auf dem Felde begegnet, und die konnten gar nicht genug rühmen, wie gut und freundlich Graf Desider mit ihnen gesprochen hat, ein bissel seltsam ist er wohl schon, das mag sein, aber –«
»Unsinn! Mein Bruder ist unheilbar geisteskrank!« unterbrach Graf Lothar fast barsch, »das beste Zeugnis dafür ist wohl sein ganzes Gebaren, welches mit gesundem Menschenverstand nichts mehr gemein hat. Meine Mutter hat mir bis jetzt nur sehr flüchtige Mitteilungen über ihn gemacht, da der liebenswürdige Sohn in den ganzen drei Monaten ihrer Anwesenheit kaum fünf Minuten Zeit für sie gehabt hat. Er ist verschollen und vergessen in seiner Einsamkeit, und ich halte es darum für meine Pflicht, mich selber von dem ganzen Stand der Dinge zu überzeugen. Desiders Unzurechnungsfähigkeit macht mich zum Majoratsherrn und Haupt der Familie!« Es lag ein scharfer Klang in der Stimme des schönen Offiziers und die Worte: »Mein Bruder ist unheilbar geisteskrank« trugen den Charakter eines Befehles, da gab es kein Widersprechen mehr. »Bewohnt meine Mutter das ganze Schloss?« fuhr er nach kurzer Pause fort, den Rest der glimmenden Cigarre mit nachlässiger Handbewegung über den Wagenschlag auf den Weg schlendernd: »Sie schrieb mir, dass das ganze Gebäude bedeutender Reparaturen bedürfe!«
»Das bedarfs halt schon, Ew. Gnaden, der linke Schlossflügel ist nahezu am Zusammenfallen und wenn ihm nicht bald ein bissel aufgeholfen wird, dann dauerts nicht lange mehr, und er schaut ebenso wackelig drein, wie die alten Gemäuer, die noch rings im Parke stehn! Die Frau Gräfin Mutter bewohnt den ganzen Neubau und auf Wunsch der Comtesse Dolores sind auch die versiegelten Zimmer geöffnet, welche zu der Kapelle führen!«
Graf Lothar lachte leise und ironisch auf: »Natürlich, die Kapelle, die hat meine fromme Schwester zuerst ausgefegt! Es gibt doch recht viele Heiligenbilder und Betschemel darin und grausige Fegefeuer, welche die gläubigen Seelen nach Möglichkeit ängstigen?«
Der alte Mann verstand nicht den frivolen Spott in der Frage des Grafen, er nickte eifrig mit dem Kopf und schien froh zu sein, das Gespräch auf ein weniger gefährliches Thema gelenkt zu sehen.
»Das will ich meinen, Ew. Gnaden, wie ein wahres Schmuckkästchen schaut die kleine Kirche aus. Rings an den Wänden vergoldete Bilder, Märtyrer und edle Herren und Frauen aus dem Geschlecht der Grafen von Echtersloh mit vielerlei Wappen und Waffen darum her, und hohen Denksteinen von Marmor, immer da, wo der Sarg in der Gruft darunter steht. Nur ein einziges Schild ist umgekehrt und mit einem schwarzen Vorhang bedeckt, da soll kein Mensch hinter schauen, Ew. Gnaden, weils der Grabstein der schönen Gräfin Casga ist!« fuhr er mit gedämpftem Flüsterton fort, »der Christian hats aber doch einmal getan, na – und da sah er eben – der Herr wissen doch –!«
»Gar nichts weiß ich, Alter! – am Ende gar meine schöne Ahnfrau selber?«
Laubmann hob die Hand an den Mund und blickte sich scheu um. »Gott behüte, Ew. Gnaden, aber eine hohe Feuerflamme, welche auf den schwarzen Grund gemalt ist, und über deren Spitze eine rote Rose schwebt, das ist eben der Irrgeist von Casgamala, und darum sind auch die Rosen und die Flammen zum Schicksal der Grafen von Echtersloh geworden!«
Graf Lothar lachte schallend auf. »Der Irrgeist von Casgamala! Gut, dass Du mich wieder an den interessanten Gesellen erinnerst, Laubmann! Du sagtest vorhin, wir seien nicht mehr weit von den Marmorbrüchen entfernt, he? wie lange dauert es noch, bis wir hinkommen?«
»Still, Herr Lieutenant, bei allem, was Ihnen lieb ist, hier dicht zur Seite sind sie schon, wir fahren halt eben daran vorüber.« Der Alte legte wie beschwörend seine zitternde Hand auf den Arm des jungen Offiziers, »treiben Sie keinen Scherz damit, Graf Lothar, erst wenn man den Schaden hat, wird man klug, sagt’s Sprichwort!«
»Hasenfuß Er!« spottete Graf Echtersloh mit lauter Stimme, »eine Schande ist’s, dass solch ein alter Kerl noch an blödsinnige Ammenmärchen glaubt, mein Bruder scheint Ihn angesteckt zu haben mit seiner Verrücktheit! Aufgepasst, Monsieur Graukopf! Ich will Ihm beweisen, dass der Irrgeist von Casgamala nur in den Köpfen dummer Bauern spukt!« Und sich hoch im Wagen emporstellend, rief Graf Lothar mit übermütiger Stimme durch Wind und Haideland in die schwarze Nacht hinaus: »Irrgeist von Casgamala, Engel oder Teufel, Flamme oder Rose, süßes Weib oder gräulicher Unhold, heran zu mir und neige Dich vor Deinem zukünftigen Meister, dem Erben und Majoratsherrn von Casgamala, Grafen Lothar von Echtersloh!«
Schauerlich hallte es durch die Dunkelheit, der Wind sauste um den Wagen und die Gräser am Wege raschelten auf, Laubmann aber saß bleich wie der Tod auf seinem Kutscherbock und umklammerte mit zitternden Händen die Zügel.
»Schläfst Du, Irrgeist von Casgamala?!« donnerte die Stimme Lothars abermals durch den Sturm, »heran. Du frecher Geselle – – ha! – – was ist das?!«
Wie ein Blitz stammte es urplötzlich durch die Dunkelheit, dicht vor dem Wagen glühte ein grelles Licht auf, flackernd in blutigem Rot, und die ganze Gegend in blendende Helle tauchend, als stünde der frivole Geisterbeschwörer auf lohendem Feuerthron. Einen Augenblick – dann schlug die Finsternis wieder über ihm zusammen.
Mit wahnwitzigem Aufschrei war Laubmann auf die Erde herab gesprungen, um das Gesicht auf dem Erdboden zu bergen, Lothar aber stand starr, mit weit aufgerissenen Augen im Wagen, stumm, unfähig sich zu rühren; doch nur eine Sekunde lang, dann stieg der Apfelschimmel mit schnaubenden Nüstern pfeilgrad in die Luft und raste wie von Furien gepeitscht über das weite Feld … Nach wenig Minuten biegt der Weg scharf in die Chaussee ein. Lothar neigt sich schwankend vor und hascht nach den Zügeln … umsonst – der Mond bricht jäh durch die Wolken – dort – kaum zwanzig Schritte noch, ragen die Marmorbrüche und senken sich mit schwarzer Untiefe hinab – schnurgerade auf sie zu donnert das Gefährt, Funken sprühen unter den Hufen des dahinstürmenden Tieres.
Schwindel erfasst den jungen Offizier, er schwingt sich über den Wagenrand und will hernieder springen, da krachen auch schon die Räder an aufgetürmtem Felsgeröll, schnaufend bricht der Schimmel in die Kniee und schleudert das leichte Gefährt schmetternd gegen die scharfen Marmorblöcke. – –
3.
Und suchst Du Deinen Trauten so geh zum Waldesgrund, wo zwischen Moos und Steinen die roten Nelken weinen, da liegt er todeswund!
Altes Lied.
Gräfin Echtersloh schlug das Romanbuch zu und warf es klatschend auf den Tisch, ein ärgerlicher Blick streifte die Uhr, welche soeben mit zwölf langzitternden Schlägen Mitternacht verkündete.
»Es ist unbegreiflich, wo sie bleiben!« klang es in harten, wenig sympathischen Tönen von den blassen Lippen, welche sich knapp und schmal über die außergewöhnlich starken Vorderzähne legten, so knapp, dass das grelle Weiß beständig hervorleuchtete und dem Gesicht der alten Dame einen ungewöhnlich scharfen Ausdruck verlieh. »Eben schlägt es zwölf und der Zug kommt bereits um sechs Uhr in Bierach an; ich finde es unbegreiflich rücksichtslos von Lothar, uns so lange warten zu lassen, um so mehr als er weiß, wie sehr ich mich auf seine Ankunft freue!« Momentan herrschte Schweigen, dann fuhr die Gräfin im gereizten Tone fort: »Nun? hält es keine von Euch der Mühe wert, mir zu antworten? Wie die Stockfische sitzt Ihr stundenlang am Tisch und kümmert Euch viel darum, ob sich Eure Mutter ängstigt oder nicht! O Du ewiges Schicksal, warum strafst Du mich mit lauter teilnahmlosen Kindern, die für nichts Sinn und Interesse haben als für ihr eigenes liebes Ich.« Und Excellenz warf den gewaltigen Fächer, welchen sie nervös auf- und zugeklappt, mit einem Ausdruck tiefster Verachtung zu dem Romanbande auf den Tisch.
Comtesse Dolores hob langsam ihr blasses Gesicht: »Was sollen wir denn antworten, Mutter? Du fragst seit drei Stunden ununterbrochen dasselbe«, klang es in fast dumpfem Tone, »vorhin schlug es elf, jetzt Mitternacht, es wird vielleicht auch noch ein Uhr werden, bis der Bruder kommt. Abwarten und geduldig sein, das ist nun einmal die Bestimmung des Christen, ob hier oder dort«, und Dolores hob langsam die magere Hand zum Himmel und fügte salbungsvoll hinzu: »Wer beharret bis ans Ende, der wird selig!«
Ein fast feindseliger Blick aus den hellen Augen der Gräfin streifte die Sprecherin: »Amen!« persiflierte sie, mit hohnvoller Kopfneigung, die Hände über der Brust kreuzend, »danke gehorsamst für den erbaulichen Vortrag, Hochwürden! Es ist doch wirklich etwas wert, wenn man fromme Töchter hat!« fuhr sie mit schneidendem Auflachen fort, »man kann dann wenigstens erleben, dass das Ei der Henne geisttötende Wiederholungen in der Unterhaltung reprimandiert! O Himmel, warum bin ich unglückliches Weib dazu verdammt, mein bischen Leben in dieser Einöde zwischen Tugendspiegeln und Verrückten zu verkümmern. Gebetbücher und Altardecken, das ist die Augenweide, welche mir hier geboten wird, jede Minute ist vergeudet, welche ich in diesem lebendigen Grabe aushalten muss, und wie kurz ist solch ein Menschenleben verflattert!«
»Und wie ernst ist die Stunde, in welcher wir über dieses nichtige Dasein abrechnen müssen!« Comtesse Dolores ließ die schwarzsammtne Decke sinken, auf deren Mitte sie mit Goldfaden Kreuz und Pokal stickte und richtete ihr graues Auge scharf auf die Mutter: »Ich dächte, Du hattest Dein Leben genossen, Mama; mehr vielleicht, als Du verantworten kannst!«
Die Gräfin schnellte von ihrem Sitz empor und ballte die weiße Hand auf der Sessellehne. »Das wagst Du mir, mir, Deiner Mutter, zu sagen??!« rang es sich fast zischend von den schmalen Lippen. »Unerhört! Verlass dieses Zimmer, elende Komödiantin, komm mir nicht wieder unter die Augen, oder – beim ewigen Himmel, ich vergesse mich und lehre Dich mit diesen Händen die Demut, welche ein Kind den Eltern schuldet! Du erdreistest Dich, mich zur Rechenschaft zu ziehen, Du –«
»Genug der Worte, Mutter, ereifere Dich nicht!« schnitt die monotone Stimme der Comtesse einen weiteren Ausbruch der Heftigkeit ab. Hoch und schmal stand ihre hagere Gestalt im Lampenschein, umflossen von eintönig grauen Wollenfalten, schlicht und schmucklos wie das Gewand einer Nonne. »Du zürnst mir als Tochter, ich vergebe Dir als Jüngerin des Herrn! Du zeihst mich der Pflichtvergessenheit und weisest mich in die Schranken kindlicher Demut, ich aber entgegne Dir, dass jetzt nur die Christin zur Christin, die Magd Gottes zu ihrer Glaubensschwester spricht! Ich durchschaue Dich, Mutter, und sehe die breiten Wege der Hoffahrt und Eitelkeit, welche Du wandelst, ich habe den eiteln Tand und Flitter mit eignen Augen gesehen, welcher unser Vermögen untergraben hat! Ich lernte den Glanz verachten, hinter dessen grinsender Larve die ewige Nacht lauert. Wo wanderten die Banknoten und Goldrollen hin in der Residenz? Auf den Markt vergänglichen Plunders, auf den grünen Tisch des Lasters, welchen tückische Freunde auf das Parquet der eleganten Welt schoben! Wer hat dort gesessen und Unsummen in den Pfuhl der Hölle gestreut? Du! – wer hat Pariser Sammet und Seide kommen lassen? Du! Wer hat sich selber die Schlinge um den Hals geworfen und auf den Pfad gesteuert, welcher in dieser Einsamkeit hier endete? Du! – und darum ertrage auch Dein Schicksal mit Geduld und Ergebung und danke dem ewigen Himmel, dass er Dich nicht schwerer heimgesucht hat! Du nennst mich verrückt und scheinheilig? Was bleibt mir anders übrig als der Himmel, wenn mir meine eigene Mutter die ehrliche Existenz in der Welt untergraben hat! Du hast Deine Kinder um ihr Leben betrogen! Und Dir dies frei und rückhaltslos in das Gesicht zu sagen, das ist die einzige Rache, die ihnen dafür geblieben ist!« Es lag eine grausame Ruhe in der Stimme der jungen Dame und der erbarmungslose Blick der Augen wirkte wie lähmend auf die Sinne der Gräfin.
Mit nervös zuckenden Gliedern sank sie in die Sesselpolster zurück. »Sie mordet mich mit ihrem Wahnsinn!« klang es erschöpft von ihren Lippen. »Und das ist der Dank für all’ meine Liebe und Aufopferung. Was ich getan habe, tat ich für meine Kinder, um Euch mit dem vollen Glanz Eures Namens in die Welt einzuführen, gab ich alles dahin, was ich besaß, viel warf ich in die Wagschale des Lebens, in der Hoffnung, viel dafür zu gewinnen; um meine Töchter glänzend zu versorgen, machte ich mich selbst zur Bettlerin und das ist der Dank, das Mitleid, welches ich ernte!«
»Nein Mutter, ich kenne kein Mitleid mehr!« erwiderte Dolores kalt, »wenigstens nicht für Feigheit. Warum versuchst Du es, Deine Schuld jetzt auf uns zu wälzen in der sinnlosesten Weise, über welche jedermann nur lachen kann? Jesabell und mich hast Du in die Welt geführt, nachdem unsere Finanzen bereits ruiniert waren. Ich habe zwei Jahre getanzt, meine arme Schwester nur einen einzigen kurzen Winter, in welchem bereits die zahllosen Rechnungen und Deine gereizte Stimmung ein jedes Vergnügen vergällten; Jesabell ist jetzt achtzehn Jahre alt, unser Vermögen aber haben die ersten zehn Jahre Deiner Wittwenschaft verschlungen, in welchen wir noch vergessen in dem Stift erzogen wurden und es nur aus Deinen flüchtigen Briefen erfuhren, wie himmlisch es sei, zu leben und zu genießen.« Eine leidenschaftliche Bitterkeit klang durch die monotone Stimme des jungen Mädchens, die Gräfin aber presste mit schneidendem Lachen die Hände gegen die Ohren.
»Genug, Dolores, genug; warum musst Du armes Kind in einem Zeitalter leben, welches den öffentlichen Pranger abgeschafft hat und den Kindern nur noch die Zunge gelassen hat, um die eigene Mutter zu geißeln, o Lothar – Lothar, mein Liebling, warum kommst Du mir nicht zu Hilfe!« und Gräfin Echtersloh warf ihr Gesicht auf die Polster und brach in konvulsivisches Schluchzen aus.
Regungslos stand Dolores und blickte auf sie herab, ein kühles Lächeln neigte ihre Mundwinkel, dann setzte sie sich gelassen wieder nieder und fuhr fort, die Goldfäden durch den schweren Sammet zu ziehn. Ihr gegenüber aber erhob sich hastig eine junge Dame und trat an den Sessel der Gräfin.
»Mama, liebe Mama, weine doch nicht!« bat eine weiche Stimme, und Jesabell neigt ihr rosiges Gesichtchen zu der Wange der alten Dame, »dass es doch auch ewig zu solchen Szenen zwischen Euch beiden kommen muss, kein Tag vergeht mehr, ohne dass Ihr Euch veruneinigt.«
»Du hast es ja selber gehört, Kind, wie Dolores mich gereizt hat!« fuhr Excellenz empor.
»Ich konnte sie nicht unterbrechen, Mama, weil ich über der Wirtschaftsabrechnung saß und alle meine Gedanken zusammenhalten musste! Du kennst ja die strengen Ansichten der Schwester und darfst nicht alles so peinlich auffassen, Ihr versteht Euch nun einmal nicht.«
»Das weiß Gott!« seufzte Gräfin Echtersloh mit feindseligem Blick auf die bewegungslosen Züge ihrer Ältesten.
»Und nun seid wieder gut zusammen und schmollt nicht Tage lang. Was soll Lothar sagen, wenn er Euch in solcher Stimmung antrifft, es verleidet ihm ja von vornherein seinen ganzen Aufenthalt hier!«
Die Gräfin zog ein Flacon aus der Tasche und netzte sich die Schläfen mit Eau der Cologne »Was hast Du eben getan, Jesabell?« fragte sie ruhiger, »Wirtschaftsrechnung durchgesehn, hörte ich recht?«
Das reizende Gesichtchen der Comtesse erglühte bis lief unter die schwarzen Haarlocken.
»Ja, Mama, ich habe die Führung des Haushaltes selber übernommen, seit die Mamsell fort ist«, sagte sie leichthin, »es lässt sich manches viel sparsamer einrichten und außerdem macht es mir auch viel Vergnügen.«
Die Gräfin seufzte auf. »Du selber die Wirtschaft führen? Mon Dieu, es ist entsetzlich – eine Comtesse Echtersloh!« rief sie, den Fächer hastig vor dem Gesicht auf und nieder bewegend. »So weit musste es also kommen! Und die Mamsell? Was fällt der Person denn ein, uns zu verlassen?«
»Sie hat seit einem Jahre keinen Lohn bekommen, Mama!« flüsterte das junge Mädchen mit geneigtem Haupt, »und da sich doch schließlich jeder selbst der Nächste ist, so hat sie uns gekündigt!«
»Natürlich, was kann man auch anders von solchem Gesindel erwarten!« Die Lippen der Excellenz kräuselten sich verächtlich. »Von Anhänglichkeit ist da keine Rede, und wie viel Güte hat die Person von mir genossen! Wenn ich allein bedenke, all die kostbaren Toiletten, die ich ihr in der Residenz schenkte, hier auf dem Lande würde ich sie ruhig weiter getragen haben, bei Hofe war es nicht möglich. Was würde ich jetzt darum geben, wenn ich meinen Sammetrock mit der französischen Stickerei noch hätte, damals schenkte ich ihn fort, weil meine Jungfer einen kleinen Flecken mit Benzin gereinigt hatte und der Geruch mir so unbeschreiblich odiös war«, und die Gräfin überflog mit schnellem Blick ihre fadenscheinige Seidenrobe, welche mit unechten Spitzen garniert war. »Nun, Gott sei Dank, Kinderchen, in vierzehn Tagen gehen wieder neue Zinsen ein, und wenn Lothar kommt und hoffentlich dem verrückten Menschen im Kiosk drüben den Majoratsherrn abgewinnt, dann hat es vollends ein Ende mit all unserer Not, dann gießt Fortuna noch einmal ihr Füllhorn über uns aus.«
»Gott soll mich bewahren, jemals dieses Sündengeld zu berühren!« klang es frostig von Dolores herüber.
Ein spöttischer Seitenblick war die einzige Antwort der Mutter, Excellenz war plötzlich guter Laune.
»Reiche mir einmal den Karton von der Kommode, liebe Jesabell!« rief sie mit scharfer Betonung dem jungen Mädchen nach, welches an den Flügel trat und ihn öffnete. »Lass jetzt Dein Spielen, ich wünsche nachher mit Dir Patience zu legen. Ah, da ist ja die Sendung, Gerson wird hoffentlich auch Deine Zufriedenheit erwerben!« und Gräfin Echtersloh schlug die Seidenpapiere auseinander und entfaltete zwei köstliche Weiße Spitzenshawls. »Herrlich! excellent!« rief sie mit leuchtenden Augen, die glänzenden Falten über dem dunklen Tischteppich zusammenraffend, sodass sich die weißen Seidendessins noch mehr hervorhoben, »und denke Dir, Lieb, beide Fichus zusammen nur einhundertzwanzig Mark, das ist doch ein Spottpreis, man darf es wirklich gar nicht bei andern Menschen sagen.«
»Einhundertzwanzig Mark?« wiederholte Comtesse Dolores wie mit Grabesstimme, »für ein paar Tüllfetzen, die hier auf dem Lande im Schrank vergilben werden? Das nenne ich ein Sündengeld, dafür hättest Du lieber die dringendste Forderung Deiner Modistin befriedigen sollen.«
»Das nächste Mal werde ich Dich um Rat fragen, meine Tochter!« Die Lippen der Gräfin schürzten sich noch höher über die Zähne, »apropos, Jesabell, die Sachen hier sind bereits bezahlt, ich habe das Geld sofort mit der Bestellung eingesandt.«
»Und wo hattest Du das Geld her, Mama?« Dolores richtete die grauen Augen durchdringend auf das Antlitz der Gefragten, »es waren vor acht Tagen noch sieben Mark in unserer Kasse.«
»Hattest Du gespart, Mamachen?« Jesabell zwang sich zu einem heiteren Ton, um die beißende Schärfe der Schwester zu mildern, »oder hast Du hier vielleicht einen: ›Sesam, Sesam öffne Dich‹ entdeckt, in welchem noch unermessene Schätze ruhen?«
Die Gräfin lächelte. »Nein, Kleine, das könnte höchstens der Kiosk des Majoratsherrn sein, in welchem allerdings das Vermögen der Echterslohs schlummert; aber dahinein dringt kein Sterblicher, am wenigsten Deine Mutter! Woher ich das Geld habe, geht keine naseweise Fragerin etwas an, wenigstens ist es mir noch unbekannt, dass Fräulein Dolores zu meinem Vormund eingesetzt ist.«
Um die Lippen der jungen Dame zuckte es, aber sie neigte schweigend das blonde Haupt und zog ruhig die Nadel durch den Sammet – voller und leuchtender trat das Kreuz daraus hervor, und auf seinem Stamm begann Dolores die Worte einzusticken: »Nehmt auf euch Sein Joch und lernet von Ihm.«
»Gib die Karten herüber, Jesabell, wir wollen eine Patience legen, ob Lothar bald kommen wird«, rief Excellenz über den Tisch, und presste das Battisttuch gegen den geöffneten Mund; sie begann mit der Zeit müde zu werden.
Die Lampe brannte mit gedämpftem Licht auf dem runden Tische von Ebenholz, einen unsichern Schein über das Turmzimmer werfend, welches die Gräfin zu ihrem Boudoir bestimmt hatte. – Hohe, mit schwerem Damast bekleidete Wände trugen den kostbaren Plafond, über welchen sich ein kunstvoll gearbeitetes, von der Zeit allerdings in seinen Farben gedunkeltes Netz üppigster Blumengewinde zog, an allen vier Ecken aus goldenem Füllhorn strömend, welches pausbäckige Engel lächelnd über die Lockenköpfchen emporhielten.
Korrespondierend mit Decke und Wandbekleidung war das überaus wertvolle Mobiliar, dessen gefällige Formen den Geschmack der Renaissancezeit verrieten, dunkelgrüne Atlaspolster, deren aufsteigende Lehnen in ovalen Medaillons zierlichste Pastellmalerei zeigten. Fast plump und geschmacklos in dieser Umgebung nahm sich der moderne Flügel aus, welcher mit seinem polierten Dreieck weit in das Zimmer ragte, fremd und absonderlich, wie ein Stück nüchterne Kultur, welches ein Sturmwind in einen Märchenwinkel verschlagen. – Es war aber der ausdrückliche Befehl der Gräfin gewesen, ihr geliebtes Instrument in nächster Nähe zu wissen, denn welch eine Zerstreuung war ihr noch in dieser Einöde geblieben, als wie die weiß glänzenden Tasten, welchen sie allerdings auch mit Meisterschaft die vollen Klänge entlockte. Gräfin Echtersloh besaß nur dieses einzige Talent, aber sie hatte es gewissenhaft ausgebildet, und wenn die langen, ringgeschmückten und sehr knöchernen Finger über die Tasten glitten, wühlend in brausenden Akkorden, und wiederum leise, schmachtende Melodien darauf hervorlockend, dann verstummte ringsum das Zischeln und Höhnen, und die boshafte Menge hatte es vergessen, dass jenes Weib vor dem Klavier die Gräfin Echtersloh sei, dass die Brillanten an ihrem Halse falsch, der schleppende Atlas um sie her noch nicht bezahlt war …
Die Zeiten aber waren vorbei, wo Frau Leontine im Glanz von hundert Flammen an den Flügel geführt wurde, wo Seine Königliche Hoheit selber ihr den Arm bot, und dann sich schweigend an das Instrument lehnte, um ein Antlitz zu studieren, in welchem man keinen einzigen Zug schön nennen konnte, und welches dennoch der Magnet eines jeglichen Festes war, die Sonne, um welche das Sternenheer der Jeunesse dorée kreiste!
Gräfin Leontine wollte schön sein, und darum war sie es auch. Was die Natur versagte, ersetzte die Kunst, was nicht versteckt werden konnte, brillierte unter der Glasur einer zauberischen Liebenswürdigkeit, welche unterstützt von Geist und Grazie das Wunder vollbrachte, die junge Wittwe als gefeiertste Schönheit der Residenz gelten zu lassen. – Man umschwärmte sie, suchte ihre witzsprühende Unterhaltung, bewunderte die oft raffinierte Pracht ihrer Toilette, sagte sich voll tiefster Überzeugung, dass die schöne Gräfin recht kokett sei, und weder ihre Augen, noch ihr Mund Anspruch auf Schönheit machen könnten, dennoch küsste man ihr die kleinen Hände und dachte: »Alle Welt verehrt sie, und die große Menge hat immer recht, allons donc, schwimmen wir also mit dem Strom!« – Jahre lang flatterte die strahlende Erscheinung Leontinens über das Parquet der Residenz, sie lachte, tanzte und amüsierte sich, und wenn die Revenuen nicht Schritt halten wollten mit all’ den enormen Ausgaben, dann griff sie zum Kapital, und als dieses mehr und mehr zusammenschmolz, da ließ sie Rechnungen schreiben. O selige Nächte, wenn die Gräfin von Spiel und Tanz zurückkam, Seide und Crêpewogen um sie her, Orangenduft und Goldstaub, und wenn sie dann auf den Klaviersessel niedersank, das Haupt in süßem Traum zurückgeneigt, die dunkle Haarespracht noch zusammengehalten von entblätterndem Kranze, und nun in die Tasten griff, um ein süßes Bild der Erinnerung in Tönen zu malen, zusammengewebt aus den Triumphen der letzten Stunden, aus Hass und Liebe, Hangen und Bangen, tausend Rätseln eines leidenschaftlichen Weiberherzens! – – Ja, das war eine wonnige Zeit, das waren die Tage der Rosen! … und was ist von ihnen übrig geblieben? … Dort in dem einsamen Turmzimmer von Casgamala, geduldet nur auf dem Grund und Boden des gehassten Stiefsohnes, sitzt Gräfin Leontine und flucht ihrem Schicksal.
Ihr Scheitel ist ergraut unter Enttäuschung und hereinbrechender Rot, dennoch wiegt sich auf ihm ein koquetter Spitzenaufschlag mit rosa Bandschleifchen, und auf dem Toilettentisch versteckt sich ein kleines Flacon fast errötend hinter dem Lavoir: »Haarfärbemittel« steht voll echt deutscher Ungeschliffenheit darauf. – Hager und gezerrt erscheinen die einzelnen Züge ihres Gesichtes, wie vergilbtes Pergament zieht sich die Haut darüber, namentlich seit letzter Zeit, wo Puder und Rouge allzu großer Luxus für diese Einöde und das verständnislose Bauernvolk sind, und die Zähne, welche man früher zwischen den purpurnen Lippen bewunderte und sie vorwitzige kleine Perlen nannte, die starren jetzt unangenehm aus dem blassen Mund, ebenso unschön wie der scharfe Blick des Auges, in welchem sich die ganze Erbitterung eines tief enttäuschten Gemütes spiegelt.
Dennoch wollen die Lippen noch immer lächeln, und die hageren Schultern drapieren sich gar zu gern mit duftigen Spitzen, auch jetzt zittern Bandschleifen und Blonden darum her, und an der eingesunkenen Brust leuchten drei grellfarbige Nelken.
Gräfin Echtersloh ist Mutter von drei Kindern, Dolores, Lothar und Jesabell.
Lothar, ihr Stolz, ihr Liebling! Er steht bei den Garde-Dragonern in der Residenz, schön wie ein Gott, flott und übermütig wie ein echter Sohn der Frau Leontine: »Mein Helios!« nennt ihn die entzückte Mutter. Mit ihm harmoniert sie vollständig, seine Passionen sind die ihren, seine Ansichten sind das Echo der eigenen, in der Schönheit des Sohnes lebt das Andenken der Mutter noch einmal auf. – Warum musste Lothar der zweitgeborne Sohn sein? Warum stellt das Schicksal jenen hässlichen verrückten Menschen im Kiosk als widerwärtiges Hemmnis auf seinen triumphreichen Lebensweg, ihm durch diese verschollene Existenz das Majorat entziehend, in dessen Schoß der Segen des Reichtums schlummert? – Desider hat ja ein bedeutendes mütterliches Vermögen, warum wird gerade er noch mit all’ diesen Glücksgütern überschüttet, er, der wie ein Toter zwischen Ruinen und einsamen Wäldern lebt? – – – Oh, nur Geduld mein Lothar, mein Liebling, es ist noch nicht aller Tage Abend!
Dolores wird gehasst von ihrer Mutter; wie Feuer und Wasser stehen sich beide Frauen gegenüber. Wie kommt Gräfin Leontine überhaupt zu einer solchen Tochter? – Es ist unfasslich; starr und streng wandelt die Comtesse ihren Weg. Ihr Auge ist grau und erbarmungslos, ihre Lippen kennen keine Schonung, wie ein steinernes Bildnis sieht sie aus, auf dessen junge Stirn das Schicksal ein unheimliches Mal gezeichnet: dicht verwachsene Augenbogen, hinter deren scharfer Wölbung Hass und maßlose Erbitterung wohnen. – Dolores ist fanatische Katholikin; stundenlang liegt sie in der Grabkapelle auf den Knien und murmelt Gebete, ein graues Wollenkleid, lang und schmucklos wie ein Talar, fließt in weichen Falten von ihren Hüften, zur Seite schaukelt sich der Rosenkranz, und weiche Sohlen machen ihren Gang unhörbar, als schwebe sie wie die Frau Sorge aus der Fabel, über den Weg ihrer Mitmenschen. In schlichten Scheiteln legt sich das aschblonde Haar an ihre Schläfen, und verschlingt sich am Hinterkopf zum spärlichen kleinen Knoten, welchen Bruder Lothar zum Amüsement der Gräfin, »das heilige Zwiebelchen« getauft hat. – Lothars Witze sind oft unbezahlbar!
Comtesse Jesabell, die jüngste der drei Geschwister, war der Liebling des so früh geschiedenen Vaters. – Dunkellockiges Haar umrahmt ihr rosiges Gesichtchen, so frisch und lieblich wie eine jung erschlossene Knospe, um welche die ersten Sonnenstrahlen zittern, zwei große rehbraune Augen leuchten darin, umrahmt von seidenweichen Wimpern, welche ihre langen Schatten auf den Sammet der Wangen malen. – Seit kurzer Zeit jedoch liegt oft eine ernste Wolke auf der klaren Stirn, das Mündchen faltet sich seufzend und redet so klug und überlegt, als hätte es sein Lebenlang wie ein kleines Hausmütterchen über Butter, Eier und Wirtschaftssorgen verhandelt. – O hätte nur die Frau Gräfin Mutter zeitweise hinab in das kühle Milchgewölbe schauen können, um es mit Nervenschütteln anzusehen, wie ihre jüngste Tochter im hoch geschürzten Kattunkleidchen und Druckschürze zwischen den spärlichen Vorräten hantiert und die Tragkörbe der braven Mutter Laubmann mit geschickten Händchen füllend, endlich einen flehenden Blick in das runde Gesicht der Alten wirft, um ihr geheimnisvoll zuzuflüstern: »Aber vorsichtig, Sibylle, dass ja kein Mensch merkt, dass ich etwas auf dem Markte verkaufen lasse – gib es in Gottes Namen noch um einen Groschen billiger hin, wie das letzte Mal, nur bring’ Geld heim, Sibylle, ich weiß ja sonst nicht wie ich auskommen soll! …«
Und welcher Jubel, wenn Frau Sibylle dann zurück kommt aus der Stadt, schmunzelnd ihr schmales Lederbeutelchen in die Hand Jesabells schüttelt und, mit wohlgefälligem Nicken berichtet: »Hier, meine liebe gnädige Comtesse, heute sind’s noch fünfzig Pfennige mehr wie das letzte Mal!«
Fünfzig Pfennige, welcher Reichtum! Dafür bezahlte Jesabell sofort das letzte Paar Tauben im Dorf, welches Gräfin-Mutter jüngst zum Frühstück befohlen hatte. – Jetzt sitzt sie neben Frau Leontine im Turmboudoir und mischt die Karten.
»Es will absolut nicht aufgehen, Mama!« sagte sie endlich aufblickend, »wir haben alle Patiencen durchprobirt, weißt Du, was ich glaube?« – die Gräfin schaute sie fragend an – »Lothar kommt heute überhaupt nicht und Laubmann bleibt auf der Station bis zu dem Frühzug! Es ist gleich ein Uhr; ich dächte, Du gingest jetzt zur Ruhe, Mama, und begrüßest den Bruder lieber morgen mit frischen Kräften! Dolores und ich können ja noch ein Weilchen hier bleiben!«
Gräfin-Mutter nickte schläfrig: »Du hast recht, petite, es ist eine schreckliche Zumutung, dieses: Warten, und ich hoffe, Lothar ist nicht so rücksichtslos es zu verlangen! Ich werde denn in mein Schlaf-Zimmer gehen – schelle der Lore, dass sie mir behilflich ist!«
Jesabell erhob sich und schritt zu der Tür. Noch aber legten sich ihre schlanken Finger nicht auf die Klinke, als die schweren Eichenflügel auch schon hastig aufgestoßen wurden, und Frau Sibylle Laubmann leichenblass auf der Schwelle stand, hinter ihr erschien Lore mit gerungenen Händen.
»Ach, Frau Gräfin, ach du allmächtiger Gott!« – rang es sich mühsam von den Lippen der korpulenten kleinen Frau – »ach dieser Schrecken, dieses Unglück! – o du heiliger Clemens, ich glaube, mich rührt noch nachträglich der Schlag!« – Und jeglichen Respekt hintansetzend sank Sibylle auf den nächsten Stuhl, die Arme in die Hüften gestützt, mit weit geöffneten Augen Luft schnappend.
Jesabell wich erschrocken zurück. – »Was ist geschehen, Sibylle? Um alles in der Welt, ist ein Unglück passirt?« – Und mit zwei Schritten stand sie neben der Kutscherfrau, und umklammerte ihren Arm – »komm’ zu Dir Sibylle, ich beschwöre Dich« –
»Ach Frau Gräfin … ach gnädigste Comtesse …«
Dolores hatte sich langsam erhoben, sie wandte sich von der Mutter zurück, welche zitternd, regungslos in ihrem Sessel verharrte – »Sie bringt eine Hiobspost, Frau Laubmann!« sagte sie mit steinernen Zügen, »Ihr Mann und Lothar haben ein Missgeschick gehabt – der Wagen ist zerbrochen?«
»Ach, wenn’s nur das wäre – Comtesse – ach der unglückliche Herr Graf – so jung noch … und doch schon …« Und Sibylle schlug die breiten Hände vor das Gesicht und schluchzte herzzerreißend.
Wie elektrisirt sprang die Gräfin empor. – »Mein Sohn, mein Lothar?« – schrie sie gellend auf – »er ist tot, Sibylle – sage – er ist tot!« – und sie wühlte die Finger in ihr toupiertes Haupthaar und lief wie eine Irrsinnige im Zimmer auf und nieder.
»Tot! das wolle Gott verhüten!« – Jesabell fasste beschwörend die kleine Frau an beiden Schultern – »Sprich, Sibylle, martere uns nicht länger!«
Dolores regte sich nicht, nur ihre Äugen folgten mit fast ironischem Blick der Excellenz, welche mit theatralisch verzweifeltem Wehklagen auf der Causeuse zusammengesunken war.
»Eben kommt mein Mann …« beginnt Sibylle mit stockender Stimme – »ganz urplötzlich … ich sitze gerade und flicke ihm noch seine alte graue Jacke zurecht … und denke gerade so in meinen dummen Gedanken, na jetzt wird ja der Wagen bald kommen … und du lieber Gott … welche Freude … wenn der junge Herr Lieutenant erst im Haus ist … dann gibt es ein bischen Leben hier … und die Frau Excellenz … wird dann so alle Kinder um sich haben … und … und …«
»Laubmann kam allein?« fragte Jesabell mit bleichen Lippen – »schnell doch, Sibylle … warum denn allein?«
»Und wie ich das also gerade eben denke, da poltert etwas auf dem Gang draußen und tappt gegen die Türe wie ein Betrunkener … und wie ich schon ganz erschrocken aufschreien will … da steht auch schon mein Alter auf der Schwelle … ach du mein Herr Jesus, wie sah der aus! – Zerfetzt und über und über mit Schmutz bespritzt, und keine Mütze mehr auf dem Kopf, und so weiß, als wäre kein Blutstropfen mehr in dem ganzen Gesicht drin … Und da schwankt er nur noch so auf sein Bett zu und stöhnt wie ein Sterbender … ›Sibylle … lauf in’s Schloss … der junge Graf‹ … –« Frau Laubmann hielt abermals inne und schlug die steife Kattunschürze knisternd vor die überströmenden Augen.
»Was ist mit ihm? – er ist tot!« gellte es von den Lippen Leontinens.
»Ach Frau Gräfin … der junge Herr hat es ja nicht gewusst mit dem Irrgeist von Casgamala, und da hat er seinen Scherz machen wollen und hat sich im Wagen aufgestellt und ihn ganz laut in die Nacht beschworen, dass er ihm erscheinen solle! Und kaum, dass er nur das Wort über die Lippen gebracht hat, da blitzt es auch schon vor ihnen auf, so grell und schauerlich, dass man es gar nicht beschreiben kann! – Mein Alter hat gerade noch so viel Zeit gehabt aus dem Wagen zu springen, dann ist aber der Schimmel auch schon wie toll und wild querfeldein gerast, direkt auf die Steinbrüche zu … ach du mein Herr Jesus … wo mag der arme Lieutenant jetzt liegen!« … Und Lore und Frau Laubmann erhoben a tempo ein solch klägliches Schluchzen, dass selbst der Angstschrei der Gräfin davon übertönt wurde.
»Er hat den Irrgeist beschworen?« fragte Dolores kalt. »Dann hat er seinen gerechten Lohn empfangen, der leichtsinnige Patron!« – Und sie fasste gelassen ihre Stickerei zusammen und wandte sich zur Tür.
»Fühllose Schlange!« knirschte es zwischen Leontinens Zähnen.
Jesabell vertrat der Schwester erregt den Weg. »Wo willst Du hin, Dolores? – Wir müssen hinaus und den Bruder suchen!« – rief sie mit tränengefüllten Augen – »wer weiß, wo der Unglückliche mit zerbrochenen Gliedern liegt!«
»Da, wo ihn die Vergeltung hingeschleudert hat!« klang es voll grausamer Härte zurück, »geht hin und seht, ob ihr den Leib noch retten könnt, ihr Kleingläubigen; ich werde versuchen, ob ich die Seele dem Himmelreich erhalten kann, ich werde für den gewissenlosen Spötter – beten!« – Und die Comtesse wandte sich ab und verschwand lautlos durch die Tür.
»Es ist unglaublich!« stöhnte die Gräfin mit geballter Hand, Jesabell aber richtete sich resolut in die Höhe.
»So wollen wir ihn allein suchen, Mama!« rief sie hastig, »schnell, Lore, lauf hinüber zu dem Pächter und klopf ihn heraus! Es soll sofort ein Wagen angespannt werden, und wenn Herr Kirschner selber mitfahren wollte, so wären wir zu großem Dank verpflichtet!«
Lore stürmte mit dickverweinten Augen davon und Frau Laubmann sprang ebenfalls eifrig von ihrem Stuhl empor.
»Ich habe es bereits dem Christian gesagt, Comtesse«, rief sie, das niedergesunkene Kopftuch wieder unter dem Kinn schlingend, »er hat schon Alarm gemacht auf dem Hofe! Wenn nur mein Alter mit könnte, aber Du lieber Heiland, der liegt ja wie ein Stück Holz und regt sich nicht! Der Schreck ist ihm zu gewaltig in die Knochen gefahren, und dann hat er fast ein und eine halbe Stunde die Kreuz und die Quer in der Dunkelheit herumgesucht, bis er den rechten Weg hierher gefunden hat!«
»Ich hole mir einen Shawl, Mama«, rief Jesabell erregt, »was darf ich Dir mitbringen? Die Nacht ist kühl und stürmisch!«
Die Gräfin schnellte momentan aus ihren Polstern empor. »Ich? Ich soll doch etwa jetzt in meinem nervösen Zustand nicht mit in die Nacht hinaus? Jetzt, wo all’ meine Glieder wie im Fieber zittern? Du bist rücksichtslos genug, es mir zuzumuten, Jesabell!« Und Frau Leontine sank wieder wehklagend auf die Causeuse zurück. »Gib mir mein Flacon, es dreht sich mir alles im Kreise wie eine Ohnmacht! oh, Mon Dieu, es ist zu viel für mich unglückliches Weib! Jesabell, wenn wir jetzt Lothar verloren hätten, all’ meine Pläne wären vernichtet, das Majorat fällt an den Vetter – und wir – o mein Gott, es ist garnicht auszudenken, verloren, für ewige Zeiten der Armut preisgegeben!«
Die Comtesse wandte sich fast ungestüm zurück. »Wie ist es nur möglich, Mama, dass Du jetzt an uns denken kannst, wo der unglückliche Bruder vielleicht mit dem Tode ringt!« rief sie außer sich, »wenn Du mich nicht begleiten willst, gehe ich allein! Sei einmal etwas resolut, Mama, beiße die Zähne zusammen, hier ist Dein Flacon, suche allein fertig zu werden, unsere Hilfe gehört Lothar!«
»Ja, hilf ihm, petite, hilf ihm!« hauchte Excellenz matt, »ich kann nicht mit, der Anblick eines Verwundeten ist mir unerträglich, ich habe noch nie einen Toten gesehen. Aber ich bitte Dich, Jesabell, wenn er wirklich schon eine Leiche ist, lass ihn in das Pachterhaus schaffen, nicht hierher in das Schloss, sonst habe ich keine ruhige Minute mehr!«
Die junge Comtesse presste die Lippen zusammen, Sibylle aber richtete ihre robuste Figur stramm empor und maß die Gräfin mit fast feindseligem Blick. »Wenn die Excellenz Gräfin Sie nicht begleiten will, liebes Fräulein Bellachen, dann müssen Sie schon erlauben, dass ich mit Ihnen gehe, denn so mutterseelenallein kann doch eine junge Dame mit dem Mannsvolk vom Pachthof nicht in den Nebel hinaus! Holen Sie sich schnell ein Tuch herbei, ich stecke indeß noch eine Laterne an und dann wollen wir in Gottes Namen sehen, wo wir den jungen Herrn finden werden!« – Sie schob das junge Mädchen am Arme mit sich durch die Tür und drückte ihr hastig die kleine Hand. »Um Sie sollte es mir leid sein, wenn er in den Marmorbrüchen läg’, Comtesse, die beiden andern aber« – und sie wies grimmig mit dem Daumen nach dem Zimmer zurück, »die verdienten’s, dass Graf Lothar ins Pachthaus getragen würde!«
4.
Im tiefen Waldesdunkel Da steht ein altes Schloss: Ein Bild vergangener Zeiten, War prächtig einst und groß Doch heute ist’s zerfallen. Und Raben hausen drin, Die schönen alten Hallen Sind wie die Zeit dahin!
Bernard
Nun lässt der Himmel seine Purpurgluten In vollen Strömen um die Trümmer fluten Und von den Zinnen seh ich Epheuranken, Vergänglichkeit, Dein grünes Wappen schwanken.
Geibel.
Die Mittagssonne strahlte über Casgamala. Wie ein fremdes, wunderliches Felsennest hing das grüne Gemäuer auf dem plateauartigen Vorsprung des Bergkammes, welcher jäh zu dem Flachland abfallend, seine pittoresken Granitformen scharf gegen die blau verschwimmende Himmelsluft abzeichnete. Weit vor ihm dehnte sich die Ebene aus, öd’ und einsam, wechselnd zwischen rotschimmernder Haide und endlos gedehnten Waldungen, deren dunkle Färbung der ganzen Gegend einen düsteren, fast melancholischen Charakter verlieh. Plötzlich aber von dem Gebirgszug begrenzt, dessen gewaltige Felsmassen wild und klüftig emporragten, ein schwindelnder Horst dem Geier, eine raue Wiege dem tobenden Bergwasser, welches brausend aus enger Kluft hervorschießt. Hoch überragt von zackigen Firnen liegt Casgamala, ein Rätsel dem Wanderer, eine verwehte Blüte spanischer Herrlichkeit, welche fern an deutscher Bergwand Wurzel geschlagen.
Rings umher atmet deutsches Leben, weht deutsche Luft und strahlt der deutsche Himmel, Casgamala aber steht fremd und unverstanden inmitten und wartet gleich dem verzauberten Dornröschen auf den heißen Liebeskuss seines Erretters, um noch einmal in lang versunkener Märchenpracht aufleben zu können. Es ist sehr selten, dass ein Fremder durch diese Gegend streift, es müsste denn gerad’ einer von den tausend wunderlichen Gelehrten sein, welcher hinauf in die Felsen klettert und allerlei Kraut und Pflänzlein zwischen dem Geröll hervorsticht; wenn er aber tagelang über die Haide, durch eintönigen Wald und flache Felder gefahren ist und nun endlich die majestätischen Riesenhäupter vor sich zum Himmel ragen sieht, dann richtet er sein Glas plötzlich ganz erstaunt auf einen weiß schimmernden Punkt, und je näher er kommt, desto größer wird sein Interesse, bis es sich endlich in Worten kund gibt.
»Ist das ein Schloss oder eine Ruine da oben?« fragt er den Kutscher, und der nimmt für einen Augenblick die Pfeife aus dem Munde und entgegnet in seiner lakonischen Weise: »Das ist halt Casgamala, Ew. Gnaden!«
»Casgamala? Welch sonderbarer Name, wie kommt der urplötzlich in diese deutsche Einöde?« Und der Wißbegierige nimmt sein Reisebuch zur Hand und schlägt auf: »Casgamala, altes Schloss auf der östlichen Seite des †††Gebirges (zum Teil Ruine); 600 Fuß über dem Meeresspiegel, vermutlich aus dem dreizehnten Jahrhundert, mit teilweise restauriertem Neubau verschiedener Jahrhunderte, Überresten orientalischer Bauten und Parkanlagen, worunter bemerkenswert ein Obelisk mit spanischer Inschrift, sowie eine noch wohlerhaltene Eklesia verschiedenartigster Skulptur und Deckenmalerei. Das Schloss ist im Besitz des Grafen von Echtersloh, unbewohnt.« Das war alles, was in dem alten Schriftchen zu finden war. Entweder fuhr der Reisende unbekümmert weiter, oder er machte den kleinen Umweg über Casgamala, ließ sich von dem lahmen Kastellan treppauf und treppab führen, hörte kopfschüttelnd das »Märchen von der schönen Gräfin, dem Irrgeist des Schlosses«, wandelte staunend durch die wunderliche Gartenwildnis voll rankender Rosen, gestürzter Säulen und wuchernden Unkrauts und atmete auf, wenn sich endlich wieder das rostige Eisengitter hinter ihm schloss.
Umzittert von der Sonne Liegt morsch der Kirch’ Gestein, Geöffnet sind die Grüfte, Zerstreut liegt das Gebein. Einst durftest stolz Du prunken, Bild der Vergangenheit, Verfallen und versunken – Das ist der Fluch der Zeit! –