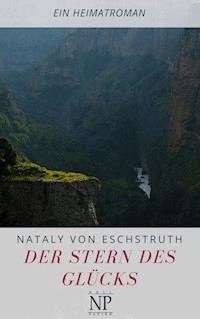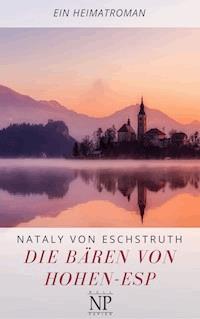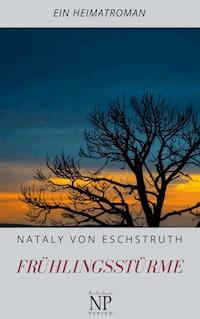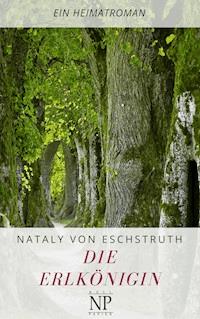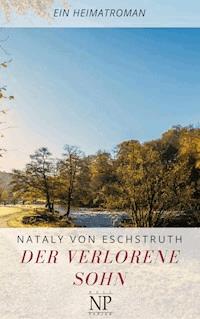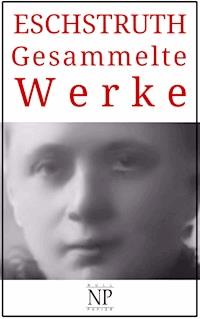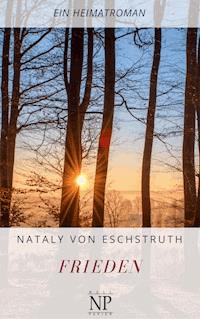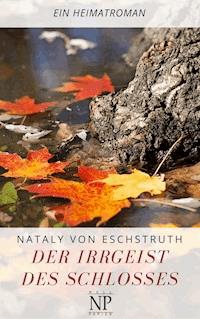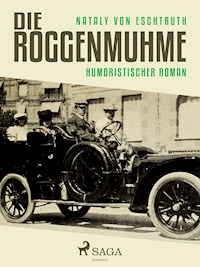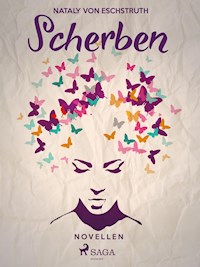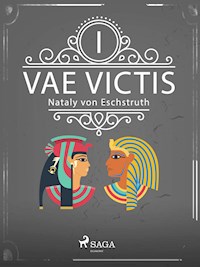Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Nataly von Eschstruth war eine deutsche Schriftstellerin und eine der populärsten und berühmtesten Erzählerinnen der Gründerzeit. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Gänseliesel
Heimatroman
Nataly von Eschstruth
Gänseliesel
Heimatroman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962810-83-2
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Dreizehntes Kapitel.
Vierzehntes Kapitel.
Fünfzehntes Kapitel.
Sechzehntes Kapitel.
Siebenzehntes Kapitel.
Achtzehntes Kapitel.
Neunzehntes Kapitel.
Zwanzigstes Kapitel.
Einundzwanzigstes Kapitel.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Vierundzwanzigstes Kapitel.
Fünfundzwanzigstes Kapitel.
Sechsundzwanzigstes Kapitel.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Kapitel.
»Ihr Gänschen, dass ihr’s alle wisst, Die Liesel eu’re Kön’gin ist – Gik – Gak – juch! – –«
Weite, wogende Kornfelder, rotblühendes Haideland und bräunliche Steppe, begrenzt und durchschnitten von endloser Kiefernwaldung, ebenso melancholisch wie der Himmel, welcher sich in einförmigem Regengrau, oder in wolkenlos strahlender Sommerbläue, mit fern, fern verschwimmendem Horizonte darüber spannt, wer kennt sie nicht, diese eigenartig nordische Landschaft, so arm an bunter und reizvoller Abwechslung, und dennoch eine zaubervolle, tränenlächelnde Poesie? Keine Bergkuppe, kein malerisches Felsenhaupt strebt zum Himmel, meilenweit schweift der Blick über die Ebene, flach und einsam hingestreckt, ausdruckslos wie ein schlafend Angesicht. Aber dort, weit hin am Waldessaum, da leuchtet und blitzt es plötzlich auf wie ein zitterndes Silberband, da dehnt sich hellkräuselnde Flut breiter und breiter vor unserm Blick, ein schilfumkränzter See ist es, der tief verborgen zwischen Wald und Haide sein träumerisches Lied von der Sehnsucht rauscht. – – –
Juni war es, die Rosen blühten. Die Luft schien zu zittern, so heiß und klar war sie, und versuchte es der Wind, die träge Schwinge zu rühren, so trug er nur schwüle Duftwogen herzu, deren süßer Atem ihm selber den Sinn berauschte, darum sank er kraftlos hernieder in die Lindenblüten und regte sich nicht mehr.
Am kleinen Bach entlang, mitten durch breite Kleefelder und Kartoffeläcker, schritt ein junges Mädchen. Ein grobgeflochtener Gartenhut, eine verblichene Bandschleife als einzigen, ungraziösen Schmuck tragend, hüllte Stirn und Augen in Schatten und saß recht nachlässig auf dem schlanken Köpfchen, von welchem zwei köstlich dicke, goldblonde Flechten etwas wirr und zerzaust über den Rücken hingen. Ein schlichtes Kattunkleid rauschte steifgestärkt um die zierliche Figur, auf zwei große, derblederne Schuhe niederfallend, welche ihre wuchtigen Nägelspuren tief in dem lockeren Sandboden zurückließen. Die sonnverbrannte Hand führte ein umfangreiches Butterbrot zum Munde, langsam und behaglich, abwechselnd mit den köstlichen Herzkirschen, welche auf breitem Kohlblatt, wohlgehütet auf dem gebogenen Arm lagen. Zeitweise blieb die junge Dame stehen, blickte sinnend auf den Klee und bog mit der plumpen Schuhspitze die grünen Blätter auseinander, lange vergeblich. Endlich beugte sie sich hastig vor, so eifrig, dass die Kirschen über die Hand in den Wegsand rollten, und so interessirt, dass sie die Flüchtlinge gar nicht bemerkte. »Ein Vierblatt! Endlich!« klang es jubelnd von den Lippen, »na, Monsieur Friedel, jetzt mach’ die Augen auf! Bin ich immer noch ein Pechvogel? Hier hab’ ich’s ja, das Glück, und wenn ich’s Dir gezeigt habe, esse ich’s auf. Grete sagt, das müsse man, wenn’s wirklich Gutes bringen soll!«
Das Butterbrot zwischen den Zähnen haltend, griff die Sprecherin vorsichtig in die dickabstehende Kleidertasche, warf einen schnellen Blick hinter sich auf den Weg und zog alsdann ein kleines, altmodisch gebundenes Büchlein hervor, einen Augenblick hielt sie es nachdenklich zwischen den Fingern. »Hm, ich will aufschlagen, welch ein Glück mir dieses Kleeblatt bringt«, überlegte sie mit reizend wichtigem Zug um den kleinen Mund, klappte langsam das Buch auseinander und schaute atemlos auf das Gedruckte unter ihrem Daumen. »Sah ein Knab’ ein Röslein stehn, Röslein auf der Haiden«, las sie feierlich, mit einer Stimme und Betonung, welche Hamlets Geist alle Ehre gemacht haben würde, las pflichtgetreu bis zu Ende und seufzte tief auf, »half ihm doch kein Weh und Ach! Ich danke für solch ein Glück! Unsinn mit diesem Gedicht, von wem ist es denn eigentlich? Aha, Goethe, also doch etwas Schönes, – – ich verstehe es vielleicht nur nicht recht!« so presste es sich murmelnd zwischen Zähnen und Butterbrot hervor, und die junge Dame legte das Vierblatt behutsam zwischen die Blätter in Goethes Gedichte und versenkte das Bändchen wieder in die gewaltige Tiefe der Kleidertasche.
In beschleunigtem Tempo schritt sie weiter, brach sich eine schlanke Weidenrute vom Bachufer und köpfte mutwillig die weißen Schafgarbdolden, welche überhoch am Feldsaum wucherten; die roten Lippen spitzten sich, in vergeblichem Versuch »Gaudeamus igitur« zu pfeifen, dieweil ihre Gedanken wieder bei Pastors Friedel weilten, und dieser Herr Studiosus und besagtes Lied ein unzertrennlicher Begriff waren. Der Weg lenkte jetzt von dem Bache seitwärts auf eine große Wiese, durchduftet von dem köstlichen Heu, welches in hohen Haufen darin aufgetürmt lag, und durchschnitten von der sandigen Fahrstraße, welche auf der anderen Seite bereits von hochstämmiger Kiefernwaldung begrenzt wurde.
An dem flachen Grasrain dieser Straße saß Bärbel, die kleine Gänsehirtin. Die Sonne schien golden auf ihr nußbraunes Haar, welches in abstehendem Knötchen auf dem Kopfwirbel aufgebunden war, schien auf den gebräunten Nacken und die hartgearbeiteten Hände, in welchen sich das Angesicht barg, um dicke, bittere Tränen durch die Finger zu weinen.
»Ei, Bärbel, was heulst Du denn?« klang es plötzlich neben ihr, und ein leichter Gertenklapps auf das gesenkte Haupt ließ die Kleine erschrocken aufschauen. »Hat Dir Jemand ’was getan?«
Mit blödem Blick starrte Bärbel aus den rotgeweinten Augen, seufzte tief auf und schüttelte wehmütig den Kopf: »Ach nä, gnä’ Frölen, mir hät Keen’s wat to Leed dohn! äwerst rohren1 möt ick doch!«
»Dömlich Dirn, wo kannst’ Di for nix so hevven!« klang es voll wohlgemeinten Trostes zurück; »wist’ unsen leeven Herrgot int’ Rägenwetter pfuschen? Gliek seggst mi, wat di ankommen is.«
Bärbel wischte krampfhaft mit dem Handrücken über das tränenüberströmte Gesicht. »Ach, gnä’ Frölen, min’ oarm Mudding – –«
»Man tau! was is mit se?«
»Se is sitn’ poar Dagen all krank und tau Bed, un’ het Fever2 seggt de Doctor – – und min lütt Swestern un de Brauder sin nu ganz ohn’ Upsicht, un Keens do, wat min Modder waarten kan!« rang es sich schluchzend von Bärbels Lippen. »Ach lever God, ick mächt woll giern do sin!«
»Oll Döskopp! worüm gehst denn nich, un sitzt all dar?« war die unzweideutige, hastig hervorgestoßene Antwort; »gliek gehst to Hus!«
»Ach, ik ging so giern – äwerst de Gös!!« Und Bärbel warf einen verzweifelten Blick über ihre schnatternden Unterthanen. »Ik möt jo bi dat Deivelsviech blieven, Frölen Josephining!«
Das gnädige Fräulein sah ebenfalls betroffen drein.
»Do hest recht, wat is dabi tau maken? Hast nich Eenen, de för di hin könnt?«
Bärbel schüttelte trostlos den Kopf. »Is keen Menschenseel nich!« Und abermals stürzten die Tränen aus ihren Augen. »Ach, wenn ik nur för’n Ogenblick nach’r seihn könnt?«
Da richtete sich Fräulein Josephine resolut in die Höhe, klatschte Bärbel mit der Weidenrute auf den Rücken, um die Rührung zu verbergen, und sagte kurz: »Sput di, oll’ Rohrdirn, un’ kiek een’s vör tu Hus, ik hevv twei Stunn’ Tid, ik bliev bi de Gös!«
»Ach gnä’ Frölen! ach Frölen Josephining!« jubelte die kleine Hirtin unter allem Schluchzen: »Sei willen bi de Gös blieven? Unse Herrgod vergelt’s!« Und sie sprang flink empor, reichte Josephine das Zeichen ihrer Macht, die lange Haselnußrute, und schüttelte die Heuhalme von dem geflickten Röckchen. »Ik moak fixing! äwerst – gnä’ Frölen – passen’s ok gaut acht, dass de Gös nich int’ Koorn un in de Tüfften gahn, sonst kreeg ik wat upp’n Puckel!« Und ehe nur die neue Stellvertreterin antworten konnte, flog Bärbel glückselig und behänd wie ein Reh über Wiese und Feld dem nahen Dörfchen zu.
Josephine stand momentan in ratloser Verlegenheit. Um sie her schnatterten und wackelten die Vögel des Kapitols, mit lauter Ovation die neue Herrin grüßend, welche es sich zur ersten Pflicht machte, die Haselnußgerte auf dem Federrock des revolutionären Ganters in Bewegung zu setzen, bis auch er, der einzige Rebell, das energische Regiment der Thronfolgerin anerkannte und sich leise pfauchend in die Nesseln des Chausseegrabens zurückzog.
Aufmerksam beobachtete die junge Dame ihre Schutzbefohlenen, jede Bewegung wurde streng überwacht, ob sich vielleicht ein Korn- oder Kartoffelgelüste der befiederten Unholde kund tue; aber alle Achtung vor Bärbels trefflicher Erziehung! keine der Gänse machte nur Miene, das erlaubte Terrain zu überschreiten. Die Sonne schien heiß, und Josephine begann sich zu langweilen. Sie rückte mit kräftigen Armen das Heu in den Schatten eines Ebereschenbaumes, welcher mit vielen anderen laubigen Kollegen die waldfreie Seite der Chaussee säumte, bereitete sich einen nicht gerade raffiniert majestätischen, aber doch einen herrlich duftenden Königsthron und zog mit einem Seufzer der Erleichterung den breiten Hut von den Haaren, um ihn recht fürstlich undankbar, gleich dem Mohren, welcher seine Schuldigkeit getan, in die tiefste Tiefe des Grabens zu schleudern. Helles Licht flutete über das reizende Gesichtchen des gnädigen Fräuleins. Schelmerei und Mutwillen blitzten die dunkelblauen Kinderaugen unter schwarzen, langgeschweiften Wimpern, schlugen sich voll auf in naivem, neugierig forschendem Staunen und verschleierten schüchtern den Blick lautester Herzensgüte, gleich dem keuschen Blumenkelch, welcher vor unberufener Hand die Blättlein schließt, um nicht zu zeigen, wie reich und schön er ist. Kind und Jungfrau stritten sich noch um die Seele dieses Blickes. Jetzt streifte er nachdenklich das frischgewaschene Kattunkleid, das Herzeleid der Tante Renate, welches nun einmal volle acht Tage getragen werden muss, coûte qui coûte! »Ich werde es völlig zerknittern!« überlegte die kleine Gänsemajestät, »und mir womöglich Grasflecken drein machen, außerdem ist es so steif und unbequem wie ein Brett! Es ist ja keine Menschenseele in der Nähe, und kommt wirklich ausnahmsweise etwas die Chaussee entlang, so sind es die Tagelöhner aus Groß-Stauffen oder die Milch-Jette, wer sollte sich denn sonst in diese Einsamkeit verlieren!« Und gar nicht an die Möglichkeit irgend einer zivilisierten Begegnung denkend, streifte Josephine flink den blauen Kleiderrock aus und trug ihn etwas abseits hinter das schirmende Ellerngebüsch, wo er gleich einem kugelrunden Luftballon an niederem Ast über der Erde schwebte. Dann warf sie sich selbst in wohligstem Behagen mitten in das Heu hinein.
Etliche Minuten verschränkte sie noch die Arme im dolce far niente unter dem Köpfchen und beobachtete mit blinzelnden Augen die rupfende und zupfende Heerde Bärbels, dann langweilte sie sich abermals, sprang auf, holte Goethes Gedichte aus dem Kleid und überließ die Gänse, in unerschütterlichem Vertrauen auf deren Wohlerzogenheit, ihrem Schicksal. Lang hingestreckt, dem Himmel den Rücken zukehrend und beide Ellbogen auf das Heu gestemmt, stützte sie den Kopf in die Hände und versank, ohne mehr rechts oder links zu blicken, völlig in den zauberischen Wogen Goethescher Poesie. Zuerst fand sie noch Zeit, die saftigen Grashalme gedankenlos zwischen den Zähnen zu zermalmen; als aber Seite um Seite umflog, und die Augen immer größer und immer verständnisloser wurden, als die Gedichte nicht nach der Qualität, sondern nach der Quantität verschlungen wurden, da standen auch die kleinen Perlzähne still, und ihre Besitzerin fand geistige Nahrung so überreich, dass vegetarianische Genüsse vollkommen zu entbehren waren. Die Sonne aber stand am Himmel und zitterte mit einzelnen Strahlen über das wildlockige blonde Mädchenhaupt. Bärbels grauen Zwilchsack, den Schutz gegen Regen, Sturm und Gewitter, hatte Josephine vorsorglich über ihr helles Unterkleid geschlagen, und nur die Nagelschuhe schauten wie kleine Ungeheuer, leise im Versrhythmus den Boden klopfend, aus den groben Falten hervor. Also hütete die dereinstige Erbin von vielen Tausenden, Freiin Josephine Wetter von Stauffenberg, die Gänse an dem Chausseerain.
Wo der Fahrweg fast stundenlang durch die Waldungen führt, eintönig geradeaus durch stark duftende Fichten und Kiefern, so eng bestanden und buschig, dass sie sich wie hohe, grüne Wände an beiden Seiten hinziehen, oder, lichter werdend, wie schlanke Palmschäfte emporragen, von deren knorrigen Häuptern die Nadelbärte malerisch herniederwehen, trabten langsam hin durch die fußhohen Sandfurchen zwei Reiter. Das Gespräch stockte momentan; der letzte Gewitterregen hatte einen beträchtlichen Teil des losen Sandwalles herniedergeschwemmt, und die Passanten waren genötigt, die eingegrenzte Strecke Weges hintereinander zurückzulegen.
»Zum Teufel mit dieser gottvergessenen Einöde!« grollte der jüngere der beiden Herren, seinen eleganten Goldfuchs parierend, um hinter dem Begleiter zurückzubleiben; »sollte man solche Zustände im neunzehnten Jahrhundert für möglich halten! Bei Nacht bricht man sich hier Hals und Beine – stop, ›golden dream‹, stop! –«
Der Sprecher war ein auffallend schöner Mann, seine Bewegungen die eines vollendeten Kavaliers. Groß und schlank, von jener leichten und graziösen Sicherheit im Sattel, welche auf den ersten Blick den Sportsmann verrät und welche in dieser Vollendung nur dem Kavallerieoffizier eigen ist, trug seine ganze Erscheinung das Gepräge sorglos lachender Heiterkeit. Dunkel flammende Augen erzählten unter der Devise »Ich kam – man sah mich – und ich siegte« – ein übermütiges Lustspiel von Triumphen, zu welchem der spöttische Zug um die Mundwinkel, welcher die Lippen so herausfordernd, fast leichtsinnig über den blendenden Zähnen schürzte, das ewig alte und ewig neue Drama von dem gebrochenen Herzen hinzufügte – »Pour passer le temps!« lautet sein gewissenloser Refrain. Ein dunkler, sehr zierlicher Schnurrbart korrespondierte mit dem Haupthaar, welches in lockiger Fülle, wohlfrisirt, die Stirn umrahmte; das Zivil war nicht dandyhaft, aber mit Geschmack und viel Sorgfalt gewählt.
Anders, durchaus anders sein Begleiter. Von großer, vierschrötiger Figur und etwas linkischen Bewegungen, mit einem breiten, frischgeröteten Gesicht, aus welchem zwei hellblaue, unendlich treuherzige Augen schauten, gelbblondem Bart und Haupthaar. Es gab wohl nicht leicht einen größeren Kontrast, als zwischen ihm und seinem Gefährten. Er wandte das Haupt und lachte. »Man sieht, wie verwöhnt Du bist, Günther, wie wenig Hindernissen Du bis jetzt, excepté im Steeple-Chase, auf Deinem Lebenswege begegnet bist. Danke den Göttern für diese Sandschanzen und nimm sie mit gewohnter Schneidigkeit, sie verhüten die zweite Auflage einer Polykratestragödie!«
»Dafür hat bereits mein Vater gesorgt, als er meine Wiege auf den sterilsten, langweiligsten Sandboden des ganzen deutschen Reiches stellte«, war die grollende Antwort, »als er mich jetzt um die schönsten Wochen meines Urlaubes kränkte, den modernen Robinson Crusoe auf der eigenen Scholle zu spielen! Mille diables, ich war absolut nicht neugierig auf hiesige Verhältnisse und wäre wirklich nicht auf Helgoland an Sehnsucht nach dem Schloss meiner Ahnen gestorben, aber der Alte tat’s nicht anders, ich soll durchaus in dem stolzen Gefühle eines Großgrundbesitzers hier schimmelig werden!«
»Bist Du denn wahrlich zum ersten Male hier, Freund Fortunatus? Unbegreiflich! ich finde Deine Heimat charmant, eine Idylle voll Frieden und Ruhe, die mir wohltut wie ein Schluck frischen Wassers nach langer, brennender Öde inmitten des erstickenden Residenzstaubes!«
»Ja, das bist Du auch, mein braver Hattenheim! – Quellwasser, Schwarzbrot und ein Hüttchen, in welchem Raum für ein glücklich liebend Paar ist, das sind die hohen Anforderungen Deines Geschmackes!« lachte Günther voll gutmütigen Spottes auf. »Hätte ich nicht gewusst, welch ein rührend genügsamer Kerl unter Deiner Flachsperrücke steckt, ich hätte niemals meine Einladung nach Lehrbach riskirt. Gott sei Dank, dass Du hier bist, alter Junge, ohne Dich wäre aus dem Prinzen Fortunatus bereits ein Fliegen klatschender Hypochonder geworden. Aber Tatsache ist es, dass ich zum ersten Mal, wenigstens mit Vollbewusstsein dieser Zumutung, Schloss Lehrbach mit meiner Gegenwart heimsuche. Siehst Du, Hattenheim, das kam so: Bis zu meinem siebenten Lebensjahre bewohnten meine Eltern ihre hiesige Besitzung jeden Sommer und siedelten erst nach meines Vaters schnellem Avancement dauernd in die Residenz über, wo Mama, schon damals viel leidend, stets genötigt war, statt Lehrbach heilsame Bäder aufzusuchen. Die Güter wurden verpachtet, Mama starb, und mein Vater stieg so hoch in Amt und Fürstengunst, dass er weder Zeit noch Gedanken für seine Scholle hatte. Wenn Du einmal Minister bist, lieber Reimar, wirst Du das begreifen. Ich hatte natürlich auch mehr zu tun, als hier die Motten auszuklopfen, und so kam’s, dass selbst meine Kindererinnerungen, bis auf mein Mooshaus im Park, pardon! einschliefen und vergilbten.«
»Und jetzt? Seine Excellenz der Minister nebst dem Herrn Sohn zu gleicher Zeit auf vier Wochen allhier in den ›oubliettes‹ zu Lehrbach freiwillig eingekerkert?« Über Hattenheims frisches Gesicht flog das behagliche Schmunzeln, welches ihm bei einem vermeintlichen Witz eigen war.
»›Oubliettes‹ ist gut!« lachte Günther; »aber ›freiwillig‹ ist eine Niete, Dicker! Meine Bereitwilligkeit wenigstens hatte den Kappzaum auf, und mein Vater? Sieh mal Du, die jährlichen Renten sind ganz infame Tyrannen, die rütteln selbst eine Excellenz aus ihrer Apathie! Unser Pachtkontrakt war abgelaufen, und neue Abschlüsse bedingen eine genaue Kenntnis der Sachlage, ergo hieß es: An die Pferde! Der alte Graf und Herr zu Lehrbach aber fürchteten sich vor Einsamkeit und Langeweile, darum kommandierte er seinen Sohn Job Günther, Grafen und Herrn zu Lehrbach, zur persönlichen Dienstleistung, und da dieser Unheil und aufziehende Wetter ahnte, sorgte er bei Zeiten für einen Blitzableiter, welcher allhier hoch zu Rosse breit und wohlgenährt vor ihm her trabt, – – nichts für ungut, lieber Hattenheim! Dieses notwendige Übel bist Du!«
Bei den letzten Worten dirigierte Graf Günther seinen Goldfuchs »golden dream« in kurzer Volte an die Seite seines Freundes, da der Weg wieder breit und frei vor ihnen lag.
Ein fast zärtlicher Blick Reimar von Hattenheims streifte das schöne Antlitz des Kameraden, dessen lustiges Lachen, ging dasselbe selbst auf Kosten seiner eigenen oft bewitzelten Persönlichkeit, zum Sonnenschein seines einsamen Lebens geworden war.
Beide junge Männer standen bei einem Regiment, den in der Residenz garnisonierenden Husaren, wohnten einander vis-à-vis und waren sogar durch Urvater Adam und eine angeheiratete Cousine etwas verwandt. Hattenheim, früh verwaist und viel auf sich selbst angewiesen, still und bescheiden, durch manch bittere Erfahrung verschlossen und neuen Bekanntschaften unzugänglich, war langsam, sehr langsam, aber desto sicherer der Freund Lehrbachs geworden. Les extrêmes se touchent – so verschieden wie die beiden Charaktere, so verschieden waren auch die Motive der Freundschaft, welche erst verschiedene Stadien zu durchlaufen hatte, ehe sie sich zu dem aufrichtigen, von beiden Seiten so ehrlich gemeinten Verhältnisse rückhaltlosen Vertrauens herangebildet hatte. Lehrbach, durch Glück und Sonnenschein verwöhnt und etwas oberflächlich beanlagt, war egoistisch und berechnend, wenn auch nur in Beziehung auf seine Persönlichkeit und das mit derselben verknüpfte Supremat über Parquet und Herzen. Sein letztes Stück Brot hätte er ohne Besinnen, sein Hab und Gut vielleicht leichtsinnig mit Hattenheim und manchem Anderen seiner Kameraden geteilt, aber Frauengunst und den in heißem Kampfe eroberten Platz als Löwe des Tages, als enfant chéri der Residenz, den teilte er mit Niemandem, selbst mit dem braven Hattenheim nicht. »Ich will keine anderen Götter haben neben mir!« blitzten seine dunklen Augen, und diese, seine eifersüchtige Eitelkeit, war die erste egoistische Ursache seiner Annäherung an Reimar gewesen. Es war eine seltene und auffallende Tatsache, dass Günthers Kameraden fast sämmtlich sehr beliebte Gesellschafter waren, entweder durch ein einnehmendes Äußere, oder durch mannigfache Talente ausgezeichnet, welche sie überall zu gerngesehenen und bevorzugten Gästen machten. »Es ist zum Rasendwerden mit dem Grafen Vroneck!« hatte Lehrbach oft mit dunkelrot echauffiertem Kopf gerufen, »da stellt sich der Kerl hin, und singt – bah! Unsinn, brüllt sage ich! – ein paar sentimentale Lieder, und Mütter und Töchter verdrehen die Augen und laden ihn womöglich ganz en famille zum Musizieren ein! – Ebenso mit Brocksdorff, Reuenstein und Clodwig! –Warum? – weil sie Geige und Clavier spielen, aber wie?! – Schauderhaft! – dass ich immer Leibschmerzen bekomme! – und trotzdem treiben die Damen einen förmlichen Cultus mit den Kerls, – immer Soiréen und Musik! – wo unser einer die Wand dekoriert und sich vorkommt wie Butter an der Sonne!« –
Als Hattenheim aus einem schlesischen Ulanenregiment nach D. versetzt wurde, nahm Lehrbach den neuen Vetter und Kameraden sofort unter den Arm und führte ihn längere Zeit spazieren. Da wurde ein hochnotpeinliches Verhör über ihn verhängt:
»Sagen Sie mal, Verehrtester, spielen Sie Clavier – oder Geige – oder sonst so eine Jammerschachtel?« fragte er misstrauisch.
Hattenheim schüttelte erstaunt sein strohgelbes Haupt. »Nein, lieber Vetter, nur Skat und Meine Tante, Deine Tante.«
»Famos! sehr nett von Ihnen – aber singen, oder dichten Sie vielleicht? – Lyrische Verse sind mir grässlich – geradezu grässlich, sage ich Ihnen! Unser guter Reuenstein dichtet mit wütender Consequenz! die armen Herrschaften, namentlich Prinzess Sylvie, bekommen diese Stiefkinder Eratos meuchlings beigebracht – dutzendweise, und jedes unter anderem Namen, zum Beispiel Sonett oder Ballade oder Distichon – oder was sich der Kerl all’ für Namen dazu ausdenkt – lächerlich, auf Wort; er blamiert sich nur damit! – Aber pardon – Sie dichten vielleicht selber?«
Ein fast entsetzter Blick traf ihn aus den hellblauen Augen Reimars: »Nie! – nie! … Ich habe absolut kein Geschick dazu, ich bin überhaupt sehr stiefmütterlich von der Natur bedacht, ich besitze kein hervorragendes Talent! aber ich liebe und verehre die Kunst!«
»Natürlich, ich auch, Vetterchen – ich male – wie man sagt – sogar ganz passabel! – Aber zum Kuckuck, das nützt mir doch nichts im Salon! Man kann doch keine Portraitir-Abende arrangieren! Also kein Talent? Hm … tut gar nichts, Hattenheimchen, es wäre ja fürchterlich, wenn nur noch Genies geboren würden! A propos – Sie soupieren heute Abend mit mir, selbstverständlich! – werden doch bei Verwandten keine Umstände machen! Papa hat einen excellenten Weinkeller – allons donc!« Noch einen Blick über des Vetters Antlitz und Figur, welche so gar nicht den Eindruck eines »schneidigen Schwerenöters« machten, und in Lehrbachs Herzen jubelte es: »Heureka! Dies ist mein Mann! Dies ist die Folie für mich, welche ich brauche, dies ist ein Freund, den Frau Fortuna, meine hohe Gönnerin, speziell für mich im lieben Schlesien gebacken hat!«
Und von Stund’ an nahm er den Vetter mit so viel – erst gekünstelter, bald aber herzlicher Liebenswürdigkeit in Beschlag, dass sich fast unbewusst für Beide ein reger Verkehr anbahnte, welcher bald eine feste und bleibende Freundschaft wurde, deren trefflicher Einfluss namentlich bei Lehrbach seine edlen Früchte trug. – Er lernte in dem unbedeutenden, gesellschaftlich so völlig übersehenen Freund einen Charakter kennen, so goldgetreu und selbstlos, so wahrhaft ritterlich und bieder, dass er seine Nähe nicht mehr aus Egoismus, sondern aus verehrungsvollster Zuneigung suchte. – Und Hattenheim? Das herzliche Entgegenkommen des bedeutend jüngeren Vetters tat dem schüchternen, und dadurch sehr vereinsamten Manne wohl; mancherlei Winke betreffs des Hoflebens, der neuen und ungewohnten Verhältnisse, die eifrige Bereitwilligkeit, ihn bei einflussreichen und beliebten Familien aufs beste einzuführen, verpflichteten ihn und erfüllten ihn bei seiner so wie so schon sehr sensibelen Natur mit unbegrenzter Dankbarkeit. – Dazu gesellte sich eine tiefe Bewunderung für den gefeierten, viel umworbenen Mann, dessen Schönheit, und die glänzende Begabung, dieselbe im Vollbesitz gesellschaftlicher Routine zur Geltung zu bringen, ihm das Ideal eines Cavaliers verwirklichten! Auch erkannte er in seiner großen Vorliebe für Alles was Kunst heißt, das wirklich beachtenswerte Talent Günthers, welcher mit Leichtigkeit den Pinsel und Stift führte, und mit wenigen Strichen ein so sprechendes Portrait lieferte, dass es selbst wenig geübte Augen frappieren musste! – Aber Lehrbach vernachlässigte seine Studien, weil das »alberne Geklexe« absolut undankbar und im Salon ja außer zur Dekoration durchaus unbrauchbar sei! – Erst auf langes, dringendes Bitten Reimars entschloss er sich durch vorzügliche Stunden sein Talent zur Vollendung zu reifen, und dankte ihm nun manchen Triumph, welchen er sich vorher gar nicht hatte träumen lassen. – Hatten ihm doch seine Caricaturen, welche er so keck und amüsant auf die Tanzkarten kritzelte, den ersten Cotillonorden der Prinzess Sylvie eingetragen! –
Weit entfernt, auch nur die mindeste Concurrenz zu suchen, freute sich Hattenheims selbstlose Seele in fast väterlicher Liebe der Erfolge des Lieblings, strahlend vor Stolz und Freude über dieselben, als seien sie ihm und nicht Günther geworden, und von rührender Gutmütigkeit, wenn der despotische Freund in übermütiger Laune den Pfeil des Witzes selbst auf ihn abschnellte. –
Lehrbach fühlte sich unsagbar wohl dabei. – »Sag’ mal, Dicker, hast Du eine unglückliche Liebe, oder bist Du heimlich verlobt, oder ohne Herz zur Welt gekommen?« fragte er einst am Morgen nach einem Balle, als er an Hattenheims Seite einen »Katerritt« unter den Fenstern des linken Schlossflügels machte, »ich bin noch nie im Leben einem so stockfischigen Kerl begegnet wie Dir! – Warum tanzt Du nicht? Fürchtest Du einem trefflich gedeihenden Embonpoint Abbruch zu tun, oder studierst Du auf den Junggesellen?«
»Keins von beiden, Kleiner, ich will Dir nur nicht in das Gehege kommen!« Hattenheim schmunzelte und hieb mit der Reitgerte ein dürres Blatt von dem tiefhängenden Kastanienzweig. –
»Bêtise! mit dieser Ausrede lasse ich mich nicht abspeisen – Hand aufs Herz, Reinz, schlägt’s für keine Einzige?«
»Leider noch immer nicht! seit fünf Jahren suche ich mein Ideal und finde es nicht, bin wohl zur unrechten Zeit auf die Welt gekommen! Lat bee, ich vermisse es nicht, und füge mich meinem Schicksal –«
Lehrbach fixierte mit misstrauischem Seitenblick das Antlitz des Sprechers, welches sich plötzlich mit einem melancholischen Aufseufzen tief zur Brust neigte. – »Hattenheim, ich verlange Offenheit von Dir! ist es vielleicht ein und dieselbe, die wir –«
Leises Auflachen unterbrach ihn. – »Nein, auf Wort nicht, Vetter! Hier meine Hand drauf, unser Geschmack ist sehr verschieden! Ich bin seit meiner Jugend einsam, an keine Weiber gewöhnt, darum mache ich vielleicht unmögliche Anforderungen an meine Zukünftige! Noch aber bin ich Freiherr, – frank und frei von jeder Neigung!« –
»Ich glaube es Dir. Aber eins, Reimar, wenn Du jemals glaubst die Rechte gefunden zu haben« »So komme ich zu Dir, und frage um Erlaubnis, ob ich sie lieben darf!« – fiel der junge Offizier heiter ins Wort, mit sichtlichem Ergötzen den Argwohn im Auge Lehrbachs beobachtend: »bis dahin aber passons la dessus –«
Schweigend ritten beide Herren neben einander. Die Hufschläge der Pferde verklangen im tiefen Sande, selten dass eines derselben aufschnaufend die Mähne schüttelte, oder ein Sporn mit leisem Silberklang den Bügel streifte; keine Menschenseele weit und breit, es war ein einsamer, langweiliger Weg, welcher Schloss Lehrbach und Groß-Stauffen verband.
Der Wald schnitt zur einen Seite ab und machte wogendem Ährenfelde Platz, während die Chaussee scharf umbog und, von Ebereschenbäumen eingefasst, sich mählich in eine Wiesenebene senkte, aus deren buschigem Hintergrunde rote Dächer und der graue, viereckige Schlossturm von Stauffen aufragten.
Hattenheim hatte in tiefe Gedanken verloren das Haupt geneigt und starrte mechanisch auf den glänzenden Nacken seines Braunen, als er sich plötzlich fest am Arm gefasst fühlte, und Günthers Stimme ihm hastig ins Ohr raunte: »Stop Reinz!«
Der Genannte zuckte empor und blickte seinen Gefährten überrascht an; ehe er aber die Lippen zu einer Frage öffnen konnte, fuhr Lehrbach flüsternd fort: »Pst, ein reizendes Bild, Dicker, eine famose Idylle!«
Hattenheim straffte die Zügel und folgte mit dem Blicke dem Finger des Kameraden, welcher sich auf den Straßenrain, dicht vor ihnen, richtete.
Dort graste in friedlicher Eintracht eine Gänseheerde zwischen Klee und Buntblümlein im hellglänzenden Sonnenlichte, während etwas abseits auf einem Heuhaufen ihre Hüterin den goldblonden Kopf in die Hand stützte und durch den Inhalt eines kleinen Buches so gefesselt schien, dass sie das Nahen der Fremden nicht bemerkt hatte. Das reizende Profil war den Reitern zugewandt und hob sich in weichen, reinen Linien von dem schattigen Hintergrunde ab.
»Famoses Idyll!« flüsterte Lehrbach, ohne den Blick von dem blonden Mädchenkopf zu wenden, »eine ländliche Studie, wie sie gar nicht besser zu finden ist! Habe ja Prinzess Sylvie etliche Beweise meines Fleißes versprochen, Land und Leute aus Lehrbach, die kleine Hoheit hat merkwürdiges Interesse dafür! Donnerwetter, welch süßes Gesichtchen! Gänseliesel soll den Reigen eröffnen Hattenheim, mille diables! Hast Du jemals solch ein reizendes Modell gesehen?«
Lehrbach zog eifrig sein elegantes Skizzenbuch aus der Brusttasche und warf einen schnellprüfenden Blick auf die Bleistiftspitze: »Halte, bitte, mal den Gaul so lange, Dicker, ich will mich schnell etwas näher pürschen, ehe meine ländliche Schöne ihre Katechismusstudien beendet hat – lernt gewiss die sieben Bitten für den Herrn Pfarrer …« Und der junge Offizier schwang sich so lautlos wie möglich aus dem Sattel, warf Hattenheim die Zügel zu und schlich behutsam in dem weichen Sande näher, bis zu dem nächsten Steinhaufen, auf welchen er sich, allerdings nicht ohne Überwindung, niedersetzte und, das Buch auf den Knien, eifrig zu zeichnen begann.
Sein ahnungsloses Modell verhielt sich meisterlich ruhig, das Umschlagen der Seiten geschah schnell und ohne die Stellung zu verändern, und wenn sich die kleine Hand hie und da regte, um die vorfallenden Löckchen aus der Stirn zu streichen, so hinderte das den jungen Künstler keineswegs, ein allerliebst ähnliches, wenn auch ein klein wenig karikiertes Porträt zu liefern, denn der vielfach geflickte Sack, welcher ihre Figur einhüllte, und die plumpen Nägelschuhe traten in humoristischer Treue hervor, auch etliche der gefiederten Unterthanen gruppierten sich in scherzhaftesten Posen um die junge Gebieterin!
Mit amüsiertestem Lächeln sah Günther schon nach kurzer Zeit auf die vollendete Zeichnung hernieder, schrieb mit kräftigen Zügen: »Gänseliesel« und das Datum darunter und verglich alsdann Original und Kopie noch einmal mit prüfendem Blick. »Wie schade, dass sie die Augen niederschlägt!« dachte er, »es geht dadurch viel Schönes verloren! Schönes? natürlich, in solch allerliebstes Gesicht gehören ein paar Musteraugen, groß – lachend – natürlich blau, nach dem Blondkopf zu schließen! – Teufel noch eins, wenn die kleine Hexe doch einmal aufsehen wollte!«
Aber »Gänseliesel« sah nicht auf, und der junge Offizier erhob sich, schritt lautlos, wie er gekommen, zu dem Pferde zurück und reichte Hattenheim die Skizze empor.
»Die hätten wir!« lachte er leise. »Eine Entführung so heimlich, dass selbst die Hauptperson keine Ahnung davon hat! – Nun? ›Zur Kritik, meine Herren!‹ ich warte auf Dein unmaßgebliches Urteil, lieber Dicker!« Mit einem Blick, in welchem Übermut und eine kleine Dosis Selbstzufriedenheit um den Vorrang stritten, blickte er zu dem Freunde auf und lehnte sich, seine Antwort erwartend und die Zügel in der Hand, gegen seinen Goldfuchs zurück.
Lange, fast ungewöhnlich ernst blickte Hattenheim auf das kleine Bild in seiner Hand hernieder. Ein vergleichender Blick flog nach der Leserin im Heu hinüber, um sich alsdann abermals auf die Zeichnung zu senken, während ein mildes, warmes Lächeln seine Züge verklärte.
»Mirabile visu!« murmelte er und nickte ein paar Mal sinnend vor sich hin. »Ein herziges Gesicht und eine vortreffliche Zeichnung. Es kommt mir vor, als sei Dir lange nicht eine solch frappante Ähnlichkeit gelungen, und doch sind’s nur wenige Striche, und gesenkte Augen! – Danke Dir, Günther, Du bist ein ganzer Kerl!« – und er warf noch einen Blick auf das Papier und reichte Lehrbach das Skizzenbuch zurück. Dieser klappte es zu und schob es in die Brusttasche.
»Ja, leider gesenkte Augen!« sagte er, sich elastisch in den Sattel schwingend. »Aber nur auf dem Papier, in Wahrheit soll sie uns sofort den blauen Himmel ihrer Seele entschleiern! Hübsch gesagt, was? ist auch nicht von mir! – Vorwärts jetzt, avançons!« und ein leichter Zungenschlag ließ den Fuchs von Neuem ausgreifen.
Hattenheim folgte fast mechanisch, um Halseslänge hinter dem Kameraden zurückbleibend, welcher dicht am Chausseerain in beschleunigtem Tempo seinem Modell entgegen eilte. Immer noch klangen die Hufe gedämpft im Sande, Lehrbach zog die Kornblume aus dem Knopfloch und warf sie mit geschicktem Schwung nach dem Buche der so außerordentlich vertieften Leserin, welche jedoch in demselben Augenblick schon emporschrak und mit zwei großen, dunkelblauen Augen fast entsetzt auf die Reiter starrte.
»Nun, kleine Haiderose, so ganz und gar vertieft?« lachte der schöne Mann, sein Roß parierend, »welch ein interessantes Buch haben wir denn da vor?« Dunkle Blutwellen ergossen sich über das Gesicht Josephinens, sie schlug erschrocken den Goethe zu und richtete sich mit schnellem Ruck empor. Momentan ruhte Auge in Auge, dann wiederholte sie plötzlich mit staunender Freude: »Haiderose?« und ehe nur Lehrbach ihr seltsames Benehmen deuten konnte, blätterten auch schon ihre Finger in fast zitternder Hast von Neuem in dem Buche.
Günther blickte Hattenheim lachend an. »So naiv, dass sie selbst die botanische Eloge nicht begreift!« und sich abermals zu Josephine wendend, fuhr er fort: »Pardon, mein schönes Kind! ich bitte noch einen Augenblick die Lectüre zu unterbrechen und mir eine Frage zu beantworten!«
Aber Gänseliesel schien seine Worte nicht zu hören, ihr Auge starrte auf das Buch. »Ganz recht!« rang es sich wie in lautem Selbstgespräch von ihren Lippen: »Röslein auf der Haiden!« und sie ließ das Buch sinken, blickte mit dunkeln, glänzenden Augen zu ihm auf und dachte im Herzen: Also Der ist Dein Glück!
Lehrbachs scharfer Blick fiel auf das Buch. Er sah gedruckte Verse und ein vierblättriges, frisches Kleeblatt, welches zwischen den Blättern lag.
»Aha! Gedichte?« rief er, die Hand nach dem Goethe ausstreckend, »darf man wohl sehen, welch ein glücklicher Meister hier mit Haut und Haar verschlungen wird?«
Wie gebannt hing Josephinens Blick an seinen lachenden Zügen, heißes Rot brannte auf ihren Wangen, und fast mechanisch reichte sie das Buch empor.
»Goethe? grâce à Dieu!« die schlanke Figur des Grafen bog sich zu Hattenheim zurück: »Dicker! ich tue der Gegend hier Abbitte dafür, dass ich sie eine Wildnis genannt habe! Mehr Kultur als die Klassiker auf der Gänsewiese kann man doch bei Gott! nicht verlangen!« Und sich zu Josephine zurückwendend, sagte er mit langem Blick in ihre Augen: »Ein Vierblatt? frisch gebrochen! wissen Sie auch, kleine Schönheit, dass dies Glück bedeutet?« Fräulein Wetter von Stauffenberg nickte eifrig. »Es ist ja schon eingetroffen!« lachte sie voll reizender Naivetät.
»So? und inwiefern, wenn man fragen darf?«
»Nun – Sie kamen des Wegs und nannten mich ja Haideröschen!« entgegnete sie treuherzig.
»Und das ist ein Glück?« Lehrbachs flammendes Auge ließ das junge Mädchen plötzlich verwirrt die Wimpern senken, sie suchte stotternd nach einer Antwort, aber der Reiter fuhr mit einem abermaligen Blick in das Gedichtbuch leiser fort: »Sah ein Knab’ ein Röslein stehn, Röslein auf der Haiden! Wie nun, wenn dieses Gedicht zur Wahrheit geworden wäre, wenn der Knab’ – und der bin ich! – das morgenschöne Röslein wirklich mit tausend Freuden ansähe?« Ein unbeschreiblicher Blick traf ihn aus den klaren Kinderaugen, lachendes Entzücken, Verlegenheit und süße Scheu waren sein Gemisch.
»Wer sind Sie denn? und was wollen Sie hier bei uns?« fragten die roten Lippen, ohne näher auf seine Frage einzugehen.
»Meinen Mut beweisen, dass ich mich nicht vor Rosendornen fürchte!« lächelte er, gerade im Begriff, noch einen Schritt näher zu reiten. In demselben Augenblick aber klang es laut und jubelnd über die Wiese: »Frölen Josephining! dar bin ik torück!« und als er erstaunt aufblickte, sah er ein schlankes, ärmlich gekleidetes Bauernmädchen querfeldein durch den Kartoffelacker laufen, um mit wenigen Schritten neben den Reitern und Josephinen zu stehen.
»Gnä’ Frölen, se sull gliek baben komm’!« rief Bärbel atemlos, fasste schnell die Hand der Baronesse und küsste sie voll dankbarer Innigkeit: »Ik dank’ ok, dass se upp de Gös achte passt hebben, un’ min Mudding ok, se is better, un’ min lütt Brauder wart’ se!«
Lehrbach und Hattenheim wechselten einen Blick maßlosen Erstaunens. »Gnädiges Fräulein?« wiederholte Lehrbach, den Hut abziehend, »ich bitte tausendmal um Pardon, ich ahnte wirklich nicht – –«
»Dass hier zu Lande die adligen Damen Gänse hüten?« lachte Josephine übermütig auf: »Das ist auch drollig, nicht wahr?« und die Händchen in unverhohlenem Vergnügen zusammenschlagend, fuhr sie heiter fort: »Ich merkte ja gleich, dass Sie mich mit Bärbel verwechselten, weil Sie gar keinen Respekt vor mir hatten! Haha! was für ein komisches Gesicht Sie machen! ich könnte mich totlachen über Sie!« Und Josephine zeigte mit so viel schelmischer Bosheit ihre Perlzähnchen, als wolle sie wirklich mit dem Totlachen Ernst machen!
»Sie sehen mich allerdings außerordentlich stupéfait, meine Gnädigste«, rief Lehrbach, sich schnell in seine eigentümliche Situation findend und ihr, gleich wie die junge Dame, die humoristische Seite abgewinnend: »Auf solch allerliebste Kapricen war ich allerdings nicht vorbereitet, und trotzdem ich mich jetzt unbarmherzig von Ihnen auslachen lassen muss, so beklage ich dennoch keinen Augenblick diese kleine Mystifikation, welche mir das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft schon etwas früher, wie erwartet, verschaffte. Gestatten Sie, meine Gnädigste, dass ich Ihnen meinen Freund, Lieutenant von Hattenheim vorstelle« – und mit einem abermaligen, noch tieferen Neigen seines Hutes fügte er langsamer hinzu: »Ich habe den Vorzug, Ihr Gutsnachbar zu sein, Graf Lehrbach!«
Josephine hatte sich empor gerichtet und stand beiden Herren gegenüber. Bärbels Regensack hielt sie noch immer gleich faltenreichem Peplum um ihr Unterkleid geschlagen, das blonde Haar hing in halb gelösten Flechten, reichlich mit Heuhalmen durchzogen, über den Rücken, und die Weidenrute in der Hand vervollkommnete den originellen Eindruck ihrer Erscheinung, welche jetzt alles Versäumte mit feierlich tiefem Kompliment wieder gut machen wollte. Zum ersten Mal traf ihr Auge Hattenheim, welcher sich schnell und etwas linkisch verneigte, aber es war nur ein flüchtiger, gleichgültiger Blick, welcher das flachsgelbe Haupt streifte, dann zog ein rosiges Lächeln über ihr reizendes Gesichtchen, und sich abermals an Lehrbach wendend, klang es wie leiser Jubel zu ihm auf: »Sie sind unser Nachbar? Sie wohnen jetzt in Lehrbach? O wie prächtig ist das, und wie freue ich mich darüber. Es war so einsam bei uns, alle Güter ringsum verpachtet, es kam mir oft recht langweilig vor, obwohl ich’s nie anders gewohnt war! Aber nun wird es besser, nun kommen Sie öfters zu uns, nicht wahr?« Sie reichte ihm in herziger Unbefangenheit die kleine Hand entgegen, welche Günther hastig umschloss, sein Blick fiel darauf nieder, auf die braungebrannten, arg verwilderten kleinen Finger, welche sich doppelt grell gegen das zarte Perlgrau feiner Handschuhe abzeichneten; ein Lächeln huschte um seine Lippen.
»So bald und so oft wie Sie uns gestatten, mein gnädiges Fräulein!« entgegnete er galant, mit einem abermaligen, langen Blick in ihre Augen, »›war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehn.‹ Sie dürfen ja nicht vergessen, dass Sie das Haideröslein sind und von mir, dem ›wilden‹ Knaben, am Wege gefunden wurden!«
Josephine nickte strahlenden Auges, aber durchaus harmlos mit dem schlanken Köpfchen: »Ja, ich wusste es, dass mein Kleeblatt Glück bringen musste!« rief sie in schmeichelhaftester Aufrichtigkeit – »und ich werde auch Pfarrers Friedel nie mehr verspotten, wenn – –«
Bärbel zupfte sie unruhig am Kleide: »Gnä’ Frölen, se sullen jo glieck baben komm’, seggt de gnä’ Fru, se sullen im Gaarden Stickelbeeren plucken!«
Abermals zuckte es um Lehrbach’s Mundwinkel wie mühsam verhaltenes Lachen. »Wir halten Sie auf, meine Gnädigste!« sagte er, »und entziehen Sie Ihren häuslichen Pflichten! Gestatten Sie, dass mir uns morgen bei Ihren verehrten Eltern die Erlaubnis holen, recht häufige Gäste in Groß-Stauffen zu sein, und um den Vorzug bitten, auch Lehrbach auf den Empfang seiner verehrten Nachbarn vorbereiten zu dürfen?«
Josephine stimmte eifrig zu: »Ja, kommen Sie morgen! und recht früh – und dann recht lange dableiben – ich will’s Onkel und Tante gleich sagen« und sie unterbrach sich plötzlich, und legte den Finger an die Lippen: »Halt! da will ich Ihnen gleich einen schlauen Rat geben!« sagte sie geheimnisvoll. »Wenn Sie wollen, dass Onkel Bernd Ihnen recht gut sein soll, dann müssen Sie sehr viel von unserm lieben Kaiser sprechen, dann erzählt er Ihnen gleich seine Lieblingsgeschichten, und Tante Renate, wenn sie der nicht die Puten im Hof jagen, wird die auch schon nett sein.«
Jetzt lachte Lehrbach sein volles, übermütiges Lachen. »Unbesorgt, gnädigstes Fräulein, die Puten und Tante Renate sollen sich nicht in der Friedfertigkeit zweier Husaren getäuscht haben! ich danke Ihnen herzlich für den vortrefflichen Rat und küsse Ihre kleine Hand dafür! Also auf Wiedersehen, und hier das Buch mit all dem Glück, welches es in seinen Blättern birgt: Sah ein Knab’ ein Röslein stehn, Röslein auf der Haiden!« und mit seinem dunklen Zauberblick neigte er sich tief hernieder, legte »Goethes Gedichte« in die Hand des Gänseliesels zurück und schwenkte grüßend den Hut. »A revoir!« Und der Goldfuchs bäumte hoch auf, schwenkte kurzum und trug seinen Reiter in schlankem Trab die Chaussee zurück. Auch Hattenheim hatte gegrüßt, aber Josephine besaß nur zwei Augen, und deren Blick hing wie gebannt an dem »wilden Knaben«, welcher schön und ritterlich wie Sanct Georg, der heilige Streiter dahin sprengte; so warf er ohne Dank und Gegengruß, mit einem leisen, melancholischen Zucken um die vollen Lippen, auch sein Roß herum und folgte dem Freunde.
weinen <<<
Fieber <<<
Zweites Kapitel.
»Wie neu seid ihr in dieser alten Welt!«
König Johann. III. Auf. 4. Sc.
Die Sonntagssonne strahlte über Schloss Stauffen. »Schloss« Stauffen? Man nannte es so, hörte es so nennen und dachte nicht weiter darüber nach, inwieweit der stolze Titel mit dem einfachen Träger in Einklang stand; wenn man aber von der westlichen Parkseite die hohe, graue Mauer vor sich sah, deren Giebel sich so altersschwach vornüber neigte, dann musste es Einem unwillkürlich vorkommen, als senke Schloss Stauffen tief beschämt sein runzliches Angesicht, in gerechter Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit auf die wohltönende Eloge des Volksmundes. Durch ein hohes, gewölbtes Steintor betrat man den viereckigen, stellenweise gepflasterten Hof, auf welchen die Front des Schlosses seit langen, langen Jahren schon mit demselben deprimierten, Grau in Grau spielenden Angesicht hernieder schaute, griesgrämlich und mit hohlen Fensteraugen, wie ein alter Mann, welchem der viereckige, kurze und massiv plumpe Turm mit dem grünlich schillernden Knauf wie eine Morgenmütze schief aufs Ohr gedrückt war. Bog man aber in den schmalen Weg zum Gemüsegarten ein, vorbei an der steinernen Auftreppe, über welcher das vielfach abgebröckelte Wappen Derer von Wetter prangte, durch eine kleine, grüne Lattentür, überhangen von üppig treibenden Geisblattranken, und blickte sich den Schlossbau von dieser Seite an, so gewann er urplötzlich ein gänzlich verändertes Ansehen. Der grauköpfige Alte verwandelte sich in ein Rococofräulein, welches das weit vorspringende Dach mit lustig nickenden Grasbüscheln und den gurrenden Tauben dazwischen gleich einem chapeau à la jardinière auf das staubgepuderte Haupt gedrückt hatte. Eine rund vorspringende Steinterrasse blähte sich gleich dem Reifrock, und die enge Galerie, welche sich ihr an beiden Seiten anschloss, von wurmstichigen Holzpfählen gestützt, machte den Eindruck von spitzen Stöckelschuhen, auf welchen Demoiselle einherstelzte. Zwar zogen sich auch durch ihr Antlitz zahllose Falten und Schmarren, und die breite dunkel verhangene Terrassentür lächelte gleich zahnlosem Munde darin, aber dennoch hing hie und da eine einzelne Jalousie gleich einem neckischen Schönheitspflästerchen schief in den rostigen Angeln, und gleichsam, als solle eine chiffonnierte Robe durch billige Hilfsmittel aufgefrischt werden, schlangen sich Epheu und wilder Wein in verschwenderischer Pracht, oft sogar kokett bis unter das Dach empor gezogen, um und über die altersschwachen Mauern. Da nistete und zwitscherte es im lauschigen Gezweig, Kletterröslein hatten sich verstohlen in das Gerank gemischt und streuten im hohen Sommer den frischen Blütenschnee auf den grasigen Weg, ja, hier konnte man Stauffen ein Schlößlein nennen, aber ein schlafendes, idyllisches Traumgebild, wie es Frau Fama um das Lager ihres Dornröschens gebaut hat.
Poesie und Prosa streiften hier hart an einander, der malerischeste Teil des Gebäudes schaute auf den Gemüsegarten hernieder, auf Kohlköpfe, Suppengrün und schwadronierende Mägde, und wie traut auch die Rosen um den heimlichen Altan schmeichelten, es kam Keiner, ihren süßen Duft zu trinken, Keiner, in ihrem dämmernden Frieden zu träumen und ihren Kelch zu wonnigem, kurzem Glück zu brechen, sie blühten einsam und vergebens, bis der Herbstwind kam und ihre Blüten in den Staub wehte.
Alles war praktisch in Stauffen, zu praktisch oft, zum gerechten Erstaunen der Inspectoren und nachbarlichen Verwalter, welche sich nicht viel von den landwirtschaftlichen Kenntnissen des alten Rittmeisters von Wetter versprochen hatten. Als nämlich der Freiherr Bodo Wetter von Stauffenberg, ein vorzüglicher Ökonom, durch einen Sturz vom Pferde den Tod fand und sein kaum zweijähriges Töchterchen Josephine verwaist in dem alten Schloss, inmitten eines außerordeutlichen Landbesitzes, zurück ließ – seine Gemahlin war ein halbes Jahr vor ihm in den kühlen Frieden der Familiengruft gebettet worden – da rollte am Vortage der Beerdigung eine alte Glaskutsche in den Schlosshof, aus welcher ein rüstiger Militär und eine stattliche Dame stiegen, um als neue Herren und Gebieter in Stauffen einzuziehen. Das war der jüngere Bruder des verstorbenen Freiherrn, Carl Bernd von Stauffen, der nunmehrige Vormund der kleinen Waise, welche von ihm und seiner Gattin mit herzlicher Liebe aufgenommen wurde. War ihnen doch das einzige, gleichalterige Töchterlein durch den Tod entrissen.
Rittmeister Bernd hatte, durch den jähen Umschwung der Verhältnisse genötigt, seinen Säbel, welchen er zwei Feldzüge hindurch in Ruhm und Ehren getragen hatte, seinem Landesfürsten mit schwerem Herzen zurückerstattet, bekam als letztes Zeichen herzoglicher Huld und Gnade das Bändlein des H.’schen Hausordens in das Knopfloch geknüpft und sagte dem bunten, leichtlebigen Getreibe der Residenz für immerdar Lebewohl, um sich in die Einsamkeit seiner Güter zu begraben. Die farbige Soldatenmütze auf dem Kopf, durchschritt er sein neues Reich, hatte von nichts eine Ahnung und für nichts die ausreichenden Kenntnisse, nahm die ganze »donnerwettersche Geschichte« militärisch, alterierte sich in hohem Grade über die verbummelte Haltung seiner Arbeitskräfte, trug sich lange Zeit mit der Idee, im Hof Reveille und Retraite blasen zu lassen, und hatte auf alle Vorschläge seines Inspectors nur ein gutmütig einverstandenes: »Na natürlich, immer schlank weg!« Kühe und Schafe verstanden es absolut nicht, sich bei ihm einzuschmeicheln, er nannte sie höchst wegwerfend die »Mistremonten« und fand sie durchaus überflüssig; desto ostensibler bevorzugte er die Pferde und Hunde, legte mit viel Geschick und Passion ein kleines Gestüt an und teilte nun seine Zeit zwischen den Koppeln und Waldungen, welch letztere er als passionierter Jäger durchpirschte. Da war es kein Wunder, wenn Nachbarschaft und Gutsverwaltung etwas bedenklich dreinschauten und Stauffen mit prophetischem Blick bereits in den Wendepunkt des Krebses versetzten. Aber sie hatten sich geirrt! Als in den ersten Tagen mannigfache Entscheidungen und Gutachten an den Freiherrn herantraten, und die Leute die Befehle des neuen Gebieters einholen wollten, da geschah es wohl regelmäßig, dass der Rittmeister die Sache eine Zeit lang mit martialisch ernstem Aussehn überlegte, den Bart zwirbelte und schließlich die Hand wuchtig auf des Fragestellers Schulter legte, mit den Worten: »Wissen Sie was, mein Guter? Gehen Sie mal zu meiner Frau! Der habe ich schon Alles auseinandergesetzt, wie ich das Ding haben will, ich bin momentan sehr beschäftigt, kann mich im Augenblick durchaus nicht darauf besinnen, aber meine Frau weiß es ganz genau, die ist ja auf dem Lande aufgewachsen!« Und Herr von Wetter blies ein paar sehr respekteinflößende Dampfwolken aus seiner Jagdpfeife und schritt hastig weiter. Wenn die Leute aber zur gnädigen Frau kamen und sahen die hohe, markige Gestalt mit den kurzen, resoluten Bewegungen, den klugen Grauaugen und den energisch geschweiften Lippen, dann wussten sie ganz genau, wer der zukünftige Herr und Gebieter auf Stauffen war. Mit sehr aristokratischen kleinen Händen fasste Frau Renate von Wetter, geborene Gräfin Malwitz, die Zügel der Verwaltung, um sie in eiserner Konsequenz, klug und umsichtig, praktisch und sparsam, wie ein weiblicher Feldherr in Haus und Hof, Flur und Feld zu führen.
In tiefster Einsamkeit zogen die Jahre dahin, verwischten mehr und mehr jede Spur vergangenen höfischen Lebens, streiften allmählig die Glacéehandschuhe von den Fingern des alternden Ehepaares und streuten den feinen Aschenregen nüchternster Prosa über Schloss und Bewohner, welcher erbarmungslos die zarten Blüten der Eleganz erstickte und dem Zeitgeist in landesüblicher Renitenz Tür und Tor versperrte. Nur möglichst praktisch, möglichst sparsam, um für Josephinchen Zins auf Zins zu legen, um dereinst sich selbst mit stolzer Genugtuung sagen zu können: »Wir sind gute Wirtschafter gewesen und haben das Deine erhalten und vermehrt!« So schwand einförmig Tag um Tag, zog unbemerkt die Silberfäden durch Tante Renatens Scheitel, gleich dem Reif, welcher welkende Blumen trifft, und streifte mit rosigem Kusse die Stirn Josephinens, wie der Frühling, wenn er Knospen zur Blüte weckt. Lieblich wie die Blume der Haide wuchs das junge Mädchen empor, der brave Dorfpfarrer und die alte Gouvernante, deren Treue größer war als die Schulweisheit, welche sich auch bei ihr von gar Manchem nichts träumen ließ, leiteten ihren Unterricht, bei welchem Onkel Bernd oftmals über die Schwelle stolperte mit eifrig blinzelndem: »Du, Phine! Komm’ flink mit, unten am Teufelskessel hat der Förster einen neuen Fuchsbau entdeckt, kannst Dir mal die rote Bagage zur Kritik beordern!« oder: »Du, Phine, die Fohlen sind ausgebrochen, setz’ Dich mal auf Deinen Braunen und hilf treiben!« Dann zog wohl Mademoiselle erschrocken die Brille von der Stirn auf die Nase nieder, machte Augen und Mund gleich weit auf und rief schmerzlich: »Mais non!« Aber es hörte Niemand mehr, vier Nägelschuhe polterten die Treppe hinab.
So war Fräulein von Wetter siebzehn Jahre alt geworden, Kind an Herz und Seele, Kind an Wollen und Wünschen, die verzauberte Märchenblüte der Einsamkeit, zu welcher erst der rechte Königssohn kommen musste, um des Kelches tiefe Pracht aus träumender Knospe zu küssen.
Die Sonntagssonne über Stauffen! Da stand sie am tiefblauen Himmel, lugte schräg durch die dichtlaubigen Kastanienwipfel auf den Schlosshof und lachte das neugierige kleine Fräulein aus, welches bereits seit zwei Stunden in ganz kurzen Intervallen die hohe Steintreppe hinab an das Hoftor lief, um die Ebereschenallee entlang zu spähen, dann aber mit ungeduldigem Gesichtchen an das Souterrainfenster zu eilen und zu rufen: »Noch keinen Kaffee ausgießen, Hanne! sie kommen noch immer nicht!« »Sie!?« Wusste denn Hanne, die hohe, dürre, rührige Küchenmagd überhaupt, wer damit gemeint war? Gewiss, ganz Stauffen wusste es, denn außer zum Neujahrstag kehrte seit Jahren kein fremdes Wesen im Schlosse ein, und damit war auch Josephinens eifriges Zünglein gerechtfertigt.
»I, wo werd’ ich denn!« schüttelte Hanne den rotblonden Kopf, »die gnäd’ge Frau macht’n heut selbst, sogar mit ’nem neuen Kaffeebeutel, damit der alte Geschmack uns nicht die neue Sorte verdirbt, ’s gibt heute von dem bessern, Sie wissen ja, Fräulein Phinchen, den Neujahrsjava, das halbe Pfund zu 80 Pfennig.« Das gnädige Fräulein nickte sehr zufrieden. »Natürlich, es kommt ja Besuch, und was für welcher! Auch die guten Tassen hat die Tante rausgetan!«
»Und Kuchen gebacken, wie zu hohen Festen!« nickte Hanne anerkennend, mit dem Daumen über die Schulter zurück nach der Speisekammertür deutend, »sogar mit Krümeln drauf, wie vor sieben Jahren, als der Manöveroberst hier war, du lieber Gott ja, damals ging’s auch splendid hier zu, sogar schon zum Frühstück Wein auf dem Tische, geschweige denn zum Essen, wo es zu gleicher Zeit Fische und Putenbraten zu einem Mittag gab!«
Josephine seufzte mit strahlenden Augen: »Ach, wenn wir’s auch jetzt mal so schön machen dürften, Hanne, was meinst Du, ob’s die Tante tut?« und das Köpfchen neugierig durch’s Fenster steckend, flüsterte sie eifrig: »Zeig’ mal den Kuchen, wie groß er ist!«
»I du lieber Gott, wie kann ich denn?« schüttelte Hanne resigniert, »die gnäd’ge Frau hat doch den Schlüssel in der Tasche!«
»Ach so – na, er wird schon reichen! – wie viel Eier –«
»Phine! Schwatzliese! Wo steckst Du denn wieder?« klang eine tief gefärbte Frauenstimme aus dem Fenster der ersten Etage nieder; Tante Renates graues Haupt, auf welchem die statiöse Sonntagshaube mit den breiten lila Bändern schwankte, erschien in dem grau steinernen Rahmen und spähte mit Falkenaugen hinab.
»Hier! ich bin am Küchenfenster bei Hanne! Was soll ich denn?« antwortete die Gerufene mit übermütiger Schwenkung in den Sonnenschein tanzend und so tief knixend, dass die steifgestärkten weißen Kleiderröcke auf dem Pflaster rauschten.
»Affenschwanz! Stipp doch nicht mit dem frischen Kleid in den Staub! … Umgedreht! … Wahrhaftig, da hat die wilde Hexe schon wieder auf der Mauer gesessen, Alles glatt gedrückt und Halme an der Schärpe! – Na, mir ist’s ja egal, wie Du aussiehst, wenn die fremden Leute kommen, aber wundern werden sie sich, dass ein Mädchen seinen besten Staat so zurichtet!«
Josephine schüttelte sich wie ein Pudel. »Ein paar Heuhalme, die ein Wagen im Vorüberfahren abgestreift hat!« rief sie leichtsinnig, die trockenen Verräter geringschätzend hinzeigend, »Flecke hat’s ja gar nicht gegeben! – Tantchen!?«
»Was denn?«
»Wirf mir doch, bitte, mal den Speisekammerschlüssel herunter!« schmeichelten die roten Lippen.
»Papperlapap! Das hieße den Bock zum Gärtner setzen! Schnell herausgekommen, Mamsellchen, hilf mir die Überzüge von den Möbeln nehmen!«
»Überzüge? – Wo denn?« wunderte sich Fräulein von Wetter mit großen Augen.
»Na, in den guten Stuben, Dummkopf! ich muss sie doch für die Gäste aufschließen!« – Und Tante Renates Kopf zog sich zurück und ließ der weißen Mullgardine freie Bahn, welche sich hoch aufblähend der seltenen Freiheit erfreute.
Mit glühenden Wangen stürmte Josephine die Treppe empor, begrüßt von einer energischen Zugluft, welche den Geruch frisch gescheuerter Dielen auf feuchten Schwingen mit sich trug. Der weite, saalartige Korridor der ersten Etage knirschte unter fein gestreutem weißen Sand, die Türen, welche darauf mündeten und welche Josephine nur geheimnisvoll verschlossen kannte, standen sperrangelweit offen, und in der vordersten erschien just Tante Renate, eine gewaltige leinene Schürze über das grauseidene Kleid gebunden, dessen oeils de paon wehmütig auf einen schönen, lang entschwundenen Geschmack zurückschielten! In der Hand hielt sie den Federbesen und eine sehr zierliche, buntgemalte Porzellanfigur, aber sie klemmte den ersteren unter den Arm, blies die geröteten Wangen auf, wie die Engelein, welche dem Sturm voranfliegen, und pustete unbarmherzig auf das zarte Fräulein los.
»Man sollte es gar nicht glauben, was das für Staubfänger sind!« grollte sie dem jungen Mädchen entgegen, »Jahr aus Jahr ein alle Fensterläden geschlossen, und dabei liegt’s wie ein grauer Schleier über allen Sachen, – Gott sei Dank, dass die Möbel verwahrt gewesen sind, sonst könnten wir am Ende den Motten Proste Mahlzeit wünschen!« Und sie wandte sich nach dem Zimmer zurück und sagte kurz: »Fass’ mal mit zu, dass mir den Kattun abziehn!«
Mit großen Augen schaute sich Josephine um, schritt auf den Zehen der Tante nach und hustete krampfhaft auf; ein scharf beitzender Geruch drang ihr entgegen und nötigte sie, der Tante letzte Worte eifrig zu beniesen.
»Riecht’s immer noch nach Kampher und Pfeffer hier?« fragte die Freifrau erstaunt, »ich habe ja schon die ganze Zeit die Fenster aufgesperrt und empfinde gar nichts mehr, oder ob ich’s jetzt nur gewohnt bin?« fügte sie im Selbstgespräch hinzu, trat an das hochbeinige Sopha und begann, etliche Bandschleifen an der Lehne aufzuziehen.
Josephine blickte sich sprachlos um. Die Erinnerung aus der Manöverzeit erwachte in ihr, wo diese kühlen, dämmerigen Zimmer mit den wunderlichen Möbeln, den großen Ölbildern an der Wand, deren ernste Gesichter unter weißen Perrücken und Federhüten so gespenstisch auf sie niederblickten, wo all’ diese fremden, bunten Kostbarkeiten wie ein Traum an ihr vorübergezogen waren. Dann hatte Tante Renate die braungeschnitzten Türen wieder abgeschlossen, und die erste Etage lag öde und grabesruhig im alten Schlafe, kein Mensch dachte auch nur daran, jene Zimmer zu betreten, welche von Niemand vermisst und von Niemand erwähnt wurden. Heute aber flutete der Sonnenschein durch die geöffneten Scheiben, deren letzte soeben noch von dem Hausmädchen die blinden Äuglein geputzt bekam, die schweren, grünseidenen Damastvorhänge mit den abgeblassten Seidenfranzen knisterten entrüstet unter der Berührung des ungewohnten Luftzuges, und die dickköpfigen Chinesen aus goldgrundigem Ofenschirm blickten so dumm und verschlafen drein, als blende sie die plötzliche Helle. Aus hohem Glasschrank lockte es mit tausend Wundern! Allerliebste Nippes, gemaltes Porzellan und eingelegte Perlmutterkästchen, dazwischen große, fremdländische Muscheln und Korallenzweige, wer kann’s mit einem Blicke überschaun!
»Na Phine, wird’s bald?!« erinnerte Tante Renate, »die Leute können ja jeden Augenblick schon kommen.«
Fräulein von Wetter wandte sich hastig zurück und blickte fast erschrocken auf die Hände der Sprecherin, welche den prächtigen, blaublumigen Kattun von dem Sopha streiften, – du lieber Gott! Da war ja die schönste, grüne Seide darunter, ebenso wie die Vorhänge! Das hatte sie sich allerdings nicht träumen lassen! Fiebernd in freudiger Hast half sie auch den steiflehnigen Sesseln ihr Mäntelchen ausziehen, blickte tief aufatmend über die seltene Pracht, huschte hin und her, rieb die Tischplatten und Kommoden ab, bat das herzallerliebste Tantchen himmelhoch, doch auch den hässlichen Müllsack von dem Kronleuchter zu nehmen, und schlang endlich die Arme jubelnd um den Nacken der Freifrau. »Aber eins musst Du mir versprechen, Tanting, Pastors müssen es auch sehen!« Frau von Wetter murmelte etwas von Kinderei und Affigkeit, aber sie schmunzelte dabei, warf einen schnellen Blick rundum und schob das Pflegetöchterchen zur Türe hinaus. »Marsch jetzt, damit der Parquetboden nicht unnötig vertrampelt wird!«
Auf der Treppe kam ihnen Onkel Bernd mit qualmender Pfeife entgegen. »Ei, du lieber Gott! Bleibst Du mir wohl mit dem Schornstein aus den guten Stuben, Olling!« klang ihm Tante Renates Stimme wie Trompetengeschmetter entgegen, »da sollte die grüne Seide bald die Bleichsucht kriegen! Rechtsum kehrt, Männchen, geh’ heute mal in den Garten, wenn Du paffen willst!«
»Aber Renatchen, ist denn rein der Deuwel los … Himmel Bataille! Mottenkommission in der ersten Etage!«
»Phine, geh’ mal in die Essstube unten und stell’ den Zucker auf den Tisch, da ist der Schlüssel!«
Tante Renate wartete, bis das weiße Kleid um die Treppenbiegung gerauscht war, dann neigte sie sich dicht zu dem Ohr des Gatten, welcher zwei Stufen tiefer stand, und flüsterte ernsthaft: »’s ist um des Kindes Willen, Bernd. Der Graf Lehrbach hat einen heiratsfähigen Sohn, und unsere Phine wird im October achtzehn Jahre alt, verstanden?«
Onkel Bernd schob seine wetterfarbige Husarenmütze mit gedehntem »Hum, Hum« von dem rechten Ohr auf das linke und sagte wehmütig: »Meinst Du, Alte? Ist unser Nestputch wahrhaftig schon flügge geworden? Wie die Zeit vergeht, hab’s gar nicht gemerkt, dass mir die kleine Hexe über den Kopf gewachsen ist; na, in Gottes Namen, Renatchen, wenn’s auch recht leer bei uns werden wird, die Rekruten schwärmen aus, und der Landsturm bleibt am Herd hocken«, und Onkel Bernd seufzte tief auf, klopfte seiner Frau wehmütig auf den Rücken und stolperte hastig die Treppe herunter.
»Alterchen!« rief’s noch einmal von oben.
»Was denn, Mutterchen?«
»Zieh erst reine Manschetten an, eh’ der Besuch kommt, ich habe sie Dir schon rausgelegt!«
»Natürlich! Immer schlank weg!« nickte der Rittmeister zerstreut, tippte mit dem Finger in den kalten Pfeifenkopf und murmelte: »Ist mir die Phine doch wahrhaftig in den Tobak gefahren, vor lauter Schreck schmeckt’s nicht mehr!« – – – – – –
Die Chaussee entlang rollte leicht und elegant auf Gummirädern ein Gefährt. Das gemalte Wappen auf dem Wagenschlag, lichtgraue Atlaspolster und reich gallonierte Dienerschaft auf hohem Kutscherbock bildeten die aristokratische Physiognomie der gräflichen Equipage, welche Excellenz der Bequemlichkeit halber selbst mit auf Reisen führte. Denn Landwege sind ein horreur für angegriffene Nerven, und Excellenz bedurfte sorgfältigster Pflege, sollte er wirklich einen wohltuenden Erfolg des knappen Urlaubs in all’ den Aktenstaub heimbringen.
Tief zurückgelehnt in die schwellenden Kissen streifte er mit nachdenklichem Blick die vorübertanzenden Waldungen und Felder. Der leichte Luftzug spielte um das ergraute Haupt, unfähig, auch nur eines der penibel gekräuselten und frisierten Löckchen zu heben, welche, unter grauem Cylinder hervorquellend, die eingesunkenen Schläfen umrahmten. Schmal und bleich war das Antlitz, bartlos und scharf geschnitten; ein müder Zug lagerte um die Lippen und senkte zwei schlaffe Falten in die Wangen, – vornehm und reservirt fielen die Augenlider unter tief dunkeln Brauen bis fast über die Hälfte der Pupille und gaben daher dem Gesicht etwas Verschleiertes, Müdes, ohne jedoch den Blick zu dämpfen, welcher oft hastig, blitzend und schnell die Wimpern durchbrach. Die linke Hand war mit tadellosem Handschuh bekleidet und in den halbgeöffneten Rock geschoben; die rechte lag farblos und mager, die seidene Polsterquaste drehend, auf dem Wagenschlag.
Excellenz gegenüber saßen Job Günther und Hattenheim, beide in Zivil, – der junge Graf mit ostensibel gewählter Haiderose im Knopfloch.
»Voilà papa! Das Terrain unseres Abenteuers!« rief er soeben, sich lebhaft zur Seite neigend. »Hier, auf diesem Heuhaufen thronte Gänseliesel mit der siebenpunktigen Krone auf dem Haupt und regierte mit assistance des Herrn von Goethe ihre capitolinischen Unterthanen!«
Der Minister lächelte und folgte mit dem Blick der Richtung, welche ihm Günthers Hand angegeben.
»Sehr originell!« sagte er mit leiser, etwas bedeckter Stimme, »ein Zufall, welchem Du entschieden eine Deiner reizendsten Skizzen verdankst! Ich freue mich darauf, das Original kennen zu lernen, – Natürlichkeit tut wohl!«
»Wie ein Schluck Quellwasser! – bien à propos bei sehr viel Durst geboten, cher pèere, für die Dauer würde man sich mindestens einen pikanten Tropfen Cognac hineinsehnen!«
Ein vorwurfsvoller, fast empfindlicher Blick Hattenheims traf den schönen Sprecher: »Wie undankbar, Günther! Ganz wie der wilde Knab’, der ein Röslein bricht, sich kurze Zeit den Hut damit schmückt und es überdrüssig bei Seite wirft! Ich dächte, wen Haideröslein mit so herzigen Augen angeschaut hat wie Dich, der hätte nicht den Mut, aus Eitelkeit die sonnige Blüte zu knicken!«
»Sehr recht, lieber Reimar!« nickte Excellenz nachdenklich, Günther aber lachte hell auf, legte die Hand klatschend auf die Schulter des Freundes und rief amüsirt:
»Beim grausigen Fegefeuer, Dicker, Du scheinst mich ja in dem fürchterlichen Verdacht zu haben, ich wollte Gänseliesel den Hof machen? – Mort de ma vie – ich will’s nämlich auch! – aber nicht ernsthaft, – werde ihr nicht einmal die Hand küssen, denn dazu hat mir dieselbe mit Hintenansetzung aller Eitelkeit schon zu viel Stickelbeer’n in ’Gaarden ’pluckt! – und ihr Herzchen? Nehmen