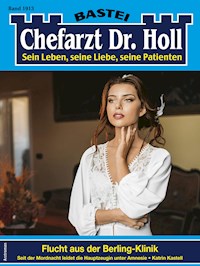5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die besten Ärzte
- Sprache: Deutsch
Willkommen zur privaten Sprechstunde in Sachen Liebe!
Sie sind ständig in Bereitschaft, um Leben zu retten. Das macht sie für ihre Patienten zu Helden.
Im Sammelband "Die besten Ärzte" erleben Sie hautnah die aufregende Welt in Weiß zwischen Krankenhausalltag und romantischen Liebesabenteuern. Da ist Herzklopfen garantiert!
Der Sammelband "Die besten Ärzte" ist ein perfektes Angebot für alle, die Geschichten um Ärzte und Ärztinnen, Schwestern und Patienten lieben. Dr. Stefan Frank, Chefarzt Dr. Holl, Notärztin Andrea Bergen - hier bekommen Sie alle! Und das zum günstigen Angebotspreis!
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Chefarzt Dr. Holl 1829: Die kleinsten Segnungen sind oft die größten
Notärztin Andrea Bergen 1308: Ein anonymer Notruf
Dr. Stefan Frank 2262: Du gibst mir Kraft
Dr. Karsten Fabian 205: Kleine Wunder braucht die Liebe
Der Notarzt 311: Die Studentin
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 320 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2016/2018 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © 0
ISBN: 978-3-7517-6478-0
https://www.bastei.de
https://www.sinclair.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Die besten Ärzte - Sammelband 64
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Chefarzt Dr. Holl 1829
Die kleinsten Segnungen sind oft die größten
Die Notärztin 1308
Ein anonymer Notruf
Dr. Stefan Frank 2262
Du gibst mir Kraft
Dr. Karsten Fabian - Folge 205
Die wichtigsten Bewohner Altenhagens
Kleine Wunder braucht die Liebe
Der Notarzt 311
Die Studentin
Guide
Start Reading
Contents
Die kleinsten Segnungen sind oft die größten
Dr. Holl und ein dramatischer Start ins Leben
Von Katrin Kastell
Als der erste klägliche Schrei erklingt, atmen alle im Kreißsaal der Berling-Klinik auf. Für einen Moment hatte es so ausgesehen, als stimmte irgendetwas mit dem Neugeborenen nicht, doch nun gibt der Kinderarzt Entwarnung.
Lächelnd legt Chefarzt Dr. Holl den kleinen Jungen in die Arme seiner erschöpften Mutter, die ihr Baby zärtlich an sich drückt – und dann in bitteres Schluchzen ausbricht! Mitfühlend drückt der Chefarzt Verena Fiebichs Schulter, denn er kennt den Grund für ihre Tränen. Der Vater des kleinen Sascha liegt im selben Haus – im Sterben. Das Wunder, das Alexander Bergreiter hätte retten können, ist leider ausgeblieben …
Schon wenige Stunden nach der Geburt seines Sohnes tut Alexander seinen letzten gequälten Atemzug, und ihr kleiner Sohn ist alles, was Verena noch von ihrer großen Liebe bleibt. Doch kaum ist sie mit ihrem Baby zu Hause, schlägt das Schicksal erneut erbarmungslos zu: Klein-Sascha erkrankt lebensgefährlich und hat kaum eine Chance …
„Großartig, einfach großartig!“ Dr. Stefan Holl nickte der werdenden Mutter aufmunternd zu. „Alles läuft bestens. Jetzt noch einmal und Sie haben es geschafft, Frau Fiebich!“
„Ich … kann … nicht … mehr“, stammelte Verena Fiebich völlig erschöpft.
„Aber, aber!“ Schwester Annegret stand neben ihr und hielt ihre Hand. „Noch einmal pressen und es ist vorüber. Sie können das. Ich weiß es!“
Verena Fiebich blickte in das gütige Gesicht der alten Schwester und sammelte die letzten Kraftreserven. Unter dem guten Zureden Schwester Annegrets unterstützte sie Dr. Holls Bemühungen.
Dr. Holl machte sich schon bereit, aktiv nachzuhelfen, weil die junge Frau wahrscheinlich zu schwach war, doch unmittelbar vor einer Entscheidung des Chefarztes der Berling-Klinik fand Verena Fiebich die nötige Kraft – und ihr Kind erblickte das Licht der Welt!
Während Dr. Holl und Schwester Olli das Neugeborene versorgten, sank Verena Fiebich ermattet zurück.
Schwester Annegret redete lobend und beruhigend auf die junge Frau ein und ließ sich die Sorge um ihre Patientin nicht anmerken. Sie wartete wie Dr. Holl und ihre Kollegin auf den ersten Schrei des Kindes, der ungewöhnlich lange auf sich warten ließ.
„Was ist …?“ Verena Fiebich war zu schwach zum Sprechen, doch sie drehte den Kopf und sah Schwester Annegret ängstlich an.
Schon wollte die erfahrene Pflegerin sich mit eigenen Augen davon überzeugen, was mit dem Neugeborenen war, als endlich der erhoffte Schrei ertönte.
„Ein gesunder Junge“, verkündete Dr. Holl, und man hörte ihm an, dass auch er erleichtert war.
Erst jetzt entspannte sich die junge Mutter vollständig, schloss die Augen und begann, bitterlich zu weinen.
Keiner der Anwesenden im Kreißsaal fragte nach dem Grund. Alle kannten ihn.
Der Vater des Kindes, die große Liebe der jungen Mutter, lag im selben Haus – im Sterben. Das Wunder, das ihn hätte retten können, war ausgeblieben.
***
„Ich bin dann weg, Mami!“
Julia Holl kannte diesen Ruf eines ihrer Kinder sehr gut, bekam sie ihn doch täglich mindestens einmal zu hören. Meistens antwortete sie mit einer Ermahnung, vorsichtig zu sein oder nicht zu spät nach Hause zu kommen. In diesem Fall hielt sie es jedoch für angebracht einzuschreiten.
„Einen Moment, junger Mann!“, rief sie ihrem jüngeren Sohn Chris zu. „Nicht so hastig.“
Chris war schon fast zur Haustür hinaus.
„Was ist denn noch?“, fragte der Fünfzehnjährige, drehte sich um und unterdrückte im letzten Moment eine genervte Miene. Seine Mutter vertrug es nicht, wenn er sich ihr gegenüber respektlos verhielt.
„Wohin willst du denn?“ Julia kam aus dem Wohnzimmer und seufzte in sich hinein. Chris lehnte wie ein Fragezeichen in der offenen Haustür, hatte die Hände in die Hosentaschen geschoben und sah ihr rebellisch entgegen.
„Papa besuchen“, erwiderte er. „Ich habe doch beim Mittagessen gesagt, dass ich heute Nachmittag mit dem Rad in die Klinik fahren will. Ich war schon lange nicht mehr dort, und Papa freut sich bestimmt.“
Grundsätzlich hatte Julia nichts gegen sportliche Aktivitäten ihrer Kinder einzuwenden. Es kam auch nicht selten vor, dass ihre Kinder von dem Haus am Stadtrand von München zur nicht allzu weit entfernten Klinik des Vaters fuhren. Bei Chris gab es allerdings gewisse Bedenken.
„Wie sieht das denn mit deinen Hausaufgaben aus?“, erkundigte sie sich. „Wenn ich mich recht erinnere, war beim Mittagessen davon die Rede, dass du sie vorher machst und erst danach in die Berling-Klinik fährst. Und du kannst mir nicht erzählen, dass du schon mit allem fertig bist.“
„Nun ja …“ Allein schon durch den gedehnten Tonfall verriet Chris, dass seine Mutter ins Schwarze getroffen hatte. „Nicht mit allem …“
Julia seufzte in sich hinein. „Könnte es sein, dass du noch gar nichts gemacht hast?“, fragte sie sehr geduldig. „Ich habe dich nämlich nach dem Essen in deinem Zimmer gehört. Du hast ziemlich laut Musik gespielt, und dabei hast du dich garantiert nicht auf Hausaufgaben konzentriert.“
„Na ja, das ist nämlich so“, begann Chris umständlich. „Ich hab versucht, mich durch die Musik in die richtige Stimmung zu bringen und vom Stress in der Schule abzuschalten, aber das hat nicht so direkt geklappt, und darum dachte ich, wenn ich jetzt in die Klinik fahre und mich dabei erhole, geht es hinterher viel leichter und …“
„Mit einem Wort“, unterbrach ihn Julia, „du hast gar nichts getan.“
„Wie ich schon sagte …“
„Du brauchst es nicht zu wiederholen“, fiel Julia ihm ins Wort. Da sie jedoch der Meinung war, dass Chris mit seinen fünfzehn Jahren Verantwortung gegenüber seinen Verpflichtungen lernen musste, lenkte sie ein. „Meinetwegen kannst du deinen Vater besuchen, aber komm gleich wieder nach Hause. Es bringt nämlich gar nichts, wenn du womöglich erst nach dem Abendessen zu arbeiten anfängst. Dann schaffst du nichts mehr. Das haben wir oft genug festgestellt.“
„Klaro“, erwiderte Chris hastig und verbesserte sich. „Ich meine, ist in Ordnung, Mama!“
Er war weg wie der Blitz, und Julia sah ihm kopfschüttelnd nach, als er mit seinem Fahrrad auf die Straße hinausfuhr, die durch das Villenviertel führte. Anders als Marc und Dani, die zwanzigjährigen Zwillinge, war Chris noch ungefestigt. Man konnte sich nicht auf ihn verlassen. Das war zwar kein Wunder, aber es erzeugte doch gelegentlich Schwierigkeiten.
Hoffentlich stellte er sich heute vernünftiger an als bei ähnlichen Gelegenheiten in der Vergangenheit.
Chris trat kräftig in die Pedale und genoss es, mit dem Fahrrad durch die stillen Straßen des Münchner Vorortes zu jagen. Dabei wählte er eine Strecke, die abseits der viel befahrenen Durchgangsstraßen lag. Auf diese Weise vermied er die von Abgasen verpestete Luft, starken Verkehr und die Gefahr durch unachtsame Autofahrer.
Er kannte sich hier sehr gut aus, war er doch mit Fahrrad, Skateboard und Inline-Skates oft unterwegs, und er wählte heute eine Strecke, die ihn an einer großen freien Wiesenfläche vorbeiführte.
Für gewöhnlich fand man hier zu jeder Tageszeit Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner ausführten und miteinander spielen ließen. Chris hatte sich noch nie sonderlich dafür interessiert und war stets weitergefahren.
Heute warf er einen Blick auf die Wiese und bremste mit einem begeisterten Stöhnen das Rad ab.
„Mann, irre“, murmelte er vor sich hin und betrachtete mit strahlenden Augen die Wohnwagen, auf denen in bunten Lettern der Name Carossa prangte. „Ein Zirkus!“
Ohne lange zu überlegen, schwang er sich von seinem Drahtesel und schob ihn zu den Wagen, zwischen denen die Mitglieder des Zirkus Carossa arbeiteten.
Einige Männer waren damit beschäftigt, das Zelt aufzubauen. Es war ein kleines Wanderunternehmen, doch das störte Chris nicht im Geringsten. Er sah eine Weile zu, wie mit Winden und kräftigem Zupacken der Mittelmast aufgerichtet wurde.
Ein kurzes Fauchen zog ihn gleich darauf zu einem der Wagen. Die Seitenwand war geöffnet, und hinter den Gitterstäben entdeckte er einen Löwen.
„Geh nicht zu nahe ran“, warnte eine Frau, die den Kopf aus einem der Wohnwagen steckte.
Chris winkte beruhigend ab. „Hallo, Miezekatze“, sagte er grinsend zu dem Löwen und hörte hinter sich ein helles Lachen.
Er drehte sich um und riss die Augen weit auf. Das Lachen wurde daraufhin noch lauter.
„Dir fallen gleich die Augen aus dem Kopf“, ertönte es aus dem Mund eines hübschen Mädchens, das für Chris’ Verwirrung verantwortlich war.
Chris brauchte eine Weile, um verstandesmäßig zu begreifen, was er da vor sich sah. Der Kopf saß auf zwei Händen. Zwei Beine waren oberhalb des Kopfes ineinander verschränkt.
Es sah aus, als hätte ein wahnsinniger Chirurg in einem Horrorfilm ein Mädchen zersägt und neu zusammengesetzt, sodass der Kopf sich direkt auf den Händen fortbewegen konnte. Und in einem Anfall völliger Verwirrung hatte derselbe Chirurg die Beine an den Ohren befestigt.
„Du siehst zum Schießen komisch aus“, urteilte das Mädchen, und im nächsten Moment sanken die Beine zu Boden, die Hände gehörten plötzlich zu Armen, und gleich darauf richtete sich ein gertenschlankes, mit einem Trikot bekleidetes Mädchen auf und trat auf Chris zu. „Hallo, ich bin Melanie.“
Chris klappte erst einmal den Mund zu, den er vor Verblüffung nicht geschlossen hatte, und lächelte verlegen.
„Ich bin Chris“, sagte er und hoffte, dass seine Wangen nur glühten und nicht auch sichtbar rot wurden.
„Ich bin das Gummimädchen“, fügte Melanie hinzu.
Chris nickte eifrig. „Klaro. Habe ich gleich gemerkt. Na ja, nicht gleich“, räumte er ein, als Melanie wieder lachte. „Das war vielleicht ein Anblick. Mann! Wie kann man sich ermaßen verrenken!“
„Training“, erwiderte sie. Melanie war einen Kopf kleiner als er, was allerdings nicht erstaunlich war. Chris war mit seinen fünfzehn Jahren gewaltig in die Höhe geschossen und schon so groß wie sein Bruder Marc. Dafür besaß er die schlaksige Gestalt eines Jugendlichen, der noch einen weiten Weg bis zum erwachsenen Mann vor sich hatte. „Machst du echt toll“, fügte er hinzu.
„Melanie Carossa“, stellte sie sich vor. „Meiner Familie gehört der Zirkus.“
„Echt?“ Chris schloss rasch den Mund, als er merkte, dass ihm der Unterkiefer schon wieder heruntergeklappt war. Schließlich wollte er nicht dämlich wirken. „Chris Holl“, stellte er sich dann vor, als er sich an die Manieren erinnerte, die er daheim gelernt hatte. „Mein Vater leitet die Berling-Klinik.“
Melanie zuckte die Schultern. „Die kenne ich nicht. Wir reisen ständig herum. Ich habe schon so gut wie jede Stadt in Deutschland und auch im umliegenden Ausland gesehen, aber eigentlich kenne ich nichts so richtig.“
„Muss irre sein, wenn man dauernd mit dem Zirkus unterwegs ist“, schwärmte Chris.
„Ich weiß nicht.“ Melanie zuckte unbekümmert die Schultern. „Ich kenne es eben nicht anders. Soll ich dir unsere Tiere und alles andere zeigen?“
„Mann, super!“, rief Chris wieder, weil er sich in diesem Moment nichts Schöneres vorstellen konnte.
Vergessen war der geplante Besuch in der Berling-Klinik. Vergessen war sein Vater genau wie seine Mutter, die ihn an die Hausaufgaben erinnert hatte. Und die Hausaufgaben gehörten ohnedies bereits einer anderen Welt an.
Chris nutzte die Chance, in die Welt des Zirkus einzutauchen, und dabei hatte er die entzückendste Führerin, die er sich vorstellen konnte. Innerhalb weniger Minuten hatte er sein Herz an Melanie Carossa verloren. Sie war zum Mittelpunkt seiner Welt geworden.
***
„Kommen Sie bitte mit, Herr Strackmeier“, sagte Dr. Stefan Holl im Vorübergehen zu dem jungen AIP, der auf dem Korridor mit einer Schwester sprach.
Holger Strackmeier, der seit einem Monat als Arzt im Praktikum an der Berling-Klinik tätig war, schloss sich sofort dem Chefarzt an.
„Frau Fiebich hat ihr Kind bekommen“, bemerkte Dr. Holl. „Einen gesunden Jungen.“
„Das ist schön.“ Holger Strackmeier freute sich sichtlich darüber.
„Sie ist sehr mitgenommen“, fuhr Dr. Holl fort, während er sich der Intensivstation näherte. „Ich möchte sehen, ob ich dem Vater die Nachricht überbringen kann.“
Holger Strackmeier nickte, und in seine blauen Augen trat sofort ein bekümmerter Ausdruck.
Der Leiter der renommierten Münchner Privatklinik blieb vor dem verschlossenen Zugang zur Intensivstation stehen und wandte sich an den Anfänger in seinem Beruf.
„Mein lieber junger Freund“, sagte Dr. Holl und klopfte dem AIP auf die Schulter. Normalerweise vermied er diese Form der Anrede sogar bei sehr jungen Kollegen, weil sie ihm herablassend erschienen wäre. Auch so vertrauliche Gesten kamen bei ihm nicht vor. In diesem Fall machte er jedoch eine Ausnahme. Die Bezeichnung „junger Freund“ kam Dr. Holl ganz natürlich über die Lippen, weil er seinen AIP mochte. Die Geste erfolgte auch unbewusst.
„Wissen Sie“, meinte Dr. Holl mit einem leichten Kopfschütteln und einem verständnisvollen Lächeln, „Sie erinnern mich ein wenig an mich selbst in Ihrem Alter. Damals habe ich mir Patientenschicksale auch zu sehr zu Herzen genommen. Wenn Sie in diesem Beruf bleiben wollen, müssen Sie rasch lernen, eine gewisse Distanz einzuhalten. Sie schaffen es sonst nicht.“
Holger Strackmeier nickte zwar, zuckte jedoch auch gleichzeitig die Schultern.
„Ich versuche es“, erwiderte er. „Es ist nur …“ Er suchte nach den richtigen Worten. „Wenn eine Frau ein gesundes Kind zur Welt bringt, der Vater dieses Kindes aber als hoffnungsloser Fall im selben Krankenhaus liegt, so ist das …“
„Ja, es ist tragisch“, fiel Dr. Holl ihm energisch ins Wort. „Wir Ärzte dürfen uns davon aber nicht zu stark beeindrucken lassen, sonst halten wir die Arbeit in unserem Beruf nervlich nicht durch.“
Holger Strackmeier nickte. „Sie haben natürlich recht, Herr Chefarzt. Andererseits habe ich Sie in dem Monat, den ich jetzt bei Ihnen bin, beobachtet. Für Sie sind Patienten und ihr Schicksal nicht bloß Beruf. Sie sehen in jedem Patienten den Menschen. Darauf will ich nicht verzichten. Ich glaube auch, dass man als Arzt gar nicht darauf verzichten darf, weil man sonst kein guter Arzt ist. Zumindest keiner, der mit Patienten arbeitet. Dann sollte man, zum Beispiel, in ein Forschungslabor gehen.“
Dr. Holl klingelte am Zugang der Intensivstation.
„Sie haben völlig recht, Herr Strackmeier“, bestätigte er. „Sie haben recht, was mich angeht, und Sie sprechen mir aus dem Herzen, was die Einstellung zum Beruf betrifft. Man sollte, meiner Meinung nach, einen gesunden Mittelweg finden. Natürlich haben wir es mit Menschen zu tun, und natürlich werden wir berührt, wenn sie leiden oder sterben. Wir dürfen aber nicht so mitleiden, dass wir nicht mehr helfen können. Helfen ist schließlich unsere Aufgabe.“
Der junge AIP seufzte. „Ich weiß einfach nicht, wo die Grenze liegt.“
„Eine Frage der Erfahrung“, meinte Dr. Holl beruhigend. „Im Lauf der Zeit werden Sie schon herausfinden, wie Sie sich am besten verhalten.“ Er nickte Pfleger Lucca zu, der die Tür geöffnet hatte und den Klinikleiter und dessen Begleiter eintreten ließ.
Dr. Holl und Holger Strackmeier traten an das Bett von Alexander Bergreiter, sechsundzwanzig Jahre alt und wegen eines durch Virenbefall weitgehend zerstörten Herzmuskels nicht mehr ohne die Geräte der Intensivstation lebensfähig.
Da der Patient nicht bei Bewusstsein war, ließ Dr. Holl sich von seinem Begleiter die Anzeigen an den lebenserhaltenden Geräten und Monitoren erläutern. Holger Strackmeier, der als AIP auf der Inneren Station in die Berling-Klinik gekommen war, unterzog sich bereitwillig und erfolgreich der kurzen Prüfung durch den Chefarzt.
Pfleger Lucca, der eine spezielle Ausbildung für die Intensivstation absolviert hatte, wandte sich hinterher an Dr. Holl.
„Kein Spender?“, fragte er leise.
Dr. Holl schüttelte den Kopf. Alexander Bergreiter stand seit etlichen Wochen auf der Liste jener Empfänger eines Spenderherzens, bei denen eine Transplantation dringendst nötig gewesen wäre. Bis zum heutigen Tag war kein geeignetes Herz gefunden worden. Dr. Holl verzichtete darauf, seine Mitarbeiter in diesem Moment über einen wesentlichen Punkt zu informieren.
Alexander Bergreiter war bereits zu schwach für eine Transplantation. Er hätte nicht einmal mehr die Operation überlebt. Bisher hatte der Klinikleiter nur mit Verena Fiebich darüber gesprochen. Sie hatte ein Recht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Nicht nur, weil sie vor wenigen Stunden Alexander Bergreiters Kind zur Welt gebracht hatte. Sie hatte auch die letzten zwei Jahre mit ihm zusammengelebt. Und sie war mit ihm in die Berling-Klinik gefahren, nachdem er daheim zusammengebrochen war.
Seither war sie trotz der Schwangerschaft kaum von seiner Seite gewichen. Sie hatte die erste niederschmetternde Diagnose gehört, und sie hatte die Verschlechterung im Zustand ihres Lebensgefährten an seinem Krankenbett verfolgt.
Dr. Holl wollte seinen Mitarbeitern nichts verschweigen. Er hätte sie schon informiert, dass es hoffnungslos geworden war, doch an den Anzeigen las er ab, dass Alexander Bergreiter aus dem einer Ohnmacht ähnlichen Schlaf erwachte. Der Patient wusste zwar, wie es um ihn stand, doch er sollte nicht hören, wie über ihn gesprochen wurde.
„Herr Doktor.“ Alexander Bergreiters Stimme war kaum zu hören.
Dr. Holl nahm ihm die Atemmaske ab.
„Wie geht es Verena?“, fragte der junge Mann, der nun schon etwas besser zu verstehen war.
„Ihre Freundin hat vor drei Stunden einen gesunden Jungen zur Welt gebracht“, erwiderte Dr. Holl. Als Alexander Bergreiter schwach lächelte, fügte er hinzu: „Mutter und Kind sind wohlauf.“
„Das ist schön“, flüsterte der Patient.
Dr. Holl nickte. „Ihre Freundin wird Sie besuchen, sobald sie kann“, fuhr er fort. Als Alexander Bergreiter daraufhin besorgt die Stirn runzelte, lächelte Dr. Holl zuversichtlich. „Sie ruht sich nur von den Anstrengungen der Geburt aus.“
Alexander Bergreiter seufzte. „Ich wäre gern bei ihr gewesen. Ein Junge. Dann nennt sie ihn wie vereinbart Sascha. Sascha für Alexander. Sie hat mich auch immer Sascha genannt.“
Dr. Holl entging nicht, dass Alexander Bergreiter von seiner Beziehung zu Verena Fiebich bereits in der Vergangenheit sprach. Der junge Mann fühlte das Ende nahen. Und das veranlasste Dr. Holl zu einer Frage, die er schon kurz nach der Einlieferung dieses Patienten gestellt hatte. Damals hatte er eine abschlägige Antwort erhalten. Vielleicht dachte Alexander Bergreiter jedoch angesichts des Todes anders.
„Was ist mit Ihren Eltern, Herr Bergreiter? Soll ich sie nicht doch verständigen?“
„Nein.“ Die Antwort kam klar und unmissverständlich. „Sie haben sich von mir gelöst, nicht ich mich von ihnen. Ich habe in den letzten zwei Jahren mehrere Versöhnungsversuche unternommen. Und ich habe meine Eltern verständigt, als mir der Arzt die erste Diagnose für meine Herzprobleme stellte. Ihre Antwort war stets gleich: Ich muss mich von Verena trennen, sonst bin ich nicht länger ihr Sohn.“
Holger Strackmeier war an die andere Seite des Bettes getreten. Daher sah Dr. Holl ihm deutlich an, wie betroffen er auf diese Eröffnung reagierte. Er selbst kannte die Geschichte bereits.
„Trotzdem …“, setzte Dr. Holl an, weil er nach Möglichkeit eine Versöhnung zwischen Eltern und Sohn herbeiführen wollte, bevor es zu spät war.
„Nein“, wehrte Alexander Bergreiter noch einmal ab. „Meine Eltern haben sich entschieden. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.“
Dr. Holl nickte. Er war zwar mit dieser Einstellung nicht einverstanden, doch er wollte seinem Patienten auch nicht länger widersprechen. Alexander Bergreiter war bereits sehr schwach, und er sollte seine Kräfte für seine Freundin und sein neugeborenes Kind aufheben.
„Haben Sie mich schon von der Liste der Herzempfänger streichen lassen?“ Mit dieser Frage bestätigte Alexander Bergreiter erneut, dass er über seinen Zustand Bescheid wusste.
Dr. Holl schüttelte den Kopf. „Nein“, erwiderte er, und das entsprach der Wahrheit. Zwar hätte er mittlerweile abgesagt, hätte sich die Stelle gemeldet, die Spenderherzen vermittelte, doch er hatte nichts in dieser Richtung unternommen.
Alexander Bergreiter hatte noch eine Frage. „Kommt Verena noch heute zu mir?“
„Ja, da bin ich sicher“, erwiderte Dr. Holl, der vor dem Gang auf die Intensivstation seine Patientin untersucht hatte. „Sicher sehr bald.“
„Gut“, murmelte Alexander Bergreiter und schloss die Augen.
Ein letzter Blick auf die Geräte zeigte Dr. Holl, dass der Patient ruhte. Er gab dem AIP ein Zeichen und verließ mit ihm die Intensivstation.
„Wie können Eltern sich bloß von ihren Kindern völlig abwenden?“ Holger Strackmeier schüttelte ungläubig den Kopf. „Es gab auch zwischen mir und meinen Eltern eine Zeit lang Spannungen, als ich ihnen sagte, dass ich schwul bin, aber das hat sich eingerenkt. Was haben denn Herrn Bergreiters Eltern gegen seine Freundin einzuwenden?“
Dr. Holl zuckte die Schultern. „Ich kenne die Einzelheiten nicht. Ich habe nur erfahren, dass die Beziehung der beiden der Grund für den Bruch war. Die Eltern Bergreiter sind reiche Unternehmer. Vielleicht ist das der Grund.“
„Sie meinen“, fragte der AIP und begleitete auch weiterhin den Chefarzt, „dass reiche Leute weniger Herz für ihre Kinder haben?“
„Nein, sicher nicht“, wehrte Dr. Holl ab. „Ich denke mir nur, dass sie gegen die Beziehung ihres Sohnes zu dieser Frau sind, weil sie nicht in ihre Kreise passt oder weil er eine andere Frau heiraten sollte. Ich weiß es wirklich nicht.“ Der Klinikleiter blieb vor dem Aufenthaltsraum der Inneren stehen. „Machen Sie jetzt hier weiter, Herr Strackmeier“, verlangte er. „Ich bin in meinem Büro, falls etwas ist.“
Dr. Holl setzte seinen Weg fort und benutzte die Tür, die vom Korridor direkt in sein Büro führte.
„War etwas, Moni?“, fragte er seine Sekretärin durch die offene Verbindungstür und setzte sich an den Schreibtisch.
„Nein, Herr Doktor“, erwiderte Moni Wolfram.
Dr. Holl lehnte sich zurück und ließ den Blick über die Wand gleiten, bis er auf den gerahmten Sinnspruch fiel, den Julia ihm vor Jahren geschenkt hatte.
„Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her!“
Sollten Eltern nicht die Chance bekommen, sich in letzter Minute mit ihrem sterbenden Sohn zu versöhnen? Konnte es einen Groll geben, der so groß war, dass man ihn nicht überwinden konnte?
„Moni!“ Dr. Holl brauchte nicht lange zu warten, bis seine Sekretärin in der Verbindungstür erschien. „Rufen Sie bitte der Reihe nach folgende Nummern an. Zuerst Bergreiter privat, und zwar meine ich die Bergreiters, denen die Werke in München gehören. Ich möchte mit den Eltern von Alexander Bergreiter sprechen. Falls sie nicht in der Villa sind, versuchen Sie es als Zweites in den Büros der Bergreiter-Werke. Und stellen Sie das Gespräch dann zu mir durch.“
Moni Wolfram nickte und machte sich sofort an die Arbeit, während Dr. Holl zu den Akten und Briefen griff, die auf seinem Schreibtisch lagen.
Er hatte schon drei Briefe gelesen und mit Randbemerkungen für die Antwort versehen, als sein Telefon summte.
„Ja, Moni?“ Während seiner Tätigkeit hatte er gehört, wie sie nebenan telefonierte.
„In der Villa war nur die Haushälterin“, erklärte seine Sekretärin rasch. „Die Herrschaften sind verreist“, wiederholte sie die Auskunft. „Ich habe die Chefsekretärin der Bergreiter-Werke am Apparat.“
„Verbinden Sie“, bat Dr. Holl und wartete, bis es im Hörer klickte. „Hallo?“
„Bergreiter-Werke, mein Name ist Armbruster“, erwiderte eine kühl klingende Frauenstimme.
„Dr. Holl, Leiter der Berling-Klinik“, erwiderte Stefan Holl. „Könnte ich bitte mit Herrn oder Frau Bergreiter sprechen? Es ist dringend.“
„Bedaure“, erwiderte Frau Armbruster. „Herr und Frau Bergreiter halten sich zurzeit in Südamerika auf. Ich bin die Chefsekretärin. Kann ich etwas für Sie tun?“
Südamerika. Selbst wenn die Eltern Bergreiter sofort zu erreichen gewesen wären und sich in die nächste Maschine nach München gesetzt hätten, wären sie nicht mehr rechtzeitig eingetroffen. Dr. Holl sah daher keine Veranlassung, den letzten Wunsch seines Patienten zu unterlaufen.
„Danke, es hat sich erledigt, auf Wiederhören“, antwortete er und legte auf, ehe die Chefsekretärin Fragen stellen konnte. Er hatte getan, was in seiner Macht stand.
Schade, dachte er und blickte erneut zu dem Sinnspruch, der auf Patienten und deren Angehörige in vielen Situationen zutraf und der auch ihm schon oft Mut gemacht hatte.
Man konnte den Spruch je nach Fall verschieden auslegen. Bei Alexander Bergreiter hatte Dr. Holl gedacht, das Licht wäre die Versöhnung eines Sohnes mit seinen Eltern, doch das traf nicht zu. Das Licht stellte im Fall Bergreiter auch nicht die Rettung in letzter Minute dar. Das hätte sogar die Möglichkeiten der modernen Medizin bei weitem überstiegen.
Vielleicht war das Licht die Geburt des kleinen Sascha Fiebich, der noch rechtzeitig zur Welt gekommen war, dass sein Vater ihn sehen konnte.
Nein, verbesserte Dr. Holl sich in Gedanken. Das war nicht vielleicht, sondern ganz sicher das Licht, das neue Hoffnung geben sollte.
Alexander Bergreiter musste diese Welt verlassen, sah aber noch seinen kleinen Sohn, der soeben die Welt betreten hatte. Ein Teil von ihm würde in diesem Kind weiterleben.
Dr. Holl sah auf die Uhr. Es war Zeit, nach Hause zu fahren. Hier in der Klinik konnte er heute nichts mehr machen.
Verena Fiebich musste mit ihrem neugeborenen Sohn noch Alexander Bergreiter besuchen, und dabei sollte ein Arzt in ihrer Nähe sein. Dr. Holl hatte schon die entsprechende Anweisung erteilt, und er konnte sich auf seine Mitarbeiter verlassen. Er brauchte bei diesem Zusammentreffen nicht dabei zu sein.
„Das war es dann für heute, Moni“, sagte er zu seiner Sekretärin. „Wir sehen uns morgen.“
„Bis morgen, Herr Doktor“, erwiderte Moni Wolfram, die ebenfalls schon den Schreibtisch räumte. „Einen schönen Feierabend.“
„Ihnen auch“, erwiderte Dr. Holl und verließ sein Büro.
Auf dem Weg zu seinem Wagen fiel sein Blick zuerst auf die Tür, hinter der er Verena Fiebich wusste. Er kam an der Säuglingsstation vorbei, auf der Sascha lag. Und er passierte den Zugang zur Intensivstation, auf der Alexander Bergreiter im Sterben lag.
So dicht beisammen waren Tod und Leben, Hoffnungslosigkeit und Hoffnung, Trauer und Freude. Alles unter einem Dach in seiner Klinik.
Tief in Gedanken versunken verließ Dr. Holl seine Arbeitsstätte und hoffte nur, dass ihm gelang, was er dem jungen AIP geraten hatte – ein Patientenschicksal strikt von seinem Privatleben zu trennen.
***
Julia Holl stand schon vor dem Haus, in dem die Familie seit über zwanzig Jahren lebte, als ihr Mann eintraf. Das war nicht ungewöhnlich, weil sie oft wusste, wann er von der Arbeit in der Berling-Klinik heimkehrte. Meist rief er sie kurz an, wenn er sich auf den Heimweg machte.
Heute war allerdings etwas anders. Sie wartete nicht direkt vor dem Haus, sondern stand auf dem Bürgersteig. Erst als sie Stefans Wagen sah, kehrte sie in den Vorgarten zurück. Sobald der Wagen vor der Garage hielt, war Julia bei ihrem Mann.
„Was ist denn mit dir?“ Stefan stieg lächelnd aus. „Hast du mich schon so sehnsüchtig erwartet?“
„Ja“, entgegnete Julia und begrüßte ihn mit einem flüchtigen Wangenkuss. Allerdings war jetzt schon klar, dass nicht Sehnsucht nach dem Ehemann der Grund war. „Hat Chris gesagt, wo er noch hinfahren wollte?“
„Chris?“ Stefan runzelte die Stirn.
Marc war aus dem Haus gekommen. „Na, dein zweiter Sohn, Papa“, meinte er lässig.
„Ich weiß, wer Chris ist“, erwiderte Stefan und streifte den Zwanzigjährigen mit einem Blick. „Was ist mit Chris?“, fragte er seine Frau.
„War er nicht bei dir in der Klinik?“, fragte Julia beunruhigt. Als ihr Mann den Kopf schüttelte, seufzte sie. „Er wollte mit dem Rad in die Klinik fahren und dich besuchen. Danach sollte er sofort nach Hause kommen, weil er keine Hausaufgaben gemacht hat.“
„Und er ist noch immer nicht da“, folgerte Stefan aus den Worten seiner Frau. „Mach dir keine Sorgen, Julia, du kennst Chris doch!“
„Ja, eben“, entgegnete sie. „Genau darum mache ich mir Sorgen.“
„Der kurvt irgendwo in der Gegend herum und drückt sich nur vor den Hausaufgaben“, meinte Stefan.
„Genau“, bestätigte Marc.
„Das mit den Hausaufgaben kann sehr gut sein“, murmelte Julia nervös. „Aber das ist kein Grund, warum er sich nicht bei dir in der Klinik gezeigt hat.“
Stefan überlegte. Er war an diesem Nachmittag streckenweise sehr beschäftigt gewesen. Seine Mitarbeiter, die seine Familie kannten, hätten Chris dann bestimmt nicht zu ihm geschickt. Andererseits hätte man ihm ausgerichtet, dass sein Sohn in der Klinik auf ihn wartete oder dort gewesen war und nach seinem Vater gefragt hatte.
„Mach dir keine Sorgen“, bat Stefan erneut seine Frau, obwohl auch er sich jetzt sorgte. „Es ist ihm bestimmt nichts passiert.“
„Unkraut vergeht nicht“, bemerkte Marc. Bevor er sich dafür von seiner Mutter einen vorwurfsvollen Blick einhandelte, lächelte er zufrieden. „Na bitte, was habe ich gesagt?“
Chris bog in einem riskant engen Boden in die Einfahrt und bremste das Fahrrad neben seinen Eltern scharf ab.
„Hi, Papa! Hallo, Mama! Ihr kommt nie dahinter, was ich erlebt habe! Das erratet ihr nicht!“
Julia warf einen Blick in das vor Aufregung gerötete Gesicht ihres Sohnes und verlor die Nerven.
„Das erraten wir nicht, weil wir gar nicht raten werden!“, sagte sie ungewohnt scharf. „Wo hast du eigentlich deinen Verstand gelassen, Chris? Du wolltest kurz in die Berling-Klinik fahren und gleich wieder heimkommen. Ich warte hier und zermartere mir den Kopf, wo du steckst, und du …“
„Ich war …“, setzte Chris an.
„Dann kehrt auch noch dein Vater heim“, fuhr Julia fort und ließ Chris gar nicht erst zu Wort kommen. „Und er hat dich den ganzen Nachmittag nicht in der Klinik gesehen!“
„Na ja, ich war …“ Auch der zweite Erklärungsversuch des Jungen scheiterte.
„Ich sehe dich schon mit dem Rad unter einem Lastwagen und auf einem OP-Tisch liegen!“, fuhr Julia den Jungen an. „Und du kommst seelenruhig heim und denkst, es wäre alles in Ordnung!“
Chris war ziemlich kleinlaut und auch blass geworden.
„Also, so habe ich das nicht … wenn es wegen der Hausaufgaben …“
„Das ist ein großartiges Stichwort!“ Julia achtete nicht darauf, dass Marc sich heimlich ins Haus stahl. „Du verschwindest sofort in deinem Zimmer und machst die Hausaufgaben! Und du kommst erst herunter, wenn du fertig bist!“
Chris schluckte. „Das Abendessen …“
„Du hast vermutlich gehört, was ich gesagt habe.“ Julia merkte, dass ihr die Nerven durchgegangen waren, war jedoch noch viel zu aufgeregt, um zurückzustecken. „Ab!“
Chris wandte sich verstört an seinen Vater, der kein Wort gesagt hatte.
„Du hast deine Mutter gehört“, erklärte Stefan, noch ehe Chris ein Wort hervorbrachte. Der Junge drehte sich daraufhin um und verschwand im Haus. Und ausnahmsweise ging er die Treppe hinauf, ohne dass es sich anhörte, als würde ein Elefant durchs Haus tanzen.
„Ist es die Möglichkeit!“, murmelte Julia und merkte erst jetzt, dass Stefan den Arm um sie gelegt hatte.
Er fühlte, dass sie innerlich zitterte, und verstand sie nur zu gut. „Er hat nicht nachgedacht“, meinte Stefan beruhigend.
„Natürlich nicht!“, brauste Julia auf, die noch lange nicht die Verkrampfung und Angst abgebaut hatte. „Aber so geht es einfach nicht! Er muss lernen …“ Sie holte tief Atem und stieß ihn seufzend wieder aus.
„Es ist zum Glück nichts passiert.“ Stefan streichelte ihren Rücken. „Komm, gehen wir hinein.“
„Nein“, wehrte Julia ab und lehnte sich Halt suchend an ihn. „Mir könnte sonst dieser nicht nachdenkende Junge über den Weg laufen, und dann könnte ich in Gefahr geraten, ihm den Hals umzudrehen!“
„Aber, aber, Julia“, murmelte Stefan. „Was sind denn das für Gedanken? Passen sie vielleicht zu einer liebenden Mutter?“
„Nein.“ Julia fühlte, dass Stefan lautlos lachte, und musste ebenfalls lachen. „Sie passen zu einer Mutter, die vor Sorge fast durchgedreht ist.“
„Na, komm schon“, redete der Arzt auf sie ein. „Es ist nichts passiert, unser Sohn ist wieder daheim, und du hast ihn ordentlich zusammengestaucht. So schnell macht er so etwas nicht wieder.“
„Das will ich ihm auch geraten haben.“ Julia schüttelte den Kopf. „Dass Kinder sich nicht vorstellen können, wie Eltern denken!“
„Konnten wir das in dem Alter immer?“, hielt Stefan ihr vor.
„Ja!“, behauptete Julia im Brustton der Überzeugung und musste gleich darauf lachen. „Bin ich eine gute Lügnerin?“
„Nein, eine sehr schlechte sogar“, versicherte Stefan. „Aber eine liebenswerte.“ Er vertrieb die letzten Reste von Sorge und Aufregung mit einem Kuss. „Komm jetzt. Das Abendessen wartet.“
Julia nickte und betrat mit ihm das Haus, seufzte aber gleich darauf. „Ich habe die Wahl, meine eigene Entscheidung rückgängig zu machen und Chris zum Essen zu rufen, oder hart zu bleiben.“
Die Entscheidung wurde ihr abgenommen. Chris war keineswegs in seinem Zimmer verschwunden, sondern saß auf der Treppe. Als er seine Eltern sah, stand er auf, und das schlechte Gewissen sprang ihm förmlich aus den Augen.
„Mami, Papa“, begann er stockend und mit leicht gesenktem Kopf. „Es tut mir leid, ehrlich. Ich hatte völlig die Zeit vergessen und nicht daran gedacht, dass ihr euch Sorgen macht. Tut mir leid, das war echt oberätzend … ich meine, das war nicht gut von mir.“
Julia nickte. „Schön, dass du es einsiehst. Also, wasch dir die Hände und komm zum Essen.“
„Und die Hausaufgaben?“, fragte Chris zögernd.
„Die machst du hinterher – und zwar ohne Ausreden“, bestimmte sein Vater. „Beeil dich!“
Chris nickte und war froh, so leicht davongekommen zu sein. Marc sorgte allerdings noch für einen kleinen Denkzettel. Der Zwanzigjährige hatte mittlerweile mitbekommen, worum es ging, und versetzte seinem Bruder im Vorbeigehen eine Kopfnuss. Und die fiel nicht so harmlos und scherzhaft wie sonst aus. Chris biss allerdings die Zähne zusammen und gab keinen Laut von sich, weil er einsah, dass er totalen Mist gebaut hatte.
Er war auch so klug, beim Abendessen zu schweigen und vor allem nicht zu berichten, was er beim Zirkus Carossa erlebt hatte. Er vermutete mit gutem Recht, dass seine Eltern dann noch einmal an die Decke gegangen wären.
Still war es am Tisch trotzdem nicht. Das war es bei den Holls nie. Auch wenn Chris sich zurückhielt, waren immer noch seine kleine Schwester Juju und die Zwillinge Marc und Dani da, die dafür sorgten, dass die Unterhaltung nicht abriss.
Nur Stefan erzählte nichts aus der Klinik, und Julia wusste Bescheid. In der Berling-Klinik gab es zurzeit etwas, das ihren Mann belastete und über das er nicht sprechen wollte. An diesem Abend begnügte er sich damit, sein Familienleben zu genießen und daraus Kraft zu ziehen. Und darin bestärkte sie ihn, so gut sie konnte.
***
Dr. Jochen Hansen sah sich auf dem Korridor der Frauenstation um.
„Suchen Sie jemanden?“ Holger Strackmeier blieb neben dem jungen Assistenzarzt stehen.
„Eine Schwester oder einen Pfleger“, erwiderte Jochen Hansen. „Ich brauche einen Rollstuhl für Frau Fiebich. Ich möchte nicht, dass sie auf die Intensivstation geht.“
„Ach so.“ Der AIP war im Bilde. „Sie soll den Vater ihres Kindes besuchen.“
Jochen Hansen nickte. „Es bleibt vielleicht nicht mehr viel Zeit. Ich möchte sie lieber gleich zu ihm bringen. Wer weiß, ob morgen …“ Hansen ließ den Rest des Satzes ungesagt.
„Wir brauchen niemanden“, meinte Holger Strackmeier. „Ich weiß, wo ein Rollstuhl steht, und schieben kann ich ihn auch.“
„Werden Sie hier nicht gebraucht?“, fragte Hansen. „Dr. Holl sieht es nicht gern, wenn einer seiner Mitarbeiter seine Station verlässt.“
„Ich habe gleich Feierabend.“ Holger verschwand in einem Abstellraum und kam mit einem Rollstuhl wieder heraus. „Gehen wir.“
„Ich kann das auch übernehmen“, wehrte Dr. Hansen ab. „Wenn Sie Feierabend haben, halte ich Sie nicht auf.“
„Nein, ich …“ Der AIP zögerte. „Ich wäre gern dabei.“
Jochen Hansen war zwar überrascht, zuckte jedoch die Schultern. „Wie Sie meinen.“ Er hielt die Tür auf, und Holger schob den Rollstuhl zu Verena Fiebich ins Zimmer.
Sie hatte geweint. Man sah es ihr an, auch wenn sie die Tränen weggewischt hatte. Holger Strackmeier warf einen Blick auf sie, ging ins Bad und kam mit einem nassen Waschlappen heraus.
„Wozu denn?“ Verena Fiebich wusste, warum Dr. Hansen bei ihr war. „Ich fange doch ohnedies gleich wieder zu weinen an.“
„Vielleicht hilft es trotzdem“, meinte Holger und reichte ihr den Waschlappen, den sie sich gegen die Augen drückte.
Der Assistenzarzt und der AIP warteten eine Weile, bis Verena den Lappen zur Seite legte. Viel besser sah sie zwar nicht aus, aber sie hatte sich beruhigt.
Mithilfe der beiden Männer stieg sie aus dem Bett und ließ sich in den Rollstuhl sinken. Jochen Hansen öffnete wieder die Tür, und Holger Strackmeier schob die Patientin auf den Korridor.
„Brauchen Sie Hilfe?“ Schwester Annegret kam ihnen entgegen.
„Wir machen das“, entgegnete Holger und merkte nicht, dass ihm die alte Schwester anerkennend nachblickte. Sie wusste, dass er Feierabend hatte und seine Dienste freiwillig anbot.
Auf der Säuglingsstation warteten sie einen Moment. Schwester Olli brachte den kleinen Sascha, der im Moment friedlich schlief. „Er wird nicht so bald aufwachen“, flüsterte die Kinderschwester. „Hier, Frau Fiebich“, fügte sie mit einem aufmunternden Lächeln hinzu und legte der jungen Mutter das Neugeborene in den Arm.
Verena betrachtete das Kind, während sie sich der Intensivstation näherten. Sie versuchte, Stärke aus der Nähe dieses kleinen Wesens zu ziehen. Sie wusste, wie es um ihren Sascha stand, und sie wollte nicht, dass er in den letzten Stunden ihr trauriges Gesicht vor sich sah. Nicht Tränen sollten ihn verabschieden, sondern ein glückliches Lächeln wegen seines Sohnes.
Dr. Jochen Hansen klingelte. Schwester Maria öffnete, und sie betraten die Intensivstation.
„Der Patient ist wach“, sagte die Schwester leise. „Er meinte, er könnte jetzt nicht schlafen. Ich glaube, er wartet auf Sie“, fügte sie, an Verena Fiebich gewandt, hinzu.
Die junge Mutter hob den Kopf, und um ihren Mund spielte ein Lächeln. Der Anblick ihres Kindes hatte es hervorgerufen, und sie kämpfte darum, es nicht zu verlieren.
Holger Strackmeier beugte sich zu ihr. „Bereit?“, fragte er leise, und als sie nickte, schob er sie an Alexander Bergreiters Bett heran.
Alexander war tatsächlich wach und sah seiner Freundin und seinem Kind mit unnatürlich großen Augen entgegen. „Verena“, flüsterte er und versuchte, die Atemmaske abzunehmen.
Schwester Maria half ihm, da er kaum die Kraft hatte, die Hände zu heben.
„Zeig ihn mir, Verena“, bat Alexander.
„Hier, Sascha, das ist dein Sohn.“ Als Verena aufzustehen versuchte, wollte Dr. Hansen sie zurückhalten. Holger Strackmeier stützte sie jedoch, und Hansen verzichtete auf einen Einwand. „Das ist der kleine Sascha. Sascha junior.“
Verena zwang sich zu diesem glücklichen Lächeln, obwohl es sie fast mehr Energie kostete, als sie besaß. Alexander merkte nicht, dass sie nicht aus eigener Kraft stehen konnte. Er sah nicht, dass der AIP sie heimlich stützte und fast ihr ganzes Gewicht hielt. Er sah nur seinen Sohn.
„Sascha …“ Matt hob Alexander wieder die Hand, und Holger half Verena Fiebich, sich so weit herunterzubeugen, dass Alexander seinen neugeborenen Sohn berühren konnte.
Der Schwerkranke streichelte die Wange des Babys und berührte geradezu ehrfürchtig die winzigen Hände, die im Schlaf zu Fäusten geballt waren.
„Mein Sascha“, flüsterte er noch einmal und ließ die Hand wieder sinken. „Er ist schön, Verena. Wunderschön. Pass gut auf ihn auf.“
„Ja, Sascha, das mache ich“, sagte sie zu Alexander.
Dr. Hansen griff zu, als er merkte, dass sie Holger zu schwer wurde. Gemeinsam ließen sie die junge Mutter und ihr Kind wieder in den Rollstuhl sinken.
Alexander hatte die Augen geschlossen. Verena lächelte noch immer, als sie zu Hansen hochblickte. Dieses Lächeln war auf ihrem Gesicht erstarrt. Aber in ihren Augen stand eine ängstliche Frage.
„Er schläft“, sagte Dr. Hansen nach einem Blick auf die Anzeigen. „Wollen wir zurückfahren?“
Verena Fiebich nickte, und während Holger ihren Rollstuhl herumdrehte und hinausschob, sah sie ein letztes Mal zu Alexander, bis sich die Tür der Intensivstation schloss.
Auf dem Korridor war es um Verena Fiebichs Beherrschung geschehen. Dr. Hansen griff rechtzeitig zu und nahm ihr das Baby ab. Ihre Kraft war erschöpft. Sie schlug die Hände vor das Gesicht und weinte leise und verzweifelt.
Sie weinte auch noch, als die beiden jungen Ärzte ihr ins Bett halfen. Den kleinen Sascha hatten sie schon auf der Säuglingsstation abgegeben.
Schwester Annegret war ihnen unaufgefordert ins Patientenzimmer gefolgt. „Ich kümmere mich um sie“, versprach die alte Schwester, und da Dr. Hansen die verzweifelte Frau bei Annegret in den besten Händen wusste, winkte er Holger auf den Korridor hinaus.
„Ich bin in der Ambulanz“, sagte Dr. Hansen, den die Szene vorhin auch nicht unbeeindruckt gelassen hatte.
Holger nickte und schob den Rollstuhl zum Abstellraum zurück.
Zehn Minuten später blickte Dr. Jochen Hansen von dem Schreibtisch in dem kleinen Büro des Arztes der Ambulanz hoch, als jemand an die offene Tür klopfte.
„Kommen Sie herein“, forderte er den AIP auf, betrachtete den schweigenden Kollegen und nickte. „Geht einem ganz schön an die Nieren, nicht wahr?“ Spontan streckte Hansen ihm die Hand hin. „Ich heiße Jochen.“
„Holger.“ Nachdem sie einander die Hand gedrückt hatten, ließ Holger sich auf den Stuhl neben dem Schreibtisch sinken. „Dr. Holl sagte heute etwas von Abstand halten zu den Ereignissen, weil man es sonst nicht verkraftet. Wie macht man das?“
„Keine Ahnung, Holger, ich kann dir kein Patentrezept nennen“, gestand Jochen Hansen. „Ich bin noch dabei, es zu lernen. Es gelingt nicht immer. Manchmal denke ich, dass ich zu gleichgültig bin. Dann wiederum geht mir etwas tief unter die Haut wie diese Sache vorhin.“ Er zuckte die Schultern. „Ich weiß es nicht“, wiederholte er. „Wahrscheinlich gibt es kein Patentrezept.“
Der AIP schüttelte den Kopf. „Und wenn ich die Kurve nicht kriege? Ich habe mit Leidenschaft Medizin studiert, und ich möchte unbedingt als Arzt mit Patienten arbeiten. Ich will mich nicht in ein Labor zurückziehen oder in einem Verlag für medizinische Fachbücher arbeiten. Was soll ich tun, Jochen?“
Der Kollege überlegte. „Meistens ist es nicht so schlimm“, meinte er dann. „Die Arbeit besteht hauptsächlich aus Routine. Dabei fällt es einem leicht, mit den Kranken locker umzugehen und sie gleichzeitig als Menschen zu behandeln.“
„Und in Ausnahmefällen wie heute?“, warf Holger ein.
„Macht mir etwas zu große Probleme“, erwiderte Jochen Hansen, „unternehme ich hinterher etwas. Einen Ausflug, einen Kneipenbummel, eine Party – irgendetwas, das einen ablenkt.“
Holger stand bedrückt auf. „Dann werde ich wahrscheinlich nach Hause fahren und eine Flasche Wein köpfen.“
„Wenn es hilft.“ Jochen Hansen wollte den jüngeren Kollegen zum Ausgang begleiten, als Schwester Doris an ihnen vorbeiging.
„Auf der Intensivstation ist Alarm“, sagte sie zu Dr. Hansen. „Waren Sie nicht vorhin oben?“
Jochen Hansen und Holger Strackmeier sahen einander kurz an.
„Verständigen Sie mich, wenn ich in der Ambulanz gebraucht werde“, bat Dr. Hansen, bevor sie loseilten.
Dr. Donat war der in dieser Nacht für die Intensivstation zuständige Arzt. Er stand neben Alexander Bergreiter und untersuchte ihn. Schwester Maria hielt sich im Hintergrund.
„Was ist?“, fragte Dr. Hansen die Schwester.
„Herzstillstand“, erwiderte sie. „Dr. Donat war sofort zur Stelle.“
Dr. Jan Jordan warf einen beiden Kollegen einen Blick zu und schüttelte denn den Kopf. „Nichts mehr zu machen“, meinte er und wandte sich ab. „Der Chef hat es vorhergesehen.“
Holger Strackmeier räusperte sich. „Werden Sie … werden Sie es Frau Fiebich noch heute sagen?“
Dr. Jordan winkte ab. „Schwester Annegret hat vorhin berichtet, dass Frau Fiebich endlich mithilfe eines leichten Beruhigungsmittels eingeschlafen ist. Morgen ist auch noch ein Tag. Sie erfährt es früh genug.“
Jochen Hansen und Holger Strackmeier verließen die Intensivstation und trennten sich erst am Ausgang der Ambulanz.
„Flasche Wein daheim?“, fragte Jochen Hansen.
„Nein, Jochen.“ Der AIP holte tief Luft. „Jetzt brauche ich etwas mehr Zerstreuung. Ich versuche es mal mit einem Zug durch die Clubs.“
„Dann bis morgen.“ Jochen Hansen lehnte sich gegen den Türrahmen und blickte in den dunklen Garten der Berling-Klinik. Und er beneidete seinen jungen Kollegen darum, dass er sich ablenken konnte. Er musste wegen des Dienstes in der Berling-Klinik bleiben, und abgesehen von einem kurzen Schlaf im Bereitschaftsraum gab es keine Zerstreuung.
***
Dr. Stefan Holl wurde am nächsten Morgen von seiner Sekretärin wie üblich mit einer starken Tasse Kaffee erwartet. Außerdem hatte Moni Wolfram eine Neuigkeit für ihn.
„Herr Bergreiter ist gestern Abend gestorben“, berichtete sie. „Dr. Jordan hat Herzstillstand diagnostiziert.“
„War Frau Fiebich vorher bei ihm?“, fragte Dr. Holl.
Die Sekretärin nickte. Da das Personal in der Berling-Klinik über den Fall informiert war und an diesem Morgen über nichts anderes sprach, wusste sie bestens Bescheid. „Dr. Hansen und der AIP haben sie mit dem Kind zu Herrn Bergreiter gebracht. Er hat seinen Sohn gesehen.“ Sie wischte sich verstohlen über die Augen. „Ungefähr eine halbe Stunde später ist er gestorben.“
Dr. Holl zog sich mit dem Kaffee in sein Büro zurück. Er hatte den Eindruck gehabt, als wartete Alexander Bergreiter nur noch auf die Geburt seines Sohnes. Der Patient war schon so schwach gewesen, dass mit seinem Tod eigentlich viel früher zu rechnen gewesen wäre. Dr. Holl hatte allerdings mit niemandem über sein Gefühl gesprochen. Es war schließlich nur eine Ahnung gewesen.
Es klopfte, und Dr. Daniel Falk kam herein. Der Chefarzt der Chirurgischen Station der Berling-Klinik war Dr. Holls Freund und Stellvertreter, und er genoss bei der morgendlichen Besprechung Frau Wolframs Kaffee.
„Ist es wegen Herrn Bergreiter?“, fragte Daniel Falk, nachdem Moni Wolfram ihm eine Tasse gebracht und sich wieder zurückgezogen hatte. Daniel hatte die betrübte Miene der Sekretärin betrachtet und seine Schlüsse gezogen. „Heute wirken alle im Haus bedrückt.“
„Wundert dich das, Daniel?“, erwiderte der Klinikleiter.
„Nein, Stefan“, bestätigte sein Freund und nahm einen Schluck. „Es ist fast so, als hätte Herr Bergreiter nur darauf gewartet, sein Kind zu sehen.“
„Das Gefühl hatte ich auch“, gestand Stefan Holl. „Jetzt habe ich das Problem, wie ich mich den Eltern des Patienten gegenüber verhalten soll.“
„Verständige sie, was sonst?“, entgegnete Daniel Falk und erinnerte sich. „Waren sie nicht mit ihrem Sohn verfeindet?“
„Sie hatten ihn aus der Familie ausgeschlossen.“ Stefan überlegte. „Trotzdem sollten sie Bescheid wissen. Der Patient wollte es allerdings ausdrücklich nicht.“
„Dann halte dich an seinen Wunsch“, riet Daniel.
„Ich habe kein gutes Gefühl dabei.“ Stefan seufzte. „Ich will mich nicht in einen Streit einmischen. Das liegt außerhalb meiner Zuständigkeit. Übrigens sind die Eltern zurzeit in Südamerika.“
„Dann kannst du sie vorerst auch gar nicht verständigen, sehr einfach.“ Daniel winkte ab. „Es wird sich schon eine Lösung finden. Wie ist das mit dem Begräbnis? Wer kümmert sich darum, Stefan?“
„Ich spreche später mit Frau Fiebich“, entschied Stefan. „Vielleicht sehe ich danach klarer.“
Er besprach mit Daniel die wichtigsten Fälle in der Berling-Klinik. Nachdem Daniel Falk auf die Chirurgie gegangen war und vor der Visite auf der Frauenstation und der Inneren sah Dr. Holl nach dem kleinen Sascha.
„Es geht ihm ausgezeichnet.“ Schwester Irmgard, eine der Kinderschwestern der Klinik, hatte den Chefarzt zu dem Neugeborenen geführt. „Er war wach und hat gut getrunken. Die Mutter kann nicht stillen. Die Sorgen der letzten Wochen und jetzt der Kummer sind sicher schuld daran“, fügte sie betrübt hinzu.
„Hauptsache, dem Kind geht es gut“, meinte Dr. Holl. „Es hätte gerade noch gefehlt, wenn Frau Fiebich noch mehr Leid erfahren müsste.“
„Ja, sicher, Herr Chefarzt“, erwiderte Schwester Irmgard.
Wenig später stieß Dr. Holl zu der kleinen Gruppe, die ihn bei der Visite begleiten sollte. Als sein Blick auf den AIP fiel, ging er lächelnd auf diesen zu.
„Da Sie letzte Nacht keinen Dienst hatten, gibt es für die Ringe unter Ihren Augen vermutlich einen anderen Grund“, bemerkte Dr. Holl.
„Tut mir leid.“ Holger Strackmeier war sichtlich verlegen. „Das kommt nicht wieder vor.“
„Solange Sie keinen Restalkohol im Blut haben“, erwiderte der Klinikleiter mit einem warnenden Unterton in der Stimme, „und Sie nicht bei der Arbeit einschlafen oder Fehler machen, soll es mir recht sein.“
„Es ist nur so … ich war …“ Holger Strackmeier entschied sich für eine ehrliche Antwort. „Der Kollege Hansen hatte mir den Tipp gegeben. Wenn einem etwas unter die Haut geht, soll man sich ablenken. Ich habe mit ihm zusammen Frau Fiebich zu Herrn Bergreiter gebracht, und wir kamen dazu, als Dr. Jordan den Tod des Patienten feststellte. Daraufhin habe ich einen Zug durch etliche Clubs gemacht. Aber ich habe nicht zu viel getrunken“, fügte er hastig hinzu.
Dr. Holl nickte verständnisvoll. „Ich ziehe mich in den Kreis meiner Familie zurück, wenn es zu dick kommt. Jeder hat eben seine eigene Art, sich abzureagieren.“
„Also, die Zerstreuung wie letzte Nacht ist für mich nicht richtig“, meinte Holger Strackmeier. „Mir fehlt am nächsten Tag einfach der Schlaf. Wenigstens habe ich keinen dicken Kopf.“
„Verkaterte Mitarbeiter kann ich auch nicht gebrauchen.“ Dr. Holl glaubte zwar nicht, dass er bei diesem jungen Kollegen ausdrücklich darauf hinweisen musste, da Holger Strackmeier einen verantwortungsbewussten Eindruck machte. Aber er warnte lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. „Gut, dann wollen wir.“
Nachdem sie sich um die Patientinnen in einigen Zimmern der Frauenstation gekümmert hatten, sprach Holger Strackmeier den Chefarzt an. „Sie sind an Frau Fiebichs Tür vorbeigegangen.“
Dr. Holl beantwortete bereitwillig die indirekte Frage. „Heute mute ich ihr keine Visite zu. Ich werde mich nachher unter vier Augen mit ihr unterhalten. Das ist für sie bestimmt leichter.“
Der AIP schätzte den Leiter der Berling-Klinik bereits nach der kurzen Zeit, die er hier arbeitete. Eine derartige Rücksichtnahme, wie Dr. Holl sie soeben gezeigt hatte, steigerte noch seine gute Meinung über den Chefarzt.
Eine Stunde später klopfte Dr. Holl an Verena Fiebichs Zimmertür und trat ein. Die junge Frau lag im Bett und war wach. Soweit er sehen konnte, weinte sie nicht. Überzeugen konnte er sich allerdings erst im Näherkommen, da die Vorhänge geschlossen waren. Trotz des Sonnenscheins am Vormittag herrschte Dämmerlicht im Raum.
Dr. Holl holte sich einen Stuhl heran und setzte sich. Und er überließ es der Patientin, das Gespräch zu eröffnen.
„Er hat nur auf seinen Sohn gewartet“, sagte sie schließlich mit brüchiger Stimme.
„Ja, offenbar.“ Er selbst hatte schon so gedacht, Daniel hatte diese Vermutung ausgesprochen, und jetzt hatte auch Frau Fiebich den gleichen Gedanken. „Ich bin sehr froh, dass er den Kleinen noch gesehen hat.“
„Ja.“ Verena Fiebich nickte und blickte starr auf die Bettdecke. „Es hat ihn noch einmal glücklich …“ Sie konnte nicht weitersprechen und presste ein Taschentuch gegen die Augen. „Entschuldigen Sie“, flüsterte sie erstickt.
Dr. Holl legte ihr die Hand auf den Arm. „Da gibt es nichts zu entschuldigen“, versicherte er behutsam. „Jeder hat Verständnis für Ihren Kummer.“
Er wartete darauf, dass sie sich beruhigte. Am liebsten hätte er gar nicht über schmerzliche Dinge gesprochen, doch er spannte den Bogen seiner Verantwortung manchmal über den Tod eines Patienten hinaus.
Es dauerte eine Weile, bis Verena Fiebich sich an den Klinikleiter wandte. „Warum sind Sie bei mir? Wollen Sie mich untersuchen?“ Als Dr. Holl den Kopf schüttelte, nahm sie sich sichtlich zusammen und versuchte, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. „Worum geht es? Ist etwas wegen der Vaterschaft zu regeln? Hat es mit dem Baby zu tun?“
„Nein. Frau Fiebich“, begann Dr. Holl, „Sie und Herr Bergreiter haben mich in groben Zügen über das Zerwürfnis mit seinen Eltern informiert. Ich bin nun in der schwierigen Lage, dass ich die Eltern meines verstorbenen Patienten verständigen sollte … allein schon wegen des Begräbnisses“, fügte er vorsichtig hinzu.
„Nein“, wehrte Verena Fiebich heftig ab. „Als Sascha krank wurde, schrieb er es seinen Eltern. Er nannte ihnen auch die Diagnose. Wissen Sie, was sie zurückgeschrieben haben?“
Obwohl er es ohnedies nicht wissen konnte, schüttelte Dr. Holl den Kopf.
„Es würde ja wohl nichts daran ändern, dass er mit mir zusammen wäre“, berichtete Verena Fiebich bitter. „Die Einstellung seiner Eltern würde sich auch durch seine Krankheit nicht ändern. Er könne jederzeit in den Schoß der Familie zurückkehren. Das zitiere ich wörtlich“, betonte sie. „Die Bedingung wäre aber unverändert – nämlich, dass er sich von mir trennt.“
Dr. Holl seufzte. „Was war denn an dieser Beziehung so schlimm, wenn ich fragen darf?“
„Sie dürfen.“ Verena Fiebich ließ den Kopf in die Kissen sinken und starrte zur Zimmerdecke. „Die Bergreiters sind reich und wohnen in einer tollen Villa, und ich bin eine Verkäuferin. Ich war nicht gut genug für ihren Sohn Alexander. Sascha hat mich aufrichtig geliebt … und ich ihn“, flüsterte sie und benutzte dabei wieder den Kosenamen für ihren verstorbenen Freund. „Er hat den Bruch mit seinen Eltern auf sich genommen. Anstatt in das Familienunternehmen einzusteigen, hat er sich eine Stellung bei einem Steuerberater gesucht. Wir waren trotzdem glücklich. Fast zwei Jahre lang.“
„Und jetzt?“, erkundigte sich Dr. Holl.
„Ich kehre mit dem kleinen Sascha in unsere bescheidene Wohnung zurück und werde ihn großziehen, wie das viele alleinstehende Mütter machen.“ Verena Fiebich wischte sich noch einmal über die Augen. „Es wird nicht leicht sein, aber ich werde es schaffen.“
Dr. Holl räusperte sich. „Was nun das Nächstliegende angeht“, sagte er, weil es geklärt werden musste.
Verena Fiebichs Gesicht wurde zu einer starren Maske. „Wir haben in den zwei Jahren gespart“, sagte sie sehr beherrscht. „Wir wollten uns, wenn das Kind da ist, eine größere Wohnung nehmen. Als Sascha ahnte, dass er diese Krankheit nicht überlebt, bestimmte er, dass ich das Geld für sein Begräbnis ausgebe. Und er verlangte von mir, dass seine Eltern nicht verständigt werden. Verstehen Sie, Herr Dr. Holl? Sie sollen nicht verständigt werden“, wiederholte sie. „Sascha wollte das so. Und ich will es auch.“
„Nun gut.“ Dr. Holl stand auf. „Wenn Sie etwas brauchen, können Sie sich an jeden Mitarbeiter meiner Klinik wenden. Und an mich natürlich auch“, fügte er hinzu. „Das gilt übrigens nicht nur für die Zeit Ihres Aufenthalts in der Berling-Klinik. Wir lassen nie jemanden im Stich.“
„Danke.“ Das eine Wort klang ziemlich schroff, doch Dr. Holl kannte den Grund. Verena Fiebich beherrschte sich nur noch mit größter Mühe.
Als er auf den Korridor trat und hinter sich die Tür leise schloss, hörte er sie schon wieder weinen.
***
„Der Zirkus ist weg“, sagte Chris Holl wenige Tage später während des Abendessens.
Stefan Holl blickte von seinem Teller hoch und sah seinen jüngeren Sohn erstaunt an. „Zirkus? Was denn für ein Zirkus?“
„Papa, habe ich dir das nicht erzählt?“, fragte Chris erstaunt.
Stefan schüttelte den Kopf, und Julia meinte: „Ich weiß auch nichts von einem Zirkus.“
„Oh.“ Chris senkte den Kopf. Erst jetzt erinnerte er sich daran, dass er wegen der Explosion seiner Mutter nach seinem ersten Besuch beim Zirkus geschwiegen hatte. „Ja, also“, sagte er dann, „auf der großen Wiese zwischen hier und der Klinik stand ein Wanderzirkus. Zirkus Carossa. Ich war ein paar Mal da, wenn ich zufällig mit dem Rad vorbeikam.“
„Zufällig?“, wiederholte Marc. „Das einzige, was bei dir zufällig ist, ist eine gute Note in Mathe.“
„Ha, ha“, entgegnete Chris genervt. „Du bist vielleicht ätzend!“
„Was war mit diesem Zirkus?“, erkundigte sich Stefan. „War da etwas Besonderes?“
„Nö.“ Chris zuckte die Schultern. „Er ist heute weitergezogen. Das ist alles.“
Julia hatte zwar den Eindruck, dass ihr Sohn nicht alles erzählte, sah ihm jedoch an, dass er nicht mit der Sprache herausrücken wollte.
„Ich hätte mir gern den Zirkus angesehen“, erklärte die elfjährige Juju und wandte sich an Chris. „Warum hast du nichts erzählt?“
„Mann, an Bäumen und Plakatwänden klebten ohnedies die Plakate“, wehrte Chris ab. „Ich dachte, du kannst schon lesen.“
„Kann ich auch“, erwiderte Juju, ohne beleidigt zu sein. „Aber ich habe die Plakate nicht gesehen.“
„Ich erinnere mich“, warf Dani ein. „Aber ich habe mich nicht dafür interessiert. Zirkus finde ich langweilig.“
„Zirkus und langweilig?“ Chris schnappte nach Luft. „Hast du vielleicht schon mal einen Gummi-Menschen gesehen?“
„Ja, dich“, sagte Marc lachend. „Wenn du wie ein Fragezeichen irgendwo lehnst. Deine Knochen müssen aus Gummi sein. Kein normaler Mensch kann eine solche Haltung einnehmen, du Zwerg.“
„Ha, ha“, sagte Chris wie vorhin.
Julia staunte. Es hätte Chris ähnlich gesehen, auf die Stichelei seines Bruders wegen seiner Haltung in die Luft zu gehen. Und den Ausdruck „Zwerg“ ließ er sich sonst nie gefallen. Heute schwieg er. Julia nahm sich vor, die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern bei Gelegenheit nachzuhaken.
Vorerst berichtete Juju die neuesten Ereignisse in ihrer Klasse, und Marc und Dani gaben etwas aus ihrer Schule wieder. Chris blieb schweigsam. Die Sprache kam nicht mehr auf den Zirkus.
„Chris war merkwürdig“, stellte Julia fest, als sie am späteren Abend mit ihrem Mann einen Spaziergang durch die umliegenden Straßen des Villenviertels unternahm.
„Findest du?“, fragte Stefan. „Mir ist eigentlich nur aufgefallen, dass er wie üblich Unmengen Essen in sich hineinschaufelt, ohne zuzunehmen.“
„Stimmt, aber er hat wenig gesprochen und diesen Zirkus nur kurz erwähnt“, meinte Julia. „Ich hatte den Eindruck, dass er uns mehr berichten wollte, es aber nicht wagte. Vielleicht war es ihm unangenehm.“
„Chris ist nicht auf den Mund gefallen“, versicherte Stefan. „Wenn ihn etwas bedrückt, redet er darüber.“
„Und wenn er nach seinem Vater gerät?“ Julia hakte sich bei Stefan unter. „Der redet auch nicht über alles, das ihn bedrückt.“
Stefan wusste sofort, worauf sie anspielte. Nach so vielen gemeinsamen Jahren erriet jeder von ihnen die Gedanken des anderen.
„Ich erzähle nie beim Essen traurige Geschichten“, wehrte er ab und gab gleich eine Erklärung für die Stimmung, die Julia ihm angemerkt hatte. „Heute wurde Alexander Bergreiter begraben.“
Julia war im Bild, wer das war und unter welchen Umständen er gestorben war. „Haben seine Eltern teilgenommen?“
Stefan schüttelte den Kopf. „Verena Fiebich hat mich hinterher angerufen und sich noch einmal für alles bedankt. Nein, die Eltern wissen wohl noch gar nichts vom Tod ihres Sohnes. Vielleicht sind sie noch in Südamerika.“
„Und wie erfahren sie davon?“ Julia seufzte. „Solche Familienstreitigkeiten sind schrecklich. Es geht aber nicht, dass diese Leute nicht erfahren, was passiert ist.“
„Es nimmt den Behördengang“, sagte Stefan. „Ich habe nichts mehr damit zu tun. Irgendwann erfahren sie es. Ich meine, sie haben es sich selbst zuzuschreiben. Ihr Sohn hat sie verständigt, als er erkrankte. Es hat sie nicht umgestimmt.“
„Und das alles nur, weil der junge Mann sich für eine Verkäuferin entschieden hat?“, fragte Julia ungläubig.
„Wenn ich Frau Fiebich glaube, war das der einzige Grund“, bestätigte er.
„Und wie geht es Mutter und Kind?“, erkundigte sich Julia. „Beiden gut?“
Stefan nickte. „Ich habe sie gestern entlassen. Frau Fiebich wollte nach Hause, und ich hatte keinen Einwand.“
„Und wie macht sie es mit dem Säugling und ohne Mann?“, fragte Julia besorgt.
Stefan legte ihr lächelnd den Arm um die Schultern. „Das ist typisch für dich. Du sorgst dich um wildfremde Menschen.“
„Du vielleicht nicht?“, entgegnete Julia.
Stefan schmunzelte, wurde aber wieder ernst. „Frau Fiebich hat mir versichert, dass sie zurechtkommt. Mehr kann ich nicht sagen oder unternehmen.“
„Aber du hast ihr jederzeit Hilfe angeboten“, vermutete Julia, die ihren Mann nur zu genau kannte.
„Ja“, erwiderte Stefan schlicht. „Hoffentlich nimmt sie das Angebot auch an, falls es einmal nötig sein sollte.“
„Hoffen wir lieber, dass es nie nötig sein wird.“ Julia sah auf die Uhr. „Ich denke, dass ich auf die Rückkehr nach Hause drängen sollte, weil ich mit einem vielbeschäftigten Arzt verheiratet bin.“
„Klug und fürsorglich wie immer.“ Stefan beugte sich zu seiner Frau und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. „Ja, gehen wir nach Hause.“
Am nächsten Morgen herrschte ziemliche Hektik im Haus, weil Chris und Juju verschlafen hatten und erst von ihrer Mutter geweckt werden mussten. Julia hatte es lieber, wenn ihre Kinder von sich aus auf den Wecker achteten, damit sie später, wenn sie selbstständig waren, schon daran gewöhnt waren. Es gab nicht immer eine Mutter, die sich um alles kümmerte.
Chris und Juju schlangen noch das Frühstück in sich hinein, und Marc und Dani brachen langsam zum Unterricht auf, als Stefan Holl bereits zur Berling-Klinik fuhr.
Heute hatte Moni Wolfram außer einer Tasse Kaffee nichts für ihn parat. Die tägliche Morgenbesprechung mit Daniel Falk brachte auch nichts Ungewöhnliches. Der Klinikleiter wollte schon sein Büro verlassen und mit der Arbeit auf der Station beginnen, als Moni Wolfram einen Anruf zu ihm durchstellte.
„Herr Bergreiter“, meldete sie und klärte: „Johannes Bergreiter von den Bergreiter-Werken.“
Dr. Holl nahm das Gespräch an und meldete sich.
„Ich bin heute nach einer geschäftlichen Auslandsreise zum ersten Mal wieder in der Firma“, sagte Herr Bergreiter kühl und distanziert. „Meine Chefsekretärin hat vor einiger Zeit einen Anruf von Ihnen erhalten. Sie haben nicht genauer ausgeführt, worum es geht. Meine Firma hat mit Ärzten und Krankenhäusern nichts zu tun. Könnten Sie mir den Grund Ihres Anrufs erläutern?“
„Sicher.“ Dr. Holl machte sich seinen eigenen Reim auf diese Nachfrage. Der Leiter eines großen Betriebes hätte sich normalerweise garantiert nicht um den Anruf aus der Berling-Klinik gekümmert. Vor allem hatte Dr. Holl keine Nachricht hinterlassen und nicht einmal angedeutet, worum es ging. Vermutlich ahnte Johannes Bergreiter, dass es mit seinem Sohn zusammenhing. „Ich schlage vor, Sie kommen her.“
„In die Berling-Klinik?“, fragte Johannes Bergreiter erstaunt. „Wozu das?“
„Um mit mir zu sprechen“, entgegnete Dr. Holl, der die Todesnachricht nicht unbedingt am Telefon übermitteln wollte. „Ich denke, das wäre angebracht“, fügte er noch hinzu.
Am anderen Ende herrschte sekundenlang Stille. „Ich bin gegen elf bei Ihnen“, entschied Herr Bergreiter.
Dr. Holl warf einen Blick auf einen eigenen Terminkalender. „Halb zwölf“, korrigierte er.
Sie einigten sich auf diesen Zeitpunkt, und der Chefarzt der Berling-Klinik kümmerte sich um seine Pflichten, bis ihn Schwester Annegret zwanzig nach elf informierte, dass Herr Bergreiter in seinem Büro auf ihn wartete.
„Ist das der Vater des verstorbenen Alexander Bergreiter?“, fragte die alte Schwester und seufzte, als Dr. Holl nickte. „Zu spät“, meinte sie nur. „Manche Leute kommen leider nicht rechtzeitig zur Einsicht.“
„Ja, das wird eine späte Einsicht, Annchen“, erwiderte Dr. Holl und ging zu seinem Büro.
Moni Wolfram hatte dem Besucher bereits Platz an der Sitzgruppe im Chefzimmer angeboten. Als Dr. Holl eintrat, schloss sie die Verbindungstür.
„Worum geht es?“, fragte Johannes Bergreiter ohne Umschweife nach der Vorstellung und Begrüßung.
„Um Ihren Sohn, wie Sie wahrscheinlich schon vermuten“, entgegnete Dr. Holl und wartete auf die Reaktion seines Gegenübers.
Johannes Bergreiter war Mitte fünfzig, dunkelhaarig mit grauen Schläfen. Er trug keine Brille, und seine Augen wirkten scharf und durchdringend. Nicht nur wegen des dunklen Anzugs strahlte er Autorität aus. Er war ein Mann, der gewohnt war zu befehlen. Die Ähnlichkeit mit seinem Sohn war nicht zu übersehen.