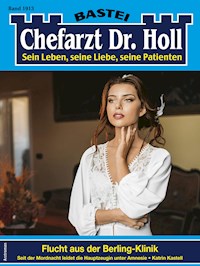5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Willkommen zur privaten Sprechstunde in Sachen Liebe!
Sie sind ständig in Bereitschaft, um Leben zu retten. Das macht sie für ihre Patienten zu Helden.
Im Sammelband "Die besten Ärzte" erleben Sie hautnah die aufregende Welt in Weiß zwischen Krankenhausalltag und romantischen Liebesabenteuern. Da ist Herzklopfen garantiert!
Der Sammelband "Die besten Ärzte" ist ein perfektes Angebot für alle, die Geschichten um Ärzte und Ärztinnen, Schwestern und Patienten lieben. Dr. Stefan Frank, Chefarzt Dr. Holl, Notärztin Andrea Bergen - hier bekommen Sie alle! Und das zum günstigen Angebotspreis!
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Chefarzt Dr. Holl 1831: Er war die Liebe ihres Lebens
Notärztin Andrea Bergen 1310: Wie konntest du so leichtsinnig sein?
Dr. Stefan Frank 2264: Ärztin ohne Gewissen
Dr. Karsten Fabian 207: Ein Märchen endet viel zu früh
Der Notarzt 313: Atemnot auf dem Sportplatz
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 320 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2016/2018 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © Halfpoint / Shutterstock
ISBN: 978-3-7517-6480-3
https://www.bastei.de
https://www.sinclair.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Die besten Ärzte - Sammelband 66
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Chefarzt Dr. Holl 1831
Er war die Liebe ihres Lebens
Die Notärztin 1310
Wie konntest du so leichtsinnig sein?
Dr. Stefan Frank 2264
Ärztin ohne Gewissen
Dr. Karsten Fabian - Folge 207
Die wichtigsten Bewohner Altenhagens
Ein Märchen endet viel zu früh
Der Notarzt 313
Atemnot auf dem Sportplatz
Guide
Start Reading
Contents
Er war die Liebe ihres Lebens
Doch nie wird ihr sein ganzes Herz gehören
Von Katrin Kastell
Silbernes Mondlicht fällt durch die Lamellen der Jalousie und zeichnet weiche Linien auf Klaus’ im Schlaf entspanntes, männliches Gesicht. Schon seit Stunden beobachtet die schöne Krankenschwester Miriam den schlafenden Geliebten, und ihr Herz ist voll und weit vor Liebe zu ihm. Keinen einzigen Tag in ihrem Leben will Miriam noch ohne ihn sein, keinen einzigen Morgen ohne ihn aufwachen! Doch auch in dieser Nacht wird Klaus wieder den Namen jener anderen murmeln, die vor Miriam die Frau an seiner Seite war und die er nicht vergessen kann: Sabine …
Miriam Spengler strich die Schwesternkleidung glatt, ehe sie den Aufenthaltsraum betrat. Die Stimme der Oberschwester der Klinik Borström war deutlich zu hören, und die Oberschwester stand nicht auf Knitterfalten oder schlampige Kleidung.
Im Aufenthaltsraum warf Schwester Miriam ihrer Vorgesetzten jedoch nur einen flüchtigen Blick zu, weil sie Robbi entdeckte. Sofort erschien auf ihrem Gesicht ein strahlendes Lächeln. Schließlich liebte sie den Pfleger so sehr, dass sie gestern von einer gemeinsamen Zukunft gesprochen hatte.
Robbi erwiderte ihr Lächeln jedoch nicht, sondern gab ihr einen Wink.
„Wir sind auf dem Korridor, wenn Sie uns brauchen“, sagte er zur Oberschwester und verließ mit Miriam den Aufenthaltsraum.
„Was ist denn, Schatz?“, fragte Miriam leise. Seine ernste Miene machte ihr Sorgen. „Ist was passiert?“
„Nein, das nicht.“ Robbi sah nach links und rechts, als suchte er etwas, dann wich er ihrem Blick aus. „Es ist nur … also, ich habe nachgedacht … was du gesagt hast von wegen Heirat und so weiter.“
„Ja, und?“ Wieso machte er bloß so ein verschlossenes Gesicht!
„Ich … Miriam, tut mir leid, aber …“ Robbi holte tief Atem. „Also, das ist nichts für mich. Du willst es, und das ist auch in Ordnung, aber nicht für mich! Und darum machen wir besser ganz Schluss, bevor es den Bach runtergeht.“
Miriam sah ihn geschockt an. Mit allem hatte sie gerechnet, nur damit nicht. Sie war so verstört, dass sie nicht einmal die Oberschwester bemerkte, die zu ihnen kam und etwas sagte.
Vor den Augen der verblüfften Oberschwester drehte sie sich um und lief weg, damit niemand ihre Tränen sah.
***
„Guten Morgen, Herr Dr. Lassow“, grüßte die Chefsekretärin den Besitzer und Leiter der renommierten Münchner Anwaltskanzlei.
„Schönen guten Morgen“, erwiderte Dr. Axel Lassow freundlich und warf auf dem Weg zu seinem Büro einen fragenden Blick auf seine rechte Hand. „Etwas Besonderes oder Dringendes?“
„Nein, Herr Doktor“, entgegnete seine Assistentin. „Herr Dr. Holl von der Berling-Klinik hat angerufen, aber Sie brauchen ihn nicht zurückzurufen. Ihr Schwager hat erwähnt, dass einer seiner Patienten die Dienste unserer Kanzlei in Anspruch nehmen möchte.“
„Ach ja, gut“, erwiderte Axel Lassow lächelnd. „Worum geht es? Hat mein Schwager das gesagt?“
„Ein Testament“, erwiderte seine Assistentin. „Ein sehr reicher älterer Herr, der wohl eine schlimme Diagnose erhalten hat und jetzt seinen Nachlass regeln möchte.“
„Warum die Leute das nicht schon viel früher machen?“, meinte Axel Lassow kopfschüttelnd. „Wie leicht gibt es im Todesfall Streit, wenn nur wenig oder gar kein Geld vorhanden ist! Umso mehr Streit entsteht, wenn es Vermögen gibt.“
Seine Assistentin zuckte die Schultern. „Die übliche Scheu der Leute vor einem Testament, als würden sie durch eine Regelung des Nachlasses ihren vorzeitigen Tod herbeirufen. Wer soll sich um die Sache kümmern? Wollen Sie selbst …?“
„Bloß nicht!“, fiel Axel Lassow ihr ins Wort. „Ich bin schon bis über beide Ohren mit Arbeit eingedeckt. Kollegin Kasinski soll das übernehmen und in die Berling-Klinik fahren. Ach ja“, fügte er hinzu, als seine Assistentin schon zum Büro von Dr. Luise Kasinski gehen wollte, „bitte noch heute Vormittag. Wenn mein Schwager persönlich anruft, eilt es vermutlich.“
Die Assistentin nickte und betrat gleich darauf das Büro der mit Anfang dreißig noch ziemlich jungen Rechtsanwältin.
„Dr. Lassow möchte, dass Sie noch heute Vormittag in die Berling-Klinik fahren, um mit einem Patienten ein Testament aufzusetzen“, richtete sie aus. „Dr. Holl wird Ihnen sagen, um wen es sich handelt.“
Luise Kasinski blickte unwillig von einer Akte auf, in die sie sich soeben vertieft hatte.
„Und wer ist Dr. Holl?“, fragte sie leicht gereizt, weil sie unter starkem Zeitdruck stand.
„Dr. Holl?“ Die Chefassistentin sah sie an, als käme Luise Kasinski von einem anderen Stern. „Nun, das ist der Schwager unseres Chefs. Dr. Stefan Holl, Leiter der Berling-Klinik. Von der haben Sie doch wenigstens gehört, oder?“
„Eine Privatklinik für Reiche hier in München, nicht wahr?“, erwiderte Luise Kasinski nervös.
„Privatklinik in München stimmt, aber in der Berling-Klinik werden auch ‚normale‘ Kassenpatienten behandelt“, belehrte die Chefassistentin die junge Anwältin. „Es ist ein ganz normales Krankenhaus für …“
„Ja, danke.“ Luise drückte eine Taste an dem Sprechgerät auf ihrem Schreibtisch. „Ich brauche Sie, Nelly“, sagte sie knapp und störte sich nicht daran, dass die Chefassistentin sichtlich eingeschnappt hinausging.
Nelly Heiler, als Sekretärin für Dr. Luise Kasinski zuständig, erschien unmittelbar darauf im Büro. „Guten Morgen“, grüßte die Dreiundzwanzigjährige.
Luise Kasinski nickte und blickte schon wieder in die Akte.
„Rufen Sie in der Berling-Klinik an“, verlangte sie gereizt. „Dr. Holl ist der Klinikleiter. Bringen Sie Namen und Zimmernummer des Mannes in Erfahrung, der ein Testament wünscht! Und bitte rasch!“, fügte sie hinzu und blätterte in der Akte weiter, weil sie eine wichtige Passage suchte.
Dr. Luise Kasinski war so in ihre Arbeit vertieft, dass sie nicht den bösen, geradezu hasserfüllten Blick ihrer Sekretärin sah. Hätte sie es getan, wäre sie mit Sicherheit zutiefst erschrocken.
***
Im Haus der Familie Vrede herrschte jeden Morgen die gleiche Hektik. Karl Vrede legte großen Wert darauf, als Abteilungsleiter in seiner Firma pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Seine Frau Hannelore nahm als Leiterin einer Schneiderwerkstatt die gleiche Haltung ein. Nur Sohn Bertram konnte den Zeitplan etwas lockerer angehen, da er gerade erst mit dem Studium begonnen hatte.
Trotzdem waren alle drei froh, dass sie seit einem Jahr die Oma im Haus hatten, die mit ihren achtzig Jahren noch so rüstig war, dass sie leichte Hausarbeiten übernehmen konnte – und vor allem wollte.
„Ist der Kaffee auch nicht zu stark?“ Walburga Vrede trat an den Frühstückstisch und blickte in die Runde. „Ich würde euch ja lieber Früchtetee machen, aber ihr wollt unbedingt Kaffee haben.“
„Ja, Oma, den brauchen wir auch, um richtig wach zu werden“, versicherte Karl Vrede lächelnd.
„Willst du dich nicht zum Frühstück zu uns setzen?“, drängte Hannelore Vrede ihre Schwiegermutter, obwohl sie seit einem Jahr vergeblich versuchte, die zierliche alte Dame morgens an den Tisch zu holen.
„Nein, nein, ich bleibe lieber in Bewegung“, wehrte Walburga Vrede auch diesmal ab. „Esst ihr in Ruhe fertig. Ich habe schon gefrühstückt, bevor ihr aufgestanden seid.“
„Von wegen Ruhe.“ Karl Vrede sah auf die Uhr, schob sich hastig den letzten Bissen in den Mund und spülte mit Kaffee nach. „Ich muss los.“
„Nimmst du wieder kein Pausenbrot mit?“, fragte seine Mutter, als wäre ihr Sohn fünfzehn und nicht schon fünfundfünfzig.
„Nein, sicher nicht“, erwiderte Karl, verabschiedete sich von seiner Mutter und seiner Frau mit Wangenküssen und klopfte seinem Sohn auf die Schulter. „Macht’s gut! Bis heute Abend.“
„Ich gehe auch.“ Hannelore Vrede hatte sich mit dem Essen etwas mehr Zeit gelassen, doch wenige Minuten nach ihrem Mann verabschiedete auch sie sich von Schwiegermutter und Sohn.
„Willst du noch etwas?“, fragte Walburga Vrede.
Bertram nickte. „Wenn du Kaffee hast, Oma“, sagte der Neunzehnjährige fröhlich. „Ich hätte nie gedacht, dass ein Technikstudium dermaßen trocken und langweilig anfangen könnte. Darum brauche ich eine Extraportion Koffein, um nicht im Hörsaal einzuschlafen.“
„Willst du nicht lieber einen gesunden Früchtetee, Junge?“, fragte die alte Frau kopfschüttelnd, kam aber bereits mit der Kaffeekanne an den Tisch und schenkte nach.
„Nein, Oma, dein Kaffee ist der beste, den es gibt“, versicherte Bertram. Er liebte seine Großmutter und ging jederzeit bereitwillig auf ihre ganz kleinen Marotten ein, zu denen die ständigen Versuche gehörten, ihre Familie vom Kaffee wegzuführen. „Allerdings habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, wenn du mich ständig bedienst. Ich kann das auch alles selbst machen.“
„Nein, nein, bleib nur sitzen und spar dir deine Kräfte für das Studium auf!“ Walburga Vrede stellte die Kaffeekanne auf die Arbeitsfläche neben der Spüle zurück und schüttelte leicht den Kopf.
Bertram hatte zur Zeitung gegriffen und las bei der letzten Tasse Kaffee. Daher bemerkte er nicht, wie ihn seine Großmutter lange eingehend und leicht verwirrt betrachtete.
Walburga Vrede überlegte. Ihr Sohn Karl und seine Frau … wie hieß sie doch gleich … Karl und seine Frau hatten schon gefrühstückt und waren gegangen. Aber wer war der große Junge am Tisch? Wer war das bloß?
Bertram faltete die Zeitung zusammen und stand auf. „Hier, die lasse ich dir zum Lesen da, Oma“, sagte er und warf die Zeitung neben die Kaffeekanne. „Damit kannst du dir die Zeit vertreiben.“
„Ja, danke“, erwiderte Walburga. „Ich mache mir dazu eine Tasse Früchtetee.“ Vielleicht fiel ihr dann wieder ein, wer der Junge war, der sich so nett von ihr verabschiedete und sie „Oma“ nannte. Ihr Sohn Karl und seine Frau sagten auch „Oma“ zu ihr. Merkwürdig …
„Bis später!“, rief Bertram, winkte, griff nach seinem modischen Rucksack und verließ das Haus.
Walburga Vrede wartete, bis sich die Tür geschlossen hatte. Dann machte sie sich auf die Suche nach Hermann, der schließlich auch aufstehen und zur Arbeit gehen musste. Aber sie fand Hermann nicht, obwohl sie in jeden Raum des Hauses blickte.
Verunsichert saß die alte Frau schließlich allein am Küchentisch und überlegte angestrengt, wieso sie ihren Mann nicht gefunden hatte. Ob er schon zur Arbeit gegangen war, ohne ihr Bescheid zu sagen? Diese Frage verdrängte sogar die Unsicherheit, was diesen großen Jungen anging, der sich vorhin verabschiedet hatte.
Nach einer Tasse Früchtetee und der Zeitungslektüre setzte Walburga Vrede sich aufs Sofa im Wohnzimmer und machte ein Nickerchen. Um die Mittagszeit wurde sie wieder wach und überlegte.
Ja, sie hatte genug Zeit, um das Grab ihres schon lange verstorbenen Mannes Hermann zu besuchen und danach das Abendessen für ihren Sohn Karl, seine Frau Hannelore und ihren Enkel Bertram vorzubereiten. Und sie konnte sich dabei viel Zeit lassen und brauchte sich nicht zu beeilen.
Zufrieden verließ die alte Frau das Haus.
***
„Du machst dich gut“, urteilte Schwester Annegret und klopfte der neuen Mitarbeiterin anerkennend auf die Schulter. „Bist wirklich fleißig.“
„Das muss man schon sein, sonst kommt man mit der Arbeit nicht nach“, erwiderte Miriam Spengler. „Und ich bin froh, dass ich in so kurzer Zeit eine Stelle gefunden habe.“
Annegret, die sich als dienstälteste Schwester nicht nur um den Arbeitseifer, sondern auch um das Wohlergehen neuer Mitarbeiter kümmerte, schenkte für sie beide Kaffee ein und setzte sich zu der Kollegin an den Tisch im Schwesternzimmer.
„Wieso bist du eigentlich aus der Klinik Borström weggegangen? Bisher hat es dort noch jedem gefallen.“
„Ja, eine angenehme Atmosphäre herrscht in der Klinik Borström tatsächlich“, bestätigte Miriam. „Das Arbeitsklima ist fast so angenehm wie hier in der Berling-Klinik. Und der Chef hat auch niemanden entlassen …“
„Ja, und warum hast du ihn dann verlassen?“, fragte Annegret noch einmal.
Miriam dachte an ihre persönliche Enttäuschung mit Robbi, den sie nach dem unerwarteten Bruch nicht mehr sehen konnte, ohne jedes Mal in Tränen auszubrechen.
„Private Gründe, rein private Gründe“, versicherte sie. „Das hatte gar nichts mit der Arbeit zu tun.“
Annegret nickte verständnisvoll. Sie sah die Traurigkeit in den Augen der hübschen Schwester und machte sich ihren eigenen Reim darauf. Es war schließlich nicht schwer zu erraten, dass Miriam aus Liebeskummer gegangen war.
„Dr. Borström war unglaublich nett zu mir“, berichtete Miriam weiter. „Obwohl er mich eigentlich behalten wollte und geklagt hat, dass ihm jetzt noch eine Kraft mehr fehlt, hat er mich an Dr. Holl empfohlen.“
„Die beiden sind schon sehr lange befreundet und helfen sich gegenseitig, wo sie nur können“, erklärte Annegret. „Wenn einer dem anderen zum Beispiel eine gute Mitarbeiterin verschaffen kann, macht er es.“
„Ja, ich bin ihm auch sehr dankbar“, bestätigte Miriam und seufzte leise.
„Ich verstehe schon.“ Annegret tätschelte ihr die Hand. „Liebeskummer. Wenn du darüber reden willst …“
„Davon geht er auch nicht weg“, fiel Miriam ihrer Kollegin ins Wort. „Und leichter wird er auch nicht.“
„War es ein Kollege?“, fragte Annegret. Sie drängte nicht aus Neugierde, sondern aus der ehrlichen Überzeugung heraus, dass jede Last leichter wurde, wenn man darüber sprach.
Miriam nickte. „Ein Pfleger. Wir waren ein Paar, und ich war überzeugt, dass es zwischen uns wunderbar läuft.“
„Bis er eine andere kennenlernte“, warf Annegret ein, als Miriam schwieg.
„Nein, gar nicht. Ich habe davon gesprochen, dass wir uns so gut verstehen, dass wir für immer zusammenbleiben könnten. Wir müssten nicht sofort heiraten, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Er sagte, dass er darüber nachdenkt.“
„Und dann hat er kalte Füße bekommen“, stellte Annegret nüchtern fest und schlug einen so festen und überzeugten Ton an, als wäre sie dabei gewesen.
„Ja. Woher weißt du das?“
„Kindchen.“ Annegret lächelte betrübt. „Du hast keine Ahnung, wie oft ich diese Geschichte schon gehört habe. Zwischen zwei Verliebten läuft alles wunderbar, und keiner denkt ans Schlussmachen, bis einer auf die Idee kommt, alles offiziell zu machen. Brief und Siegel. Und was passiert? Der andere kriegt Panik und kneift, weil er oder sie sich nicht binden will. So einfach ist das.“
„Es hilft mir auch nicht weiter zu wissen, dass so was schon oft vorgekommen ist“, klagte Miriam.
„Das vielleicht nicht, aber es ist doch schon oft vorgekommen, dass der kneifende Teil eines Paares sein Verhalten bereut und zurückkommt“, meinte Annegret. „Du hättest vielleicht doch lieber in der Klinik Borström bleiben und abwarten sollen, bis dein Freund zur Vernunft kommt.“
„Das bringt doch nichts“, wandte Miriam ein. „Robbi hat klar und deutlich mit mir Schluss gemacht.“
„Ja, aber jetzt lebt er ohne dich und merkt, was er verloren hat“, gab Annegret zu bedenken. „Vielleicht tut es ihm schon leid, doch er kommt nicht mehr mit dir zusammen.“
„Dann könnte er zur Berling-Klinik fahren oder mich daheim besuchen oder anrufen“, wandte Miriam ein. „Er weiß schließlich, wo ich wohne. Und meine Telefonnummer kennt er auch. Zudem ist in der Klinik Borström bekannt, dass ich jetzt an der Berling-Klinik arbeite. Nein, so klappt das nicht. Zwischen Robbi und mir ist es endgültig aus.“
„Wie heißt der Junge denn mit vollem Namen?“, erkundigte sich Annegret. „Nur damit ich Bescheid weiß, falls er sich doch einmal in deiner Abwesenheit hier meldet und nicht seinen Spitznamen nennt. Robbi ist doch vermutlich nur eine Abkürzung, oder?“
Miriam nickte. „Robert Heißler. Aber der meldet sich nicht mehr. Da bin ich sicher.“
Annegret war zwar anderer Ansicht, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass sich ein klar denkender Mann ein solches Mädchen entgehen ließ, nur, weil ihn die Vorstellung einer lebenslangen Bindung schreckte. Doch sie sagte nichts mehr, weil Miriam erst den Schock der Trennung überwinden und zur Ruhe kommen musste. Vielleicht war die junge Kollegin dann eher bereit, eine Versöhnung mit ihrem Freund anzustreben und auch etwas zu tun, um ihm eine goldene Brücke zu bauen.
Der Schwesternruf ertönte, und Miriam stand sofort auf und eilte davon.
Annegret sah ihr lächelnd nach. Hübsch, tüchtig und nett. Ihr Freund mochte kalte Füße bekommen haben, aber die kältesten Füße mussten sich bei dem Gedanken an Miriam Spengler wieder erwärmen. Und wenn diese Wärme erst einmal das Herz des jungen Pflegers erreichte, dauerte es bestimmt nicht lange, bis er in der Berling-Klinik auftauchte, um seine Liebste zurückzuholen.
***
Dr. Stefan Holl kam am nächsten Morgen früher als sonst in seine Klinik. Er hatte in der Nacht schlecht geschlafen und war so zeitig erwacht, dass er es nicht mehr im Bett aushielt.
Moni Wolfram, seine Sekretärin, war noch nicht im Büro, als der Klinikleiter den Vorraum betrat. Trotzdem brannte Licht, und hinter dem Schreibtisch machte sich eine sehr junge Frau zu schaffen.
„Oh, guten Morgen“, grüßte sie. „Ich bin gleich wieder weg, keine Sorge.“
„Guten Morgen“, erwiderte Dr. Holl verwundert. Er staunte nicht darüber, eine Putzfrau im Büro vorzufinden. Ihm war bekannt, dass die Reinigungskräfte entweder abends oder morgens die Büros in Ordnung brachten. Er staunte jedoch über den Mundschutz der höchstens zwanzigjährigen Frau. „Sind Sie krank?“, fragte er. „Ich habe keine Angst, mich anzustecken, falls Sie erkältet sein sollten.“
„Nein, ich bin kerngesund, aber ich will es auch bleiben“, entgegnete sie und hob das Telefon auf Frau Wolframs Schreibtisch hoch, um darunter Staub zu wischen.
Dr. Holl lächelte amüsiert. „Ich weiß, dass man in letzter Zeit ziemlich viel über Infektionsquellen im Krankenhaus geschrieben hat. Sie brauchen trotzdem keine Angst zu haben. Die Infektionen bedrohen Kranke – beziehungsweise in erster Linie frisch Operierte, und die Quellen finden sich hauptsächlich in den OP-Sälen oder am chirurgischen Besteck.“
„Nein, daran habe ich gar nicht gedacht, Herr Doktor“, wehrte die junge Frau ab und deutete auf den Arbeitsplatz der Sekretärin. „Aber diese Krankheitsschleuder hier …“
Sie kam nicht weiter, weil in dem Moment Moni Wolfram das Büro betrat.
„Guten Morgen“, grüßte die Sekretärin ihren Chef überrascht, weil sie noch nicht mit ihm gerechnet hatte, sah die Putzhilfe und lächelte verschmitzt. „Oje, grassiert wieder ein Virus, Marianne?“
Die junge Frau nickte eifrig. „Haben Sie es nicht in der Zeitung gelesen? Frau Wolfram“, fügte sie flehend hinzu, „macht es Ihnen viel aus, wenn ich Ihren Computer heute nicht putze?“
„Aber nein, lassen Sie nur, Marianne!“, erwiderte Moni, der es sichtlich schwerfiel, nicht zu lachen. „Wenn Computerviren herumschwirren, brauchen Sie dieses gefährliche Ding nicht anzufassen.“
Die Putzhilfe atmete erleichtert auf. „Sie haben wenigstens Verständnis, Frau Wolfram, danke.“ Damit nahm sie ihren Eimer und das restliche Handwerkszeug und verließ das Büro der Sekretärin.
„Computerviren?“, wiederholte Dr. Holl verblüfft. „Sagen Sie bloß, die Gute hat Angst, sich mit Computerviren anzustecken.“
Moni Wolfram stellte die Handtasche auf dem Schreibtisch ab und hängte die Jacke in den Schrank. „Und wie. Darum trägt sie immer einen Mundschutz, wenn die Zeitungen neue Computerviren melden.“
„Ich bitte Sie, Moni!“ Dr. Holl schüttelte den Kopf und schwankte zwischen Lachen und Tadel. „Wie können Sie einen solchen Unsinn auch noch unterstützen? Sie hätten der jungen Frau erklären müssen …“
„Habe ich versucht.“ Es kam selten vor, dass Moni Wolfram ihrem Chef das Wort abschnitt. Jetzt tat sie es lachend. „Ich habe versucht, ihr zu erklären, was Computerviren sind und dass sie nichts mit Krankheiten zu tun haben. Aber Sie müssen erst einmal versuchen, Marianne Sträußler etwas auszureden, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Sie ist ein richtiger bayrischer Dickschädel, in den Sie nichts hineinbekommen, was sie nicht will – und aus dem Sie auch nichts entfernen können.“
„Trotzdem“, meinte Dr. Holl, während seine Sekretärin die Kaffeemaschine einschaltete. „So etwas kann man nicht auf sich beruhen lassen. Diese Marianne Sträußler macht sich doch lächerlich, und das wollen wir nicht.“
„Bitte, wie Sie meinen.“ Die Sekretärin zeigte sich völlig unbeeindruckt. „Sie können bei der nächsten Gelegenheit gern versuchen, Marianne auseinanderzusetzen, was Computerviren sind und dass man keinen Mundschutz gegen sie braucht.“
„Das werde ich auch machen“, versicherte Dr. Holl und zog sich endlich in sein Büro zurück.
Der Klinikleiter bedankte sich, als seine Sekretärin ihm wie jeden Morgen eine Tasse ihres guten Kaffees brachte.
Dr. Daniel Falk, Chefarzt der Chirurgischen Station der Berling-Klinik, nahm gern ebenfalls eine Tasse des heißen Gebräus an, bevor er mit Stefan Holl die aktuellen Fälle besprach. Sie gingen die Behandlungsmethoden einiger Patienten durch, die zu den schweren Fällen zählten, und einigten sich auf kleine Veränderungen bei den Patienten, bei denen die bisherige Behandlung keinen ausreichenden Erfolg gezeigt hatte.
Bei einer zweiten Tasse Kaffee erzählte Stefan schließlich von dem Zusammentreffen mit der Putzhilfe, die Angst hatte, sich an Computerviren anzustecken, und Daniel Falk lachte erwartungsgemäß aus voller Brust.
Das Telefon klingelte im Vorraum, und Moni kam gleich darauf herein. „Sie werden auf der Station verlangt, Herr Doktor“, sagte sie zu Daniel Falk. „Zwei neue Patienten.“
„Ich komme.“ Der Chirurg leerte seine Tasse und stand auf. „Dann wollen wir wieder.“ Er nickte seinem Freund zu und machte sich auf den Weg zu seiner Abteilung.
Dr. Stefan Holl seinerseits trat die Visite auf der Frauenstation an. Bei der Gelegenheit konnte er die neue Schwester beobachten. Bisher war er mit Miriam Spengler sehr zufrieden und freute sich, dass sie von der Klinik seines Freundes Henrik Borström zu ihm gekommen war. Auch heute machte Schwester Miriam einen guten Eindruck, obwohl sie traurig wirkte.
Kummer, urteilte Stefan Holl bedauernd. Er fand es immer schade, wenn Menschen unglücklich waren, und es reichte eigentlich schon aus, wenn das auf die meisten seiner Patienten zutraf. Da wollte er wenigstens beim Personal zufriedene Gesichter sehen. Doch man konnte es sich eben nicht aussuchen.
***
Seit Tagen vermisste Miriam Spengler ein Portemonnaie, das ihr besonders ans Herz gewachsen war. Robbi hatte es ihr während eines gemeinsamen Urlaubs in Tunesien im Basar gekauft. Es war aus Leder und sehr schön bestickt und verziert.
Sie hatte zuletzt kein Geld mehr darin aufgehoben, sondern nur Notizzettel und Kalender. Insofern war der Verlust nicht hoch. Sie wollte jedoch das Portemonnaie wiederhaben.
Nachdem Miriam daheim alle ihre Sachen gründlich durchsucht hatte, gab es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder hatte sie das Portemonnaie verloren oder in der Klinik Borström vergessen. Widerstrebend griff sie nach Dienstende in der Berling-Klinik zum Telefon und rief an ihrer früheren Arbeitsstelle an.
Sollte Robbi sich melden, wollte sie gleich wieder auflegen, ohne auch nur ihren Namen zu nennen. Sie hatte jedoch Glück und bekam eine ehemalige Kollegin an den Apparat.
„Ich wollte dich ohnedies schon anrufen, Miriam“, erklärte die Kollegin. „Ich habe dein Portemonnaie gefunden. Es lag in deinem Schrank auf dem oberen Regalbrett ganz hinten.“
„Sehr gut“, erwiderte Miriam erfreut. „Ich hole es mir.“ Nach kurzem Zögern fügte sie hinzu: „Hat Robbi jetzt Dienst?“
„Nein, er hat heute frei und zeigt sich gar nicht in der Klinik“, antwortete die Kollegin.
„Dann bis gleich“, sagte Miriam und machte sich sofort auf den Weg.
Bald darauf erkundigte sich die Kollegin, die ihr die Geldbörse aufbewahrt hatte, wie es ihr in der Berling-Klinik gefiel.
„Großartig, Iris“, versicherte Miriam. „Sie haben da ein fantastisches Arbeitsklima, und Dr. Holl ist der netteste Chef, den man sich vorstellen kann.“
„Was denn?“, fragte Iris, „noch netter als Dr. Borström?“
„Ach, das war so dahergesagt!“, wehrte Miriam ab. „Dr. Borström war auch immer sehr nett. Es gefällt mir aber wirklich gut in der Berling-Klinik.“
Die Kollegin betrachtete sie forschend. „Glücklich siehst du trotzdem nicht aus.“
„Wie denn auch?“, wehrte Miriam unwillig ab. Iris hatte schließlich mitbekommen, wie es zwischen Robbi und ihr gekracht hatte. Sie hätte gern gewusst, wie er sich jetzt fühlte, wollte jedoch um keinen Preis der Welt fragen.
„Robbi läuft mit einer ähnlichen Trauermiene durch die Korridore“, bemerkte die Kollegin.
„Sein Problem“, wehrte Miriam ab. „Ich war nicht diejenige, die Schluss gemacht hat.“
„Ich glaube, es tut ihm leid“, behauptete Iris.
„Und?“, fragte Miriam herausfordernd.
Sie hatte zwar erfahren, dass Robbi heute gar nicht arbeitete, wollte sich aber trotzdem nicht länger in der Klinik Borström aufhalten.
Auf dem Weg zum Ausgang kam Miriam an dem Korridor vorbei, der zum Büro des Chefarztes der Klinik führte. Sie warf nur einen kurzen Blick hinein.
Der Flur war leer, abgesehen von einem jungen Paar. Der Mann, den sie nur von der Seite sah, hielt die Frau an den Schultern fest und sprach eindringlich mit ihr. Sie schüttelte ständig den Kopf und drehte sich auch weg, als wollte sie nichts hören.
Miriams Blick fiel auf das Gesicht der Frau, die ungefähr in ihrem Alter war. Schmerz und Verzweiflung zeichneten sich darauf ab.
Im nächsten Moment riss sich die Frau los und lief an Miriam vorbei zu den Aufzügen. Dabei bemerkte sie die junge Pflegerin nicht und wäre sogar um ein Haar mit ihr zusammengestoßen.
Miriam seufzte lautlos. Wie oft hatte sie in ihrem Beruf schon miterlebt, wie Menschen eine vernichtende Diagnose hören und damit fertigwerden mussten.
Der Aufzug stand auf der Etage. Die Frau betrat ihn, und gleich darauf schlossen sich die Türen.
Miriam wandte sich dem Mann zu. Er stand wie benommen da und starrte auf die Türen des Aufzugs. In seinem Gesicht malte sich pure Verzweiflung ab.
Auch wenn sie nicht mehr hier arbeitete, konnte Miriam gar nicht anders. Sie ging auf den Mann zu und sagte sanft und behutsam: „Kann ich Ihnen irgendwie helfen?“
Es kostete ihn sichtlich Mühe, den Blick vom Aufzug zu der Sprecherin zu lenken. „Wie?“, murmelte er.
„Ob ich Ihnen helfen kann.“ Miriam blickte in Augen, in denen sie einen ähnlichen Schmerz las, wie sie ihn seit der Trennung von Robbi empfand. Und sie verspürte beim Anblick dieses traurigen Gesichts den fast unwiderstehlichen Drang, diesen Mann zu trösten. „Möchten Sie sich vielleicht für einen Moment setzen?“, fuhr sie fort. „Soll ich Ihnen eine Tasse Kaffee bringen? Ich bin von Beruf Krankenschwester“, erklärte sie noch, damit ihr Angebot nicht so merkwürdig wirkte, und verschwieg, dass sie nicht zum Personal dieses Hauses gehörte.
„Ach so“, murmelte der Fremden, der höchstens Ende zwanzig war. „Nein, vielen Dank, ich brauche nichts“, fügte er hinzu und ging an ihr vorbei zum Aufzug.
Miriam sah ihm nach, bis das Signal ertönte und sich die Türen öffneten. Gut gekleidet, hervorragender Haarschnitt, attraktiv – und vor allem todtraurig. Sie seufzte. Warum gab es auf der Welt bloß so wenig Glück?
***
Dr. Axel Lassow wollte schon seine Kanzlei verlassen, als er auf Licht in einem der Büros aufmerksam wurde. Er trat in die halb offene Tür und sah seiner Mitarbeiterin eine Weile zu, wie sie verbissen auf den Bildschirm ihres Computers starrte. Endlich räusperte er sich.
„Ach, Herr Dr. Lassow.“ Dr. Luise Kasinski lehnte sich seufzend auf dem Drehstuhl zurück. „Sie sind noch hier?“
„Das Gleiche wollte ich Sie fragen“, erwiderte der Leiter der Anwaltskanzlei. „Sie sollten längst Feierabend machen.“
„Das wollte ich auch, aber es geht nicht.“ Luise deutete auf den Bildschirm. „Die Arbeit eines halben Tages ist verschwunden.“
„Was heißt verschwunden?“ Axel Lassow kam langsam näher. „Arbeit verschwindet nicht so einfach.“
„Sagen Sie das dieser Höllenmaschine!“ In einem Anflug von Galgenhumor deutete Luise Kasinski auf den Computer. „Ich hatte die Weihrauch-Akte durchgearbeitet und mit Kommentaren versehen. Und ich bin sicher, dass ich die Arbeit richtig gespeichert habe. Trotzdem ist sie nicht mehr aufzufinden. Vermutlich habe ich sie durch ein Versehen wieder gelöscht. Ich muss alles noch einmal machen, und ich brauche das Ergebnis bis morgen früh. Also sitze ich noch gut zwei Stunden hier.“
„Das ist natürlich Pech“, meinte Axel Lassow. „Tut mir leid für Sie, Frau Kollegin. Gut, dann eben bis morgen. Hoffentlich haben Sie noch ein wenig von Ihrem Feierabend!“
„Kaum.“ Luise Kasinski seufzte. „Ich werde hinterher gleich nach Hause fahren und ins Bett fallen, sonst nichts.“
Nachdem der Chef gegangen war, widmete sich die Rechtsanwältin wieder ihrer Tätigkeit, bis sich ihr Handy meldete. Seufzend griff sie nach dem Funktelefon und meldete sich.
„Wo bleibst du denn?“, fragte Hartmut Siegel unwillig. „Ich warte seit einer Stunde auf dich.“
„Ich habe versucht, dich zu erreichen, Schatz“, erwiderte Luise. „Aber ich bin nicht durchgekommen.“ Sie erklärte ihrem Freund knapp, was geschehen war. „Leider geht es heute Abend nicht.“
„Na toll!“, erwiderte er ungehalten. „Dann muss ich allein ins Restaurant gehen.“
„Hartmut, ich habe es mir nicht ausgesucht“, sagte Luise gereizt. „Oder meinst du, ich habe die Arbeit eines halben Tages absichtlich gelöscht, damit ich hinterher noch mehr zu tun habe?“
„Nein, natürlich nicht“, lenkte er ein. „Aber du hättest dir doch einen Ausdruck von allem machen können. Das wäre keine Mühe gewesen, und du hättest dir die doppelte Arbeit erspart.“
„Was du nicht sagst!“, entgegnete sie genervt. „Hinterher ist man immer schlauer. Jetzt weiß ich auch, was ich hätte machen sollen, aber mir ist das bisher eben noch nie passiert. Wie sollte ich da im Traum daran denken, dass ich stundenlang nachsitzen muss?“
„Na ja, tut mir leid für dich“, lenkte Hartmut Siegel ein. „Wirklich dumm. Kann man nichts machen. Wir sehen uns eben morgen Abend.“
„Ja, bis morgen, Liebling“, erwiderte Luise und bemühte sich, nicht zu deutlich zu zeigen, wie gern sie das Gespräch schon beendete. Sie hatte keine Lust, bis Mitternacht oder womöglich noch länger im Büro zu sitzen und am nächsten Morgen wieder ganz zeitig aufzustehen.
Nach dem Anruf widmete sie sich erneut ihrer Arbeit und verschwendete keinen Gedanken mehr darauf, wieso auf rätselhafte Weise das Ergebnis vieler Stunden angestrengter Tätigkeit verschwunden war. Schon gar nicht kam sie auf die Idee, einen Zusammenhang zwischen diesem und einem anderen Vorfall herzustellen. Sie war auf Weisung ihres Chefs Axel Lassow in der Berling-Klinik gewesen und hatte den Patienten aufgesucht, der sein Testament machen musste.
Allerdings hatte sie feststellen müssen, dass der Mann, den sie in seinem Patientenzimmer traf, gar nichts von einem Testament wissen wollte. Der Mann hatte sich sogar sehr darüber aufgeregt und sich bei Dr. Holl, dem Klinikleiter, beschwert, weil auf einmal eine Anwältin bei ihm aufgetaucht war.
Hinterher ließ sich nicht mehr feststellen, wieso Nelly Heiler, Luises Sekretärin, einen falschen Namen geliefert hatte. Nelly Heiler schwor Stein und Bein, diesen Namen bei der Anfrage in der Berling-Klinik erfahren zu haben. Es fand sich jedoch niemand, der diese Auskunft erteilt haben wollte. Das war allerdings kein Wunder, weil die meisten Leute nur ungern einen Fehler eingestanden.
Luise Kasinski hatte jedenfalls nicht nur Ärger ausgelöst, sondern auch wertvolle Arbeitszeit verloren, bis die den richtigen Patienten fand und mit ihm sein Testament besprechen konnte.
Vielleicht war sie überarbeitet. In letzter Zeit hatte sie sehr viel zu tun gehabt. Es wäre kein Wunder gewesen, hätte der Stress Auswirkungen gezeigt. Fehler wie beim Speichern der Aktennotizen waren erklärlich.
Die Uhr auf dem Schreibtisch zeigte schon fast Mitternacht, als Luise Kasinski endlich fertig war. Jetzt war sie vorsichtig und speicherte nicht nur sehr gewissenhaft, sondern fertigte auch zwei Ausdrucke an. Die bedruckten Blätter steckte sie in die Aktentasche und nahm sie mit nach Hause, falls sie morgen früh noch einmal etwas nachsehen wollte, bevor sie ins Büro fuhr.
Ein verlorener Abend, viele Stunden zusätzlicher Mühe und Ärger mit Hartmut. Das war das Ergebnis eines viel zu langen Tages. Frustriert fiel Luise Kasinski in ihr Bett und konnte prompt lange nicht einschlafen. Auch das noch!
***
Dr. Daniel Falk untersuchte seine junge Patientin sehr eingehend. „Ja, das ist eindeutig ein Kreuzbandriss“, bestätigte er schließlich. „Vom Sportunterricht in der Schule?“
Die siebzehnjährige Lena Birkner nickte. „Mein Hausarzt meint, dass ich damit noch eine Weile herumlaufen kann, wenn ich das Knie nicht belaste und vor allem keinen Sport betreibe. Er hat aber auch gesagt, dass ich um eine Operation nicht herumkomme.“
„Das kann ich nur bestätigen“, erwiderte Dr. Falk und zeigte ihr die Verletzung auf den Röntgenbildern. „Sehen Sie – hier und hier. Wir müssen irgendwann operieren. Als Arzt rate ich stets zu einer möglichst baldigen Operation. Spricht etwas dagegen?“
„Ja, wichtige Arbeiten in der Schule“, erwiderte Lena Birkner. „Darum würde ich gern noch eine Weile warten.“
Dr. Falk nickte. „Das können Sie, wenn Sie sich an die Ratschläge Ihres Hausarztes halten“, bestätigte er. „Schieben Sie den Eingriff aber nicht auf die lange Bank! Es wird dadurch nicht besser.“
Während er Eintragungen auf dem Patientenblatt machte, fiel ihm eine bei Lena Birkner wiederkehrende Handbewegung auf. Wenn sie den Kopf gedreht oder geneigt hatte, strich sie sich jedes Mal über die kinnlangen Haare auf der linken Gesichtshälfte.
Neugierig geworden, beobachtete Dr. Falk die junge Patientin etwas genauer und war nach der nächsten Wiederholung überzeugt, dass es eine ganz bewusste Handlung war. Er sah genauer hin. Die Haare hingen nur auf der linken Seite vor der Wange und bildeten einen Schleier, der Ohr und Wange bis zum Kinn verdeckte. Bei einer kurzen Bewegung schimmerte es darunter dunkel.
„Darf ich?“ Der Chefarzt der Chirurgie kam hinter dem Schreibtisch des Behandlungsraums hervor und schob die Haare von der linken Wange.
Lena Birkner zuckte zurück, als hätte er sie geschlagen, und wandte sich sofort ab, doch Dr. Falk hatte bereits das große Feuermal auf der linken Wange gesehen.
„Was ist denn?“, fragte er. „Ich bin Ihr Arzt. Vor mir brauchen Sie keine Scheu zu haben.“
Lena Birkner presste die Lippen aufeinander und überzeugte sich durch die bereits zur Selbstverständlichkeit gewordene Handbewegung davon, dass die Haare das Feuermal wieder verdeckten.
„Macht es Ihnen Probleme?“, erkundigte sich Dr. Falk, obwohl das schon eindeutig war. „Stört es Sie sehr?“
„Ja“, erwiderte Lena leise.
„Man kann ein Hämangiom in den meisten Fällen entfernen“, setzte Dr. Falk ihr auseinander. „Darf ich?“, fragte er noch einmal und streckte die Hand aus. Diesmal wartete er, ob sich die Patientin wieder abwandte.
Als Lena Birkner stillhielt, schob er die Haare weg und betrachtete die blutrote Verfärbung an der Wange. Sie besaß etwa die Größe einer Zwei-Euro-Münze und war leicht erhaben.
„Ein kavernöses Hämangiom“, urteilte er. „Es ist über das Hautniveau erhaben und reicht in die Tiefe, entstanden durch zu viele Blutkörperchen an dieser Stelle. Wie gesagt, eine Entfernung mittels Laser ist möglich.“
„Nein“, wehrte Lena Birkner zu seiner Überraschung ab.
Dr. Falk hatte den Eindruck bekommen, dass Lena Birkner unter diesem Feuermal litt. Daher hatte er angenommen, sie würde sich über die Möglichkeit, die er ihr bot, freuen. Das Gegenteil war aber wohl der Fall.
„Gut, wie Sie meinen“, lenkte er ein, da er sich stets nach dem Willen seiner Patienten richtete und niemandem zuredete, der etwas nicht wollte. Allerdings fügte er noch hinzu: „Sie können sich überlegen, ob wir das Feuermal gleichzeitig mit Ihrem Knie versorgen. Das ginge dann sozusagen in einem Aufwaschen.“
Lena Birkner nickte nur.
Dr. Falk machte eine letzte Eintragung auf dem Patientenblatt und verabschiedete sich von der jungen Patientin. Er hätte ihr gern geholfen, aber wenn sie nicht dazu bereit war, waren ihm die Hände gebunden.
***
Karl und Hannelore Vrede saßen mit ihrem Sohn Bertram am Tisch, während Walburga sich in ihrem Zimmer aufhielt. Es war noch zu früh zum Abendessen, und heute hatte Hannelore das Kochen übernommen. Sie hatte alles schon vorbereitet und in den Backofen zum Warmhalten gestellt.
„Wir müssen über Oma reden“, erklärte sie jetzt und überzeugte sich davon, dass ihre Schwiegermutter nicht in der Nähe war und daher auch nichts hörte. „Ich mache mir Sorgen um sie.“
„Warum denn?“, fragte Bertram sofort.
„Sie ist in letzter Zeit unwahrscheinlich vergesslich geworden“, sagte seine Mutter. „Ich habe heute Abend den Stöpsel des Waschbeckens im Badezimmer auf dem Küchentisch gefunden. Das war keiner von uns, sondern Oma.“
„Na schön“, meinte Bertram, „hat sie ihn eben aus Versehen mitgenommen.“
„So einfach ist das ja wohl nicht“, wehrte sein Vater ab. „Manchmal sieht sie einen merkwürdig an.“
„Das ist mir auch schon aufgefallen.“ Hannelore Vrede nickte ihrem Mann zu. „Sie sieht durch einen hindurch.“
„Ihr redet von einer fast achtzigjährigen Frau“, hielt Bertram seinen Eltern vor. „Was erwartet ihr von Oma? Dass sie wie ein junges Mädchen immer topfit ist?“
„Nein“, versicherte sein Vater. „Aber wir müssen uns darauf verlassen können, dass sie genau weiß, was sie tut.“
„Was soll das denn heißen?“, fragte Bertram gereizt.
Seine Eltern sahen ihn verständnisvoll an. „Sieh mal“, begann seine Mutter behutsam, „wenn sie geistige Aussetzer hat, kann sie sich selbst und uns in Gefahr bringen.“
„Stell dir vor, sie macht den Herd an und geht weg“, fuhr sein Vater fort. „Das ganze Haus kann abbrennen.“
„Oder sie verwechselt die Medikamente“, führte Hannelore Vrede an. „Es gibt viele Möglichkeiten, wie sie sich schaden könnte. Wenn es mit ihr schlimmer wird, wäre das Risiko zu hoch.“
„Ihr wollt sie in ein Heim stecken“, fuhr Bertram auf.
„Wir wollen nicht“, entgegnete sein Vater. „Tatsache ist nur, dass wir alle außer am Wochenende tagsüber nicht daheim sind. Oma ist die ganze Zeit allein, und niemand ist hier, um ihr zu helfen, wenn ihr etwas passiert.“
„In einer betreuten Altenwohnung oder in einem Heim wäre das ganz anders“, gab seine Mutter zu bedenken. „Ich sage ja nicht, dass wir das schon morgen machen sollten, aber wir müssen es in Erwägung ziehen.“
„Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.“ Karl Vrede winkte ab, als er die Schritte seiner Mutter hörte.
Walburga Vrede wirkte erholt, als sie ins Zimmer kam. „Gibt es schon Essen?“, fragte sie. „Ich helfe euch beim Auftragen.“
„Dann komm mit in die Küche, Oma!“, bat Hannelore Vrede. „Es ist alles fertig.“
Bertram schwieg verbissen, während seine Mutter und seine Großmutter sich um das Essen kümmerten.
Karl Vrede wartete einen Moment ab, in dem er mit seinem Sohn allein war. „Als wir deine Großmutter zu uns nahmen, hat sie selbst verlangt, dass wir sie in ein Heim bringen, wenn sie nicht mehr kann“, sagte er dann leise. „Sie wird nun einmal nicht jünger, und wenn es nicht anders geht …“
„Aber nur dann“, fiel Bertram seinem Vater ins Wort. „Ich will nicht, dass sie …“ Auf einen warnenden Blick seines Vaters hin verstummte er.
Gleich darauf kamen seine Mutter und seine Großmutter aus der Küche zurück.
Bertram behielt während des ganzen Essens seine Großmutter besonders aufmerksam im Auge.
Walburga Vrede gab sich völlig normal. Ihr war nicht anzumerken, dass sie irgendwelche Schwierigkeiten hatte. Sie unterhielt sich lebhaft und ließ nicht erkennen, dass ihr etwas fehlte. Bertram atmete auf. Seine Eltern hatten sich bestimmt nur etwas eingebildet.
***
Dr. Borström betrachtete den vor seinem Schreibtisch sitzenden jungen Mann voller Mitgefühl. „Ich verstehe Sie sehr gut, Herr Wiegand“, erklärte er. „Ich weiß schließlich, wie sehr Sie und Ihre Verlobte sich Kinder wünschen, aber …“ Er zuckte die Schultern. „Sie haben meine Diagnose gehört. Selbst wenn es trotz der Probleme Ihrer Verlobten zu einer Empfängnis käme …“ Er unterbrach sich erneut. „Ich habe Ihnen klar und deutlich gesagt, dass ich mit dieser Möglichkeit gar nicht rechne.“
„Wenn aber doch“, drängte Klaus Wiegand. „Was wäre, wenn Sabine … wenn Frau Hohmann schwanger werden könnte?“
Dr. Borström nahm seine ganze Geduld zusammen. Mehr als einmal hatte er den beiden schon erklärt, wie alles ablaufen würde. „Sie käme nicht über den fünften Monat hinaus, wenn überhaupt so weit“, setzte er dem Juristen noch einmal auseinander. „Es geht einfach nicht.“
„Und Sie können nichts machen? Keine Operation? Keine Unterstützung durch Medikamente?“, fragte Klaus Wiegand verzweifelt.
„Ich hätte Frau Hohmann dann doch nicht mit dem Bescheid weggeschickt, dass ich ihr nicht helfen kann.“ Dr. Borström hatte keine Schwierigkeiten, über all das zu sprechen. Klaus Wiegand und Sabine Hohmann waren schließlich immer gemeinsam zu ihm gekommen, und er hatte auch vor ihnen beiden über diese Probleme geredet.
„Sehen Sie absolut keine Möglichkeit?“, drängte Klaus Wiegand. „Unser Glück hängt davon ab. Wie wäre es mit einem anderen Arzt? Können Sie uns keinen empfehlen? Ich will Ihre Fähigkeiten nicht infrage stellen, Herr Dr. Borström, verstehen Sie mich bitte richtig“, fügte er hastig hinzu. „Es ist nur so, dass wir in einer verzweifelten Lage sind und keinen Ausweg finden.“
„Wie wäre es mit Adoption?“, schlug Henrik Borström vor. „Oder mit einer Leihmutter?“
Doch Klaus Wiegand schüttelte entschieden den Kopf. „Das wäre dann doch nicht unser Kind“, erklärte er. „Darüber haben wir gesprochen, und das kommt nicht infrage.“
„Tja, dann …“ Henrik Borström war geradezu erleichtert, als das Telefon summte. Er nahm den Hörer ans Ohr. „Ja, bitte?“, fragte er seine Sekretärin.
„Dr. Holl auf Leitung eins. Soll ich durchstellen?“
„Ja, bitte“, erwiderte Henrik Borström und begrüßte gleich darauf seinen Freund. „Was hast du auf dem Herzen, Stefan?“, fragte er.
„Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich mit deiner ehemaligen Mitarbeiterin Miriam Spengler sehr zufrieden bin“, erwiderte Stefan Holl. „Sie ist sehr tüchtig.“
„O ja, ich weiß“, bestätigte Henrik Borström. „Darum ließ ich sie auch so ungern gehen. Ach, Moment!“ Er warf Klaus Wiegand einen Blick zu und setzte eine Idee sofort in die Tat um. „Stefan, ich schicke dir durch einen Boten eine Krankengeschichte zur Begutachtung“, fuhr er dann fort. „Ohne Namen wegen der Schweigepflicht. Eine junge Frau mit erheblichen Problemen bei Empfängnis und Schwangerschaft. Ich sehe keine Möglichkeit für sie, ein Kind zu bekommen. Vielleicht kannst du ein ganz persönliches Gutachten abgeben. Ein inoffizieller Freundschaftsdienst.“
„Aber ja, gern“, stimmte Stefan Holl sofort zu. „Ich warte auf die Unterlagen.“
„Das war Dr. Stefan Holl, Leiter der Berling-Klinik hier in München“, erklärte Henrik Borström, nachdem er aufgelegt hatte. „Ich denke, er wird meine Diagnose bestätigen, aber wir werden hören, was er dazu sagt. Er genießt als Gynäkologe einen ausgezeichneten Ruf.“
„Die Berling-Klinik ist mir ein Begriff“, bestätigte Klaus Wiegand und schöpfte neue Hoffnung. „Vielleicht kann Dr. Holl ja doch helfen.“
„Ich fürchte, Sie haben mich falsch verstanden“, wandte Henrik Borström ein. „Ich meinte, dass Dr. Holl meine Diagnose bestätigen wird. Das wird Ihnen deutlich machen, dass Sie sich doch mit dem Gedanken an eine Adoption oder eine Leihmutter anfreunden müssen.“
„Dr. Holl und die Berling-Klinik“, sagte Klaus Wiegand mehr zu sich selbst und stand auf. „Sehr gut. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Borström“, ergänzte er hastig und verließ das Büro des Klinikleiters so eilig, als könnte er sich gleich anschließend in der Berling-Klinik eine gute Nachricht abholen.
Dr. Borström sah ihm kopfschüttelnd nach.
„Eine Frau Hohmann möchte Sie sprechen“, meldete seine Sekretärin am Nachmittag.
„Soll hereinkommen“, entschied Dr. Borström und ging der Jurastudentin entgegen. „Frau Hohmann, was führt Sie zu mir?“, fragte er, nachdem er ihr die Hand gegeben hatte. „Ich dachte, es wäre alles klar.“
Sabine ließ sich auf den Stuhl sinken, auf den der Chefarzt deutete, und sah betrübt zu Dr. Borström hoch. Er hatte sich mit verschränkten Armen gegen den Schreibtisch gelehnt.
„Es ist sehr schwer für mich“, gestand sie. „Wegen meiner Kinderlosigkeit habe ich mich von Klaus getrennt. Klaus Wiegand, Sie wissen schon.“
„Oh“, murmelte Dr. Borström betroffen. „Und jetzt haben Sie erfahren …“
„Ich hatte gehofft, Sie könnten mir doch eine Möglichkeit zeigen, ein Kind zu bekommen“, fiel Sabine Hohmann ihm ins Wort.
Der Klinikchef setzte sich hinter seinen Schreibtisch. „Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mit einer anderen Antwort von Ihnen gerechnet habe“, erwiderte er. „Herr Wiegand war heute bei mir. Ich war der Meinung, Sie beide wären noch immer ein Paar. Und da ich stets offen vor Herrn Wiegand sprechen durfte, habe ich heute ohne Sie mit ihm über die Situation diskutiert.“
Sabine Hohmann winkte ab. „Machen Sie sich deshalb keine Vorwürfe, Herr Dr. Borström! Ich nehme an, Sie konnten ihm nichts Neues verraten.“
„Nein“, erwiderte der Chefarzt. „Er hat mich so lange bedrängt, doch einen anderen Arzt hinzuzuziehen, dass ich Ihre Unterlagen an die Berling-Klinik zu meinem Freund und Kollegen Dr. Stefan Holl schickte. Ohne Ihren Namen, also anonym“, fügte er hinzu. „Ich wollte nur, dass Dr. Holl mein Urteil bestätigt, damit Herr Wiegand endlich einsieht, dass nichts zu machen ist. Streng genommen habe ich heute meine Schweigepflicht verletzt und …“
„Nein, es ist schon in Ordnung“, schnitt Sabine Hohmann ihm das Wort ab. „Sie haben in gutem Glauben gehandelt, und Sie haben keinen Schaden angerichtet. Meinetwegen kann Klaus … Herr Wiegand … sogar Dr. Holls Beurteilung erfahren. Fällt sie nämlich günstig aus, wird aus Klaus und mir sofort wieder ein glückliches Paar. Und fällt sie negativ aus, bestätigt Dr. Holl damit nur unsere Trennung, und Klaus hört nichts Neues.“
Dr. Borström war sehr erleichtert, dass er sich nicht durch eine unbedachte Handlung in eine unangenehme Situation gebracht hatte. Nachdem Sabine Hohmann gegangen war, griff er zum Telefon und rief Stefan Holl an.
„Du erwischst mich gerade noch zwischen Tür und Angel“, erwiderte Stefan, als er die Stimme seines Freundes hörte. „Was gibt es?“
„Es geht um diese anonymen Patientenunterlagen“, sagte Henrik. „Sie gehören zu Sabine Hohmann, Jurastudentin. Sie und ihr Verlobter, Klaus Wiegand, ein Anwalt, dessen Vater mit deinem Schwager Axel gut bekannt ist, wollten gemeinsame Kinder. Ich musste leider ihren Traum zerstören. Weil Klaus Wiegand nicht lockerließ, habe ich dich eingeschaltet. Sabine Hohmann ist damit einverstanden, dass Herr Wiegand dein Urteil erfährt. Sie ist übrigens auch schon gespannt.“
„Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, mir die Unterlagen anzusehen“, erwiderte Stefan Holl. „Das mache ich morgen, versprochen.“
„Alles klar, Stefan“, meinte Henrik. „Keine Eile. Du wirst eh nichts anderes sagen als ich.“
***
Als Axel Lassow an diesem Abend aus der Kanzlei nach Hause kam, war es schon dreiundzwanzig Uhr. Er schleuderte zornig seinen Aktenkoffer in eine Ecke der Diele und machte auch noch ein finsteres Gesicht, als er seine Frau Trixi mit einem Kuss begrüßte.
„So schlimm?“, fragte sie. „Setz dich! Wir essen erst einmal.“
„Ja, so schlimm.“ Axel ließ sich seufzend auf einen Platz am Esstisch sinken. „Die Kinder sind oben?“
„Die haben sich bereits in ihr eigenes Reich zurückgezogen“, bestätigte Trixi, servierte für sie beide und schenkte Wein dazu ein. „Guten Appetit.“
„Der ist mir vergangen“, murmelte Axel, doch da er Hunger hatte, langte er ordentlich zu, und der Wein half ihm, sich zu entspannen. „Ich begreife das nicht“, erzählte er nach einer Weile. „Luise Kasinski war bisher eine meiner besten Mitarbeiterinnen. Seit einiger Zeit baut sie nur Mist.“
„Was ist mit ihr los? Hat sie Kummer? Beziehungsstress?“
„Möglich, obwohl sie verneint“, erwiderte Axel. „Ich habe heute aber zufällig mitbekommen, wie sie sich am Telefon mit ihrem Freund gestritten hat. Offenbar hat sie ihn in der jüngsten Vergangenheit mehrfach versetzt.“
„Dann hat sie vielleicht einen anderen Mann kennengelernt und bringt die beiden Freunde nicht mehr unter einen Hut“, tippte Trixi.
Axel nickte nachdenklich. „Du meinst, zwei Freunde, zwei private Terminkalender, zweifache Verabredungen und die Sorge, es könnte auffliegen? Wäre möglich, aber mir ist das letztlich gleichgültig. Diese Kollegin macht einen Fehler nach dem anderen, und ich konnte es heute ausbaden. Wenn sie sich noch etwas leistet, schicke ich sie in die Wüste.“
„Du willst sie gleich entlassen?“, fragte Trixi. „Ich kenne sie nicht, aber findest du das nicht etwas zu hart reagiert?“
„Soll ich abwarten, bis wir womöglich wegen ihrer Zerstreutheit und Schlamperei einen wichtigen Klienten verprellen oder gar einen bedeutenden Prozess verlieren?“, fragte Axel. „Das kann ich mir nicht leisten. Der Ruf meiner Kanzlei steht auf dem Spiel.“
„Ja, das sehe ich ein“, meinte Trixi. „Aber gleich Entlassung … Du könntest deine Mitarbeiterin in Urlaub schicken. Dann würde sie keinen Schaden mehr anrichten, sich erholen und voll einsatzfähig zu dir zurückkommen. Du hättest zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.“
„Man soll doch immer auf seine kluge Ehefrau hören“, scherzte Axel. „Du hast recht“, fügte er ernst hinzu. „Wenn Dr. Kasinski noch einen Fehler begeht, schicke ich sie zwangsweise in Urlaub. Ich habe weniger Arbeit, wenn ich selbst ihre Fälle bearbeite, als wenn ich hinter ihr die Schäden beseitige.“
„So gefällst du mir schon besser“, lobte Trixi lächelnd und wechselte bewusst das Thema. Axel musste abschalten, und das gelang ihm am besten, wenn sie von ihrem Tag erzählte.
***
Dr. Stefan Holl setzte am nächsten Morgen soeben in seinem Büro die Kaffeetasse an die Lippen, als jemand das Büro seiner Sekretärin betrat. Da um diese frühe Uhrzeit die Verbindungstür noch offen stand, hörte er, wie der Besucher seinen Namen nannte.
„Klaus Wiegand. Herr Dr. Borström hat gestern die Unterlagen einer Patientin an Herrn Dr. Holl geschickt mit der Bitte …“
„Kommen Sie herein!“, rief Dr. Holl und winkte den Mann, den er auf Ende zwanzig schätzte, zu sich herein. „Ich bin Dr. Holl. Nehmen Sie Platz, Herr Wiegand! Ich habe gehört, Ihr Vater ist mit meinem Schwager Axel Lassow gut bekannt?“
„Ja, allerdings“, bestätigte Klaus Wiegand. „Ich arbeite in der Anwaltskanzlei meines Vaters, und ich habe Herrn Dr. Lassow auch kennengelernt.“
Dr. Holl merkte, dass sein Besucher nur aus reiner Höflichkeit antwortete, mit den Gedanken jedoch nicht bei der Sache war. „Dr. Borström hat mich noch gestern darüber informiert, wen die Unterlagen betreffen und dass ich Ihnen ruhig Auskunft geben kann.“ Er deutete auf einen vor ihm liegenden Aktenordner. „Ich habe mir die Krankengeschichte vorhin angesehen.“
„Ja, und?“ Klaus beugte sich erwartungsvoll vor.
„Ich sage das jetzt nicht, um meinen Freund Borström zu unterstützen oder weil ich ihm nicht in den Rücken fallen möchte“, erwiderte er. „Aber ich kann nur seine Diagnose bestätigen. Frau Hohmann kann keine Kinder bekommen.“
„Ist das endgültig?“, fragte Klaus Wiegand tief enttäuscht.
„Leider ja“, bestätigte Dr. Holl. „Es handelt sich, laienhaft ausgedrückt, um eine angeborene Deformierung der Ovarien. Würden wir sie operativ korrigieren, wäre das nicht nur ein schwerer Eingriff, sondern es würden auch Narben zurückbleiben, die eine erfolgreiche Schwangerschaft verhindern. Es tut mir leid, aber ich bestätige Dr. Borströms Urteil.“
„Tja, dann …“ Klaus Wiegand stand auf und wirkte nicht wie ein junger, freudig in die Zukunft blickender, sondern wie ein alter und vom Leben gebeugter Mann. „Vielen Dank für Ihre Mühe, Herr Dr. Holl“, fügte er ganz automatisch hinzu, ehe er das Büro verließ.
Der Leiter der Berling-Klinik sah ihm nach, bis sich die Tür schloss. Danach wanderte sein Blick zu einem gerahmten Sinnspruch, den ihm seine Frau Julia vor Jahren geschenkt hatte.
„Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.“
In Klaus Wiegands Fall konnte das nur bedeuten, dass er mit seiner Verlobten beziehungsweise Exverlobten vielleicht doch eine Möglichkeit für eine glückliche Zukunft fand. Auf eigene Kinder musste er mit dieser Frau allerdings verzichten.
Klaus Wiegand war von Dr. Holls Urteil vor allem deshalb so schwer getroffen worden, weil es dadurch bei der Trennung von Sabine blieb. Sie hatte nach der endgültigen Diagnose durch Dr. Borström die Verlobung gelöst und einen klaren Bruch herbeigeführt.
Das Schlimme daran war, dass Klaus keinesfalls auf Sabine verzichten wollte, sich jedoch mit ihrer Entscheidung abfinden musste. Sie hatte recht gehabt, als sie ihm vor Augen hielt, dass sie ohne eigene Kinder nie glücklich werden könnten.
„Du würdest mir immer unterbewusst verübeln, dass ich dir keine Kinder schenken kann“, hatte sie ihm vorgehalten. „Nein, Klaus, ich liebe dich zu sehr, als dass ich das uns beiden antun würde. Eine glatte Trennung ist besser. Darüber werden wir irgendwann hinwegkommen, nicht jedoch über eine Ehe, die nur schlechter werden kann, je länger sie dauert.“
Klaus Wiegand war so in Gedanken versunken, dass er die hübsche junge Schwester erst sah, als er direkt vor ihr stand. Sie wartete am Aufzug, den er angesteuert hatte.
„Ich habe den Rufknopf für die Abwärtsfahrt schon gedrückt“, sagte sie.
Klaus nickte nur.
„Woher kenne ich Sie?“, fuhr die Schwester fort. „Ja, richtig, ich habe Sie in der Klinik Borström gesehen und auch angesprochen.“
„Sie?“ Klaus betrachtete sie daraufhin genauer. Sie trug die übliche Schwesternkleidung und war ihm fremd. Nur bei einem Blick in ihre Augen regte sich eine vage Erinnerung. „Ich weiß nicht mehr“, meinte er unsicher.
„Ich hatte in der Klinik Borström Jeans und Pulli an“, erklärte sie. „Ich habe früher dort gearbeitet und bin jetzt an der Berling-Klinik. An dem Tag habe ich Sie gefragt, ob ich Ihnen helfen kann und ob Sie vielleicht einen Kaffee möchten. Sie sahen noch mitgenommener aus als jetzt. Auch wenn es nicht in meine Zuständigkeit fiel, wollte ich etwas für Sie tun.“
„Ja, jetzt weiß ich es wieder“, bestätigte Klaus, obwohl die Erinnerung sehr blass war. Und unangenehm! Schließlich hatte Sabine sich nach dem Gespräch bei Dr. Borström von ihm getrennt.
„Heute sehen Sie auch mitgenommen aus“, stellte die Schwester fest. „Und in der Berling-Klinik ist es meine offizielle Aufgabe, mich um Patienten oder ihre Angehörigen zu kümmern. Kann ich etwas für Sie tun?“
„Sie sind im Dienst, Schwester …“ Er beugte sich etwas näher, um das Namensschild lesen zu können. „Schwester Miriam?“
„Ja, aber nur noch zehn Minuten“, entgegnete sie verhalten lächelnd. „Ich soll etwas in die Ambulanz bringen. Danach ziehe ich mich um und bin frei. Wenn Sie also einen Wunsch haben, müssen Sie sich beeilen.“
„Ich habe einen Wunsch“, entgegnete er spontan, weil er nach der niederdrückenden Aussprache mit Dr. Holl nicht allein sein wollte. „Dafür muss ich allerdings warten, bis Sie dienstfrei haben. In zehn Minuten werde ich vor dem Ausgang stehen, durch den Sie ins Freie kommen, und fragen, ob Sie mit mir einen Kaffee trinken möchten. Sie sehen nämlich auch so aus, als wollten Sie im Moment nicht unbedingt allein sein.“
Sie sah ihn erstaunt an, weil er so viel Einfühlungsvermögen zeigte. „Das können Sie mich auch fragen, während ich im Dienst bin“, entgegnete sie. „Ich zeige Ihnen gleich den Ausgang bei der Ambulanz. Dort komme ich auf den Parkplatz. Und ich werde gern mit Ihnen einen Kaffee trinken.“
„Dann freue ich mich schon.“ Er verließ mit Schwester Miriam im Erdgeschoss den Aufzug und verließ durch die Schwingtüren der Ambulanz die Berling-Klinik.
Eine Viertelstunde später erschien Miriam tatsächlich wie versprochen auf dem Parkplatz und stieg zu ihm in den Wagen.
„Jetzt erinnere ich mich wieder genau an das Zusammentreffen in der Klinik Borström“, meinte er nach einem Blick auf ihre Jeans, den Pulli und die Turnschuhe. „Kümmern Sie sich eigentlich um alle Leute, die unglücklich dreinsehen?“
„Eigentlich schon“, erwiderte sie. „Das ist bei mir zur zweiten Natur geworden. Oder es ist einfach meine Natur, und ich bin deshalb Krankenschwester geworden. Für mich kam nie ein anderer Beruf infrage.“
„Und für mich war immer klar, dass ich Anwalt werde“, entgegnete er, während er losfuhr. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass mein Vater eine Anwaltspraxis besitzt. Ich bin mit Paragrafen aufgewachsen. Wie war das bei Ihnen?“
„Wir hatten weder Ärzte noch Schwestern in der Familie“, berichtete Miriam. „Ich weiß noch, dass ich schon als kleines Mädchen alle meine Puppen verbunden habe. Und ich habe Fieber gemessen und den Puls gefühlt.“
„Also war es Bestimmung“, meinte er lächelnd und parkte.
Sie hatten ein kleines Café in der Nähe der Berling-Klinik gefunden, und bei einer Tasse Cappuccino unterhielten sie sich über alles Mögliche, ohne dass sie hinterher hätten sagen können, worüber. Was ihnen in den Sinn kam, sprachen sie aus und warteten auf die Meinung des jeweils anderen.
„So spät schon?“, stellte Klaus Wiegand schließlich erstaunt fest. „Höchste Zeit zum Mittagessen. Ich lade Sie ein.“
„Aber nein, wieso sollten Sie so etwas …“, setzte Miriam an. Doch warum nicht? Sie war gern mit Klaus Wiegand zusammen. Er war nett und sympathisch und vertrieb das Gefühl von Einsamkeit, das für sie am schwersten zu ertragen war.
Über das Privatleben war bisher kein Wort gefallen, und beim Mittagessen wichen sie diesem Thema ebenfalls aus. Miriam erzählte nichts von dem Bruch mit Robbi, und Klaus verriet nicht, wer die Frau war, mit der Miriam ihn in der Klinik Borström gesehen hatte.
Als er nach dem Essen fragte, ob sie sich wiedersehen könnten, war Miriam einverstanden.
„Sie erreichen mich in der Berling-Klinik“, entgegnete sie, als er ihre Telefonnummer haben wollte. „Entweder arbeite ich gerade, oder man kann Ihnen sagen, wann meine nächste Schicht beginnt.“
„Ich melde mich“, versprach Klaus, doch als sie sich voneinander verabschiedeten, hegte Miriam kaum Hoffnung, ihn wiederzusehen. Er hatte bestimmt nur aus einer Laune heraus gefragt.
Trotzdem war es nett gewesen, einige Stunden in Klaus Wiegands Gesellschaft zu verbringen und nicht daran zu denken, dass ihr Leben zurzeit alles andere als rosig aussah.
***
Dr. Luise Kasinski schleppte sich zu Tode erschöpft die Stufen zu ihrer Wohnung hinauf, schloss die Tür auf und blieb stirnrunzelnd in der Diele stehen.
Hartmut saß im Wohnzimmer auf dem Sofa und sah ihr gereizt entgegen. Er hatte einen Schlüssel zu ihrer Wohnung, benutzte ihn jedoch nur, wenn sie verabredet waren und ausdrücklich vereinbart hatten, dass er ihre Wohnung betreten und dort auf sie warten oder schon das Essen vorbereiten sollte.
„Was machst du denn hier?“, fragte sie nicht sonderlich freundlich. „Ich habe dich erst morgen erwartet.“
„Ja, das merke ich“, erwiderte er zornig. „Ich dachte schon, dass du mich bis morgen warten lässt.“
„Auf meinem Terminkalender habe ich den Abend mit dir für morgen eingetragen“, entgegnete sie gereizt.
„Mag sein, aber am Telefon haben wir gestern vereinbart, dass ich heute zu dir komme. Ich warte seit zwei Stunden.“ Hartmut griff nach dem Jackett. „Ich kann natürlich gehen, wenn ich dir so lästig bin.“
„Nein, bitte!“ Sie hielt ihn auf dem Weg zur Tür zurück. „Es tut mir leid. Wahrscheinlich habe ich etwas durcheinandergebracht. Ich weiß nicht mehr, was mit mir ist. Dr. Lassow hat heute einen leichten Tobsuchtsanfall bekommen und angekündigt, dass er mich in Urlaub schickt, wenn ich so weitermache.“
„Was ist los mit dir?“, fragte Hartmut, schon etwas sanfter gestimmt. „Du siehst schrecklich aus, so, als wärst du krank.“
„Ich fühle mich auch krank“, gestand Luise und ließ sich auf das Sofa sinken. „Seit einigen Wochen läuft alles schief. Ich lösche wichtige Arbeit im Computer und muss sie noch einmal machen. Ich vergesse Termine, weil ich sie nicht im Kalender eingetragen habe. Ich bringe Termine durcheinander. Und ich mache Fehler.“
„Warst du schon beim Arzt?“ Hartmut setzte sich zu ihr und legte ihr den Arm um die Schultern. „Vielleicht kann er dir helfen.“
„Dann müsste er mir vermutlich einen neuen Kopf verschreiben“, scherzte Luise matt. „Ich habe keine Ahnung, was los ist. Früher ist mir doch so etwas nicht passiert, und jetzt ständig.“
„Du bist überarbeitet“, meinte Hartmut.
„Von einem Tag auf den anderen?“ Luise schüttelte den Kopf. „Das kann ich mir nicht vorstellen. Manchmal bekomme ich es mit der Angst, wenn ich mir vorstelle, was die Ursache sein könnte.“
„Man merkt Überarbeitung eben nicht sofort“, redete Hartmut ihr gut zu. „Und falls du andeuten willst, dass mit deinem Verstand etwas nicht stimmt, kann ich dir versichern, dass ich nie eine klügere und schärfer denkende Frau als dich kennengelernt habe.“
„Lieb, dass du das sagst.“ Luise schmiegte sich Halt suchend an ihn. „Trotzdem habe ich in der letzten Zeit mehr als einmal an meinem Verstand gezweifelt.“
„Kein Grund zur Sorge“, beteuerte er noch einmal. „Ein Arztbesuch wäre trotzdem keine schlechte Idee. Der Doktor sollte dich auf Herz und Nieren untersuchen. Ich glaube, du leidest ganz einfach unter Stress. Du hast mir oft erzählt, wie anstrengend die Arbeit für Dr. Lassow ist.“
„Das stimmt schon, aber ich habe sie immer geschafft.“
„Irgendwann wird es jedem zu viel“, versicherte Hartmut. „Deshalb solltest du dir keine Sorgen machen. Aber deine Gesundheit ist wichtig. Geh zu einem guten Arzt!“
An diesem Abend zeigte Hartmut sich von seiner angenehmsten Seite. Er ließ nicht zu, dass Luise auch nur einen Handgriff tat, sondern kümmerte sich um alles. Beim Essen entspannte sie sich allmählich und konnte über einige Missgeschicke der letzten Zeit sogar lachen.
Trotzdem blieb die tief sitzende Sorge, was nun wirklich mit ihr war. Sie konnte einfach nicht glauben, dass bloße Überarbeitung die Schuld an allen Fehlern und Pannen hatte. Es musste noch einen anderen Grund geben, und der machte ihr gewaltig Angst.
***
„Ich bin wieder da, Oma!“, rief Bertram Vrede, warf die Tasche mit seinen Büchern für die Uni in eine Ecke und ging in die Küche. „Oma, wo steckst du?“, fügte der Neunzehnjährige hinzu.
Alles blieb still. Das Summen des Kühlschranks war das einzige Geräusch im Haus.
„Oma?“ Vielleicht war sie im Garten. Ja, sicher sogar. Die Hintertür war nur angelehnt. Doch als Bertram ins Freie trat, war von seiner Großmutter weit und breit keine Spur zu sehen.
Allmählich wurde er unruhig. Es war ein warmer, sonniger Tag. Solche Gelegenheiten nutzte seine Großmutter gern, um sich auf die Terrasse zu setzen. Weil sie die heißen Sonnenstrahlen nicht mehr vertrug, spannte sie stets einen Schirm auf und setzte sich in den Schatten.
Merkwürdig. Der Schirm war aufgespannt. Bertrams Sorge steigerte sich, als er auf dem Tisch ein Buch und die Lesebrille seiner Großmutter fand. Nur von ihr fehlte jede Spur. Er suchte das Haus systematisch ab, doch die Oma hielt sich in keinem der Räume auf. Sie war auch nicht im Bad.
Schließlich hielt Bertram es nicht mehr aus. Es sah ganz so aus, als hätte sich seine Großmutter zum Lesen auf die Terrasse gesetzt, wäre dann aber weggegangen, ohne das Haus abzuschließen. Sie war nicht sonderlich ängstlich und fürchtete sich nicht vor Einbrechern, aber bisher hatte sie das Haus nie unverschlossen zurückgelassen.
Rasch stieg er in seinen Kleinwagen, den er vor einem Jahr von den Eltern bekommen hatte, und fuhr durch die umliegenden Straßen.
Beinahe hätte er die dick vermummte Frau nicht beachtet, die auf dem Bürgersteig zielstrebig marschierte. Er warf ihr nur einen Blick zu, weil er sich wunderte, wieso an einem so warmen Tag jemand einen dicken Mantel anzog und dazu auch noch eine gefütterte Mütze aufsetzte.