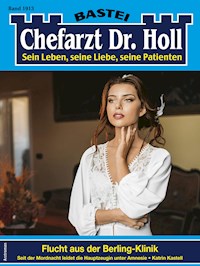5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Willkommen zur privaten Sprechstunde in Sachen Liebe!
Sie sind ständig in Bereitschaft, um Leben zu retten. Das macht sie für ihre Patienten zu Helden.
Im Sammelband "Die besten Ärzte" erleben Sie hautnah die aufregende Welt in Weiß zwischen Krankenhausalltag und romantischen Liebesabenteuern. Da ist Herzklopfen garantiert!
Der Sammelband "Die besten Ärzte" ist ein perfektes Angebot für alle, die Geschichten um Ärzte und Ärztinnen, Schwestern und Patienten lieben. Dr. Stefan Frank, Chefarzt Dr. Holl, Notärztin Andrea Bergen - hier bekommen Sie alle! Und das zum günstigen Angebotspreis!
Dieser Sammelband enthält die folgenden Romane:
Chefarzt Dr. Holl 1832: Stimmen im Kopf
Notärztin Andrea Bergen 1311: Wie lange wirst du noch spielen?
Dr. Stefan Frank 2265: Abenteuer Kanada
Dr. Karsten Fabian 208: Die Rivalin kam ins Heidedorf
Der Notarzt 314: Notruf aus dem Hörsaal
Der Inhalt dieses Sammelbands entspricht ca. 320 Taschenbuchseiten.
Jetzt herunterladen und sofort sparen und lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2016/2018 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © u
ISBN: 978-3-7517-6481-0
https://www.bastei.de
https://www.sinclair.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Die besten Ärzte - Sammelband 67
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Chefarzt Dr. Holl 1832
Stimmen im Kopf
Die Notärztin 1311
Wie lange wirst du noch spielen?
Dr. Stefan Frank 2265
Abenteuer Kanada
Dr. Karsten Fabian - Folge 208
Die wichtigsten Bewohner Altenhagens
Die Rivalin kam ins Heidedorf
Der Notarzt 314
Notruf aus dem Hörsaal
Guide
Start Reading
Contents
Stimmen im Kopf
Warum eine Frau glaubt, verrückt zu werden
Von Katrin Kastell
Nur wer vergessen wird, ist wirklich tot. Du wirst in meiner Erinnerung ewig weiterleben.
Als ihr geliebter Mann vor fast vier Jahren bei einem Brand ums Leben kam, hat Eva-Maria Bucksteller sich selbst und ihm dieses Versprechen gegeben. Immer noch hält sie gern eine stille Zwiesprache mit ihm, erzählt ihm in Gedanken die Dinge, die sie am Tag erlebt hat, was sie bedrückt und glücklich macht.
Doch alles wird anders, als Jörg ihr plötzlich „antwortet“. Laut und deutlich hört sie seine Stimme, so, als befinde er sich mit ihr im selben Raum!
Empfindet Eva-Maria im ersten Augenblick pure Freude, fürchtet sie im nächsten Moment den Verstand zu verlieren …
„Das ist seelische Grausamkeit! Ich komme nach Hause, und du musst los zur Arbeit. Sag mir eine Beschwerdestelle im Universum, und ich beschwere mich!“, brummelte Dr. Jörg Bucksteller. Er umarmte seine Frau und hielt sie fest, obwohl sie sich zu befreien versuchte und zur Tür strebte. Sie war spät dran und musste zur Arbeit.
„Jörg, du bis unmöglich!“, schimpfte Eva-Maria Bucksteller lachend und gab ihm noch einen spielerischen Kuss auf die Nasenspitze. „Ich muss los! Du weißt doch, wie wichtig es ist, dass ich bei der Übergabe dabei bin. Wärst du pünktlich gekommen, Mann meines Herzens, hätten wir noch einen Tee zusammen trinken können.“
„Du weißt doch, wie wichtig es ist, dass ich bei der Übergabe …“, wiederholte er ihren Satz. „Hans kam etwas später, und ich musste noch etwas wegen der Schmerzbehandlung einer Patientin mit ihm durchsprechen.“
„Unsere Liebe droht zum Opfer der modernen Medizin zu werden – merkst du das? Ich glaube, wir müssen ein Zeichen setzen und in aller Form protestieren!“ Er zog sie noch einmal an sich und küsste sie wieder.
„Hmmmm! Protestieren ist schön! Daran könnte ich mich gewöhnen, aber ich muss trotzdem los! Leider.“ Sie schmiegte sich einen Moment an ihn und genoss seine Zärtlichkeit, dann machte sie sich resolut frei. „Es ruft die Pflicht!“
„Oh, lass sie rufen! Hör nicht hin, mein holdes Weib und …“
„Und was sage ich dann Doktor Holl, wenn er mich wegen Pflichtvergessenheit im Dienst einbestellt? Am besten schiebe ich die ganze Schuld auf dich. Assistenzärzte sind auch nicht mehr, was sie einmal waren …“, drohte Eva-Maria.
Sie warf ihm einen verschmitzten Blick zu und setzte ihre Rede fort.
„Und wenn er das deinem Vater erzählt, dann wirst du einbestellt zum Familienkonzil und bekommst einmal mehr zu hören, dass ein Arzt in der dritten Generation unter keinen Umständen und nie und nimmer eine Krankenschwester ehelicht. Bei Standesverrätern wundert es nicht, wenn sie den Anforderungen ihres Standes …“
„Aufhören!“ Er hielt sich die Ohren zu.
„Vor der Wahrheit, der reinen Wahrheit, kann man nicht die Ohren verschließen. So wird das kommen, wenn du mich nicht gleich und auf der Stelle loslässt. Willst du das, mein Herz?“, neckte sie ihn.
„Biest!“ Jörg schüttelte den Kopf, gab sie aber widerstrebend aus seiner Umarmung frei. Er war Assistenzarzt auf der onkologischen Station der Berling-Klinik in München, und Eva-Maria arbeitete dort als Krankenschwester auf der Intensivstation.
Dr. Stefan Holl war der Leiter der Klinik, mit dem sie nicht nur beruflich, sondern in gewisser Weise auch privat verbunden waren.
Jörgs Vater war wie Dr. Holl Gynäkologe, und die Männer waren eng befreundet und kamen regelmäßig zum Medizinerstammtisch mit anderen Kollegen zusammen. Dr. Holl kannte Jörg seit seinen ersten Studienjahren und war eher ein väterlicher Freund. Der Klinikleiter hütete sich, je ein Wort über Jörgs Arbeit gegenüber dessen Vater zu verlieren, weil er wusste, dass Vater und Sohn ein schwieriges Verhältnis hatten. Trotzdem neckten sich Jörg und Eva-Maria öfter damit.
„Ich bringe morgen früh frische Brötchen mit und halte mich für eine Tasse Kaffee mit dir wach!“, versprach Eva-Maria und war schon in der Tür.
„Ich will ein Baby mit dir haben und Papa werden!“, rief er ihr da aus heiterem Himmel zu.
Sie blieb wie angewurzelt stehen. Eva-Maria liebte Kinder und wünschte sich eigene. Bisher hatte Jörg sie immer um noch etwas Zeit gebeten, weil er erst Stationsarzt sein und besser verdienen wollte, bevor er daran dachte, eine Familie zu gründen.
„Ist das dein Ernst?“, fragte sie unsicher und wagte noch nicht, sich zu freuen. Plötzliche Meinungsänderungen waren eigentlich nicht Jörgs Art.
„Mit so etwas mache ich keine Scherze. Heute Nachmittag ging mir auf, was für ein Idiot ich bin. Das Leben kann so entsetzlich schnell vorbei sein. Du möchtest Kinder, ich möchte Kinder, und anstatt es immer wieder zu verschieben, sollten wir es angehen. Es ist nicht gut, auf später zu verschieben, was wirklich wichtig ist.“
„Und das sagst du mir zwischen Tür und Angel? Bist du wahnsinnig?“ Sie strahlte vor Freude und warf sich in seine Arme.
„Ich musste es dir gleich sagen, falls ich heute Nacht wieder Angst bekomme vor der Verantwortung. Falls ich ein miserabler Vater werde, baue ich darauf, dass du als Mutter nur umso besser bist und für einen Ausgleich sorgst.“
„Du wirst ein toller Papa sein! Mein mutiger, wunderbarer, einmaliger, großartiger, unvergleichlicher Mann!“ Eva-Maria bedeckte sein Gesicht mit Küssen.
„Geh schon!“ Lachend schob er sie von sich. „Morgen früh machst du genau an dieser Stelle weiter!“ Er deutete auf die Stelle an seinem Kinn, an der sie ihn eben geküsst hatte.
„Wird gemacht! Ich liebe dich!“
„Und ich dich. Verschwinde! Sonst werde ich doch noch von meinem Vater vor das Familiengericht beordert, und darauf habe ich gar keine Lust.“
„Irgendwann wirst du ihm sagen müssen, dass er Opa wird. Das wird neckisch. Bin ich froh, dass ich nicht dabei sein werde. Glück braucht der Mensch.“
„Verschwinde!“
Eva-Maria summte auf der Fahrt zur Berling-Klinik glücklich vor sich hin. Jörg und sie hatten sich auf einer Gartenparty der Holls kennengelernt. Jeden Sommer lud der Klinikleiter zu einer Gartenparty mit zahllosen Lampions, Musik und kaltem Büffet ein. Alle, die keinen Dienst hatten, ließen es sich dort gut gehen, und die Party war immer über Wochen hin das Thema in der Berling-Klinik.
Für Jörg und Eva-Maria war jener Abend unvergesslich geblieben. Bei ihnen war es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Zwei Jahre lag das nun zurück, und sie hatten von jenem Abend an nie daran gezweifelt zusammenzugehören.
Dabei hatten sich ihnen unerwartete Hindernisse in den Weg gestellt. Jörgs Eltern lehnten Eva-Maria kategorisch ab, weil sie nur eine Krankenschwester war. Ihrer Überzeugung nach hatte ihr Sohn bessere Chancen auf dem Heiratsmarkt. Ihre Ablehnung reichte so tief, dass sie demonstrativ nicht zu der kleinen Hochzeitsfeier vor einem Jahr erschienen waren.
Da Eva-Maria keine Familie mehr hatte, war es Stefan Holl gewesen, der die Braut zu ihrem Bräutigam an den Altar geführt hatte. Für das junge Paar war der Klinikleiter so etwas wie ein Schutzpatron, dem sie vertrauten.
„Heutzutage sind Scheidungen nur noch eine Formsache. Wenn du irgendwann wieder zu Verstand kommst, lässt sich der Schaden beheben.“ Jörgs Mutter hatte ihren Sohn ein paar Tage nach der Trauung mit diesen Worten begrüßt.
„Papa hat den Schaden nie behoben. Soweit ich weiß, stammst du zwar aus einer angesehenen Münchner Industriellenfamilie, aber Medizin hast du nicht studiert, oder?“ Nach dieser Antwort hatte sie ihn wortlos stehen lassen und war für einige Monate beleidigt gewesen, was ihn wenig gekümmert hatte.
Erstaunlich, dass deine Krankenschwester dich zu uns gehen lässt … So wurde Jörg jedes Mal spöttisch von seinem Vater, Dr. Bernhard Bucksteller, begrüßt, wenn er ohne seine Frau zu einem Familienfest kam. Eva-Maria wurde nie direkt ausgeladen, aber sie tauchte auch nie auf einer Einladung auf.
„Eva-Maria hat mich überredet zu kommen. Ohne ihren Einfluss wäre ich mit Sicherheit nicht hier!“, antwortete Jörg dann ärgerlich.
In der Tat ließ Eva-Maria nicht zu, dass er den Kontakt zu seinen Eltern einschlafen ließ, obwohl sie in deren Haus nicht willkommen war.
„Du hast noch Eltern, Jörg. Glaub mir, ganz egal, wie schwierig es gerade ist, das ist kostbar. Ich wünschte, ich hätte dir meinen Vater und meine Mutter vorstellen können. Sie hätten dich gemocht. Irgendwann merken deine Eltern vielleicht, dass sie sich in mir täuschen und dass ich dir eine gute Frau bin.“
„Es ist doch vollkommen egal, was diese zwei arroganten Sturköpfe denken. Sie haben keine Ahnung“, schimpfte er zu solchen Gelegenheiten.
„Mir ist es wichtig, Jörg, weil ich weiß, dass sie dich lieben – genau wie ich.“
Ob ein Enkelkind etwas an der Meinung ihrer Schwiegereltern ändern würde? Eva-Maria wünschte es sich sehr. Zu ihrer Vorstellung von einer Familie gehörten Oma und Opa, die Anteil am Leben ihres Enkels hatten. Mama – sie würde endlich Mama sein. Am liebsten hätte sie die ganze Welt umarmt.
***
Für die Übergabe auf der Intensivstation kam sie auf die Minute pünktlich und lächelte ihre Kollegin vom Spätdienst entschuldigend an. Es war immer schöner, wenn etwas mehr Zeit blieb. Für gewöhnlich war sie immer zehn Minuten früher auf der Station, damit sie ganz entspannt ihre Patienten übernehmen konnte.
„Alles gut, Eva-Maria!“, winkte die ältere Kollegin beruhigend ab. „Wir sind nicht voll belegt, und bei einigen Patienten steht eine Verlegung auf die Normalstation morgen früh auf dem Plan, weil sich ihr Zustand stabilisiert hat. Ich denke, ihr werdet eine ruhige Nacht haben. Das wünsche ich euch zumindest sehr. Die letzten drei Nächte hatten es in sich. Ich habe es in euren Aufzeichnungen gesehen.“
Eva-Maria war in dieser Nacht für fünf Patienten zuständig, denen es aber dafür, dass sie noch auf der Intensivstation lagen, bereits deutlich besser ging. Tagsüber betreute sie oft nur zwei oder drei Patienten. Es hing immer davon ab, wie viel Pflege ein Kranker brauchte und wie ernst sein Zustand war.
Da sie ihre Arbeit äußerst sorgfältig ausübte, bedeuteten fünf Patienten trotz allem, dass sie fast die ganze Nacht auf den Beinen war und selten dazu kam, sich auch einmal hinzusetzen, um die schriftlichen Eintragungen vorzunehmen, die nun einmal auch zu ihrer Arbeit gehörten.
Kurz nach vier Uhr ging sie zu den Überwachungsmonitoren, die im vorderen Bereich der Station aufgestellt waren. Ihre zwei Kolleginnen saßen bereits dort, gönnten sich eine Tasse Kaffee und gaben dabei in den Computer ein, was dokumentiert werden musste. Sie unterhielten sich dabei.
„Schrecklich, wenn so etwas passiert! Was wohl die Ursache für den Brand war?“, hörte Eva-Maria die eine sagen.
„Man kann nur hoffen, dass es kein menschliches Fehlverhalten war. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre für so eine Katastrophe verantwortlich und Menschen würden durch mich alles verlieren und sogar sterben – damit könnte ich nicht leben!“
„Ich auch nicht“, stimmte die erste Kollegin zu.
„Was ist denn passiert?“, fragte Eva-Maria, die bis eben bei ihren Patienten gewesen war und nichts mitbekommen hatte.
„Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in einem Viertel nahe der Innenstadt. Wir bekommen in etwa einer halben Stunde zwei neue Patienten hoch von der Notaufnahme. Eine Einundachtzigjährige mit schwerer Rauchvergiftung und einem Herzinfarkt durch die Aufregung. Es sieht nicht gut aus“, wurde sie informiert.
„Ihr dreiundfünfzigjähriger Sohn schlief im Zimmer neben ihr und hat auch eine schwere Rauchvergiftung. Sein Zustand ist etwas besser, und er wird es hoffentlich schaffen. Übel! Für einen Mann, der vier Stockwerke über den beiden in seiner Wohnung schlief, kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot von der Feuerwehr geborgen werden. Der Schwelbrand muss direkt im Zimmer unter ihm ausgebrochen sein“, sagte die andere Kollegin.
Eva-Maria lief ein Schauder über den Rücken, aber sie schob die dunkle Ahnung weg. So etwas passierte nicht! Das waren zufällige Ähnlichkeiten und nicht mehr.
„Gut, dass wir noch Sommerferien haben. Die drei anderen Wohnungen waren leer. Die Leute sind wohl noch im Urlaub mit ihren Kindern. Wenigstens etwas!“, fügte ihre Kollegin noch an und redete weiter.
Eva-Maria hörte nicht mehr zu. Das war eine Ähnlichkeit zu viel. Und wenn so etwas Entsetzliches doch zweimal in einem Leben passieren konnte? Was war, wenn ihre Kolleginnen tatsächlich von dem Mietshaus sprachen, in dem sie mit Jörg wohnte?
Ein Fünf-Familienhaus am Rande der Innenstadt, im Erdgeschoss eine alte Dame mit ihrem älteren Sohn, dann drei Stockwerke mit Familien mit Kindern, die gerade im Urlaub waren, und im obersten Stock ihre Wohnung. Das passte alles. Und doch konnte sie es nicht glauben.
Vor fünf Jahren, sie hatte gerade ihre Zusatzausbildung zur Intensivschwester begonnen, waren ihre Eltern bei einem schweren Auffahrunfall auf der A81 gestorben. Eva-Maria hatte bei der Arbeit von dem Unfall erfahren, der über fünfzehn Autos betroffen hatte.
Erst als die Polizei sie später informiert hatte, hatte sie begriffen, dass ihre Eltern, die von einem Kurzurlaub im Schwarzwald zurückgekommen waren, in den Unfall verwickelt gewesen waren. Ihre Mutter war noch am Unfallort gestorben und ihr Vater im Hubschrauber auf dem Weg zur Klinik.
Mit Jörg war alles in Ordnung, und es war nur ihre alte Angst, die sie glauben ließ, ihr Haus könne von dem Brand betroffen sein. Eva-Maria merkte, dass es ihr den Angstschweiß aus den Poren trieb. Nach dem Tod ihrer Eltern hatte sie ein halbes Jahr lang unter solchen Panikattacken gelitten.
Mit Hilfe eines Traumatherapeuten hatte sie diese Attacken dann überwunden und war seither davon verschont geblieben. Ärgerlich, dass ihr das nach über fünf Jahren nun wieder passierte. Sicher hing es damit zusammen, dass sie wegen Jörgs Entscheidung, nun doch gleich ein Kind zu wollen, noch etwas aus dem Häuschen war.
„Du bist ja totenbleich, Eva-Maria. Ist alles in Ordnung mit dir?“, wollte eine ihrer Kolleginnen wissen und musterte sie besorgt. „Möchtest du nach den Einträgen gehen? Bis zur Übergabe ist es doch nicht mehr lange. Da kommen wir ohne dich klar“, bot sie großzügig an.
„Nein! Mir geht es gut!“, lehnte Eva-Maria ab und rang sich mühsam zu einem halbherzigen Lächeln durch. Sie stand auf, reckte sich etwas, um die Verkrampfungen zu lockern, die sie am ganzen Körper spürte, und ging dann zu einem Computerterminal etwas abseits.
Die zwei Patienten, die demnächst nach oben gebracht werden sollten, waren bereits gemeldet, und ihre gesamten Daten fanden sich im Programm. Eva-Maria las die Namen und die Adresse. Da war kein Schmerz, den sie empfand. Da war nur Leere, absolute Leere.
Der Boden unter ihren Füßen löste sich in seine molekularen Bestandteile auf und verlor jede feste Struktur. Er war nur Illusion über einem endlosen Abgrund, in dem es nichts mehr gab, an dem man sich hätte festhalten oder orientieren können.
Dankbar spürte Eva-Maria, wie etwas in ihr den Hebel für absolute Notfälle fand und umlegte. Bewusstlos kippte sie vom Stuhl und schlug hart auf dem Boden auf, aber davon merkte sie nichts mehr. Ihr Bewusstsein hatte sich vor dem Unerträglichen geschützt.
Als sie wieder zu sich kam, hoben ein Pfleger und ein Arzt, den sie kannte, sie gerade in ein Bett. Dr. Georg Löhrer war Assistenzarzt auf der Intensivstation. Er überprüfte ihren Blutdruck und wollte sie untersuchen, als er bemerkte, dass sie zu sich gekommen war.
„Hallo, Eva-Maria! Du hast uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt“, sagte er freundlich.
Sie wollte sich in eine sitzende Position aufrichten, aber es gelang ihr nicht. Um sie herum drehte sich alles.
„Bleib liegen! Hast du schon länger Probleme mit dem Blutdruck?“, fragte Dr. Löhrer besorgt. Er hatte mit Jörg seine Assistenzarztzeit in der Berling-Klinik begonnen und war schon oft bei ihnen zu Hause gewesen.
„Jörg ist tot“, sagte Eva-Maria mit tonloser Stimme. Es war das erste Mal, dass sie es aussprach, und damit wurde es real.
„Wie kommst du denn auf so etwas?“, meinte Georg. „Der liegt daheim im Bett und schläft friedlich, während wir Nachtdienstler schuften. Er hat diese Woche Spätdienst, soweit ich weiß. Du hast nur geträumt.“
„Georg, Jörg ist tot. Der Hausbrand – das war unser Haus. Frau Schrepel und ihr Sohn wohnen im Erdgeschoss. Ihnen gehört das ganze Haus. Jörg ist tot.“ Sie sagte es noch einmal, und da konnte sie den Schmerz plötzlich spüren, und ihr Bewusstsein weigerte sich, noch einmal zu fliehen, obwohl sie keine Ahnung hatte, wie sie diesen Kummer ertragen sollte.
Ihr Körper krümmte sich zusammen, als ob er seine Oberfläche gegen die anbrandende Pein verkleinern müsse. Sie stöhnte qualvoll auf, und dann kamen die Tränen. Es war kein Weinen, eher ein den ganzen Körper aufbäumendes Schluchzen. Eva-Maria brach innerlich zusammen und war von dem Moment an nicht mehr ansprechbar.
Dr. Georg Löhrer warf einen Blick in den Computer und wurde bleich. Er kannte die Adresse nur zu gut, die da bei den Patienten stand, die gerade hoch auf die Intensivstation gebracht wurden. Eigentlich war er wegen ihnen gekommen, um sie auf der Station aufzunehmen.
Betroffen zog er ein Beruhigungsmittel für Eva-Maria auf und spritzte es ihr. Sie schlief kurz danach ein. Georg rief Dr. Holl an. Es war Viertel vor fünf Uhr morgens, und der Klinikleiter wurde von dem Anruf aus dem Schlaf gerissen, aber in einem solchen Notfall ließ sich das nun einmal nicht vermeiden.
Georg war bei Eva-Marias und Jörgs Hochzeit gewesen und wusste, wie nah sich Dr. Holl und Eva-Maria standen. Auf die Schnelle fiel ihm niemand ein, den er ansonsten hätte informieren können. Soweit er wusste, hatte sie keine eigenen Verwandten mehr, und ihre Freunde kannte er nicht.
„Mein Gott! Ich komme sofort. Danke, dass Sie mich angerufen haben!“, reagierte Stefan Holl und war sofort hellwach. „Wurden die Eltern von Doktor Bucksteller schon informiert?“
„Kaum. Es ist gerade erst passiert, und Eva-Maria hat es nur erfahren, weil Hausbewohner von ihr auf die Intensivstation verlegt werden.“
„Dann ist sein Tod noch nicht offiziell bestätigt?“, fragte Dr. Holl hoffnungsvoll. Es musste sich um einen Irrtum handeln! Konnte Jörg nicht rechtzeitig aus dem Haus geflohen sein? Er war jung und fit. Bestimmt hatte er es geschafft.
„Nein, das ist er nicht. Ich denke, die Feuerwehr ist noch dabei zu ermitteln, wer der Tote ist, der im fünften Stock des Hauses gefunden wurde. Jörg war allein zu Hause und schlief. Es besteht kein Zweifel, dass … dass …“ Dr. Löhrer schluckte. Ganz konnte er noch immer nicht begreifen, was geschehen war. Es war einfach unfassbar.
Jörg war ein Kollege und fast ein Freund. Vor ein paar Tagen hatten sie im Ärztekasino der Klinik zusammen gegessen und sich gegenseitig ihr Leid als unterbezahlte Assistenzärzte geklagt. Sie hatten über Kinder gesprochen. Georg Löhrer war Vater von zwei Söhnen, auf die er sehr stolz war. Er hatte Jörg zugeraten, nicht mehr zu lange zu warten.
„Sind Sie in der Lage weiterzuarbeiten, oder wollen Sie lieber nach Hause gehen?“, bot Dr. Holl ihm an.
„Mein Dienst geht nur noch eine gute Stunde. Das geht schon. Es ist nur …“ Wieder brach Dr. Löhrer ab. Es war ihm unangenehm, vor dem Klinikleiter seine Gefühle nicht im Griff zu haben. Als Arzt musste man schließlich mit so einer Nachricht umgehen können, fand er.
„Zu unserem Geschäft gehört der Tod, und wir bilden uns ein, wir wären auf alles vorbereitet. Das ist Unsinn. Darauf kann kein Mensch vorbereitet sein. Es ist immer etwas anderes, wenn es Menschen trifft, die wir persönlich kennen“, sagte Dr. Holl traurig.
***
Eva-Maria erlitt einen schweren Nervenzusammenbruch und verbrachte eine Woche auf der psychiatrischen Station der Berling-Klinik. Nur mit Hilfe von Beruhigungsmitteln überstand sie den ersten Schmerz und kam langsam zu sich.
Es waren Jörgs Eltern, die sich um die Beerdigung ihres Sohnes kümmerten. Am Grab reichten Dr. Bernhard Bucksteller und seine Frau ihrer Schwiegertochter kühl die Hand. Vielleicht hätte ein Enkelkind die Fronten erweichen können, der Tod vermochte es nicht. Selbst in ihrem Schmerz hatten sie sich nichts zu sagen.
Eva-Maria stand einmal mehr vollkommen alleine in der Welt. Ihre Wohnung war ausgebrannt, und es gab nichts mehr, was sie hätte retten können. Ihr blieben nur die Kleidungsstücke, die sie am Körper getragen hatten in jener Nacht.
All die kostbaren Erinnerungsstücke aus ihrer Kindheit und an ihre Eltern waren verbrannt. Jörgs und ihre Möbel, die Fotos und all der Schnickschnack, der sich in einem Leben so ansammelte, waren verloren. Es gab nichts mehr, was Zeugnis über die zwei glücklichen gemeinsamen Jahre hätte ablegen können bis auf die Bilder in ihrer Erinnerung.
Aufrecht stand Eva-Maria am Grab ihres Mannes. Ihre Miene war ausdrucksleer, und die abweisende Kälte ihrer Schwiegereltern berührte sie nicht. Es gab nichts mehr, was sie hätte berühren können, denn in ihr war alles öde und leer.
„Es tut mir so leid! Wie dumm die beiden sind! Du bist doch das Einzige, was ihnen von ihrem Sohn geblieben ist“, sagte Dr. Holl mit tiefer Anteilnahme, als er Eva-Maria zusammen mit seiner Frau Julia vom Friedhof führte. Er war entsetzt über die Kaltherzigkeit seines Kollegen und Freundes.
Dr. Stefan Holl und Julia hatten sich in den Tagen nach Jörgs Tod fürsorglich um Eva-Maria gekümmert. Sie machten sich große Sorgen um die junge Frau, die zum zweiten Mal durch so eine Hölle gehen musste. Vorerst hatten sie Eva-Maria dazu gebracht, bei ihnen zu wohnen, bis sie wieder etwas Eigenes gefunden hatte.
„Wir hatten an den schönen Tagen keinen Kontakt. Warum sollten wir an den trostlosen Tagen zusammenstehen. Jörg und ich, wir wollten ein Kind. Wir … Ich wünschte, ich wäre schwanger von ihm, aber das bin ich nicht. Ich habe keinen Trost für seine Eltern, und ich habe auch keinen Trost für mich“, antwortete Eva-Maria müde.
„Jörg hat dich sehr geliebt, und du hast ihn froh gemacht. So ausgeglichen und heiter wie in den letzten zwei Jahren mit dir habe ich ihn zuvor nie erlebt. Du hast ihm gutgetan“, sagte Dr. Holl eindringlich, um die Feindseligkeit der Eltern vergessen zu machen.
Verloren sah sie ihn an. Er meinte es gut, aber seine Worte taten nur weh. Jörg hatte sie froh gemacht und ihr gutgetan. Bei ihm hatte sie wieder ein Zuhause gefunden und sich geborgen gefühlt nach dem Tod ihrer Eltern. Und nun war auch er tot.
Eva-Maria wünschte, sie hätte mit ihm tauschen können. Warum war nicht er zum Nachtdienst gefahren und hatte sie alleine zu Hause gelassen? Warum hatte sie nach der wunderschönen Nachricht nicht beschlossen, die Nacht freizunehmen, und sich krankgemeldet?
Sonderlich kollegial war so etwas nicht, aber es gab immer eine Springerin, die für sie übernommen hätte. Warum war sie nur so verdammt pflichtbewusst gewesen und zur Berling-Klinik gefahren? Sie hätte mit ihm sterben können, und nun musste sie ohne ihn leben. Dabei hatte sie keine Ahnung, wie sie das schaffen sollte.
Im Nachhinein beneidete Eva-Maria ihre Eltern darum, dass sie zusammen hatten gehen dürfen. Zuvor hatte sie sich immer gewünscht, sie hätte zumindest einen von ihnen behalten können. Nun wusste sie, wie grausam dieser Wunsch gewesen war. Nein, ihren Eltern war der Schmerz erspart geblieben, auseinandergerissen zu werden.
„Eva-Maria, gib nicht auf!“, bat Julia Holl sie. Die Arztfrau konnte kaum mit ansehen, wie sehr die junge Frau litt. „Es wird besser werden – irgendwann.“
„Ich weiß. Ich kenne das schon. Irgendwann lernt man, damit zu leben. Es dauert, und es kommt immer wieder hoch, aber man lernt, damit zu leben“, sagte Eva-Maria, um ihre Freundin zu trösten.
Zu Hause bei den Holls zog sie sich sofort auf ihr Zimmer zurück. Sie weinte nicht mehr. Ihr war, als ob es keine Tränen mehr in ihr geben würde. Reglos saß sie auf dem Gästebett und sah vor sich hin. Es ging weiter. Natürlich tat es das. Genau das machte sie so hilflos, denn sie wollte nicht, dass es weiterging.
Sie hatte keine Kraft mehr, und sie wollte, dass dieses Leid ein Ende hatte. Wie gerne wäre sie Jörg freiwillig gefolgt, aber so etwas kam für sie nicht infrage. Ihre Eltern hatten sie katholisch erzogen, und auch wenn sie nicht strenggläubig war, betrachtete sie Selbstmord als eine schwere Sünde.
Aber das war es nicht allein. Als Intensivschwester sah sie zu viel Krankheit und Elend, um das Leben nicht zu ehren. War man gesund, konnte morgens aufstehen und seine Arbeit tun, dann hatte man in ihren Augen nicht das Recht, Hand an sich zu legen. Sosehr das Leid sie auch beugte, so war ihr das Leben heilig.
Eva-Maria blieb sechs Wochen bei den Holls, dann konnte sie in eine kleine Zweizimmerwohnung umziehen, die sie ganz in der Nähe der Berling-Klinik für sich gefunden hatte. Die Arbeit war es, in der sie Vergessen, wenn auch keinen Trost fand.
„Du musst uns oft besuchen kommen!“, baten die vier Kinder der Holls sie zum Abschied, mit denen sie sich sehr gut verstanden hatte. Für sie gehörte sie zur Familie.
„Versprochen!“, sagte Eva-Maria und freute sich über die offensichtliche Zuneigung.
Nun würde sie doch keine eigenen Kinder haben. Sie trauerte um Jörg, um das gemeinsame Leben, das ihnen nicht vergönnt gewesen war, und um das Kind, das sie sich so sehr von ihm gewünscht hatte.
Eva-Maria war zu diesem Zeitpunkt achtundzwanzig, aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass es jemals einen anderen Mann in ihrem Leben geben würde. Jörg war genau der Richtige gewesen, und er würde der einzige Mann bleiben.
Die Brandursache fand sich genau unter dem Schlafzimmer, in dem Jörg geschlafen hatte. Vermutlich war der Rauch langsam ins Zimmer gekrochen und hatte ihn im Schlaf erstickt. Von dem Feuer, das ausgebrochen war, hatte er nichts mehr mitbekommen. Das war zumindest ein Trost. Schmerzen hatte er nicht erlitten.
Eva-Maria richtete sich gerade bescheiden in ihrer neuen Wohnung ein, als ein Brief von einer Lebensversicherung kam. Jörg hatte eine Versicherung abgeschlossen, um seine Frau abzusichern, ohne ihr etwas davon zu erzählen, weil es für ihn selbstverständlich gewesen war, an ihre Zukunft zu denken, sollte ihm etwas passieren.
Fassungslos hielt Eva-Maria den Brief in den Händen. Es kam ihr wie Spott und Hohn vor. Sie hatte verloren, was sie liebte, und das machte sie nun reich. Am liebsten hätte sie das Schreiben weggeworfen, aber das ließ Stefan Holl nicht zu.
„Jörg wollte, dass du versorgt bist und dich um nichts sorgen musst. Das ist etwas, womit er dir über seinen Tod hinaus zeigt, wie viel du ihm bedeutet hast. Ehre seine Fürsorge!“, mahnte er.
Eva-Maria ließ zu, dass er sich um die Formalien kümmerte, und als ihr der hohe Betrag schließlich überwiesen wurde, legte sie ihn nach seinem guten Rat an, ohne auch nur einen Euro davon zu nutzen. Sie brauchte kein Vermögen. Ihren Mann, den hätte sie gebraucht, aber dieses Geld war ihr zutiefst zuwider.
***
Ein gutes Jahr war seit Jörg Buckstellers Tod vergangen. Eva-Maria führte ein ruhiges Leben, das sich in erster Linie um ihre Patienten und die Arbeit drehte. Sie machte jede Überstunde, die gebraucht wurde, vertrat ihre Kolleginnen bereitwillig und verbrachte viel Zeit in der Berling-Klinik.
Freie Wochenenden waren ihr ein Gräuel, und mit ihrer Freizeit konnte sie wenig anfangen. Ihren Urlaub ließ Eva-Maria zu einem guten Teil verfallen, weil es ihr Angst machte, so viel Zeit für sich und ihre düsteren Gedanken zu haben. Arbeit war ein Heilmittel, ohne das sie noch nicht sein konnte.
Hinter ihrem Rücken begannen ihre Kolleginnen allmählich zu tuscheln. Sie hätten ihr gerne aus der Trauer herausgeholfen, aber sie wussten nicht, wie sie an sie herankommen sollten. Von der Eva-Maria, mit der sie vor dem Schicksalsschlag zusammengearbeitet hatten, war nichts mehr geblieben. Es war, als hätte der Schmerz eine vollkommen andere Frau aus ihr gemacht.
Eva-Maria hatte ihre Heiterkeit und ihren Frohsinn nicht zurückgewonnen. Ernst und bedacht ging sie alles an und machte ihre Arbeit gut, aber sie schien vergessen zu haben, wie man lachte. An Gesprächen beteiligte sie sich so gut wie nie, und wenn man sie etwas fragte, war ihre Antwort kurz und bündig.
Es schien nichts zu geben, das zu ihr durchdringen und ihr Interesse hätte wecken können. Sie war so weit von allem entfernt, dass sie kaum noch dazuzugehören schien. Nicht nur Jörg schien in jenem grausigen Feuer gestorben zu sein, sondern auch seine Frau, wenn sie auch noch unter den Lebenden weilte.
„Wir wollen morgen zusammen essen gehen. Kommst du mit?“ Immer wieder wurde sie von ihren Kolleginnen eingeladen, aber sie sagte jedes Mal freundlich Nein. Es zog sie nicht in Gesellschaft. Eva-Maria war gerne allein, unterhielt sich in ihren Gedanken mit Jörg und lebte in gewisser Weise nach wie vor mit ihm.
Stefan und Julia Holl ließen sich nicht ganz so leicht abweisen. Es war zur Tradition geworden, dass Eva-Maria einmal im Monat an einem Sonntagmittag bei ihnen und den Kindern aß und bis zum Abendessen blieb. Diese Sonntage genoss Eva-Maria in vollen Zügen, weil sie gerne mit den Holls und ihren Kindern zusammen war.
Die Zwillinge Marc und Dani wurden langsam erwachsen, und es war spannend zu beobachten, wie sie ihren Platz in der Welt einnahmen. Der fünfzehnjährige Chris steckte mitten in der Pubertät, und Juju, die Jüngste, war ein charmantes Nesthäkchen. Alle waren sie hellwach, blitzgescheit und lebensfroh.
Eva-Maria fragte sich, wie Jörgs und ihre Kinder wohl gewesen wären. Sie unterhielt sich oft in Gedanken mit ihrem verstorbenen Mann darüber. Wären es aufgeweckte, intelligente Kinder geworden wie die der Holls? Sie träumte sich in eine Zukunft, die es nie geben konnte, und begnügte sich mehr und mehr damit, in diesen Träumen zu leben.
Die Realität, die sie umgab und in der sie ihre Rolle wahrnehmen musste, arbeitete sie wie ein Pflichtprogramm tapfer ab. Dort fand sie aber nichts, was ihr Kraft und Freude hätte schenken können. Wohl und am Leben fühlte sie sich, wenn sie mit Jörg alleine war und sich ihm nahe fühlen konnte.
Es war ihr egal, dass ihr die Welt dabei immer fremder wurde. Ohne Jörg schien ihr das ohnehin nicht mehr ihre Welt zu sein. Es war Zufall, dass sie noch am Leben war, und etwas in ihr konnte es kaum erwarten, irgendwann wieder mit ihm vereint zu sein.
„Eva-Maria, so geht es nicht weiter!“, sprach Stefan Holl das Problem beim Kaffee nach dem gemeinsamen Essen direkt an, als ein weiteres halbes Jahr verstrichen war und sich nichts an dem Zustand der jungen Frau verändert hatte.
Julia und er waren übereingekommen, nicht länger tatenlos zuzusehen und alles zu tun, um Eva-Maria irgendwie wieder zurück ins Leben zu stupsen.
„Was meinst du?“, fragte sie verwirrt und dachte, seine Bemerkung müsse sich auf die Arbeit beziehen.
„Jörg ist jetzt seit über achtzehn Monaten tot, und es geht dir nicht besser. Du hast dich von allem zurückgezogen, und du arbeitest viel zu viel“, fasste Dr. Holl zusammen.
„Die Arbeit macht mir Freude“, rechtfertigte Eva-Maria sich ein wenig verlegen. Sie mochte es nicht, wenn sie zum Thema des Gesprächs wurde. Die Holls meinten es gut mit ihr, daran zweifelte sie nicht, aber ihre Fürsorge war anstrengend. Warum durfte sie ihr Leben nicht gestalten, wie sie es für sich als richtig empfand?
„Du hast deinen alten Urlaub verfallen lassen, und auch dieses Jahr hast du noch kaum einen Tag freigenommen. Eva-Maria, ich schicke dich in Zwangsurlaub. Suche dir ein schönes Ziel und fahre weg! Tue etwas nur für dich und erlaube dir, ein wenig froh zu sein! Du trauerst schon zu lange!“, redete er ihr zu.
„Ich will aber keinen Urlaub!“, lehnte sie ab.
„Du arbeitest nur noch. Mit neunundzwanzig Jahren liegt der größte Teil des Lebens noch vor dir, und du hast dich dagegen verschlossen aus Trauer. Das ist nicht gut. Jörg würde das mit Sicherheit nicht wollen“, drang Stefan Holl in sie.
„Jörg ist tot. Wäre er noch hier, könnte er mir seine Meinung sagen, aber er hat es vorgezogen zu sterben“, antwortete Eva-Maria.
Sofort erschrak sie über den Zorn, der aus ihren Worten sprach.
„So habe ich es nicht gemeint, Stefan!“, fügte sie rasch hinzu.
„Bist du dir da sicher? Es ist normal, wenn du wütend auf ihn bist. Er hat dich allein gelassen.“
„Es war ein schrecklicher Unfall“, widersprach Eva-Maria mechanisch und konnte die Wut nicht einmal vor sich selbst leugnen.
„Na und? Was ändert das? Er ist tot“, provozierte Stefan Holl, der froh war, zumindest einmal ansatzweise eine Reaktion bei ihr ausgelöst zu haben.
„Er wollte mich nicht alleine lassen. Wäre es nach ihm gegangen, dann wäre er noch bei mir. Das zählt. Ich halte ihn fest und lasse ihn nicht gehen. Dieser ganze Unfall war ein Irrtum. So war unser Leben nicht gedacht. So war es nicht geplant. Wir sollten inzwischen ein Kind haben und stolze Eltern sein. Das wäre richtig!“, brach es aus Eva-Maria hervor.
„Ja. Das wäre richtig, aber so ist es nicht. Jörg ist tot, und du bist allein.“
„Nein! Er wird immer bei mir sein! Ich halte ihn fest, wie er mich an jenem Abend hätte festhalten sollen. Warum bin ich zur Klinik gefahren? Warum hat er mich fahren lassen? Ich lasse ihn nicht gehen!“
„Du musst ihn loslassen, Eva-Maria! Es ist an der Zeit, dass du ihm erlaubst zu gehen und einen neuen Anfang machst. Du bist am Leben. Lass ihn gehen!“, beschwor der Klinikleiter sie.
„Niemals!“, kam es trotzig zurück, und Tränen schimmerten in ihren Augen.
Julia Holl legte ihrem Mann begütigend die Hand auf den Unterarm, und er verstand und schwieg. Eva-Maria brauchte noch Zeit, aber das Gespräch hatte eine erste Bresche in ihren Panzer geschlagen. Machte er jetzt weiter, bestand die Gefahr, dass sie sich von ihm zurückzog. Vorerst hatte er mehr erreicht, als er für möglich gehalten hatte.
Eva-Maria war für den Rest des Besuches sehr distanziert und brach gleich nach dem Abendessen auf. Zum Abschied aber ließ sie sich von Julia Holl und den Kindern gerne umarmen und versprach wiederzukommen.
„Überfordere sie nicht, Stefan! Die Wut ist gut. Etwas in ihr ist in Bewegung gekommen“, meinte Julia Holl später, als das Paar noch ein Glas Wein zusammen trank und entspannt auf der Terrasse der Villa saß.
***
Eva-Maria brachte jede Woche eine rote Rose an Jörgs Grab. Anfangs hatte die Rose meist gefehlt, wenn sie am anderen Tag wieder ans Grab gekommen war. Sie vermutete, dass ihre Schwiegereltern sie auf den Kompost des Friedhofs geworfen hatten, weil sie ihren Sohn nach wie vor für sich alleine beanspruchten.
Mit den Monaten blieb die Rose immer öfter auf dem Grab liegen. Dennoch konnte Eva-Maria erkennen, dass sie nicht allein viel Zeit am Grab verbrachte. Persönlich begegnete sie ihren Schwiegereltern aber nie, und darüber war sie sehr froh. Da war nichts, was sie ihnen zu sagen hatte. Sie waren Fremde für sie, die zufällig um denselben Menschen trauerten.
Es war der zweite Geburtstag, am dem sie Jörg nur an seinem Grab gratulieren konnte. Sie hatte eine kleine Flasche Sekt dabei und zwei Gläser. Die zwei Geburtstage, die ihnen vergönnt gewesen waren, hatten sie Urlaub genommen und waren im Bett geblieben. Sie hatten Sekt getrunken, geschmust, gelacht und waren glücklich gewesen.
„Alles Gute zum Geburtstag, mein Herz!“, gratulierte Eva-Maria ihm mit tränenerstickter Stimme und schenkte gerade den Sekt ein, als sie hinter sich ein Räuspern hörte.
Ihre Schwiegermutter war alleine. Helga Bucksteller war um Jahre gealtert. Das Leid stand ihr ins Gesicht geschrieben. Mit Anfang sechzig wirkte sie wie eine alte Frau.
„Guten Tag, Eva-Maria!“, sagte sie und reichte ihrer Schwiegertochter die Hand. „Es ist schön, dich einmal zu sehen.“
„Guten Tag, Frau Bucksteller.“
Eva-Maria brachte es nicht fertig, sie mit Du anzusprechen. So eine Beziehung hatten sie nie zueinander aufgebaut. Stattdessen reichte sie ihr das zweite Glas Sekt. Die Mutter nahm es zögernd, dann stießen sie auf Jörgs Geburtstag an und tranken einen Schluck.
Eine Weile standen sie schweigend zusammen und dachten an das Verlorene. Helga Bucksteller hatte den Verlust ihres Kindes nicht verwunden. Anfangs hatte sich ihr Zorn auf Eva-Maria gerichtet, weil sie ihr vorgeworfen hatte, ihr den Sohn bereits zuvor entfremdet zu haben. Nach fast zwei Jahren spielte das keine Rolle mehr. Was blieb, war Einsamkeit.
„Ich habe eine neue Vitrine für all seine Pokale anfertigen lassen. In seinem Zimmer ist alles noch so, wie es immer war“, erzählte die Mutter.
Eva-Maria hatte nicht gewusst, dass Jörgs Jugendzimmer überhaupt noch existierte. Von Pokalen hatte er ihr nie etwas erzählt. Für ihn konnten sie keine besondere Bedeutung gehabt haben. Die Vergangenheit, die seine Mutter am Leben erhielt, war lange vorbei gewesen schon vor seinem Tod.
„Hat Jörg viele Pokale gewonnen?“, fragte Eva-Maria, weil ihr klar war, wie wichtig es für Helga Bucksteller war.
„Natürlich!“ Die Augen der Mutter leuchteten. „Schon in der Schule war er ein guter Leichtathlet und hat immer eine goldene Urkunde gewonnen bei den Jugendspielen. Und er war in der Schach AG. Da hat er immer den ersten Platz belegt. Während seines Studiums hat er regelmäßig an Schachturnieren teilgenommen und gewonnen. Mein Sohn war genial.“
Eva-Maria schauderte innerlich. Ihr war, als hielte Helga Bucksteller ihr einen Spiegel vor, und was sie in diesem Spiegel sah, war alles andere als schön oder fair. Jörg war ein warmherziger, freundlicher Mann gewesen, der nie jemandem hatte Schaden zufügen wollen. Was seine Mutter und sie sich antaten in seinem Namen, war ein Unrecht ihm gegenüber.
„Komm uns doch einmal besuchen, Eva-Maria! Bernhard und ich, wir würden uns freuen“, lud ihre Schwiegermutter sie zum Abschied ein.
Es war mehr als eine Floskel und doch nicht wirklich ernst gemeint. Die Zeit für so eine Annäherung war längt vorüber, und doch hatte die Einladung etwas Versöhnliches. Im Schmerz um Jörg schwanden die Vorurteile.
„Wenn ich in der Gegend bin, gerne!“
Sie schüttelten sich lange die Hand. Nach der Begegnung fuhr Eva-Maria nicht gleich mit der U-Bahn nach Hause. Sie war verwirrt und wanderte durch die Stadt. Ohne dass sie die Villa der Holls anstrebte, stand sie irgendwann plötzlich davor. Erst da ging ihr auf, dass sie mit jemandem sprechen musste.
„Hallo, Julia! Ich komme unangemeldet und …“
„Rein mit dir! Du musst dich doch bei uns nicht anmelden! Stefan ist in der Klinik, und die Kinder sind alle unterwegs, aber ich koche mir gerade einen Kaffee. Möchtest du auch einen?“
Die Frauen setzten sich in den gemütlichen Wintergarten, und Julia Holl stellte einen Teller mit Weihnachtsplätzchen, die sie bereits gebacken hatte, auf den Tisch. Draußen hatte es begonnen zu nieseln und wurde schon dunkel. Es war Ende November, und es war spürbar, wie kurz die Tage schon geworden waren.
„Greif zu! Ich weiß, bis Weihnachten ist es noch lange, aber um diese Zeit vertilgen wir Unmengen an Plätzchen und lieben es, zusammen Tee oder Kaffee zu trinken. Wenn es dann erst einmal Weihnachten ist, bleiben die Plätzchen oft auf dem Teller. Dann ist der Reiz vorbei“, plauderte Julia munter drauflos, denn sie spürte, wie durcheinander Eva-Maria war.
„Jörg wäre heute fünfunddreißig geworden. Ich habe auch immer ab Anfang November Plätzchen gebacken. Er war eine Naschkatze, genau wie ich.“
Eva-Maria lächelte traurig, und ihr Blick trübte sich.
„Julia, ich habe seine Mutter auf dem Friedhof getroffen. Sie kommt nicht klar mit seinem Tod und … und sie ist selbst mehr tot als lebendig – wie ich“, sagte sie sehr leise.
Wortlos legte Julia ihre Hand auf Eva-Marias Rechte.
„Er fehlt mir so! Wir hatten Pläne, und mein Leben, unser Leben, lag vor mir. Unser Kind – ich werde es nie im Arm halten. Julia, wie soll ich ihn loslassen? Nichts konnten wir abschließen und zu einem guten Ende bringen. Wir waren doch noch ganz am Anfang.“
Sie weinte bitterlich, und Julia hielt sie im Arm und wiegte sie schweigend, bis sie sich etwas beruhigt hatte.
„Das ist am schwersten zu akzeptieren am Tod. Er bricht immer ins Leben ein und reißt uns heraus, und es gibt immer noch so vieles, das offen ist, nicht abgeschlossen“, sagte Julia sanft.
„Und wie geht man damit um? Wie schafft man es abzuschließen, wenn doch alles offen ist?“ Hoffnungsvoll sah Eva-Maria sie an. Sie brauchte Antworten, und Julia war eine weise Frau. Sie konnte ihr bestimmt sagen, wie man das Unmögliche schaffen konnte.
„Ich weiß es nicht. Für jeden von uns ist es vermutlich anders. Jeder hat seinen ganz eigenen Weg des Loslassens. Es ist wichtig, dass man bereit dazu ist weiterzugehen, dann öffnet sich auch irgendwann der Weg. Bist du bereit?“
Eva-Maria schüttelte den Kopf, und wieder kamen die Tränen. Julia ließ ihr Zeit, sich zu fassen.
„Ich habe Angst, dass ich ihn verliere, wenn ich loslasse. Verstehst du das? Ich habe Angst, dass ich ihn vergesse, dass ich vergesse, wie es war, bei ihm zu Hause zu sein. Ich habe Angst davor, alleine zu sein – ohne ihn“, flüsterte sie nach ein paar Minuten so leise, dass es kaum zu hören war.
„Ich weiß. Liebe, die wir in uns tragen, vergeht nicht einfach so. Wir haben sie in uns wachsen lassen, und sie ist ein Teil von uns geworden. Jörg wird immer zu dir gehören, auch wenn du ins Leben zurückfindest, wieder froh bist und Schönes erlebst, trägst du ihn in dir. Er wird sich mit dir freuen, so wie er jetzt mit dir weint. Er ist ein Teil von dir.“
„Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, wie“, gestand Eva-Maria.
„Hast du schon einmal daran gedacht, in eine Trauergruppe zu gehen und mit anderen zu reden, die etwas Ähnliches erfahren haben und am selben Punkt stehen? Ich halte das für hilfreich und heilsam“, riet Julia.
Eva-Maria blieb, bis Stefan Holl und die Kinder nach Hause kamen, und aß mit der Familie zu Abend. Es tat ihr gut, Menschen, die sie gerne hatten, um sich zu haben an diesem Tag. Gleich am anderen Tag beschloss sie, sich eine Trauergruppe zu suchen und Julias Rat anzunehmen.
Sie brauchte Hilfe. Alleine fand sie nicht aus ihrer Trauer heraus, und schon um Jörgs willen wollte sie es schaffen, wieder am Leben teilzunehmen.
***
Vor dem ersten Treffen der Trauergruppe, für die sie sich entschieden hatte, hätte Eva-Maria am liebsten gekniffen. Was war da nur in sie gefahren? So etwas war nichts für sie! Es ging ihr doch gut, wie es war. Sie dachte an Jörg, hielt die Erinnerung liebevoll lebendig und harrte an seinem Grab aus. Musste es denn nicht so sein?
Sie hatte ihn geliebt, und etwas in ihr war mit ihm gestorben. Warum konnte ihre Umwelt das nicht verstehen und respektieren? Warum erwarteten alle, dass sie weitermachte, als ob nichts gewesen wäre?
Mehr als einmal entschied sie, den Plan aufzugeben und zu Hause zu bleiben, aber dann musste sie an Helga Bucksteller denken, und ihr wurde schlagartig wieder klar, dass überhaupt nichts in Ordnung war. Es ging ihr alles andere als gut, und nicht die anderen waren das Problem. Sie musste dringend etwas ändern, wenn sie nicht krank werden wollte, und genau das hätte Jörg nie und nimmer gewollt. Er hatte gerne gelebt und mit Freude.
Am Abend machte sie sich nervös und skeptisch auf den Weg zu dem Gemeindehaus, in dem sich die Gruppe traf. Konnte es tatsächlich helfen, mit anderen zu sprechen, die dasselbe Leid trugen? Warum sollte es ihr besser gehen, nur weil andere genauso litten und sie mit klugen Ratschlägen bedachten? Das Konzept dieser Selbsthilfegruppen hatte ihr nie ganz eingeleuchtet, und nun besuchte sie selbst eine.
So kurz vor Weihnachten stand in der Gruppe alles im Zeichen des Festes. Zwei Tische waren zusammengeschoben und mit roten Tischdecken bedeckt worden. Mehrere Kerzen brannten, und Adventskränze schmückten den Raum. Plätzchen und Getränke standen für die Teilnehmer bereit. Kleine Grüppchen standen zusammen und plauderten entspannt.
Eine ältere Dame kam mit warmem Lächeln auf Eva-Maria zu, als sie durch die Tür trat, und reichte ihr die Hand.
„Ich bin Mechthild und leite die Gruppe. Schön, dass du es geschafft hast, zu uns zu kommen“, begrüßte sie den Neuzugang herzlich.
Eva-Maria wusste aus dem Internet, dass sie eine erfahrene Psychologin war, deren Schwerpunkt auf Trauerbewältigung lag. Ihre Herzlichkeit war so echt, dass sie sich tatsächlich willkommen fühlte und etwas ruhiger wurde. Neugierig sah sie sich um.
„Wir nennen uns hier alle beim Vornamen und sagen Du“, führte Mechthild sie in die Gepflogenheiten ein. „Anfangs ist das vielleicht etwas eigen, aber du wirst dich schnell daran gewöhnen.“
Eva-Maria nickte. Ganz geheuer war ihr das alles zwar nicht, aber nun war sie schon einmal da und wollte sich darauf einlassen. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass die Gruppe so gut besucht war. Es mussten etwa zwölf Menschen da sein. Die Mehrzahl war weiblich, aber es waren auch drei Männer dabei, die schon etwas älter waren.
Die Anwesenden kannten sich offensichtlich schon länger und hatten sich auch privat viel zu erzählen. Von den Grüppchen drang Lachen an Eva-Marias Ohr. In Trauer erstarrt wirkte keiner, den sie sah, und bis auf eine junge Frau trug keiner schwarze Kleidung. War sie überhaupt richtig hier?
„Ist das wirklich die Trauergruppe?“, fragte sie etwas verunsichert.
„Du bist schon richtig hier. Jeder von uns hat einen oder mehrere liebe Menschen verloren. Mit Schmerz und Trauer kennen sich alle gut aus, aber in der Gruppe geht es eher darum, wieder Lebensfreude zu finden.“
Eva-Maria war sich nicht sicher, ob sie eben sanft gemaßregelt worden war. Sie hatte keine große Lust zu bleiben, aber sie blieb. Mechthild klatschte in die Hände.
„Auf! Auf! Wir legen los!“, rief sie in die Runde.
Die Grüppchen lösten sich langsam auf. Alle nahmen Platz am Tisch.
„Benehmt euch! Sonst verjagen wir sie gleich wieder. Eva-Maria hat sich uns heute angeschlossen und ist das erste Mal hier“, stellte Mechthild den Neuzugang vor. Es wurde freundlich gelächelt und Hallo gerufen.
„Möchtest du kurz etwas über dich sagen?“, schlug Mechthild vor, und Eva-Maria wünschte sich weit fort. Das war wirklich nichts für sie.
„Ich bin Krankenschwester und habe vor sieben Jahren meine Eltern bei einem Autounfall verloren“, sagte sie schließlich und war selbst überrascht, dass sie den Tod ihrer Eltern überhaupt erwähnte, aber er gehörte dazu. „Vor zwei Jahren ist mein Mann bei einem Hausbrand ums Leben gekommen.“
„Das ist heftig!“, sagte die Frau, die Trauer trug und kaum älter als sie sein konnte. Sie hatte tiefe Schatten unter den Augen und wirkte fahrig und nervös. „Ich bin Katharina. Meine Tochter wurde vor drei Jahren auf dem Weg zur Schule auf dem Zebrastreifen überfahren. Kannst du schlafen?“, wollte sie wissen. „Schlaf – nichts ist so wichtig wie Schlaf!“
Eva-Maria wunderte sich etwas über die Frage und nickte.
„Es hat ein paar Wochen gedauert, in denen ich ständig aufgewacht bin und dachte, es sei alles nur ein schlechter Traum. Dann habe ich Jörg neben mir im Bett gesucht und lag den Rest der Nacht wach. Inzwischen ist das vorbei, und ich schlafe durch.“
„Du Glückliche! Immer wenn ich kurz einschlafe, glaube ich, meine Tochter rufen zu hören, und schon bin ich wieder wach. Manchmal wache ich zehnmal und öfter in einer Nacht auf. Meinen Mann hat das in den Wahnsinn getrieben. Er hat mich verlassen. Na ja, so ist das eben. Einmal wieder eine Nacht durchschlafen – das wäre mein Traum!“, erzählte Katharina.
„Und wieder sind wir bei Katharina und ihren Schlafstörungen!“, stöhnte ein Mann und verdrehte die Augen. „Gibt es auch einmal etwas Neues im Staate Dänemark? Katharina, mein Schatz, nichts gegen dich! Ehrlich! Aber ich kann es nicht mehr hören, dass du nicht schlafen kannst. Nimm endlich Schlaftabletten, dann ist alles gut!“
„Thorsten, möchtest du dich Eva-Maria als Nächster vorstellen?“, sprach Mechthild ihn direkt an.
„Hallo, ich bin der Motzkegel der Gruppe, den keiner mag. Am besten hörst du nicht auf mich!“, riet Thorsten ihr und schnitt eine Grimasse. „Bei mir ist es meine Frau. Sie hatte einen Herzinfarkt und war auf der Stelle tot. Wir wollten ein paar Tage danach eine Kreuzfahrt antreten und waren etwas im Stress wegen der Vorbereitungen. Übrigens, ich schlafe wie ein Bär und könnte vierundzwanzig Stunden durchschlafen, aber meine Frau fehlt mir trotzdem.“
„Idiot!“, schimpfte Katharina. „Du hast doch keine Ahnung!“
„Aber davon jede Menge!“, stimmte er zu.
Die beiden waren sofort in ein Streitgespräch verwickelt, dem Eva-Maria erstaunt folgte. Nach und nach lernte sie auch die anderen kennen und erfuhr, wen sie verloren hatten. Das Thema Tod war an diesem Tisch das Normalste des Lebens, und keiner machte ein Tabu daraus.
Manchmal flossen Tränen bei den Berichten, aber es wurde auch immer wieder gelacht. Was Eva-Maria von diesem Abend mitnahm, waren vor allem die Herzlichkeit und das Wissen, in der kommenden Woche wieder willkommen zu sein. Von da an ging sie jede Woche hin.
Die ersten Male sprach sie kaum über Jörg und wie es für sie war, ohne ihn zu leben. Als sie es schließlich tat, war es eine Geschichte, die sich in die Geschichten einfügte, die sie von den anderen gehört hatte. Sie war nicht allein mit ihrer Ratlosigkeit, und das allein war tröstlich.
Fast jeder in der Gruppe hatte versucht, den geliebten Menschen um jeden Preis bei sich zu halten und so zu tun, als ob er noch am Leben sei. Diese Verleugnungsphase mussten wohl die meisten durchlaufen, nachdem ihnen ein geliebter Mensch überraschend entrissen worden war.
„Mein Verstand sagt mir, dass ich noch lebe und ihn loslassen muss, aber mein Herz sagt etwas ganz anderes“, bekannte Eva-Maria. „Ich will nicht, dass mein Leben weitergeht. Tut es das, kann ich mich nur von ihm entfernen, weil seine Uhr stillsteht. Gehe ich weiter, bleibt er weiter und weiter in der Vergangenheit zurück. Das kann ich nicht ertragen.“
„Die Zeit geht weiter, ob du es wahrhaben möchtest oder nicht“, sagte Katharina. „Meine Kleine wäre jetzt dreizehn. Sie wäre in der Pubertät und würde mir vermutlich den letzten Nerv rauben. Manchmal stelle ich mir vor, was für ein Teenager sie wäre, aber als sie starb, war sie gerade zehn geworden. Sie wird nie älter als zehn werden – nicht in diesem Leben.“
„Ich möchte aber mit Jörg in der Vergangenheit stehen bleiben und …“
„… und immer denselben Tag und dieselbe Zeit wieder und wieder und wieder durchleben. Das macht ihn nicht lebendig, aber dich bringt es auf Dauer um“, warf ein Gruppenmitglied ein. „Ich habe das Spiel wie du zwei Jahre durchgehalten, dann war ich sechs Monate in der Psychiatrie nach einem Selbstmordversuch.“
Von Woche zu Woche fühlte sich Eva-Maria in der Gruppe heimischer. Die Rangeleien zwischen Katharina und Thorsten gehörten dazu, wie Mechthilds verständnisvolle Anregungen und vieles mehr. Eva-Maria begann, sich auf den Freitagabend mit der Gruppe zu freuen und nahm extra Urlaub, wenn sie Nachtdienst hatte, um immer teilnehmen zu können.
„Eine Kollegin hat mich gestern gefragt, ob wir morgen zusammen ins Kino und danach noch irgendwo etwas essen gehen“, erzählte sie im Februar stolz.
„Und, was hast du gesagt?“, wollten gleich mehrere wissen.
„Dass es eine schöne Idee ist und ich mitgehe.“
„Die Einsiedlerin verlässt ihre Höhle! Hört! Hört! Das ist Applaus wert!“, rief Thorsten und klatschte.
Die Gruppe fiel ein, wie es üblich war, wenn jemand über sich hinauswuchs und Fortschritte machte. Es wurde gescherzt und gelacht.
Der Samstagabend mit ihrer Kollegin verlief nett. Jörg kam nicht zur Sprache, aber sie redeten viel über die Arbeit, den Film und das Essen. Eva-Maria entspannte sich und nahm sich vor, in Zukunft mitzugehen, wenn die anderen etwas unternahmen.
Millimeterweise fand sie ins Leben zurück, wenn sie auch noch immer ernster war als früher.
***
„Das ist Christian. Er ist heute das erste Mal bei uns, also erschreckt ihn nicht gleich gar zu sehr und seid nett, ihr Raubtiere!“, stellte Mechthild Mitte März einen Neuen vor, der höflich und distanziert in die Gruppe nickte.
„Anzug, Krawatte und gute Manieren – da könnt ihr euch ein Vorbild nehmen!“, spottete Anna gutmütig in Thorstens Richtung.
„Unsere Kontrolltante! Jetzt will sie sogar noch eine Kleiderordnung einführen. Sollen wir dann alle graue Taschentücher zücken, wenn es ans Weinen geht, meine Liebe?“, verteidigte sich Thorsten mit gewohnt spitzer Zunge.
Christian sah irritiert zu Mechthild, die nur lächelnd mit den Schultern zuckte. An den Ton musste er sich gewöhnen. Es gehörte dazu, dass keiner in diesem Rahmen ein Blatt vor den Mund nehmen musste. Alles war erlaubt, alles durfte zur Sprache kommen und nichts wurde übel genommen. Das war die einzige Regel.
„Möchtest du etwas sagen?“, fragte sie ihn.
„Ich komme direkt von einer Besprechung – deshalb der Anzug. Nächste Woche gibt es mich in Jeans und weniger formell“, sagte er. „Zur Not bekomme ich auf Bestellung einen Dreitagebart hin.“
Die Gruppe lachte, und er hatte sich mit der lockeren Bemerkung seinen Platz erobert. Er mochte Mitte dreißig sein und war von den anwesenden Männern der jüngste.
„Ich meinte zwar eher, ob du dich kurz vorstellen möchtest, Christian, aber den Dreitagebart geben wir jetzt natürlich gleich in Auftrag“, scherzte Mechthild.
„Ich bin Architekt und …“ Er brach ab und das Lockere, Scherzhafte verlor sich völlig. Sein Blick wanderte zur Tür, und Fluchtgedanken waren spürbar.
Eva-Maria konnte sich noch gut erinnern, wie lange sie nicht in der Lage gewesen war, über Jörgs Tod zu reden. Selbst wenn sie es versucht hatte, war es ihr nicht gelungen. Ihre Stimme hatte versagt, und genau wie er hatte sie mehr als einmal die Flucht ergreifen wollen und zum Teil auch ergriffen.
„Schön, dass du da bist!“, begrüßte sie ihn mit Wärme. „Du musst nicht darüber reden! Irgendwann, wenn du so weit bist“, nahm sie ihm den Druck.
Dankbar lächelte er sie an, und von dem Moment an waren sie auf eine besondere Weise verbunden. Erklären konnten sie es nicht, aber sie mochten sich, wenn sie auch lange kaum ein persönliches Wort wechselten.
Bald saßen sie bei den Treffen ganz selbstverständlich nebeneinander. Nach den Treffen gingen sie mit einem freundlichen Lebewohl jeder ihrer Wege, aber während der Runde gehörten sie irgendwie zusammen und wurden selbst von den anderen wie eine Art Team wahrgenommen.
Christian brauchte zwei Monate, in denen er meist schweigend dabeisaß und zuhörte, bevor er in der Lage war, über seinen eigenen Verlust zu sprechen.
„Die Schuldgefühle sind für mich das Schlimmste. Meine Frau ist seit einem guten Jahr tot, und nichts kann sie lebendig machen. Es ist nicht mehr wichtig, ob ich nun verantwortlich bin für den Unfall oder nicht. Ich weiß das, aber die Schuldgefühle lassen dennoch nicht nach“, erzählte er schließlich.
Die anderen der Gruppe erfuhren, dass Ingrid wie auch er Architektin gewesen war. Sie hatten zusammen ein Architekturbüro gehabt und waren recht erfolgreich gewesen.
„Wir haben uns gut ergänzt und die meisten Projekte gemeinsam gemacht. Es ist so verdammt unfair. Wir haben riesige Büroblöcke entworfen und gebaut. Wir sind auf Baustellen herumgeturnt, die alles andere als sicher waren, und nie ist etwas passiert.“
Christian räusperte sich und fuhr dann mit rauer Stimme fort.
„Ingrid und ich wollten Kinder und eine Familie gründen. Die Entscheidung war getroffen, nicht länger zu warten. Zuerst wollten wir uns aber unser Traumhaus bauen – von uns entworfen und gebaut. Ich glaube, das ist eine Berufsmacke. In einem Haus leben, das man bis ins Kleinste selbst entworfen und gebaut hat – das ist das Ideal“, erklärte er mit einem verlegenen Lächeln.
Er erzählte, dass sie schnell am Stadtrand den idealen Bauplatz gefunden hatten.
„Für die Pläne ließen wir uns viel Zeit und bauten ein Model nach dem anderen. Es sollte perfekt sein, unser Zuhause. Und irgendwann hatten wir es und legten los.“
Nach einem kurzen Moment des Schweigens kämpfte Christian mit sich und schaffte es nur mühsam weiterzusprechen.
„Sie war im Baumarkt und hatte die Ladefläche unseres Wagens voller schwerer Säcke. Ich hätte da sein müssen. Beim Aufladen im Baumarkt half ihr immer ein Mitarbeiter. Wir waren zum Abladen verabredet, aber ich kam etwas später aus dem Büro. Sie hat alleine angefangen und aus Versehen die Handbremse des Wagens nicht angezogen.“
Es war schrecklich für ihn, darüber zu reden und alles noch einmal vor sich zu sehen.
„Der Wagen stand leicht abschüssig und rollte an. Ingrid geriet zwischen Wagen und Wand und wurde zerquetscht. Als ich kam, war es gerade passiert, aber ich konnte ihr nicht mehr helfen. Wäre ich zehn Minuten früher aus dem Büro gekommen, dann hätten wir uns zusammen ans Abladen gemacht, und vermutlich wäre nichts passiert. Zehn Minuten.“
„Du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Meine Tochter war zehn und eine kleine Dame, die auf ihre Unabhängigkeit pochte. Die Schule war nur zweihundert Meter entfernt, die Straße wenig befahren, wenn nicht gerade Schulbeginn oder Schulende anstand. Dann kamen all die Eltern und brachten ihre Kinder mit dem Auto zur Schule.“
Katharina wusste nur zu gut, was Schuldgefühle waren.
„Meine Tina wurde auf dem Zebrastreifen vor der Schule von einer Mutter überfahren, die es eilig hatte, zur Arbeit zu kommen. Die Familie wohnt in unserer Nachbarschaft. Und ich quäle mich seitdem mit Vorwürfen, weil ich mein Kind nicht auch mit dem Auto zur Schule gefahren habe“, erzählte sie.
Die anderen der Gruppe wussten all das, aber Christian hörte ihr aufmerksam zu.
„Hat das irgendeinen Sinn? Nein! Die Mädchen hätten zusammen die paar Meter gehen können. Tina wollte groß sein, und sie war vernünftig und passte auf. Es war richtig, sie allein zur Schule gehen zu lassen. Ich weiß das, und doch würde ich alles dafür geben, sie an jenem Morgen gefahren zu haben.“
Christians Augen wurden feucht, und er fuhr sich rasch mit dem Handrücken darüber.
„Du konntest nicht wissen, wie entscheidend diese verdammten zehn Minuten waren. Die Schuldgefühle sind einfach nur Ausdruck unserer Trauer, und wir schwächen uns zusätzlich damit. Sie sind durch nichts begründet. Über Bord damit! Es wird Zeit!“, sagte Katharina eindringlich.
Es war ein Kampf, den sie noch immer täglich mehrmals austrug. Nur sehr langsam wurde es besser, und die Attacken kamen seltener, was sie der Gruppe verdankte, in der sie offen darüber reden konnte.
„Über Bord damit!“, wiederholte Christian und nickte ihr dankbar zu.
Nach dieser Sitzung zog es ihn nicht nach Hause. In ihm war zu viel in Bewegung geraten, und er fürchtete die Stille.
„Gehen wir noch ein Glas Wein zusammen trinken?“, fragte er Eva-Maria spontan. „Ganz in der Nähe gibt es einen gemütlichen Biergarten an der Isar. Mir ist nach einem kleinen Spaziergang an der frischen Luft.“
Es war Ende Mai, und die Abende waren ungewöhnlich warm. Eigentlich herrschten geradezu sommerliche Temperaturen, und die Frühlingsblumen gingen bereits in den Sommerbewuchs über.
Eva-Maria zögerte kurz, aber dann stimmte sie zu. Er hatte bei diesem Treffen einen großen Schritt gemacht, und sie konnte sich vorstellen, wie es in ihm aussah.
Wortlos schlenderten sie nebeneinander an der Isar entlang. Der Fluss murmelte leise, und eine sanfte Brise ließ die Büsche und Weiden am Ufer sanft rauschen. Es war Vollmond, und Eva-Maria bedauerte, dass die Laternen der Uferbeleuchtung dem fahlen Mondschein etwas von seinem Zauber raubten.
„Heute müsste man sie ausschalten können“, meinte sie und deutete auf die Laternen.
„Ja, das wäre schön“, stimmte Christian ihr zu. „In der Stadt werden wir keinen Winkel finden, an dem alleine das Mondlicht regiert. Ingrid und ich wollten an den Stadtrand, um eine landähnliche Lebenssituation zu schaffen, aber mit allen Vorteilen der Stadtanbindung. Gut durchdacht alles. Wir waren gut in der Planung“, meinte er ironisch.
„Jörg und ich auch. Wir wollten Kinder und haben zu lange über den idealen Zeitpunkt debattiert. Am Abend seines Todes hat er mir gesagt, dass er nun reif für die Verantwortung sei. Tja, wie schön wäre es jetzt, unser Kind aufwachsen zu sehen und noch etwas von ihm um mich zu haben. Zu spät.“
Christian nickte und warf ihr einen nachdenklichen Blick zu. Ob sie auch dieses eigentümliche Gefühl kannte, um ein Kind zu trauern, das noch gar nicht geboren war? Darüber hatte er bisher mit niemandem gesprochen, weil er sich lächerlich dabei vorkam. Aber der Schmerz, dass es die zwei, drei Kinder nie geben würde, die in Ingrids und seinen Träumen im Garten geschaukelt hatten, war mindestens so tief wie die Trauer um seine Frau.
„Es ist nicht nur die Trauer um Jörg. Ich trauere auch um unser Kind, das nie geboren werden wird“, sagte sie da.
„Mir geht es genauso.“ Ein warmes Gefühl von Dankbarkeit durchströmte ihn, nicht mehr so entsetzlich allein zu stehen.
In dem Biergarten herrschte reger Betrieb. Viele Münchner hielt es nicht in ihren Wohnungen an einem so schönen Abend. Da sie am Samstag nicht arbeiten mussten, genossen sie es, den Freitag bei einem Bier und in netter Gesellschaft ausklingen zu lassen. Von der etwas erhöhten Terrasse drangen Stimmengewirr und fröhliches Lachen zu ihnen herüber.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: