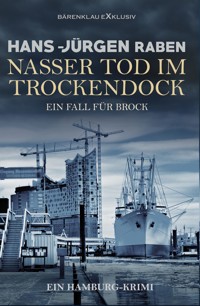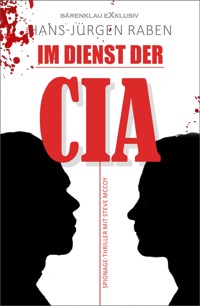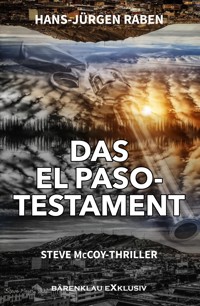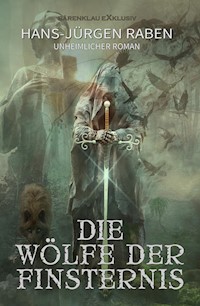5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was anfänglich harmlos erscheint, entpuppt sich bald als Wirklichkeit, die sich niemand wünscht, nicht einmal seinem ärgsten Feind …
In diesen fünf unheimlichen Romanen und Erzählungen widmen sich die Autoren dem Unheimlichen, dem Unfassbaren, einem wahren Albtraum, dem sich ihre Figuren stellen müssen, und keiner von ihnen kann diesem Schicksal entrinnen. Für einige wird es mit dem Tod enden, bei anderen wird sich das Leben künftig grundlegend ändern und manche werden sich wünschen, niemals geboren worden zu sein. Nichts wird wieder sein, wie es einst war.
In dieser Anthologie sind folgende Romane und Erzählungen enthalten:
› Die Stunde der Insekten – von Hans-Jürgen Raben
› Das Mädchen, das im Kreis lief – von Michael Minnis
› Die Brut des Grünen Abgrunds – von C. Hall Thompson
› Prozession ins Totenmoor – von Rolf Michael
› Den Teufel im Display – von Olivier Watroba
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hans-Jürgen Raben – Michael Minnis – C. Hall Thompson – Rolf Michael – Olivier Watroba
Die Brut des Grünen Abgrunds
Fünf unheimliche Romane und Erzählungen
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach einem Motiv von Vladimir Maneyukhin, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Stunde der Insekten
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Das Mädchen, das im Kreis lief
4. April 1923
6. April 1923
10. April 1923
13. April 1923
14. April 1923
22. April 1923
26. April 1923
30. April 1923
Die Brut des Grünen Abgrunds
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Prozession ins Totenmoor
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Den Teufel im Display
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nachwort
Über die weiteren Autoren
Das Buch
Was anfänglich harmlos erscheint, entpuppt sich bald als Wirklichkeit, die sich niemand wünscht, nicht einmal seinem ärgsten Feind …
In diesen fünf unheimlichen Romanen und Erzählungen widmen sich die Autoren dem Unheimlichen, dem Unfassbaren, einem wahren Albtraum, dem sich ihre Figuren stellen müssen, und keiner von ihnen kann diesem Schicksal entrinnen. Für einige wird es mit dem Tod enden, bei anderen wird sich das Leben künftig grundlegend ändern und manche werden sich wünschen, niemals geboren worden zu sein. Nichts wird wieder sein, wie es einst war.
In dieser Anthologie sind folgende Romane und Erzählungen enthalten:
› Die Stunde der Insekten – von Hans-Jürgen Raben
› Das Mädchen, das im Kreis lief – von Michael Minnis
› Die Brut des Grünen Abgrunds – von C. Hall Thompson
› Prozession ins Totenmoor – von Rolf Michael
› Den Teufel im Display – von Olivier Watroba?
***
Die Stunde der Insekten
von Hans-Jürgen Raben
1. Kapitel
Eine spitze Kanüle, deren Ende leicht gekrümmt war, entledigte sich einiger weniger Tropfen wasserheller Flüssigkeit, die auf den Boden eines Vivariums tropften, um dort zu versickern.
Ein Skorpion sah sich durch die blendende Helle, die durch das Öffnen seines kleinen Gefängnisses hervorgerufen wurde, in Pogromstimmung versetzt, reagierte dementsprechend aggressiv und ließ seinen Schwanz mit dem giftgeschwollenen Stachel herausfordernd emporwippen.
Doch dabei wurde das Spinnentier bereits gepackt. Verzweifelt versuchte es, seinen Stachel einzusetzen, aber das Handschuhleder konnte er nicht durchdringen. Dafür durchdrang die Spitze der Kanüle seine gepanzerte Haut und entleerte ihren Inhalt. Die behandschuhten Finger öffneten sich und ließen den Skorpion in das Vivarium fallen. Einen Augenblick blieb er teilnahmslos liegen.
Dem Beobachter ging es zu langsam. Ein ums andere Mal fuhr seine Zunge nervös über die Lippen, aber dann weiteten sich seine Augen vor Freude. Der Skorpion begann, sich zu verändern.
Wie im Krampf warf sich das Tier auf den Rücken und strampelte mit den Gliedmaßen, als müsste es sich aus einem Gefängnis befreien. Und es war ein Gefängnis, denn Skorpione müssen sich häuten, wenn sie wachsen. Mit einem Laut, der dem eines zerbrechenden Astes glich, platzte der Brustpanzer auf. Der Riss setzte sich fort und verlief gleich darauf in einer ausgezackten Linie bis zum Schwanzende. Er wurde breiter und breiter, bis sich das Tier befreien konnte.
Und nun begann es erst richtig zu wachsen. Die Haut war noch weich und dehnbar, und in Minutenschnelle hatte der Skorpion die Größe eines kleinen Hundes erreicht.
Branco Furiani atmete auf. Der erste Schritt war gelungen. Nun galt es, zu erforschen, wie sich die Kreatur auf ihre neue Größe einstellte. Der Kroate überlegte einen Moment, dann hatte er seine Wahl getroffen. Er streifte sich die Handschuhe wieder über und öffnete einen weiteren Käfig.
Mit sicherem Griff fasste Branco Furiani eine große Ratte am Genick.
Das Tier verfiel in Tragstarre und ließ sich so verhältnismäßig leicht transportieren. Nur die Knopfaugen wieselten angstvoll hin und her. Aber da war es bereits um sie geschehen.
Mit sattem Plumpsen fiel sie ebenfalls in das Vivarium, wo der Skorpion offensichtlich immer noch mit den Nebenwirkungen seiner Verwandlung zu kämpfen hatte.
Furiani erschauerte, als er in das Gefängnis aus Glas starrte. Der Skorpion wuchs immer noch ein wenig, gleichzeitig wuchs sein Hunger, und so war es nur eine Frage der Zeit, bis er die Ratte angreifen würde. Und noch ein Erfolg war ihm heute beschieden: Zum ersten Mal hatte er sein Elixier so einsetzen können, dass es keinen Wildwuchs zeugte, sondern kontrolliertes Riesenwachstum, also kontrollierte Mutation bewirkte.
Mit jedem Zentimeter, den der Skorpion zunahm, wurde er aggressiver – und die Ratte ängstlicher.
Längst hatte sie sich in die äußerste Ecke des Vivariums zurückgezogen und die Klauen instinktiv zur Abwehr gespreizt. Kurz darauf hatte sich der Skorpion erholt.
Einen Besessenen wie Furiani kümmerte die Angst des Opfers nicht. Das Ziel war wichtig – sonst nichts.
Das Spinnentier schoss mit zappelnden Bewegungen auf sein Opfer los.
Die Ratte stieß ein schrilles Pfeifen aus, dann ging sie ihrerseits zum Gegenangriff über.
Blitzschnell wich sie den zupackenden Scheren des Gegners aus und ließ ihre Hornkrallen zuschlagen.
Aber die Ratte erwischte nur eine Schere – die andere fuhr ihr in die Kehle und mitten ins Leben. Gleichzeitig bohrte sich der Stachel in das Nagetier.
Aber noch einmal erwachten ungeahnte Aktivitäten in der Ratte. Mit einem letzten Aufkreischen stürzte sie sich auf den Skorpion und schlug ihre Nagezähne in den Chitinpanzer, der krachend nachgab. Nun war auch das Ungeheuer zum Tode verurteilt.
Furiani wandte sich enttäuscht ab.
Doch in diesem Augenblick flog die Tür auf, und Kurt Amtmann, sein Dozent, stand auf der Schwelle. Seine wachen grauen Augen streiften über das Labor, die Einrichtung und blieben schließlich an dem Vivarium mit den zwei sterbenden Tieren hängen. Rasch eilte er darauf zu und starrte entgeistert durch die dicken Glasscheiben.
»Zum Teufel, was ist das?«
Furiani zuckte nervös zusammen. »Ein Experiment, sonst nichts.« Amtmann fuhr empört hoch, sein Gesicht war dunkelrot vor Zorn.
»Ich habe Sie gewarnt, Furiani. Ich habe mich immer über Ihren Einsatz und über Ihr Interesse gefreut – deshalb habe ich Ihnen auch diese Assistentenstelle und die kostenlose Wohnung verschafft, obwohl – weiß Gott – genügend Anwärter vorhanden waren. Hier aber haben Sie die Grenze überschritten, und das bleibt nicht ohne Folgen!«
Furianis Hände vollführten einen nervösen Tanz. »Aber – aber sehen Sie doch, es hätte nicht viel gefehlt, und der Skorpion wäre Sieger geblieben. Mir fehlt nur ein bisschen Zeit.«
Amtmanns Faust schlug krachend auf den Tisch. »Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Unsere Aufgabe ist es, zu forschen und nicht Mutationen zu erzeugen. Außerdem« – und jetzt brüllte er zornig – »kommt es für uns nicht darauf an, ständig zu ergründen, wer Sieger bleibt. Ich habe den Verdacht, Sie nutzen Ihre Möglichkeiten hier nur aus, um Ihren primitiven Instinkten Nahrung zu geben. Das hat jetzt ein Ende!«
Furiani stand kreidebleich vor Wut und Angst da und wagte kein Wort zu sagen. Aber Professor Amtmann war noch nicht am Ende.
»Sie werden sich ein Zimmer suchen müssen, Herr Furiani. Außerdem erübrigt sich damit ja wohl die Frage einer weiteren Tätigkeit als Assistent! Ihr Studium dürfen Sie selbstverständlich fortsetzen«, fügte er hinzu.
Furiani erstarrte. »Aber – ich werde meine Experimente einstellen, ich werde das tun, was Sie verlangen …«
Die Tür knallte zu, denn Kurt Amtmann hatte bereits den Raum verlassen. Furiani starrte ihm mit hasserfüllten Augen nach. Er überlegte krampfhaft. Eine Weile grübelte der Exil-Kroate, dann hatte er einen Entschluss gefasst. Über sein Gesicht schlich ein Grinsen.
Die Privaträume waren im Kellergeschoss des Universitätsgebäudes untergebracht. Furiani riss sich mit entschlossener Gebärde den weißen Kittel von den Schultern. Die Tür krachte zum zweiten Mal zu, und er stürmte mit raumgreifenden Schritten die Treppen hinunter. Kurze Zeit später hatte Furiani sein Ziel erreicht.
Die Tür sprang unter der hastigen Bewegung des Schlüssels auf. Furiani winkelte beim Überschreiten der Schwelle das rechte Knie an und ließ den Absatz gegen das Holz prallen. Gleich darauf flog die Tür wieder lautstark ins Schloss, sodass es von den nackten, gekachelten Wänden widerhallte.
Irgendwo in dem Gebäude runzelten sich Stirnen, zogen sich Brauen zusammen, um steile vertikale Falten zu bilden. Augen flogen irritiert hin und her, spiegelten Unmut wider, um sich dann allmählich wieder zu beruhigen. Die Arbeit wurde fortgesetzt. Auch Furianis Arbeit nahm ihren Fortgang.
2. Kapitel
Durch die Gitterstangen, mit denen die Souterrainfenster gesichert waren, drang nur spärliches Licht und fiel auf den Rücken eines einsamen Mannes, der in besessenem Eifer in ein Experiment vertieft war.
Branco Furianis Hand wanderte tastend über die Regale, ohne dass er selbst von seinen Papieren aufblicken musste. Seine Hand ertastete die Zigarrenkiste.
Zur Kontrolle öffnete der Kroate noch einmal den Deckel.
Das Tier, das sich darin befand, machte auch ihm noch Angst, obwohl er seit Wochen mit derlei Kreaturen umging. Es hatte die Beine weit von sich gespreizt, ein bizarres Gitter bildend, den Hinterleib hochgereckt, während die gewaltigen Scheren sich drohend emporreckten. Gleichzeitig ertönte ein wütendes Fauchen und Zischen.
Furiani war klug genug, seine Finger aus der Reichweite der Solifuga zu halten. Mit geübter Bewegung durchstieß er mit einer Kanüle die Membrane eines ampullenähnlichen Fläschchens, um gleich darauf mit ebenso geübter Bewegung die Flüssigkeit aufzuziehen.
Der Kroate hatte wieder die dicken Handschuhe übergestreift, als er nun das Tier ergriff und vorsichtig die Injektionsspritze ansetzte. Der Rest kümmerte ihn nicht weiter.
Ohne Eile lud Furiani seine Pistole. Er nahm sich Zeit damit, wischte die Patronen sauber, ölte sie und schob sie anschließend gemächlich in das Magazin.
Zuweilen war ein Scharren und Keuchen zu vernehmen, das aus einer Zigarrenkiste kam, die sich auf seinem Schreibtisch befand. Als es dann häufiger wurde und der Deckel sich langsam abhob, um zuweilen ein oder zwei Beine freizugeben, wurden seine Bewegungen emsiger.
Er erhob sich, schob die Pistole in den Hosenbund und verließ den Raum, ohne ihn abzuriegeln.
3. Kapitel
»… Insekten, meine Damen und Herren, sind wohl die am meisten verbreitete und die artenreichste Gruppe unserer Fauna.« Kurt Amtmann hatte sich in Feuer geredet. »Uns sind rund siebenhundertfünfzigtausend Arten bekannt. Die wirkliche Anzahl aber schätzt man auf über eineinhalb Millionen!«
Der Professor beugte sich in einer familiär anmutenden Gebärde über das Pult.
»Nun, meine Damen und Herren, bevor ich mich daran mache, Sie in die Anfangsbegriffe einzuführen, nehmen Sie bitte eines zur Kenntnis: Spinnen, Skorpione, Tausendfüßler – sie alle gehören nicht zu den Insekten.«
Der Professor bewegte sich rasch hinter dem Katheder heraus und schwenkte ein Bündel hektographierten Papiers.
»Hat jemand bestimmte Referatswünsche?«, brüllte er gegen den aufkommenden Lärm an. »Ich habe gefragt …«
Professor Amtmanns Hand drosch auf das Holz des Pults und versuchte sich durch den klatschenden Laut Gehör zu verschaffen. Aber es war zwecklos, denn die Gruppe der Studenten stritt sich um die zu verteilenden Referate.
Schließlich schüttelte der Professor resigniert den Kopf. »Herr Furiani?«
Auf die Frage meldete sich niemand.
»Ist er nicht anwesend?«, erkundigte sich eine Stimme vom Eingang her. Der Professor fuhr herum und musterte die Eingetretenen.
Es waren zwei Männer – der eine klein und untersetzt, der andere jung und lang aufgeschossen. Auf unverkennbare Art wirkten sie dienstlich. Die Blicke der Anwesenden richteten sich ebenfalls auf die Eindringlinge.
»… uns interessiert nämlich ebenfalls, wo Herr Furiani sich aufhält.« Der Jüngere blickte sich um. »Hier scheint er ja wohl nicht zu sein.«
Der Ältere wandte sich an den Professor. »Mein Name ist Lindner.«
Seine Hand klaubte mit oft geübter Bewegung eine ovale messinggoldene Marke aus der Tasche. Professor Amtmann nickte stumm.
Lindner sagte: »Herr Professor, ich hätte Sie gern privat gesprochen – unter vier Augen.«
Amtmann nickte, dann gab er den Zuhörern ein kurzes Zeichen. »Schluss für heute. Bitte lesen Sie das nach, was Sie heute gehört haben …«
Verwundert stellte er fest, dass der Hörsaal noch nie so schnell leer gewesen war wie heute.
»Also?« Amtmann drehte sich wieder um.
»Wie Sie schon gehört haben, geht es um Branco Furiani.« Der ältere Beamte zog etwa ein Dutzend Bilder aus seiner Brieftasche und präsentierte sie dem staunenden Professor.
Es gab keinen Zweifel, die Bilder zeigten Furiani. Aber wie sah er aus?
Seine Arme umklammerten zwei dicke Reisetaschen, er blickte sich gehetzt um, während die rechte Hand eine riesige Pistole umkrampfte.
»Woher haben Sie das?«
»Ein Passant hat es geschossen. Selbst im Tod hat sein Daumen noch den Knopf des automatischen Filmtransports gedrückt. Glücklicherweise hatte der Mann ein Weitwinkelobjektiv an seine Kamera geschraubt – eigentlich wollte er etwas ganz anderes einfangen, daher haben wir diese Aufnahmen. Und Furiani hat auch noch zwei unserer Kollegen mitgenommen. Sie hinterlassen zwei Frauen und drei Kinder. Zuerst hätten wir gern Näheres über Herr Furiani erfahren …«
Professor Amtmann zuckte mit den Schultern. »Was gibt es über ihn zu sagen? Eigentlich ist es nicht viel, was ich über ihn erzählen könnte. Da waren diese verrückten Experimente – sie haben mich am meisten gestört …«
»Was waren das für Experimente, und weshalb führte er sie durch?«, fragte der Beamte.
»Er glaubte, wenn man riesenwüchsige Insekten züchten könnte, dann würde das einen gewaltigen Fortschritt darstellen. Manchmal musste ich ihn bremsen, weil uns Forschungen solcher Art suspekt sind. Gerade neulich habe ich ihm verboten, seine Forschungen weiterzuführen. Es war einfach zu entsetzlich …«
Kommissar Lindner ermunterte ihn mit einem Kopfnicken fortzufahren. Sein jugendlicher Begleiter gähnte.
»Nun gut, was er wollte, das waren riesenwüchsige Insekten und Spinnen, weil er glaubte, dass man keine Panzer und Kanonen zu bauen hätte, wenn einem die Züchtung solcher Riesenwesen gelänge …«
Verständnislose Augen begegneten den seinen.
»Er meinte einfach, es sei unnütz, Waffen dieser Art zu bauen, weil es ja doch viel bequemer wäre, sie einfach zu züchten. Außerdem wäre es viel billiger …«
Zum ersten Mal zeigte sich Interesse in den Augen des jüngeren Beamten. »Würden sie das denn?«
In die Augen des Professors trat Zorn.
»Über derlei Dinge habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht, und das nicht, weil es mir an Wissbegierde fehlte, junger Mann. Solche Überlegungen sind mir suspekt, und zwar nicht aus Mangel an Befähigung, sondern weil es unsere Aufgabe ist, zu forschen und Sachverhalte zu ergründen …« Amtmann drehte sich um und winkte den beiden Beamten, ihm zu folgen.
Die drei Männer drangen über gekachelte Flure und ausgetretene Steinstufen vor, bis sie das Kellergeschoss erreicht hatten. Auf der Höhe zweier graugestrichener Türen machte Amtmann halt.
»Hier wohnt er.« Er schwenkte ein großes Schlüsselbund und wählte zwei Schlüssel aus, die er dem Kommissar in die Hand drückte.
»Für welche Türen sind die bestimmt?«, fragte Lindner.
»Der da ist für seine Privaträume, und der andere ist für einen weiteren Raum. Furiani hat ihn als Labor ausgebaut.« Amtmann zeigte auf eine grüngestrichene Tür.
Als Lindner mit dem Schlüssel in der Labortür herumstocherte, erklangen Laute, die, sich an den Kacheln brechend, ein vielfaches Echo erzeugten. Von drinnen zeugte kein Laut davon, dass die Räume bewohnt waren.
Ein Gedanke begann Amtmanns Gemüt zu peinigen: Vielleicht trug er indirekt die Schuld an Furianis Verbrechen. Ob eine weitere Chance den Kroaten auf seinem verhängnisvollen Weg zurückgehalten hätte?
Die Labortür sprang auf, und die beiden Beamten drangen in den schmalen Flur ein. Amtmann ließ ihnen den Vortritt. Vielleicht verdankte er diesem Umstand sein Leben.
Professor Amtmann wusste, wie es klingt, wenn ein Mensch in höchster Todesnot schreit. Ein qualvolles, schmerzerfülltes Schreien war es, das durch das Gebäude hallte.
Türen klappten, fragende Stimmen erklangen, Schritte kamen über Treppen und Flure.
Der Professor war bis in das Labor vorgedrungen. Hier stand er nun und starrte mit fassungslosen Augen auf ein Bild brutaler Realität.
Auf dem Linoleumfußboden war Blut. Der ältere Beamte war tot. Alles musste blitzschnell gegangen sein.
Amtmanns Augen schweiften wie gehetzt von einem Winkel des Raumes zum anderen. Wo war der zweite Beamte? Im selben Augenblick, als sich Amtmann diese Frage stellte, hatte er den Jüngeren auch schon entdeckt.
Unter einem Schreibpult ragten zwei Beine hervor.
Ein wütendes Fauchen und Zischen ließ den Professor hochschrecken. Zu lange hatten seine Blicke wie gebannt auf dieser Szene eines Albtraums verweilt. Und ein zweites Mal wäre es fast zu spät gewesen.
Unter schnarrenden Geräuschen kam ein riesiges Tier unter dem Tisch hervorgeschossen, unter dem der junge Beamte sein Ende gefunden hatte. Mit hastigen Sprüngen kam es herangestürmt und musterte den Dozenten mit sechs paarweise angeordneten Augen. Die riesigen Tasterscheren öffneten und schlossen sich wie in Vorfreude.
Einen Augenblick musterten sich der Professor und das Tier. Fast hatte es den Anschein, als müssten sich die beiden abschätzen – wie Gegner.
Die Solifuga, auch Walzen- oder Sonnenspinne genannt, ist ein hochbeiniges kräftiges Tier. Sie überwältigt sogar Vögel, Skorpione und Schlangen. Zwar ist ihr Biss keineswegs giftig, aber mit ihren riesigen Scheren vermag sie auch Säugetieren empfindliche Wunden beizubringen. Angegriffen verteidigt sie sich mit wütendem Imponiergehabe und empfindlichen Bissen.
Dies alles schoss Kurt Amtmann durch den Sinn, aber er war nicht in der Lage, auch nur ein Glied zu rühren. Verschwommen nahm er wahr, wie sich das Tier, das mittlerweile die Größe eines Kleinwagens hatte, auf ihn warf. Zwei Hände packten ihn an den Schultern und rissen ihn zurück.
Wie aus einem Traum erwachend, drehte sich Amtmann um und erkannte Chuck Wegner, einen amerikanischen Gastdozenten. Gleichzeitig wurde ihm bewusst, dass auch Dieter Eckert, ebenfalls ein Gastdozent, hinzugeeilt war.
Aber die Solifuga ließ sich durch die offensichtliche Übermacht nicht abschrecken. Mit hastigen, kurzen, für die Spinnenart typischen Sätzen kam das Tier näher.
Amtmann fasste sich mühsam.
»Chuck – Chuck, bitte, sei vorsichtig«, schrie er entsetzt, als er sah, dass sich der Amerikaner unvorsichtig dem Tier näherte, das sich immer noch abwartend verhielt.
Aber Chuck Wegner ließ sich nicht zurückhalten. Mit kurzentschlossenem Ruck riss der Gastdozent einen Bunsenbrenner vom Tisch und drehte die Einstellschraube so, dass eine meterlange Lohe aus der Düse schoss. Dann näherte er sich langsam der Spinne.
Offensichtlich schien das Tier die verheerende Wirkung der Flamme nicht zu kennen. Chuck bestrich den rötlich bepelzten Körper des Gegners mit der Flamme, sodass kurz darauf der kleine Raum mit beißendem Geruch nach verbranntem Chitin erfüllt war.
Mittlerweile war auch Dieter Eckert mit auf den Plan getreten. Seine kräftigen Fäuste umklammerten den Stiel einer Feueraxt und rissen sie ruckartig von der Wand. Gleich darauf krachte die schwere Klinge auf den gepanzerten Oberkörper des Tieres. Und das Tier zeigte Wirkung.
»Dieter, um Himmels willen, pass auf!« Amtmann kreischte fast.
Aber es war zu spät. Der Gasschlauch hatte eine Schlinge gebildet, die sich um den Knöchel des jungen Dozenten legte. Er taumelte, ruderte einige Male verzweifelt mit den Armen durch die Luft und stürzte dann schwer. Im nächsten Augenblick bildeten acht dicke beborstete Spinnenbeine ein bizarres Gitter um ihn, und die riesigen Tasterscheren schnappten zu. Der junge Mann brüllte schmerzerfüllt.
Aus dem Fauchen und Zischen des Tieres war ein wütendes Röcheln geworden. Amtmann erblickte den Feuerlöscher an der Wand.
Kurz entschlossen packte der Professor den Schaumlöscher, richtete die Handdüse auf die Augen der Spinne und drückte ab. Ein breiter weißer Strahl schoss hervor und legte sich zäh auf den Vorderleib des Tieres, das immer noch das Bein des jungen Mannes in den Scheren hielt.
Unbewusst hatte Professor Amtmann das Richtige getan. Die Scherentaster öffneten sich, gaben das Bein frei, und die Spinne begann, unsicher umherzukriechen.
Chuck Wegner drang stärker auf die Solifuga ein, die jetzt langsam zurückwich. Aber noch war das Ungeheuer nicht geschlagen, denn eines der gewaltigen Vorderbeine hakte sich blitzschnell in dem Gasschlauch fest. Der Gummi riss wie Papier.
Amtmann erkannte voller Schrecken die Gefahr.
»Wir müssen hier raus, bevor der Laden in die Luft fliegt!«, rief er und griff seinem verletzten Kollegen unter die Achseln.
Auch Chuck hatte erkannt, in welcher Gefahr sie schwebten. Er stellte seine Attacken ein und kam dem Professor zu Hilfe. Gemeinsam schleppten sie den verletzten Dieter Eckert zur Tür. Ein Blick zurück zeigte Amtmann, dass es allerhöchste Zeit wurde.
Soeben hatte die Walzenspinne mit einem kräftigen Ruck den Schlauch aus der Wand gerissen. Die ohnehin überdehnte Leitung kam wie eine Schlange zurückgeschossen und sauste durch den kleinen Raum. Dies war das letzte Bild, das der Professor aufnahm. Mit einem kräftigen Ruck drückte der Amerikaner die Tür ins Schloss, um gleich darauf seine zwei Kollegen zur Seite zu zerren.
Seine Rettungsaktion kam keinen Moment zu früh, denn im nächsten Augenblick wurde die Tür regelrecht aus der Füllung geblasen. Unzählige Splitter wirbelten durch die Luft und trafen die Gesichter der Männer wie Pfeile. Die Druckwelle fegte mit Urgewalt durch den langen Korridor, und aus der zerstörten Tür drangen immer noch knatternde Serien von kleineren Explosionen.
Aber noch waren die Schrecken nicht gebannt. Mit bleichen Gesichtern gewahrten die Männer, wie sich in den Trümmern der Tür etwas tat. Amtmann stockte der Atem. Aber dann sah er, dass es kein Trugbild war. Das Ungeheuer hatte die Explosion überlebt und schickte sich an, Furianis Labor zu verlassen.
»Verdammt, dem Vieh muss doch beizukommen sein«, keuchte Dieter Eckert mit schmerzverzerrtem Gesicht. Sein Bein sah übel aus und bereitete ihm Höllenqualen.
»Ich glaube, es ist nicht mehr nötig, etwas zu unternehmen«, rief der Professor und deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf den Hinterleib des Tieres, das sich jetzt völlig durch die Türöffnung geschoben hatte. Und nun sahen es alle.
Die Bewegungen des Ungeheuers wurden hektischer und wilder. Wie irrsinnig drehte es sich im Kreis und schnarchte und fauchte, dass es einem angst und bange werden konnte. Schließlich sprang die Spinne mit einem gewaltigen Satz hoch und stürzte auf den Rücken.
Die Flammen loderten höher und hüllten das Tier völlig ein.
Die Spinne starb. Mochten ihr die Explosionen und Axthiebe nichts anhaben können, die Flammen jedenfalls wurden zu ihrem Verderben. Wie eine bizarre Skulptur des Grauens streckte sie ein letztes Mal die Beine von sich, um sie dann in einer motorischen Bewegung zusammenzukrümmen.
Die Männer hatten das scheußliche Schauspiel angewidert beobachtet. Chuck Wegner war es jetzt, der seine beiden Kollegen aufrüttelte.
»Wir müssen raus, hier sind wir nicht sicher«, rief er. »Drinnen strömt immer noch Gas aus!«
Die beiden anderen nickten zustimmend. Gemeinsam halfen sie Dieter Eckert auf die Beine und taumelten, mehr als sie gingen, zur Tür. Mit letzter Kraft erreichten sie – zerschunden wie sie waren – das Portal.
Draußen hatten sich bereits die übrigen Studenten und das Personal versammelt. Hilfreiche Hände streckten sich den drei Männern entgegen, und in schreckensbleichen Gesichtern waren unzählige stumme Fragen zu lesen. Aber die Männer waren froh, dem Inferno erst einmal entkommen zu sein und schüttelten nur abweisend die Köpfe.
Ferne Sirenentöne und dumpfes Klirren zeugten davon, dass die Gefahr keineswegs gebannt war. In Sekundenschnelle hatte sich das Gebäude in einen rauchenden Trümmerhaufen verwandelt.
Die Menschen standen fassungslos mit tauben Ohren auf dem riesigen Hof und starrten in die Trümmer, in denen vereinzelt Brände aufflackerten.
Wie es dazu gekommen war, wussten jedoch nur drei von ihnen, und einer davon würde als Andenken ein Leben lang ein steifes Knie behalten – Dieter Eckert. Wie das riesige Spinnentier hatte entstehen können, konnte sich keiner erklären – und so recht glaubte auch niemand diese Geschichte. Aber die drei Männer hatten es mit eigenen Augen gesehen.
Branco Furiani vergaß man – zwanzig Jahre lang.
4. Kapitel
Seit sechs Tagen regnete es. Wenn Chuck Wegner seine Augen zum bleigrauen Himmel wandern ließ, fragte er sich allen Ernstes, wie Kurt Amtmann es fertiggebracht hatte, einen Flecken Erde mit derartigem Sauwetter auszubaldowern. Seit Taglio di Po waren die Straßenverhältnisse obendrein so schlecht, dass es ihn wunderte, dass sie überhaupt bis hierher nach Goro gekommen waren.
Die schwüle Wärme, die jetzt zu Pfingsten hier im Po-Delta herrschte, setzte allen Menschen gleichermaßen zu – ganz gleich, ob es sich um Einheimische oder Touristen handelte. Und hier in Goro, am Verlauf des Po di Goro, sah es besonders schlimm aus.
Eine eigenartige Landschaft war es, die nahegelegenen Sümpfe atmeten zu jeder Tageszeit eine schier unerschöpfliche Feuchtigkeit aus, die sich mit zunehmender Abendkühle zu dicken weißen Wolken ballte und als zäher Nebel bis in die Häuser vordrang.
Die Wärme des neuen Tages ließ dann die absonderlichsten Formen der Flora und Fauna hervorbrechen. Blitzschnell entwickelten sie sich, reiften in einer wahren Orgie von Farben und Formen heran und – wurden gefressen oder vergingen sonst wie. Spurlos, als hätte es sie nie gegeben und in selbstmörderischer Schnelle – wie sie gelebt hatten.
Über seinen Gedanken war es Chuck überhaupt nicht aufgefallen, dass der Regen nachgelassen hatte. In der schwülen Wärme trockneten die Gehwegplatten rasch, und bald waren nur noch feuchte Ränder zu sehen, die sich an den Fugen dunkel abzeichneten.
Etwas Hartes stieß in Chucks Kniekehlen. Überrascht drehte er sich herum und blickte mitten in das Gesicht seiner Frau. Sie trug zwei schwere Koffer und musterte ihn vorwurfsvoll:
»Du stehst hier am Fenster und träumst, während Lennie und ich die Koffer packen dürfen. Nun sag bloß nicht, du hättest nicht gemerkt, dass es aufgehört hat zu regnen. Vielleicht hilfst du uns wenigstens beim Tragen der Koffer.«
Chuck schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich war tatsächlich ganz in Gedanken …«
Entschlossen nahm er seiner Frau die Koffer aus den Händen und marschierte nach draußen. Gleich darauf kam er zurück.
»Wo ist Lennie?«
Auf der Treppe erklangen polternde Geräusche, und im selben Augenblick erschien Lennie auf der Bildfläche. Chuck schmunzelte, denn sein Sohn hatte sich einen weiteren Koffer unter den Arm geklemmt, während die Hand eine prall gefüllte Reisetasche trug. Fleiß war im Allgemeinen nicht eine von Lennies Tugenden. Offensichtlich hatte auch der Junge es eilig, von hier fortzukommen.
»Na, gib schon her«, murmelte Chuck und nahm seinem Sohn den Koffer ab.
Der Kofferraumdeckel des Fiats stand noch offen. Chuck brachte die Packstücke unter und eilte wieder hinein. Seine Frau Helen und sein fünfzehnjähriger Sohn standen am Tresen und waren unter Zuhilfenahme der Hände und Füße damit beschäftigt, sich mit dem Wirt zu verständigen.
Mit verständnislosem Gesicht eilte Chuck hinzu und lauschte eine Weile der erregten Diskussion.
»Was meint er?« Sein Daumen deutete über die Schulter zu dem ständig verschwitzten Wirt, der sich unter anderem mit rollenden Augen verständlich zu machen suchte.
»Er will uns nicht fortlassen«, übersetzten Helen und Lennie wie im Chor. »Er meint, es würde noch schlimmer werden mit dem Regen, und dann wären wir abgeschnitten und …«
»Si.« Der Wirt nickte zur Bekräftigung.
»Das ist mir egal«, entschied Chuck, »ich will weiter. Kurt wartet jetzt den zweiten Tag auf uns. Dieter ist bestimmt schon da. Schlimm genug, wenn wir die Letzten sind!«
Entschlossen wandte sich der Amerikaner dem Wirt zu.
»Wie viel?« Er machte die internationale Geste mit Daumen und Zeigefinger.
Der Wirt verstand sofort. Er legte die Stirn in Falten und beugte sich behäbig über sein Pult. Die Augen huschten geschäftig über den Rechnungsblock, der mit vielen unverständlichen Notizen übersät war. Endlich war er fertig. Mit freudestrahlendem Gesicht überreichte er dem Amerikaner die Rechnung.
Die Miene Chucks hellte sich auf. Na also, dachte er, es ist billiger, als ich gedacht hatte. Mit rascher Gebärde fuhr seine Hand in die Gesäßtasche und förderte das Portemonnaie zutage. Der Betrag, den er dem Mann hinblätterte, schien dessen Erwartungen zu übersteigen. Mit eifrigen Verbeugungen zog sich der Italiener zurück, eilte hinter dem Tresen hervor und öffnete den Fremden die Haustür.
Als die Familie hinaustrat, hatte sich der Himmel erneut bezogen, und das trübe Tageslicht wich mehr und mehr den Schatten des hereinbrechenden Abends. Bald würde es dunkel sein.
Chuck klemmte sich entschlossen hinter das Steuer des Leihwagens, startete das Fahrzeug und lenkte es anschließend zielstrebig auf den Ortsausgang zu. Die Familie verließ Goro.
5. Kapitel
Wie lange war er eigentlich schon gefahren? Chuck starrte mit schwimmenden Augen auf das Zifferblatt seiner Uhr und erkannte, dass bereits zwei Stunden vergangen waren. Er schüttelte den Kopf.
War er im Kreis gefahren? Fast schien es ihm so, als würde er immer nur fahren, ohne sich dabei fortzubewegen.
In regelmäßigen Abständen blitzte das Leuchtfeuer an der Mündung des Po di Goro auf. Sicher – danach musste er sich richten, aber warum kam es dann nicht näher?
Hinten auf der rückwärtigen Sitzbank hatte sich Lennie zusammengerollt und gab im Schlaf leise Schnarchgeräusche von sich. Der Junge hat es gut, dachte Chuck neidisch.
Sein Blick glitt langsam zu seiner Frau, die neben ihm auf dem Beifahrersitz hockte und, das Kinn in die Hände gestützt, mit müden Augen auf die Fahrbahn starrte. Sie schien in Gedanken versunken und kümmerte sich nicht um ihn. Chuck seufzte leise und lenkte seine Blicke erneut zurück auf die Fahrbahn.
Es war nicht einfach, mit einem Menschen wie Helen auszukommen. Zwar lenkten ihre hübsche Figur, das kurz geschnittene blonde Haar und ihr Gesicht mit den ausdrucksvollen Augen die Blicke der Männer fast automatisch auf sich, aber ihre plötzlichen Launen, die sie kompromisslos an ihre Umgebung weitergab, hatten schon einige Unruhe in Chucks Familienleben ausgelöst.
Die Dunkelheit war schnell über das Land hereingebrochen. Sie hatte erneute Regengüsse und Nebel mit sich gebracht, welche die ohnehin aufgeweichte Straße in eine Rutschbahn verwandelt hatten. Ein ums andere Mal musste Chuck bremsen und gegenlenken, damit der kleine Wagen nicht die Böschung hinunterrutschte.
Auf der Windschutzscheibe hatte sich ein leichter Film gebildet, der mit dem Schmutz zusammen einen zähen Kleister bildete. Die Scheibenwischer gaben nur noch verzweifelte Quietschtöne von sich, ausrichten konnten sie nichts mehr. Auch die Scheinwerfer hatten es schwer, die dichte Masse aus feuchtigkeitsgeschwängerter Luft und Regentropfen zu durchdringen. Ich hätte die Wischerblätter wechseln müssen, dachte Chuck und wandte sich erneut seiner Frau zu.
»Weißt du, die anderen sind wirklich nett, und ich glaube, du wirst dich mit ihnen bestimmt gut verstehen«, begann er zaghaft ein Gespräch. »Wir sind seit über zwanzig Jahren Freunde …«
Seine Frau hatte die Augen weit geöffnet. »Seit du damals aus Deutschland zurückgekommen bist und nie wieder dorthin wolltest …«
Chuck rutschte nervös auf seinem Sitz hin und her. »Das ist doch schon so lange her. Warum soll ich das wieder aufwärmen?«
»Weil es mich interessiert!«
»Aber das habe ich dir doch schon so oft erzählt. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen, wirklich nicht!«
»Aber« – Helen richtete sich auf – »er lebt doch noch!«
»Furiani?« Chuck wiegte den Kopf. »Natürlich, wenn man ihn nicht irgendwo geschnappt hat, dann erfreut er sich noch seiner Freiheit. Aber das ist unwahrscheinlich. Jemand wie Furiani fällt immer auf, ganz gleich, wo er sich befindet. Dazu waren seine Ansichten, sein Gehabe und …« Chuck machte eine hilflose Gebärde mit den Händen. »Verstehst du, alles an ihm war übersteigert und extrem.«
Helens Stimme klang wieder träge und schläfrig, als sie antwortete: »Trotzdem habe ich all die Jahre nichts über ihn in der Zeitung gelesen. In den Nachrichten war auch nichts zu hören.«
Chuck hatte den sarkastischen Unterton in ihrer Stimme nicht überhört. Dementsprechend scharf fiel auch seine Antwort aus. »Glaubst du denn, ich hätte nicht alle Nachrichten verfolgt? Ich weiß überhaupt nicht, was diese verdammte Fragerei bezwecken soll, muss ich denn …«
Er hieb wütend die flache Hand auf das Lenkrad.
In diesem Augenblick begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. Im Moment des Aufpralls fing der Wagen plötzlich zu schleudern an. Chuck griff verzweifelt in die Lenkradspeichen und versuchte, durch wildes Kurbeln den Fiat wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Aber je hastiger er das Steuerrad bewegte, desto mehr brach das leichte Fahrzeug aus. Schließlich drehte sich das Auto auf der schlammbedeckten Straße um die eigene Achse und schleuderte unhaltbar auf die Böschung zu.
Aber der erwartete steile Absturz blieb aus. Stattdessen blieb der Fiat plötzlich stehen, als wäre er durch ein unerwartetes Hindernis abgefangen worden. Leicht vibrierend kam er zum Stehen, als hätte ihn ein Netz aufgefangen.
Helens Augen richteten sich groß und anklagend auf ihren Mann.
»Du wirst uns noch alle umbringen«, stellte sie fest.
Chuck verbiss sich die scharfe Äußerung, die ihm auf der Zunge lag und starrte angestrengt nach draußen. Der Wagen war mit dem Heck ein Stück die Böschung hinuntergerutscht, sodass die Vorderräder den Kontakt mit dem Boden verloren hatten. Das ganze Fahrzeug hing dadurch in steiler Schräglage am Abhang.
Der Amerikaner drehte sich auf dem Sitz nach hinten und versuchte, durch die Heckscheibe etwas zu erkennen. Aber auch hier war nichts zu entdecken. Entschlossen betätigte er die Türverriegelung. Gleich darauf sprang der Wagenschlag auf, und feuchte Luft drang herein.
Chuck hatte bereits die Beine nach draußen geschwungen, als Helen sich wieder meldete. Ihre Stimme vibrierte leicht vor verhaltener Hysterie.
»Nun sag bloß, du willst uns hier allein lassen?«
Chuck presste die Lippen zusammen und musterte sie mit mühsam zurückgehaltenem Ärger. »Soll ich vielleicht warten, bis ein Wunder geschieht, das uns wie auf Schwingen davonträgt?«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage, Chuck!«
»Das war schließlich auch keine Frage, sondern eine deiner ständigen Quengeleien. Und nun lass mich zufrieden, ich will sehen, wie ich uns aus dieser Lage befreien kann …«
»… in die du uns gebracht hast, Chuck«, stellte sie fest.
»In die ich euch nicht gebracht hätte«, gab er zur Antwort, »wenn du mir mit deiner ewigen Nörgelei nicht auf die Nerven gegangen wärst.«
»Mom, ich finde, Daddy hat recht. Schließlich können wir hier nicht hängen bleiben und auf den nächsten Winter warten.« Lennie hatte sich auf der Rückbank aufgerichtet und musterte seine Umgebung mit verschlafenen Augen.
Chuck blickte seinen Sohn dankbar an. Lennie hatte die hübschen Gesichtszüge seiner Mutter, das schwarze Borstenhaar seines Vaters und auch dessen ruhiges, ausgeglichenes Temperament. Letzteres missfiel seiner Mutter allerdings sehr.
Helen war genau fünfzehn Jahre jünger als ihr Mann – genau die fünfzehn Jahre, die Lennies Alter ausmachten. Die beiden hatten heiraten müssen, ein Umstand, der Helens Eltern zwar missfiel, denn schließlich hatten sie mit ihrer verwöhnten Tochter andere Pläne gehabt, aber ein uneheliches Kind wäre zweifellos der größere Eklat gewesen. So hatte man sich zähneknirschend mit dem brotlosen Akademiker, der obendrein noch Sohn jüdischer Emigranten war, abgefunden.
Die anerzogene Hoffart und die zweifellos übersteigerte Selbstsucht aber hatte Helen nicht abgelegt. Sie waren im Gegenteil ein wesentlicher Teil ihrer Persönlichkeit geworden.
Helen war bei Lennies Worten herumgefahren. Jetzt musterte sie ihren Sohn zornig, gleichzeitig beschrieb ihre Hand einen weitausholenden Bogen.
Chuck konnte den Schlag gerade eben noch verhindern. Seine Finger umfassten Helens Handgelenk mit eisernem Klammergriff.
»Du schlägst den Jungen nicht«, stieß er hervor.
Helens Nasenflügel blähten sich empört. »Ich wusste es doch: Ihr haltet zusammen wie Pech und Schwefel, wenn es gegen mich geht!«
»Wenn du meinst, dass es so ist, dann will ich dich an diesem Glauben nicht hindern«, knurrte Chuck und schwang sich endgültig nach draußen.
Chucks Stiefel versanken bis zu den Knöcheln in dem zähen Matsch. Er befreite sich fluchend aus der Falle und rettete sich mit einem weiten Sprung auf eine nahe Grasinsel. Erst hier kam Chuck dazu, sich die Gegend näher anzuschauen.
Eine seltsame Landschaft war es. Der Regen hatte das angeschwemmte Land mit einer hohen Wasserschicht überzogen, sodass nur vereinzelte Buschinseln und Binsen und Schilfgrassoden aus der Einöde ragten.
Chuck bewegte sich vorsichtig um den Wagen herum, um festzustellen, was den federnden Aufprall des Fahrzeugs bewirkt hatte. Der Weg war schwieriger, als er angenommen hatte, denn die Böschung war nur mit einer dünnen Grasnarbe befestigt, die – vom Regen aufgeweicht – unter seinen Absätzen nachgab und davonrutschte.
Mit beiden Händen hielt sich der Mann am Wagendach fest, bereit, sich im Moment des Abrutschens sofort wieder hochzuziehen. Seine Blicke tasteten sich mühsam bis zum Wagenheck vor, das jedoch durch den Nebel nur schemenhaft zu erkennen war. Aber irgendetwas war da.
Chuck strengte die Augen an und spähte mit zusammengekniffenen Lidern durch den zähen Nebel. Der Gegenstand mutete an wie ein Kabel, das sich um das Wagenheck gelegt hatte und das sich irgendwo im Dunkel verlor. Die Sache wurde ihm immer mehr zum Rätsel. Kopfschüttelnd bewegte er sich näher heran.
In diesem Augenblick geschah es. Unter Chucks Stiefel gluckste es kurz, und sein Fuß versank bis zum Knöchel im Matsch. Gleichzeitig verlor er das Gleichgewicht.
Seine Arme ruderten ein paarmal, wurden zu Windmühlenflügeln, und Chuck rutschte immer schneller die Böschung hinab. Schließlich überschlug sich der Mann einige Male.
Die Orientierung hatte er längst verloren. Als die Rutschpartie begonnen hatte, hatte er instinktiv die Arme vor dem Gesicht angewinkelt, um die Augen zu schützen. Es klatschte, und Chucks Körper landete weich in einem schlammigen Tümpel.
Schmutziges Wasser drang ihm in Mund und Nase. Hustend und spuckend rappelte sich der Mann auf und schüttelte sich wie eine nasse Katze. Er rieb sich verwundert die Augen und schaute sich um.
Die Straße und das Auto waren nicht mehr zu sehen. Aber das Kabel war noch da …
Das Kabel! War es überhaupt eines? Chuck beschloss, sich die Sache näher anzusehen. Helen und Lennie konnten warten. Vorsichtig tastete sich der Mann heran und berührte den Strang mit der ausgestreckten Hand. Es war kein Kabel, eher wirkte es wie ein Seil aus Kunststoff oder Seide. Chuck schüttelte den Kopf, denn die Sache wurde immer rätselhafter.
Entschlossen zog er an der Schnur. Sie straffte sich, gab aber nicht nach. Hand über Hand tastete er sich an der Leine vor und entfernte, sich langsam von der Absturzstelle.
Der Himmel hatte sich wieder geöffnet und ließ bleiches Mond- und Sternenlicht hindurch. Wie bizarre Tiere schwammen die weißen Wolkengebilde in der samtenen Bläue. Als der Amerikaner sich aufrichtete, bemerkte er, dass auch der Nebel sich legte. Zwar reichte er ihm nur noch bis zur Brust, aber es war abzusehen, wann sich die Feuchtigkeit endgültig niedergeschlagen haben würde. Die Temperatur war merklich gefallen.
Entschlossen marschierte Chuck weiter. Leichter Wind kam auf und trieb die restlichen Nebelschwaden in Fetzen auseinander. Soweit er erkennen konnte, endete das Seil inmitten einer Buschinsel, die sich in zwanzig Meter Entfernung schwarz und drohend auftürmte.
Chuck beschleunigte seinen Schritt unbewusst. Seine Gedanken waren zu seinem Auto zurückgekehrt, wo Helen und Lennie auf seine Rückkehr warteten. Außerdem fror er bei dem aufkommenden Wind.
Einen Augenblick mochte der Amerikaner nicht auf den Weg geachtet haben, jetzt rächte es sich. Erneut verlor er das Gleichgewicht und stürzte schwer in den Schlamm. Aber diesmal war der Fall anders, Chuck war gestolpert.
Als er sich wieder hochrappelte und sich umsah, um herauszufinden, was das Straucheln ausgelöst hatte, erkannte er einen länglichen Gegenstand, der wie ein Baumstamm anmutete. Wütend hastete Chuck darauf zu. Er kniete nieder und säuberte den Gegenstand mit raschen Handbewegungen. Im gleichen Moment erstarrte er.
Der Mond hatte sich wieder freigeschwommen und enthüllte eine grausige Szene.
Chuck starrte in ein bleiches Gesicht, das seltsam blutleer wirkte. Dünnes Blondhaar lag in Strähnen über den Augen, die im Tode unnatürlich weit aufgerissen waren. Als Chuck näher hinschaute, bemerkte er, dass der ganze Körper von einem weißlichen Gespinst eingehüllt war, wie von einem Kokon. Chuck geriet in Panik.
Seine Hände tasteten sich wie im Fieber weiter vor und versuchten, den Körper von dem Geflecht zu befreien. Aber die Fäden gaben nicht nach. Gleichzeitig erkannte der Amerikaner, dass die dünnen Schnüre von derselben Beschaffenheit waren wie das Seil. Erneut trat der Mond hinter den Wolken vor, und diesmal erkannte Chuck auch das Gesicht des Mannes. Vor ihm lag die Leiche seines Kollegen Dieter Eckert.
War es die Angst, war es das Unheimliche an dieser Szene? Chuck schnellte aus der Hocke herum und ließ seine Blicke misstrauisch über die Landschaft tasten.
Auf einmal schien jeder Busch, jeder Strauch ihn zu belauern. Das Rascheln der Blätter im Wind war plötzlich überlaut und schien von allen Seiten zu kommen. Er musste hier weg!
Mit klammen Händen tastete Chuck den Körper ab und suchte nach Verletzungen. Seine Bewegungen wurden hastiger, und dann erstarrte er. Etwa in Hüfthöhe ließ sich deutlich etwas Hartes ertasten. Entschlossen zerriss Chuck das Gespinst und hielt – eine Pistole in den Händen.
Mit der Erkenntnis, eine Waffe in der Hand zu halten, gewann eine andere Tatsache Raum in seinem Denken. Dieter musste ermordet worden sein. Anders ließ es sich nicht erklären, dass er versucht hatte, die Pistole zu benutzen. In einer plötzlichen Anwandlung von Panik schoss Chuck wieder hoch und blickte sich gehetzt um.
Hinter der Buschinsel tat sich etwas. Riesige schwarze Greifer ragten, Spinnenbeinen gleich, hervor und schickten sich an, das Hindernis zu überwinden. Gleichzeitig straffte sich das Seil, das zum Wagen führte, wie von unsichtbaren Händen bewegt. Chuck hatte genug.
Ohne auf die Unzugänglichkeit des Geländes zu achten, hetzte er davon. Die Furcht saß ihm im Genick und trieb ihn an. Der aufgeweichte Boden flog nur so unter den Füßen des Fliehenden dahin. Die Stiefelabsätze saugten sich ein ums andere Mal fest, rissen sich unter saugendem Geräusch los und verspritzten Dreck nach allen Seiten.
Wieder verhakte sich der Knöchel des Mannes und brachte ihn zum Straucheln. Chuck sank mehr hin, als dass er fiel. Sein Herz hämmerte, der Atem flog, und die Erschöpfung machte sich lähmend in allen Gliedmaßen breit.
Ein lautes Scheppern und Krachen ließ ihn hochschrecken. Es kam aus der Richtung, in der er das Auto vermutete. Da war es wieder – diesmal deutlicher.
Chuck glaubte auch, so etwas wie verwehte Stimmen zu hören. Mühsam richtete er sich auf und erkannte, dass er bei seiner Flucht die falsche Richtung eingeschlagen hatte. Er lauschte erneut in den Wind, aber diesmal war nichts anderes zu hören als das Rascheln der Blätter.
Um zu dem Wagen zurückzugelangen, musste Chuck einige hundert Meter an der Böschung entlang. Er dachte nach. Natürlich hieß das die Rückkehr an den unheimlichen Ort, wo er auf die Leiche des Freundes gestoßen war. Es schauderte ihn erneut, als er an das bizarre Wesen mit den gewaltigen Greifern dachte.
Aber andererseits hatte er gar nicht so genau hingeschaut, um beurteilen zu können, ob es sich wirklich um ein Tier gehandelt hatte. Entschlossen machte er sich wieder auf den Weg.
Da war die Stelle, deutlich war das helle Kabel auszumachen. Chucks Augen tasteten sich weiter und suchten nach dem Körper des Freundes. Hier musste er liegen. Chuck wappnete sich. Aber der Körper war fort.
Chuck wollte sich fassungslos mit der Hand über die Stirn fahren, als seine Augen gebannt an einem Gegenstand hängen blieben. Rasch bückte er sich und hielt gleich darauf die Pistole in der Hand. Wer auch immer den Leichnam entfernt haben mochte, er hatte die Waffe übersehen.
Mit der Pistole kehrte ein Teil von Chucks Mut zurück. Er bewegte sich zögernd auf die Buschkette zu, während seine Hand die Waffe umklammerte. Aber auch hier war nichts zu entdecken. Nur in den höher gelegenen Zweigen ballten sich dicke Bündel des merkwürdigen Materials.
In einer plötzlichen Eingebung raffte Chuck etliche der Schnüre zusammen und verstaute sie in der Tasche. Anschließend wandte er sich um und trat den Rückweg zur Straße an.
Wieder gluckste und quatschte der Schlamm unter seinen Füßen, als er sich vorsichtig hochtastete. Immer wieder war das Seil der letzte Rettungsanker, wenn der Boden unter seinen Sohlen fortrutschte. Mit einer letzten Anstrengung zog er sich empor und stand gleich darauf auf der Straße. Und hier erwartete ihn die zweite böse Überraschung.
Die Stelle, an der der Wagen steckengeblieben war, war verlassen. Kein Auto, keine Helen, kein Lennie.
Jäh schoss Chuck die Erinnerung an die verwehten Laute und Stimmen durch den Sinn. Er eilte zu der Stelle, wo das Fahrzeug abgerutscht war und entdeckte einige tiefe Reifenspuren. Aber sie endeten abrupt, als hätte sich das dazugehörige Auto in Luft aufgelöst.
Mühsam versuchte der Mann, Ordnung in seine wirbelnden Gedanken zu bringen. Aber je klarer er sah, desto sicherer wurde er: Eine schreckliche Tragödie hatte hier ihren Anfang genommen.
In der Ferne blitzte das Leuchtfeuer und wies Chuck den Weg, als er sich mühsam mit schleppenden Schritten auf den Weg machte. In seinem Kopf war nichts als Leere …
6. Kapitel
»Der Po misst von seiner Quelle bis zur Mündung sechshundertzweiundfünfzig Kilometer. Er entspringt in den Cottischen Alpen und bringt von dort Unmengen von Schlamm mit sich. Unterwegs nimmt er noch mehr Geröll und Sedimente auf. So kommt es, dass der Fluss regelmäßig im Frühjahr über die Ufer tritt. Vor der Mündung hat sich ein gewaltiges Delta gebildet. Es setzt sich aus dem mitgeführten Schlamm zusammen. Jahr für Jahr verlagert er seine Mündung …«
»… um etwa siebzig Meter«, echoten Kurt Amtmanns Zuhörer wie aus einem Mund.
Der Professor fixierte verblüfft die anderen, die sich ihrerseits über seine Miene diebisch freuten.
Amtmann nahm seine Brille ab und putzte sie umständlich.
»Ich sehe«, meinte er leichthin, »dass sich mein Sohn Thomas in den Kreis der Spötter eingereiht hat.« Thomas Amtmann richtete seinen Blick in gespielter Verzweiflung zur Zimmerdecke. Er stand auf. »Ich werde Alfie zu Bett bringen.« Sein Blick ging zur Uhr. »Ich glaube es ist höchste Zeit.«
Thomas stand auf und nahm den jüngeren Bruder wortlos auf den Arm. Alfie war ein neunjähriger Junge mit hübschen Zügen. Die Natur hatte ihn mit einer blühenden Fantasie und einer gehörigen Portion Frechheit ausgestattet, die sich aus seinem Mund kompromisslos über die Anwesenden verteilte. Alter und Herkunft waren da unwichtig, vor Alfie waren sie alle gleich. Auch die Eltern machten da keine Ausnahme.
»Schaffst du es allein?« Karin Amtmann war herangetreten und musterte ihren zwanzigjährigen Sohn besorgt. Sie war eine Frau von vierzig Jahren, die mit ihren großen Augen, dem dunklen Haar und der sportlichen Figur immer noch unerhört attraktiv war.
»Wenn ich mir Mühe gebe«, bemerkte Thomas spöttisch und schritt mit seinem Bruder die schmale Holzstiege zu den zwei kleinen Schlafzimmern hoch.
Das Gespräch hatte Alfie aus dem Schlaf gerissen. Er rieb sich die Augen und blinzelte verwundert.
»Was ist hier los?«, wollte er wissen.
»Nichts ist los«, entgegnete Thomas. »Du musst ins Bett, Bruderherz, das ist los!«
»Tommi, ich muss dir etwas erzählen, aber du darfst es nicht weitersagen.« Alfies Stimme hatte einen verschwörerischen Klang angenommen, und er legte demonstrativ den Zeigefinger auf die Lippen.
»Großes Ehrenwort, Häuptling. Meine Lippen sind versiegelt.« Im Stillen grinste Thomas. »Aber auch Häuptlinge müssen ins Bett, also mach keine unnötigen Faxen.«
Alfie schwieg beleidigt, aber seine Augen verrieten deutlich, dass er förmlich darauf brannte, seine Neuigkeiten loszuwerden. Aus diesem Grund ließ er sich auch widerstandslos hinauftragen – ein Akt, der sonst nie ohne wütenden Protest abging.
Aber heute verlief alles ziemlich glatt. Wahrscheinlich, weil Alfies ganzes Sinnen und Trachten darauf gerichtet schien, seinem Bruder die Neuigkeit brühwarm zu unterbreiten. Thomas deckte den Kleinen zu.
»Tommi, sag mal, wie groß werden eigentlich Grashüpfer?«
»Na, du stellst mir vielleicht Fragen:« Thomas hielt Daumen und Zeigefinger etwa fünf Zentimeter auseinander. »Ich denke so. Was hat die Frage zu bedeuten?«
Die Stimme des kleinen Bruders sank zum Flüstern herab. »Ich habe einen gesehen, der war so groß wie ein Hund.« Jetzt funkelten seine Augen triumphierend. »Er hat sogar ein Kaninchen gefangen und sofort aufgefressen. Da staunst du, was?«
»Da staune ich allerdings«, meinte Thomas, »nämlich über deine blühende Fantasie.«
»Wenn ich es doch gesehen habe!«, antwortete Alfie wütend. »Ich stand hinter einem Busch und war mucksmäuschenstill. Hinterher ist er dann davongestelzt.«
»Na fein, und jetzt ist Feierabend, Bruderherz. Wenn du es dir bis morgen nicht anders überlegt hast, dann können wir ja noch einmal darüber reden«, erklärte Thomas resolut und hatte die Hoffnung, dass Alfie die Sache bis zum nächsten Tag vergessen haben würde. Er löschte das Licht und verließ den Raum, um in das Wohnzimmer zurückzukehren.
Die Eltern beachteten ihn nicht weiter, sie waren ins Gespräch vertieft und ließen sich nicht ablenken.
»Eigentlich hätten sie längst da sein müssen«, murmelte der Professor und starrte nach draußen in den strömenden Regen.
»Dein Amerikaner wird den Weg nicht gleich gefunden haben.«
»Dein Amerikaner, was soll denn das heißen?« Professor Amtmann drehte sich herum und musterte seinen Sohn. »Chuck Wegner ist keiner von den Amerikanern, die Bierkrüge sammelnderweise durch Old Germany ziehen und bei der Fronleichnamsprozession aus Unkenntnis Helau schreien. Dazu hat er zu lange in Deutschland gelebt.«
»War ja auch nicht so gemeint«, murmelte Thomas.
Frau Amtmann meinte: »Thomas wird nervös sein, weil Dieter und Hannelore noch nicht da sind.«
Über Kurt Amtmanns Gesicht glitt ein Lächeln. Thomas’ Freundschaft mit Dieter Eckerts Tochter Hannelore fand seine volle Zustimmung. Das Mädchen glich fast bis aufs Haar Dieters verstorbener Frau – eine niedliche Blondine mit vereinzelten Sommersprossen, einem ewig lachenden Mund und einer Stimme, die der eines Jungen im Stimmbruch glich.
In diesem Augenblick pochte es einige Male energisch an der Tür. Thomas sprang auf und eilte in den Flur. Gleich darauf drang lautes Stimmengewirr herein.
Als Erster betrat Thomas das Wohnzimmer, dichtauf gefolgt von einem kleinen untersetzten Mann, offenbar einem Einheimischen. Die beiden hatten ihn noch nie gesehen. Der Professor schaute den Sohn fragend an. »Was will er?«
Thomas wollte antworten, doch der kleine Italiener ließ ihn nicht zu Wort kommen. Seine ausgestreckte Rechte schwenkte einen weißen Leinensack. Die Linke hielt eine dunkle Baskenmütze.
»Er sagt, wir seien abgeschnitten«, murmelte Karin Amtmann. Sie verstand ein wenig Italienisch.
»Si.« Der Italiener nickte zur Bekräftigung. »Mich« – er deutete mit dem Daumen auf seine Brust – »mich, Giovanni Santadi. Ich Bauer – bringe Lebensmittel für zwei.« Er spreizte Zeige und Mittelfinger. »Für zwei Tage. Überschwemmung in zwei Tagen vorbei …«
»Frag ihn doch bitte einmal, ob wir die einzigen Abgeschnittenen sind«, forderte Amtmann seine Frau auf.
»Giovanni verstehn deutsch.« Er lachte. »Fünf Jahre in Deutschland, als Gastarbeiter. Da ist eine Mann – ist Forscher. Unheimlicher Kerl. Wir ihn nennen Maligatto, weil er alle Maligatti gesammelt, die er finden. Ich nichts mit ihm zu tun habe, weil jedes Mal, wenn ich zu nahe komme sein Haus, er bedrohen mich mit Gewehr. Er hat riesengroße Treibhäuser.«
»Hm, die Lebensmittel können wir brauchen«, entschied der Professor und zückte sein Portemonnaie. »Wenn er von Chuck und Dieter nichts weiß, dann werden sie bestimmt in Goro darauf warten, dass die Straßen wieder befahrbar sind.« Kurt Amtmann entlohnte Santadi reichlich und geleitete ihn zur Tür. Gleich darauf hörte man die Haustür schlagen, und er kam zurück.
»Maligatto.« Der Professor überlegte. »Seltsame Bezeichnung.« Er wandte sich an seine Frau. »Kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist?«
»Nein«, sagte Karin. »Wenn es mit Mal… beginnt, dann bedeutet es etwas Schlechtes.«
»Aha, und wenn es mit Bene beginnt, dann bedeutet es etwas Gutes«, meinte Thomas Sarkastisch. »Das ist ja ungeheuer aufschlussreich.«
»Er hat Maligatti gesammelt«, sinnierte Karin. »Was heißt das?«
»Vielleicht grüne Knollenblätterpilze«, mutmaßte Thomas unverschämt.
Karin Amtmann musterte ihren Sohn zornig. »Hör mal zu, es reicht mir jetzt allmählich. Wenn du vor schlechter Laune vergehst, bloß weil deine Freundin nicht hier ist, dann lass das gefälligst nicht an uns aus!« Es klopfte erneut heftig an der Haustür. Thomas zögerte nicht lange, sondern rannte zum Eingang. Im Augenblick, als sie die Angeln laut quietschen hörten, überstürzten sich die Ereignisse.
Ein lauter Ausruf des Schreckens – zweifellos von Thomas – drang herein. Noch bevor die beiden reagieren konnten, kam der junge Mann zurück, sein Gesicht war schreckensbleich. Er wurde von einem Mann verfolgt, der eine riesig anmutende schwarze Pistole in der Faust hielt.
Sein Haar war schwarz und borstig. Die Kleidung war über und über mit Dreck besudelt. An der Stirn klaffte eine Platzwunde.
»Chuck, verdammt, wo kommst du her?«, rief Amtmann entsetzt.
»Kurt, sie haben – sie haben …« Chuck Wegner verdrehte die Augen, langsam knickten seine Knie ein, und er fiel ohnmächtig zu Boden.
7. Kapitel
Wo sie saß, war es finster und feucht.
So sehr sie sich anstrengte, ihre Augen konnten die völlige Finsternis nicht durchdringen. Sie wusste ohnehin nicht, wie sie hierhergekommen war.
Das Mädchen war übergangslos wach geworden, hatte die Augen geöffnet und sich hier in dieser Grabesstille wiedergefunden. Jäh kam die Erinnerung an die Vorgänge zurück, die sich auf der nächtlichen Straße abgespielt hatten, und sie erstarrte vor Schreck.
Scheinwerfer, die ihre Kegel gerade in den Nebel bohrten, eine schlüpfrige Straße und Büsche, die schemenhaft links und rechts auftauchten und wieder verschwanden. Aber plötzlich war da etwas, es stand auf der Straße und blockierte sie. Ehe der Vater bremsen konnte, fing das Hindernis an, sich zu bewegen. Eine bizarre Klaue sauste auf das Fahrzeug zu, erfasste es und schleuderte es mit einer einzigen Bewegung die Böschung hinunter.
Die Scheinwerfer sandten ihr Licht in den nächtlichen Himmel. Der Wagen drehte sich, überschlug sich und raste weiter. Irgendwann blieb er stehen. Der Vater stieß die Tür auf, ergriff sie an der Hand und zerrte sie hinaus.
Geruch nach Benzin war zu verspüren, und hier und da züngelten einzelne Flämmchen. Er zerrte sie weiter und weiter, doch als sie sich umdrehten, erkannten sie, dass das bizarre Tier ihnen gefolgt war. Der Vater zog eine Pistole aus der Tasche. Hannelore hatte sie noch nie gesehen.
Das Tier verhielt prüfend in der Bewegung und reckte zwei gewaltige Klauen wie zum Gebet in den Himmel. Plötzlich knallte es. Hannelore blickte erschrocken zur Seite und sah, dass ihr Vater auf das Tier schoss. Tatsächlich schien sich das Ungeheuer vor den Schüssen zurückzuziehen.
Urplötzlich setzte starker Regen ein.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: