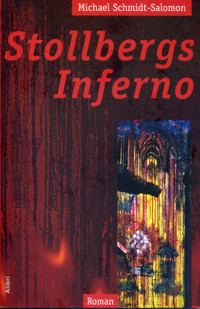15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie das moderne Denken entstand Wir leben in einer komplexen Welt, in der man leicht den Überblick verliert. Wie gelingt es uns angesichts der Flut an Informationen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, Ereignisse einzuordnen und zu verstehen? Gibt es Erkenntnisse, die für eine moderne, aufgeklärte Sicht der Welt zentral sind – und wenn ja: wer hat sie hervorgebracht? Michael Schmidt-Salomon stellt in diesem Buch einige der wichtigsten Denkerinnen und Denker der Geschichte vor und zeigt, was wir von ihnen lernen können, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern. »Schmidt-Salomons Überlegungen regen zum Nachdenken an.« SRF Kultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv und Illustrationen: Roland Straller
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Einleitung
Ein Kopf denkt nie allein
Die größten Genies aller Zeiten?
Influencer für ein zeitgemäßes Weltbild
Auf den Schultern von Riesen
Das Problem der kulturellen Demenz
1 Nichts ist beständiger als der Wandel
Die Reise mit der Beagle
Der Wandel der Arten
Survival of the Sexiest
Die Neandertaler von morgen
2 Unterwegs in Raum und Zeit
Unstillbare Neugier
Ein neues Weltbild
Die Entdeckung der Raumzeit
Auf der Suche nach der Weltformel
3 Die Bausteine des Kosmos
Der mühsame Weg einer Hochbegabten
Die Entdeckung der Radioaktivität
Die Kosten des Erfolgs
Das Geheimnis der Materie
4 Die Welt gerät ins Wanken
Ein Abenteurer der Wissenschaft
Pioniere der Klimaforschung
Wandernde Kontinente
Und sie bewegt sich doch!
5 Ein Staubkorn im Weltall
Ein Wunderkind auf dem Weg ins All
Is there anybody out there?
Verantwortung für die Erde
Die Entprovinzialisierung des Denkens
6 Carpe diem
Ein Leben im Verborgenen
Die Entdeckung des Individuums
Sinn und Sinnlichkeit
Ein später Triumph
7 Jenseits von Gut und Böse
Leben am Abgrund
Der Philosoph mit dem Hammer
Jenseits von Gut und Böse
Wege und Irrwege
8 Geschichte wird gemacht
Sein und Bewusstsein
Das Gespenst des Kommunismus
Das Kapital
Marx und die Marxismen
9 Wir irren uns empor
Eine ungewisse Zukunft
Logik der Forschung
Die offene Gesellschaft und ihre Feinde
Die Schwierigkeiten einer rationalen Debatte
10 Im Lichte der Evolution
Zum Erfolg verdammt
Im Lichte der Evolution
Der evolutionäre Humanismus
Die Herausforderungen der Zukunft
Ausblick: Der Zukunft entgegen
Planetare Verantwortung
Die neue Achsenzeit
Stichwortverzeichnis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Register
Motto
Niemals hatte ich den Wunsch, den Leuten zu gefallen.Denn was ihnen gefiel, habe ich nicht gelernt.Was ich aber wusste, lag weit außerhalb ihres Horizonts.
Epikur (341–271 v. u. Z.)
Einleitung
Ein Kopf denkt nie allein
Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Je größer die Menge an Informationen ist, die wir produzieren, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Schon 2012 lag das Volumen des täglichen Datentransfers bei einer Milliarde Gigabyte, was etwa dem 2500-Fachen der Datenmenge aller Bücher entspricht, die jemals geschrieben wurden. Wie wollen wir angesichts dieser Flut an Informationen noch Bedeutsames von weniger Bedeutsamem unterscheiden, Sinn von Unsinn, Fakten von Fakes?
Früher bestand das Problem darin, an Informationen zu gelangen, heute müssen wir damit kämpfen, von ihnen nicht mitgerissen zu werden. Dies erklärt auch, warum einfach gestrickte Weltverschwörungsideologien so attraktiv geworden sind. Denn sie bieten einen großen Vorteil, nämlich Inseln der Sicherheit in einem Meer der Unübersichtlichkeit. Verschwörungsgläubige profitieren von dem schönen »faustischen« Gefühl, »den vollen Durchblick« zu haben und zu den wenigen »Auserwählten« zu gehören, die begreifen, »was die Welt im Innersten zusammenhält«. Kein Wunder, dass sie alle Fakten und Argumente ausblenden, die das Kartenhaus ihres Weltbildes zum Einsturz bringen könnten.
Verschwörungsideologien beruhen auf einer unzulässigen Reduktion der Komplexität der Welt – das heißt allerdings nicht, dass die Reduktion von Komplexität an sich schon problematisch wäre, sie ist vielmehr lebensnotwendig: In jeder Sekunde filtert unser Gehirn aus den vielen Millionen Bits an Information, die auf uns einströmen, die Daten heraus, die für unsere Existenz von Bedeutung sind oder es sein könnten. Ohne diesen neuronalen Selektionsmechanismus würden wir völlig orientierungslos durch das Leben irren. Anders formuliert: Die Komplexität des menschlichen Gehirns ist erforderlich, um die Komplexität der Wirklichkeit auf eine handhabbare Größe herunterzurechnen. Erst auf dieser Basis kann unser Denkapparat als effektive »Vorhersagemaschine« dienen und dafür sorgen, dass wir uns in unserem Leben zurechtfinden.
Wir erkennen daran, dass die Selektion von Information ebenso wichtig ist wie die Konstruktion von Information. Doch anhand welcher Maßstäbe entscheiden wir sinnvollerweise, was relevant ist und was nicht? In der Regel stellen wir uns diese Frage nicht. Denn unser Gehirn beurteilt sämtliche Informationen, die es erhält, routinemäßig auf der Grundlage von angeborenen Programmen, die sich in der Evolution als erfolgreich erwiesen haben, sowie anhand der Erfahrungen, die wir in unserem eigenen Leben gemacht haben.
Diese einfache Routine ist hilfreich im Alltag, doch objektive Kriterien für die Relevanz von Informationen können wir von ihr nicht erwarten. Schließlich arbeitet unser Gehirn auf der Basis von subjektiven Erlebnissen, die in höchstem Maße davon abhängig sind, in welche Zeit, in welche Kultur, in welche Familie wir zufällig hineingeboren wurden. Aus diesem Grund halten wir genau das für bedeutsam, von dem wir im Rahmen unserer Sozialisation gelernt haben, dass es bedeutsam sei – was aber nicht heißt, dass es losgelöst von diesen Einflüssen tatsächlich bedeutsam ist.
Damit stellt sich die Frage, wie wir dieser »Subjektivitätsfalle« entgehen können. Wie also unterscheiden wir das, was wirklich relevant ist, von dem, was uns aufgrund unserer Prägungen bloß relevant erscheint? Oft greifen wir in solchen Fällen auf das Mittel der Quantifizierung zurück: Wir versuchen eine objektivere Perspektive zu entwickeln, indem wir unsere subjektiven Erfahrungen mit den Erfahrungen vieler anderer Menschen abgleichen. Doch hilft uns das hier weiter? Ist die Relevanz einer Information tatsächlich abhängig davon, wie viele Menschen sie als relevant erachten? Steht und fällt die Qualität von Texten, Bildern oder Klängen mit der Quantität des Interesses, das sie hervorrufen?
Ganz so einfach ist es wohl nicht, denn ansonsten müssten wir den »Baby Shark Dance« – die südkoreanische Version des Kinderliedes »Kleiner Hai« mit unglaublichen zwölf Milliarden Aufrufen bei YouTube (Stand Anfang 2022) – zum wichtigsten kulturellen Erzeugnis der Menschheit erklären und Cristiano Ronaldo (»den Influencer mit der größten Reichweite der Welt«) zur einflussreichsten Person des Planeten. Selbst seriösere Plattformen als YouTube, Facebook, Instagram & Co. helfen uns auf diesem Gebiet kaum weiter: So gibt es zu Donald Trump 230 Einträge in der internationalen Wikipedia, zur zweifachen Nobelpreisträgerin Marie Curie hingegen nur 174 und zu Alfred Wegener, dem Entdecker der Kontinentalverschiebung, nur 73 – doch das macht Trump nicht notwendigerweise zu einer »bedeutenderen Persönlichkeit«.
Die größten Genies aller Zeiten?
Die Methode der Quantifizierung ist äußerst nützlich, um ein klareres Bild der Welt zu erhalten – allerdings gilt dies nur unter der Voraussetzung, dass die Forschungsfragen klug gestellt sind und die Datenlage einigermaßen klar ist. Ist dies nicht der Fall, hilft uns Statistik wenig weiter. Zu welch skurrilen Ergebnissen man kommt, wenn man versucht, die Bedeutung historischer Persönlichkeiten über Umfragen zu ermitteln, zeigten vor 20 Jahren zwei Fernsehsendungen, bei denen ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte:
In der BBC-Sendung 100 Greatest Britons (2002) wählten die Zuschauerinnen und Zuschauer Winston Churchill und Lady Di auf Platz 1 und Platz 3 der »größten Briten aller Zeiten« – noch vor Charles Darwin, William Shakespeare und Isaac Newton (Plätze 4 bis 6). In der nach gleichem Strickmuster produzierten ZDF-Sendung Die größten Deutschen (2003) waren die Ergebnisse nicht weniger erstaunlich: Hier landeten Konrad Adenauer und Martin Luther auf den Plätzen 1 und 2. Karl Marx konnte (dank ostdeutscher Unterstützung) zwar einen respektablen 3. Platz erringen, Albert Einstein jedoch musste sich mit dem 10. Platz begnügen und konnte posthum noch »froh« sein, nicht von dem ehemaligen »Deutschland sucht den Superstar«-Kandidaten Daniel Küblböck (Platz 16 auf der Liste der »größten Deutschen«) übertrumpft zu werden.
Gibt es andere Möglichkeiten, die Personen zu bestimmen, die für die Menschheitsgeschichte besonders relevant waren beziehungsweise die es für uns Heutige noch immer sind? 2016 sorgte eine Liste der vermeintlich »größten Genies aller Zeiten« für internationale Schlagzeilen. Aufgestellt hatte sie der US-amerikanische Ingenieur Libb Thims, der sich dabei auf zwei zentrale Eigenschaften stützte, nämlich den Einfluss der jeweiligen Personen und ihres Werks auf die Welt sowie ihr gemessener beziehungsweise unterstellter Intelligenzquotient (IQ). In dieser »Top 40 der klügsten Köpfe der Geschichte« schaffte es Johann Wolfgang von Goethe auf Platz 1, Albert Einstein auf Platz 2 und Leonardo da Vinci auf Platz 3. Eigentümlicherweise jedoch tauchten in dem Ranking der »40 größten Genies« weder Charles Darwin noch Friedrich Nietzsche noch Karl Marx auf, wohl aber ein amerikanischer Gewichtheber, der als der »klügste Mann der USA« gilt, sowie ein Quizshow-Erfinder, der bei IQ-Tests herausragend abgeschnitten hatte.[1]
Wie nicht anders zu erwarten, führte Thims’ Top 40 zu heftigen Kontroversen. Bemängelt wurde unter anderem, dass die Liste insgesamt zu US-lastig sei und erst auf Platz 25, mit Marie Curie, eine Frau erschien. Fraglich war und ist auch der von Thims unterstellte Zusammenhang zwischen Genialität und Intelligenz. Zwar ist ein gewisses Maß an allgemeiner Intelligenz erforderlich, um auf irgendeinem Gebiet herausragende Leistungen zu erbringen, das heißt aber keineswegs, dass ein eindeutig proportionaler Zusammenhang zwischen IQ und Genialität bestehen würde, wie es der amerikanische Psychologe Lewis M. Terman (1877–1956), der Entwickler des berühmten »Stanford-Binet-Tests«, unterstellt hatte.
Von den über 1500 hochbegabten Kindern, die Terman in seiner Langzeitstudie ab 1928 untersuchte (alle hatten einen IQ über 135), waren viele zwar überdurchschnittlich erfolgreich, jedoch ging keines von ihnen durch herausragende (»geniale«) Leistungen in die Geschichte ein – im Unterschied zu zwei Kindern, die Terman wegen ihres (vermeintlich) zu geringen IQs (also unter 135 Punkten) aus der Studie ausgeschlossen hatte, nämlich die beiden Physik-Nobelpreisträger William Shockley und Luis Alvarez![2] Vor allem Alvarez erwies sich dabei als eine Art »Universalgenie«: Neben seinen entscheidenden Beiträgen zur Elementarteilchenphysik war er ein äußerst produktiver Erfinder, der 1978 in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen wurde. Zudem lieferte er zusammen mit seinem Sohn, dem Geologen Walter Alvarez, die Erklärung für das rätselhafte Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren.[3]
Halten wir fest: Hohe Intelligenz ist wohl eine notwendige, aber keine hinreichende Eigenschaft, um herausragende Leistungen auf den Gebieten der Wissenschaft und der Philosophie erklären zu können.[4] Wie aber steht es um das zweite Merkmal, das Thims seiner »Top 40« zugrunde gelegt hatte? Lässt sich der Grad der Genialität einer Person tatsächlich über ihren quantitativen Einfluss auf die Welt bestimmen? Nun, wenn dem so wäre, müssten wir Hitler, Stalin und Mao ebenfalls in die »Liste der größten Genies« aufnehmen und sicherlich auch die von Abermillionen Menschen weltweit verehrten (über weite Teile jedoch bloß fiktionalen) Religionsstifter Jesus, Mohammed oder Buddha, die es tatsächlich – wen wundert’s? – in einige »Bestenlisten« geschafft haben.
Dass derartige Rankings so unterschiedlich ausfallen, hat einen guten Grund: Denn »Genialität« bezeichnet keine reale Eigenschaft einer Person, sondern ist das Ergebnis einer sozialen Zuschreibung. Der deutsche Psychiater Wilhelm Lange-Eichbaum, der sich in seinem elfbändigen Werk Genie – Irrsinn und Ruhm wie kaum ein anderer mit dem »Genie-Problem« beschäftigt hat, brachte dies folgendermaßen auf den Punkt: »Genie ist nichts anderes als Anerkennung.«[5]
Was das bedeutet, kann man sich am Beispiel von Vincent van Gogh leicht verdeutlichen: Sicherlich waren dessen Gemälde, die unsere Sehgewohnheiten radikal veränderten, bereits »genial« (im Sinne von »überwältigend kreativ und originell«) zu einem Zeitpunkt, als sie noch niemand kannte. Doch zu einem veritablen »Genie« avancierte der niederländische Maler erst in dem Moment, als seine Werke internationale Beachtung fanden und zu Rekordpreisen verkauft wurden. Es bedarf also einer »Gemeinde von Verehrerinnen und Verehrern«, um aus einer Persönlichkeit der Kunst, der Wissenschaft, der Philosophie oder der Politik ein »Genie« zu machen. Erst Apostel erschaffen Propheten.
Tatsächlich hat »das Genie« mit der realen Person, die im Zentrum des Verehrungskultes steht, oft wenig gemein. Der historische Mensch muss sich hinter dem Zerrbild des vergöttlichten Ideals geradezu verflüchtigen, damit »das Genie« als solches gefeiert werden kann. Lange-Eichbaum behauptete sogar, dass der »wahre Mensch« die »Geniegemeinde« überhaupt nicht interessiere: »Denn sie verehrt ja nur die Struktur, die sie selbst gezimmert. Damit sie überhaupt ein Idealbild zu schauen vermag, muss der primäre Träger, der historische Mensch, in seiner wahren Gestalt verschwinden. […] Jeder würde von seinem Genie-Fetisch aufs Bitterste enttäuscht sein, wenn er ihn wirklich durch und durch kennte.«[6]
Aus diesem Grund werden »Genies« oft erst nach ihrem Tod geboren. Sie sind, wie der bedauernswerte Herr Tur Tur in Michael Endes Kinderbuch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, »Scheinriesen«, die erst aus der Ferne übermenschlich groß wirken. Arthur Schopenhauer hat diesen zentralen Aspekt des Geniekults wunderbar auf den Punkt gebracht: »Die Verehrung verträgt nämlich nicht die Nähe, sondern hält sich fast immer in der Ferne auf; weil sie, bei persönlicher Gegenwart des Verehrten, wie Butter an der Sonne schmilzt.«[7]
Was aber treibt uns dazu, einen Menschen, den wir nur über räumliche oder zeitliche Distanz wahrnehmen, derart zu idealisieren, dass die reale Person hinter diesem Zerrbild nahezu verschwindet? Solche Verhaltensweisen sind uns aus religiösen Kontexten wohlbekannt. Offenkundig hat die Säkularisierung (die Verweltlichung der Gesellschaft seit dem 18. Jahrhundert) diese Verhaltensweisen nicht aufgehoben, sondern bloß modifiziert. Dabei wurden die religiösen Idole (»die himmlische Schar der Engel und Heiligen«) durch weltliche Idole ersetzt, etwa durch Künstler wie Leonardo da Vinci, Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Wissenschaftler wie Albert Einstein, Schauspielerinnen wie Greta Garbo (»die Göttliche«), Popikonen wie Janis Joplin oder Sportler wie Muhammad Ali. Genie-Kult ist nicht zuletzt auch Religionsersatz.
Hinter diesem Kult verbirgt sich jedoch ein tiefes menschliches Bedürfnis: Wir brauchen Vorbilder, um uns in unserem Leben zu orientieren. Sie sind Teil unserer Identität, sagen uns, wer wir sind oder sein könnten. Daher ist es verständlich, dass wir jenen Personen Respekt, Dankbarkeit, ja Bewunderung zollen, die Außergewöhnliches geleistet haben, deren Werke uns ergreifen, deren Gedanken uns inspirieren, deren Kämpfe für eine bessere Welt uns zu eigenem Handeln anregen. Jedoch sollte die Bewunderung nicht in Wunderglauben umschlagen. Daher sollten wir uns davor hüten, unsere Vorbilder zu Halbgöttern zu verklären, die in ganz eigenen, »heiligen« Sphären jenseits des »Menschlich-Allzumenschlichen« schweben. Denn natürlich waren auch sie bloß Menschen aus Fleisch und Blut. Was Personen wie da Vinci, Einstein oder Beethoven für die Nachwelt zu etwas so »Besonderem« macht, verdankt sich, wie wir noch sehen werden, keiner »überhistorischen individuellen Größe«, sondern einem profanen historischen Zufall: Sie waren mit ihren jeweiligen Eigenschaften genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Influencer für ein zeitgemäßes Weltbild
Ich werde in diesem Buch zehn Personen vorstellen, von denen ich mir wünschen würde, sie könnten eine größere Reichweite entfalten als Cristiano Ronaldo oder Donald Trump. Die meisten von ihnen lebten im 19. und 20. Jahrhundert. Einer starb vor gerade einmal einem Vierteljahrhundert, ein anderer schon vor mehr als zwei Jahrtausenden. Ich habe sie nicht deshalb ausgewählt, weil sie die »größten Genies aller Zeiten« sind (die vorangegangenen Ausführungen sollten klargestellt haben, wie unsinnig solche Rankings sind), sondern weil ich meine, dass sie Gedanken formuliert haben, die uns in besonderer Weise dabei helfen können, ein zeitgemäßes Weltbild zu entwickeln, mit dessen Hilfe wir die Probleme der Menschheit im »Anthropozän«, dem »geologischen Zeitalter der Menschheit«, rationaler angehen können.
Kritiker*innen werden zweifellos monieren, dass meine »10 Influencer für eine bessere Welt« überwiegend »alte weiße Männer« sind. Tatsächlich findet sich unter ihnen nur eine einzige Frau – und sie alle stammen zudem auch noch aus dem westlichen Kulturkreis! Dies lädt zu Missverständnissen ein, die ich gern aus dem Weg räumen möchte (auch wenn ich befürchte, dass dies in einigen Fällen ein hoffnungsloses Unterfangen sein dürfte).
Zunächst einmal: Die Auswahl besagt natürlich keineswegs, dass Männer begabter sind als Frauen oder Europäer talentierter als Asiaten oder Afrikaner.[8] Sie belegt nur, dass europäische Männer bis ins 20. Jahrhundert höhere Chancen hatten, Werke hervorzubringen, die noch nach ihrem Tod von Bedeutung sind. Unabhängig davon kann kein Zweifel daran bestehen, dass es Menschen anderer Herkunft und anderen Geschlechts gegeben hat, die ähnlich talentiert waren wie Darwin, Marx oder Einstein. Letztere aber hatten den Vorteil, mit ihren Eigenschaften »zur richtigen Zeit am richtigen Ort« zu sein, ansonsten wären auch sie längst vergessen.
Für Frauen gab es in der Vergangenheit für solchen Nachruhm meist weder die »richtige Zeit« noch den »richtigen Ort«. Welcher Schaden daraus entstanden ist, dass die Hälfte der Menschheit über so lange Zeit intellektuell ausgegrenzt wurde, lässt sich schwer ermessen. Zweifellos könnten wir uns heute an sehr viel mehr bedeutenden Künstlerinnen, Philosophinnen und Wissenschaftlerinnen erfreuen, hätten patriarchale Verhältnisse Frauen nicht über Jahrhunderte daran gehindert, ihre Potenziale zu entfalten.
Der geringe Frauenanteil unter »meinen Influencern« lässt sich also leicht erklären – doch warum stammen sie alle aus dem westlichen Kulturkreis? Verbirgt sich dahinter nicht ein »Kultur-Bias« (eine kulturell bedingte Wahrnehmungsverzerrung), wenn nicht sogar eine unverhohlene Form von »Kulturimperialismus«? Nun, so etwas ist nie auszuschließen, auch wenn man sich darum bemüht. Sicher ist allerdings, dass es in diesem Buch nicht darum geht, die Leistungen, die in anderen Kulturen erbracht wurden (man denke nur an das chinesische oder das altägyptische Reich), in irgendeiner Weise herabzuwürdigen. Es sollte klar sein, dass »Humanismus und Aufklärung« keineswegs »exklusive Kulturgüter des Westens« sind (wie oft behauptet wird), sondern dass es sich hierbei um ein »Weltkulturerbe der Menschheit« handelt, an dem Männer und Frauen aller Zeiten und aller Kontinente mitgewirkt haben.[9]
Dennoch dürfen wir nicht ignorieren, dass es vom 18. bis zum 20. Jahrhundert einen außergewöhnlichen Hotspot der intellektuellen, künstlerischen und technologischen Entwicklung gegeben hat – und der lag nun einmal in Westeuropa und Nordamerika![10] Für begabte Menschen (vor allem Männer) der Bildungsschicht war dies genau die richtige Zeit und der richtige Ort, um revolutionär neue Perspektiven zu entwickeln, die das traditionelle Weltbild aus den Angeln heben sollten.
Einige Jahrhunderte zuvor hätte man »dem Westen« eine solche Vorreiterrolle kaum zugetraut, denn vom 9. bis zum 13. Jahrhundert lag der »kulturelle Hotspot der Menschheit« im Osten.[11] Während unter islamischer Herrschaft Gelehrte wie Al-Razi (864–925), Ibn al-Haitam (um 964–1039) oder Ibn Sina (980–1037) relativ frei forschen konnten und zu außergewöhnlichen Erkenntnissen kamen, befand sich das christliche Europa in einem verhängnisvollen kulturellen Stillstand. Erst mit der Renaissance (der »Wiedergeburt« Europas, die mit der Wiederentdeckung antiker, vorchristlicher Schriften einherging) konnte sich der Westen allmählich aus der religiösen Umklammerung befreien. Die fast gleichzeitige Erfindung des modernen Buchdrucks durch Johannes Gutenberg (um 1400–1468) sorgte dafür, dass neue Sichtweisen immer effektiver verbreitet werden konnten. Durch Flugschriften und Bücher, später auch durch Zeitungen und Magazine, wurden immer größere Bevölkerungsteile erreicht und in den »transformativen Kreislauf des Wissens«[12] eingebunden, was die kulturelle Evolution in Europa enorm beschleunigt hat.
Mitte des 18. Jahrhunderts war die »kritische Masse« an gebildeten Menschen (vornehmlich männlichen Geschlechts) erreicht, die notwendig ist, um revolutionäre neue Erkenntnisse zu entwickeln. Denn: »Ein Kopf denkt nie allein«, wie es der Schriftsteller Karlheinz Deschner einmal formuliert hat.[13] Nirgends wird dies so deutlich wie auf dem Gebiet der Wissenschaft. Auf einer einsamen Insel wären weder die Evolutionstheorie noch die Relativitätstheorie entstanden. Es bedarf eines reichen Reservoirs an Erkenntnissen und eines unablässigen Austauschs von Argumenten, um große Ideen zu gebären.
Auf den Schultern von Riesen
So originell uns die »großen Denkerinnen und Denker der Menschheit« auch erscheinen mögen – sie alle waren abhängig von dem intellektuellen Umfeld, das sie umgab, sowie von den Leistungen, die andere vor ihnen erbracht hatten. Isaac Newton (1643–1727) drückte dies einmal folgendermaßen aus: »Wenn ich weiter gesehen habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe.«[14]
Man könnte dies als Ausdruck einer übermäßigen Bescheidenheit deuten – schließlich war Newton, dem wir unter anderem die Bewegungsgesetze, das Gravitationsgesetz sowie die Erklärung des Lichtspektrums verdanken, einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten. Doch ging es Newton wirklich darum, sein Licht unter den Scheffel zu stellen? Hat er allen Ernstes geglaubt, dass seine Vorgänger ihn in wissenschaftlicher Hinsicht überragen würden, also im Gegensatz zu ihm »Riesen« waren, Gestalten von übermenschlicher Größe? Sicherlich nicht. Er wollte bloß aufzeigen, wie sehr seine eigenen Erkenntnisse auf dem aufbauten, was andere bereits vor ihm erkannt hatten.
Newton wusste, dass er seine Principia Mathematica nur auf der Basis der Vorarbeiten vieler gescheiter Köpfe verfassen konnte. Im Grunde führte er bloß weiter, was andere (unter anderem Galileo Galilei und Johannes Kepler) begonnen hatten. Dabei war er als Student und späterer Dozent am Trinity College in Cambridge genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Viele Erkenntnisse, für die Newton berühmt werden sollte, lagen damals so sehr in der akademischen Luft, dass es immer wieder zu erbitterten Prioritätsstreitigkeiten kam. So hatte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) die Infinitesimalrechnung zeitgleich mit Newton entwickelt, weshalb er die Urheberschaft für sich beanspruchte, während Robert Hooke (1635–1703) Newton bezichtigte, das Gravitationsgesetz von ihm gestohlen zu haben.
Was sich am Beispiel Newtons leicht aufzeigen lässt, trifft auf sämtliche Wissenschaftler*innen, Philosoph*innen und Künstler*innen der Geschichte zu: Sie alle waren weit weniger originell, als es aus der Ferne erscheinen mag, sondern in hochkomplexe Ursache-Wirkungs-Netze eingebunden, die sich in ihren Werken widerspiegelten. Hieraus lässt sich eine Einsicht ableiten, die dem »Geniekult« früherer Tage diametral entgegensteht. Pointiert formuliert: Kein Werk hat nur einen Schöpfer! Deshalb sollten wir die »bedeutenden Vertreter der Wissenschaft, Philosophie und Kunst« nicht als alleinige Urheber ihrer Werke betrachten, sondern vielmehr als letzte Glieder einer langen, komplexen Determinationskette, welche die Entstehung dieser Werke ermöglicht hat. Revolutionäre Erkenntnisse haben eine lange evolutionäre Vorgeschichte.
Das soll nicht heißen, dass Newton, Einstein, Darwin, Leonardo da Vinci oder Ludwig van Beethoven keine »faszinierenden Persönlichkeiten« waren (selbstverständlich waren sie das, sonst hätten sie ihre Werke kaum hervorbringen können). Aber es lag schlichtweg nicht in ihrer Hand, weniger faszinierend, weniger kreativ zu sein. Ihr Stil, ihre Meisterschaft, ihre Berühmtheit – all dies sind bei genauerer Betrachtung Resultate des sinnfreien Zusammenspiels von Zufall und Notwendigkeit.
Die Bescheidenheit, die Newton mit seiner berühmten Formulierung an den Tag legte, war somit keineswegs übertrieben, sondern Ausdruck einer tiefen Einsicht in die Natur der Dinge: Je genauer man nämlich hinschaut, desto klarer wird, wie sehr alle menschlichen Eigenschaften von Zufall und Notwendigkeit bestimmt sind. Und eben deshalb gibt es keinen vernünftigen Grund dafür, sich irgendetwas auf die Eigenschaften einzubilden, über die man verfügt. Nehmen wir als Beispiel das Merkmal einer »intellektuellen Hochbegabung«, das vielen »Genies« zugeschrieben wird: Wir wissen, dass hohe Intelligenz maßgeblich auf die zufällige Verschmelzung einer Eizelle mit einer Samenzelle zurückgeht, also auf ein Ereignis, das stattgefunden hat, als das »stolze Ich« noch längst nicht existierte. Daher wäre es absurd, sich als »Hochbegabter« über »Normalbegabte« erheben zu wollen. Mehr noch: »Wer meint, sich etwas auf seine Klugheit einbilden zu müssen, zeigt damit nur, dass er so klug gar nicht ist. Stolz auf Intelligenz ist kein Zeichen von Intelligenz.«[15]
Was für die Intelligenz gilt, gilt auch für andere Merkmale des Menschen. Schon geringfügige Änderungen unserer Anlagen und Erfahrungen würden uns zu anderen Menschen mit anderen Eigenschaften machen. Das trifft auf die »großen Wissenschaftler*innen, Philosoph*innen und Künstler*innen« ebenso zu wie auf »Otto Normalverbraucher«. Wären sie in eine andere Zeit oder in ein anderes Umfeld geboren worden, hätten sie nicht die Eigenschaften entwickelt, die wir an ihnen wertschätzen, und ihre Namen wären längst in Vergessenheit geraten.
Fassen wir zusammen: Dass weiße Männer größere Chancen hatten, bahnbrechende Erkenntnisse zu formulieren, als schwarze Frauen, ist nicht zuletzt den historischen Herrschaftsverhältnissen geschuldet. Was folgt daraus für die heutige Zeit? Sollten wir die Erkenntnisse von Darwin, Einstein & Co. ignorieren, weil sie in der Vergangenheit privilegiert waren? Sollten wir uns im Namen einer »interkulturellen Gender-Gerechtigkeit« nicht mehr auf sie berufen, wie es Vertreter*innen »kultursensibler« oder »diversitätsbetonter« Auffassungen fordern? Ganz gewiss nicht! Denn durch eine solche Maßnahme würden wir kein höheres Maß an Gerechtigkeit erzielen (die historischen Herrschaftsverhältnisse bleiben davon ja unberührt), sondern bloß ein höheres Maß an Irrationalität. Schließlich gehört es zu den Grundvoraussetzungen einer rationalen Debatte, zu akzeptieren, dass die Gültigkeit eines Arguments unabhängig davon zu bewerten ist, wer es geäußert hat.[16]
Das heißt nicht, dass wir den Aspekt der Diversität von Lebenserfahrungen vernachlässigen dürften. Im Gegenteil: Wir sollten anerkennen, dass wir allesamt in unserer Zeit und Kultur gefangen sind, was leider oft genug dazu führt, dass wir tradierte Vorurteile als solche nicht erkennen. Vor derartigen Wahrnehmungsverzerrungen sind selbst die brillantesten Köpfe der Menschheit nicht gefeit – wie etwa Nietzsches Äußerungen über »die Frauen« oder Darwins Ausführungen zu »den Wilden« zeigen. Zu Recht gelten diese Teile ihres Werks als obsolet. Dies ändert jedoch nichts daran, dass wir in diesen Werken ungemein wertvolle Einsichten finden können, die wir berücksichtigen sollten, wenn wir unseren Platz in dieser komplexen Welt bestimmen wollen.
Das Problem der kulturellen Demenz
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich in den letzten Jahren den Eindruck gewonnen habe, dass in der Flut der Informationen, die uns tagtäglich überschwemmt, relevantes Wissen verloren geht. Selbst in akademischen Kreisen scheinen viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen die Grundlagen des modernen Weltbildes kaum noch zu kennen, geschweige denn, dass sie wüssten, wem wir diese Grundlagen zu verdanken haben.
Diese »kulturelle Demenz« ist gefährlich, weil sie unsere Perspektive verengt. Tatsächlich lassen sich einige Probleme der Gegenwart klarer sehen, wenn man die reichen Erkenntnisse der Vergangenheit zu schätzen weiß. Andernfalls verliert man schnell die Orientierung und ist dazu verdammt, die gleichen Fragen immer und immer wieder neu zu diskutieren, obwohl die maßgeblichen Antworten schon vor Jahrzehnten, wenn nicht sogar vor Jahrhunderten gefunden wurden.
Vor zehn Jahren habe ich schon einmal einen Anlauf genommen, dem Prozess des kulturellen Vergessens entgegenzuwirken. Im Nachhinein denke ich, dass das damalige Buch (Hoffnung Mensch) vielleicht ein wenig überambitioniert war.[17] Deshalb werde ich mich hier auf jene Aspekte des modernen Weltbilds beschränken, von denen ich denke, dass wir sie im Kopf behalten sollten, wenn wir die Probleme der »Menschheit im Anthropozän« in rationalerer Weise angehen wollen. Zudem werde ich mich eines kleinen Tricks bedienen: Da die meisten Menschen sich mehr für Menschen interessieren als für Ideen, stehen im Zentrum der nachfolgenden zehn Kapitel die Lebensgeschichten jener Menschen, die meines Erachtens besonders relevante Einsichten für die heutige Zeit hervorgebracht haben.
Die Auswahl dieser Personen ist mir nicht leichtgefallen.[18] Sehr viel lieber hätte ich 50 statt nur 10 »Influencer« beschrieben, doch dies hätte den Umfang dieses Buches gesprengt. Letztlich ist die Auswahl aber auch gar nicht so entscheidend. Schließlich geht es in diesem Buch nicht um die »10 größten Genies der Menschheit«, sondern bloß um »10 Influencer für ein zeitgemäßes Weltbild«. Wenn sie in ihrem Leben »Großes« vollbracht haben, so nur deshalb, weil sie dabei auf die Leistungen unzähliger anderer Individuen zurückgreifen konnten, die über die Jahrtausende hinweg zum Fortschritt des menschlichen Erkenntnisvermögens beigetragen haben. (Wir erinnern uns: »Kein Werk hat nur einen Schöpfer!«)
Bevor wir nun in die Lebensgeschichten der »Influencer« eintauchen, noch zwei kurze Vorbemerkungen: Ich habe versucht, die zentralen Erkenntnisse meiner »Botschafter für eine klarere Weltsicht« möglichst einfach und verständlich darzustellen, ohne sie dabei zu verfälschen – was sich in einigen Fällen (etwa im Fall der Einstein’schen Relativitätstheorie) als eine echte Herausforderung erwiesen hat.[19] Zudem habe ich beschlossen, der aktuellen Debatte zur Dominanz alter weißer Männer gegenüber jungen schwarzen Frauen mit einem etwas unorthodoxen Sprachgebrauch zu begegnen. Inwiefern? Nun, ich habe mich redlich darum bemüht, es niemandem recht zu machen – weder strengen Genderist*innen noch strengen Anti-Genderisten. Und so wird man in diesem Buch sowohl das Gendersternchen als auch beide Geschlechterformen als auch das generische Maskulinum finden. Dies mag einige Leserinnen und Leser irritieren und vielleicht sogar erzürnen – aber ich finde, ein wenig Ambiguitätstoleranz tut uns allen gut …
Michael Schmidt-Salomon,
Frühjahr/Sommer 2023
1 Nichts ist beständiger als der Wandel
Charles Darwin und die Entdeckung der Evolution
»Mir ist, als gestände ich einen Mord […].« 1844 – mehr als fünf Jahre, nachdem er die grundlegenden Ideen zur Veränderung der Arten in seinem Notizbuch skizziert hat – bringt Charles Darwin (1809–1882) erstmals den Mut auf, sich einem Kollegen anzuvertrauen. Am Ende seines berühmten Briefes an den Botaniker Joseph Hooker (1817–1911) gibt er zu, sich »mit einem vermessenen Werke« zu beschäftigen. Er kenne »keinen Menschen, der es nicht töricht heißen würde«, doch inzwischen sei er »nahezu überzeugt […], dass die Spezies nicht unveränderlich sind […] Ich glaube, das einfache Mittel entdeckt zu haben […], durch das die Spezies so ausgezeichnet an verschiedene Zwecke angepasst sind. Sie werden nun stöhnen und bei sich denken, ›wem habe ich da geschrieben und meine Zeit vergeudet?‹. Noch vor fünf Jahren hätte ich das Gleiche gedacht […].«[20]
Zu Darwins Erleichterung zeigt sich Hooker eher interessiert als entrüstet. Und so baut Darwin den 35-seitigen Aufsatz, den er bereits 1842 zur »natürlichen Auslese« formuliert hat, zu einem 230-seitigen Manuskript aus. Schon im Juli 1844 ist der Text vollendet. Er enthält bereits alle zentralen Thesen sowie viele markante Formulierungen des bahnbrechenden Werks, das 15 Jahre später unter dem Titel Über die Entstehung der Arten das traditionelle Weltbild erschüttern wird. Doch Darwin scheut sich davor, seine »gefährliche Theorie« zu veröffentlichen. Also schließt er das Manuskript weg und weist seine Frau an, im Falle seines plötzlichen Todes einen kompetenten Experten mit der Herausgabe des Buchs zu beauftragen, wofür er 400 Pfund aus seinem Erbe vorsieht.[21]
Man muss sich vergegenwärtigen, was hier geschieht: Darwin hat gerade die vielleicht bedeutendste Theorie der gesamten Wissenschaftsgeschichte formuliert – doch er legt sie auf Eis und beschäftigt sich stattdessen acht lange Jahre (!) mit der Erforschung von Rankenfußkrebsen, denen er zwei dicke Bände widmet. Erst 1854 nimmt er die Arbeit an der Evolutionstheorie wieder auf, denkt aber noch immer nicht an eine Veröffentlichung. Dazu kommt es erst, als er 1858 von den Arbeiten des britischen Naturforschers Alfred Russel Wallace (1823–1913) erfährt. Dieser ist nämlich auf seinen Expeditionen zu ähnlichen Ergebnissen gelangt wie Darwin 20 Jahre zuvor, hat aber im Gegensatz zu Darwin keinerlei Hemmungen, seine Erkenntnisse umgehend zu publizieren.
Darwin steht unter Schock, da er befürchten muss, die Priorität für die Entwicklung der Evolutionstheorie zu verlieren. Dies allerdings wird im letzten Moment mithilfe eines »Gentleman-Agreements« (dank der Fairness von Wallace) verhindert: Darwins Vertraute Joseph Hooker und Charles Lyell (1797–1875), die ihren Freund immer wieder bedrängt hatten, seine Theorie zu publizieren, sorgen dafür, dass am 1. Juli 1858 nicht nur der maßgebliche Aufsatz von Wallace, sondern auch Darwins unveröffentlichte Schriften zur Evolutionstheorie in der Linnean Society of London vorgestellt werden.
Kurioserweise stößt der Vortrag, der das wissenschaftliche Weltbild eigentlich hätte erschüttern müssen, auf wenig Resonanz. Der Präsident der Linnean Society, der Zoologe Thomas Bell (1792–1880), meint in seinem Jahresrückblick sogar, 1858 habe es keine »auffallenden Entdeckungen« gegeben. Diese Einschätzung erweist sich jedoch schon wenig später als obsolet: Als Charles Darwins Buch Über die Entstehung der Arten am 24. November 1859 erscheint, schlägt es ein wie eine Bombe. Wohl kein Werk der Geschichte hat die Sicht des Menschen auf sich selbst und auf die Welt so schnell und so nachhaltig verändert. Schon zwei Tage vor dem offiziellen Erscheinungsdatum ist die Erstauflage vergriffen. In kürzester Zeit avanciert Darwins Theorie zu dem Gesprächsthema in gebildeten Kreisen, und es dauert nur wenige Jahre, bis das Konzept der evolutionären Veränderung der Arten internationale Anerkennung findet.
Warum also zögert Darwin so lange, seine Theorie zu veröffentlichen? Zwei Aspekte scheinen hierbei von besonderer Bedeutung zu sein: Zum einen ist Darwin ein äußerst vorsichtiger Forscher, der seine Theorie penibel belegen will, bevor er damit an die Öffentlichkeit geht. Zum anderen ist er sich der enormen Tragweite der Evolutionstheorie bewusst.[22] Daher befürchtet er nicht nur, durch eine voreilige Publikation seinen Ruf als Wissenschaftler zu ruinieren, er hat auch großen Respekt vor Angriffen von religiöser Seite. Denn Darwin weiß nur zu gut, dass seine Evolutionstheorie im Widerspruch zur christlichen Schöpfungslehre steht.
Anfangs hat er selbst Probleme, den weltanschaulichen Schock zu verarbeiten, der mit seiner Theorie einhergeht. Denn der junge Darwin versteht sich als »frommer Christ«. Auf Anraten seines Vaters hat er sogar Theologie studiert – mit dem Ziel, Geistlicher der Kirche von England zu werden. Noch auf seiner Expeditionsreise mit der Beagle ist Darwin felsenfest von den »Glaubenswahrheiten« des Christentums überzeugt, wie er sich in seiner Autobiografie von 1876 erinnert: »Ich weiß noch, wie etliche Schiffsoffiziere über mich lachten, weil ich die Bibel als unanfechtbare Autorität in einer Frage der Moral zitierte.«[23]
Selbst Jahre später, als er beginnt, die Theorie der natürlichen Auslese zu entwickeln, traut er sich kaum, das christliche Weltbild infrage zu stellen. Rational ist ihm zwar klar, dass er sich zwischen Evolution und Schöpfung entscheiden muss, emotional aber will er dies lange nicht wahrhaben, wie er in seinen Lebenserinnerungen berichtet: »Ich war aber gar nicht willens, meinen Glauben aufzugeben.«[24] Doch die Zweifel mehren sich. Charles Darwin kann die Diskrepanz zwischen dem, was er weiß, und dem, was er glauben sollte, nicht länger verdrängen. Allmählich wird ihm zur Gewissheit, dass das, was er in der Natur entdeckt, mit den Lehren der Religion nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Darwin resümiert: »So beschlich mich der Unglaube ganz langsam, am Ende aber war er unabweisbar und vollständig.«[25]
Dies allerdings kann er erst in seiner Autobiografie, wenige Jahre vor seinem Tod, so freimütig zugeben. In den Jahrzehnten zuvor wird er von heftigen Gewissensbissen geplagt. Obgleich er schon 1844 davon überzeugt ist, dass seine Theorie einen »beträchtlichen Schritt für die Wissenschaft« bedeuten würde,[26] hadert er mit der Frage, ob er sie überhaupt veröffentlichen dürfe. Schließlich ist ihm bewusst, wie schwer es ihm selbst gefallen ist, die weitreichenden Konsequenzen der Evolutionstheorie zu verdauen – wie viel schwerer musste es da erst allen anderen fallen, die nicht mit eigenen Augen gesehen haben, was er gesehen hat?! Hatte er das Recht, eine Theorie zu veröffentlichen, die eine fundamentale Glaubenskrise auslösen könnte? Durfte er den Menschen die Illusion nehmen, die »Krone« einer gut gemeinten, gut gemachten »göttlichen Schöpfung« zu sein?
Man stelle sich vor, was es bedeutet, eine solch weitreichende Idee jahrelang mit sich herumzutragen, ohne es der Umwelt mitteilen zu können! Ist es Zufall, dass sich Darwins Gesundheitszustand kurz nach der ersten Skizzierung der Selektionstheorie so dramatisch verschlechtert? Vieles spricht dafür, dass Darwins ständige Übelkeit, seine Schlaflosigkeit, seine permanenten Schwindelgefühle, Kopfschmerzen und Schwächezustände nicht zuletzt auch psychisch bedingt sind.[27] Die Sorge um die Konsequenzen, die sich aus der Veröffentlichung der Evolutionstheorie ergeben könnten, schlägt ihm so sehr auf den Magen, dass ein normales Leben kaum mehr möglich ist.
Diesem inneren Konflikt kann Darwin tragischerweise auch zu Hause nicht entrinnen. 1839 hat er seine Cousine Emma Wedgwood geheiratet, die ihren kränkelnden Ehemann liebevoll umsorgt. Doch bei all ihren Vorzügen, die Darwin sehr zu schätzen weiß, ist Emma eine gläubige, wenn auch liberale Christin, was seine Gewissensbisse verstärkt. Möglicherweise schiebt er die Veröffentlichung seiner Evolutionstheorie auch deshalb so lange hinaus, um seine Ehe nicht zu gefährden.[28] Es sind durchaus nicht immer tiefsinnige theoretische Erwägungen, die das Denken und Handeln eines Forschers bestimmen, sondern auch die scheinbaren Banalitäten des Alltags.
Was Darwins Alltag betrifft: Ab 1842 ist Down House, ein Anwesen, 25 Kilometer von London entfernt, das Zentrum seiner Welt. 40 Jahre lang wird Charles Darwin seine Zeit in der Abgeschiedenheit dieses Landsitzes verbringen, fernab vom hektischen London, fernab auch von den hitzigen Debatten, die seine Werke auslösen sollten. Schon mit 33 Jahren zieht er sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Die Kämpfe um die Durchsetzung der Evolutionstheorie überlässt er anderen, vor allem Hooker, Wallace und Thomas Henry Huxley (1825–1895). Bis zu seinem Tod 1882 wird er Down House nur in Ausnahmefällen verlassen. Wenn man die äußeren Lebensumstände betrachtet, scheint der Darwin der zweiten Lebenshälfte kaum noch etwas gemein zu haben mit jenem jungen Mann, der sich mit 22 Jahren auf das Abenteuer eingelassen hat, die exotischsten Orte der Welt mit einem Segelschiff zu erkunden. Und doch wäre der eine ohne den anderen nicht denkbar.[29]
Die Reise mit der Beagle
Charles Darwin wird am 12. Februar 1809 in eine vermögende britische Ärzte- und Forscherfamilie hineingeboren. Sowohl seinem Großvater Erasmus Darwin (1731–1802) als auch seinem Vater Robert Darwin (1766–1848) ist zuvor die Ehre zuteil geworden, in den Gelehrtenkreis der Royal Society aufgenommen zu werden. Eine vergleichbare akademische Laufbahn wird nun auch von Charles erwartet. Zwar begeistert sich der jüngste Sohn der Familie für die Naturforschung, doch seine schulischen und akademischen Leistungen lassen zu wünschen übrig. Als sich herausstellt, dass Charles das Medizinstudium nicht schafft – als Notfallplan wechselt er in die Theologie –, ist dies eine herbe Enttäuschung für den Vater. In den Augen von Robert Darwin ist Charles ein akademischer Versager, dem es vielleicht nicht an Intelligenz mangelt, wohl aber an der Motivation, etwas wirklich Bedeutsames zu leisten.
Dies ändert sich jedoch, als der junge Mann von einer Expedition erfährt, die nicht nur seine Karriere, sondern sein gesamtes Weltbild in eine radikal andere Richtung lenken wird: »Die Reise mit der Beagle war das wichtigste Ereignis meines Lebens und hat meine ganze Berufslaufbahn bestimmt«, bekennt Darwin in seiner Autobiografie – und fügt hinzu, dass es dazu wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre, wenn sein Onkel (und späterer Schwiegervater) Josiah Wedgwood II. ihn im August 1831 nicht großzügigerweise nach Hause gefahren hätte.[30] Denn während der Fahrt berichtet der junge Charles, sein Vater habe ihm untersagt, das Angebot einer Südsee-Expedition anzunehmen, woraufhin Wedgwood kurzerhand mit Robert Darwin spricht und ihn vom Gegenteil überzeugt.
Dass Darwin die Reise auf der Beagle im Dezember 1831 antreten kann, verdankt sich tatsächlich einer ganzen Reihe von Zufällen: Da ist beispielsweise Robert FitzRoy (1805–1865), der depressiv veranlagte Kapitän des Schiffs, der nach einem »Gentleman-Naturforscher« sucht, der ihn nicht nur bei den geologischen Vermessungsarbeiten unterstützen soll, sondern mit dem er sich auf der langen Reise auch gepflegt unterhalten kann. Hiervon erfährt unter anderem John Stevens Henslow (1796–1861), der Gründer des Botanischen Gartens der Universität Cambridge. Zunächst überlegt sich der Botanik-Professor, selbst die Fahrt mit der Beagle anzutreten, gibt diese Idee aber nach der entsetzten Reaktion seiner Frau sofort wieder auf. Dies wiederum ist die Chance für den 22-jährigen Theologie-Absolventen Charles Darwin, der auf eine große, abenteuerliche Expedition hofft, bevor er sich in dem beschaulichen Leben eines anglikanischen Pfarrers einrichtet.
Durch die Vermittlung eines Großcousins hat sich Darwin mit Henslow angefreundet, der in ihm den perfekten »Gentleman-Naturforscher« sieht. Alles scheint wie am Schnürchen zu laufen, denn die Empfehlungsschreiben aus Cambridge sind eindeutig. Und so sitzt Darwin bereits auf gepackten Koffern, als er erfährt, dass FitzRoy in der Zwischenzeit einen anderen Kandidaten gefunden hat, der ihm als Reisebegleiter mehr zusagt. Erst als der Wunschkandidat des Kapitäns im letzten Moment abspringt, wird der Weg frei für Darwin, an einer Expedition teilzunehmen, die wie kaum eine andere in die Wissenschaftsgeschichte eingehen wird.
Nach mehrmonatiger Verzögerung sticht die H. M. S. Beagle am 27. Dezember 1831 in See. Darwin wird sofort seekrank, erholt sich aber schnell. Schon im Januar 1832 konstruiert er ein engmaschiges Schleppnetz, mit dem er Kleinstorganismen, die Jahrzehnte später als »Plankton« bezeichnet werden, einfängt. Unter dem Mikroskop entdeckt er ihren Formenreichtum, der ihn beeindruckt. Vor allem aber studiert er das Lehrbuch der Geologie seines späteren Vertrauten Charles Lyell, das ihm FitzRoy vor der Abfahrt geschenkt hat. Lyells These, dass sich die heutige geologische Form der Erde über einen langen, langsamen, graduellen Prozess entwickelt habe,[31] ist zu diesem Zeitpunkt noch umstritten. Doch schon bei der ersten Station der Reise – am 16. Januar 1832 erreicht die Beagle die kapverdische Insel Santiago – macht Darwin eine Entdeckung, die Lyells Theorie zu bestätigen scheint: In den Klippen der Insel verläuft etwa 14 Meter über dem Meeresspiegel ein waagerechtes Muschelschalenband, was bedeutet, dass sich dieses Hochplateau vor langer Zeit am Meeresboden befunden haben muss.[32]
Diese Entdeckung verstärkt Darwins geologisches Interesse. Tatsächlich sind seine geologischen Notizen am Ende der Reise sehr viel umfangreicher als seine biologischen Berichte, was wohl auch auf den Auftrag der Beagle zurückzuführen ist, unbekanntes Terrain zu vermessen. Von der Vulkaninsel Santiago geht die Reise weiter an die südamerikanische Ostküste. Ende Februar betritt Darwin erstmals das brasilianische Festland. Er ist bezaubert von der Artenvielfalt des tropischen Regenwaldes, aber auch schockiert von den Folgen der Sklaverei – ein heftiges Streitthema zwischen dem progressiven Darwin und dem konservativen FitzRoy.
Im September 1832 stößt Darwin in Argentinien auf seine ersten Fossilien, darunter gut erhaltene Überreste zweier Riesenfaultiere. Drei Jahre später, nach langwierigen Expeditionen in Argentinien, Uruguay, Chile und Peru, begibt er sich im September 1835 erstmals auf die berühmten Galapagosinseln, die 1978 – nicht zuletzt wegen seines Besuchs – in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen werden. Darwin sammelt hier zahlreiche Pflanzen- und Tierexponate und ist fasziniert von den auf den Inseln lebenden Riesenschildkröten – den Vögeln allerdings, die später seinen Namen tragen sollten (»Darwinfinken«), schenkt er zu diesem Zeitpunkt keine besondere Beachtung.
Ursprünglich sollte die Reise der Beagle nur zwei Jahre dauern, tatsächlich aber ist sie knapp fünf Jahre unterwegs. Während der Fahrt hat Darwin neben seinen zoologischen und geologischen Notizen ein fast 800 Seiten starkes Reisetagebuch verfasst sowie zwölf Kataloge zu seinen Sammlungen angelegt, die am Ende rund 4500 Exponate enthalten. Als das Schiff (nach weiteren Zwischenstationen unter anderem in Neuseeland, Australien und Südafrika) am 2. Oktober 1836 in den englischen Hafen Falmouth einläuft, ist der 27-jährige Darwin bereits ein bekannter Mann in wissenschaftlichen Kreisen. Denn sein Mentor Henslow hat 1835 Auszüge aus den Briefen, die Darwin ihm während der Expedition geschrieben hat, in der renommierten Cambridge Philosophical Society vorgetragen und in Form eines kleinen Buches mit dem Titel Letters on Geology (»Briefe zur Geologie«) veröffentlicht, das er unter namhaften Forschern verbreitet.
Die Letters on Geology beeindrucken auch Charles’ Vater, der seinem Sohn keine akademische Karriere zugetraut hatte. Robert Darwin erhält sogar Besuch von dem angesehenen Cambridge-Professor Adam Sedgwick (1785–1873), einem der Begründer der modernen Geologie, der ihm versichert, Charles sei »ein Platz unter den führenden Wissenschaftlern sicher«.[33] Mit großem Wohlwollen registriert Darwin senior, dass sein Sohn nach der Rückkehr der Beagle als »wissenschaftliche Berühmtheit« gefeiert und von den größten Naturforschern umgarnt wird. Unter diesem Eindruck gibt der vermögende Robert Darwin seinem Sohn das Startkapital, um seine wissenschaftliche Arbeit privat fortsetzen zu können, statt (wie ursprünglich geplant) eine Stelle als anglikanischer Pfarrer antreten zu müssen.
Im Januar 1837 schenkt Charles Darwin der Zoologischen Gesellschaft London unter anderem 450 Vögel, die er während der Reise mit der Beagle gesammelt hat. Deren Kurator, der Ornithologe John Gould (1804–1881), erkennt schnell, dass die von Darwin auf den Galapagosinseln eingesammelten Finken eine eigenständige Gattung bilden, die Gould in zunächst 12, später 13 Arten unterteilt, die offenkundig gut an die jeweiligen Lebensbedingungen auf den unterschiedlichen Inseln angepasst sind. Dieser Befund untermauert Darwins eigene Beobachtungen zu den Spottdrosseln auf den Galapagosinseln, die er in seinem Reisetagebuch notiert hat. Die empirischen Belege scheinen nun mehr und mehr dafür zu sprechen, dass es einen fließenden Übergang zwischen den Arten gibt.
Goulds Beiträge bestärken Darwin in seinem Forschungsvorhaben, einen sehr viel stärkeren Eindruck macht auf ihn jedoch ein alter Aufsatz des britischen Ökonomen Thomas Malthus (1766–1834), den Darwin im September 1838 liest. Malthus hat in seinem berühmten Essay on the Principle of Population aus dem Jahr 1798 aufgezeigt, dass das Bevölkerungswachstum einer Gesellschaft notwendigerweise durch die jeweils vorhandenen Ressourcen begrenzt wird. 40 Jahre später kommt Darwin auf die Idee, diese Theorie aus der klassischen Nationalökonomie auf die Verhältnisse in der Natur zu übertragen – und hat augenblicklich ein Kernelement seiner Theorie gefunden, mit dessen Hilfe er die Veränderung der Arten wissenschaftlich erklären kann.
Der Wandel der Arten
Darwin ist keineswegs der erste Gelehrte, der vom allmählichen Wandel der biologischen Arten ausgeht. Schon der altgriechische Philosoph Anaximander (etwa 610–547 v. u. Z.) hat vermutet, dass die ersten Menschen aus Tieren hervorgegangen sind. Bei Epikur (etwa 341–271 v. u. Z.) beziehungsweise dessen Anhänger Lukrez (etwa 99–55 v. u. Z.) findet man sogar eine recht modern wirkende Erklärung für die Ursachen dieses Wandels, wovon später im Buch noch die Rede sein wird. Doch mit der Durchsetzung des Christentums werden solche Spekulationen lebensgefährlich, wie das Schicksal Giordano Brunos (1548–1600) zeigt, der die Ideen von Epikur und Lukrez aufgreift und für diese »ungeheuerliche Anmaßung« am 17. Februar 1600 als Ketzer auf dem Scheiterhaufen in Rom verbrannt wird.
Erst im Zeitalter der Aufklärung wird es möglich, ausgefeilte Evolutionstheorien zu formulieren. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Jahr 1809 – nicht nur, weil Charles Darwin 1809 geboren wird, sondern auch, weil Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) in diesem Jahr seine Philosophie zoologique vorlegt.[34] Lamarck beschreibt in seinem Buch die allmähliche Veränderung der Arten, führt diese allerdings auf eine dem Leben innewohnende Tendenz zur »Vervollkommnung« zurück. Ein solches Erklärungsmodell lehnt Darwin jedoch ab. Er ist zu sehr von dem erfahrungsorientierten Denken des schottischen Philosophen, Ökonomen und Historikers David Hume (1711–1776) geprägt, als dass er dem Leben einen »Vervollkommnungsdrang« unterstellen könnte, der sich in der Natur nicht beobachten lässt.
Indem Darwin die Erfahrungen, die er auf der Reise mit der Beagle gemacht hat, mit den ökonomischen Einsichten zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums von Malthus kombiniert, entwickelt er eine bestechend einfache, aber äußerst plausible Theorie, um den Wandel der Arten wissenschaftlich nachvollziehbar zu machen. Hierzu verbindet er fünf verschiedene Theoriebausteine auf elegante Weise miteinander, nämlich:
Die
Abstammungslehre:
Darwin zeigt auf, dass alle heute existierenden Arten miteinander verwandt sind, da sie, wie er annimmt, allesamt von primitiven Urformen abstammen, die vor unendlich langer Zeit entstanden sind.
[35]
Das
Prinzip der natürlichen Auslese:
Da die Organismen mehr Nachkommen produzieren, als unter dem Diktat begrenzter Ressourcen überleben können, kommt es in der Natur zu einem »Kampf ums Dasein«, aus dem nur jene Lebensformen erfolgreich hervorgehen, die an die jeweiligen Lebensbedingungen hinreichend angepasst sind.
Die
Lehre von der Veränderung der Arten:
Da sich die Umweltbedingungen immer wieder ändern (etwa durch Klimaveränderungen oder das Auftreten neuer Fressfeinde), stehen die Arten unter permanentem Anpassungsdruck, weshalb sie nicht konstant bleiben können, sondern sich umformen müssen. Arten, die sich an veränderte Umstände nicht anpassen können, sind laut Darwin dem Untergang geweiht, womit er erklären kann, weshalb so viele Spezies (etwa die Riesenfaultiere, deren Fossilien er 1832 in Argentinien gefunden hat) bereits ausgestorben sind.
Das
Modell des Gradualismus:
Alle evolutionären Veränderungen vollziehen sich langsam in unzählig vielen, kleinen Schritten. Da die Natur keine Sprünge macht, können von heute auf morgen weder neue Organe noch neue Arten entstehen.
Das
Konzept der Artbildung und Artvermehrung:
Populationen derselben Art können sich durch einen unterschiedlichen Anpassungsdruck, der auf sie wirkt, mit der Zeit so weit voneinander entfernen, dass ihre Mitglieder sich nicht mehr untereinander fortpflanzen können. So können – wie bei den Darwinfinken auf den Galapagosinseln – aus einer Art mehrere Tochterarten hervorgehen, aus denen möglicherweise wiederum neue Arten entstehen, die sich von der Ursprungsart immer weiter entfernen – was
summa summarum
die große Vielfalt der Lebensformen auf der Erde erklärt.
Mithilfe dieser fünf einfachen Theoriebausteine kann Darwin zeigen, dass es weder einer »göttlichen Absicht« noch eines Lamarck’schen »Vervollkommnungsdrangs« bedarf, um die Mannigfaltigkeit des Lebendigen hervorzubringen. Dies alles lässt sich wissenschaftlich elegant auf ein sinnblindes, natürliches Selektionsprinzip zurückführen, das aufgrund der unterschiedlichen Fortpflanzungsfähigkeit der Organismen bestimmte Eigenschaften fördert und andere eliminiert. Darwin selbst fasst diese ernüchternde Erkenntnis am Ende seines Buchs Über die Entstehung der Arten wie folgt zusammen: »So geht aus dem Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod unmittelbar die Lösung des höchsten Problems hervor, das wir zu fassen vermögen, die Erzeugung immer höherer und vollkommenerer Tiere.«[36]
Dass Darwin mit den »höheren und vollkommeneren Tieren« gerade auch Homo sapiens meint, ist Eingeweihten sofort klar. Vor allem sein Mitstreiter Thomas Henry Huxley, der aufgrund seiner scharfzüngigen Rhetorik den Beinamen »Darwins Bulldogge« erhält, lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass auch die Entstehung des modernen Menschen evolutionstheoretisch gedeutet werden muss. Schon im Juni 1860, wenige Monate nach dem Erscheinen von Darwins Buch, kommt es in Oxford zu einer berühmten Kontroverse zwischen Huxley und dem Bischof von Oxford, Samuel Wilberforce (1805–1873). Angeblich fragt dabei der Bischof den Biologen, ob er lieber väterlicher- oder mütterlicherseits von Affen abstamme, worauf dieser antwortet, dass er sich für einen Affen als Vorfahren nicht schäme, wohl aber für einen gebildeten Mann, der wissenschaftliche Erkenntnisse ins Lächerliche ziehe.[37]
Knapp drei Jahre später veröffentlicht Thomas Huxley den schmalen Band Evidence as to Man’s Place in Nature (»Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur«), der keinerlei Zweifel mehr an der Abstammung des Menschen aufkommen lässt.[38] Darwin selbst hält sich in dieser heiklen Angelegenheit auffällig zurück. Statt sich mit dem Thema zu beschäftigen, das den Menschen unter den Nägeln brennt, legt er 1868 ein zweibändiges Mammutwerk über Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestikation vor, das zwar vor Fakten strotzt, aber die Erwartungen vieler Leserinnen und Leser enttäuscht.
Einige Stimmen munkeln schon, Darwin habe nicht den Mut, sich zur Abstammung des Menschen explizit zu äußern. Doch sie täuschen sich gewaltig. Denn 1871 erscheint Darwins zweites evolutionstheoretisches Hauptwerk Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl, das alles in den Schatten stellt, was zuvor zu diesem Thema geschrieben wurde.
Survival of the Sexiest
Es scheint, als habe Darwin im Alter von 63 Jahren seine Hemmungen verloren. In bemerkenswerter Offenheit zeigt er die Tatsachen auf, welche die »Abstammung des Menschen von einer niederen Form« belegen, und setzt die »Geisteskräfte des Menschen« in Beziehung zu den Fähigkeiten anderer Tiere. Dabei führt er die »moralischen Gefühle« des Menschen unter anderem auf soziale Instinkte sowie Gruppenbeziehungen zurück, die man in ähnlicher Form bereits im Tierreich vorfindet. Anders als beispielsweise Alfred Russel Wallace erklärt Darwin selbst die höchsten geistigen Eigenschaften des Menschen konsequent aus der Natur heraus. Dabei unterschlägt er keineswegs die Bedeutung der kulturellen Evolution (also die Entwicklung immer komplexerer Gesellschaften, die das reale Erscheinungsbild der Menschen bestimmen), aber für althergebrachte metaphysische Konzepte, wie eine von »Gott« geschaffene »unsterbliche Seele« des Menschen, gibt es in Darwins wissenschaftlichem Erklärungsmodell keinen Platz mehr.
Dies allein ist schon starker Tobak für das 19. Jahrhundert, doch Darwin setzt noch einen drauf: Wie bereits der Titel des Buchs andeutet, führt er die Evolution des Menschen wesentlich auf »geschlechtliche Zuchtwahl« zurück, sprich: auf die sexuellen Präferenzen unserer Vorfahren. Dass ausgerechnet Sex (!) etwas mit der Entwicklung zum Menschen zu tun haben könnte, geht im viktorianischen London des Jahres 1871 vielen zu weit (nicht ohne Grund trägt eine Erfolgskomödie, die genau 100 Jahre nach dem Erscheinen von Darwins Werk in London uraufgeführt wird, den Titel »No Sex Please, We’re British«!).
Darwin lässt sich von den puritanischen Vorbehalten seiner Zeitgenossen allerdings nicht beirren. Schon früh hat er erkannt, dass das Prinzip der natürlichen Auslese nicht ausreicht, um den Formenreichtum in der Natur zu erklären. Denn ginge es in der Evolution tatsächlich nur um das Überleben der Bestangepassten (»Survival of the Fittest«), sähe unsere Welt deutlich trister aus: Es gäbe in ihr keine Paradiesvögel mit prächtigem Gefieder, keine Löwen mit mächtigen Mähnen, keinen Gesang der Nachtigall – und auch keine menschliche Kunst. Das reiche Spiel der Farben und Formen in der Natur, die virtuosen Gesangs- und Nestbaukünste mancher Vögel, werden nämlich nicht aus dem »Kampfe der Natur, aus Hunger und Tod« geboren, sondern resultieren vielmehr aus dem luxuriösen Verschwenden der Kräfte beim Liebeswerben um geeignete Sexualpartner*innen – was im Tierreich vor allem die männlichen Exemplare unter Druck setzt, da die Weibchen in der Regel das Privileg der Partnerwahl haben.[39]
Darwin weiß: Damit sich ein Organismus fortpflanzen kann, genügt es nicht, im Kampf ums Dasein lange genug zu bestehen (etwa Räubern zu entfliehen oder Beute zu erhaschen), er muss auch attraktiv auf potenzielle Geschlechtspartner wirken. Daher wird das Erscheinungsbild einer Spezies nicht zuletzt auch von den Präferenzen der Partnerwahl bestimmt. So können »weibliche Vögel, indem sie tausende Generationen hindurch den melodiereichsten und schönsten Männchen […] bei der Wahl den Vorzug geben, […] einen merklichen Effekt bewirken«, wie Darwin bereits 1859 in seinem Bestseller Über die Entstehung der Arten ausführt.[40]
Näher geht er im Artenbuch nicht auf das Prinzip der geschlechtlichen Zuchtwahl ein – vermutlich weil er ohnehin mit massiver Gegenwehr rechnet und die viktorianische Leserschaft nicht zusätzlich noch durch eine Darlegung der fundamentalen Bedeutung der Sexualität brüskieren will. In Die Abstammung des Menschen nimmt Darwin aber kein Blatt mehr vor den Mund: Ausführlich schildert er anhand zahlreicher Fallbeispiele, wie sich im Verlauf der Zeit die Eigenschaften unterschiedlichster Arten durch die geschlechtliche Partnerwahl verändert haben. In der Natur, so macht er klar, geht es eben nicht nur um das Prinzip der natürlichen Selektion, sondern auch um das Prinzip der sexuellen Selektion. Pointiert formuliert: Die Evolution wird nicht nur vom »genetischen Überleben der Bestangepassten« bestimmt (»Survival of the Fittest«), sondern auch vom »genetischen Überleben der Attraktivsten« (»Survival of the Sexiest«).
Gerade bei der Evolution des Menschen hat die sexuelle Selektion, so Darwin, eine herausragende Rolle gespielt. Er meint sogar, »dass von allen Ursachen, welche zu den Verschiedenheiten in der äußeren Erscheinung zwischen den Rassen des Menschen und in einem gewissen Grade auch zwischen dem Menschen und den niederen Tieren geführt haben, die geschlechtliche Zuchtwahl bei Weitem die wirksamste gewesen ist«.[41] Verantwortlich ist die sexuelle Selektion dabei nicht nur für das Auftreten körperlicher Merkmale (etwa für die Nacktheit der Haut oder die Fülle des Kopfhaares), sondern auch für die Entstehung der besonderen kognitiven, emotionalen wie künstlerischen Fähigkeiten des Menschen.
Folgt man Darwin, so ist nicht der Krieg »der Vater aller Dinge«, wie es Heraklit (um 550–480 v. u. Z.) einst formuliert hat, sondern der Fortpflanzungstrieb. Darwin selbst drückt es folgendermaßen aus: »Mut, Kampfsucht, Ausdauer, Kraft und Größe des Körpers, Waffen aller Arten, musikalische Organe, sowohl vokale als instrumentale, glänzende Farben und ornamentale Anhänge, Alles ist indirekt von dem einen oder dem andern Geschlechte erlangt worden, und zwar durch den Einfluss der Liebe und Eifersucht, durch die Anerkennung des Schönen im Klang, in der Farbe oder der Form.«[42]
Für seine Zeitgenossen ist dies eine doppelte Provokation – nicht nur weil Darwin der Sexualität (Jahrzehnte vor Sigmund Freuds Psychoanalyse und Magnus Hirschfelds Begründung der Sexualwissenschaft) eine fundamentale Rolle bei der Entstehung des Menschen zuweist, sondern auch weil er verdeutlicht, dass die »Herren der Schöpfung« in ihren zentralen Eigenschaften durch die Partnerwahl der Frauen herangezüchtet worden sind, was dem patriarchalen Denken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts diametral widerspricht. Darwin rechnet deshalb auch nicht damit, dass das Prinzip der geschlechtlichen Auslese ähnlich rasche Anerkennung findet wie das Prinzip der natürlichen Auslese – und trifft damit (wie so häufig) voll ins Schwarze.
Tatsächlich werden in den nächsten 100 Jahren unzählige Arbeiten zur natürlichen Selektion veröffentlicht, aber nur sehr wenige, die sich mit der sexuellen Selektion beschäftigen. Dies ändert sich erst in den 1970er-Jahren (also mit dem Aufkommen der »sexuellen Revolution« in den westlichen Ländern): 1975 kann das israelische Biologen-Ehepaar Amotz und Avishag Zahavi mithilfe des sogenannten »Handicap-Prinzips« erklären, warum Pfauenhennen bei der Partnerwahl so großen Wert auf ein reich geschmücktes Federkleid der Männchen legen, obwohl dies für deren Überleben in der Natur keineswegs von Vorteil ist. Da sich nur gesunde, gut genährte Hähne das sexy Handicap eines überdimensionierten Federschmucks leisten können, erhöht diese Wahl für die Weibchen die Chance, dass ihr Erbmaterial die nachfolgenden Generationen überlebt.[43] Das Handicap-Prinzip erklärt auch, warum Vogelweibchen jene Männchen bevorzugen, die den anmutigsten Tanz vorführen, die variantenreichsten Gesangskoloraturen zustande bringen oder die aufwendigsten Nester bauen – denn auch dies ist mit hohem Aufwand verbunden, den man sich nur leisten kann, wenn man bei bester Gesundheit und im Vollbesitz seiner Kräfte ist.
Beim Menschen ist dies kaum anders. Auch wir wählen unsere Partnerinnen und Partner nicht nur nach (für das Überleben unerheblichen) körperlichen Merkmalen aus, sondern auch anhand der Weise, wie sie sprechen, sich bewegen, sich gegenüber uns und anderen verhalten, sowie anhand der Artefakte, die sie erschaffen oder mit denen sie sich umgeben (ihre Wohnungseinrichtungen, Kleidungsstile, Musikpräferenzen, Essensvorlieben, Freundeskreise, Weltanschauungen, politischen Überzeugungen, Hobbys, Berufe et cetera). Wir sind sogar in besonderem Maße sinnliche Tiere, da wir danach trachten, nahezu alle Bereiche unseres Lebens mit großem Aufwand zu ästhetisieren. All die großen Wunderwerke der Kunst und Kultur – von der Malerei, der Musik und dem Tanz, vom Schauspiel und der Literatur bis hin zur Mode, der Architektur und den »Bewegungskünsten« des Sports – sind letztlich aus dem Liebeswerben und den ritualisierten sexuellen Rivalenkämpfen unserer nicht menschlichen Vorfahren hervorgegangen.[44]
Die Neandertaler von morgen
Darwin hat all dies bereits im Blick. Ganz bewusst überschreitet er die sakrosankte Trennlinie, die traditionellerweise zwischen »dem Menschen« und »den Tieren« gezogen wird. Schon ein Jahr später veröffentlicht er ein weiteres Buch, das dies besonders deutlich macht: In seinem Werk Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren aus dem Jahr 1872 zeigt Darwin die vielen Parallelen auf, die zwischen den Empfindungen und Körpersignalen des Menschen und jenen von Menschenaffen, Katzen, Hunden oder Pferden bestehen. Das Buch ist ein weiterer scharfer Angriff auf den Exklusivitätsanspruch, den unsere Spezies so gern erhebt: Denn Darwin macht plausibel, dass wir Menschen keineswegs die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten sind, die Gefühle haben, da alle Tiere mit komplexen Gehirnen (zumindest alle Säugetiere) Leid und Freude in durchaus ähnlicher Weise wie wir empfinden können – eine These, die allerdings noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein von vielen Forscher*innen bestritten wird.
Auch in seinen letzten Lebensjahren gönnt sich Darwin keine Auszeit: Von 1875 bis 1880 erscheinen gleich vier Bücher zu Fragen der Botanik. Sein letztes Werk, das 1881 veröffentlicht wird, widmet er einem (bis heute aktuellen) ökologischen Thema, nämlich der Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer (entgegen der damals verbreiteten Meinung weist Darwin nach, dass Regenwürmer keineswegs schädlich, sondern ausgesprochen nützlich für den Pflanzenanbau sind, da sie eine zentrale Rolle bei der Boden- und Humusbildung spielen).
Als Charles Darwin am 19. April 1882 im Alter von 73 Jahren in Down House stirbt, hinterlässt er ein Werk, das unseren Blick auf die Welt nachhaltig verändert hat. 35 Jahre nach seinem Tod stellt Sigmund Freud (1856–1939) fest, Darwin habe der menschlichen Selbstverliebtheit die zweite fundamentale Kränkung der Geschichte zugefügt (nach der kopernikanischen Kränkung, die aus der Erkenntnis resultiert, dass sich die Erde nicht in der Mitte des Sonnensystems befindet).[45] Um die »Darwinische Kränkung« auf den Punkt zu bringen: Eigentlich sollte heute jedem denkenden Menschen klar sein, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern bloß die Neandertaler von morgen. Wir »nackten Affen« sollten uns nicht zu viel darauf einbilden, dass wir die Körperbehaarung abgeworfen und die Smartwatch angezogen haben.
Selbstverständlich ist die Entwicklung der Evolutionstheorie mit Darwins Tod 1882 nicht abgeschlossen. Viele wesentliche Entdeckungen erfolgen erst im 20. Jahrhundert. So weiß Darwin noch nichts von den Gesetzen der Vererbung (und somit auch nichts von der zufälligen Variation und Mutation der Gene, durch die die Evolution vorangetrieben wird), obgleich die ersten Grundlagen hierzu schon zu Darwins Lebzeiten durch den österreichischen Augustinermönch und Amateurforscher Gregor Mendel (1822–1884) geschaffen werden. In den 1940er-Jahren führen die neuen Erkenntnisse in der Genetik, Populationsbiologie, Paläontologie, Embryologie, Zellbiologie, Ökologie, Geologie und Geografie zu einer grundlegenden Revision der Darwin’schen Evolutionstheorie. Auf diese Weise entsteht ein neues, einheitliches Theoriegebäude, das nach dem Vorschlag des Evolutionsbiologen Julian Huxley, mit dem wir uns im Verlauf des Buchs noch beschäftigen werden, die Bezeichnung »Moderne Synthese« beziehungsweise »Synthetische Evolutionstheorie« erhält.
Diese »moderne Synthese« ist zweifellos ein wichtiger Schritt in der Evolution der Evolutionstheorie, bedeutet aber keineswegs schon das Ende dieser Evolution. Denn immer wieder kommen neue Erkenntnisse hinzu, die eine Anpassung der Theorie erforderlich machen. Nur ein Beispiel unter vielen:[46] In den letzten Jahrzehnten hat sich herausgestellt, dass es in der Erdgeschichte Zeitspannen gab, in denen sich der evolutionäre Wandel massiv beschleunigte – was im Widerspruch zu dem gut belegten Gradualismus steht, von dem die Evolutionstheorie seit Darwins Zeiten ausgeht. Ausgelöst werden solche Entwicklungsbeschleunigungen meist durch plötzlich auftretende, drastische Umweltveränderungen, etwa infolge des Ausbruchs eines Supervulkans oder des Einschlags eines großen Himmelskörpers auf der Erde.
Halten wir fest: Darwins berühmter Satz »Nichts ist beständiger als der Wandel« gilt nicht zuletzt auch für die Evolutionstheorie selbst. Sie hat sich in den letzten gut 150 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile wird sie nicht nur in der Biologie, sondern auch in vielen anderen wissenschaftlichen Disziplinen als theoretisches Rahmenmodell akzeptiert. Tatsächlich ergibt vieles von dem, was wir in der Welt beobachten, erst dann einen Sinn, wenn wir es »im Lichte der Evolution« betrachten, wie es Julian Huxley 1953 formuliert.[47]
Und so finden evolutionäre Denkmodelle inzwischen selbst in der Theoretischen Physik Anwendung – also jenem Fachgebiet, aus dem das wohl grundlegendste Gegenargument stammt, mit dem sich Darwin zu Lebzeiten herumschlagen muss. Denn die führenden Physiker des 19. Jahrhunderts bestreiten vehement, dass die Erde schon so alt sein könne, wie es Darwins Theorie der vielen kleinen, evolutionären Veränderungen voraussetzt. So berechnet Lord Kelvin (1824–1907), nach dem die Temperatureinheit »Kelvin« benannt ist, das Alter der Erde beziehungsweise der Sonne auf 20 bis 40 Millionen Jahre,[48] was zwar deutlich mehr ist als die 6000 Jahre der Bibel, aber dem tatsächlichen Alter der Erde von rund 4,6 Milliarden Jahren nur ansatzweise näher kommt.
Die Vorstellung der Biologen und Geologen um Darwin