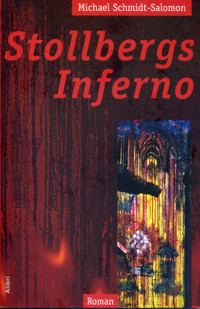9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mensch ist das mitfühlendste, klügste, fantasiebegabteste, humorvollste Tier auf diesem Planeten. Er hat Kunstwerke von atemberaubender Schönheit hervorgebracht und raffinierteste Methoden entwickelt, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Nie zuvor gab es ein Lebewesen, das sich so aufopferungsvoll um Kranke und Schwache kümmerte, das so unermüdlich für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte – trotz aller Niederlagen. Über die dunkle Seite der Menschheit ist viel geschrieben worden, ihre Sonnenseite fiel meist unter den Tisch. Dieses Buch zeigt sie auf. Eine Liebeserklärung an unsere oft verkannte Spezies, die es wert ist, dass wir uns für sie engagieren, statt vorauseilend vor der Irrationalität der Welt zu kapitulieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe3. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96640-5© Piper Verlag GmbH, MünchenCovergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenDatenkonvertierung: psb, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
VORWORT: ABSCHIED VOM ZYNISMUS
Es ist so leicht, Zyniker zu sein. Unendlich viele Gründe sprechen dafür, die Menschheit zu verachten. Man werfe nur einen Blick in die Geschichte. Oder in die Reality-Soaps, die Tag für Tag über unsere Bildschirme flimmern. Haben diejenigen nicht furchtbar recht, die den Menschen als »fatalen Irrläufer der Evolution« beschreiben? Wäre es nicht ein Segen für die Erde, wenn sie sich endlich von dem »Krebsgeschwür Menschheit« befreien könnte? Sollten wir dem »Untier Mensch« auch nur eine müde Träne nachweinen?
Sätze wie diese gehen uns leicht von der Hand. Wie auch könnten wir angesichts der unzähligen Belege, die unsere Unzulänglichkeit, unsere Wahnanfälligkeit, unsere Grausamkeit dokumentieren, den Glauben an die Menschheit aufrechterhalten? Nicht ohne Grund ist der Zynismus die große intellektuelle Verführung für jeden, der sich ernsthaft mit der Geschichte und Gegenwart unserer unglückseligen Spezies beschäftigt. Denn er verhindert bereits im Ansatz die schmerzliche Diskrepanz zwischen den hochtrabenden Idealen, die wir vertreten, und den bitteren Realitäten, die wir erzeugen, indem er die hehren Ideale von vornherein als utopisch verwirft. Subjektiv ist das durchaus entlastend: Wer den Glauben an die Menschheit ohnehin verloren hat, kann durch nichts und niemanden mehr enttäuscht werden.
Durch seine Illusionslosigkeit wirkt der Zyniker reif, überlegen, abgeklärt, ja: vernünftig – und doch beruht gerade der Zynismus auf einer totalen Bankrotterklärung der Vernunft, nämlich der Überzeugung, dass rationale Argumente nichts, aber auch rein gar nichts am Lauf der Dinge ändern können. Zyniker zu sein bedeutet, vorauseilend vor der Irrationalität der Welt zu kapitulieren, um sich den eigentlichen Herausforderungen des Menschseins gar nicht erst stellen zu müssen. Warum auch sollte man sich für »höhere Ziele« einsetzen, wenn man sowieso davon ausgehen muss, dass sich ein solcher Einsatz niemals lohnt? Das zynische Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen: »Rien ne va plus!« / »Nichts geht mehr!«, kichern die selbstzufriedenen Bankrotteure der Vernunft – erleichtert, dass ihnen die Bürde, Geschichte humaner zu gestalten, von der schmalen Schulter genommen wurde.
Zyniker sind auf einem Auge blind, weshalb sie nur die Schattenseite der menschlichen Existenz erkennen können. Tragischerweise wirkt diese Wahrnehmungsverzerrung im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung: Denn wer ohnehin nicht damit rechnet, dass sich die Verhältnisse je zum Besseren hin ändern können, wird auch nichts dafür tun, dass sie sich je zum Besseren hin ändern werden, wodurch die ursprüngliche, zynische Annahme bestätigt wird. Ein Teufelskreis.
Michelangelo (1475–1564) hatte recht mit seiner Aussage: »Die größte Gefahr für die meisten von uns ist nicht, dass wir hohe Ziele anstreben und sie verfehlen, sondern dass wir uns zu niedrige setzen und sie erreichen.« Dies gilt für uns als Individuen, aber auch für die menschliche Spezies als Ganzes: Wenn wir unsere Potenziale unterschätzen, werden wir sie auch nicht entfalten können und notgedrungen unter unseren Möglichkeiten leben. Daher sollten wir uns davor hüten, uns selbst in zynischer Weise kleinzureden.
Die beste Medizin gegen die vorauseilende Resignation des Zynismus besteht darin, sich an jenen zu orientieren, die die besten Seiten der Menschheit zum Vorschein gebracht haben – und genau darum wird es im Weiteren gehen: Thematisierte mein letztes Buch Keine Macht den Doofen die unerträgliche Penetranz menschlicher Dummheit in Geschichte und Gegenwart, handelt dieses von der heilenden Wirkung menschlicher Klugheit, von der Güte, dem Einfühlungsvermögen, der Kreativität, durch die sich unsere oft verkannte Spezies eben auch auszeichnet. Denn so seltsam es auch klingen mag: Von seiner Veranlagung her ist der Mensch das mitfühlendste, klügste, phantasiebegabteste, humorvollste Tier auf dem gesamten Planeten.
Die Natur hat uns ganz besondere Talente in die Wiege gelegt, auch wenn wir es bisher nur selten verstanden haben, diese Talente sinnvoll zu nutzen. Doch wenn dies geschah, kam es zu jenen wunderbaren Momenten, in denen die Natur sich gewissermaßen selbst überschritt. »Mutter Natur« war dies freilich völlig schnuppe – uns aber sollte es keinesfalls egal sein: Immerhin hat die Evolution Jahrmilliarden gebraucht, um ein Wesen hervorzubringen, das in der Lage ist, den evolutionären Prozess zu durchschauen. Schon allein deshalb wäre es schade um uns, würden wir vorzeitig von der Bühne des Lebens abtreten.
Wer dies verneint und glaubt, man müsse der Menschheit bei ihrem finalen Abgang keine müde Träne nachweinen, hat, wie ich meine, die großartigen Seiten unserer Spezies nur noch nicht entdeckt. Dem will dieses Buch entgegenwirken. Es zeigt auf, welch phantastische Leistungen der Mensch in Wissenschaft, Philosophie, Kunst und Technik erbracht hat, wie aufopferungsvoll sich viele unserer Artgenossen darum bemühten, diese Welt zu einem besseren, gerechteren Ort zu machen, und mit wie viel Anstand, Würde und Tapferkeit die meisten von uns ihr Leben meistern.
Kurzum: Ich werde darlegen, dass es trotz aller Irrungen und Wirrungen der Geschichte unendlich viele Gründe gibt, die Menschheit zu achten. Und vielleicht, ja vielleicht, wird es dem einen oder anderen nach der Lektüre dieses Buchs dann doch ein wenig schwerer fallen, Zyniker zu sein. Die Hoffnung, so heißt es, stirbt stets zuletzt …
DIE BEDRÄNGTE SPEZIES
DAS TRAGISCHE TIER: VON DEN NÖTEN DES MENSCHSEINS
Es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Denn wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass nichts von dem, was wir lieben, Bestand haben wird. Wir wissen, dass am Ende unserer Tage ein Kampf auf uns wartet, der nicht zu gewinnen ist – ein Schicksal, dem auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht entrinnen werden. Und schon bald nach unserem Tod wird sich niemand mehr daran erinnern können, wer wir waren, worauf wir hofften und wie sehr wir uns darum bemühten, unserem Leben einen halbwegs tragfähigen Sinn zu verleihen. Kaum sind wir fort, wird es so sein, als ob es uns nie gegeben hätte.
Das tragische Los des Menschen ist oft beklagt worden. Man denke nur an die berühmten Worte, die William Shakespeare (1564–1616)[1] seinem Macbeth in den Mund legte: »Das Leben ist nichts als ein wandelnder Schatten; ein armer Schauspieler, der seine Stunde auf der Bühne stolziert und sich quält und dann nicht mehr gehört wird: Es ist eine Geschichte, von einem Idioten erzählt, voller Schall und Raserei, ohne Bedeutung.«[2]
Arthur Schopenhauer (1788–1860) formulierte es noch etwas drastischer: Wer sich das irdische Dasein »mit seinen stündlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen, kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten, mit seinen getäuschten Hoffnungen und seinen alle Berechnungen vereitelnden Unfällen« vergegenwärtige, der müsse zwangsläufig zu der Überzeugung gelangen, »dass gar nichts unseres Strebens, Treibens und Ringens wert sei, dass alle Güter nichtig seien, die Welt an allen Ecken bankrott, und das Leben ein Geschäft, das nicht die Kosten deckt«.[3] Und so sei das Leben der meisten Menschen nichts weiter als ein »mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken«.[4]
Gewiss: Nicht jeder wird die Situation des Menschen so düster beurteilen, wie es Schopenhauer, der Großmeister des philosophischen Pessimismus, getan hat. Dennoch lässt sich die fundamentale Tragik der menschlichen Existenz nicht leugnen: Das Universum, in das wir hineingeboren werden, ist offensichtlich nicht darauf ausgelegt, uns besonders angenehme Rahmenbedingungen zu bescheren. Im Gegenteil: Wir sind nicht nur – wie alle »höheren« Lebensformen auf der Erde – mit allen erdenklichen Arten des physischen und psychischen Leids konfrontiert, wir wissen zudem, dass wir diesen Übeln letztlich nicht entgehen können – wie sehr wir uns auch anstrengen mögen. Diese Ausweglosigkeit zu ertragen, ohne zu verzweifeln, ist keine Lappalie – und es grenzt fast schon an ein Wunder, dass die meisten Menschen ihr Leben trotz allem so tapfer meistern, ohne dem Irrsinn zu verfallen.
Will man ein faires Urteil über die Menschheit fällen, so darf man die besonderen Herausforderungen nicht außer Acht lassen, die das Leben an uns stellt. Denn erst vor dem Hintergrund der »kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten« des Daseins, von denen Arthur Schopenhauer sprach, wird verständlich, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Die Erfahrung des Absurden
Benjamin Button, als Greis geboren, wurde mit zunehmendem Alter immer jünger, bis er schließlich als 85-jähriger Säugling in den Armen seiner ehemaligen Geliebten Daisy starb. Die Handlung des amerikanischen Spielfilms Der seltsame Fall des Benjamin Button[5] fasziniert gerade deshalb, weil er unseren Erfahrungen so fundamental widerspricht. Denn natürlich wissen wir, dass das Altern ein unumkehrbarer biologischer Prozess ist. Die Stationen unseres Lebens sind fest vorgegeben: Wir entwickeln uns vom Säugling zum Kleinkind, vom Kind zum Jugendlichen, vom Erwachsenen zum Greis – niemals in die entgegengesetzte Richtung.
Dass die Geschichte des Benjamin Button dennoch nachvollziehbar ist, hängt damit zusammen, dass sich die beiden Pole unseres Lebens in grotesker Weise gleichen – nicht nur, weil der Greis am Ende unter Umständen ähnlich hilflos ist wie der Säugling am Anfang, sondern auch, weil er unweigerlich auf jenen Zustand des Nichtseins zusteuert, aus dem der Säugling hervorgegangen ist: Haben wir zuvor über Jahrmilliarden noch nicht existiert, werden wir danach über Jahrmilliarden nicht mehr existieren. Der verschwindend kleine Spalt, der die beiden gewaltigen Zeiträume unserer Nichtexistenz voneinander trennt, markiert das, was wir unser Leben nennen.
Allein diese Tatsache kann verschrecken. Nicht ohne Grund hatte die »Entdeckung der Tiefenzeit« solch verstörende Wirkungen.[6] Als die Geologen im 18. und 19. Jahrhundert herausfanden, dass die Erde sehr viel älter sein musste, als man auf der Basis religiöser Überlieferungen angenommen hatte, löste dies einen kulturellen Schock aus, den man durchaus mit dem der kopernikanischen Wende vergleichen kann. Warum? Weil die kosmische Irrelevanz der Menschheit nun nach der räumlichen auch in der zeitlichen Dimension offensichtlich wurde. Hatte Kopernikus die Welt des Menschen vom Mittelpunkt des Universums in eine unscheinbare Provinz der Milchstraße katapultiert, musste der Mensch jetzt verkraften, dass seine Kulturgeschichte zu einer winzigen Fußnote im kosmischen Kalender zusammenschrumpfte.
Zwar ist schon der Blick zurück auf ein Universum, das über 13 Milliarden Jahre problemlos auf uns verzichten konnte, schwindelerregend, doch steigert sich dieses Gefühl noch einmal, wenn wir den Blick nach vorne richten auf ein Universum, das künftig für einen wahrscheinlich noch sehr viel längeren Zeitraum auf uns verzichten wird. Denn obwohl zwischen den beiden Phasen unserer Nichtexistenz bei objektiver Betrachtung kein gravierender Unterschied besteht, so sieht dies subjektiv doch völlig anders aus: Als Individuen kommen wir mit der Tatsache, dass wir vor unserer Geburt noch nicht existierten, weit besser zurecht als damit, dass wir nach unserem Tod nicht mehr existieren werden. Gleichsam ist es für uns leichter zu ertragen, dass von der Menschheit in der Vergangenheit über Jahrmilliarden nichts zu sehen war, als dass von ihr in der Zukunft über Jahrmilliarden nichts mehr zu sehen sein wird. Denn wir wissen: Mit dem Ende der Menschheit wird auch ihr kulturelles Gedächtnis versiegen und damit die allerletzte Chance vergehen, dass irgendetwas von dem, was wir waren oder getan haben, in Erinnerung bleibt.
Entsprechend groß war die Erschütterung, als der berühmte Berliner Physiker Rudolf Clausius (1822–1888) die Gesetze der Thermodynamik auf den Kosmos übertrug. Das uns bekannte Universum müsse, so Clausius, unweigerlich den »Wärmetod« sterben, wenn die Entropie ihr Maximum erreiche, Energie und Materie im Weltall gleichmäßig verteilt seien und somit keine Energieumwandlung mehr stattfinde. Clausius’ These vom »Ende der Welt« löste im 19. Jahrhundert einen regelrechten Kulturkampf aus. Vertreter aller erdenklichen gesellschaftlichen Gruppen fühlten sich bemüßigt, Stellung zu beziehen, stand die Wärmetod-Hypothese doch in krassem Widerspruch zur Fortschrittserwartung der damaligen Zeit.[7]
Mittlerweile hat sich die Aufregung über das in Aussicht gestellte Weltenende etwas gelegt, die existenzielle Erschütterung, die mit dieser Erkenntnis einhergeht, ist aber erhalten geblieben – auch wenn die Physiker der Gegenwart nicht mehr vom »Wärmetod«, sondern vom »Big Freeze«, »Big Crunch« oder »Big Rip« sprechen.[8] Wir haben uns sogar an die Vorstellung gewöhnen müssen, dass wir keineswegs jenes »kosmische Ende aller Tage« abwarten müssen, bis es auf der Erde tödlich ungemütlich wird. Wir wissen: Asteroideneinschläge oder Gammastrahlenblitze können das Leben auf unserem Heimatplaneten von heute auf morgen vernichten. Aber auch ohne derartige kosmische Unfälle ist das Schicksal der Erde längst besiegelt.
Dies hängt mit dem Lebenszyklus unserer Sonne zusammen, die die Erde seit 4,6 Milliarden Jahren zuverlässig mit lebensspendender Energie versorgt. Bedauerlicherweise hat der Kernfusionsprozess, der dies ermöglicht, seine Tücken, denn er ist verantwortlich dafür, dass die Strahlkraft der Sonne kontinuierlich steigt und es folglich auf der Erde immer wärmer werden wird – auch ohne die Hilfe anthropogener Treibhauseffekte. Aufgrund der gestiegenen Erdtemperatur werden voraussichtlich schon in 500 Millionen Jahren keine höheren Lebensformen mehr auf der Erde existieren können, in 900 Millionen Jahren werden sämtliche Pflanzen verschwunden sein, in zwei Milliarden Jahren wird sich die Erde in einen reinen Wüstenplaneten verwandelt haben.
Sollte irgendeine intelligente außerirdische Spezies in einigen Milliarden Jahren zufälligerweise in unser Sonnensystem vordringen, würde sie (sofern es der Menschheit nicht gelingen sollte, einen anderen Planeten zu besiedeln)[9] nicht einmal mehr feststellen können, dass es eine höhere Zivilisation hier jemals gegeben hat. »Von unseren Städten wird bleiben, der, der durch sie hindurchging, der Wind«, schrieb Bertolt Brecht (1898–1956) in seinem Gedicht Vom armen B. B. – und selbst das war in gewisser Weise noch überoptimistisch, denn auch der Wind wird nicht ewig wehen, wie auch die Sonne nicht ewig strahlen wird. (In etwa 7,7 Milliarden Jahren verwandelt sie sich in einen »Weißen Zwerg«, der allmählich abkühlen und schließlich verlöschen wird.)
Selbst wenn der Menschheit das Kunststück gelänge, einen neuen Heimatplaneten mit intaktem Heimatstern zu finden, würde uns dies als Spezies nicht vor dem finalen Exitus retten. Denn auch auf diesem fernen Planeten werden sich – wie überall im Universum – die Verhältnisse verheerend ändern. Irgendwann, so viel ist sicher, wird das kulturelle Gedächtnis der Menschheit enden, wird nicht nur der Genpool der Menschheit, sondern alles Leben aus dem Universum verschwunden sein.
Das, was für uns als Individuen gilt, trifft also letztlich auf unsere gesamte Spezies zu: Irgendwann werden wir vergessen sein und selbst das Vergessen wird vergessen sein. »Unsterblichen Ruhm« gibt es ebenso wenig wie »unsterbliche Gene«. Nichts von dem, was wir sind oder erschaffen, überdauert die Zeit. Und so steht am Ende der menschlichen Geschichte nicht der dauergrinsende »Mr. Fortschritt«, sondern das heillose, trostlose, sinnlose Nichts.
Sich mit dieser finalen Nichtigkeit der menschlichen Existenz zu konfrontieren kann einen Menschen bis ins Innerste erschüttern. Das wurde mir vor rund 15 Jahren auf dramatische Weise bewusst gemacht. Als junger Dozent an der Universität Trier hatte ich den Fehler begangen, die Studierenden in einem Seminar am frühen Montagmorgen mit der Frage zu begrüßen, warum sie sich überhaupt für diese Veranstaltung aus dem Bett gequält hatten, immerhin würde sich doch in absehbarer Zeit niemand mehr daran erinnern, wer sie gewesen seien und was sie in ihrem Leben geleistet hätten. Offenkundig fielen meine Ausführungen über die kosmische Irrelevanz aller menschlichen Bemühungen allzu plastisch aus, denn plötzlich begann eine der Studentinnen so stark zu hyperventilieren, dass sie vom Stuhl fiel und wie gelähmt auf dem Boden lag. Zwar verschwanden ihre Symptome bald wieder, doch der Schreck, den die Episode bei mir auslöste, war so groß, dass ich das Thema in meinen späteren Seminaren nie wieder in dieser Deutlichkeit ansprach.
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung konnte ich gut nachvollziehen, warum das ausgezeichnete Jugendbuch Nichts – Was im Leben wichtig ist der dänischen Schriftstellerin Janne Teller (*1964) anfangs auf solch erbitterten Widerstand stieß.[10] Tellers Roman beginnt mit einer auf das Wesentliche komprimierten nihilistischen Botschaft: »Nichts bedeutet irgendetwas […] Deshalb lohnt es sich nicht, irgendetwas zu tun.« Verstörend daran ist, dass diese Worte nicht von einem in Würde ergrauten Philosophieprofessor ausgesprochen werden, sondern von dem 13-jährigen Schüler Pierre Anthon. Das gesamte Buch handelt davon, wie sich seine Klassenkameraden an diesen Worten abarbeiten, wie sie zunehmend verzweifelter und aggressiver versuchen, der vermeintlichen Sinnlosigkeit der menschlichen Existenz eine wirkliche Bedeutung, gar einen »Berg der Bedeutung«, entgegenzustellen.
In gewisser Weise lässt sich Tellers Roman als Parabel auf die menschliche Geschichte lesen, denn auch diese wurde nicht zuletzt von dem verzweifelten Ringen um Bedeutung angetrieben. Wie im Roman war auch in der Geschichte die Erzeugung von Bedeutung mit großen existenziellen Opfern verbunden – und natürlich richtete sich auch dort die Aggression der »Sinnstifter« in besonderer Weise gegen jene, die es wagten, die mühsam konstruierte »Bedeutung« infrage zu stellen. Insofern ist es dramaturgisch gesehen nur konsequent, dass Pierre Anthon letztlich im Feuer umkommt – so wie es einst auch zahlreichen als »Ketzer« geschmähten Denkern widerfuhr, etwa Giordano Bruno (1548–1600), der auf dem Scheiterhaufen der Inquisition landete, nachdem er das Sakrileg begangen hatte, die Sonderstellung und damit die Bedeutung des Menschen im Kosmos zu bestreiten.
Die Erregung der Gemüter ist verständlich, ist doch der nüchterne Blick auf die Tatsachen des Lebens nicht gerade erbaulich. Friedrich Nietzsche (1844–1900) skizzierte die empörenden Rahmenbedingungen der menschlichen Existenz wie folgt: »Der Mensch, eine kleine, überspannte Tierart, die – glücklicherweise – ihre Zeit hat; das Leben auf der Erde überhaupt ein Augenblick, ein Zwischenfall, eine Ausnahme ohne Folge, etwas, das für den Gesamt-Charakter der Erde belanglos bleibt; die Erde selbst, wie jedes Gestirn, ein Hiatus zwischen zwei Nichtsen, ein Ereignis ohne Plan, Vernunft, Wille, Selbstbewusstsein, die schlimmste Art des Notwendigen, die dumme Notwendigkeit (…) Gegen diese Betrachtung empört sich etwas in uns; die Schlange Eitelkeit redet uns zu ›das alles muss falsch sein: denn es empört …‹«[11]
Nietzsche aber wollte sich von der »Schlange Eitelkeit« nicht blenden lassen. Und so fasste er die Menschheitsgeschichte in wenigen, schonungslosen Worten zusammen:
»In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der ›Weltgeschichte‹; aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Tiere mussten sterben. – So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben.«[12]
Der französische Existenzialist, Philosoph und Literaturnobelpreisträger Albert Camus (1913–1960) wandte sich, nicht zuletzt inspiriert durch die Lektüre Nietzsches, wenige Jahrzehnte später ebenfalls dieser Thematik zu. In seinem berühmten Essay Der Mythos des Sisyphos entwickelte er in einer bis dahin unerreichten Klarheit die Idee des Absurden, die sich aus dem unaufhebbaren Widerspruch zwischen der offenkundigen Sinnwidrigkeit der Welt und der ebenso offenkundigen Sehnsucht des Menschen nach Sinn ergibt. Intellektuell redlich könne sich der Mensch der Widersinnigkeit seiner Existenz nicht entziehen, meinte er. Niemand bleibe gänzlich von der Erfahrung des Absurden verschont: »Das Absurde«, so Camus, »kann jeden beliebigen Menschen an jeder beliebigen Straßenecke anspringen.«[13]
Zwar vermag uns der Alltag über die Mühen eines über weite Strecken glanzlosen Lebens hinwegzutragen, doch manchmal »stürzen die Kulissen ein«: »Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer der derselbe Rhythmus – das ist meist ein bequemer Weg. Eines Tages aber erhebt sich das ›Warum‹, und mit diesem Überdruss fängt alles an.«[14]
Natürlich können wir die bohrende Frage nach dem »Warum« oder dem »Wozu« des Lebens verdrängen, indem wir die Beantwortung der Frage immer wieder auf die Zukunft verschieben (»mit den Jahren wirst du’s verstehen«).[15] Doch irgendwann wird der Tag kommen, an dem es dieses »morgen« nicht mehr geben wird. Von Geburt an steuern wir mit erbarmungsloser Konsequenz auf diesen einen letzten Tag zu. »Im tödlichen Licht dieses Verhängnisses«, schreibt Camus, »tritt die Nutzlosigkeit in Erscheinung. Keine Moral und keine Anstrengung lassen sich a priori vor der blutigen Mathematik rechtfertigen, die über uns herrscht.«[16]
Wir sind zum Tode verurteilt und wir wissen darum. Ebendieses Bewusstsein schafft die Grundlage für die Erfahrung des Absurden: »Wäre ich Baum unter Bäumen, Katze inmitten der Tiere, dann hätte dieses Leben einen Sinn oder dieses Problem hätte vielmehr keinen, denn ich wäre Teil dieser Welt. Ich wäre diese Welt, gegen die ich mich jetzt mit meinem ganzen Bewusstsein und mit meinem ganzen Anspruch auf Vertrautheit stemme. (…) Mit diesem Augenblick tritt das Absurde, das so evident und gleichzeitig so schwer fassbar ist, ein in das Leben eines Menschen und wird dort heimisch.«[17]
Mein kürzlich verstorbener Stiftungskollege Johannes Neumann (1929–2013),[18] der einst als renommierter Kirchenrechtler neben Hans Küng, dem späteren »Weltethos«-Begründer, und Joseph Ratzinger, dem späteren Papst, an der Theologischen Fakultät Tübingen lehrte, brachte die gleichsam evidente wie unfassbare Widersinnigkeit, die mit der blutigen Mathematik des Todes einhergeht, einmal sehr treffend zum Ausdruck. In einem »neuen Glaubensbekenntnis«, das er (gemeinsam mit seiner Frau Ursula Neumann) einige Jahre nach seinem Abschied vom Christentum formulierte, heißt es:
»Als erstes glaube ich daran, dass ich sterben werde. – Das ist schon falsch. Ich weiß es zwar, aber glauben kann ich es trotz allen Bemühens immer noch nicht. Es ist ein weiter Weg vom Kopf zum Herzen. Ich sage mir immer wieder: ›Eines Tages wird die Sonne aufgehen wie immer, die Leute gehen zur Arbeit wie üblich, es gibt Verkehrsstaus wie gewohnt, der Wetterbericht bringt auch nichts Neues, lediglich im Werbefernsehen wird für ›Das neue XY‹ geworben, alles wird sein wie sonst …, außer dass es dich nicht mehr gibt. Die Welt wird nicht stillstehen, sie wird nicht mal den Atem anhalten. Business as usual. Bloß ohne dich. Und bald, sehr bald, wird niemand mehr was von dir wissen. Nicht die Spur.‹ – ›Das darf doch nicht wahr sein‹, empört sich mein armes und ungläubiges Herz. ›Doch‹, sage ich und weiche keinen Millimeter, lasse kein Hintertürchen offen.«[19]
Der Skandal des Todes liegt, wie wir gesehen haben, nicht nur darin, dass er uns zwingt, von allem für immer Abschied zu nehmen. Der eigentliche Skandal besteht in der Gewissheit, dass der Tod über kurz oder lang jede Bedeutung eliminiert, die wir unserem Leben gegeben haben. Was für uns erheblich war – die Freude, die wir erleben durften, das Leid, das wir ertragen mussten, die Anstrengungen, die wir auf uns nahmen – all dies wird letztlich irrelevant sein.[20] Dieses Wissen um die Vergeblichkeit unserer Bemühungen führt das Bedürfnis nach Sinn in die Irre: Wozu noch all der Aufwand, der mit dem Leben Tag für Tag verbunden ist, wenn am Ende doch alles für die Katz ist?
Solange sich die Menschen einbilden konnten, das irdische Leben sei bloß eine Durchgangsstation zu einer höheren Daseinsform, stellte sich diese Frage nicht in dieser Dringlichkeit. Denn wer ein »Wozu« des Lebens hat, kann sich mit nahezu jedem »Wie« abfinden. Geht dieses »Wozu« jedoch verloren, rückt das »Wie« des Lebens in den Vordergrund. Leid und Elend lassen sich von nun an nicht mehr über ein »höheres Ziel« rechtfertigen. Aus dem Schatten des endgültigen Todes tritt somit der Skandal eines Lebens hervor, das nicht hält, was wir uns von ihm versprechen.
Die Widrigkeiten des Lebens
»Jedes Existierende wird ohne Grund geboren, lebt aus Schwäche weiter und stirbt durch äußere Einwirkung.« Antoine Roquentin, der diesen magenbitteren Satz in sein Tagebuch notiert, empfindet einen zunehmend stärker werdenden Ekel gegenüber allem, was ihm begegnet. Seine ehemalige Geliebte, die Menschen in der Bibliothek, die Porträts erfolgreicher Bürger im Museum, ja sogar ein Blatt Papier, ein Kieselstein, seine eigene Hand, lösen bei ihm ein tief sitzendes Unbehagen, einen unkontrollierbaren inneren Würgereflex aus. Das Dasein an sich ekelt ihn an, es erscheint ihm als schal, unbedeutend, überflüssig, nicht der Rede wert.
Glücklicherweise handelt es sich bei Antoine Roquentin nur um eine literarische Figur aus Jean-Paul Sartres (1905–1980) Roman Der Ekel, doch gibt es tatsächlich Menschen, die so empfinden. Nehmen derartige Gefühle überhand, sprechen wir von einer psychischen Erkrankung, denn normalerweise verhindert ein gesunder Abwehrmechanismus, dass wir uns die Vergeblichkeit unserer Existenz allzu bewusst machen und in unseren anmutig spielenden Kindern bloß »künftige Gräber« sehen.
Auch ohne die ständige Konfrontation mit dem Absurden ist das Leben schwer genug. Die Probleme beginnen schon im Mutterleib. Es ist eine Gnade der Natur, dass der Embryo noch kein Bewusstsein seiner selbst hat und nicht antizipiert, welche Tortur er durchstehen muss, um das »Licht der Welt« zu erblicken. Selbst ausgefeilteste Methoden einer »sanften Geburt« können die traumatische Urerfahrung des »Geburtsschocks« nicht verhindern. Der Eintritt in die Welt ist eine schmerzvolle, beklemmende Prozedur, an die wir uns später glücklicherweise nicht mehr erinnern können.
In den ersten Wochen und Monaten seines Lebens zählt der Mensch zu den hilflosesten Wesen auf Erden, auf Gedeih und Verderb seiner Umwelt ausgeliefert. Es ist offensichtlich, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht heimisch in der Welt fühlen, sondern uns erst an sie gewöhnen müssen. Die Gefühle des Unbehagens sind übermächtig, denn wir ahnen noch nicht, dass sie vorübergehen werden. Hunger, Durst, Langeweile, Einsamkeit und Müdigkeit plagen uns, aber wir können nichts dagegen tun, als zu schreien. Schmerzen erleben wir in dieser ersten Lebensphase intensiver, als wir sie später je erleben werden, da das schmerzunterdrückende System, das Leidensempfindungen durch Endorphinausschüttungen erträglicher macht, erst Monate nach der Geburt voll funktionsfähig ist.[21] Kein Wunder, dass viele von uns so lange schreien, bis sie vor Erschöpfung einschlafen.
Kaum haben wir uns an den Stress des Lebens gewöhnt und einen guten Rhythmus zwischen Schlaf und Wachheit gefunden, beginnen wir auch schon zu zahnen, was weiteres Unbehagen erzeugt. Aber auch das geht vorüber. Allmählich nehmen wir Kontakt mit unserer Umwelt auf. Wir lächeln, wenn wir ein vertrautes Gesicht sehen, und ängstigen uns, wenn ein Fremder vor uns auftaucht. Mutter und Vater würden wir in dieser Zeit am liebsten ganz in Beschlag nehmen, doch müssen wir lernen, dass dies nicht immer möglich ist – ein notwendiger, wenn auch schmerzhafter Ablösungsprozess.
In der Auseinandersetzung mit anderen entwickeln wir langsam unsere eigene Identität. Mühsam müssen wir erfahren, dass wir nicht der Mittelpunkt der Welt sind, um den sich alles dreht. Unsere narzisstischen Ansprüche werden schrecklich enttäuscht. Wir müssen lernen, zurückzustecken und uns mit dem abzufinden, was uns nach Auffassung der Erwachsenen, zu denen wir mit großen Augen aufschauen, zusteht. Man lehrt uns Gebote und Verbote, die wir zunächst nicht einsehen können, aber dennoch befolgen müssen. Die Größeren lassen uns oft genug spüren, wie unterlegen wir ihnen sind, und auch aus den ersten Rangeleien mit Gleichaltrigen gehen wir nicht immer als strahlende Sieger hervor.
Gleichwohl: All dies ist zu ertragen. Sofern wir das Glück haben, in eine liebevolle Familie und in eine halbwegs intakte Gesellschaft hineingeboren zu werden, können wir durchaus eine »glückliche Kindheit« erleben. Doch schon inmitten dieser sozialen Schonphase versucht man, uns an den sogenannten »Ernst des Lebens« zu gewöhnen. Das Realitätsprinzip tritt nun mehr und mehr an die Stelle des Lustprinzips, sosehr wir uns auch dagegen auflehnen mögen. In der Schule lassen wir uns dazu breitschlagen, Dinge zu lernen, die uns eigentlich kaum interessieren, doch in der Regel schlucken wir diese bittere Pille brav, hat man uns doch beigebracht, dass all dies notwendig sei, damit »später einmal etwas aus uns wird«.
In der Phase der Pubertät gerät dieses mühsam ausgehandelte Arrangement zwischen uns und der Welt vorübergehend ins Schwanken. Hormone überschwemmen unseren Körper, und die Stimmung wechselt zwischen »himmelhoch jauchzend« und »zu Tode betrübt«. Neue Lüste und unbekannte Ängste verunsichern das jugendliche Ich, das sich selbst noch nicht gefunden hat. Aus den spielerischen Rangeleien der Kindheit werden nun ernsthafte Wettbewerbe. Wir werden zu Protagonisten eines uralten biologischen Programms, bei dem es darum geht, zu zeigen, was man hat und was man kann, um potenzielle Sexualpartnerinnen oder -partner zu beeindrucken.
Doch das Spiel geht nicht immer auf. Manch einer findet ein Leben lang niemanden, mit dem er die intimsten Dinge teilen kann. Aber auch den anderen steht Ungemach ins Haus: Auf die erste Liebe folgt die erste Trennung. Man hat das Gefühl, die Welt werde untergehen – und ist erstaunt, dass sie sich trotz allem weiterdreht. Dabei ist das Drama der ersten Liebe bloß ein harmloses Vorspiel, verglichen mit den Dramen späterer Jahre. Auch dafür sind biologische Programme mitverantwortlich: Da die Menschheit trotz aller Tugendkataloge keine monogame Spezies ist, gehören Seitensprünge und Partnerwechsel zu unserem normalen Verhaltensrepertoire.[22] Das geht nicht immer glimpflich aus. Denn gerade die größten Leidenschaften können die größten Leiden schaffen. Die Weltliteratur liefert unzählige Beispiele dafür.
Liebe, Lust und Leidenschaft lassen uns die höchsten Gipfel erklimmen, aber auch in die tiefsten Abgründe stürzen. Damit umzugehen ist nicht einfach. Selbst hoch reflektierten Menschen gelingt es oft nicht, die richtige Balance zu finden zwischen der Freiheit, die wir zum Atmen brauchen, und der Bindung, die notwendig ist, um sich auf einen anderen Menschen wirklich einlassen zu können. Und so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir zumindest einmal in unserem Leben vor dem Scherbenhaufen einer Beziehung stehen, die uns einst die Welt bedeutete.
Von all den Erschütterungen und Enttäuschungen, die da in Liebesdingen auf uns zukommen werden, wissen wir als junge Erwachsene glücklicherweise noch nichts – und wollen es im Grunde auch gar nicht wissen. Denn die »Romantik« wird uns bereits von anderer Seite gründlich ausgetrieben. So müssen wir uns in der Regel schon recht früh damit abfinden, dass wir doch nicht den Beruf ergreifen können, von dem wir als Kinder geträumt hatten. Statt als Astronaut, Popstar, Fußballspieler, Model oder Schauspielerin weltweit Anerkennung zu finden, verdienen wir unseren Unterhalt nun als Versicherungskaufmann, KFZ-Mechaniker, technische Zeichnerin oder Erzieherin. Das ist wahrlich keine Schande (eine Gesellschaft, die nur aus Astronauten, Popstars, Fußballspielern, Models oder Schauspielerinnen bestünde, käme nicht weit!), aber ein gewisses Gefühl der Unzufriedenheit bleibt bei dem einen oder anderen doch.
Allerdings führen selbst diejenigen, die das Glück hatten, ihren Traumjob zu ergattern, nicht notwendigerweise eine glückliche Existenz. Dafür gibt es viele Beispiele – man denke nur an Robert Enke, den ehemaligen Torwart der deutschen Nationalmannschaft, der vieles von dem erreicht hatte, wovon andere nur träumen können. Weder das viele Geld, das er verdiente, noch die internationale Anerkennung, die er als Spitzensportler genoss, konnten ihm dazu verhelfen, einen Sinn in seinem Leben zu sehen. Am Ende war seine Verzweiflung so groß, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah, als sich vor einen fahrenden Zug zu werfen.
Robert Enke litt unter Depressionen – der am häufigsten auftretenden psychischen Erkrankung weltweit. Das deutsche Bundesgesundheitsministerium schätzt, dass aktuell etwa vier Millionen Bundesbürger (etwa fünf Prozent der Gesamtbevölkerung) von einer Depression im engeren Sinne betroffen sind. Fasst man die Kriterien etwas weiter, wie es die britische Gesundheitsbehörde in einer Aufklärungskampagne getan hat, kann man davon ausgehen, dass fast jeder Mensch im Verlauf seines Lebens mit depressiven Symptomen zu kämpfen hat. Gefühle der Niedergeschlagenheit, der Antriebslosigkeit, der inneren Unruhe und existenziellen Sinnlosigkeit erleben auch diejenigen, die nicht mit einer besonderen genetischen Disposition für Depressionen ins Leben gestartet sind. Das ist nur verständlich: Man müsste ja schon mit einem erstaunlichen Übermaß an Ignoranz oder Gleichmut ausgestattet sein, um angesichts der Nöte der menschlichen Existenz nicht hin und wieder am Leben zu verzagen.
Häufig werden depressive Episoden durch äußere Ereignisse mit ausgelöst. Bei Robert Enke etwa war es der Dauerstress im Job sowie der Tod seiner Tochter Lara, die, mit einem Herzfehler geboren, drei schwere Herzoperationen überstanden hatte, aber im September 2006 kurz nach ihrem zweiten Geburtstag infolge eines vergleichsweise leichten Eingriffs am Ohr starb. Der Verlust eines Kindes gehört zweifellos zu den schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch verkraften muss. Es ist der dramatische Höhepunkt in der Sammlung jener »alle Berechnungen vereitelnden Unfälle«, von denen Arthur Schopenhauer gesprochen hat. Glücklicherweise ist die Kindersterblichkeit in Deutschland auf einen historischen Tiefstand gesunken,[23] dennoch müssen Jahr für Jahr Tausende von Eltern ihre minderjährigen Söhne und Töchter zu Grabe tragen. Und Zehntausende müssen damit leben, dass ihre Kinder unter schwersten Behinderungen oder unheilbaren chronischen Krankheiten leiden. Jeder einzelne Fall ist eine Katastrophe, die unser Vertrauen in das Leben nachhaltig erschüttert.
Aber auch diejenigen, die in ihren ersten Jahrzehnten schweren Schicksalsschlägen entgehen können, kommen letztlich nicht heil davon. Denn ab der Mitte unseres Lebens müssen wir uns immer häufiger von jenen verabschieden, die wir geliebt haben. Sie hinterlassen Lücken in unserer Biografie, die wir nicht mehr füllen können. Spätestens mit dem Verlust der eigenen Eltern wird uns auch die »blutige Mathematik des Todes« bewusst. Mit ungläubigem Erstaunen stellen wir fest, dass wir nun selbst in jene Generation aufrücken, die als Nächstes von der Bühne des Lebens abtreten wird. Die Verpflichtungen des Alltags verhindern zwar, dass wir uns diesem verstörenden Gedanken allzu häufig stellen, doch hin und wieder scheint nun die bange Frage auf, ob das denn alles gewesen sein soll. Hat das Leben wirklich gehalten, was wir uns von ihm versprachen? Nur die wenigsten können darauf mit einem uneingeschränkten »Ja« antworten.
Die meisten von uns bekommen Beklemmungen bei dem Gedanken, wie schnell die Zeit verfliegt und wie wenig uns bleibt, um all die Dinge zu tun, die wir uns vorgenommen hatten. Erschwerend kommt hinzu, dass die negativen Begleiterscheinungen des Alterns immer offensichtlicher werden. Es fängt vergleichsweise harmlos an: Die Haare werden grau oder fallen aus, die Haut wird faltiger, für das Lesen brauchen wir neuerdings eine Brille. Können wir uns überhaupt noch zu sportlichen Betätigungen aufraffen, so stellen wir fest, dass unsere Kondition nachlässt und die Reaktionen langsamer werden. Auch wenn wir uns innerlich noch jung fühlen mögen, so werden wir zunehmend zum »alten Eisen« gezählt. Als sexuelle Wesen werden wir kaum noch wahrgenommen, was nicht allein dem »Jugendwahn« unserer Gesellschaft geschuldet ist, sondern auch dem biologisch bedingten Absinken des Testosteron- bzw. Östrogenspiegels.
Unser Verhältnis zum Alterungsprozess ändert sich nun grundlegend: Früher war das Älterwerden für uns mit einer Zunahme an Selbstbestimmung verbunden, es ging unaufhaltsam bergauf – jetzt aber müssen wir erschüttert feststellen, dass wir den Gipfel längst überschritten haben. Wir wissen: Von nun an geht es unaufhaltsam bergab. Wir hören und sehen schlechter, die Muskelmasse nimmt ab, die Gelenke werden unbeweglicher, die Knochen brüchiger, das Immunsystem wird schwächer. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns die Gebrechen des Alters erwischen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bronchitis, Diabetes, Demenz, Osteoporose, Arthrose, Krebs.
Am Beispiel von Freunden, Bekannten und Verwandten haben wir erlebt, welche Qualen es bedeutet, wenn sich Tumore wie tollwütige Hunde durch die inneren Organe fressen – und wir hoffen inständig, dass uns selbst dieses Schicksal erspart bleiben möge. Andererseits macht uns die Alternative, von schweren Krankheiten verschont zu bleiben, dafür aber im Greisenalter auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein, keine geringere Angst: Die Aussicht, in Zukunft nicht einmal mehr alleine essen und trinken zu können, sondern wie ein Säugling gefüttert, gebadet, gewickelt zu werden, lässt die Befürchtung in uns wachsen, dass wir im Alter unsere Würde, unsere Selbstachtung verlieren könnten. Im Idealfall, so malen wir uns aus, bleiben wir bis ins hohe Alter gesund und geistig rege und wachen eines Morgens einfach nicht mehr auf, nachdem wir am Abend zuvor mit einem zufriedenen Lächeln zu Bett gegangen sind. Doch ein solcher »sanfter Tod« ist, wie wir wissen, nur sehr wenigen vergönnt.
Also beißen wir die Zähne zusammen und verdrängen den Gedanken an unsere wahrscheinlich nicht mehr allzu glorreiche Zukunft. Immerhin: Momentan haben wir das Heft noch selbst in der Hand! Noch können wir etwas aus unserem Leben machen! Heißt es nicht zu Recht in Udo Jürgens’ altem Gassenhauer: »Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran«? Völlig danebengegriffen ist das tatsächlich nicht, denn in den letzten Jahrzehnten hat sich das Bild des Alters sehr zum Positiven gewandelt. Den sogenannten »jungen Alten« gelingt es durchaus, vieles von dem nachzuholen, was sie zuvor unter dem Druck des Berufslebens und der Verantwortung für eine Familie verpasst hatten. Einige von ihnen sind bis ins hohe Alter erstaunlich aktiv und nehmen regen Anteil am Zeitgeschehen.
Dies trägt sicherlich mit dazu bei, dass so mancher am Ende eine positive Bilanz ziehen kann und dankbar ist für ein Leben, das sich – summa summarum – zu leben lohnte. Andere hingegen hadern bis zum Schluss mit ihrem Schicksal und verfluchen diese eine, so unerfüllte Existenz, die im Wesentlichen nur Leid und Kummer brachte und – summa summarum – kaum mehr war als eine »kolossale Zeitverschwendung«.
Paradoxerweise haben beide recht – ein weiterer Skandal des Lebens, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Die Ungerechtigkeit der Welt
»Das Leben ist ungerecht – aber schön.« Eine gute Freundin, die seit Jahren in bewundernswerter Weise gegen immer wieder neu entstehende Tumore und Metastasen ankämpft, sagte diesen Satz, kurz nachdem sie mir mitgeteilt hatte, dass sich die Krebszellen in ihrem Körper wieder in besorgniserregender Weise vermehrten und sie sich bald einer weiteren Chemotherapie unterziehen müsse. Ich erinnere mich nicht mehr, wie ich damals auf ihren Ausspruch reagiert habe, aber er hat sich nachhaltig in mein Gedächtnis eingebrannt.
Kompakter lässt es sich nämlich nicht formulieren: Gerade weil wir um die schönen Seiten, die wohligen Gefühle der Zufriedenheit, Freude und Ekstase, wissen, empört es uns, dass so viele so wenig an diesen Freuden teilhaben können. Wäre das Leben tatsächlich nur durch quälende Trostlosigkeit gekennzeichnet, wie Arthur Schopenhauer meinte, würde uns das Elend nicht sonderlich interessieren. Wir würden es als gegeben hinnehmen, statt uns darüber zu empören.
Es verletzt ein tief in uns verankertes Gerechtigkeitsempfinden, dass Chancen und Talente, Krankheiten und Behinderungen, materielle und immaterielle Ressourcen so verstörend ungleich unter den Menschen verteilt sind. Und so fühlen wir uns immer auch ein wenig mitschuldig, wenn wir feststellen, wie gut es uns und wie schlecht es anderen geht. Dabei können wir als Individuen für diese Missstände oft nichts. Über weite Strecken sind sie nicht einmal menschengemacht, sondern Ausdruck einer fundamentalen Ungerechtigkeit der Natur, die wir nur schwer akzeptieren können.
Gerechtigkeit ist ein Maßstab, den wir ethisch denkenden Tiere intuitiv an die Natur anlegen, der in der biologischen Evolution aber keine Rolle spielt. Dass einige Arten aufsteigen, während andere vom Erdboden verschwinden, dass einige Lebewesen sich prächtig entwickeln, während andere ein kurzes, trostloses Dasein fristen, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, es resultiert vielmehr aus den blinden Mechanismen der Evolution, die keinerlei Mitleid kennen, keine Gnade, keinen Heilsplan.
Diese Ungerechtigkeit der Natur ist eine der verstörendsten Tatsachen, mit denen wir konfrontiert sind – zumal wir sie auch im kulturellen Rahmen bislang nicht wirklich aufheben können. Man denke nur an die Naturgewalten, denen wir immer wieder ausgeliefert sind: Allein im letzten Jahrzehnt starben Hunderttausende von Menschen, weil sie von Erdbeben begraben, von riesigen Flutwellen hinweggespült oder mit todbringenden Viren infiziert wurden. Dass es die einen traf, die anderen nicht, hatte keinen vernünftigen Grund, keinen tieferen Sinn, sondern war allein Ausdruck des blinden Waltens von Zufall und Notwendigkeit – ein Walten, das völlig gleichgültig ist gegenüber unseren Hoffnungen, Ängsten und ethischen Empfindungen.
Die Ungerechtigkeit der Natur offenbart sich allerdings auch in Dimensionen, die auf den ersten Blick weniger dramatisch anmuten (tatsächlich aber haben auch sie dramatische Konsequenzen für unser Leben). Vergegenwärtigen wir uns nur die Folgen, die aus der Ungleichverteilung sexueller Attraktivität erwachsen: Warum erhalten hochattraktive Vertreter unserer Spezies wie Brad Pitt oder Angelina Jolie so viel positive Aufmerksamkeit und warum werden Menschen, die nach landläufiger Meinung »hässlich« sind, in vielen Bereichen des Lebens so stark ausgegrenzt, wenn doch Schönheit über weite Strecken nichts weiter ist als das Produkt der zufälligen Kombination von Erbmerkmalen beim Verschmelzen einer Samenzelle mit einer Eizelle?
Bei intellektuellen Leistungen sieht es kaum anders aus: Den einen fällt das Lösen komplexer Gleichungen in den Schoß, die anderen werden sie bei aller Anstrengung nie begreifen. Dass die einen die Schule mit Bravour meistern, während die anderen kläglich scheitern, ist, wie wir heute wissen, nicht zuletzt auf unterschiedliche genetische Ausstattung zurückzuführen – also auf einen Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktor, für den das jeweilige Individuum beim besten Willen nichts kann.[24] Dennoch gelten die einen als Gewinner, die anderen als Versager. Fair ist das ganz sicher nicht.
Und damit nicht genug: Auch das individuelle Glücksempfinden wird, wie vor allem Zwillingsstudien gezeigt haben, in erschreckend hohem Maße von genetischen Faktoren beeinflusst.[25] Einige von uns haben von Natur aus ein schier unverwüstliches, sonniges Gemüt, das es ihnen ermöglicht, selbst schwere Schicksalsschläge wegzustecken, als sei kaum etwas gewesen. Andere hingegen werden schon von kleinsten Erschütterungen in ihrer Biografie in tiefe Abgründe gerissen, aus denen es kaum noch ein Entrinnen gibt. Ist es nicht zutiefst empörend, dass unser Lebensglück zu einem maßgeblichen Teil davon abhängt, welche DNA-Paare im Moment unserer Zeugung zufällig aufeinandergetroffen sind?
Gleichermaßen verhält es sich mit erblich bedingten Krankheiten: Ist es nicht hochgradig unfair, wie unterschiedlich wir in Sachen »Gesundheit« ausgestattet sind? Manche Kinder werden mit so großen körperlichen Schäden geboren, dass sie schon nach wenigen Wochen – oftmals nach unsäglichem Leiden – aus dem Leben scheiden. Andere erkranken als Jugendliche unheilbar an Leukämie oder erleiden einen tödlichen Herzanfall, kurz nachdem ihr erstes Kind geboren wurde. Wieder andere hingegen scheinen geradezu immun gegen jegliche Krankheit zu sein. Irgendeine Form von »Sinn« oder »Gerechtigkeit« ist dahinter nicht zu entdecken.
Zwar können wir uns darum bemühen, möglichst gesundheitsbewusst zu leben, aber das Erreichen eines hohen Alters ist dadurch keineswegs garantiert. Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass wir uns in diesen Dingen nur auf eines verlassen können, nämlich dass man sich auf rein gar nichts verlassen kann: Während manche sich sklavisch an jede Gesundheitsregel halten, aber schon mit 49 an Lungenkrebs sterben, rauchen andere Kette und werden dennoch über 90. Grotesk, aber wahr: Ausgerechnet der älteste Mensch, der – soweit nachweisbar – je gelebt hat, die Französin Jeanne Calment (1875–1997), war dem Rauchen verfallen. Die alte Dame, die mit 100 Jahren noch Fahrrad fuhr, hatte sich dieses »Laster« 1896 als 21-Jährige angewöhnt und hielt an ihm fast 100 Jahre fest. Erst mit 119 Jahren gab sie das Rauchen auf – nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil sie, mittlerweile erblindet, zu stolz war, andere danach zu fragen, ob sie ihr die Zigarette anzünden könnten.
Jeanne Calment führte ihr erstaunlich langes Leben auf den Genuss von Olivenöl, Knoblauch, Gemüse und Portwein zurück (ein zweiter Aspekt, der strengen Abstinenzlern kaum gefallen dürfte), der entscheidende Punkt war aber zweifellos ihre außergewöhnliche genetische Ausstattung: Langlebigkeit lag in ihrer Familie. Schon ihr Vater hatte das bemerkenswerte Alter von 94 Jahren erreicht, ihr Bruder wurde 97. Calment profitierte davon, dass sie keine Disposition zu einer der großen Krankheiten mitbrachte, an denen die meisten Menschen vor dem Erreichen der maximalen Lebensspanne sterben, zudem schien sie geradezu immun gegen Stress und Depressionen zu sein. Gemäß ihrem Lebensmotto: »Wenn du etwas nicht ändern kannst, ärgere dich nicht darüber!«, begegnete sie auch den Gebrechen des Alters mit einer ordentlichen Portion Humor. Wenn sich Reporter von der ältesten Frau der Welt mit den Worten verabschiedeten, man sähe sich ja vielleicht beim nächsten Geburtstag wieder, antwortete sie schelmisch: »Ich wüsste nicht, was dagegen spräche. So schlecht sehen Sie doch gar nicht aus …«
Für ihr sonniges Gemüt konnte sie ebenso wenig wie für ihre strotzende Gesundheit, aber auch in anderer Hinsicht hatte Jeanne Calment Glück: Trotz der beiden Weltkriege musste sie niemals unter materieller Not leiden. Aufgewachsen als Tochter eines vermögenden Schiffbauers, hatte sie 1896 einen reichen Ladenbesitzer geheiratet, was sie in die Lage versetzte, ein komfortables Leben zu führen. Statt sich die Gesundheit durch harte Arbeit auf dem Feld oder in der Fabrik zu ruinieren, konnte sie Opernaufführungen besuchen oder ihren sonstigen Hobbys (Tennis, Radfahren, Schwimmen, Klavierspielen) nachgehen.
Jeanne Calment, die älteste Frau der Welt, war also gleich in zweifacher Hinsicht privilegiert: biologisch und kulturell. Andere hatten dieses Glück nicht, sondern vielmehr doppeltes Pech: Sie mussten nicht nur mit schlechteren genetischen Voraussetzungen ins Leben starten, sondern stießen zu allem Übel auch noch auf gesellschaftliche Bedingungen, die ihre Lebenschancen zusätzlich minimierten. In besonders grausamer Form zeigte sich dies im sogenannten »Euthanasieprogramm« der Nazis (das Wort »sogenannt« ist hier entscheidend, denn den nationalsozialistischen Ärzten ging es nicht um einen »guten Tod«, also »humane Sterbehilfe«, sondern um systematischen Massenmord an behinderten und psychisch kranken Menschen!). Allerdings müssen wir keineswegs solche Extrembeispiele der Geschichte bemühen, um den grundlegenden Sachverhalt zu verstehen, schon ein kurzer Blick auf die gegenwärtige Weltlage genügt: Offenkundig ist die menschliche Kultur nicht nur meilenweit davon entfernt, die Ungerechtigkeit der Natur aufheben zu können, sondern sie führt insgesamt sogar zu einer weiteren Verschärfung des Problems.
Betrachten wir nur das Verhältnis von Arm und Reich auf globaler Ebene: Während einige Millionen Menschen dank der enorm gestiegenen Produktivität der Wirtschaft einen Luxus genießen können, vor dem selbst die mächtigsten Kaiser, Könige und Päpste der Vergangenheit vor Neid erblassen würden, sterben gleichzeitig Tag für Tag fast 20000 Kinder unter fünf Jahren an den Folgen von Unterernährung, fehlender Hygiene und mangelhafter medizinischer Versorgung. Während die einen die Sektkorken knallen lassen, haben die anderen (eine Milliarde Menschen weltweit!) keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Während die einen ins Fitnesscenter gehen, um überschüssige Kalorien abzutrainieren, sind die anderen (derzeit etwa 700 Millionen Menschen) vom Hungertod bedroht.[26]
Es gibt kein vernünftiges Argument, das diese kolossale Ungleichverteilung materieller Güter ethisch rechtfertigen könnte. Wir (der Autor dieses Buches und wohl auch der überwiegende Teil seiner Leserinnen und Leser) haben einfach nur unverschämtes Glück gehabt, in eine wohlhabende Gesellschaft hineingeboren worden zu sein statt in eine der vielen Elendsregionen der Welt. Aber auch in unseren Breitengraden nimmt das Missverhältnis von Arm und Reich besorgniserregende Formen an: So besitzen die reichsten zehn Prozent der deutschen Bevölkerung mittlerweile mehr als 60 Prozent des bundesweiten Vermögens (1988 lag ihr Anteil am Gesamtvermögen noch bei 45 Prozent, 2002 schon bei 57,9 Prozent, 2007 bei 61,7 Prozent, Tendenz weiter steigend).[27] Den reichsten 20 Prozent der Haushalte gehören mittlerweile über 80 Prozent, während 80 Prozent der Haushalte mit weniger als 20 Prozent des Kapitals auskommen müssen und die ärmsten 50 Prozent der Haushalte mit Müh und Not zwei Prozent zusammenkratzen können. Über reale Leistungen lassen sich derartige Vermögensunterschiede ganz sicher nicht begründen, und von »Chancengerechtigkeit« kann unter solchen Bedingungen schon gar nicht die Rede sein.[28]
Die Menschen starten nicht nur biologisch, sondern auch kulturell unter höchst ungleichen Bedingungen ins Leben. So, als würde man bei einem 100-Meter-Lauf dem einen 70 Meter Vorsprung gewähren und dem anderen zusätzlich noch Steine in den Weg legen. Besonders auffällig ist dies im Fall der absoluten Armut: Es ist die große, durch nichts zu rechtfertigende Schande unserer Spezies, dass Abermillionen Kinder weltweit von Geburt an zu einem Leben verurteilt sind, das ihnen nur Hunger, Krankheit, Gewalt und Tod bringen wird. Doch selbst wenn wir diesen »Skandal der Skandale« für einen Moment außen vor lassen und den Blick nur auf die wohlhabenden Gesellschaften richten, wird uns schmerzhaft bewusst, wie ungleich die Karten von Anfang an verteilt sind.
Obwohl hier aus ökonomischen Gründen niemand verhungern muss, wird trotzdem nicht jedes Kind in ein Umfeld hineingeboren, in dem seine Talente erkannt oder gar optimal gefördert werden. Vielen Familien fehlen dafür schlichtweg die materiellen Ressourcen, sie sind froh, mit dem wenigen, das ihnen bleibt, über die Runden zu kommen. Häufig kommen zum materiellen Elend noch psychische Defizite hinzu (die selbstverständlich auch in wohlhabenderen Haushalten auftreten können). Nicht jeder Junge, nicht jedes Mädchen erfährt die Liebe und Unterstützung, die notwendig ist, um eine reife, stabile Persönlichkeit entwickeln zu können. Viele verkümmern vorzeitig innerlich, werden von ihrem direkten Umfeld in schlimmster Weise missbraucht, gedemütigt, psychisch misshandelt.
Erfahren wir davon, sind wir gewöhnlich schnell dabei, die jeweiligen Eltern zu verurteilen. Schauen wir jedoch etwas genauer hin, wird sehr bald das ganze Ausmaß der Tragödie deutlich: Denn die Täter von heute sind meist die Opfer von gestern. So werden die Symptome häufig von einer Generation auf die nächste übertragen – ein Teufelskreis, aus dem die Familien alleine kaum herausfinden. Bedauerlicherweise sind die gesellschaftlichen Institutionen vom Jugendamt über den Kindergarten bis hin zur Schule kaum in der Lage, solche familiären Beeinträchtigungen auszugleichen. Zum Teil tragen sie gar zu einer zusätzlichen Diskriminierung der ohnehin Benachteiligten bei, was sich im späteren Berufs- bzw. Nichtberufsleben meist weiter fortsetzt.
Macht man sich all dies bewusst, wird offensichtlich, wie absurd die Selbstgefälligkeit ist, mit der so viele, die »es im Leben zu etwas gebracht haben«, über sich und andere urteilen. Denn sehr leicht hätte es auch anders kommen können: Eine kleine Abweichung im genetischen Code oder ein Sauerstoffmangel bei der Geburt hätten genügt – und der brillante XY würde heute nicht in der Vorstandsetage eines Großkonzerns sitzen, sondern Kugelschreiber in einer Behindertenwerkstatt zusammenschrauben. Eine andere Herkunft, andere familiäre Verhältnisse, andere Peergroups – und er würde nicht in edlen Sterne-Restaurants speisen, sondern nach Essbarem im Müll suchen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es nun einmal so – ob wir es wollen oder nicht: Das menschliche Leben ist ein Glücksspiel, bei dem einige ein Traumlos ziehen, während es andere übel trifft. Wer sich darauf etwas einbildet, hat nur wenig vom Leben begriffen.[29]
Während die strukturelle Ungerechtigkeit, die den einen in die Armut und den anderen in den Reichtum treibt, leicht übersehen wird, sind jene Formen der Ungerechtigkeit, die mit der Anwendung direkter Gewalt einhergehen, für jeden offensichtlich. Das hängt damit zusammen, dass die Verursacher dieser Gewalt, die kleinen und großen Verbrecher der Menschheitsgeschichte, sehr viel leichter zu identifizieren sind. Wir kennen ihre Taten, wissen um das Elend, das sie verursacht haben.
Die Konfrontation mit dem unfassbaren Leid, das Menschen anderen Menschen zugefügt haben, nährt den Zweifel an der ethischen Zurechnungsfähigkeit unserer Spezies. Nicht zuletzt aus diesem Grund schlug ich in Keine Macht den Doofen vor, auf das Reden vom Homo sapiens, dem »weisen Menschen«, zu verzichten – und stattdessen vom Homo demens, dem irren, dem wahnsinnigen Menschen, zu sprechen: »Über Jahrtausende hatten wir nichts Besseres zu tun, als uns gegenseitig niederzumetzeln. Wer zählt die Millionen und Abermillionen, die gefoltert, gehängt, gesteinigt, erstochen, erwürgt, erschlagen, erschossen, verbrannt, vergiftet, vergast wurden? Ein einzigartiger Blutstrom zieht sich durch die Jahrhunderte, er ist der rote Faden in jener sinnlosen Aneinanderreihung von Mord und Totschlag, Ausbeutung und Gewalt, die sich Geschichte nennt.«[30]
Gewiss: Es wäre unfair, die Geschichte der Menschheit hierauf reduzieren zu wollen. In ihr gab es selbstverständlich auch Liebe, Freundlichkeit, Kooperation, Mut, Phantasie, Klugheit, Humor – all die wunderbaren Dinge, von denen dieses Buch handeln wird. Dennoch ist die schiere Allgegenwart von Ungerechtigkeit, Not, Ausbeutung und Gewalt in unserer Geschichte nicht zu leugnen – und es wäre unrealistisch zu erwarten, dass sich diese negativen Phänomene in Zukunft vollständig vermeiden ließen.
Solange die Menschen glauben konnten, dass die Ungerechtigkeit auf Erden durch eine höhere, jenseitige Gerechtigkeit aufgehoben würde, stellte sich das Gerechtigkeitsproblem nicht in dieser Schärfe. Gehen wir jedoch davon aus, dass das Leben des Menschen (als Individuum wie als Gattungswesen) endlich ist, müssen wir uns der verstörenden Tatsache stellen, dass mit dem Tod oft auch die schreiende Ungerechtigkeit der Welt das letzte Wort haben wird. Eine Vorstellung, die nur schwer zu ertragen ist, wie Johannes und Ursula Neumann in ihrem »neuen Glaubensbekenntnis« aufzeigten:
»Das eigentlich Skandalöse des Glaubens an die Endgültigkeit des Todes ist nicht das Eingeständnis meiner Endlichkeit, sondern der damit implizierte Verzicht auf den Glauben an Gerechtigkeit. Wenn der Tod das letzte Wort ist, dann ist er es auch für jedes verhungerte Kind, auf dessen Kosten wir uns überfressen, jeden zu Tode Gefolterten, dessen Peiniger nach Verzehrung der staatlichen Pension seinen spätmöglichsten Tod unter bester medizinischer Betreuung stirbt, für jeden Arbeiter mit Staublunge, dessen Chef bewegt über die unerträglich hohen Lohnkosten Klage zu führen weiß, für jede Frau, die – ob mit Schleier oder ohne – in die Kategorie ›Mensch zweiter Klasse‹ von jenen eingeteilt wird, deren moralische Autorität allenthalben unbestritten ist und unter deren billigen Mahnworten die Mächtigen zusammenzucken.«[31]
Angesichts dieser unerträglichen Konsequenzen wünschten sich die beiden Autoren, sie brauchten sich nicht bloß mit dem »allzu schwachen Trost abspeisen, dass es doch schon viel ist, wenn ich meinen Beitrag leiste, dass ein winziges Bisschen mehr Gerechtigkeit herrscht«.[32] Gerechtigkeit sollte Wirklichkeit sein – nicht bloß ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Wer die Welt realistisch betrachtet, weiß, dass es dafür wenig Anhaltspunkte gibt. Das zu akzeptieren fällt nicht leicht. Ist es da nicht verständlich, dass so viele von uns entgegen aller Evidenz daran festhalten, »dass das Gute belohnt und das Böse bestraft wird, dass die Gänseliesel den Prinzen heiratet und die treulose Magd mit Schimpf und Schande aus dem Land gejagt wird«?[33]
Eigentlich wissen wir zu viel, um einer solchen Heile-Welt-Idylle noch Glauben schenken zu können. Und doch: Wie Ertrinkende, die im Kampf ums Überleben nach jedem Strohhalm greifen, klammern sich noch immer Abermillionen von Menschen weltweit an die Rettungsringe des Glaubens – auch wenn aus ihnen, objektiv betrachtet, längst alle Luft entwichen ist. Wohl ahnen viele, dass sie sich mithilfe dieser metaphysischen Rettungsringe nicht über Wasser halten können, doch nur wenige gestehen es sich ein. Zu groß ist die Angst, loslassen zu müssen und im Existenzstrudel ganz auf sich alleine gestellt zu sein.
Werfen wir also einen Blick auf die tragischen Rettungsversuche, mit denen der Mensch seit Jahrtausenden gegen die Abgründe des Lebens ankämpft. Erst sie komplettieren unser Bild von den Nöten der menschlichen Existenz.
Der Seufzer der bedrängten Kreatur
Angesichts der »Erfahrung des Absurden«, der »Widrigkeiten des Lebens« und der »Ungerechtigkeit der Welt« sehnen sich viele ein »Happy End« herbei, das ihrer Existenz Sinn verleiht, woraus sich bis heute die große Attraktivität der Religion speist. Karl Marx (1818–1883) hat dies – anders als viele seiner Anhänger, die in der Religion nichts weiter sahen als ein Instrument der politischen Herrschaft – klar erkannt: »Die Religion«, so schrieb er 1844, »ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks.«[34]
Man übersieht leicht, dass in diesen berühmten Zeilen nicht nur eine Kritik am illusorischen Charakter der religiösen Heilsversprechungen zum Ausdruck kommt, sondern auch ein tiefes Verständnis für die existenziellen Nöte, aus denen heraus der religiöse Glaube geboren wird. Wer diesen Aspekt ignoriert, verkennt die Gründe, warum sich so viele Menschen ein Leben ohne Religion nicht vorstellen können. Religion ist für sie eine unverzichtbare Lebensbewältigungsstrategie. Sie dient nicht nur zur Betäubung des Daseinsschmerzes oder zur Erklärung und Rechtfertigung des sozialen Elends. In ihr äußert sich auch der ohnmächtige Protest gegen eine Welt, die so, wie sie ist, nicht sein sollte.
In der strikten Weigerung, sich mit der Ungerechtigkeit der Welt abzufinden und das menschliche Leben als eine in jeder Hinsicht bedeutungslose Episode der kosmischen Geschichte zu entwerten, liegt der humane Kern der Religion. In dieser Hinsicht bietet sie ein Gegengift zur zynischen Lebensverachtung, die vor der Irrationalität der Welt voreilig kapituliert. Dies ist mir als Humanist höchst sympathisch – und so hätte ich gegen die Verabreichung der religiösen Arznei auch gar nichts einzuwenden, wären da nicht die vielfältigen Risiken und Nebenwirkungen, die mit ihrem Gebrauch unweigerlich verbunden sind.
Sämtliche Medikamente, die auf dem religiösen Markt zu finden sind, beruhen auf dem gleichen Wirkmechanismus: der Bereitstellung eines überindividuellen Sinnangebots zur Blockade individueller Existenzzweifel. Trotz dieses gemeinsamen Wirkmechanismus sind die jeweiligen Rezepturen recht verschieden: So löst der Hinduismus das Gerechtigkeitsproblem der Welt auf gänzlich andere Weise als das Christentum. Der Buddhismus wiederum begegnet der Erfahrung der Vergeblichkeit mit einem grundsätzlich anderen Erlösungsversprechen als der Islam. Auch wenn sich in jeder religiösen Tradition höchst unterschiedliche Interpretationen entwickelt haben, die sich mitunter diametral widersprechen (ein signifikanter Hinweis darauf, dass die Religionen den Zweifel nicht so gründlich eliminieren können, wie sie es versprechen), lassen sich doch einige Grundmuster erkennen, die zumindest einen groben Überblick über die verschiedenen, im religiösen Kontext entstandenen Diesseitsbewältigungsstrategien erlauben:
Der klassische Hinduismus beispielsweise deutet die Ungerechtigkeit der Welt in geradezu genialer Weise um, indem er die verstörende Ungleichverteilung von Lebenschancen in Natur und Kultur als Ausdruck einer tiefer liegenden »kosmischen Gerechtigkeit« interpretiert. Grundlegend hierfür sind die Vorstellungen von Samsara (wörtlich: »beständiges Wandern«, womit der »Kreislauf der Wiedergeburten« gemeint ist, dem angeblich jedes Lebewesen bis zur »Erlösung« unterworfen ist), Karma (wörtlich: »Wirken, Tat«, also den angenommenen Rückwirkungen vergangener Handlungen auf dieses oder auf kommende Leben) und Dharma (dem vermeintlichen kosmischen Gesetz, dem alle Lebewesen unterliegen und aus dem die jeweiligen religiösen und ethischen Pflichten des Menschen abgeleitet werden).
Auf der Basis dieser Konzepte lassen sich selbst die widrigsten Lebensumstände, mit denen ein Mensch zu kämpfen hat (Hunger, Armut, Krankheit, Tod der eigenen Kinder), als gerechte Folgen früherer karmischer Verfehlungen deuten. Das reduziert zwar das Engagement, katastrophalen Lebensumständen entgegenzuwirken, macht sie für die Betroffenen aber zugleich erträglicher, da sie sich einbilden können, durch die aktuellen Leiderfahrungen »schlechtes Karma« abzubauen und bei der nächsten Reinkarnation unter besseren Voraussetzungen starten zu können.
Diese eigentümliche Konstruktion erklärt auch, warum sich das indische Kastensystem so lange halten konnte. Während die Vorstellung, dass der soziale Status einer Person ein ganzes Leben lang davon abhängig sein soll, in welche Familie und damit auch in welche Kaste sie zufälligerweise hineingeboren wurde, das moderne Gerechtigkeitsempfinden grundlegend verletzt, stellt sich die Situation für traditionelle Hindus völlig anders dar, denn für sie ist die Geburt in eine spezifische Familie und Kaste keineswegs zufällig, sondern eine notwendige Folge des kosmischen Gesetzes. Sich dagegen aufzulehnen würde das Dharma verletzen und schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.
Auch der Erfahrung des Absurden begegnet der Hinduismus mit einer originellen Neuinterpretation: Während wir die Vergeblichkeit des menschlichen Strebens in der Regel darin erblicken, dass sich unsere Bemühungen nicht lohnen, weil am Ende nichts von dem bleibt, was wir waren und taten, sieht der Hinduismus gerade in dieser finalen Aufhebung die eigentliche Erlösung (Moksha), auf die all unser Streben ausgerichtet ist. Das große Übel ist aus hinduistischer Sicht nämlich nicht der Tod, sondern das Leben, das vor allem eines bedeutet: Leiden. Sich aus dem leidvollen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt zu befreien, gilt als das eigentliche Ziel des Lebens. Und so ist die Horrorvorstellung des westlichen Denkens, dass von unserem Tun am Ende nichts übrig bleiben wird, die Idealvorstellung des Hinduismus: Nach hinduistischer Vorstellung bedeutet das endgültige Verlöschen aller Belege der individuellen Existenz nämlich keineswegs, dass all unsere Bemühungen vergeblich waren, sondern im Gegenteil: dass es sich gelohnt hat, die Lasten des Daseins (über unzählige Reinkarnationen hinweg) zu tragen, um endlich von ihnen befreit zu werden.
Im Buddhismus finden wir ähnliche Konzepte vor: Auch für Buddha (Siddhartha Gautama, 563–483)[35] war das Leben vor allem durch Leiden gekennzeichnet. Auch ihm ging es darum, den leidvollen Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt zu durchbrechen. Insofern gleicht die buddhistische Antwort auf die »Erfahrung des Absurden«, die »Widrigkeiten des Lebens« und die »Ungerechtigkeit der Welt« den hinduistischen Lösungsvorschlägen. Und doch gibt es bedeutsame Unterschiede: So kam der Buddhismus in seiner ursprünglichen Gestalt ohne Götter und Göttinnen aus, weshalb Buddha nachdrücklich darauf hinwies, dass seine Lehre auf einer kontemplativen Einsicht in die Natur der Dinge beruhe – nicht auf »Offenbarungswissen«. Zudem bestritt er die hinduistische Vorstellung einer »ewigen Seele« (Atta), ja sogar die Überzeugung, dass so etwas wie ein feststehendes, individuelles Selbst überhaupt existiere.
Die buddhistische Lehre vom »Nicht-Selbst« (Anatta) reduziert die Bedeutung, die der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt für das Individuum hat (schließlich wandert hier keine »ewige Seele« und auch kein »individuelles Bewusstsein« mehr von einer Existenzform zur anderen, sondern bloß ein abstrakter »karmischer Impuls«), stellt dafür aber das erlösende »Nirwana« schon zu Lebzeiten in Aussicht. Für diese Erlösung ist es nicht entscheidend, in welche Familie ein Mensch hineingeboren wurde (Buddhas Lehre widerspricht insofern dem hinduistischen Kastensystem), sondern ob er in seinem Leben die »Vier Edlen Wahrheiten« (Wahrheit vom Leiden, von der Ursache des Leidens, der Aufhebung des Leidens und dem Weg zur Aufhebung des Leidens) berücksichtigt und den »Edlen Achtfachen Pfad« (rechte Ansicht, rechtes Denken, rechte Rede, rechte Handlung, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration) beschreitet.[36]
Buddha lehrte: Wer sich auf diese Weise von den »Anhaftungen des Ich« befreit, findet schon zu Lebzeiten in einen Zustand tiefster innerer Ruhe, in dem alle Wünsche, alle Sehnsüchte, alle Unterscheidungen und damit auch alles Leid verschwunden ist. Dieses Nirwana vor dem Tod, in dem der »Erwachte« zwar noch essen, trinken, atmen muss, aber doch leidlos in einer Welt des Leids leben kann, ist gewissermaßen die Vorstufe zum vollständigen Erlöschen im absoluten Nirwana, das nach dem physischen Tod eintritt, wenn alle »karmischen Wirkungen« aufgehoben und die »fünf Daseinsgruppen« (Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesregungen und Bewusstsein) zur Ruhe gekommen sind.[37]
Die Lösung, die die jüdische Religion für die existenziellen Probleme des Menschseins fand, unterscheidet sich grundlegend von den hinduistischen und buddhistischen Vorschlägen. Im Unterschied zu ihnen ist das irdische Leben im jüdischen Glauben nicht grundsätzlich mit Leiden verknüpft, sondern kann, wie das »Hohelied Salomos« eindrucksvoll zeigt, sehr wohl mit höchsten Wonnen verbunden sein. Dadurch jedoch verschärft sich das Problem der Ungerechtigkeit: Denn weshalb können die einen ein Leben in Saus und Braus führen, während den anderen so viel Schreckliches widerfährt? Die Antwort, die das Judentum auf diese Frage gibt, ist ebenso einfach wie verstörend: Weil ein allmächtiger Gott (Jahwe) es so und nicht anders wollte!
In dieser Hinsicht wird den Menschen von Jahwe viel abverlangt. Besonders drastisch zeigt sich dies im Buch Hiob (Original: Ijob), das wie das »Hohelied Salomos« zum Tanach, den Quellentexten der »jüdischen Bibel«, gehört. Hiob, so lesen wir, war ein frommer und vermögender Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied.[38]