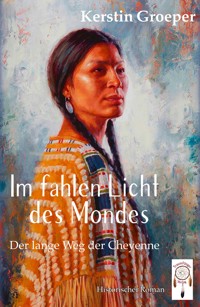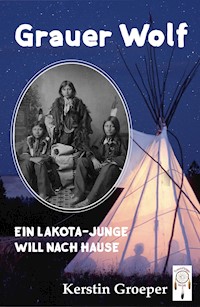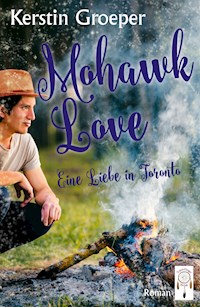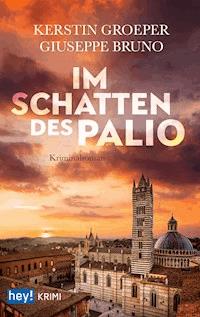4,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Familie Bruckner lebt ein bescheidenes, aber durchaus zufriedenes Leben in Deutschland. So folgt Theresa ihrem Mann mit eher gemischten Gefühlen, als dieser 1863 nach Amerika auswandert. Nach dem Massaker an einem friedlichen Cheyennedorf am Sand-Creek durch weiße Soldaten überfallen die nach Rache sinnenden Cheyenne und verbündeten Lakota die abgelegene Farm der deutschen Familie. Schrecklich bemalte Indianer zerren Theresa aus dem Haus und entführen sie in eine Welt, die ihr völlig unbekannt und bedrohlich erscheint. Gestrandet in einem fortwährenden Alptraum, lehnt sie jede Annäherung ab und weigert sich die andere Sprache zu lernen. Auch Wakinyan-gleschka, der Mann, der sie eher aus Mitleid vor der Rache der Cheyenne bewahrt hat, weiß nichts mit der Frau anzufangen. In seinen Augen ist sie dumm und ungebildet, kaum in der Lage ein Tipi zu führen oder ihn im Bett zu erfreuen. Doch dann erreicht der Krieg der weißen Soldaten das Dorf der Brulé-Lakota, mit einer Brutalität, die Theresas Leben für immer verändern wird…Basierend auf wahren Begebenheiten beschreibt das Buch diese Geschichte abwechselnd aus dem Blickwinkel von Theresa und Wakinyan-gleschka.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für unseren Freund Leonard Little Finger …
Die Feder folgt dem Wind
Eine weiße Frau bei den Sioux
Historischer RomanvonKerstin Groeper
Impressum
Die Feder folgt dem Wind, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2012
1. Auflage eBook Februar 2022
eBook ISBN 978-3-948878-17-7
Lektorat: Ilona Rehfeldt
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: Marion und Doris Arnemann
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG, Hohenthann
Inhalt
Die Überfahrt
Wakinyan-gleschka
Zerplatzte Träume
Pankeska-Wakpa
Gefangenschaft
Cachli-Wakpa
Jesus Christus
Hemdträger
Mila Hanska
Der weiße Büffel
Leben
Heimat
Winterleben
Pawnee
Reise zurück
Friedensverhandlungen
Wambli-tokahe
Liebesflöte
Wettrennen
Das Feuerross
Faules Fleisch
Verlorene Jagdgründe
Raue Sitten
Fort Laramie
Whetstone Agency
Kojote
Der Weg nach Westen
Nachwort und historischer Hintergrund
Kultur identifiziert Menschen in ihrem Denken, Handeln und Verhalten, und wie sie mit ihren Augen die Welt sehen.
Als Volk der Lakota haben wir unsere Sprache über Jahrhunderte hinweg erhalten, da allein durch ihren Gebrauch die Wichtigkeit beschrieben wird, die in der Verbindung zwischen Gott, Wakan Tanka und der gesamten Schöpfung besteht.
Wichtig ist die Verbindung zu allen Wesen, die in dem Respekt ausgedrückt wird, den man gegenüber einem Verwandten zeigt.
Dieses Fundament aus Respekt ist spirituell und ganzheitlich gemeint, und wurde von Gott vielleicht von Anbeginn der Schöpfung so ersonnen und im Laufe der Zeit wieder vergessen.
Unsere Sprache liegt uns am Herzen, weil wir immer noch dieses ursprüngliche Leben verstehen können, das all die Zeit überdauert hat, trotz der Versuche es auszurotten.
Wir teilen dieses Wissen, indem wir sagen:
Mitakuye Oyasin - Alle meine Verwandten
Leonard Little Finger
Lakota Circle VillageCangleska Wakan Owayawa
Die Überfahrt
(Hamburg, Frühjahr 1863)
Theresa Bruckner stand an der Reling des Schiffes und schaute mit beklommenem Herzen auf den Hafen zurück, der im morgendlichen Dunst allmählich verschwand. Ihre Hand umklammerte fest das Kopftuch, das sie sich tief ins Gesicht gezogen hatte, so als könnte sie damit die eisige Kälte aufhalten, die in ihr hochstieg. Nur gedämpft vernahm sie die aufgeregten Stimmen der anderen Reisenden, die einen wehmütigen Blick auf ihre Heimat warfen. Oh! Vielleicht zum ersten Mal in dem Trubel der letzten Wochen erkannte sie mit völliger Klarheit, dass sie nie mehr zurückkehren würde. Die schemenhaften Umrisse der Hafengebäude wären das Letzte, was sie an die Heimat erinnern würde. Ein endgültiger Abschied von ihren Eltern, ihren Geschwistern, der kleinen Schmiede, die ihnen ein Auskommen gesichert hatte. Es war nicht viel gewesen, gewiss, aber ihr hatte es gereicht.
„In Amerika wird alles viel besser!“, hatte ihr Mann voller Enthusiasmus prophezeit. Er war berauscht von dem Gedanken an Freiheit und welche Möglichkeiten sich ihm eröffnen würden. „Ich bin Schmied! So etwas suchen sie dort drüben!“
Dort drüben! Wie oft hatte sie diese Worte in den vergangenen Wochen und Monaten gehört, manchmal auch verwünscht!
Einige Möwen flogen kreischend um die Masten des Schiffes und Theresa hob gedankenverloren den Kopf. Wie gerne würde sie sich jetzt in einen Vogel verwandeln und einfach wieder zurückfliegen! Aber es gab kein Zurück. Sie hatte eingewilligt oder sich in endlosen Diskussionen überreden lassen, und nun war sie hier. An dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. „Oh Herr! Gib mir Kraft!“, betete sie inbrünstig.
„Mama, sieh die Vögel! Sie fliegen mit uns!“, erklang die begeisterte Stimme ihres Sohnes. Seine pummelige Hand streckte sich den Vögeln entgegen, als wollte er sie ergreifen.
„Oh, Thomas! Sie begleiten uns nur ein Stück, dann kehren sie um!“, erklärte sie voller Sehnsucht.
„Wirklich! Zu Großvater und Großmama?“
Sie schluckte die Tränen hinunter und presste ein mühsames „Ja“ heraus. Ihre Kehle war plötzlich wie zugeschnürt. Zitternd tastete sie nach der Hand des Kindes, suchte Trost und Halt ausgerechnet bei ihrem Sohn. Für ihn taten sie all dies. Damit er es einmal besser hatte!
„Stell dir nur vor, welche Zukunft er in Amerika haben wird! Es wird großartig!“, hatte ihr Mann versucht sie zu begeistern.
„Aber er hat doch auch hier ein sicheres Zuhause!“
„Sicher!“, hatte er gelästert. „Bei dir muss immer alles sicher sein und seine Ordnung haben! Fortschritt ist nicht sicher! Man muss Risiken eingehen, wenn man etwas erreichen will!“
Wie konnte sie, als Mutter, ein kaum dreijähriges Kind irgendeinem Risiko aussetzen?
Eine kräftige Hand umschlang ihre Hüften und eine dunkle Stimme jubelte voller Freude in ihr Ohr: „Resi, Resi, ist es nicht wunderbar! Oh, riechst du die Luft? Ich schmecke das Salz auf meiner Zunge! Komm, lass uns nach vorne gehen!“
Tränen schimmerten in ihren Augen, als sie ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes legte: „Oh Jonathan!“
„Komm Mädchen! Schau nicht zurück! Wir gehen nach Amerika, ins gelobte Land! Dort, wo uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen!“
„Ach du!“, wehrte sie ihn entrüstet ab, aber ein klein wenig fühlte sie sich besser. „Weißt du, ich dachte gerade an meine Eltern und unsere …“
„Wir werden Briefe schreiben!“, lachte er sorglos. „Wir sind doch nicht aus der Welt!“
„Ja, aber ich werde sie nie mehr wiedersehen!“
„Wie kannst du so etwas sagen? Wir werden so viel Geld verdienen, dass wir uns die Reise mehrmals leisten können! Stell dir vor, was deine Eltern sagen werden, wenn wir als reiche Leute heimkehren!“
„Meinst du?“
„Aber ja! Du hast doch die Anwerber gehört! In einem Land, in dem Milch und Honig fließen, werden auch wir unser Auskommen haben. Sonst würden ja nicht so viele Leute gehen!“
Unsicher blickte Theresa auf die Mitreisenden, aber alle schienen in Hochstimmung zu sein. War sie undankbar? Widerwillig ließ sie sich von der Hand ihres Mannes nach vorne ziehen, dorthin wo die Spitze des Schiffes nach Westen zeigte.
„Sieh nur“, flüsterte Jonathan. „Dort liegt unsere Zukunft!“
Es sprach so viel Glück und Zufriedenheit aus seiner Stimme, dass sie ihm nicht widersprechen wollte.
Sie hatte Glück gehabt, einen solch gut aussehenden Mann zu bekommen und so hütete sie sich davor, ihn zu verärgern. Sie war keine Schönheit. Sie war groß und kräftig, taugte zur Arbeit, aber wenigstens hatte sie Rundungen an den richtigen Stellen – jetzt, unter den vielen Lagen Kleidung, kaum noch zu erahnen. Ihr Gesicht war eher kantig, mit hohen Backenknochen und einem energischen Kinn. Nicht viele Männer hatten ihr den Hof gemacht und so war sie voller Zweifel, fast Ablehnung, gewesen, als Jonathan erschienen war. Doch er war geblieben, höflich und zielstrebig hatte er um ihre Hand angehalten. „Findest du mich denn schön?“, hatte sie geflüstert.
„Aber ja! Sieh nur, deine schöne gerade Nase und deine hübschen braunen Augen! Du wirst eine wunderbare Ehefrau für einen Schmied sein!“
Schmied! Die letzten Jahre waren hart gewesen. Voller Arbeit und Plackerei, aber sie hatte sich nicht beklagt. Ihr Glück war vollkommen gewesen, als Thomas geboren wurde. Ihr kleiner, zarter Engel. Damals hatte es angefangen! Jonathans Idee vom Auswandern. Jeden Taler ihres geringen Auskommens hatte er gespart und nun standen sie alle hier, an Bord der „Seabird“. Voller Begeisterung nahm Jonathan seinen Sohn Huckepack und zeigte auf die Möwen: „Wir sind so frei wie diese Vögel! Wir können fliegen!“
„Fliegen!“, jauchzte das Kind, als der Vater sich wie ein Verrückter im Kreis drehte.
Theresa schaute nach oben, wo in Schwindel erregender Höhe die Matrosen wie die Affen in den Masten kletterten und die Segel setzten. Sie blähten sich wie Bettwäsche auf der Leine, wenn der Wind die Laken trocknete, und sie blinzelte. Wann würde sie je wieder saubere Bettwäsche sehen? Mit Schaudern dachte sie an den dunklen Schiffsrumpf, der für die nächsten Wochen ihr Zuhause sein würde. Sie genoss die Augenblicke auf dem Deck, denn in Zukunft würde der Aufenthalt im Freien geregelt sein. Wie in einem Gefängnis!
„Meine Männer müssen arbeiten!“, hatte der Kapitän gesagt. „Da geht es nicht, dass ständig irgendjemand im Weg herumsteht!“
Sie fürchtete sich vor der Ansprache des Kapitäns, die für den späten Vormittag angesetzt war. Dabei war ihr der Mann nicht einmal unsympathisch. Ein hagerer, disziplinierter Mann mit sorgsam gestutztem Bart, der seine Mannschaft offensichtlich gut im Griff hatte. Aber mit der gleichen Strenge, mit der er seine Leute befehligte, richtete er seine Worte auch an die Passagiere.
„Ich gehe nach unten“, murmelte sie.
„Ja, geh nur, ich komme gleich!“, lachte Jonathan.
Sie nickte kurz und ging über den schwankenden Boden zurück zu der Luke, die zu ihrer Unterkunft führte. Sie raffte ihre Röcke und kletterte vorsichtig nach unten. Mit jeder Stufe wurde es heißer und stickiger. „Wie der Weg in die Hölle!“, dachte sie in einer plötzlichen Vorahnung, die ihr Herz zusammenkrampfen ließ. Sie murmelte schnell ein Gebet, dann hastete sie zu ihrer Unterkunft. Ein niedriger Raum, dunkel und stickig, den sie sich mit noch fünfzig anderen Reisenden teilen musste. Schmale Kojen standen an den Wänden ringsum, drei übereinander, mit denen der Raum eigentlich schon restlos überfüllt war, dennoch lagen auch in der Mitte noch Säcke, auf denen sich Menschen niedergelassen hatten. Sie drängte sich durch das Gewimmel, bis sie ihr Bett erreichte und mutlos darauf niedersank. Es war zu niedrig, um zu sitzen und so lag sie einfach da, musterte das Chaos, in dem sie nun leben sollte.
Mütter versuchten ihre aufgeregten Kinder zu beruhigen und Männer waren lauthals in heftige Diskussionen vertieft. Schon jetzt gab es Streit um die besten Plätze.
Theresa schloss einfach die Augen und versuchte das alles nicht mehr zu hören. Ihre Hand suchte nach der ledernen Truhe neben dem Bett, in der ihre Habseligkeiten untergebracht waren. Wäsche zum Wechseln, einige Andenken, das war alles, was von ihrem früheren Leben übrig geblieben war. Die Truhe war noch da und erleichtert atmete sie durch. Aber wer sollte hier etwas stehlen? Der einzige Reichtum befand sich in zwei Gürteln, die Jonathan und sie unter der Wäsche auf dem Leibe trugen. Geld, um in Amerika einen Neuanfang zu wagen. Sie döste ein wenig, erschöpft von den letzten Tagen, die sie mit Hunderten anderer Menschen im Auswandererhaus im Hafenviertel verbracht hatte.
„Mama!“, weckte sie die vorwurfsvolle Stimme ihres Sohnes.
Orientierungslos fuhr sie hoch, nur um sich gewaltig den Kopf anzustoßen. „Autsch!“, entfuhr es ihr. Ihr Sohn kicherte ausgelassen und sie tadelte ihn mit einem wütenden Blick. „Man lacht nicht, wenn jemand sich weh tut!“
Sofort verschwand das Lachen aus den blitzenden blauen Augen und schon taten ihr die Worte leid. Sanft streichelte sie durch die blonden Locken. „Ach, macht nichts. Es hat überhaupt nicht wehgetan!“
„Die Betten sind so klein!“, schimpfte Thomas.
„Ja, sehr klein!“
„Wo schlafe ich?“
„Na, hier bei mir“, bestimmte Theresa. Sie hatten nicht das Geld gehabt, um drei Kojen zu bezahlen.
„Und wo schläft Papa?“
„Über uns!“ Theresa deutete auf die Koje über ihrem Bett.
Schon stand Jonathan neben ihr und grinste breit. „Nein, ich schlafe ganz oben. Dieses Mädchen hier schläft in der Mitte. Sie heißt Cäcilie. Ihre Familie hat die Kojen neben uns.“
„Oh, herzlich willkommen“, begrüßte Theresa das vielleicht fünfzehnjährige Mädchen. „Ich heiße Theresa Bruckner! Wandert ihr auch nach Amerika aus?“
Höflich reichte ihr das Mädchen die Hand und machte einen Knicks. „Ja, wir haben einen Onkel in Ohio. Dort wollen wir erstmal hin.“
„Oh, es ist schön, dass ihr dort drüben jemanden kennt. Wir sind ganz allein!“
Das Mädchen sagte nichts mehr und Theresa blickte sich um. Irgendwie hatten es die Frauen geschafft, ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen. In der Mitte des Raumes blieb sogar ein wenig Platz frei, sodass man sich setzen konnte. Überall waren die Familien dabei, sich gegenseitig vorzustellen. Jonathan stand schon wieder mitten in der Menge und schwang großartige Reden. Sie lächelte über seinen Eifer, aber eben deswegen liebte sie ihn. Seine Abenteuerlust war geradezu ansteckend und sie hatte sich von seiner Phantasie und seinen Geschichten buchstäblich verführen lassen. Aber tatsächlich war es etwas anderes, in ihn verliebt zu sein, ihn wie ein kleines Mädchen anzuhimmeln, als nun mit ihm verheiratet zu sein und die Verantwortung für einen kleinen Jungen zu haben.
„Eigentlich habe ich jetzt zwei kleine Jungen!“, dachte sie ein wenig spöttisch, als ihr Mann so dastand, mit den Daumen unter den Hosenträgern, breit und groß, mit einigen Fransen seiner Stirnhaare, die ihm ins Gesicht fielen. Er warf sie immer mit einem Ruck nach hinten, wie ein wildes Pferd, das die Mähne schüttelt.
Eine schrille Pfeife ertönte und sie wusste bereits, dass dies die Aufforderung war, an Deck zu erscheinen. Zusammen mit den anderen bildete sie eine ordentliche Reihe, außerdem mischten sich einige junge Männer, die allein reisten, unter die Familien. Sie waren in einer anderen Kajüte untergebracht, um den Frauen wenigstens einen Rest an Intimität zu gewähren. Langsam kletterten alle an Deck und Theresa atmete die frische Luft ein. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie stickig und heiß es unter Deck war. Erwartungsvoll stellten sich alle auf, warteten auf die Worte, die der Kapitän sprechen würde. Einige Kinder sprangen aufgeregt umher, wurden jedoch sofort still, als der Kapitän auftauchte.
„Nun!“, hallte es überraschend laut über das Schiff. „Ich bin Kapitän Masterson! Ich befehlige dieses Schiff! Die Seabird wird Sie alle sicher nach Amerika bringen, so Gott will!“ Er machte eine künstlerische Pause und blickte ernst auf die versammelten Menschen. „Wir werden eine lange Zeit zusammen sein und deshalb ist es nötig, dass Sie alle gewisse Regeln einhalten. In erster Linie bin ich dafür verantwortlich, dass Sie alle gesund und munter Ihr Ziel erreichen. Deswegen werde ich mit aller Härte gegen jeden vorgehen, der sich nicht an die Regeln hält! Ist das klar?“
Wieder schweiften seine Augen über die versammelten Menschen und leises Murmeln antwortete ihm auf diese Frage. „Das Essen und das Wasser sind rationiert! Zum Waschen oder Saubermachen wird Meerwasser benutzt. Einmal am Tag wird mit Meerwasser geduscht. Männlein und Weiblein fein säuberlich voneinander getrennt. Ist das klar?“
Theresa blickte ungläubig auf den Kapitän. Wollte er ihnen etwa befehlen, wann sie zu baden hatten? Mit Meerwasser?
Ehe sie weiter darüber nachdenken konnte, fuhr der Kapitän in seiner Ansprache fort: „Jede Familie bekommt einen Eimer für ihre Notdurft. Dieser ist sofort zu entleeren und zu säubern! Der Waschtag für die Wäsche wird vorher angekündigt. Das hängt davon ab, ob wir gutes Wetter haben. Ausgenommen sind die Binden der Damen oder die Windeln der Säuglinge!“
Theresa wurde knallrot. Es war das erste Mal, dass ein Mann ein so unanständiges Wort überhaupt in den Mund nahm! Wie konnte er nur? Binden! Über so etwas redete man doch nicht!
Ungerührt sprach der Kapitän weiter: „Für alle gibt es täglich einen Spaziergang an Deck. Wer dazu imstande ist, sollte ihn nicht verpassen, denn er fördert die Gesundheit. Besonders Mütter mit Kindern sollten die Zeit nutzen, auch wenn es vielleicht windig oder kalt ist. Bald erreichen wir ohnehin wärmere Gewässer. Ansonsten möchte ich Sie bitten, die Routine der Mannschaft möglichst wenig zu stören. Das ist alles! Bitte gehen Sie nun wieder unter Deck. Der Koch wird in Kürze das Essen bringen. Jeder erhält für die Reise sein Geschirr, für das er dann selbst verantwortlich ist!“
„Wo sollen wir es denn waschen?“, wagte eine Frau zu fragen.
„Na, in dem Eimer! Da könnt ihr auch eure Wäsche waschen!“
Theresa drehte sich vor Ekel der Magen um. Ein und derselbe Eimer zum Waschen, Urinieren und Geschirrabwaschen? Herr im Himmel!
Aber es kam noch schlimmer. Ernüchtert kehrten die Passagiere in ihr Quartier zurück und blickten voller Entsetzen auf den Kessel, den ein Matrose lieblos auf den einzigen Tisch des Raumes knallte. In ihm schwamm eine undefinierbare Suppe aus allerlei Gemüse und Kartoffeln. Das war also das Mittagessen.
Theresa erkannte in diesem Augenblick, dass sie diesem Schiff auf Gedeih und Verderb ausgeliefert waren. Sie nahm Thomas an der Hand und stellte sich in die Reihe, um eine Kelle zu ergattern. Selbst ihr Mann war merkwürdig ruhig geworden und dachte vermutlich an das Geräucherte und Eingelegte, das es sonst immer zum Essen gegeben hatte.
Sie erhielten jeder einen Napf, einen Becher und Besteck, dann klatschte der Matrose eine Kelle der Brühe in ein Behältnis, von dem niemand sagen konnte, für was es sonst schon gebraucht worden war. Für die kleineren Kinder gab es tatsächlich einen Brei und so stellte sie sich an, um etwas für Thomas zu bekommen. „Ab morgen dürfen die Mütter in die Kombüse und selbst etwas für die Kinder kochen“, knurrte der Matrose. „Wasser gibt es an Deck!“
Schon war er verschwunden und hinterließ einige ratlose Menschen. „Gibt es diesen Fraß jetzt jeden Tag?“
„Wohlan! Mitgefangen, mitgehangen! Wir können ja schlecht wieder aussteigen!“, meinte ein älterer Mann.
Lustlos fischte Theresa einige Kartoffelstückchen aus der Suppe, denn ihr war der Appetit restlos vergangen.
Ihr Mann dagegen stopfte mit Heißhunger das Zeug in sich hinein, so als müsse er beweisen, dass alles seine Ordnung hat. „Schmeckt doch gut!“, brummte er mit vollem Mund.
Am Nachmittag durften die Frauen und Kinder wieder an Deck und still sah Theresa zu, wie Thomas mit einem kleinen Mädchen spielte. Die Mutter versuchte ein Gespräch mit ihr, aber Theresa gab einsilbige Antworten.
Schließlich entschuldigte sie sich für ihre Unhöflichkeit: „Ich bin ein wenig unpässlich! Hoffentlich vergeht es wieder!“
„Oh, das tut mir leid! Legen Sie sich doch hin! Ich passe gerne auf Ihren Thomas auf!“
„Nein, es geht schon! Die frische Luft tut mir gut!“
Mit diesen Worten stellte sie sich an die Reling und schaute in das Wasser, das unter ihnen hinwegglitt. Weit in der Ferne konnte sie noch die Küste erkennen und sie seufzte tief.
Das Schiff schaukelte sanft auf und ab und manchmal wehte ihr die Gischt ins Gesicht. Es graute ihr davor, wieder in das Verlies, wie sie es nannte, hinunterzusteigen.
Zum Abendessen gab es frisch gebackenes Brot mit Käse und erleichtert biss Theresa in die Schnitte. Die Stimmung stieg, als ein Mann seine Fidel hervorzog und musizierte. Bald klatschten alle den Rhythmus und die Kinder hüpften lachend im Kreis. Irgendwie war es doch schön!
Theresa wurde müde und bereitete sich für die Nacht vor. Sie band ihre komplizierte Flechtfrisur auf und bürstete ihr langes braunes Haar. Dann machte sie sich einen Zopf und setzte ihre Nachthaube auf. Thomas steckte bereits in seinem langen Hemd und wartete darauf, dass seine Mutter sich zu ihm legte. Jonathan hielt eine Decke als Sichtschutz vor seine Frau, damit sie sich ausziehen konnte.
Schnell entledigte sie sich der Röcke und Mieder und schlüpfte in ihr bequemes Nachtgewand. Nur den Gürtel mit dem Geld behielt sie am Körper. Über ihr knarrte es, als das Mädchen sich ruhelos hin und her warf. Theresa bekam Platzangst, schielte immer wieder ängstlich nach oben, ob die Betten wohl halten würden. Vielleicht sollte sie lieber mit ihrem Mann tauschen? Wie sollte sie hier nur schlafen? Steif lag sie in der engen Koje, in der kaum Platz für sie, geschweige denn für ihr Kind war! Wie sehr beneidete sie plötzlich die Frauen, die auf den Schlafsäcken am Boden schliefen. Vielleicht sollte sie auch mit jemandem tauschen?
Sie horchte auf die Geräusche, die zu ihr hinüberdrangen. Leises Geflüster, lautes Schnarchen, hier und da ein Husten, im hinteren Teil des Raumes brüllte ein Baby, das sich nicht beruhigen ließ. Hier würde es nie Ruhe geben! Hinzu kam die schwere, stickige Luft von den Ausdünstungen der Menschen. Warum konnte man keine der Fensterluken öffnen? Die einzige Luftzufuhr kam durch die Tür, die nun geschlossen war.
Sie kletterte aus der Koje und stellte sich an die winzige Luke, um einen Blick auf das Meer zu erhaschen. Stockfinstere Nacht schlug ihr entgegen, tiefe Schwärze, nicht einmal die Sterne spiegelten sich im Wasser, aber vielleicht war es auch bewölkt. Wie gern wäre sie jetzt an Deck gegangen und hätte einen tiefen Atemzug genommen. Aber es schickte sich nicht, nachts den Raum zu verlassen. „Die Matrosen sind wilde Gesellen!“, hatte ihr Mann sie gewarnt. „Du solltest sie meiden!“
Sie kicherte ein wenig, als sie sich vorstellte, dass sie vielleicht barfuß und mit Nachthemd bekleidet an Deck schlich. Allein der Gedanke war schon Sünde und so schlug sie sich erschrocken die Hand vor den Mund. Sie wollte in ihre Koje zurück, doch Thomas hatte sich quer gelegt, so dass nun überhaupt kein Platz mehr für sie war. Seufzend wickelte sie eine Decke um ihre Schultern und setzte sich in eine Ecke. Quer durch den Raum erkannte sie schemenhaft eine Frau, die ihr Baby an der Brust angelegt hatte, um es zu beruhigen. Das Saugen des Babys war deutlich über den Atemzügen der anderen zu hören und Theresa lächelte gerührt. Irgendwann döste sie ein, träumte von milchigweißen Flüssen und grünen Wiesen, auf denen ihre zukünftigen Kinder spielten.
Die nächsten Tage verliefen ereignislos, fast langweilig. Eine gewisse Routine spielte sich ein, als das Schiff langsam nach Süden fuhr und auf günstigen Wind wartete, um sie über den großen Teich zu segeln.
Morgens durften als Erstes die Frauen und Kinder zum Waschen auf Deck. Mit den stinkenden Eimern in der Hand kletterten die Frauen nach oben und leerten diese mit dem Wind über die Bordwand. Hinter großen Leinentüchern konnten sie sich schließlich waschen, abgeschirmt vor den begehrlichen Blicken der Matrosen. Nur der Ausguck des Schiffes war ein beliebter Arbeitsplatz, weil man von dort einen Blick auf die Frauen erhaschen konnte. Das Salzwasser trocknete die Haut aus, machte sie spröde und rau, doch der Kapitän gab nur jeweils einen kleinen Eimer mit Süßwasser für die Pflege der drei Babys. Die Mütter konnten es nicht lassen, wenigstens ihre Gesichter ein wenig mit dem lauwarmen Wasser zu waschen und ernteten sofort neidische Blicke der anderen Frauen. So ein Luxus!
Wehmütig schlüpften die Frauen wieder in ihre unbequeme Kleidung, schnürten sich gegenseitig die Mieder und kämmten sich sorgsam die Haare, nur um sie sofort unter irgendwelchen Hauben oder Kopftüchern verschwinden zu lassen. Dann durften sich die Männer und Junggesellen waschen, nun nicht mehr von Leinentüchern gegen Blicke geschützt. Oft wurde es eine ausgelassene Balgerei, die einzige Möglichkeit, am Tag etwas Dampf abzulassen. Anschließend saßen alle auf ihren Plätzen und warteten auf die erste Mahlzeit des Tages. Das Essen blieb gleichbleibend gut oder schlecht, je nach Ansicht. Man gewöhnte sich auch nicht daran!
Theresa ernährte sich ausschließlich von dem Brot mit Käse und ließ regelmäßig eine Mahlzeit aus. „Du wirst bald so dürr wie eine Bohnenstange sein!“, schimpfte ihr Mann.
„Ich esse nichts, wenn ich nicht weiß, was darin ist!“
„Du solltest froh sein, dass es überhaupt etwas gibt.“
Es wurde merklich wärmer und die Frauen schwitzten in ihrer warmen Kleidung. Sehnsüchtig sahen sie zu den Männern hinüber, die in ihren Hosen und einfachen Hemden wesentlich zweckmäßiger gekleidet waren als sie selbst in ihren langen Röcken. Unter Deck war es nicht zum Aushalten und sich Luft zufächelnd saßen die Frauen auf ihren Matratzen und sehnten den Deckspaziergang herbei.
Der Kapitän hatte schließlich ein Einsehen und dehnte die Stunden für die Passagiere aus. So herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, ein Gewirr aus Kindern und Frauen, Babys und Männern, die sich auf den Vorbauten und Kisten des Schiffes niederließen oder dazwischen Verstecken spielten. Der Kapitän übersah das Chaos mit ruhiger Gelassenheit. Er berechnete den Kurs, maß die Entfernung mit seinem Sextanten oder ließ sich die Geschwindigkeit von einem Maat zurufen. „Sieben Knoten!“, ertönte es über das Deck. Geschickt hielt der Kapitän das Schiff vor dem Wind, kreuzte immer wieder, bis sich die Segel blähten.
Erste Freundschaften entstanden, kurze Kontakte, denn alle wussten, dass sie sich nach ihrer Ankunft in alle Winde verstreuen würden. Trotzdem nutzten gerade die Männer die Möglichkeit, Informationen auszutauschen. Viele Weisheiten kamen nur vom Hörensagen, Märchen, die weitererzählt wurden, trotzdem schöpften alle Hoffnung aus ihnen.
„Wir gehen nach Oregon! Dort soll der Boden besonders fruchtbar sein!“, erzählte ein Mann aus dem Schwarzwald. Andere wollten nach Ohio, zum Missouri oder nach Chicago. Jeder erzählte etwas anderes und beim abendlichen Kartenspiel wurden die Träume immer großspuriger.
Die Gespräche der Frauen drehten sich um praktischere Dinge. Welches Gemüse könnten sie anpflanzen, wie waren die Jahreszeiten in dem neuen Land, würde es Schulen für die Kinder geben und gab es schon eine Kirche? Jonathan hatte eine Einladung von den Bewohnern von Julesburg erhalten, dort eine Schmiede zu gründen. Eigentlich war es eine Anzeige in der Zeitung gewesen, die er zufällig gelesen hatte. Er wusste nicht, wie viele darauf geantwortet hatten, aber er war der Einzige, der nun tatsächlich auf dem Weg dorthin war.
„So, ihr geht nach Julesburg!“, meinte Jonas Bergbauer, ein grobschlächtiger Mann mit breiten Schultern, die verrieten, dass auch er anpacken konnte.
„Ja, ich dachte, dass ich es mir mal anschaue!“, meinte Jonathan.
„Dort gibt es viele deutsche Familien! Ihr werdet euch dort sicher wohlfühlen. Gutes Farmland! Der Platte-Fluss bringt genügend Wasser.“
„Woher weißt du das?“, wunderte sich Jonathan.
„Ich habe einen Onkel dort!“
„Warum geht ihr dann nicht auch dorthin?“
„Ach, ich versuche mein Glück in Oregon! Aber bis Julesburg können wir zusammenbleiben! Der Bozeman Trail führt daran vorbei!“
„Der Bozeman Trail?“
„Ja! Das ist der Weg nach Oregon. Ein Herr Bozeman hat ihn entdeckt. Daher der Name.“
„Ich freue mich, wenn wir beisammen sind“, erklärte Jonathan offen.
Dann erreichten sie eine Inselkette und der Kapitän nahm ein letztes Mal vor der langen Reise frisches Wasser an Bord. Es war eine Abwechslung in der täglichen Routine und so standen die meisten Passagiere an Bord, als das kleine Beiboot zu Wasser gelassen wurde.
Einige junge Männer und Jungen nutzten den Aufenthalt, um zu schwimmen und neidisch schauten ihnen die Frauen zu. Schließlich zogen zwei unverheiratete Mädchen unter den Protest ihrer Eltern einfach ihre Nachthemden an und kletterten an der Strickleiter ins Wasser hinunter. Der Stoff blähte sich im Wasser auf und es sah aus, als wären zwei Schmetterlinge ins Meer gefallen. Unter dem Gelächter und Gejohle der Matrosen kletterten die beiden schließlich verlegen an Bord. Der Stoff klebte an ihrer Haut und offenbarte jede Kleinigkeit ihrer Rundungen bis ins Detail. Ihre besorgten Mütter wickelten sofort eine Decke um die Mädchen und brachten sie laut schimpfend aus der Sichtweite der lüsternen Augen. Der Kapitän schüttelte nur gutmütig den Kopf. Er wusste um die lange, langweilige Überfahrt und gestand allen gern diesen Übermut zu. Noch waren alle gesund und es versprach, eine gute Überfahrt zu werden.
In den nächsten Tagen glitt das Schiff zum ersten Mal nach Westen. Eine frische Brise erleichterte das Vorwärtskommen und alle waren frohen Mutes. Oft standen die Menschen an der Reling und schauten den Delfinen zu, die das Schiff übermütig begleiteten. „Sieh nur!“, kreischte Thomas. „Die Fische können fliegen!“
„Nein!“, korrigierte ihn Theresa. „Die Fische springen nur.“
„Lass ihn doch!“, meinte ihr Mann amüsiert. „Natürlich können die Fische fliegen! Sie fliegen immer weiter in die Sonne hinein!“
„Wirklich?“, staunte das Kind.
„Ja! Sie fliegen in die Sonne hinein und landen dann gebraten auf unserem Tisch!“
„Jetzt rede doch nicht solchen Unsinn! Du verwirrst das Kind ja völlig!“
„Aber nein! In Amerika gibt es überall fliegende Fische! Da brauche ich nur noch ein großes Netz, um sie zu fangen!“
„Oder die Schürze von der Mama!“, meinte Thomas mit glänzenden Augen.
„Ja, die Fische fliegen direkt in die Schürze und Mama muss sie dann nur noch in den Kochtopf werfen!“
Beide kicherten ausgelassen und selbst Theresa musste schmunzeln. Ihr Mann war wirklich ein lustiger Vogel!
Ein frischer, aber auch kräftiger Wind trieb das Schiff vorwärts und sofort wurden die ersten Passagiere seekrank. Auch Theresa kämpfte mit der Übelkeit und ein penetranter Gestank breitete sich im Zwischendeck aus.
Theresa lag in ihrer Koje und wünschte sich nur noch, dass das Schiff endlich stehen blieb. „Bitte, halt es an! Oh, mein Gott! Halt es doch an!“, flehte sie zum hundertsten Male. Doch erbarmungslos stürzte das Schiff den nächsten Wellenberg hinunter, nur um dann wieder emporgehoben zu werden. Unermüdlich, ständig, pausenlos und ohne Gnade für die Menschen, die mit dem Brechreiz zu kämpfen hatten. Oft wurde das Bettzeug beschmutzt und der saure Gestank haftete an den Menschen.
Dann wurde aus der frischen Brise ein Sturm. Ohne Warnung schlug das Wetter um und mit knapper Müh und Not rafften die Matrosen die Segel, sonst wären sie bei den Böen wohl zerrissen. Wie ein Ball auf dem Polofeld wurde das Schiff hin und her gestoßen. Immer höhere Wellenberge türmten sich auf und das Schiff wurde wie von einer riesigen Faust emporgetragen und wieder fallengelassen. Alles, was nicht irgendwie befestigt war, wurde kreuz und quer geschleudert, auch die Menschen. Hilflos klammerten sie sich an den Kojen oder an sonst irgendetwas fest, als das Schiff sich wie ein bockendes Pony hin und her warf.
„Wir werden alle ertrinken!“, kreischte eine Frau völlig hysterisch. Gepäckstücke flogen durch den Raum und ein Baby wurde der Mutter aus dem Arm gerissen und prallte mit voller Wucht gegen die Wand.
Verzweifelte Hände griffen nach dem Kind, aber ihm konnte nicht mehr geholfen werden. Die abgehackten Schreie der Mutter zeugten von dem entsetzlichen Leid, das hier geschehen war. Mit der nächsten Böe stürzte das Schiff nach vorne und ein riesiger Schwall Wasser ergoss sich in den Raum. Alle waren klatschnass und das Schreien der Menschen wurde zu einem flehenden Gebet, als viele sich in ihrer Verzweiflung an Gott wandten. Theresa hielt ihren Sohn im Arm und betete unablässig das Vaterunser. Wie in Trance murmelte sie die wohlbekannten Zeilen, ihre Lippen zitterten vor Angst. Thomas hatte aufgehört zu schreien und hatte sich wie ein Äffchen an seine Mutter geklammert. Vor ihrer Koje kniete Jonathan, bemüht seine Familie zu schützen, aber dieses Unwetter ging über seine Kraft. Immer wieder wurde er durch den Raum geschleudert, trug Blutergüsse und Schorfwunden davon.
Der Sturm dauerte die ganze Nacht, erst in der Morgendämmerung legte er sich so plötzlich, wie er gekommen war. Völlig erschöpft sanken die Menschen zusammen, schliefen dort ein, wo sie gerade lagen oder saßen.
Nur die Mutter hielt ihr totes Baby im Arm und schaukelte summend vor und zurück. Ihr Mann hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht seinen gebrochenen Arm, unfähig seine Frau irgendwie zu trösten. Niemand von der Mannschaft ließ sich blicken, nicht einmal der Arzt, denn dieser musste erst nach den Verletzungen der Matrosen sehen. Wer sich noch auf den Beinen halten konnte, wurde in den Kielraum des Schiffes geschickt, um das Wasser herauszupumpen. Wertvolle Ladung war zerstört worden und die Mannschaft rettete, was noch zu retten war. Schlimmer war der Verlust einiger Lebensmittel und der Kapitän ließ sofort eine Bestandsaufnahme machen. Zwei wertvolle Wasserfässer waren zerstört und einige Lagen von getrocknetem Fisch und Fleisch waren durchnässt worden.
„Wasser wird ab sofort rationiert und das Fleisch wird in den nächsten Tagen gegessen, ehe es verdirbt!“, ordnete der Kapitän an. Dann schickte er die Zimmerleute, um Reparaturen durchzuführen. Endlich erschien auch der Arzt im Zwischendeck und kümmerte sich um die Verletzungen der Passagiere.
Traurig senkte er den Kopf, als er den Körper des Babys mitnahm. Es war das erste Opfer auf dieser Reise und andere sollten noch folgen.
Der Kapitän hielt eine kurze Andacht, las ein wenig aus der Bibel und schloss mit dem Vaterunser, dann überließ er die Leiche des Babys der See. Die Andacht war entsetzlich kurz, fast kalt, so als wollte der Kapitän das Leid nicht an sich heranlassen.
Der kleine Körper platschte ins Wasser, wurde sofort unter Wasser gezogen, dann war er auf immer verschwunden. Wehklagend sank die Mutter in die Knie, verstand nicht, was hier so schnell geschehen war. Hysterisch schreiend verlangte sie ihr Baby zurück. „Nicht so, nicht so!“, rief sie die ganze Zeit.
Ihr Mann führte die schluchzende Frau unter Deck, doch auch dort konnte er sie nicht beruhigen. Tagelang heulte und weinte die Frau, so dass ein normales Leben unmöglich wurde. Ständig wurden alle mit ihrer Trauer konfrontiert und niemand fand Worte, um die Frau zu trösten.
Nach dem Unwetter versuchten die Passagiere, ihre Sachen wieder zu trocknen, doch die Nässe hatte sich in die Matratzen und Decken gesogen. Es roch nach Moder und Schimmel, vermischt mit dem sauren Gestank des Erbrochenen. Immer noch plagte viele die Seekrankheit, obwohl der Schiffsarzt sein Möglichstes tat, um zu helfen. Großzügig verteilte er Äpfel, die ohnehin faul zu werden drohten.
Der saure Geschmack half tatsächlich ein wenig und zumindest Theresa fühlte sich besser. Inzwischen gab es dreimal am Tag Fisch. Fisch, der nach Salzwasser stank und nach Salzwasser schmeckte. Aber niemand beschwerte sich, denn allen war klar, dass es anschließend kein Fleisch oder Fisch mehr geben würde.
„Was essen wir dann?“, fragte Jonathan den Koch.
„Nun, nicht alles ist verdorben! Wir haben noch einige Fässer mit Kraut. Und Mehl ist auch noch da. Außerdem können wir angeln!“
„Na, das ist ja wunderbar“, meinte Jonathan sarkastisch. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ein paar Fische für über hundert Leute reichen würden.
Wieder vergingen die Tage, trostlos und niederschmetternd. Von dem anfänglichen Enthusiasmus war nichts mehr geblieben, außer blanker Verzweiflung. Erste Fälle von Skorbut breiteten sich aus, obwohl der Koch vorbeugend Sauerkraut verteilte. Aber nicht jeder verstand den Sinn dieser Maßnahme und so weigerten sich viele, davon zu essen!
Die geschwächten Menschen kamen kaum noch aus ihren Kojen hoch und unweigerlich breiteten sich Krankheiten aus. Nur die Widerstandsfähigsten, wie Jonathan, versammelten sich noch an Deck und unterhielten sich aufgebracht über die Situation. Aber es war lediglich Ausdruck ihrer Hilflosigkeit, ein Dampfablassen, denn ändern konnten sie nichts. Wütend forderten sie eine Erklärung von dem Kapitän, wie er auf die Situation reagieren würde, und senkten betreten die Köpfe, als dieser unumwunden gestand, dass es keine Lösung und auch kein Zurück mehr gab. Hier half nur noch beten!
Besorgt kehrte Jonathan zu seiner Koje zurück, in der seit Tagen sein kleiner Sohn fieberte. Beten! Sein Sohn brauchte Medikamente oder einen kompetenten Arzt und nicht diesen unfähigen Quacksalber, der sich manchmal äußert widerwillig in die Quartiere der Passagiere verirrte.
Jonathan umklammerte seine Hosenträger, als suche er Halt bei ihnen, und blickte auf seinen Sohn, dessen kleines Gesicht glühte. Theresa kühlte ihm die Stirn mit einem Lappen und sah ihren Mann mit haselnussbraunen Augen an. „Sein Fieber ist so hoch!“
„Vielleicht hat er sich nur ein bisschen erkältet!“
Sie nickte erleichtert und wandte sich dann wieder dem Kind zu.
Aber das Fieber breitete sich aus. Bald lag mehr als die Hälfte aller Passagiere mit hohem Fieber und fleckigen Gesichtern darnieder. Beunruhigt beugte sich der Arzt über die Kranken und befürchtete eine Epidemie.
„Die Matrosen sollen die Passagiere meiden“, empfahl er dem Kapitän.
„So?“ Eine steile Falte zeigte sich im Gesicht des Kapitäns. „Ist es ernst?“
„Ich befürchte, es ist Typhus!“
Der Kapitän biss die Lippen aufeinander. Er wusste, was das bedeutete. Er hatte schon einmal fast die Hälfte aller Passagiere durch eine Epidemie verloren. „Und jetzt?“
Der Arzt zuckte die Schultern. „Wir können nur abwarten!“
Theresa saß die nächsten zwei Tage neben ihrem kleinen Sohn und hielt dessen heiße Hand. Sie war so klein, so zart, fast zerbrechlich. Die Haut des Kindes schien durchsichtig zu sein und die Brust hob und senkte sich unregelmäßig. Ihr war schlecht vor Angst, als sie immer wieder kühle Umschläge machte und versuchte, das Fieber zu senken.
„Mama? Fahren wir wieder zu Großvater und Großmama?“, hauchte der kleine Junge. Ihr zerbrach fast das Herz, als sie versuchte zu lächeln. „Wir wollen doch nach Amerika!“
„Dort, wo die Fische fliegen?“
„Ja, weißt du noch? Wir fangen die Fische und werfen sie in den Kochtopf!“
„Ich mag keine Fische mehr“, erklärte Thomas. „Ich will zu Großvater und Großmama!“
Müde schloss das Kind die Augen, die Lippen leicht geöffnet, als versuchte es, auf diese Weise seinen Körper zu kühlen. Theresa strich durch die verschwitzten Haare und versuchte sich selbst zu beruhigen.
„Kinder haben leicht hohes Fieber. Das vergeht bald wieder“, hatte der Arzt ihr versichert.
Sie döste ein wenig und träumte von der Zukunft in diesem neuen Land. Vielleicht konnte sie einen kleinen Gemüsegarten anlegen? Sie stellte sich vor, wie Jonathan in der neuen Schmiede arbeitete, und sie für das Abendessen eine Vase mit Blumen auf den Tisch stellte. Welche Blumen wuchsen dort eigentlich? Gab es in Amerika Rosen?
Der Atem des Kindes war schwer und holte sie wieder in die Wirklichkeit zurück. Eigentlich wusste sie nichts über dieses neue Land. Wie hatte sie sich nur zu so einem Abenteuer überreden lassen können?
Dann war auf einmal alles still. Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie die Wahrheit erkannte. Alles war so schnell gegangen, dass ihr keine Zeit geblieben war, sich darauf einzustellen oder es zu begreifen. Ihr kleiner Engel war tot.
Sie weinte nicht einmal, so sehr traf sie der Schock. Völlig apathisch saß sie neben dem Kind, so dass ihr Mann erst glaubte, dass sie ein wenig ausruhte, als er vom Deckspaziergang zurückkehrte. Das Kind lag so ruhig, so friedlich, als schliefe es. Doch dann erkannte Jonathan an den blicklosen Augen seiner Frau, dass etwas nicht stimmte. Hastig setzte er sich neben sie, tastete erschrocken nach der Brust des Kindes, doch dann erkannte auch er, dass Thomas zu Gott gegangen war.
Ein trockenes Schluchzen stieg in ihm hoch, eine entsetzliche Trauer, die ihn lähmte.
„Für Thomas gibt es keine Zukunft mehr“, sagte seine Frau tonlos, nicht einmal vorwurfsvoll.
„Oh Gott! Das habe ich nicht gewollt“, flüsterte Jonathan heiser.
„Nein! Das hat niemand gewollt! Aber es ist geschehen!“
„Oh Resi! Ich mache es wieder gut! Bitte! Ich mache es wieder gut!“ Heiße Tränen liefen über sein Gesicht und nun konnte auch Theresa nicht mehr an sich halten. Schluchzend brach sie zusammen, klammerte sich an ihren Mann, der ebenso hilflos dasaß und sie festhielt. „Es tut mir so leid! Es tut mir so leid“, stammelte Jonathan immer wieder.
Der kleine Junge zählte zu den ersten Opfern der Seuche, doch im Laufe des Tages starben noch weitere Passagiere an der heimtückischen Krankheit.
Fassungslos sahen die Hinterbliebenen zu, wie ihre Lieben in Leinen eingenäht und dann der See übergeben wurden. „Wir haben nicht einmal ein Grab für ihn, an dem wir ihn besuchen können“, schluchzte Theresa.
Der Typhus wütete unter den Menschen. Nach nur einer Woche waren zehn Kinder und dreiundzwanzig Erwachsene gestorben.
Cäcilie war plötzlich Vollwaise geworden, hilflos stand sie auf dem Schiffsdeck, als ihre gesamte Familie fast wie Abfall über Bord geworfen wurde. Traurig, aber betont sachlich wandte sich der Kapitän an das Mädchen: „Hast du noch Familie?“
„Ja, einen Onkel in Ohio!“
Der Kapitän war sichtlich erleichtert, denn es war offensichtlich, dass er nicht wusste, wie er mit dem Waisenmädchen umgehen sollte. „Gut, dann werde ich ihn benachrichtigen, damit du zu ihm kannst!“ Cäcilie nickte nur gehorsam mit dem Kopf, konnte das Geschehene überhaupt noch nicht begreifen. Aber auch andere Familien hatte die Krankheit getroffen. Bei Familie Bergbauer war ein Kind gestorben und die Trauer vereinte die beiden betroffenen Familien. „Ihr seid noch so jung! Ihr werdet bestimmt noch andere Kinder haben“, meinte Jonas voller Mitgefühl. Wenigstens waren ihm noch drei Kinder geblieben.
„Thomas war einzigartig, etwas Besonderes, genauso wie eure Vroni! Niemals kann ein anderes Kind diese Kinder ersetzen!“, meinte Theresa ernst. Dann schickte sie ihre Gedanken zu Gott: „Oh, Vater im Himmel, warum schickst du uns diese Krankheit? Haben wir gesündigt? Haben wir dein Missfallen erregt? Und warum nimmst du uns Thomas? Er war so unschuldig, so rein! Warum hast du nicht uns bestraft? Warum hast du ausgerechnet die Kinder zu dir gerufen?“
Doch der sonst so gnädige oder grausame Gott schwieg. Vielleicht waren die Menschen auf dem winzigen Schiff, das auf dem endlosen Meer hin und her geworfen wurde, einfach zu klein, sodass er ihre Gebete nicht erhörte.
Wakinyan-gleschka
(Nebraska, Winter 1864)
Wakinyan-gleschka lag in seinem Tipi und kämpfte gegen die bleierne Schwäche in seinen Gliedern. Sein ganzer Körper war mit nässenden Pusteln bedeckt, die langsam verschorften und hässliche Narben hinterließen. Seine Frau und seine beiden Kinder waren bereits an der Weißschorfkrankheit gestorben, aufgebahrt lagen sie auf den Totengerüsten neben all den anderen. Mehr als die Hälfte ihres Dorfes hatte die Krankheit dahingerafft und die wenigen Menschen, die noch stehen konnten, kamen kaum nach, die vielen Toten zu bestatten. Ein eisiger Wind pfiff um die Zelte und manchmal wollte Wakinyan-gleschka hinauslaufen und seinen heißen Körper im Schnee kühlen. Welchen Sinn hatte sein Leben jetzt noch? Warum nahm der Große Geist nicht auch sein Leben, führte ihn mit seiner Frau und seinen Kinder zusammen? Sie waren so schnell gestorben, kampflos und leise, hatten einfach zu atmen aufgehört. Wie viel musste sein Volk noch ertragen? War es nicht genug, dass die Waschitschu, diese seltsamen weißen Menschen, ihnen das Land nahmen? Mussten sie ihnen jetzt auch noch die Krankheiten schicken? Diese Weißen brachten nur Tod und Verderben! Sonst nichts!
Eine unbändige Wut erfüllte ihn, ein Hass, der ihn leben ließ, denn er wollte sein Volk rächen! Diese Weißen würden für jeden einzelnen Toten in seinem Dorf büßen! Er wusste nicht wirklich, wer alles gestorben war, aber es mussten viele sein. Wenn es ihm besser ging, dann würde er vorschriftsmäßig trauern, Abschied nehmen, um anschließend seine Kriegsfarben aufzutragen. Diese weiße Flut musste endgültig aufgehalten werden!
Warum hielten sie sich nicht an die Verträge und schickten weiterhin diese Siedler in ihr Land? Diese Menschen, die in Erdlöchern hausten, behaart wie Bären, sich vermehrten wie die Kaninchen und die Mutter Erde mit ihren Werkzeugen aufrissen. Die Weißen gehörten nicht hierher!
Dieses Land gehörte dem Wind, den Büffeln und den Mustangs. Es war wild und gefährlich, so wie die Klapperschlangen, die es beherbergte, aber die Weißen hatten keinen Respekt vor diesem Land und beugten es unter ihrem Pflug.
Mit zitternden Händeln, die deutlich seine Schwäche zeigten, warf er einen Ast in die glimmende Glut. Eine ältere Frau, die ihre gesamte Familie verloren hatte, versorgte ihn und suchte auf diese Weise Schutz und Hilfe bei ihm. Er war dankbar und beschloss, sich auch um sie zu kümmern, wenn es ihm besser ging. Sie mussten zusammenhalten, wenn sie überleben wollten. Diese alte Frau wäre keine Gefährtin für ihn, aber sie konnte seine Sachen flicken, kochen und Feuerholz holen, so wie eine Mutter. „Winuchtschala“, nannte er sie. „Alte Frau“. Es war weder respektlos, noch abwertend gemeint, sondern einfach eine Tatsache. Sie war eine alte Frau, eine „Winuchtschala“ und umgekehrt nannte sie ihn „Tschinktschi“, Sohn.
Am nächsten Morgen fühlte er sich zum ersten Mal kräftig genug, um zum Fluss zu gehen. Um sein Zelt herum zeugten gelbe gefrorene Flecken davon, wie oft er hier uriniert hatte, etwas, das ihn zutiefst beschämte, aber er hatte einfach nicht die Kraft gehabt, weiter weg zu gehen. Sein hagerer, ausgezehrter Körper zeugte von der schweren Krankheit und seine sonst so leuchtenden Augen waren blicklos und blass. Ungepflegte Haare hingen wie Zotteln über seine nackten Schultern, denn er trug nur einen Lendenschurz und hatte sich ansonsten in eine blaue Wolldecke gewickelt. Seine Füße steckten in schmucklosen, gefütterten Mokassins. Noch fühlte er sich zu schwach, um wirklich zu baden, aber er genoss das kalte Wasser auf seiner Haut und wusch sich gründlich den Schweiß ab. Das Fieber schüttelte ihn und so kehrte er schnell wieder in sein Tipi zurück. Dabei fiel sein Blick auf die Totengerüste, die überall wie Mahnmale schwankend im Wind standen. Unzählige! Überall in dem Tal verstreut, in dem sie ihr Winterlager aufgeschlagen hatten.
Wakinyan-gleschka kroch erschöpft in sein Tipi, dann kniete er bewegungslos vor dem glimmenden Feuer. Ohne Eile, wie abwesend, zog er sein Messer und begann seine Haare abzuschneiden. Die langen Zotteln fielen zu Boden und er ließ sie einfach liegen. Sein kantiges Gesicht mit der scharfen Nase sah aus wie der Kopf eines Raubvogels, mit hohen Backenknochen und einer flachen Stirn. Fiebrige dunkle Augen starrten ausdruckslos, wie die gebrochenen Augen eines erlegten Hirsches, in die Glut, dazwischen bildete sich eine steile, sorgenvolle Falte. Mit Holzkohle färbte er sein Gesicht schwarz, dann sank er in sich zusammen. Er weinte nicht, aber sein Herz fühlte sich an wie ein schwerer, kalter Felsen. Überall lagen noch die vertrauten Dinge seiner Familie: die Puppen seiner Tochter, der kleine Bogen seines Sohnes, die Kochutensilien seiner Frau. Es war keine Zeit gewesen, den Toten diese Dinge mitzugeben, aber er würde sie an die Totengestelle hängen, wenn er die Kraft dazu fand.
Zähneklappernd vor innerer Kälte rollte er sich unter dem warmen Büffelfell zusammen und döste eine Weile. Er hörte im Halbschlaf seine Familie lachen, obwohl er wusste, dass sie nicht mehr da war. Aber in seinen Träumen würde sie zu ihm kommen und das tröstete ihn.
Leise kletterte Winuchtschala in sein Tipi und stellte eine dampfende Schüssel mit Essen an sein Lager. Auch ihr Aussehen zeigte deutliche Anzeichen der Trauer: kurze graue Haare, Asche in ihrem faltigen Gesicht, Narben an den Armen, ein einfaches Trauerkleid.
Er schnupperte vorsichtig und fühlte zum ersten Mal wieder wirklichen Hunger. Dankbar richtete er sich auf, wickelte die Decke um seinen Körper und nahm das Essen langsam zu sich. Die alte Frau wartete höflich, bis er fertig war, dann verschwand sie mit der Schüssel. An dem Gestell neben dem Eingang hing eine Büffelblase mit frischem Wasser. Mit tiefen Zügen trank er das Wasser und fühlte sich etwas besser. Das Fieber war gesunken, nur seine Haut juckte entsetzlich. Er zerrieb getrockneten Salbei zwischen seinen Händen und rieb sich das Pulver auf die Wunden. Er hatte zumindest den Eindruck, dass es half!
Er verbrachte den ganzen Tag in seinem Tipi, gedankenlos dem Wind lauschend, der seine eigene Trauermelodie sang.
Eine völlige Gleichgültigkeit erfüllte ihn, eine tiefe Lähmung. Es interessierte ihn nicht einmal, wer die Krankheit überlebt hatte oder wer nicht. Als müsste er sich vor weiteren schlechten Nachrichten schützen, versank er im Nebel des Vergessens. Seine Familie, seine Verwandten, seine Freunde, all dies hatte keinerlei Bedeutung mehr für ihn! Er würde trauern, seine Gebete verrichten und dann in den Krieg ziehen! Diese Weißen würden seinen Kriegsschrei fürchten lernen!
Am nächsten Morgen fühlte er sich stark genug, um im Fluss zu baden und so tauchte er in das eisige Wasser. Die Kälte nahm ihm die Luft, als sich alles in ihm zusammenzog, aber er fühlte sich erfrischt und klar. Zwei andere Männer kamen zum Fluss und er erkannte Tschan-ihakab-naschin, Steht-hinter-dem-Baum, und Wambli-tokahe, Adler-der-führt. Wambli-tokahe schien gesund zu sein, obwohl er sichtlich angespannt wirkte. Seine dichten Augenbrauen zogen sich besorgt zusammen und eine steile Falte erschien zwischen seinen Augen, als er seine Freunde prüfend musterte.
„Hokahey!“, meinte er übertrieben lässig. „Wir wären im Moment eine leichte Beute für unsere Feinde!“
Die freundlich gemeinte Bemerkung entlockte Wakinyan-gleschka nicht einmal ein müdes Grinsen. Er fühlte weder Freude noch Dankbarkeit, dass seine Freunde noch lebten, sondern nahm lediglich zur Kenntnis, dass sie noch da waren. Er sah keinen Unterschied mehr zwischen Leben und Tod. Es war lediglich eine andere Form des Seins. Irgendwann würden alle auf den Geisterpfad gehen, die einen früher, die anderen etwas später. Das war alles.
Die Männer nickten sich zu und niemand befragte den anderen über die Toten. „Eine Schwitzhütte würde uns guttun!“, meinte Tschan-ihakab-naschin. Auch er sah geschwächt aus, seine pechschwarzen, glänzenden Haare waren stumpf und fransig. Sein sonst muskulöser Körper mit leichtem Bauchansatz wirkte erschreckend abgemagert und hager. Sein kantiges Gesicht wurde von einer breiten, gebogenen Nase unterstrichen und seine schmalen herabgezogenen Lippen vermittelten den Eindruck, als wäre er ständig verärgert. Mit einer flüchtigen Bewegung strich er seine langen Stirnhaare aus dem Gesicht und musterte seine Freunde prüfend. Erst jetzt war zu erkennen, dass er ein ausgeschossenes Auge hatte, dessen leere Augenhöhle sein Gesicht verunstaltete. Er hatte die Angewohnheit, seinen Kopf schief zu legen und alles mit dem verbliebenen Auge zu mustern, wie ein Adler, ehe er die Beute schlägt. Auffordernd nickte er mit dem Kopf und wartete auf eine Antwort.
„Waschté!“, stimmte Wambli-tokahe zu, obwohl seine Freunde reichlich mitgenommen aussahen. Aber eine Schwitzhütte war immer der erste, manchmal auch der letzte Schritt auf dem Weg der seelischen Heilung.
„Der heilige Mann ist tot!“, wandte Wakinyan-gleschka ein. Ihr Medizinmann war einer der ersten gewesen, der an der Weißschorfkrankheit gestorben war, vielleicht, weil er gleich mehrere dieser weichen Decken der Weißen in sein Tipi gebracht hatte.
„Dann bereiten wir die Schwitzhütte eben alleine vor.“
Alle nickten zustimmend und gingen zu der kleinen Hütte aus gebogenen Weiden, die in der Nähe des Flusses stand. Unberührt stand sie da, ein Gerüst aus geflochtenen Stämmen und Ästen, so niedrig, dass ein Mann nur sitzend hineinpasste.
„Ich hole Decken“, meinte Wakinyan-gleschka.
„Gut, und ich richte die Steine und das Feuer“, bot sich Tschanihakab-naschin an.
Wambli-tokahe lächelte ohne Freude. „Ich bitte Hiyu-iyanka, unser Feuerhüter zu sein!“
Alle nahmen regungslos zur Kenntnis, dass also auch Hiyu-iyanka, Kommt-angerannt, noch am Leben war. Die Weißschorfkrankheit hatte hauptsächlich unter den Alten, Frauen und Kindern gewütet!
Kunstvoll errichteten Tschan-ihakab-naschin und Hiyu-iyanka sieben Schritte von der Hütte entfernt eine Pyramide aus Holzscheiten und Steinen. Das Feuer brannte wie ein Scheiterhaufen und es dauerte fast den halben Tag, ehe die Steine die nötige Hitze für die Zeremonie hatten. Schweigend entblößten sich die Männer, dann hängten sie einige Bündel mit Tabak vor den Eingang und krochen in die Dunkelheit der winzigen Hütte. Sie sammelten sich um die Grube, in die nacheinander die glühenden Steine mit einem Geweih hineingerollt wurden. Ein angenehmer Geruch nach verbranntem Salbei und Süßgras stieg auf und leise stimmten die Männer das erste Gebet an. Die Zeremonie dauerte vier Runden, in denen immer wieder Steine hereingerollt und mit Wasser bespritzt wurden, damit sich heißer Dampf entwickelte. Mit einem Lied wurden die Geister eingeladen und eigentlich verlangte es die Sitte, dass man sich bei ihnen bedankte. Aber wofür sollten sie dankbar sein? Ihre Familien waren tot, ihr Stamm fast ausgelöscht, ihre Jagdgründe wurden von Fremden überrannt und die Büffel blieben aus!
Trotzdem dankte Wakinyan-gleschka den Geistern für die Stärke, durch die wenigstens er überlebt hatte. Dann bat er sie um Kraft, mit diesem Verlust fertigzuwerden. Er bat um Hilfe für seine Rache und flehte um Gnade, damit auch er einst in die Geisterwelt ziehen konnte.
Mit einem weiteren Lied dankten sie den Geistern, dann murmelten sie leise: „Mitakuye oyas‘in!“, denn alle waren miteinander verwandt. Die Tiere, die Pflanzen, die Steine, die Erde, das Wasser und der Mensch, nur die Weißen nicht!
Wakinyan-gleschka tauchte seinen erhitzten Körper in den Fluss und fühlte, wie alle Krankheit, alle Schwäche von ihm abfiel. Er ging in sein Tipi zurück und sammelte die Gegenstände seiner Familie ein, dann schritt er langsam zu den Totengerüsten, auf denen seine Liebsten aufgebahrt waren. Tränen sammelten sich in seinen Augen und jetzt ließ er sie ohne Hemmungen laufen. Bedächtig legte er die Kleinigkeiten zu seiner Frau und seinen Kindern, dann rief er nach seinem Lieblingshund. Vertrauensvoll kam er näher und legte sich winselnd zu seinen Füßen, froh darüber, dass sein Herr ihn endlich wieder bemerkte. Sanft streichelte er das treue Tier, dann nahm er sein Messer und tötete es mit einem sauberen Stich ins Herz.
Seiner Familie würde die Reise in die Geisterwelt leichter fallen, wenn etwas Vertrautes sie begleitete. Er wickelte die Decke enger um seinen Leib und verharrte in der Kälte, übernahm die Totenwache, zu der er vorher nicht fähig gewesen war. Mit heiserer Stimme sang er ein nicht enden wollendes Klagelied.
Erst bei Einbruch der Dunkelheit kehrte er in sein Zelt zurück. Es war warm und eine Schüssel mit Essen wartete bereits auf ihn. Dankbar schlang er den Eintopf hinunter, dann kroch er wieder unter seine Decken.
Die nächsten Tage vergingen in einem seltsamen Rhythmus aus Schlafen, Essen und Trauern. So, als würde es nichts anderes mehr geben. Die plötzliche Leere in seinem Tipi schmerzte und ihm fehlte der Grund zum Weiterleben. Ohne seine Familie war er nichts! Für wen sollte er nun jagen und kämpfen? Warum war er nicht ebenso gestorben und begleitete seine Familie in die Geisterwelt?
„Du bist noch jung“, versuchte ihn Winuchtschala zu ermuntern.
„So viele junge Frauen sind Witwen! Du solltest eine neue Familie gründen!“
„Wozu?“, sinnierte Wakinyan-gleschka tonlos.
„Damit unser Volk lebt!“
Der Krieger ließ nur traurig den Kopf hängen und winkte mutlos ab. Mit seinen Lippen wies er die alte Frau an, das Tipi zu verlassen und ihn in Ruhe zu lassen.
Sie waren weit im Süden ihrer Jagdgründe. Sein Häuptling Sinte-gleschka versuchte Frieden mit den weißen Einwanderern zu halten, aber einige Dogsoldiers der Cheyenne versuchten verzweifelt die weiße Flut aufzuhalten. Die Situation war angespannt. Überall im Tal des Pankeska-Wakpa, des Platte-Flusses, entstanden unrechtmäßig weiße Siedlungen und im Frühjahr riss der Strom der Planwagen, die ihr Land durchkreuzten, nicht mehr ab. Anfangs hatte Sinte-gleschka sich noch mit dem Tauschhandel einen Vorteil versprochen, inzwischen jedoch sah er bereits in dem bloßen Kontakt mit den Weißen eine Gefahr. Während andere Dörfer gern ihre Lager in der Nähe der weißen Forts aufschlugen und dort von den Almosen der Weißen lebten, wich Sinte-gleschka ihnen lieber aus und jagte auf die alte Weise den Büffel. Wie recht er damit hatte! Wakinyan-gleschka schloss die Augen und hing seinen Gedanken nach. Die Weißen brachten nur Tod und Verderben in ihre Dörfer!
Verstummt war das Gelächter der Frauen und Kinder, verhallt der Klang der Trommel, erloschen die Wärme der Feuer. Alles erschien wie gelähmt, erstarrt in der klirrenden Kälte des Winters und in den trauernden Seelen der Überlebenden. „Tunkáschila! Omakiya-yo“, flehte er leise um den Beistand seines Schöpfers.
Leises, unterdrücktes Hufgetrappel erklang, als eine Gruppe Cheyennekrieger in ihr Lager ritt. Wakinyan-gleschka horchte kaum interessiert auf, aber dann raffte er sich doch auf, um ins Ratszelt zu gehen. Teilnahmslos saß er zwischen den anderen, ließ müde seinen Blick über die Versammlung schweifen. Sinte-gleschka lebte noch und Pawnee-Killer, ein weiterer Kriegshäuptling, aber er erkannte auch andere Gesichter, gezeichnet von der schweren Krankheit. Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf die Cheyennekrieger, die höflich darauf warteten, dass das Wort an sie gerichtet wurde. Sie schienen keine guten Nachrichten zu bringen. Ihre Gesichter waren düster, verbissen und von unsagbarer Traurigkeit erfüllt.
Sinte-gleschkas freundliche Augen richteten sich auf die Ankömmlinge. Seine gescheitelten Haare hingen lose über die Schulter, als Zeichen seiner Trauer, und seine sonst so vollen Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammengekniffen, als er das Schlimmste befürchtete. „Seid uns willkommen! Doch eure Herzen sind schwer! Was ist der Grund eurer Trauer?“
Einer der Krieger stand auf und suchte mit steinernem Gesicht nach Worten. Nur zögernd kamen sie aus seinem Mund, als würde ihm jede Silbe erneut Schmerzen zufügen. „Schreckliches ist passiert! Hört meine Worte und fällt euer eigenes Urteil! Dann könnt ihr über unsere Bitte beratschlagen!“
Sinte-gleschka nickte nur und setzte sich abwartend auf seinen Platz.
„Ich bin aus dem Dorf von War Bonnet! Unsere Dörfer standen am Sand Creek, zusammen mit den Dörfern von White Antelope, Lone Bear, Left Hand und Black Kettle. Wir lagerten dort unter der Fahne des Friedens, die uns die weißen Soldaten gegeben hatten!“ Er spuckte verächtlich auf den Boden und blickte anklagend in die Runde. „Vor wenigen Tagen wurden wir im Morgengrauen angegriffen. Ohne Vorwarnung! Ohne Provokation! Unter der Fahne des Friedens!“
Ein entsetztes Raunen ging durch die Versammlung, doch der Krieger bat um Ruhe. „Jetzt ist keine Zeit zum Trauern. Wir wollen Rache! Die Soldaten haben angegriffen und ohne Gnade jeden getötet. Gleichgültig ob Mann, Frau oder Kind! Selbst Frauen, die sich ergeben wollten, haben sie abgeschlachtet! Die wenigen, die fliehen konnten, sind nun am Smoky Hill Fluss. Ohne Kleidung, Nahrung und Tipis.“
„Warum töten die Soldaten wehrlose Frauen und Kinder?“
„Sie haben Schlimmeres getan! Ich habe die Toten gesehen. Geschändete Frauen, denen man die Leiber aufgeschnitten hatte. Frauen, die mit ihren Kindern im Arm abgeknallt worden waren. Das war kein Kampf! Niemals werde ich diesen Anblick vergessen. Im Kampf werde ich mich daran erinnern und Kraft daraus schöpfen. Ich werde den Weißen das Gleiche antun. Das sind keine Menschen. Das sind nur böse Geister, die man bekämpfen muss!“
„Aho“, murmelten die anderen schockiert und senkten betreten den Blick. Unverhohlener Hass sprach aus der Stimme des Cheyennekriegers und jeder konnte seine Gefühle verstehen.
Mit fester Stimme fuhr dieser fort: „Ich bringe die heilige Pfeife! Wollt ihr sie mit mir rauchen und uns bei unserem Kampf unterstützen? Wollt ihr uns helfen, die Frauen und Kinder zu rächen?“
Erregtes Gemurmel war zu hören und herausfordernd blickte der Krieger auf die Häuptlinge: „Beratet euch und lasst mich eure Entscheidung wissen!“ Mit diesen Worten verließ er mit den anderen Cheyennekriegern das Tipi.
Wakinyan-gleschka sah ihm lange nach, dann wandte er sich der hitzigen Diskussion zu, die im Gange war. Sein Freund Tschanihakab-naschin zischte vor Zorn: „Erst sterben wir an Krankheiten und dann kommen die Soldaten und töten den Rest von uns! Black Kettle wollte den Frieden, das weiß jeder hier, und doch schützte das sein Dorf schlecht! Mit den Weißen kann man keinen Frieden schließen! Wir müssen sie vertreiben!“
„Aho“, brummten viele zustimmend.
Dann stand Pawnee-Killer auf. „Du hast recht! Wie oft haben wir schon versucht, in Frieden mit ihnen zu leben! Ebenso wie Black Kettle. Wir sollten diesen Feiglingen zeigen, was es heißt, ein Cheyennedorf anzugreifen. Die Weißen sind schwach! Sie haben hier nur wenige Forts. Wir werden deren Dörfer angreifen! Deren Frauen und Kinder töten und deren Häuser verbrennen!“
Alle schrien ihre Zustimmung und nur mit Mühe konnte Sintegleschka die Männer wieder beruhigen: „Aber auch unsere Dörfer müssen mit der Vergeltung der Soldaten rechnen, wenn wir auf Kriegszug gehen! Das dürft ihr nicht vergessen!“
Kurzes Schweigen folgte nach diesen bedächtigen Worten, doch die Wut in den Herzen der Menschen war größer als die Vernunft. „Wir folgen den Cheyenne! Wir sind stark und werden unsere Dörfer schützen!“, meinte Pawnee-Killer zuversichtlich. „Wenn wir uns einig sind, dann treiben wir die Weißen zurück!“
„Hokahey!“, stimmten ihm die anderen mit dem alten Schlachtruf der Lakota zu.
Der Krieg war nicht mehr aufzuhalten, zu tief saß der Hass in den Menschen. Die Pfeife wurde geraucht und ein großer Trupp Krieger brach auf, um die Toten der Cheyenne zu rächen.
Einige Krieger jedoch machten sich auf den Weg nach Süden, um den Cheyenne zu helfen, ihre Verwandten zu beerdigen. Auch Wakinyan-gleschka schloss sich ihnen an, denn er wollte Kraft für den bevorstehenden Kampf sammeln. Einige Tage auf seinem Pony würden ihn stählen und die letzte Schwäche der Krankheit vertreiben.
Es war ein stiller Zug, der zum Sand Creek zog. Keiner wusste, was sie erwarten würde, und so hingen die Männer ihren Gedanken nach. Immer mehr Menschen schlossen sich ihnen an, bis sie schließlich das Schlachtfeld erreichten. Es hatte geschneit und eine weiße Decke verhüllte gnädig die Überreste der getöteten Frauen, Kinder und Männer.
Klagend gingen die Frauen über das Schlachtfeld und wischten den Schnee von den Gesichtern der Toten, um nach ihren Verwandten zu suchen. Unfassbares eröffnete sich vor ihnen und vor Entsetzen schlugen die Frauen die Hände vor den Mund. Die Gesichter der Männer wurden zu Stein, als sie erkanten, was die Soldaten den Toten angetan hatten. Jeder Einzelne war skalpiert worden, selbst Kleinkinder, und ihre Gesichtszüge waren so verzerrt, dass man sie fast nicht mehr wiedererkannte.
Frauen lagen mit entblößtem Unterleib im Schnee, mit durchschnittenen Kehlen, nachdem man sie missbraucht hatte, manchmal ihrer Geschlechtsteile beraubt. Wakinyan-gleschka musste sich unkontrolliert übergeben, als er den eingetretenen Kopf eines Säuglings sah. Seine Knie wurden weich und hilflos sank er in den Schnee. Daneben lag die Leiche einer Frau, der man das Ungeborene aus dem Leib geschnitten hatte. Was waren das für Menschen, die solche Grausamkeiten verübten? Hilflos blickte er auf die klagenden Menschen, sah den Schmerz, den es ihnen bereitete, ihre Familienangehörigen auf diese Weise verstümmelt zu sehen. Wieder stieg der Hass in ihm hoch, der Wunsch zu töten, zu zerstören, jemand anderem weh zu tun!
Er nahm die Decke seines Pferdes, legte den toten Säugling auf den Bauch seiner Mutter und wickelte die beiden vorsichtig darin ein. Er konnte diesen Anblick einfach nicht mehr ertragen. In einem halb eingestürzten Zelt stieß er auf drei Kinder, die sich in Todesangst aneinander geklammert hatten. Sie waren erbarmungslos erschossen und ebenfalls skalpiert worden. Ihre Hände waren so in Todesstarre ineinander verkrampft, dass es nicht möglich war, sie zu lösen. So bestatteten sie die Kinder auf einem Totengerüst, ließen sie gemeinsam den Weg in die Geisterwelt beschreiten.
Es dauerte mehrere Tage, alle Toten zu bestatten, und dies lenkte Wakinyan-gleschka von seiner eigenen Trauer ab. Er half die Bäume für die Gerüste zu fällen und hob die Leichen auf die Plattform. Die eingewickelten Körper waren so leicht! Kinder! Kinder, die spielen wollten, und deren Leben auf so brutale Weise ausgelöscht worden war.
Mit zusammengekniffenen Augen blickte er auf die Totengerüste, die nun ein weiteres Tal bevölkerten. Wie er diesen Anblick satt hatte! Er war bereit zu kämpfen. Und er war bereit zu sterben.
Mit einem Trupp Krieger machte er sich auf, das Tal des Pankeska-Wakpa von den Weißen zu befreien.