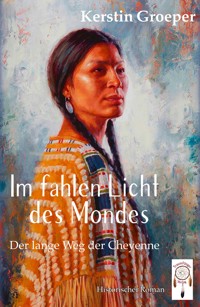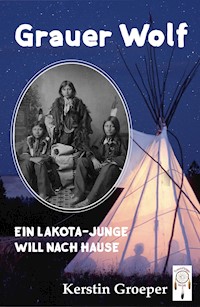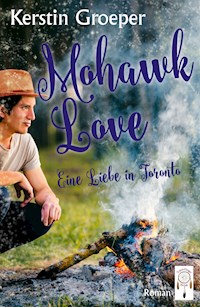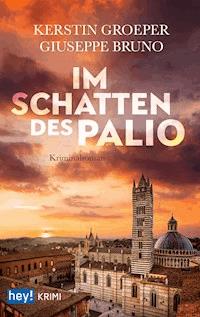4,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Black Hills um 1790. Tanzt-im-Feuer, ein junger Lakota-Krieger trifft bei einem Erkundungsritt auf ein feindliches Mädchen. Aus Sorge, sie könnte ihr Dorf warnen, schießt sein Bruder einen Pfeil auf die Flüchtende und nur im letzten Moment kann Tanzt-im-Feuer verhindern, dass sein Bruder das Mädchen mit seiner Keule erschlägt. Sie bleibt verletzt zurück und den ganzen Winter über wird Tanzt-im-Feuer in seinen Träumen von der Erinnerung an ihre entsetzten Augen verfolgt. Als sein ungestümer Bruder ihm ausgerechnet dieses Mädchen nach einem Raubzug zum Geschenk macht, ist Tanzt-im-Feuer verwirrt und beschließt, die Gefangene zu ihrem Volk zurückzubringen. Dies erweist sich als schwieriger und gefahrvoller als gedacht. Als er schwer verletzt wird, sucht er den Schutz der Geister, und fleht am Bear Butte um spirituellen Beistand. Fortan wird die Vision der Bärin sein Leben bestimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für meine Mutter
Wie ein Funke im Feuer
Eine Lakota und Cheyenne Odyssee
Historischer RomanvonKerstin Groeper
Impressum
Wie ein Funke im Feuer, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2012
1. Auflage eBook Februar 2022
eBook ISBN 978-3-948878-26-9
Lektorat: Ilona Rehfeldt
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: James Ayers
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG, Hohenthann
Inhalt
Che sapa (Black Hills um 1780)
Cheyenne-Winter
Tsistsistas
Ménonéhné
Taischeé
Inyan
Wolakota
Kornblume
Mni-Luzahe
Thoka
Wi-Wamblee-win
Machaju
Makita
Mato-Paha
Olepi
Nemo‘ehe
Hanbletschiya
Kizapi
Kupi
Tschannapopa wi
Peji to wi
Skidi
Wiyaka-lowan
Waniyetu
Mato-Paha
Mahto-tanka
Siksika
Peta-el-waji
Historische Anmerkung und Danksagung
Die Black Hills gehören uns.Wenn die Weißen versuchen, sie uns wegzunehmen,werde ich kämpfen.
Sitting Bull
Che sapa
(Black Hills um 1780)
Tanzt-im-Feuer atmete tief die würzige Luft ein, die nach Pinien roch und einen leichten Geschmack von Harz auf seiner Zunge hinterließ. Gleichzeitig bewunderte er die unberührte Schönheit des Tales, das sich vor ihm öffnete, und dessen Anblick ihn mit tiefer Ehrfurcht erfüllte.
Ein schmaler, schnell fließender Bach schlängelte sich durch die Lichtung, die ansonsten von hohen Pinien und sanften Hügeln gesäumt war. Die letzten Blätter der Espen, die sich zwischen die dunklen Pinien geschummelt hatten, leuchteten in einem satten Goldton, reflektierten die Strahlen der Sonne, die zu dieser späten Jahreszeit bereits an Kraft verloren hatten. An den Zweigen und Blättern glitzerten Eiskristalle, sodass Tanzt-im-Feuer seine Augen ein wenig zusammenkniff, um nicht geblendet zu werden. Der erste Raureif hatte sich über die silbergrauen Halme des hohen Grases gelegt, noch nicht als wärmende Decke, sondern lediglich wie ein feiner Schleier, der die Welt verzauberte.
„Hier wäre ein schöner Platz für unser Winterlager!“, hörte er die andächtige Stimme seines Bruders.
„Ja!“ Tanzt-im-Feuer seufzte aus tiefstem Herzen und dieses Seufzen drückte ihr ganzes Dilemma aus:
Endlos waren die Menschen seines Volkes nach Süden gewandert, immer weiter fort aus ihren Jagdgründen, in denen sie von Feinden überrannt worden waren. Mit seltsamen Waffen, aus denen Blitz und Donner kamen, waren Ojibwe und Cree über sie hergefallen und hatten ihre Dörfer zerstört. Sein Vater war jung gewesen, als sie bis zum großen Fluss vorgestoßen waren, doch auch dort warteten weitere Feinde auf sie: Palani, Omaha, Arikara oder Miwatani, nirgends waren sie sicher, stets mussten sie auf der Hut vor weiteren Angriffen sein.
Ihre Gruppe hatte daher beschlossen, den großen Fluss zu überqueren und dort nach neuen Jagdgründen zu suchen. Doch die endlose Prärie, die sich vor ihnen auftat, war fremd, der Boden ungeeignet für Ackerbau, außerdem fehlte es an Holz, um wie gewohnt ihre Dörfer zu errichten. Stattdessen trafen sie auf Tiere mit riesigen Hufen und schweren Köpfen, die drohend ihre Hörner gegen jeden richteten, der ihnen zu nahe kam. Es dauerte lange, bis sich die Mutigsten unter ihnen wagten, diese urzeitlichen Kolosse zu jagen. Tatanka hießen sie seitdem, die Wesen mit den großen Hufen! Einige Älteste erinnerten sich daran, dass es diese Tiere auch östlich des großen Flusses gegeben hatte, aber dort waren sie längst verschwunden. Ihr Volk nannte sich fortan „Oglala“, die sich selbst zerstreuen, weil sie als erste diesen neuen Weg gegangen waren. Inzwischen hatten sie sich diesem Leben ganz gut angepasst, fanden Freude darin, ihr Dorf nach Belieben zu verlegen und waren stolz auf den Jagderfolg, der ihr Überleben auch in den schweren Zeiten des Winters sicherte.
Tanzt-im-Feuer ließ die Herbststimmung auf sich wirken und genoss den Frieden, der sich mit der rötlichen Abenddämmerung über das Tal legte. Frieden! Seit sie den großen Fluss überschritten hatten, waren sie kaum noch auf feindliche Stämme gestoßen. Hier waren höchstens kleinere Jagdgruppen unterwegs, die keine ernstzunehmende Bedrohung darstellten. Ganz im Gegenteil! Die jungen Krieger machten sich einen Spaß daraus, ihren Feinden die Pferde zu stehlen!
Das Land lag brach vor ihnen, nur bewohnt von Kojoten, Klapperschlangen und ihren neuen Brüdern, dem Büffelvolk. Anstelle von rindenbedeckten Häusern lebten sie nun in Hütten, die mit Büffelhäuten bedeckt waren, einige waren sogar dazu übergegangen sich Zelte zu nähen, indem sie mehrere Felle zusammennähten und über lange Stangen zogen. Tanzt-im-Feuer fand das ganz praktisch, denn so ein Zelt konnte über lange Strecken transportiert und an dem neuen Lagerplatz wieder aufgebaut werden, selbst wenn es dort kein Holz gab. Tipi, hieß dieses neuartige Ding, übersetzt bedeutete es: sie leben darin. Es bot auf jeden Fall mehr Platz als die zugigen Weidenhütten, die sie sich sonst bauten.
Auf ihrer langen Wanderschaft nach Westen, immer den Herden der Büffel nach, waren sie im Sommer durch Gegenden gekommen, die selbst für Tiere unbewohnbar waren. Mako-schitsche nannten sie dieses Gebiet, das schlechte Land. Umso mehr hatten sie gestaunt, als sich vor ihnen plötzlich eine lang gezogene Bergkette erhoben hatte, dessen bewaldete Hänge ihnen Schutz und Nahrung versprachen. Bei den ersten Erkundungsritten entdeckten sie eine Vielfalt an Tieren und Pflanzen, die den Oglala als wahrer Überfluss erscheinen musste. Das Herz der Welt nannten sie die schwarzen Berge und allen war klar, dass hier der Ursprung allen Lebens sein musste. Diese Berge waren „wakan“, etwas Heiliges! Hier würden sie jagen und leben, unter dem Wohlwollen der Geister, die diesen Ort beschützten.
Die beiden Krieger hockten wie Statuen auf ihren Pferden, locker und entspannt, nur die Ohren der Pferde bewegten sich neugierig hin und her, als erforschten auch sie die neue Umgebung. Beide Männer trugen lange Wildlederhemden ohne jede Verzierung, an deren Schnitt noch die ursprüngliche Form der Tierhaut zu erkennen war. Dort, wo sonst die Beine des Tieres waren, verlängerte sich das Hemd nach unten und schlug locker um die Schenkel der Männer. Es überdeckte auf diese Weise den schmalen Gürtel, an dem die fransenbesetzten Leggins befestigt waren. Selbst der Lendenschurz, der zwischen den Beinen durchgezogen wurde, um die Lenden zu verdecken, war aus weich gegerbtem Leder, nun durch das lange Reiten abgewetzt und schmierig. An ihren Füßen trugen die Männer einfache Mokassins, ebenfalls ohne Verzierung. Beide Männer hatten das Haar offen, nur am Hinterkopf zu einem schmalen Zopf geflochten, in dem zwei Adlerfedern steckten, Zeichen dafür, dass sie Kundschafter waren.
Man erkannte auf den ersten Blick, dass es sich um Brüder handelte, so ähnlich waren sie sich. Der Jüngere hatte einen etwas verwegeneren Gesichtsausdruck, gerne kniff er die rechte Wange ein wenig zusammen, sodass sich sein Gesicht verschob, als ärgere er sich ständig über etwas. Der Ältere hatte ebenmäßige Gesichtszüge, eine gerade Nase und ruhige Augen. Er schien wesentlich ausgeglichener zu sein als sein jüngerer Bruder. Im Körperbau war er etwas kräftiger, hatte nicht mehr die schlaksige Gewandtheit des Jugendlichen, sondern die Spannkraft und Ausdauer eines erfahrenen Kriegers. Er zählte bestimmt schon zwanzig und fünf Winter, während sein Bruder höchstens zehn und acht Winter zählte. Ihre Ausrüstung bestand aus einigen Bündeln, die an dem indianischen Sattel befestigt waren, außerdem verwendeten die beiden schwere Büffelfelle als Satteldecken, die sie in der Nacht als Schlafdecken benutzen konnten oder zur Not als Regenumhänge.
Tanzt-im-Feuer folgte seinem Bruder, der die Initiative übernahm und seinem Pony ungeduldig die Fersen in den Bauch stieß. Sein Pony trottete dahin, suchte sich mit vorsichtigen Schritten einen sicheren Weg durch das knirschende Gras. Tanzt-im-Feuer ließ seine Blicke über das Tal schweifen, achtete kaum auf den Weg vor sich und genoss die letzten Strahlen der untergehenden Sonne auf seinem Gesicht.
„Wakta-yo!“ Pass auf!
Tanzt-im-Feuer war so in seinen Gedanken versunken gewesen, dass ihn der Warnruf seines Bruders wie ein Schock traf. Sein Blut zirkulierte schneller in den Adern und all seine Sinne waren plötzlich hellwach. Er folgte mit den Augen der Bewegung der Hand, die auf eine Spur in dem sonst unberührten Gras zeigte. Die Fußabdrücke eines Menschen! Mit einer fließenden Bewegung glitt er vom Pferd, um für einen möglichen Feind kein allzu leichtes Ziel zu bieten, während sein Bruder bereits den Bogen aus seinem Köcher riss.
Sie ließen ihre struppigen Pferde an Ort und Stelle zurück und folgten den deutlichen Fußabdrücken. Wachsam musterten sie die Umgebung, suchten nach irgendwelchen Anzeichen für die Anwesenheit von Menschen.
„Kein Rauch!“, signalisierte sein Bruder mit den Händen und Tanzt-im-Feuer nickte kurz. Also war ein feindliches Dorf nicht in Sichtweite zu vermuten. Sein Bruder bückte sich und untersuchte die Spur genau. Er tastete nach Rändern und versuchte abzuschätzen, wie groß die Person wohl war, die eine solche Spur hinterlassen hatte, und wie lange es her war, dass sie hier entlang gekommen war. Tanzt-im-Feuer schmunzelte über den Eifer seines Bruders. Seit ihm bei seinem letzten Erkundungsritt das Pferd weggelaufen war, versuchte er vergeblich diese Scharte in seinem Selbstbewusstsein wieder auszuwetzen. Auch, weil alle Leute immer noch lachten und ihn prompt mit einem neuen Namen versehen haben: Taschunka-ayuchtata, „der sein Pferd verliert“! Was für eine Blamage! Pferde waren kostbar, es gab immer noch Familien, die nicht einmal genug Pferde hatten, um ihren Hausrat zu transportieren und dazu ihre Hunde benutzten oder die Frauen mussten selbst ihre schweren Bündel schleppen. Ein Pferd durch Unachtsamkeit zu verlieren, war eine Schande ohnegleichen. Taschunka-ayuchtata hatte zähneknirschend das großzügige Angebot seines Bruders angenommen, ein Pferd von ihm zu reiten, und ansonsten geschworen, diese Schande durch großartige Taten auszumerzen. Tatsächlich wäre es eine größere Strafe gewesen, ihn zu Fuß laufen zu lassen, aber Taschunka-ayuchtata war ein hervorragender Späher und Tanzt-im-Feuer liebte seinen jüngeren Bruder. Mit ihm durch die unbekannte Bergwelt zu reiten war schön und er konnte sich auf ihn verlassen. Noch einmal würde seinem Bruder kein Pferd mehr davonlaufen und auch nachts würde er sich keine Blöße mehr geben und während der Wache einnicken. Allen jungen Männern passierte so ein Missgeschick höchstens einmal!
„Junger Mann oder Frau! Spur ist frisch“, signalisierten die Hände seines Bruders und alarmiert horchte Tanzt-im-Feuer auf. Der Fremde war also noch in der Nähe! Im lockeren Dauerlauf folgten sie der Spur, nun höchst wachsam und mit ihren Bögen griffbereit in den Händen, den Pfeil bereits auf der Sehne. Die Strahlen der untergehenden Sonne tanzten durch die Zweige der Bäume und beiden war klar, dass sie bei Nacht dieser Spur nicht mehr folgen konnten.
Eine Elster flatterte plötzlich hoch, aufgeschreckt durch die beiden sich nähernden Krieger. Dann brach vor ihnen jemand durch die Büsche und verschwand wie ein aufgescheuchter Hirsch in den Wald. Lange Zöpfe wehten um den Kopf der Gestalt und Tanzt-im-Feuer registrierte in seinem Jagdfieber wie nebenbei, dass er eine Frau vor sich hatte. Sie flüchtete zwischen die Pinien, schlug Haken und sprang geschickt über herumliegende Äste und Bäume. Außerdem war sie schnell!
Tanzt-im-Feuer spürte die Hitze des Laufens in seinem Körper aufsteigen, neben sich hörte er seinen Bruder keuchen. Gleichzeitig wunderte er sich, dass die Frau vor ihm nicht um Hilfe schrie. „Sie ist zu weit von ihrem Dorf weg!“, erkannte er scharfsinnig, fühlte wie er innerlich ruhig wurde. Sie mussten verhindern, dass diese Frau ihre Leute warnte, irgendwelche Feinde vielleicht ihr eigenes Dorf aufspürten und so zur Gefahr wurden. Seine Sprünge wurden länger, auch sein Bruder hielt locker Schritt, während sie die fremde Frau durch das Tal hetzten.
Schließlich verengte sich das Tal zu beiden Seiten und die Frau rannte auf eine Felswand zu, nicht ahnend, dass ihre Flucht dort zu Ende wäre. Sie tastete mit ihren Händen nach Ritzen und Spalten und versuchte verzweifelt sich nach oben zu ziehen. Offensichtlich hatte sie unterschätzt, wie nahe ihr die beiden Verfolger bereits gekommen waren. Ein Pfeil traf sie an der Schulter und mit einem Stöhnen sank sie zu Boden, ihre Beine plötzlich ohne Kraft. Zitternd drehte sie ihren Kopf zu den beiden Männern, blickte ihnen mit vor Schreck geweiteten Augen entgegen. Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn und ihre Haut wurde fleckig.
Tanzt-im-Feuer sah, wie sein Bruder nach seiner Keule griff und blieb abrupt stehen. „Hiya!“ Nein, brüllte er mit überschnappender Stimme, verhinderte im letzten Moment den tödlichen Schlag.
„Was?!“ Verblüfft drehte sich Taschunka-ayuchtata zu ihm um, die Waffe immer noch erhoben.
„Es ist doch nur ein Mädchen!“, erklärte Tanzt-im-Feuer mit einer verächtlichen Handbewegung.
„Na und! Denk doch an unser Dorf.“
Tanzt-im-Feuer biss kniff die Lippen zusammen, als er an die Überfälle auf sein Dorf dachte. Sein Bruder hatte recht! So viele Krieger waren gestorben und Frauen und Kinder in Gefangenschaft geführt worden. Aber hier sollte alles anderes werden, hier sollte Frieden herrschen! Und wie sollte das gelingen, wenn sie bereits den ersten Menschen, den sie hier überhaupt trafen, einfach töteten? Nein, dann wäre nichts anders. Alles wäre wie früher und Blut würde mit Blut gerächt werden. Es musste hier aufhören! Hier, bei diesem Mädchen, das nun zitternd vor ihnen kniete. Er sah mit einem Blick, dass sie schwer verletzt war und umriss die Situation in Gedanken, ohne auf die Argumente seines Bruders einzugehen. Das Mädchen war jung, vielleicht zehn und sieben Winter alt und in ihren Händen hielt sie immer noch ein Stück Leder, in dem sie anscheinend Kräuter gesammelt hatte. Einige waren herausgerutscht und er wunderte sich, dass ein Mädchen irgendwelche Kenntnisse von Heilkräutern hatte. Ihre schmalen Nasenflügel bebten, als sie viel zu schnell ein- und ausatmete und ihre geschwungenen Lippen wurden seltsam blutleer. Sie kniete dort, schmal und hilflos, und doch wunderschön. Erschöpft sank ihr Kopf gegen den kalten Felsen, dann flatterten ihre Augen und sie fiel in den schwarzen Nebel, der nach ihr griff. Tanzt-im-Feuer erkannte, dass sie zu schwer verletzt war, um sie mitzunehmen, gleichzeitig wusste er, dass sie verbluten würde, wenn er sie hier liegen ließ.
„Sammle Holz!“, bat er seinen Bruder.
„Was?!“ Vor Verblüffung wurden dessen Augen groß. „Wozu?“
„Sie wird erfrieren, wenn wir sie hier liegen lassen! Sammle Holz und mach ein Feuer, damit ihre Leute sie finden.“
Taschunka-ayuchtata machte eine kreisende Bewegung der Faust vor seiner Stirn, das Zeichen für „verrückt“, und fragte: „Sag mal, bist du völlig verrückt? Erst jagen wir sie, damit sie unsere Anwesenheit nicht verrät und nun warnst du ihr ganzes Volk? Willst du, dass wir an ihren Feuern gebraten werden?“
Tanzt-im-Feuer schmunzelte leicht, dann schüttelte er seinen Kopf. „Nein! Sie werden mit dem verletzten Mädchen beschäftigt sein. Wir haben genug Zeit, um zu verschwinden. Sammle Holz, während ich ihre Wunde verbinde. Dann holst du die Pferde!“
„Hohch!“ Der Tonfall seines Bruders zeigte wenig Begeisterung für diesen Plan, aber gehorsam bückte er sich nach einigen abgebrochenen Ästen, die überall auf dem Boden lagen.
Besorgt beugte sich Tanzt-im-Feuer über das fremde Mädchen und tastete nach dem Pfeil in der Schulter. Er brach ihn nur ab, damit er sie vorsichtig hinlegen konnte, ließ die Spitze aber stecken. Er hatte keine Zeit, ihre Wunde tatsächlich zu behandeln, sondern kontrollierte nur, dass sie nicht zu viel Blut verlor, ehe sie gefunden wurde. Sanft strich er über ihr zartes Gesicht, fühlte den kalten Schweiß und ihr flaches Atmen. Sein Herz krampfte sich zusammen, als ihm klar wurde, wie unüberlegt ihre Aktion gewesen war. Sie hatten auf ein wehrloses Mädchen geschossen, das vor ihnen geflohen war und sich nicht verteidigen konnte. Das war wahrlich keine tapfere Tat gewesen. Tanzt-im-Feuer riss sich von ihrem Anblick los und sprang auf, um ein paar Zweige von den Bäumen zu brechen. Wieder staunte seine Bruder. „Was machst du denn jetzt?“
„Ich lege sie auf ein paar Zweige, damit sie nicht auskühlt. Der Boden ist bereits gefroren.“
„Hohch! Warum bringst du sie nicht gleich in dein Tipi und legst sie auf ein warmes Bärenfell?!“
„Vielleicht tue ich das eines Tages!“, schoss Tanzt-im-Feuer zurück. Langsam ärgerte ihn das Getue seines Bruders.
Er schichtete die Zweige zu einem weichen Lager auf, dann hob er das Mädchen behutsam hoch und bettete sie möglichst bequem. Sie war so zart, so zerbrechlich und doch so weiblich, dass es ihm den Atem nahm. Ihre jungen Brüste zeichneten sich deutlich durch das Wildlederkleid ab, das sie trug, und er konnte es nicht lassen, ganz leicht, wie unabsichtlich, darüber zu streichen. Kurz fiel ihm der fremde Schnitt dieses Kleides auf, das wunderschön gearbeitet war. Zwei weich gegerbte Hirschhäute, die an den Schultern zusammengenäht waren. An ihrer Brust konnte man noch erkennen, wo der Schwanz des Hirsches gewesen war, denn er war als Verzierung in das entstandene Loch eingesetzt worden. Das Kleid war knöchellang, mit langen Fransen verziert. Ihm gefiel diese Art ein Kleid zu schneidern, denn sie unterschied sich von den Kleidern, wie sie die Frauen seines Volkes trugen. Fast tat es ihm leid, wie die wunderschöne Arbeit nun durch den Pfeil seines Bruders mit Blut besudelt wurde. Wieder strich er gedankenverloren über die langen Fransen und berührte dabei die kniehohen Leggins, die das Mädchen trug. Sie waren mit einem feinen Muster bemalt und der Form des schlanken Beines angepasst. Sein Bruder hatte die sanfte Geste gesehen und seine Augen funkelten, als er seinen Bruder deswegen neckte. „Vielleicht nimmst du sie doch mit?“
„Sie ist zu schwer verletzt“, wehrte Tanzt-im-Feuer ab, aber irgendwo klang Bedauern in seiner Stimme.
„Natürlich!“ Taschunka-ayuchtata nickte ein wenig zu übertrieben. „Du kümmerst dich nun wohl um alle feindlichen Frauen und Mädchen.“
Tanzt-im-Feuer schnalzte ungeduldig mit seiner Zunge. „Rede keinen Unsinn und mach endlich ein Feuer!“
Sein Bruder schüttelte verschmitzt seinen Kopf. „Ich hole lieber die Pferde, damit wir hier schnellstens verschwinden können. Ich möchte nämlich nicht von ihrem verärgerten Vater geröstet werden. Mach du das Feuer!“
Tanzt-im-Feuer deutete nachlässig auf die Abenddämmerung, die sich über das Land senkte. An vielen Stellen lag das Tal bereits im Tiefschatten und bald würde die Finsternis nach ihnen greifen. „Wenn wir uns nicht beeilen, kommt die Nacht und dann erfriert sie!“
„Gut! Besser sie, als wir“, maulte sein Bruder. „Außerdem werden sie das Feuer bei Nacht besser sehen als am Tag. Also meckere nicht wie ein altes Weib!“
Wortlos beugte sich Tanzt-im-Feuer über die Zweige und holte aus seinem Zundertäschchen zwei Feuersteine sowie etwas trockenes Gras heraus. Im Nu hatte er ein Feuer entfacht und schob weitere Äste in das Feuer, damit man es weithin sah. Kurz fühlte er die angenehme Wärme in der frostigen Luft, dann kam bereits sein Bruder angaloppiert und warf ihm die Zügel seines Pferdes zu. „Schnell! Das Feuer leuchtet wahrlich weit genug. Ihre Leute werden bestimmt gleich hier sein. Noch können sie unseren Spuren folgen. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, sie hierher zu locken.“
Tanzt-im-Feuer warf einen letzten Blick auf das Mädchen, dann galoppierte er seinem Bruder hinterher. Sein Herz war schwer, denn es ließ ihm keine Ruhe, sie so unbewacht zurückzulassen, auf Gedeih und Verderb dem Zufall ausgeliefert, dass jemand das Feuer sah.
Aber er hatte mehr für sie getan, als jeder andere getan hätte und es machte keinen Sinn, sein eigenes Leben oder das seines Bruders für ein unbekanntes feindliches Mädchen zu opfern. Ihr Volk hatte zu viel erlitten, als dass es auf zwei gute Jäger verzichten könnte. Jetzt mussten sie an ihre eigene Sicherheit denken und an das Fortbestehen ihres Volkes.
Sorgenvoll blickte er auf die deutliche Spur, die ihre Ponys für jeden sichtbar im Gras hinterließen. Selbst ein Kind wäre in der Lage, sie zu finden! Er überholte seinen Bruder und setzte sich wie selbstverständlich an die Spitze, während er überlegte, wie sie verschwinden konnten. Niemals durften sie jetzt auf direktem Weg in ihr Dorf zurück! Jetzt war Taktik und Können gefragt. Er wich nach Westen aus, folgte einem Wildwechsel tiefer in die Berge, dort wo die Geröllhänge ihre Spur verwischen würden. Sein Bruder versuchte, ihn mit einem Zuruf aufzuhalten: „Wenn Schnee fällt, werden wir in den Bergen eingeschlossen!“
Er hatte recht, aber Tanzt-im-Feuer wollte kein Risiko für sein Dorf eingehen. „Ich hoffe auf Schnee, dann wird er unsere Spur tarnen. Solange reiten wir hier kreuz und quer.“
„Wan! So viel Aufwand für eine Gefahr, die vielleicht noch nicht einmal existiert. Woher willst du wissen, ob die Feinde uns folgen?“
„Das weiß ich nicht! Aber wir wissen auch nicht, wer diese Menschen sind und wie viele in ihrem Dorf leben. Wir reiten erst zurück, wenn wir sicher sein können, dass uns niemand folgt.“
„Hohch!“, prustete Taschunka-ayuchtata entrüstet. „Wenn du so besorgt bist, dann sollten wir lieber ihr Dorf beobachten. Dann erhältst du Antworten auf deine Fragen!“
Tanzt-im-Feuer lachte schallend, dann nickte er anerkennend. „Eine gute Idee! Ich habe nur daran gedacht, unsere Spur zu verwischen, aber du siehst nach vorne. Wir sind Kundschafter! Wenn hier ein anderes Dorf ist, sollten wir das als Erste wissen.“
Taschunka-ayuchtata lächelte zufrieden. „So ist es. Außerdem wird es die Feinde verwirren, wenn unsere Spur zu ihrem Dorf führt.“
„Stimmt! Wo vermutest du ihr Dorf?“
Taschunka-ayuchtata wedelte überheblich mit seiner Hand. „Das Mädchen war zu Fuß. Und es wurde schon dunkel. Ich glaube nicht, dass sie vorgehabt hat, die Nacht im Wald zu verbringen. Ich vermute, dass ihr Dorf am anderen Ende des Tales liegt. Wir haben ihr wahrscheinlich den Fluchtweg abgeschnitten und sie in die Richtung fort von ihrem Dorf getrieben.“
„Das ist möglich. Also reiten wir in einem großen Bogen und versuchen, die Quelle des Baches zu finden. Die Berge werden uns verbergen. Außerdem werden die Feinde nicht damit rechnen, dass wir so frech sind, zu ihnen zurückzukehren.“
Ihr leises Lachen hallte von den Bergen, doch sie schienen nicht besorgt zu sein, dass irgendjemand es hören könnte. Kurze Zeit später schlugen sie ihr Lager unter einer riesigen Fichte auf, weil es einfach zu gefährlich war in der Dunkelheit weiterzureiten. Sie verzehrten etwas Dörrfleisch aus ihren Bündeln und wickelten sich in die warmen Büffelfelle. Die Pferde grasten in der Nähe, ihr leises Schnauben erfüllte die Nacht zusammen mit anderen Geräuschen. Die Männer achteten kaum darauf, konnten das leise Rascheln eines nächtlichen Jägers im Unterbewusstsein deuten. Kurze Zeit später schliefen sie tief und fest, hielten es nicht für nötig, in der unendlichen Einsamkeit der Bergwelt abwechselnd zu wachen. Selbst die Verfolger würden es nicht wagen, bei der Dunkelheit zu reiten.
Kurz vor der Morgendämmerung jedoch waren die beiden wieder auf den Beinen und setzten ihre Flucht oder auch ihren Angriff fort. So ganz konnte man nicht mehr unterscheiden, wer hier der Jäger oder der Gejagte war!
Tanzt-im-Feuer führte seinen Bruder in einem großen Bogen wieder an das Tal mit dem klaren Bach heran, kletterte gemütlich über Hügel und Berge, schlug kurze Haken und sah sich nach eventuellen Verfolgern um. Auf der Kuppe eines hohen Berges erblickte er die Schar der Verfolger, weit unten im Tal, vielleicht zehn Reiter, die sich an ihre Fährte geheftet hatten. Sie waren so winzig wie Ameisen, lagen mindestens eine halbe Tagesreise hinter ihnen. Er zeigte mit seiner Hand auf sie. „Sie reisen ziemlich schnell! Es muss ein großes Dorf sein, wenn sie zehn Männer ausschicken können, um uns zu jagen.“
„Ja, oder sie sind reichlich nachlässig und lassen ihre Frauen und Kinder ungeschützt zurück.“
Tanzt-im-Feuer wackelte nachdenklich mit seinem Kopf. „Das glaube ich nicht! Wir müssen vorsichtig sein, denn sie scheinen ziemlich wütend zu sein.“
„Vielleicht ist das Mädchen gestorben?“, folgerte sein Bruder ohne große Regung, doch das Gesicht von Tanzt-im-Feuer verdüsterte sich merklich. Mit zusammengebissenen Zähnen trieb er sein Pony den Hang hinunter und sein Bruder folgte ihm betreten.
Am Nachmittag erreichten sie tatsächlich über Umwege das wunderschöne Tal und kletterten mit ihren Ponys einen schmalen Grat hinunter. Sie waren auf der Hut, achteten auf jeden Schritt und sicherten wachsam die Umgebung. Sie blieben im Schatten der hohen Bäume, nutzten große Felsen als Deckung, doch dann lag das Dorf der Fremden vor ihnen.
Ihre Zelte und Hütten lagen tief im Tal an dem Bach verstreut, mindestens dreißig an der Zahl und Tanzt-im-Feuer zog überrascht die Luft ein. „Großes Dorf!“, signalisierte er mehr zu sich selbst, als zu seinem Bruder, so als müsste er die Nachricht erst einmal verdauen. Hier lauerte beträchtliche Gefahr.
„Welches Volk?“, fragten die Hände seines Bruders. Tanzt-im-Feuer zuckte ratlos mit den Schultern, konnte die Kleidung und die Form der Hütten nicht einordnen. Viele Familien hatten Tipis wie die Lakota, aber einige lebten in Hütten aus Ästen und Zweigen, die noch mit Grassoden und Erde bedeckt waren. Er schätzte die Kampfkraft des Dorfes auf mindestens zehnmal fünf Krieger und ein Schauer lief ihm über seinen Rücken, als er daran dachte, dass er ihnen vielleicht in die Hände fiel. Kurz überlegte er, in welcher Hütte wohl das Mädchen lag und ob es noch am Leben war. Sinnend blickte er auf das geschäftige Treiben im Dorf, wunderte sich über die Arglosigkeit dieser Menschen. Sie rechneten tatsächlich nicht damit, dass ihre Feinde umgekehrt waren, um sie zu beobachten.
Kinder spielten zwischen den Hütten, Frauen kehrten aus dem Wald mit Feuerholz zurück, ältere Männer saßen vor den Hütten und genossen die letzten schneefreien Tage vor dem Winter. In der Nähe graste eine große Pferdeherde und Taschunka-ayuchtatas Augen wurden rund vor Neid. „Gute Pferde! Wir sollten wiederkommen und sie uns holen!“, flüsterte er unternehmungslustig.
„Wie viele Männer willst du dafür opfern?“, holte ihn Tanzt-im-Feuer in die Wirklichkeit zurück. „Das Dorf ist zu groß!“
Taschunka-ayuchtata sagte nichts, doch wenn Tanzt-im-Feuer seine begehrlichen Augen gesehen hätte, dann hätte er vermutlich allen Grund gehabt, sich ernsthaft Sorgen zu machen.
„Hiyu-wo!“, befahl Tanzt-im-Feuer leise. „Folge mir!“
Mit größter Vorsicht umgingen sie das große Dorf, hofften darauf, dass keine Kinder oder Frauen plötzlich vor ihnen auftauchten. Sie blieben zwischen den Stämmen der hohen Fichten, doch das Tal war weit und bot viele Möglichkeiten unentdeckt zu bleiben.
Als sie eine ziemliche Distanz zwischen sich und dem fremden Dorf zurückgelegt hatten, saßen sie auf und erreichten nach einer Weile die Stelle, an der sie das verletzte Mädchen zurückgelassen hatten. Nur die Asche des Feuers und einige zusammengedrückte Fichtenzweige erinnerten an das Geschehen des Vortages. Schweigend ritten die Brüder daran vorbei, jeder mit anderen Gedanken, dann setzten sie sich auf die Fährte ihrer Verfolger.
„Und jetzt?“, fragte Taschunka-ayuchtata.
Tanzt-im-Feuer kicherte ausgelassen und deutete mit seiner Hand auf die Spur der zehn Reiter. „Wir folgen ihnen! Das wird sie völlig verwirren!“
Taschunka-ayuchtata fiel in das Gelächter ein: „Wir führen sie im Kreis herum. Keine schlechte Idee! Wir brauchen nur eine günstige Gelegenheit, die Spur zu verlassen, ohne dass man es sieht.“
Tanzt-im-Feuer hob den Blick und ruckte mit seinem Kopf in Richtung des wolkenverhangenen Himmels. „Wir bleiben in der Spur bis es schneit. Dann verschwinden wir und niemand wird uns folgen können.“
Wieder verbrachten sie die Nacht im Freien, hofften auf den Schneefall, doch sie mussten bis zum Nachmittag des nächsten Tages reiten, ehe der Riese im Norden ein Einsehen hatte und den ersehnten Schnee schickte. Taschunka-ayuchtata vermutete bereits, dass sie das Dorf ein zweites Mal erreichen würden und argwöhnte, ob ihnen die feindlichen Krieger nicht einen Trupp entgegen schicken würden.
Tanzt-im-Feuer befürchtete insgeheim das Gleiche, denn ein zweites Mal würden sich die Fremden nicht täuschen lassen. Als der Schneefall einsetzte, schwenkte er daher sofort in eine andere Richtung, nutzte das Geröll, auf dem sie gerade ritten, um eine weitere Verfolgung unmöglich zu machen. Ein versierter Fährtenleser würde auch unter dem Schnee in dem zerdrückten Gras eine Spur finden, aber nicht auf steinigem Boden.
Die beiden Männer nutzten nun die Satteldecken als Umhänge gegen den Schnee, während sie geduckt gegen den Wind auf ihren Ponys hockten. Bei Schnee zu reiten, war selbst Indianern zu kalt. Doch Tanzt-im-Feuer ließ keine Rast zu. Der Schnee würde alle Spuren zuwehen und so trieb er sein Pony unbarmherzig vorwärts. Dies war die Chance, auf die er einen ganzen Tag gewartet hatte und er würde sie nutzen. Er wechselte mehrmals die Richtung, ehe er wieder in einen Wald auswich, in dessen Schutz er die Nacht verbringen wollte. Sein Bruder hockte sich frierend unter einen Baum und schimpfte leise vor sich hin. Tanzt-im-Feuer fühlte sich genauso durchfroren, aber er sah davon ab, ein Feuer zu machen. Wenigstens hatte der Wind nachgelassen und der Schnee fiel in weichen, großen Flocken vom Himmel, legte sich als schützende Decke über das Land. Tanzt-im-Feuer breitete seine Satteldecke am Boden aus, dann rüttelte er seinen Bruder auf. „Komm, lass uns zusammen unter der Decke schlafen. Das ist wärmer.“
Wenig begeistert legte sich Taschunka-ayuchtata auf das Lager und überließ seinem Bruder einen Teil seiner Decke. Frierend drängten sie sich aneinander, suchten die Körperwärme des anderen. „Ein Mädchen wäre mir jetzt lieber“, grummelte der Jüngere.
Tanzt-im-Feuer lachte erheitert, dann stupste er seinen Bruder in die Rippen. „Solange du kleine Mädchen mit deinen Pfeilen erlegst als wären sie Hirsche, wirst du keine auf dein Lager bringen.“
„Auf unsere Mädchen schieße ich ja nicht!“, verteidigte sich Taschunka-ayuchtata.
„Gut, dass du das noch unterscheiden kannst“, brummte Tanztim-Feuer, ehe ihm die Augen zufielen.
Sie brauchten gute drei Tage, um in ihr Dorf zurückzukehren. Der hohe Schnee machte ein Durchkommen manchmal fast unmöglich und Tanzt-im-Feuer wunderte sich über den plötzlichen Wintereinbruch. Nur weil sie die unwilligen Pferde manchmal mit Gewalt hinter sich herzogen, kamen sie überhaupt noch voran. Aber sie mussten das Winterlager erreichen, wenn sie nicht erfrieren wollten. Niemand, der nicht schon selbst kurz vor dem Erfrieren stand, kann die Erleichterung nachempfinden, die nach Tanzt-im-Feuer griff, als sie endlich die niedrigen Hütten und Tipis des Dorfes sahen, aus denen der heimelige Rauch der Feuer stieg.
Die Nachricht von einem feindlichen Dorf in den Bergen wurde allerdings mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen, vor allen Dingen, weil Tanzt-im-Feuer jenen Stamm noch nie gesehen hatte. Feinde, die man nicht einschätzen konnte, gaben Anlass zur Spekulation und Gerüchte machten die Runde.
Tanzt-im-Feuer dagegen war nur froh, endlich wieder im Warmen zu sitzen und ließ sich von seiner Mutter eine Schüssel mit dampfendem Essen geben. Seine Füße lagen in der Nähe des Feuers und er fühlte die angenehme Wärme in seinem Körper. Sein Bruder war schon wieder unterwegs zu seinen Freunden und prahlte von den Abenteuern, die sie erlebt hatten.
Tanzt-im-Feuer konnte darüber nur den Kopf schütteln, aber vor Urzeiten, als er genauso jung gewesen war, hatte er vermutlich ähnlich geprahlt.
Seine jüngere Schwester setzte sich mit scheuer Neugier in seine Nähe, hoffte offensichtlich auch eine spannende Geschichte aus seinem Mund zu hören. Sie trug ebenso wie ihre Mutter ein Kleid, das aus einer großen Haut gefertigt war und seitlich gefaltet wurde. An den Schultern wurde es von zwei Riemen gehalten, die jetzt im Winter von einem weiteren Fell verdeckt wurden, das die Frauen gegen die Kälte wie einen Poncho übergezogen hatten. Die dunklen Augen seiner Schwester blitzten erwartungsvoll, aber noch mehr amüsierte Tanzt-im-Feuer die Ungeduld seines Vaters, der seine Tochter tatsächlich mit einer kaum sichtbaren Handbewegung aufgefordert hatte, dem Bruder die Geschichte zu entlocken. Tanzt-im-Feuer kicherte in sich hinein, freute sich umso mehr wieder zuhause zu sein. Seine Eltern zu sehen und seine kleine Schwester, die sich vertrauensvoll an ihre Mutter kuschelte, machten alle Strapazen wieder wett. „Oh seht!“, schimpfte er zum Schein. „Meine kleine Schwester erdrückt ihre Mutter ja!“ Beschämt rückte das Mädchen etwas zur Seite, ohne den Blick von ihm abzuwenden.
Tanzt-im-Feuer lehnte sich bequem gegen eine Rückenstütze und kurz flammte die Erinnerung an seine andere Schwester in ihm hoch, die in etwa dem gleichen Alter gewesen war, als sie bei einem schrecklichen Angriff von den Arikara geraubt worden war. Sie war damals zehn und drei Winter alt gewesen, so wie seine jüngste Schwester jetzt. Lange hatten sie unter dem Verlust gelitten, immer wieder gebetet und die Geister befragt, ob sie wohl noch am Leben war, aber die undurchdringlichen Wälder des Nordens hatten sie einfach verschluckt. Wahrscheinlich war sie längst die Ehefrau eines Arikara Kriegers oder war an einen anderen Stamm getauscht worden.
Sein Vater hatte tapfer gekämpft, aber er hatte es nicht verhindern können, dass sein schreiendes Kind von einem halb nacktem Krieger auf ein Pferd gezerrt worden war. Seit diesem Tag kämpfte er mit einer schweren Verletzung, die seinen linken Fuß lähmte. Nur mit Hilfe seiner Söhne war er noch in der Lage, seine Familie zu ernähren, aber seine Hände waren geschickt und so fertigte er scharfe Messer und Pfeilspitzen, oder wertvolle Bögen und Schilde. Er konnte humpeln oder auch reiten, aber zum Jagen reichte seine Kraft nicht mehr aus. Trotzdem hatte die Verletzung nicht seinen Lebensmut nehmen können. Seine anderen drei Kinder brauchten ihn und nun war er stolz auf seine mutigen Söhne. Zu sehen, wie sie ihren Platz im Volk einnahmen, erfüllte ihn mit Zufriedenheit. Sein Name war Mato-tschikala, kleiner Bär, aber dieser Name wurde selten gesagt. In seinem Dorf waren fast alle Menschen miteinander verwandt und nannten sich gegenseitig voller Respekt und Liebe mit ihren Verwandtschaftsbezeichnungen. Kleiner Bruder, großer Bruder, Onkel, Tante, Cousine, Vater, Mutter, etwas anderes galt als unhöflich. Der Name hatte große Macht und ihn auszusprechen lockte vielleicht die bösen Geister an.
Mit einem lockeren Lächeln ließ sich Mato-tschikala auf seinen Platz fallen, mit seinen zehnmal vier und acht Wintern immer noch eine stattliche Erscheinung. Nur die tief liegenden, sorgenvollen Augen und ebensolchen Falten in seinem Gesicht zeugten von den Schicksalsschlägen, die sein Leben geprägt hatten. Mit einer fahrigen Bewegung strich er seine losen, bereits ergrauten, Haare zurück, die am Schopf mit einer zerfledderten Adlerfeder geschmückt waren, dann wiederholte er die Handbewegung, diesmal direkt an seinen Sohn gerichtet. Er hatte die gleichen ausgeglichenen Gesichtszüge wie sein älterer Sohn, während das Mädchen mit ihrer lebhaften Mimik ein Abbild von Taschunka-ayuchtata war. Sie hieß Taschina-luta, Rote-Decke, weil ihre Mutter sie nach der Geburt in eine rote Wolldecke eingewickelt hatte, die erste, die je einer von ihnen gesehen hatte. Mato-tschikala hatte sie von einem französischen Trapper eingetauscht, zusammen mit dem ersten Messer aus Metall. Selbst jetzt, nach zehn und drei Wintern war Mato-tschikala immer noch der einzige, der ein solches Messer besaß. Die rote Decke hatte sich in Wohlgefallen aufgelöst, nur der Name war geblieben und einige zerschlissene Streifen mit denen das Mädchen ihre schwarzen Haare schmückte.
„Warum hat Taschunka-ayuchtata auf das Mädchen geschossen?“, fragte Taschina-luta ihre Mutter mit bebenden Lippen, stellte sich wahrscheinlich vor, dass auch sie einmal in solch eine furchteinflößende Situation kam. Sie vermied es, ihren Bruder direkt anzureden, obwohl die Frage eindeutig an ihn gerichtet war. Tanzt-im-Feuer seufzte laut, als er sich die Antwort überlegte. „Wahrscheinlich wollte er verhindern, dass sie um Hilfe rief und das ganze Dorf auf uns aufmerksam machte. Wenn der Pfeil ein wenig tiefer getroffen hätte, dann hätte er ihr Herz durchbohrt.“
„Und warum habt ihr sie nicht getötet?“, wunderte sich sein Vater.
„Wan! Sie wurde ohnmächtig und stellte keine Gefahr für uns dar. Wahrscheinlich wurde sie von ihren Leuten gefunden.“
Mato-tschikala senkte amüsiert den Kopf, denn er hatte die Geschichte ganz anders gehört. „Warum hast du dann ein Feuer gemacht?“, lockte er seinen ältesten Sohn aus der Reserve.
„Hohch! Mir war kalt!“, versuchte Tanzt-im-Feuer die Geschichte herunterzuspielen.
Taschina-luta glaubte ihm kein Wort. „Liebst du sie?“, fragte sie mit leuchtenden Augen, dann schlug sie sich erschrocken die Hand vor den Mund.
Seine Reaktion war so heftig, dass es ihm sofort leid tat, weil er sich so schlecht im Griff hatte. Was hatte dieses fremde Mädchen überhaupt mit ihm zu schaffen, wieso brachte es seine Gefühle so durcheinander? „Natürlich nicht!“, fauchte er viel zu laut. „Sie ist eine Feindfrau!“
Seine Mutter schlug vor Lachen die Hand vor den Mund und auch sein Vater schien wenig überzeugt zu sein. Seine Mundwinkel zuckten vor Vergnügen, als er sich demonstrativ dem Feuer zuwandte und geschäftig darin herumstocherte. Es war längst an der Zeit, dass sein Ältester sich eine Frau suchte, aber dass ausgerechnet ein feindliches Mädchen dessen Herz berührt hatte, erfüllte ihn mit Sorge. Wer waren diese Fremden?
Nach den Beschreibungen seines Sohnes erinnerten ihre Bauten an die Dörfer der Miwatani oder Hidatsa, nur die Kleidung schien anders zu sein.
Cheyenne-Winter
Die Cheyenne hatten sich tatsächlich voller Wut an die Fersen der Fremden geheftet, doch als die Spuren zum Dorf zurückführten, hatten sie sich beträchtliche Sorgen gemacht, dass diese Feinde es doch auf Skalpe abgesehen hatten! Zu ihrer Verwunderung waren die Feinde vorsichtig an ihrem Dorf vorbeigeschlichen, nur um in ihrer eigenen Spur die Verfolger zu necken. Gebrochene-Pfeife, Anführer der Kriegsschar, ein Mann mittleren Alters mit hängenden Wangen und Tränensäcken unter den Augen, hatte darüber nur den Kopf geschüttelt und von einer weiteren Verfolgung abgesehen. Er trug einen beeindruckenden Kopfschmuck aus mehreren Adlerfedern und hatte sich die Stirn und Augenpartie schwarz bemalt. Er wedelte frustriert mit der Hand und schnalzte fast bewundernd mit seiner Zunge. „Lasst sie reiten! Wir holen uns nur kalte Füße, wenn der Schnee kommt! Die beiden sind ganz schön schlau! Sie werden noch ewig im Kreis reiten, bis sie sicher sein können, dass sie uns entwischt sind!“
Falke-am-Boden, ein Mann Mitte zwanzig, mit kühnen und kantigen Gesichtszügen, schüttelte entrüstet den Kopf. „Sie haben Taischeé schwer verletzt! Wir sollten sie nicht ungestraft entkommen lassen!“
„Du kannst ja weiterreiten! Ich sage, dass wir sie nicht mehr einholen werden. Ich glaube nicht, dass sie die Absicht hatten, jemanden zu töten. Wahrscheinlich haben sie Taischeé erschreckt und ohne nachzudenken geschossen. Sonst hätten sie kaum ein Feuer entfacht, damit wir sie finden. Ich reite zurück. Es ist besser im Dorf zu sein, wenn der Schnee kommt.“
„Ich denke, dass wir verhindern sollten, dass diese Feinde unser Dorf verraten. Jetzt sind es nur zwei. Vielleicht kehren sie mit vielen Männern zurück.“ Deutlich war die Kampfbereitschaft in der Stimme des Jüngeren zu hören und sein hochgewachsener Körper drehte sich in Richtung der Flüchtigen, als könne er es kaum abwarten, sie endlich aufzuspüren. Seine Nasenflügel bebten vor Ungeduld und sein Mund war zu einem schmalen Strich zusammengezogen.
Gebrochene-Pfeife dachte über diesen Einwand nach, dann nickte er zögernd. „Ein guter Rat! Wir werden Wachen aufstellen, damit wir gegen einen Angriff gewappnet sind.“
Falke-am-Boden zischte wütend durch die Zähne, sein Gesicht zeigte deutlich seine Missbilligung. „Warum brichst du die Verfolgung ab, wenn du die Gefahr erkennst?“
„Weil wir sie nicht einholen werden“, erklärte Gebrochene-Pfeife nüchtern. Er machte eine auffordernde Handbewegung und befahl damit den anderen ins Dorf zurückzukehren.
Alle dachten an das Mädchen, das schwer verwundet in ihrem Zelt lag und um ihr Leben rang.
Taischeé fühlte den pochenden Schmerz lange bevor sie tatsächlich aus ihrer Ohnmacht erwachte. Sie wehrte sich gegen das Erwachen, denn es brachte furchtbare Erinnerungen in ihr hoch. Sie wollte sich nicht erinnern und sie wollte diesen dumpfen, pochenden Schmerz nicht aushalten, der sich von ihrer Schulter strahlenförmig in ihrem ganzen Körper ausbreitete. Wieder sah sie die beiden Männer vor sich, die erhobene Keule und die zusammengekniffenen Augen, in denen der deutliche Wille lag, sie zu töten. „Hiya!“ Immer noch dröhnte dieses eine Wort in ihrem Kopf, das über Leben und Tod entschied. „Hiya!“
Sie erinnerte sich an erschrockene Augen, die sich über sie gebeugt hatten und an sanfte Hände, die sie auf ein Lager gebettet hatten, ehe sie in das schwarze Schattenreich fiel. Warum hatte er sie nicht getötet? Oder war sie längst tot, und all das nur eine Täuschung? Noch hatte sie nicht die Kraft, ihre Augen zu öffnen. So versuchte sie mit ihren anderen Sinnen zu ertasten, wo sie war. Es roch nach Fleisch, nach Kräutern und jemand arbeitete leise neben ihr, in dem Versuch sie nicht zu stören. Sie ahnte die Anwesenheit ihrer Mutter und schluchzte auf, ließ ihre Angst und ihren Schmerz in dieser tröstenden Gegenwart heraus.
„Mutter!“
„Meine Tochter!“, hörte sie die beruhigende Stimme neben ihrem Ohr, gleichzeitig spürte sie die Hand, die sanft über ihr Gesicht strich. „Du hast so lange geschlafen! Wir dachten schon, dass du zu den Schatten gehst.“
Taischeé bemühte sich die Augen zu öffnen und blinzelte unter ihren langen Wimpern. Sie war daheim! Ihre Mutter kniete neben ihr, ihr immer noch rabenschwarzes Haar zu zwei festen Zöpfen geflochten. Sie trug ein locker geschnittenes Wildlederkleid, das ihren schlanken Körper weich umhüllte und ihr durchaus Bewegungsfreiheit ließ. Es war mit Erdfarben gelb gefärbt und hatte am Ausschnitt ein kleines Muster aus blauen Stachelschweinborsten. Es war nur eine winzige Borte, und doch verlieh es dem Kleid Anmut und Wert. Ihre Mutter hatte ewig daran gesessen die Borsten mit einem flachen Stein zu plätten, zu färben und in einer komplizierten Falttechnik auf das Kleid anzubringen. Sie trug den wunderschönen Namen Ménonéhné, was wörtlich übersetzt „Frau, die singend hereinkommt“ bedeutet.
Vorsichtig hob sie den Kopf ihrer Tochter, um sie an einer Schale mit Wasser nippen zu lassen. Ihre Züge waren kräftig, mit leichten Falten, die sich noch zu vertiefen schienen, als sie nach der Verletzung ihrer Tochter sah. Ihre hohen Lider öffneten sich voller Besorgnis, vermittelten den Eindruck von Klugheit und einem bedächtigen Wesen.
„Es tut so weh“, hauchte Taischeé fast unhörbar, hatte nicht die Kraft ihre Stimme zu heben.
„Du bist schwer verletzt! Ein Pfeil hat dich an der Schulter getroffen“, erklärte ihre Mutter in dem flüsternden Singsang der Cheyennesprache.
Taischeé nickte mit ihrem Kopf, obwohl dieses Nicken im Grunde nicht zu sehen war. „Da waren zwei Männer. Sie verfolgten mich. Der Jüngere wollte mich töten, aber der andere hat es verhindert. Mutter, ich hatte solche Angst!“
„Ich weiß, meine Tochter! Wir alle hatten Angst um dich. Aber nun wird es dir bald besser gehen.“
„Wie habt ihr mich gefunden?“, flüsterte Taischeé, denn plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie sich weit vom Dorf entfernt hatte.
„Die Männer, die dich verwundet haben, haben ein großes Feuer gemacht, damit wir dich finden.“
„Wirklich?“, fragte Taischeé verwundert. „Das macht aber keinen Sinn. Haben unsere Krieger sie denn nicht verfolgt?“
„Natürlich!“ Die Mutter kicherte leicht. „Aber die beiden haben unsere Krieger an der Nase herumgeführt und sind verschwunden.“
Taischeé schloss erleichtert die Augen und wunderte sich über ihre Gefühle. Warum nahm sie irgendwelchen Anteil an dem Schicksal dieser Feinde, die sie fast getötet hätten? Ihre Schulter schmerzte entsetzlich und eigentlich müsste sie froh sein, wenn die Skalpe dieser beiden Feinde an den Gürteln ihrer Krieger hingen. Warum hatten sie ein Feuer angezündet? Und warum hatte der eine der jungen Männer Mitleid mit ihr gehabt? Wieder hatte sie die beiden vor Augen, ihre muskulösen Körper, ihre Spannkraft, die Wildheit in den Augen des jüngeren Bruders. Brüder! Ja, das war es! Sie waren sich ähnlich, das konnte man deutlich sehen, und doch waren sie anders. Wieder schoss die Erinnerung an das ehrliche Entsetzen in den Augen des Älteren, der sich über sie gebeugt hatte, in ihr hoch. Er würde ihr niemals wehtun!
„Weißt du, von welchem Volk sie waren?“, fragte Ménonéhné.
Taischeé riss sich von ihren Gedanken los und versuchte, sich an irgendwelche Merkmale zu erinnern, die auf eine Stammeszugehörigkeit deuteten. „Nein! Aber einer von ihnen sagte ‚Hiya‘, um den andern zu hindern, mich zu töten.“
„Hiya?“, wiederholte ihre Mutter sinnend.
„Ja!“
„Es könnten welche vom Volk der Halsabschneider sein, aber ich habe noch nie gehört, dass sie so weit westlich leben.“
„Halsabschneider“, hauchte Taischeé ehrlich entsetzt.
Ihre Mutter lachte harmlos. „Ja, sie nennen sich selbst Lakota, Verbündete, aber ihre Feinde nennen sie Halsabschneider. Eigentlich leben sie auf der anderen Seite des großen Flusses, haben ihre Felder im Gebiet der großen Seen. Ist dir sonst etwas an ihnen aufgefallen?“
„Nein, im Grunde sahen sie aus wie unsere Männer. Sie trugen Adlerfedern im Haar und waren jung.“
Ihre Mutter zwinkerte vertraulich. „Vielleicht sahen sie auch gut aus?“
Taischeé lachte ein wenig, dann stöhnte sie, als der Schmerz wieder durch ihren Körper schoss. „Abgesehen davon, dass sie auf mich geschossen haben, sahen sie ganz gut aus.“ Es klang ziemlich patzig und doch freute sich ihre Mutter über diesen kleinen Ausbruch, denn er zeigte ihr, dass ihre Tochter bald auf dem Weg der Besserung sein würde. „Schlaf ein wenig! Mit jedem Tag wird es dir besser gehen.“
Taischeé nickte erschöpft ein und in ihren fieberhaften Träumen erschien immer wieder ein junger Mann mit erschrockenen Augen, der sie sanft auf den Händen trug.
Ihre Heilung brauchte viel Zeit. Es dauerte mehrere Tage, ehe sie in der Lage war, an einer Rückenlehne zu sitzen und einen weiteren halben Mond ehe sie zum ersten Mal ihre Behausung verlassen konnte. Den Arm immer noch in einer Schlinge ließ sie sich zum Bach führen, damit sie sich endlich gründlich waschen konnte. Ihre Mutter schrubbte sie mit Yukkaseife ein, wie in einer Zeremonie, während sie nackt im Schnee hockte und endlich all den Schweiß und Gestank ihrer langen Krankheit los wurde. Selbst ihre verfilzten Haare legte sie in das eisige Wasser und anschließend brauchte ihre Mutter eine Ewigkeit, um es zu kämmen und in feste Zöpfe zu flechten.
Taischeé lebte mit ihrer Mutter allein in der kleinen Hütte, denn Ménonéhné war eine Heilige Frau, eine Frau mit Kenntnissen über Kräuter und Heilkunst. Für kurze Zeit hatte sie sich dem Glück einer Partnerschaft hingegeben, aber nach dem Tod ihres Mannes bei einem Überfall der Crow hatte sie beschlossen, allein zu leben und ihr Leben dem Volk zu widmen. Taischeé war ganz natürlich mit dem gleichen Wissen aufgewachsen, hatte ihre Mutter, kaum dass sie laufen konnte, beim Kräutersammeln begleitet. Die Männer des Dorfes hatten gewaltigen Respekt vor ihr, sodass bisher noch niemand gewagt hatte, um ihre Hand anzuhalten. Sie fragte auch nicht danach. Ihr war es genug, mit ihrer Mutter durch die Wälder zu streifen, in letzter Zeit auch oft genug alleine, um nach den verschiedenen Pflanzen zu suchen. Sie genoss die Einsamkeit und die Stille, lauschte auf den Gesang der Vögel oder das Röhren des Hirsches und wunderte sich manchmal über das sinnlose Geschnatter der anderen Mädchen in ihrem Dorf. Sie war es gewohnt, mit ihrer Mutter über ernste Dinge zu reden, über die Wirkung von Heilpflanzen oder die Auswirkungen des Mondes auf den Zyklus der Frauen. Oft saß sie still dabei, wenn ihre Mutter einen Kranken behandelte oder einer Frau bei ihren Beschwerden half. Sie bewunderte deren geschickte Hände, wenn sie einem Baby auf die Welt half und der werdenden Mutter die Schmerzen nahm. Sie wollte auch eine so gute Heilerin werden!
Seit Urzeiten war ihr Volk im Sommer zu diesen heiligen Bergen gezogen, erst im Herbst kehrten sie wieder in ihre Dörfer am großen Fluss zurück, um den Mais zu ernten, den sie im Frühjahr gepflanzt hatten. Doch die letzten Jahre waren schwer gewesen. Immer mehr Feinde hatten ihre Dörfer am großen Fluss errichtet, ebenso von ihren Feinden verdrängt. Ihr Volk war klein und so hatte es dem Druck nachgeben, sich hierher zurückgezogen, mitten in die Berge, in denen sie früher höchstens gejagt oder ihre heiligen Zeremonien veranstaltet hatten. Letztendlich hatte es sie gerettet, denn ihre früheren Feinde am großen Fluss waren durch seltsame Krankheiten schwer getroffen worden. Die Lebensgewohnheiten hatten sich geändert. Anstelle von erdbedeckten Hütten, lebten sie nun in Zelten, die mit Büffelfellen bespannt waren. Ihre neuen Feinde waren Crow, Kiowa und Pawnee, die ebenfalls in diesem wildreichen Gebiet jagten und ihre Dörfer entweder weiter westlich oder südlich aufschlugen. Nun weitere Feinde in ihrem Gebiet zu wissen, beunruhigte die Männer zutiefst.
Im nächsten Mond zeigte sich tatsächlich eine gewisse Nervosität und Wachsamkeit bei den Cheyenne, doch mit zunehmendem Wintereinbruch glaubte niemand mehr an einen Angriff. Der Schnee lag einfach zu hoch, als dass es irgendeinem Menschen möglich gewesen wäre, durchzukommen. Selbst die Cheyenne waren kaum noch in der Lage, ihr Dorf zu verlassen und so breitete sich winterliche Ruhe aus. Niemand ging mehr von einer Gefahr aus, solange der Schnee nicht schmolz und die Pässe wieder frei waren. Alle freuten sich, dass es Taischeé wieder besser ging, obwohl es fast den ganzen Winter dauerte, ehe die Wunde wirklich verheilt war. Besonders beim Gerben fehlte dem Mädchen die Kraft oder beim Holzsammeln. Sie blieb meist bei ihrer Mutter in der Hütte, half ihr beim Kochen oder Nähen, ohne die Schulter groß zu bewegen. Wahrscheinlich war es nur dem Wissen ihrer Mutter zu verdanken, dass die Wunde so gut heilte, vielleicht hatte sie aber auch nur Glück gehabt, dass kaum Dreck eingedrungen war. Schließlich erinnerte nur noch eine Narbe an den ausgestandenen Schrecken und die wiederkehrenden Alpträume in der Nacht.
Sie redete viel mit ihrer Mutter über die Begegnung, sinnierte über das seltsame Verhalten der fremden Männer. Besonders die Wildheit des Jüngeren machte ihr immer noch Angst, denn sie erkannte instinktiv, dass er kein Mitleid mit ihr gehabt hätte.
„Junge Männer haben oft noch nicht die innere Ausgewogenheit“, erklärte ihre Mutter. „Das macht sie grausam und unüberlegt!“
„Sind unsere Männer auch so?“, fragte Taischeé.
„Oh ja! Aber, wenn sie erst ihren Mut bei irgendwelchen Kriegszügen abgekühlt haben, werden sie sanfter. Vielleicht schätzen sie dann das Leben mehr.“
„Schätzen Männer denn das Leben nicht?“, wunderte sich Taischeé.
Ihre Mutter blickte sinnend in das Feuer und überlegte sich ihre Antwort. „Männer sind anders. Sie haben andere Aufgaben und manche werden nie weise. Ich denke, dass es damit zu tun hat, dass sie kein Leben in sich tragen können. Wir Frauen haben ein Gespür für die Schönheit des Lebens, weil wir Leben schenken können. Männer sehen nur die Vergänglichkeit. Deswegen hat der Tod für sie auch keine solche Bedeutung. Sie töten, weil sie wissen, dass auch ihr Leben im gleichen Augenblick zu Ende sein kann, während wir an die Zukunft des Volkes denken.“
„Ich glaube, ohne Männer gäbe es keinen Krieg zwischen den Völkern“, erklärte Taischeé nüchtern.
Ménonéhné lachte amüsiert. „Vielleicht nicht, aber dann gäbe es auch keine Kinder und keine Hoffnung. Wir Frauen müssen sie immer wieder an die schönen Dinge im Leben erinnern. Das ist unsere Aufgabe.“
Ihre Tochter schnaubte empört. „Indem wir ihnen Kinder gebären, Brennholz sammeln, Kleidung herstellen und ihnen die Töpfe füllen? Ist das unsere Bestimmung?“
Ihre Mutter strich ihr sanft über die Wange. „Kind, du musst noch eine Menge lernen. Es gibt auch schöne Dinge zwischen einem Mann und einer Frau.“
„Warum habe ich das bisher nicht gespürt?“, wunderte sich Taischeé mit sehnsüchtigen Augen. „Bin ich anders als die anderen Mädchen?“
„Nein, aber du bist bereits weiser als die anderen Mädchen. Du ignorierst die Blicke der jungen Männer, weil sie im Grunde nur sich selbst sehen und noch nicht gelernt haben, auf die Wünsche oder Bedürfnisse einer Frau Rücksicht zu nehmen. Du bist bereits eine Frau, kein verliebtes junges Mädchen mehr. Eines Tages wird ein Mann kommen, der dies zu schätzen weiß. Warte nur ab!“
Taischeé senkte getröstet den Kopf und dachte über die Worte ihrer Mutter nach. Sie hatte recht! Wie sie das aufgeblasene Gehabe von Falke-am-Boden oder den anderen jungen Männern satt hatte! Sie verbrachten weit mehr Zeit ihre Haare zu flechten, als sie es tat. Sie schienen nur auf ihr Aussehen bedacht zu sein, und wie viele Mädchen ihnen nachschauten. Dabei würde doch eins durchaus reichen, wenn es die Richtige war. Nein, hier konnte keine zuverlässige Partnerschaft entstehen, keine Vertrautheit, keine Liebe! Diese jungen Männer liebten nur sich selbst, sonnten sich im Rausch der Gefahr oder versuchten, sich an Tapferkeit gegenseitig zu übertreffen. Selbst das Verführen von Mädchen schien nur ein Wettbewerb zu sein, mit dem sie protzen konnten. Taischeé ging ihnen aus dem Weg und konzentrierte sich auf die Worte ihre Mutter.
Der Winter war eine harte Zeit und bald wurden die beiden von anderen Sorgen abgelenkt. Die Winterkrankheit breitete sich aus, schwerer Husten plagte die Menschen und hohes Fieber, das ihre Mutter mit Kräutern und Tees zu lindern versuchte.
Die Nahrungsvorräte wurden knapp, wie jedes Jahr zum Ende des Winters hin. Zwar gingen die Krieger zur Jagd, doch noch konnten sie sich nicht weit vom Lager entfernen und die Gegend war überjagt. Alle hofften auf die Schneeschmelze und die Rückkehr der Zugvögel. Lawinen rollten zu Tale, machten die Berge zu einem gefährlichen Ort. Die Menschen magerten ab. Außerdem wurde die Nahrung einseitig, weil die getrockneten Früchte, Nüsse oder Prärierüben längst verzehrt waren. Selbst die Wildtiere waren ausgezehrt, eingefallene Flanken zeugten von der Not des Winters. Überall trieben Kadaver von Tieren in den Fluten der reißenden Flüsse, die den Winter nicht überstanden hatten. Krähen und andere Aasfresser lebten im Überfluss, während andere verzweifelt den matschigen Schnee beiseite scharrten, um an das verdorrte Gras zu kommen.
Die Vögel dagegen kehrten wohlgenährt aus den warmen Gefilden im Süden zurück, landeten platschend in den Flüssen und Seen oder bauten sich ihre Nester in den Wipfeln der Bäume. Nach der Ruhe des Winters erfüllte plötzlich Zwitschern, Kreischen und Schnattern die Luft, das die Menschen mit Freude erfüllte. Der Duft nach gebratenen Enten ließ einem den Speichel im Mund zusammenlaufen und erinnerte die Menschen an ihre knurrenden Mägen.
Gute Stimmung breitete sich aus und mit dem besseren Essen verschwanden auch die Krankheiten. Die Sonne gewann an Kraft, trotzdem brachte das wärmere Wetter erst einmal völliges Chaos. Der schmelzende Schnee verwandelte die Umgebung in eine Landschaft aus Sumpf und Matsch. Die Feuchtigkeit durchdrang jeden Winkel, schien sich selbst in den Schlaffellen und in der Kleidung festzusetzen.
Die Frauen fanden kaum noch trockenes Holz und brachen dazu die verdörrten Äste der Fichten ab. Es qualmte, wenn man es entzündete, weil selbst das dichte Dach der oberen Zweige kein Schutz für die vordringende Nässe war. Die Menschen hatten ihre eigene Weise, damit umzugehen: Sie bewegten sich mehr und erreichten so, dass sich die Wärme in ihren Körpern ausbreitete. Krieger brachen im Dauerlauf zur Jagd auf, Frauen klopften Decken und Felle aus, huschten geschäftig zwischen den Hütten hin und her, Kinder machten ihre Wettspiele.
Unvermittelt wurde es warm. Der Boden saugte die Feuchtigkeit auf, grünes Gras schoss anscheinend über Nacht in die Höhe und an den Büschen entfalteten sich die Blätter. Nach einem weiteren Mond mit warmem Wetter waren die Wälder voller Waldbeeren, die von den Frauen eifrig gesammelt wurden. Der leicht saure Geschmack war eine Wohltat auf der Zunge, außerdem wussten die Menschen instinktiv, dass sie frische Früchte brauchten. Kichernd verteilten sich die Frauen und Mädchen in den Wäldern, füllten ihre selbst geflochtenen Körbe mit den köstlichen Früchten, die meist am gleichen Tag verzehrt wurden.
Taischeé vermied es, allein in den Wald zu gehen. Immer noch saß der Schreck in ihr und so hatte das Durchstreifen der Wälder seinen Reiz verloren. Irgendwie erschienen sie ihr nun dunkel und bedrohlich. Sie genoss das Beisammensein mit ihrer Mutter und lauschte auf deren Stimme, wenn sie ihr etwas erklärte. „Du kannst die Beeren auch trocknen und daraus einen Tee brühen!“
„Ah, hat der Tee eine Heilwirkung?“
„Ja, er reinigt den Magen und wirkt bei Blähungen! Babys vertragen ihn gut! Auch die Blätter sind gut! Der Tee hilft den Frauen bei der Geburt!“
Ihre Unterhaltung plätscherte dahin, während die beiden Frauen auf der Lichtung knieten und die Beeren sammelten. Taischeé hatte dazu ihr Kleid ein wenig hochgeschoben, um es vor der Feuchtigkeit des Bodens zu schützen. Ihre Knie schmerzten bereits und sie wusste, dass ihre Mutter mit ihrem Alter wahrscheinlich weit größere Schmerzen hatte. „Setz dich auf einen Stein und ruhe dich aus!“, meinte sie daher freundlich.
Mit einem erleichterten Seufzen richtete Ménonéhné sich mühsam auf und hockte sich auf einen großen Felsen, der mitten auf der Wiese lag, als hätte ihn eine Lawine oder das Hochwasser aus den Bergen bis hierher geschoben.
Taischeé beugte sich mit einem Lächeln über die kleinen Früchte und füllte weiter ihren Korb. Bald wäre es Zeit heimzugehen, und sie wollte ihn noch voll bekommen. Eine feste Hand presste sich von hinten auf ihren Mund, zerrte sie hoch und ein Messer setzte sich an ihre Kehle. Ihre Hände griffen in völliger Panik nach dem Unterarm des Mannes, der sie gepackt hatte und dessen Körper sich an sie heranpresste. Alles war unnatürlich still, und sie wunderte sich, dass ihre Mutter nicht schrie. Das Messer drückte stärker gegen ihre Kehle, bohrte sich gegen ihre Halsschlagader und ihre Gegenwehr erschlaffte. Plötzlich waren vier weitere Männer in ihrem Gesichtsfeld und sie erkannte den Jüngeren wieder, der sie zu Beginn des Winters mit seinem Pfeil verletzt hatte. Die Halsabschneider waren wiedergekommen! Mit sichtlich zufriedenem Gesichtsausdruck musterte sie der junge Krieger abschätzend, dann machte er eine befehlende Handbewegung das wehrlose Mädchen zu fesseln.
Wo war der ältere Bruder? Der ruhige Krieger mit dem freundlichen Blick? Ihre Augen versuchten mehr von der Umgebung zu sehen, doch er war nicht da. Und sie war sich auch ziemlich sicher, dass es nicht der Mann war, der sie immer noch umklammert hielt. Dazu war er zu grob. Stattdessen blieben ihre Augen auf ihrer Mutter haften, die ebenso von einem Mann umklammert wurde, mit einem Messer an ihrer Kehle. Der Mann machte eine leichte Bewegung mit seiner Hand, deutete damit an, dass er sie töten wollte.
Taischeé blieb das Herz stehen. Nein! Nicht ihre Mutter! Sie durfte nicht sterben! Ein verzweifeltes Stöhnen stieg in ihr hoch und ihre Augen waren blank vor Angst. Nicht ihre Mutter! Sie fühlte kaum, wie ihre Hände auf den Rücken gefesselt wurden, all ihre Sinne galten der Szene, die sich einige Schritte entfernt vor ihr abspielte. Der jüngere Mann diskutierte mit schnellen Handbewegungen mit den anderen, während der Mann, der ihre Mutter bedrohte, wenig begeistert zu sein schien. „Zwei Frauen sind zu umständlich!“ Taischeé las voller Schrecken die Zeichen. „Diese hier ist zu alt!“
Taischeé merkte, wie Tränen in ihr hochstiegen und konnte sie nicht zurückhalten. Diese Männer entschieden über das Leben ihrer Mutter, als wäre sie ein Ding und kein lebender Mensch. Plötzlich benutzten sie keine Gestensprache mehr, sondern flüsterten in dieser Sprache, die Taischeé nicht verstand. Mehrmals hörte sie „hiya“ von dem Jüngeren und sein energisches Kopfschütteln gab ihr Hoffnung. Er wollte ihre Mutter offensichtlich nicht töten, obwohl sie nicht verstand, warum. Kurz lockerte sich die Hand auf ihrem Mund und sie ruckte ihren Kopf frei. „Hiya!“, bat sie mit tränenerstickter Stimme. Ein Knebel wurde dem Mädchen in den Mund geschoben und unterdrückte das hilflose Schluchzen. Der Jüngere musterte sie mit gerunzelter Stirn, sichtlich überrascht, dass sie ein Wort in seiner Sprache gestammelt hatte. Er schien die Situation zu überdenken, dann machte er eine Bemerkung, die anscheinend lustig war, denn die anderen kicherten unterdrückt. „Wir lassen die Frau hier zurück!“ Er machte eine abschließende Handbewegung.
Ihre Mutter wurde gefesselt ins Gras geworfen und Taischeés Knie wurden schwach vor Erleichterung, kurz wallte die Dankbarkeit für den Jüngeren in ihr hoch.
Die Männer zerrten das widerstrebende Mädchen zwischen die Bäume und machten ihr mit Handzeichen klar, dass sie ihre Mutter doch noch töten würden, wenn sie sich nicht beeilte. Taischeé war so geschockt über diese erneute Drohung, dass sie widerstandslos mitlief, obwohl die gefesselten Hände einen ruhigen Dauerlauf unmöglich machten. Immer wieder überprüfte sie die Anzahl der Männer, hatte Angst, dass doch einer umkehrte und sich den Skalp ihrer Mutter holte.
Nach kurzer Zeit hatte Taischeé entsetzliches Seitenstechen, außerdem bekam sie mit dem Knebel im Mund nicht genügend Luft, um das schnelle Tempo durchzuhalten. Ihr wurde schwindelig und rote Lichter tanzten vor ihren Augen, ihre Schritte wurden zunehmend unsicherer. Zwei der Männer packten sie daraufhin rechts und links unter ihren Armen und schleiften sie weiter. Ihre gefesselten Hände brannten, außerdem hatte sie das Gefühl, dass ihre Arme aus den Gelenken kugelten. Wo war der ältere Bruder, der so sanft zu ihr gewesen war? Plötzlich sehnte sie seine Anwesenheit herbei, während ihr diese Männer mit ihrer Grobheit entsetzliche Angst machten. Wo wurde sie hingebracht? Als sie schließlich die wartenden Pferde erreichten, war sie zu Tode erschöpft. Wie ein schweres Fell wurde sie kopfüber auf ein Pferd gelegt und mit einem Strick um den Bauch festgeschnürt. Ihre Hände und Arme wurden taub, dafür spürte sie ihre Rippen umso mehr und Übelkeit stieg in ihr hoch. Die Männer schlugen ein schnelles Tempo an, trieben dabei einige Pferde vor sich her, die sie offensichtlich ebenfalls geraubt hatten. Sie waren so mit ihrer Flucht beschäftigt, dass sie kaum auf das Mädchen achteten, dass auf dem Pferd durchgeschüttelt wurde und unter entsetzlichen Schmerzen litt.
Die Männer ritten durch einen schmalen Canyon, trieben dann ihre Pferde in einen Bach, dessen kiesigem Bett sie eine Weile folgten. Erst nach einer geraumen Weile kehrten sie im Wasser um, plantschen den ganzen Weg wieder zurück, ehe sie den Bach wieder verließen und einen Geröllhang hinaufkletterten. Taischeé rutschte auf dem Pony immer weiter nach hinten, nur noch von dem Strick gehalten. Mit ihren gefesselten Händen war sie nicht in der Lage, ihre Position zu korrigieren und sie stöhnte, als die Fesseln durch den Druck immer tiefer in das Fleisch schnitten. Das Pony machte bei dem steilen Aufstieg manchmal einen Satz, der weitere Schmerzen auslöste.
Das Pony kletterte den steilen Grad entlang und hatte nun selbst Probleme das Gewicht des Mädchens auszugleichen, weil es nur noch an einer Seite hing und drohte ganz herunterzufallen. Einer der Männer, der hinter der Gefangenen ritt, glitt schließlich von seinem Pferd und machte die anderen auf ihre missliche Lage aufmerksam. Mit einem Messer durchschnitt er den Strick und Taischeé plumpste hilflos auf den steinigen Boden.