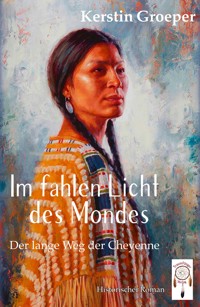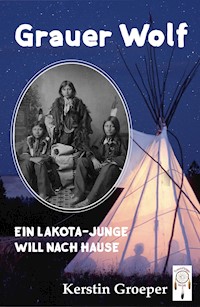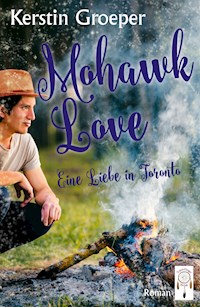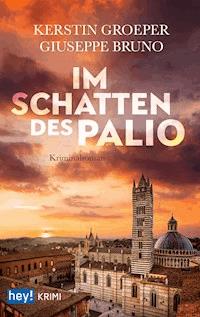Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kathleen wächst um 1920 in einem Pensionat in der Nähe von Pittsburgh auf. Immer wieder träumt sie von ihrer Vergangenheit, in der sie mit Großvater und Bruder in einem Tal in den Black Hills gelebt hat. In diesem naturverbundenen Leben hatten sie Lakota gesprochen, schöne Geschichten gehört und waren auf den wilden Mustangs geritten – Großvaters ganzer Stolz. Nach ihrem Schulabschluss versucht die junge Frau herauszufinden, warum sie von den Sheriffs aus dieser geliebten Umgebung gerissen wurde. Verzweifelt sehnt sie sich danach, endlich ihre Familie wiederzufinden, und nimmt deshalb eine Stellung als Lehrerin in der Schule in Rapid City an. Ihre ersten Nachforschungen führen sie zum Büro des Sheriffs. Wo sind ihr Großvater und ihr Bruder geblieben, die dem Volk der Lakota angehören? Sie weiß, dass sie selbst keine Lakota ist und möchte dem Rätsel ihrer Vergangenheit auf dem Grund gehen. Warum hatte sie mit den beiden fernab der Welt in der Wildnis gelebt? Und wer sind ihre wahren Eltern? Leben die Ponys noch? Dabei erfährt sie nicht nur von der schwierigen Situation der Lakota, sondern entwickelt Gefühle, mit denen sie nicht gerechnet hätte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kerstin Groeper
Träume von Salbei und Süßgras
Für Ava
Träume von Salbeiund Süßgras
Roman von
Kerstin Groeper
Impressum
Träume von Salbei und Süßgras, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag, Kerstin Schmäling, 2024
eBook ISBN 978-3-948878-45-0
Lektorat: Monika Nebl
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: iStock/Mercy_C_M_H
Copyright by TraumFänger Verlag,
Kerstin Schmäling, Hohenthann
Inhalt
Träume
Wer bin ich?
Pläne schmieden
Geisterpferde
Gefährliche Ablenkung
Abschied
Ankunft
Die Suche
Die Sechs Großväter
Tagebücher
Vater Buechel
Schulalltag
Das Rodeo
Der Prozess
Wicachpi win braucht Hilfe
Pocahontas
Die Rückkehr
Red Shirt
Weihnachten
Überraschung
Pha Sla – Der Kahle Kopf
Der alte Weg
Tracht
Powwow
Abschied
Buddy
Spirit Lake
Manitoba
Eine neue Heimat
Nachwort
Danksagung:
Mein Dank gilt all meinen Freunden und Lesern, die mich all die Jahre unterstützt haben.
Mein besonderer Dank geht an Carmen Vicari, die mir für dieses Buch so viele gute Ratschläge gegeben hat.
Und vielen Dank an Dorit Dewald, die das Manuskript nochmals durchgeackert hat.
Mehr geht nicht!
Träume
Kathleen schreckte hoch, als die Handarbeitslehrerin ungeduldig mit ihren Fingerknöcheln auf das Pult pochte. „Träumst du schon wieder?“
Desorientiert blickte Kathleen sich um. Entschwunden waren der leichte Wind in ihrem Traum und der Duft von Salbei. Vorbei waren der Anblick der schiefen Kiefern, das sorglose Lachen ihres Bruders und der Anblick der schroffen Berge im Hintergrund. Stattdessen befand sie sich in einem kargen Klassenzimmer mit grellen, weißgetünchten Wänden, hohen Fenstern, der schwarzen Schiefertafel und dem Geruch nach Bohnerwachs. Da war sie also: In dieser seltsamen Schule, in der sie „erzogen“ werden sollte – finanziert von der Regierung über einen Fond für Waisenkinder. Dabei war sie gar kein Waisenkind! Sie hatte einen liebevollen Großvater, der sie nach dem Tod des Vaters aufgezogen hatte, und einen Bruder, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Kurz zuckte sie zusammen, als sie sich wieder an diesen schrecklichen Tag erinnerte, an dem sie gewaltsam ihrer Familie entrissen worden war. Sie hatte kein Wort verstanden, was diese Sheriffs geschrien hatten, nur die Worte ihres Großvaters hallten immer noch in ihren Ohren: „Kiksuya yo!“ Erinnere dich!
Dann war sie in einem Fahrzeug weggebracht worden – für immer, hieß es.
Vor ihr tippten noch immer die Knöchel auf die Tischplatte und forderten ihre Aufmerksamkeit. Erschrocken blickte sie hoch und versuchte das Rasen ihres Herzens zu beruhigen. Diese Tagträume suchten sie immer häufiger heim – als wollten sie verhindern, dass sie die Worte ihres Großvaters und ihr Leben von damals tatsächlich vergaß. „Kiksuya yo!“
Die anderen Mädchen im Klassenzimmer kicherten und rückten mit ihren Stühlen hin und her. Aber die Lehrerin in ihrem steifen Rock und der hochgeschlossenen Bluse rügte sie sofort. „Seid still und arbeitet weiter!“ Das Kichern verging, und eifrig wandten die Mädchen sich wieder ihren Arbeiten zu.
Mit wässrigen blauen Augen blickte Kathleen die gestrenge Handarbeitslehrerin an. „Entschuldigen Sie bitte, Missis Grant. Ich war etwas abgelenkt.“
Prüfend tastete die Lehrerin über die Stickerei, die Kathleen gerade anfertigte: ein Blütenmuster am Kragen einer Bluse. „Sehr hübsch!“, wurde sie gelobt. „Aber du solltest dich nicht so leicht ablenken lassen.“
„Ja, Missis Grant!“, antwortete Kathleen folgsam. Sie hatte gelernt, dass es besser war, sich dem strengen Reglement zu fügen. „Ich habe ein wenig Kopfschmerzen.“
„Oh, vielleicht solltest du ein Glas Wasser trinken?“ Die Lehrerin blickte sie leicht besorgt an.
Kathleen nickte und trat zum Waschbecken, um ein paar Schlucke zu nehmen. Das Wasser schmeckte abgestanden und metallisch, nicht nach der Reinheit der Quelle, aus der sie als Kind getrunken hatte. Vorsichtig benetzte Kathleen ihre Stirn und gewann an Klarheit. Sie musste diese Tagträume besser kontrollieren!
Die Lehrerin schritt zum nächsten Pult, um sich dort um einen weiteren Schützling zu kümmern. Die Mädchen im Alter von vierzehn bis siebzehn Jahren trugen alle die gleichen blauen Röcke mit weißen Blusen und darüber gestreifte Schürzen – die Schuluniform der Einrichtung.
Kathleen beugte sich über die Stickerei und dachte über den kurzen Traum nach, aus dem sie gerade geweckt worden war. Sie hatte wieder in dieser alten Sprache geträumt, die ihr viel vertrauter war als das Englische, das sie erst seit ihrer Ankunft vor sechs Jahren mühsam hatte lernen müssen. Niemand hier hatte verstanden, warum sie damals kein Englisch konnte, und das hatte das Rätsel um ihre Herkunft noch vergrößert. „Eine Wilde, die bei Indianern aufgewachsen war“, wurde hinter ihrem Rücken getuschelt.
„Eine Wilde?“ Sie war beileibe keine „Wilde“, sondern ihr Großvater hatte sie behütet und beschützt. Sie verstand nicht, warum man ihr nicht glaubte, sondern den alten Mann für einen Kindesentführer hielt. Auch ihr Bruder war in die Obhut einer Einrichtung gewandert und sie vermisste ihn so sehr. Irgendwann, wenn sie endlich als „erwachsen“ galt, würde sie sich auf die Suche nach den beiden begeben. Irgendwann würde sie ihre Familie wiederfinden und dann wäre dieser ganze Spuk vorbei. In ihrem Kopf summte sie unhörbar ein kleines Mutmachlied, das ihr Großvater sie gelehrt hatte. Immer, wenn sie Kraft brauchte, hielt sie sich daran fest. Das alte Lakota beruhigte sie auf wundersame Weise und half ihr das Heimweh und die Einsamkeit zu überwinden. „Tunkashila, wamashake shni, ca omakiya ye!“ Sie sang es nur noch unhörbar, weil sie nicht wieder dafür bestraft werden wollte, wenn sie die alte Sprache benutzte. Es war eine heidnische Sprache, die hier nicht erwünscht war. Dabei wusste hier niemand, um welche Sprache es sich überhaupt handelte – woher also wollten sie wissen, dass sie von Heiden abstammte?
„Alle Indianerdialekte sind heidnisch und vom Teufel besessen!“, hatte Mutter Oberin ihr erklärt und sie durch die dicke Brille hindurch streng angesehen. „So etwas wollen wir hier nicht.“
Also hatte Kathleen ihr Geheimnis tief in sich begraben und gelernt, sich „wie es sich geziemt“ auszudrücken. Die Mutter Oberin zeigte sich jedenfalls sehr zufrieden über ihre Fortschritte und lobte sie über alle Maßen. Im Gegensatz zu den anderen Mädchen war Kathleen ausgesprochen pflichtbewusst und gehorsam. Das lag aber auch daran, dass Kathleen es als unschicklich ansah, wie frech sich manche der Mädchen gegenüber den Lehrerinnen und Nonnen benahmen. Ihr Großvater hatte ihr da ein anderes Benehmen beigebracht. Außerdem erinnerte sie sich nur zu lebhaft an die Zeit zurück, als sie hier angekommen war und kein Wort verstanden hatte. Sie war sprachlos gewesen, apathisch, herausgerissen aus einem Umfeld, das sie seit ihrer frühen Kindheit gekannt hatte. Hier war alles fremd gewesen, chaotisch und laut – mit Regeln und Anweisungen, die sie nicht verstanden hatte. Trotzdem hatte sie schnell gelernt, sich anzupassen, und versucht, Ordnung in die große Unordnung zu bekommen.
Man war ihr gewogen gewesen, hatte Mitleid mit ihr gehabt – nur Antworten auf ihre Fragen hatte man ihr nicht gegeben. Ihre ersten zögerlichen Versuche, sich nach ihrem Bruder oder ihrem Großvater zu erkundigen, waren im Keim erstickt worden. „Kind, man hatte dich entführt! Vergiss die beiden! Du wirst sie nie wieder sehen!“
Aber wenn die beiden nicht ihr Großvater oder ihr Bruder waren, wer war sie dann wirklich? Wer waren ihre wahren Eltern? Aber auch das wurde nur mit einem Schulterzucken beantwortet. „Du bist anscheinend ein Waisenkind. Der Staat zahlt großzügigerweise für deine Ausbildung. Sei also dankbar!“
Kathleen fügte sich. Als man sie hergebracht hatte, war sie zu klein gewesen, um sich zu wehren. Aber sie hatte sich geschworen, die Erinnerung an ihr früheres Leben zu bewahren. Inzwischen verfolgte sie einen anderen Plan: So viel zu lernen wie möglich – und dann zurückzukehren. Irgendwann würde sie ihren Großvater, ihren lieben „Lala“, und ihren Bruder finden – und vielleicht dem Geheimnis ihrer wahren Herkunft auf die Spur kommen. Wer war sie wirklich? Wenn sie in den Spiegel sah, wusste sie, dass sie keine Indianerin war. Dafür waren ihre Haut zu weiß und ihre Haare zu hell. Sie hatte schöne lange braune Haare mit leichten Locken – die sie gerne zu einer Flechtfrisur zusammensteckte. Als man sie hergebracht hatte, waren sie noch zu zwei Zöpfen geflochten gewesen, aber diese „Indianersitte“ hatte man ihr ausgetrieben. Unwillkürlich fasste sie nach einer Haarnadel, die sich etwas gelöst hatte, und stickte dann weiter an dem blauen Blütenmuster. Sie liebte das Fach Handarbeit, weil sie dann ihren Gedanken nachhängen konnte. Auch die Lehrerin war nett und normalerweise sehr geduldig. Kathleen war ohnehin sehr geschickt, sodass die Lehrerin sie gern hatte. „Wenn doch nur alle meine Schülerinnen so begabt wären!“, lobte sie Kathleen oft.
Kathleen schloss für einen Augenblick die Augen und rief den Traum in sich hoch. Er war so schön gewesen: Sie befand sich wieder im Zelt des Großvaters, der seine schönen Geschichten erzählte. Sie begannen immer mit „Ehanni“ – vor langer Zeit – und endeten mit „Oihanke“ – das Ende. Es waren Geschichten um tapfere Krieger, listige Spinnenwesen und mutige Frauen. Manchmal verliebte sich ein Krieger in eine Büffelkuh, und ein anderes Mal ging eine Schildkröte auf den Kriegspfad und trickste die Menschen aus. Abends, wenn sie allein in ihrem Bett lag, wiederholte sie in Gedanken all diese Geschichten, damit sie nichts davon vergaß. Auch ihre Lieblingsgeschichte hatte sie schon oft in Gedanken nacherzählt. Sie handelte von einem berühmten Häuptling, dessen Ehefrau untreu gewesen war. Sie hatte sich in den Cousin des Häuptlings verliebt, und das ganze Dorf wusste um den Betrug. Aber der Häuptling, obwohl er von dem Betrug wusste, tat nichts, sondern ließ es zu, dass die Frau zu dem Cousin zog. Nach einer Weile kehrte die Frau wieder zu ihrem Mann zurück, und das ganze Dorf wartete darauf, dass es nun im Tipi hoch her gehen würde – aber nichts dergleichen geschah. Der Häuptling fragte seine Frau nur, ob sie nun glücklich wäre. „Ja!“, sagte die Frau, und so schwieg der Häuptling.
Eines Tages aber gingen alle zur Büffeljagd – nur der Cousin nicht, da er faul und feige war. Nach der Büffeljagd sattelte der Häuptling sein bestes Pferd, setzte die Frau hinauf und brachte sie zu dem Cousin. „Cousin, ich sehe, dass du nicht Manns genug bist, um zu jagen und eine Frau zu finden. Ich schenke dir nun dieses Pferd, damit du zukünftig zur Jagd gehen kannst. Außerdem gebe ich dir mein Tipi, damit du ein Zuhause hast! Und hier hast du meine Frau, da du nicht Manns genug bist, dir selbst eine zu suchen. Ich kann mir jederzeit eine neue Frau suchen und sie auch ernähren und ihr ein neues Tipi schenken.“
Die Frau jammerte zwar, aber der Ehemann blieb hart und nahm sie nicht zurück. Die Dorfbewohner hingegen bewunderten den Häuptling für seinen Großmut und seine Großzügigkeit.
Kathleen öffnete wieder die Augen und schmunzelte. Sie hatte nie verstanden, warum eine Frau überhaupt so untreu hatte sein können und hatte daher kein Mitleid mit der Frau gehabt. „So etwas gehört sich nicht!“, hatte ihr der Großvater erklärt.
Ihr Bruder war da ebenso unnachgiebig. „Ich hätte die Frau und den Nebenbuhler getötet!“, hatte er mit fester Stimme gedroht.
„Wozu?“, hatte der Großvater zu Bedenken gegeben. „Die Frau und der Mann haben sich durch ihre Taten selbst entehrt. Alle haben sie verachtet! Aber den Häuptling haben sie für seine Nachsicht bewundert. Wem ist also der Schaden entstanden?“
Kathleen wusste noch, wie sie nachdenklich den Kopf gesenkt hatte. Ja, Großvater hatte recht gehabt: Man sollte stets so handeln, dass man sich für seine Taten nicht schämen musste.
Wieder vertiefte sich Kathleen in die Handarbeit und dachte über die Worte des Großvaters nach. Damals hatte sie „Wagmiza win“ – Maismädchen geheißen. Mais war etwas sehr Nützliches, und so hatte der Name eine gewisse Kraft. Der Name Kathleen hatte für sie keine Bedeutung. Der Name war von der Mutter Oberin ausgesucht worden, weil man nicht herausfinden konnte, woher sie eigentlich stammte. Er war zufällig gewählt worden. Kathleen hörte auf diesen Namen, obwohl sie in Wahrheit immer noch Wagmiza win war. Ihr Nachname war „Palmer“ – aber auch der schien zufällig gewählt worden zu sein.
Das Fach Handarbeit war die letzte Stunde vor dem Mittagessen und mit dem Gong standen die Schülerinnen geräuschvoll auf, um in den Speisesaal zu gehen. Stühlerücken und Gekicher erfüllten den Raum.
Die Lehrerin klatschte empört in die Hände. „Mädchen, Mädchen, nun räumt doch noch schnell auf!“
Mit fahrigen Bewegungen stopften die Schülerinnen ihre Arbeiten in die bereitstehenden Körbchen und stellten sie in ein hohes Regal, dann verließen sie plappernd den Raum. Kathleen tat es ihnen gleich und folgte ihnen in die Mensa. Sie setzte sich an einen der langen Tische und wartete darauf, dass zwei Mädchen, die für die Essensausgabe eingeteilt waren, ihr den Teller füllten.
Neben ihr saß Lucy, mit der sie das Zimmer teilte. Die größeren Mädchen genossen den Vorteil, nicht mehr in Schlafsälen zu schlafen, sondern ihr eigenes Zimmer zu haben, das sie nur mit einer weiteren Person teilen mussten. Es gab ihnen ein wenig Privatsphäre.
Lucy war nett und liebte es, von Kathleens wilder Vergangenheit zu hören. Wenigstens Lucy konnte sie all die Geschichten erzählen, die sie als Kind erlebt hatte. Dann lagen sie gemeinsam unter der Bettdecke und tuschelten. Das war schön und erinnerte sie an ihr Zuhause. Lucy war ebenfalls ein Waisenkind: Die Mutter war bei der Geburt gestorben und der Vater im Krieg gefallen. Er war ein Oberst der Armee gewesen, und die Regierung hatte die Kosten für die Erziehung übernommen, nachdem es sonst keine Verwandten gab, zu denen man das Kind hätte hinschicken können. Es war großzügig, denn sonst wäre Lucy wohl im Armenhaus gelandet.
„Was gibt es denn heute?“, erkundigte sich Lucy mit rollenden Augen. Sie aß gerne und viel. Dabei war sie spindeldürr und hochgewachsen.
Kathleen zog die Schultern hoch. „Keine Ahnung!“ Es war ihr tatsächlich egal, denn eigentlich schmeckte ihr hier nichts. Sie vermisste das frische Fleisch, den Fisch, oder die frischen Früchte, die sie früher gegessen hatte. Ihr Tag war davon bestimmt gewesen, nach Nahrung oder Brennholz zu suchen, die Jagdbeute des Großvaters zu verarbeiten oder sich um das Tipi zu kümmern. Auch ihr Bruder war schon früh zur Jagd gezogen und hatte Enten, Fische und Kaninchen gefangen. Es hatte so lecker geschmeckt.
Es wurde gebetet, dann wurde mit einer Kelle das Essen auf ihren Teller geklatscht. Sie rümpfte die Nase. Bohneneintopf! Man brauchte schon eine Lupe, um darin ein Stückchen Fleisch zu finden. Lucy kicherte albern und stocherte mit der Gabel in dem Essen herum. „Ob da tatsächlich Bohnen drin sind?“, flüsterte sie frech.
„Höchstens Stroh“, behauptete Kathleen.
„Schweigt, Mädchen!“, kam es ermahnend vom Tisch der Nonnen. „Wir wollen Gottes Gaben ehren.“
„Gottes Gaben“, prustete Lucy los. Sie war ein bisschen zu laut, sodass die Aufmerksamkeit sich ihr zuwandte.
„Lucy, möchtest du uns etwas sagen?“, fragte Mutter Oberin. In ihrem schwarzen bodenlangen Gewand sah sie eher wie eine Hexe aus, die drohend über die Brillengläser hinweg die Mädchen musterte.
„Aber nein!“, versicherte Lucy. „Mein Magen hat nur laut geknurrt. Es sieht sehr lecker aus!“
Alle Häupter senkten sich vor unterdrücktem Gelächter, doch die Nonnen ignorierten es. Sie wussten, dass das Essen oft sehr eintönig war.
Nach dem Essen herrschte „Ruhezeit“, in der die Mädchen entweder lesen oder spazieren gehen durften. Kathleen vertiefte sich gern in ihrem Zimmer in ein Buch. Nachdem sie erst mit zwölf Jahren lesen und schreiben gelernt hatte, eröffneten sich ihr hier nun völlig neue Welten. Bisher hatte sie ja nur das Tal gekannt, in dem sie aufgewachsen war, aber nun las sie „Onkel Toms Hütte“ oder die Geschichten von Jules Verne oder Mark Twain.
Die Schritte der Mädchen hallten durch die Gänge, Türen klapperten, dann wurde es still.
Kathleen setzte sich auf ihr Bett und blickte sinnend aus dem Fenster heraus. Ihr Zimmer lag in Richtung des Parks, und sie genoss den Ausblick auf die alten Eichen. Sie liebte es, die Eichhörnchen zu beobachten, die geschwind von Ast zu Ast hüpften. Es erinnerte sie an ihr Zuhause – obwohl es dort eher Kiefern und Pflaumenbäume gegeben hatte. Der Wind strich durch die Blätter und erzeugte ein beruhigendes Rauschen. Wenn sie die Augen schloss, war sie wieder in dem Tal und fühlte die Sonne in ihrem Gesicht.
„Erzählst du mir, was du mit deinem Bruder gespielt hast?“, hörte sie die Stimme ihrer Freundin.
Mit einem hörbaren Seufzen kehrte Kathleen in die Realität zurück. „Gespielt?“, wiederholte sie sinnend.
„Ja, Kinder spielen doch, oder nicht?“
„Hm! Wir hatten nicht so viel Zeit zum Spielen. Meistens habe ich mich um den Haushalt gekümmert. Ich habe Holz gesammelt, Beeren gepflückt, Felle gegerbt, Essen gekocht und genäht.“ „Das klingt ja so, als wärst du ein Dienstmädchen gewesen!“
„Überhaupt nicht!“, verteidigte sich Kathleen. „Es waren einfach meine Aufgaben. Im Winter hat mir mein Bruder dabei auch geholfen.“
„War das nicht oft langweilig?“
„Wie kommst du darauf? Ich hatte immer etwas zu tun. Und im Winter hat uns unser Großvater schöne Geschichten erzählt oder wir haben Würfelspiele gespielt.“
„Ah, also doch!“, freute sich Lucy.
Kathleen lächelte leicht. „Ja, wir haben auch Geschicklichkeitsspiele gemacht. Aber da hat Mathola immer gewonnen.“
„Mathola?“
„Ja, so heißt mein Bruder. Es bedeutet Kleiner Bär.“
„Den würde ich gern mal kennenlernen“, schwärmte Lucy.
„Und ich würde ihn gern wiedersehen“, sagte Kathleen bedrückt.
„Das wirst du!“, versicherte Lucy. „Das wirst du!“
„Ich weiß nicht einmal, wo er jetzt ist. Die sagen mir ja nichts.“ „Vielleicht steht ja was in den Unterlagen? Da müsste ja ein Verweis sein, wo sie dich gefunden haben. Dein Großvater und dein Bruder werden wahrscheinlich immer noch dort sein. Wenn du erst erwachsen bist, dann fährst du dort einfach hin.“ Lucys Augen rollten wieder vor Abenteuerlust. „Ich könnte dir ja helfen!“
„Wobei?“
Lucy senkte die Stimme zu einem Flüstern. „In den Unterlagen nachzuforschen.“
„Du meinst …?!“
„Genau! Wir schleichen uns ins Büro von Mutter Oberin und schauen nach, ob wir was herausfinden können.“
Kathleens Herz klopfte etwas schneller. Einbrechen? Und wenn sie dabei erwischt wurden?
Sie hasste es, gegen Regeln zu verstoßen. So war sie einfach nicht erzogen worden. Andererseits wollte sie zu ihrer Familie zurück, und da war es vielleicht gut, die Kriegerin in ihr zu wecken. Sie hatte gelernt, sich zu verteidigen – und wenn nötig auch zu jagen. Sie würde sich an ihre Feinde heranschleichen und sie ausspionieren – wie ein Scout es tun würde. Daran war nichts Verwerfliches. Man hatte sie gegen ihren Willen hierher verschleppt. Aber sie musste vorsichtig sein! Sie hatte das Vertrauen von Mutter Oberin gewonnen und wollte dies nicht gefährden. Nicht einmal mehr ein Jahr und sie wäre ohnehin frei und konnte gehen, wohin es ihr beliebte.
„Mal sehen“, wich sie aus. „Wir brauchen einen guten Plan.“ Sie hatte gelernt, geduldig zu sein und auf den richtigen Augenblick zu warten.
„Och!“, stöhnte Lucy enttäuscht. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten sie schon morgen zugeschlagen. Sie liebte Abenteuer!
„Wir müssen erst in Erfahrung bringen, wo der Schlüssel ist, wenn Mutter Oberin das Büro verlassen hat.“
„Der hängt immer am Schlüsselbund.“ Lucy schob sich unwillig eine Locke aus dem Gesicht. „Wir müssten sie plötzlich herauslocken – zu einem Notfall!“, schlug sie vor.
„Dann kann es aber sein, dass sie schnell zurückkommt“, gab Kathleen zu bedenken.
„Hm!“ Lucys Gesicht verdunkelte sich. „Das braucht wohl doch noch mehr Planung“, gab sie zu.
„Glaube ich auch!“ Kathleen vertiefte sich in ihr Buch, und auch Lucy schnappte sich eine Lektüre, sodass es still wurde. Nur vom Gang drangen die gewohnten Geräusche herein: Das ferne Klappern von Geschirr aus der Küche, das entrückte Singen der Nonnen in der Kapelle und das leise Tapsen von Schuhen, weil vermutlich ein Kind gerade zur Toilette schlich.
Wer bin ich?
Am Nachmittag stand körperliche Ertüchtigung in der Turnhalle auf dem Stundenplan, und sie übten das anmutige Balancieren mit einem Reifen. Es machte Spaß und lenkte von dem strengen Schulalltag ab. Die Bewegungen erinnerten Kathleen an einen Tanz, den ihr Bruder immer geübt hatte. Erst hatte er nur mit einem Reifen getanzt und Geschicklichkeitsübungen gemacht und dann mit mehreren Reifen Figuren aus der Mythologie geformt. Sein Kunststück war ein Adler aus fünf Ringen und die Darstellung der Erde. Die Reifen hatte er aus Weidenzweigen geformt und mit Leder kunstvoll umwickelt. Eigentlich war es ein Heilungstanz, sodass der Großvater immer recht lange Erklärungen dazu abgegeben hatte. Einer Intuition folgend, versuchte Kathleen in ihrem Rock durch den Reifen zu springen – so wie man es beim Seilspringen machte – und es gelang ihr! Die Lehrerin hatte es beobachtet und lobte sie. „Mach es doch noch mal und zeige es den anderen.“
Also sprang Kathleen in gebückter Haltung durch den Reifen und ließ ihn dann anschließend um ihr Handgelenk kreisen. Die anderen Mädchen kicherten und versuchten, es nachzuahmen. „Wo hast du denn diese Übung gesehen?“, wollte die Lehrerin wissen.
„Ach, einfach so“, wich Kathleen aus. Sie wollte es nicht riskieren, dass ihr wieder etwas Heidnisches vorgeworfen wurde. „Es ist ja fast wie Seilspringen.“
„Da hast du recht!“, stimmte die Lehrerin zu. Sie wandte sich an die anderen: „Körperliche Ertüchtigung ist sehr wichtig für euch! Ihr müsst später einmal sehr auf eure Figur achten, damit eure Ehemänner stolz auf euch sind.“
Wieder erklang Kichern. Aber die Erziehung sah vor, dass aus den Mädchen einmal tugendhafte, sittsame Ehefrauen wurden. Daher auch all der Unterricht in Haushaltsführung, Handarbeit und Kochen. Nur wenige Mädchen hatten andere Pläne und wollten vielleicht einmal als Lehrerin arbeiten. Sie erhielten hierzu auch Unterricht in Arithmetik, Geografie und Geschichte. Hierzu kam eigens einmal die Woche ein Lehrer an die Schule. Kathleen liebte die Herausforderung und hatte jedes Mal rote Wangen vor Aufregung. Sie sah es als Privileg an, dass sie diesen Unterricht besuchen durfte. Eines Tages würde sie in den Westen gehen, ihre Familie suchen und dort als Lehrerin arbeiten. So etwas wurde bestimmt gesucht. Sie war bereits im zweiten Ausbildungsjahr und hatte damit ihren schulischen Rückstand sehr schnell aufgeholt. Mutter Oberin hielt allerdings nicht viel von ihren Plänen, in den Westen zu gehen. „Mein Kind“, erläuterte sie stets. „Du hast doch hier viel bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn du an ein Mädchenpensionat gehst, wärst du in nur wenigen Jahren Leitung.“
„Meinen Sie wirklich?“, hatte Kathleen gefragt. „Ich könnte mich ja bewerben …“ Sie würde in Zukunft vorsichtiger sein, was sie der Oberin erzählte. Eines Tages würde sie einfach ihren Koffer packen und gehen. Der Staat zahlte ohnehin nur bis zu ihrem Abschluss. Sie rechnete nach: nur noch sechs Monate! Dann wäre sie frei – aber auch arbeitslos und obdachlos, wenn sie bis dahin nichts gefunden hatte. Es wurde langsam Zeit, sich umzusehen.
Am Abend saß sie noch an ihrem Schreibtisch im Zimmer und las die Stellenanzeigen. Lehrerinnen wurden fast überall gesucht, aber natürlich nur in Pennsylvania, wo das Internat lag. Wie sollte sie an Stellen kommen, die im Westen angeboten wurden? Ob es dort eine Zeitung gab, in der sie inserieren konnte? Und wie sollte sie mit einer solchen in Kontakt treten? Und noch schwieriger: Wie sollte sie die Anzeige bezahlen? Sie hatte kein Geld zur Verfügung. Wieder wurde ihr das Dilemma bewusst, unter dem sie seit sechs Jahren litt: Sie war ein Waisenkind.
„Erinnerst du dich eigentlich an deinen richtigen Vater?“, fragte Lucy unvermittelt.
Kathleen runzelte die Stirn und legte die Zeitung beiseite. „Nicht wirklich …“, antwortete sie zögernd.
„Klingelt denn bei dir nichts, wenn du an deinen Daddy denkst?“
„Daddy?“ Kathleen hörte in sich hinein. Nein, das Wort brachte keine Erinnerungen. Überhaupt keine. Für sie gab es nur „Lala oder Tunkashila“ – ihren Großvater.
„Manchmal hat man doch so verschwommene Erinnerungen“, behauptete Lucy. „Ich weiß noch, dass meine Mama mir immer vorgesungen hat, ehe sie gestorben ist.“
„Ich dachte, dass deine Mutter bei der Geburt gestorben sei“, wunderte sich Kathleen. „Wie kannst du dich dann an ihr Singen erinnern?“
Lucy starrte sie mit großen Augen an. „Stimmt! Dann war es wohl das Kindermädchen, das mein Vater eingestellt hatte. Na, so was …“
„Wahrscheinlich!“ Kathleen kicherte leicht. „Und dein Vater? Erinnerst du dich an ihn?“
„Aber klar! Ich war ja schon zehn, als er starb. Er war immer sehr streng und hatte eine tiefe Stimme. Und er sah sehr schick in seiner Uniform aus.“
Kathleen blickte sinnend aus dem Fenster. „Ich habe kaum eine Erinnerung an meinen Vater. Ich war wohl noch sehr klein, als er starb. Ich weiß nur, dass er Zigarren geraucht hat. Sie rochen so süßlich … wie die Pfeife meines Großvaters. Vielleicht erinnere ich mich deshalb daran.“
„Woher willst du wissen, dass er gestorben ist?“
„Weil mein Großvater es mir erzählt hat. Mein Vater ist irgendwo abgestürzt. Manchmal sind wir an sein Grab gegangen, aber das ist auch schon alles.“
„Warum war dein Vater dort überhaupt unterwegs?“
„Ich glaube, er hat etwas gesucht.“
„Und was hat er gesucht?“
Kathleen zuckte die Achseln. Ihr Großvater hatte nie viel erzählt. Über Tote redete man nicht. „Keine Ahnung.“
„Das wäre aber schon interessant. Dann könnte man vielleicht in Erfahrung bringen, wer deine wahren Eltern waren.“
Das stimmte allerdings. Sie fragte sich, warum die Polizei damals keinerlei Nachforschungen angestellt hatte. „Ich muss dort noch mal hin!“, erklärte sie bestimmt. „Vielleicht finde ich ja etwas heraus. Oder mein Großvater erzählt mir mehr.“
„Ich frage mich, warum er es überhaupt verschwiegen hat.“
„Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er mich schützen wollte.“
Lucy riss ungläubig die Augen auf. „Indem er dich in die Wildnis verschleppt? Das ist doch Unsinn.“
„Er hat mich nicht verschleppt!“, verteidigte Kathleen ihren Großvater. „Wir haben dort gelebt. Immer schon. Ich kann mich an keinen anderen Ort erinnern.“
„Spannend!“, musste Lucy zugeben. „Stell dir mal vor, du bist vielleicht irgendeine verschollene Prinzessin. Könnte doch sein, oder?“
„Quatsch. So etwas gibt es nur im Märchen! Vielleicht war mein Vater ein Bankräuber, der dort Unterschlupf gesucht hat? Es muss doch einen Grund geben, warum er abseits der Zivilisation gelebt hat.“
„Wow! Das wäre aber auch spannend.“ Lucy kicherte hemmungslos los. „Du – als die Tochter eines Bankräubers!“
„Na ja, ich hoffe, dass sich das nicht als die Wahrheit herausstellt.“ Sie seufzte tief. Wer war sie wirklich? Irgendwo zwischen Bankräubertochter und Prinzessin würde die Wahrheit zu finden sein. Vielleicht war ihr Vater nur ein einfacher Tagelöhner oder Vagabund gewesen, der sich durch das Leben geschnorrt hatte. Er hatte das einsame Tal entdeckt, hatte dort eine Zeitlang mit den beiden Indianern gelebt, war gestürzt und hatte den Tod gefunden. Das war wohl die plausibelste Erklärung. Und sie war in keiner Weise romantisch. Sie sah an sich herunter: Dann wären diese saubere, gepflegte Kleidung, die Erziehung, die sie hier genoss, und das ordentliche Zimmer, in dem sie leben durfte, wahrlich ein sozialer Aufstieg und viel mehr, als der Vater ihr hätte bieten können. Trotzdem wollte sie wissen, wer sie wirklich war. Sie wollte endlich ihre Herkunft klären, und das gelang ihr vermutlich nur, wenn sie Großvater wiederfand. Sie war nun kein Kind mehr, sondern eine erwachsene Frau. Jetzt würde er gewiss ihre vielen Fragen beantworten.
In der Nacht wurde sie wieder von diesem Alptraum heimgesucht: Sheriffs mit groben Händen rissen sie von ihrem Großvater weg und redeten in einer Sprache auf sie ein, die sie nicht verstand. Im Hintergrund stand Mathola einfach nur da und beobachtete entsetzt die Szene. Er wirkte so hilflos, so traurig und so verloren. Auch er wurde weggeführt – aber in ein anderes dieser stinkenden Fahrzeuge. Sie hatte so etwas noch nie gesehen und fürchtete sich davor. „Hiya, hiya!“, hatte sie geschrien. „Nein, nein!“ In ihren Träumen sprach sie immer nur in der alten Sprache – in Lakota. Noch hatte Englisch keinen Einzug in ihre Träume gehalten. Und dann war da noch eine andere Sprache – eine längst verschollene – an die sie sich nur dunkel erinnerte. Jedenfalls war es kein Englisch. Aber immer wenn sie aufwachte und sich daran erinnern wollte, war diese andere Sprache wie weggewischt. Sie wusste, dass es wichtig war, aber sie konnte die Erinnerung nach dem Aufwachen einfach nicht mehr abrufen.
Wieder saß sie im Traum in diesem ratternden Zug, der sie nach Osten in das Mädchenpensionat gebracht hatte. Eine Dame im langen Rock begleitete sie, doch die fremde Frau konnte ihre Barriere, die sie zum Schutz aufgebaut hatte, nicht durchbrechen. Kathleen schaute stur zum Fenster hinaus und sah die Landschaft an sich vorbeigleiten. Sie wollte nicht weg! Sie wollte zurück zu ihrem Großvater! Aber niemand hatte sie verstanden, als sie immer wieder gebettelt hatte, zu ihrem Großvater zurückzudürfen. Schließlich hatte man nach einem Dolmetscher verlangt, der jedoch auch nicht viel aus ihr herausgebracht hatte, weil sie zu diesem Zeitpunkt schon entschieden hatte, mit niemandem mehr zu reden. Der Dolmetscher hatte ihr schließlich erklärt, dass man sie im Osten in eine Schule schicken würde, wo sie die Sprache des Weißen Mannes lernen würde. Ihr war inzwischen alles egal gewesen. Sie wollte zu ihrer Familie zurück und sonst nirgends hin. „Er ist nicht dein wahrer Großvater“, hatte der Dolmetscher erklärt. „Wahrscheinlich hat er dich als kleines Kind entführt. Du bist keine Indianerin.“
„Er hat mich nicht entführt“, hatte Kathleen gefaucht. „Ich habe dort immer schon gelebt.“
„Wie erklärst du dann, dass du ein weißes Kind bist?“
Kathleen hatte die Zähne aufeinandergebissen. „Gar nicht. Großvater hat erzählt, dass mein Vater einen Unfall gehabt und er mich dann aufgezogen hat.“
Großvater hatte den Sheriffs das Grab gezeigt, aber das hatte nichts daran ändern können, dass Kathleen in den Osten geschickt worden war. „Die Wildnis ist nichts für ein weißes Mädchen!“, hieß es vonseiten der Behörden. „Der alte Mann wäre verpflichtet gewesen, dich in einem Waisenhaus abzuliefern.“
„Wahrscheinlich wollte er genau das nicht“, hatte Kathleen erwidert. Sie verstand nicht, warum nun wildfremde Menschen für sie die Entscheidungen trafen. Sie hatte doch einen Großvater!
Die Dame hatte sie bei Mutter Oberin abgeliefert und der Oberin eine Mappe mit Unterlagen überreicht, in der alle Informationen zu dem neuen Schützling gesammelt waren. Dann hatte die Frau sich mit einem letzten mitleidigen Nicken verabschiedet.
Kathleen hatte der Mutter Oberin gegenüber gesessen, die umständlich in den Unterlagen geblättert hatte. „Soso“, hatte sie dann gemurmelt. Alles andere hatte Kathleen nicht verstanden. Sie war der Oberin gefolgt, die ihr neue Kleidung und einen Platz in einem Schlafsaal zugewiesen hatte. Dann war sie an Madame Frerichs übergeben worden, die ihr mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben hatte, dass sie nun für das Mädchen verantwortlich war. Alles war laut und fremd gewesen, und sie hatte blutige Lippen vor Angst gehabt, weil sie so fest darauf gebissen hatte.
Kathleen schreckte aus dem Traum hoch und schaute sich orientierungslos im Zimmer um. Neben ihr schlief Lucy tief und fest. Mit einem Seufzen ließ Kathleen sich zurücksinken und starrte im Dunkeln an die Decke. Sie erinnerte sich noch gut an die erste Zeit im Internat. Sie hatte kein Wort verstanden, und die anderen Mädchen hatten über sie getuschelt, weil sie weder lesen noch schreiben konnte. Kathleen hatte auch noch nie eine Stadt gesehen, kannte keine Stühle und Tische, hatte noch nie in einem richtigen Bett geschlafen oder in einem Klassenzimmer gesessen. Auch die vielen Menschen und der Lärm machten ihr anfangs zu schaffen. Wo fand man hier Ruhe? Die hohen Räume gaben den Hall wider, und selbst nachts gab es immer irgendeine Geräuschkulisse. Aber der geordnete Tagesablauf und die vielen Rituale hatten ihr geholfen, sich schnell einzugewöhnen und die Sprache zu lernen. Sie war jung und wissbegierig. Nur das Essen war eine Herausforderung, denn es schmeckte ihr nicht. Alles war viel zu salzig oder generell zu stark gewürzt. Auch das Wasser schmeckte schal, und Milch vertrug sie überhaupt nicht. Madame Frerichs hatte bei ihr eine Ausnahme gemacht und erlaubt, dass sie stattdessen Tee trank. Kathleen hatte immer ganz grün ausgesehen, wenn sie ihr Glas Milch trinken sollte. Das war etwas, an das sie sich einfach nicht hatte gewöhnen können. Jetzt merkte man ihr die seltsame Herkunft nicht mehr an. Sie sprach akzentfrei Englisch, und ihre Erziehung war vorbildlich. Sie konnte gepflegt eine Unterhaltung führen, mit abgespreiztem Finger ihre Tasse Tee trinken und wunderschöne Stickereien anfertigen – als wäre sie eine Tochter aus gutem Hause. Sogar eine kleine Aussteuer hatte sie schon zusammen – eine Beigabe der Regierung, wenn die Mädchen das Pensionat verließen. Die meisten gingen ohnehin nur, um zu heiraten oder als Hausmädchen zu arbeiten.
Am schönsten waren für Kathleen die Sonntage: Da ging es morgens in die Kirche, wo immer so schön gesungen wurde. Das hatte ihr von Anfang an gefallen. Auch die Predigten fand sie interessant – als sie begann, sie zu verstehen. Sie widersprachen nicht dem, was Großvater ihr erzählt hatte. Anstelle von „Spirits“ überbrachten hier nun Engel oder der Heilige Geist Botschaften an die Gläubigen. Für sie war es das Gleiche. Weniger schön fand sie die Geschichten um den Teufel oder das Fegefeuer, aber auch bei den Lakota gab es böse Spirits, die die Menschen verführten oder ihnen Schlechtes brachten. Doch der Glauben hielt einen Leitfaden bereit, wie man das Fegefeuer vermied, sodass Kathleen beruhigt war. Solange man ein gottgefälliges Leben führte, brauchte man sich keine Sorgen zu machen. Die Regeln waren einfach: Vor dem Essen beten, sonntags in die Kirche gehen und sittsam bleiben.
Nach der Kirche gab es immer einen schönen Spaziergang im Park, den sie sehr genoss. Manchmal machten sie sogar ein Picknick und breiteten dafür Decken auf der Wiese aus – ganz wie sie es auch zu Hause erlebt hatte. Im Park floss der Monongahela Fluss vorbei, an dessen Ufer sie sich setzten, um die Füße im Wasser baumeln zu lassen. Beim ersten Mal hatte Kathleen sich einfach ausgezogen und war nackt ins Wasser gestiegen. Es hatte einen Aufschrei gegeben, und sie hatte lernen müssen, dass „sittsam“ bedeutete, seine nackte Haut nicht zu zeigen. „Kind, wie kannst du denn so etwas tun?“, hatte Madame Frerichs empört geschimpft. Madame hatte einen Tadel der Mutter Oberin erhalten, weil sie ihren Schützling nicht richtig unterwiesen hatte. „Wie kann ich denn ahnen, dass das Kind sich splitternackt auszieht! Sie ist ja völlig verwildert“, hatte Madame sich verteidigt, und Kathleen zur Strafe eine Woche lang Kleider flicken lassen.
Die anderen Kinder aber hatten schallend gelacht und noch Wochen später über dieses denkwürdige Ereignis gesprochen.
Die Anfangszeit war für Kathleen wirklich schwierig gewesen, auch, weil sie den Umgang mit so vielen Menschen nie gelernt hatte.
Das Pensionat lag südlich von Pittsburgh in einer kleinen Stadt. Für Kathleen war es schon Trubel genug, aber als sie tatsächlich einmal nach Pittsburgh fuhren, um dort ein Museum zu besuchen, kam sie aus dem Staunen nicht heraus. Straßenschluchten um Straßenschluchten öffneten sich vor ihren Augen. Knatternde Fahrzeuge fuhren an ihr vorbei, und Menschen hasteten die Straßen entlang, als wären sie auf der Flucht. Bei ihrer Reise mit der Bahn war sie an Städten vorbeigekommen, aber aus der sicheren Abgeschiedenheit des Zuges war es ihr nicht so schlimm vorgekommen. Vielleicht hatte sie auch die vielen Eindrücke nicht alle auf einmal verarbeiten können.
Von der Geschichtslehrerin erfuhren sie, dass in Pittsburgh die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet worden und die Stadt somit ein geschichtsträchtiger Ort war. Kathleen interessierte sich sehr für die Pioniergeschichte des Landes und lauschte diesen Erklärungen mit Begeisterung. Leider wusste die Lehrerin nur wenig über die Vertreibung der Indianerstämme. Sie vertrat die Ansicht, dass es schon immer das Recht des Stärkeren gewesen war, das Land für sich in Anspruch zu nehmen. „Wir haben das Land mit Blut und Schweiß urbar gemacht.“
„Wieso? Die Indianer waren doch schon vorher da“, wandte Kathleen ein.
„Aber sie haben das Land nicht bewirtschaftet!“, wurde sie belehrt.
„Das stimmt nicht. Großvater hat mir erzählt, dass es viele Stämme gibt, die Ackerbau betrieben haben. Was geschah mit denen?“
„Die haben wir ins Indianerterritorium umgesiedelt, damit sie dort unter sich sind.“
„Warum?“
Darauf hatte die Lehrerin auch keine Antwort gewusst. „Weil wir Verträge mit ihnen abgeschlossen haben“, behauptete sie unsicher. „Es ist eben der Lauf der Zeit. Die Indianer mussten zivilisiert werden.“
Kathleen hatte darüber nur den Kopf geschüttelt. „Die Lakota besitzen einen Vertrag, der ihnen die Black Hills und all das Land darum bis zum Missouri zuspricht, aber es ist ihnen trotzdem weggenommen worden.“
Die Lehrerin sah sie streng an. „Das wird schon seinen Grund haben! Überhaupt nennen wir sie Sioux und nicht Lakota.“
„Sie selbst nennen sich aber Lakota“, antwortete Kathleen mit ungewohnter Sturheit.
„Nun, wenn du meinst. Darum brauchen wir uns ja wohl nicht zu streiten.“
Trotz dieses kleinen Disputs war es ein schöner Ausflug gewesen, der den Horizont der älteren Mädchen erweitert hatte. „Ich will auch mal in so einer Stadt wohnen“, hatte Lucy am Abend voller Sehnsucht geflüstert.
„Ich nicht! Da stinkt es mir zu sehr“, hatte Kathleen ihre Nase gerümpft.
„Du kannst ja in einem Tipi hausen, wenn du hier raus kommst!“
„Das werde ich auch!“
Pläne schmieden
Es war wieder einer dieser schönen Träume: Sie saß am Ufer des Baches und beobachtete Mathola beim Fischen. Er trug eine dieser leichten Hosen aus Stoff, die Großvater ihm gegeben hatte. Sie selbst hatte ein leichtes Sommerkleid aus Stoff an. Sie wusste nicht, woher er diese Kleidung hatte. Manchmal kamen Leute, die um eine Heilungszeremonie baten und ihm im Austausch dafür Dinge brachten, die er brauchen konnte. Vielleicht hatten diese Leute die Kleidung mitgebracht. Sie waren sehr freundlich – vor allen Dingen gegenüber Mathola. Sie nannten ihn „Die Zukunft des Volkes“. Für die Kinder war es immer ein wenig aufregend, wenn Besuch kam, auch wenn sie sich still im Hintergrund hielten, wie es sich geziemte. Einmal hatte Mathola gefragt, warum er die Zukunft des Volkes sei, und Großvater hatte geantwortet: „Weil die Menschen die alte Sprache vergessen. Die Weißen nehmen den Menschen die Kinder weg und verbieten ihnen, die alte Sprache zu sprechen. Aber wenn wir kein Lakota mehr sprechen, vergessen wir auch, wer wir sind. Ihr beide müsst euch immer erinnern! Versteht ihr?“
Sie hatten voller Ehrfurcht genickt. Wie sollten sie die Sprache je vergessen? Sie war ja die einzige, die sie kannten. Manchmal sprach Großvater wirklich in Rätseln.
„Sind wir deshalb hier bei dir?“, hatte Mathola gefragt.
„Ja! Deine Eltern wollten, dass du bei mir aufwächst und die alten Dinge lernst, falls ihnen mal etwas passiert.“ Er hatte traurig den Kopf gesenkt, denn sein Sohn war bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Schwiegertochter war schon vorher von Weißen getötet worden, als sie allein auf dem Nachhauseweg gewesen war. Man hatte die Täter niemals gefunden. Die Zeiten waren schwer für die Lakota, die man in Reservate gepfercht hatte.
In ihrem Traum kaute Kathleen wieder auf einem Grashalm und blinzte faul in die Sonne. „Hast du denn schon was gefangen?“, fragte sie ihren Bruder.
„Das siehst du doch“, antwortete er unwirsch. Vielleicht dachte er, dass sie nicht an sein Jagdglück glaubte.
„Ich bin doch gerade erst gekommen“, rechtfertigte sie sich freundlich. „Ich würde mich sehr über Fisch heute Abend freuen.“
„Scht!“, zischte er durch die Zähne. „Du vertreibst die Fische.“ „Können die denn unter Wasser hören?“, wunderte sie sich.
„Ich glaube schon!“ Er winkte leicht mit der Hand, damit sie endlich still war. Er hielt einen Speer in der Hand, mit dem er auf die alte Art fischte. Er stand bis zu den Knien hinter einem Felsen im Wasser und starrte angestrengt auf die sich vorbeischlängelnden Fische. Kathleen bewunderte seinen braunen Körper und die langen schwarzen Haare, die er in zwei Zöpfe geflochten hatte. Sie war ebenfalls braun gebrannt, aber nur an den Armen und im Gesicht. Aber sie lief im Sommer ja auch nicht den ganzen Tag fast nackt umher. „Wusch!“ Schon hielt er stolz die Spitze aus dem Wasser, an der eine Forelle zappelte. „Heute gibt es Fisch!“, rief er stolz. Er warf den Fisch weit ins Gras, wo er noch eine Weile zuckte.
„Das reicht aber nicht“, sagte Kathleen. „Ich habe nämlich riesigen Hunger.“
Mathola lachte laut. „Ich auch!“, gab er zu. „Ich werde schon noch mehr fangen!“ Er klang stolz und zuversichtlich, so als käme ein Versagen nicht in Frage. Wie auch? Der Bach war voll von Fischen.
„Du bist so ein geschickter Jäger“, sagte Kathleen bewundernd.
Mathola richtete sich noch höher auf. „Wirklich?“
Kathleen nickte. „Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du mal ohne Beute heimgekommen wärst.“
„Doch, im Winter“, schränkte Mathola ein.
„Das zählt nicht. Da findet auch Lala oft nichts.“
„Stimmt! Gut, dass wir immer Vorräte haben.“
„Oder Konserven, die uns die Leute bringen.“ Kathleen dachte an die leckeren Bohnen, die sie einfach auf dem Feuer in der Dose erhitzten. Es war ziemlich schwierig, die Dose mit einem Messer zu öffnen, außerdem musste man aufpassen, dass man sich nicht verletzte. Manchmal gab es auch Pfirsiche oder eine Frucht, die sich Ananas nannte. Kathleen liebte es, den süßen Saft zu trinken. „Wo bekommen die Leute diese Konserven eigentlich her?“, fragte sie.
„Es gibt Häuser, in denen so etwas verkauft wird“, erklärte Mathola.
„Da möchte ich gern mal hin. Dann würde ich einen ganzen Sack Pfirsiche kaufen.“
Mathola kicherte. „Ich auch! Wenn wir groß sind, nimmt Großvater uns bestimmt mal mit.“
Mit seinem Speer erwischte er die nächste Forelle und hielt sie Kathleen stolz vor die Nase. „Du kannst sie schon mal ausnehmen und vorbereiten.“
Widerspruchslos nahm Kathleen den Fisch entgegen, schnappte sich den anderen und machte sich auf den Weg nach Hause. Das würde lecker werden!
Dann wachte sie widerwillig auf und hatte immer noch den Geschmack von frischem Fisch im Mund. Hier, im Pensionat, hatte es noch nie Fisch gegeben. Dabei war der Fluss ganz in der Nähe. Sie ging gerne mit Lucy am Ufer spazieren. Dort gab es nur das Rauschen des Wassers – wenn Lucy zur Abwechslung mal ihren Mund hielt. Immer noch verwunderte es sie, wie viel diese Mädchen quasseln konnten. Meist redeten sie über völlig belanglose Dinge. Es waren Mädchenfantasien über zukünftige Ehemänner, Klatsch aus dem Pensionat über andere Mädchen oder die Lehrerinnen, Schwärmereien über einen gewissen Mathematiklehrer, der ja so „süß“ war, und Witzeleien über die Nonnen. Kathleen hielt sich bei all dem zurück. Klatsch und Tratsch lagen ihr nicht besonders. Bei Lala und Mathola gab es nur wichtige Dinge, über die man reden konnte: Wo fand man trockenes Holz, wann kam der erste Schnee, wo fand man Beeren und Prärierüben, was konnte man kochen und wo fand man Jagdbeute? Selbst die Geschichten dienten weniger der Unterhaltung, sondern bildeten den Charakter.
Leider waren sie weniger geeignet, sie den anderen Mädchen zu erzählen. Sie konnten mit Figuren wie dem Trickster, einem Spinnenwesen, das stets gierig war und die Menschen oder andere Tiere hereinlegte, nichts anfangen. Dabei hätten sie die eine oder andere Weisheit durchaus vertragen können.
Unter all den Schülerinnen war Kathleen dabei ein anderes Mädchen aufgefallen, das sich ebenfalls kaum an Klatsch und Tratsch beteiligte: Jennifer. Sie war ein ruhiges Mädchen, das von ihren Eltern hier ins Mädchenpensionat geschickt worden war, weil ihre Farm so abseits lag, dass ein Schulbesuch unmöglich war. Sie hatte noch eine jüngere Schwester, die ebenfalls hier zur Schule ging. Ihre Eltern zahlten für den Schulbesuch, allerdings war es hier nicht so teuer wie an einem richtigen Internat. Etwa die Hälfte der Schülerinnen waren Waisen, die anderen aber durften in den Ferien nach Hause fahren. Kathleen war immer ein bisschen eifersüchtig, wenn die „Heimfahrer“ zum Bahnhof gebracht wurden. Warum durfte sie nicht wenigstens in den Ferien ihren Großvater besuchen? „Weil ihr nicht blutsverwandt seid!“, war die patzige Antwort der Oberin gewesen.
„Aber ich könnte ihm doch wenigstens schreiben!“, hatte Kathleen gehofft, aber all ihre Versuche, eine Adresse ausfindig zu machen, waren fruchtlos geblieben.
Jennifer tröstete sie in solchen Augenblicken. Sie verstand, dass Kathleen unter der Situation litt, während Lucy diese Sehnsucht mit ungeduldigen Bemerkungen abtat. „Sei doch froh, dass du jetzt hier ein Zuhause hast. Wenn du zurückkehrst, dann doch nicht, um wieder in der Wildnis zu wohnen, oder?“
An den verständnislos aufgerissenen Augen hatte Kathleen erkannt, dass Lucy zwar die spannenden Geschichten liebte, aber weniger die Vorstellung, tatsächlich in einem Zelt zu wohnen. Jennifer dagegen hatte kurz nach ihrer Hand gegriffen, um ihr zu zeigen, dass sie diesen Wunsch sehr wohl nachvollziehen konnte. „Es war halt ihre Heimat!“, hatte sie Lucy erklärt.
„Ja, damals! Aber doch nicht jetzt!“ Lucy schüttelte ihren Kopf. „Wenn sie zurückgeht, dann als Lehrerin ...“, behauptete sie unerschütterlich.
Kathleen schwieg. Sie wollte nicht ihre wahren Absichten offenbaren. Es wurde Zeit, ihren Plan in die Tat umzusetzen und in das Büro einzubrechen, um vielleicht doch irgendwelche Hinweise zu erhalten! Sie hoffte, wenigstens in Erfahrung zu bringen, wo man sie damals gefunden hatte. Dann konnte sie dort mit der Suche nach Großvater und Mathola beginnen.
Lucy war trotz ihres Unverständnisses Feuer und Flamme und versprach, ihr zu helfen. Die beiden saßen in ihren Nachthemden auf Kathleens Bettkante und schmiedeten Pläne. „Wir müssen an den Schlüssel herankommen!“, flüsterte Lucy eifrig.
„Den trägt Mutter Oberin aber immer am Gürtel!“, wiederholte Kathleen den Gedanken von Lucy. „Hast du doch selber gesagt.“
„Dann brechen wir nachts in ihr Zimmer ein und holen uns ihn von dort.“
„Puh, ich weiß nicht! Das sind zwei Einbrüche: Einmal bei Mutter Oberin und einmal ins Büro. Ein bisschen viel, findest du nicht? Und zurückbringen müssen wir den Schlüssel auch, damit sie nichts merkt.“
„Hm!“ Lucy runzelte die Stirn. „Hast du eine bessere Idee?“
Es blieb eine Weile still, als die beiden über Alternativen nachdachten.
„Wir müssten sie ablenken. Ich brauche ja nicht lange“, griff Kathleen Lucys Plan wieder auf.
„Sagte ich doch! Aber wie?“
„Die Idee mit dem Notfall ist schon gut. Aber da brauchen wir noch mehr Hilfe.“
Lucy schüttelte den Kopf. „Nee, je mehr Mädchen wir einweihen, desto größer ist die Gefahr, dass wir verpetzt werden.“
„Nicht alle müssen von unserem Plan wissen. Vielleicht reicht es, wenn wir nur eine einweihen?“
„An wen denkst du?“ Lucy schaute sie mit großen Augen an.
„Jennifer?“
„Ja, die verrät uns bestimmt nicht!“, sagte Lucy überzeugt. „Sie könnte einen Streit anfangen … und Mutter Oberin wird zu Hilfe gerufen.“
Kathleen runzelte leicht die Stirn. „Dann bekommt Jennifer aber Ärger. Das will ich nicht.“
„Stimmt!“
„Wir könnten Jennifer fragen. Vielleicht hat sie ja eine Idee?“
„Das machen wir! Vielleicht rufen wir nach der Oberin, um ihr etwas vorzusingen … dann würde niemand Ärger bekommen.“
Kathleen dachte darüber nach. „Nein, denn dann sperrt sie zu. Es muss schon etwas Plötzliches sein. Etwas Unerwartetes. Etwas, bei dem sie vergisst, die Tür abzusperren.“
„Hm …. Und wir brauchen jemanden, der Schmiere steht“, gab Lucy zu bedenken.
„Was bedeutet das?“, fragte Kathleen, die den Ausdruck noch nie gehört hatte.
„Jemanden, der aufpasst und dich warnt, wenn sie zurückkehrt.“
„Huh!“ Kathleen klopfte das Herz vor Aufregung. Der Plan roch nach Gefahr. Was, wenn die Oberin sie erwischte? „Der Gang ist lang … da sieht sie mich doch, wenn ich das Büro wieder verlasse.“
Lucy winkte ungeduldig ab. „Das Büro liegt im Erdgeschoss. Wir werden dich warnen, und dann verschwindest du durch das Fenster. Da hast du genug Zeit.“
„Sie wird merken, dass es jemand geöffnet hat.“
„Na und? Sie wird denken, dass sie es selbst versäumt hat, zu schließen. Wir stehlen ja nichts! Wenn nichts fehlt, wird sie die Sache schnell wieder vergessen.“
„Stimmt auch wieder“, ließ Kathleen sich beruhigen. Sie wollte ja nur an ein paar Informationen kommen. „Wir brauchen also noch jemanden: einen, der Schmiere steht.“
„Genau! Fällt dir jemand ein?“
Kathleen seufzte tief. Sie hatte nicht so viel Kontakt, da sie als schüchtern und ein wenig weltfremd galt. Ihre indianische Erziehung stand ihr da oft im Weg. Sie hörte lieber zu, und die schnippischen Bemerkungen mancher Mädchen waren ihr zuwider. Lucy konnte auch manchmal frech sein, aber ihr konnte sie das verzeihen, weil sie ansonsten lustig und liebevoll war. Jennifer war ähnlich – aber auch sie galt eher als Außenseiterin. Also: Wer käme noch in Frage? „Vielleicht Jennifers kleine Schwester?“, überlegte Kathleen laut.
„Prima Idee!“, jubelte Lucy. „Die ist so klein und niedlich, dass sie keinen Argwohn erregt. Die stellen wir in den Flur, damit sie pfeift, wenn die Oberin zurückkehrt.“
Langsam nahm der Plan Gestalt an, und die beiden hatten rote Wangen vor Aufregung. „Jennifer und die kleine Talitha verpetzen uns ganz bestimmt nicht“, sagte Lucy zufrieden. „Jetzt brauchen wir nur noch ein gutes Ablenkungsmanöver.“
„Puh!“, seufzte Kathleen. Sie rollte mit den Augen, sodass Lucy herzhaft zu lachen anfing. „Mach dir keine Sorgen, uns fällt bestimmt was ein!“
Kathleen nickte vorsichtig. Hauptsache, sie kam ihrem Ziel näher, ihre Familie zu finden. Sie vertraute Lucy und Jennifer. Die beiden würden sie mit Sicherheit nicht verraten.
Geisterpferde
Am Abend stellte Lucy wieder eine ihrer vielen Fragen: „Wie ist dein Großvater eigentlich in die Stadt gekommen?“
„Wieso?“, hob Kathleen verwundert die Augenbrauen.
„Du hast doch erzählt, dass er manchmal verschwunden und dann mit Lebensmitteln und anderen Dingen zurückgekommen ist.“
„Stimmt!“ Kathleen lächelte, als die Erinnerung in ihr wachgerufen wurde. „Meist wurden uns die Sachen gebracht, aber manchmal war mein Großvater auch ein paar Tage weg.“
„Gleich ein paar Tage? Er hat euch einfach allein gelassen?“
„Na ja, wir wussten ja, was zu tun war.“
„Hatte dein Großvater ein Automobil?“
Kathleen schüttelte den Kopf. Sie dachte daran, wie sie das erste Mal in so einem stinkenden Ding von ihrem Zuhause weggebracht worden war. Bis zu diesem Augenblick hatte sie nie zuvor ein Automobil gesehen. „Nein! Großvater ist immer auf einem seiner Ponys geritten.“
„Ihr hattet Ponys?“, fragte Lucy. Ihre Stimme überschlug sich vor Aufregung. „Davon hast du mir ja noch nie erzählt.“
Kathleen zuckte mit den Schultern. „Na ja, sie waren einfach da. Sie lebten mit uns, genauso wie unser Hund. Er hieß ‚Takuni‘ – das bedeutet ‚Nichts‘. Seine Aufgabe war es, uns vor Gefahren zu warnen.“
„Wieso hieß er denn ‚Nichts‘?“, wunderte sich Lucy.
„Ach, das war ein Scherz von Lala“, erklärte Kathleen mit einem Kichern. „Er bettelte immer um Fressen, und dann hat Großvater ihm gesagt, dass es nichts gäbe.“
„Und er hat ihm tatsächlich nichts gegeben?“
„Aber nein … Takuni hat immer die Knochen oder zähes Fleisch bekommen.“
„Und die Ponys?“
Kathleen senkte traurig den Blick, denn manchmal tat die Erinnerung an ihr früheres Leben weh. „Eigentlich waren es ja Mustangs – aber wir sprachen immer nur von unseren Ponys. Sie liefen frei herum. Nur wenn Großvater in die Stadt wollte, hat er sie gerufen. Sie waren ziemlich wild. Ich bin nur manchmal auf ihnen geritten, aber Mathola hat es genossen. Dabei ist er oft abgeworfen worden. Einmal hat er sich dabei sogar die Schulter ausgerenkt. Es waren richtige Biester. Nur bei Großvater waren sie lammfromm.“
„Und wo waren sie im Winter?“
„Na, auch in dem Tal. Wo hätten sie denn sonst hin sollen?“
„Hattet ihr keinen Stall?“