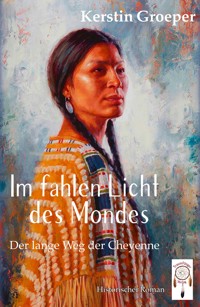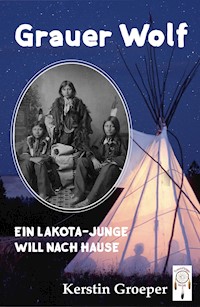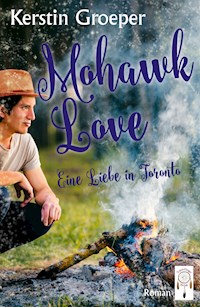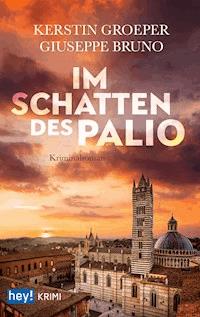Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Mary liebt ihr Pony Tupfen, denn nach dem Tod ihrer Eltern ist es das Einzige, was ihr noch geblieben ist. Verzweifelt folgt sie den Wagenspuren des Trecks, der einfach ohne sie weitergezogen ist. Mary klammert sich an die trügerische Hoffnung, die anderen bald einzuholen. Doch sie verläuft sich und irrt ziellos durch die Weiten des amerikanischen Westens. Nur Tupfen spendet ihr Trost und gibt ihr das Gefühl, nicht ganz alleine zu sein. Schließlich werden die beiden von Indianern gefunden und Mary erlebt spannende Abenteuer…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ruth
Geflecktes-Pferdemädchen
Ein weißes Kind bei den Sioux
Kinder- und JugendromanvonKerstin Groeper
Impressum
Geflecktes Pferdemädchen, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2011
1. Auflage eBook März 2022
eBook ISBN 978-3-948878-30-6
Lektorat: Ilona Rehfeld
Satz/Bildbearbeitung: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: Christian Heeb
Illustration: Eugénie Pierschalla
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG, Hohenthann
Inhalt
Spuren im Stein
Allein in der Wildnis
Indianer
Schlimme Nachrichten
Eine neue Familie
Neue Freunde
Winter
Taschunka withko
Stern
Der Händler
Büffel und Beeren
Leiser Wind
Familie
Der zweite Winter
Geschichten
Gefährliche Begegnung
Fort Laramie
Missis Jennings
Aufbruch
Ein weiter Weg
Cheyenne
Heimkehr
Hier lebt Mary!
Vorwort
Ehe Amerika von den Weißen besiedelt wurde, gehörte es den Indianern. Doch dann kamen die Menschen aus Europa. Sie siedelten erst im Osten von Amerika und vertrieben dort die Ureinwohner. Dann streckten sie ihre Finger auch nach dem Westen aus. Planwagen rollten über die Prärie und ihre Räder hinterließen tiefe Spuren im Gras, manchmal sogar im Stein. Die Menschen suchten nach neuem Farmland, auf dem sie ihre Felder bestellen konnten. Es waren fleißige Menschen, die weite Entfernungen und Entbehrungen in Kauf nahmen, um irgendwo im Westen ihr Glück zu machen. Monatelang zogen die Siedler mit ihren rollenden Wägen durch das Land und folgten den ausgefahrenen Spuren der anderen. Dieses Buch handelt von Mary, die um 1860 mit ihren Eltern in dieses gelobte Land im Westen unterwegs ist. Doch es kommt alles ganz anders … denn Mary landet plötzlich bei den Indianern.
Spuren im Stein
Mary wickelte sich fester in die Decke und starrte auf die untergehende Sonne. Die Nacht würde wieder so kalt werden! Sie saß etwas abseits von dem Planwagen, der ihre Familie bis zu diesem Ort gebracht hatte. Bis hierher, aber nicht weiter. Mama lebte jetzt im Himmel. Dort oben bei den Sternen. Dieser Gedanke war tröstend. Bald würden die Sterne zu sehen sein und sie konnte sich vorstellen, dass ihre Mutter ihr zublinzelte. Ein leises Schnauben war zu hören und ein samtenes Maul strich über ihren Kopf. Es war Tupfen, ihr Pony. Ich bin gar nicht allein, dachte Mary etwas getröstet. Mein Pony ist ja bei mir! Müde stand sie auf und streichelte ihr Pony am Hals. „Hallo Tupfen! Morgen müssen wir weitergehen und die anderen einholen!“
Die anderen! Wieder starrte Mary in die Ferne und dachte an die Familien, die einfach ohne sie weitergezogen waren. Zwei Tage war ihre Familie in einigem Abstand dem Treck der Planwagen gefolgt, doch dann waren Mama und Vater plötzlich zu schwach gewesen. Die anderen waren einfach weitergefahren. Sie hatten Angst gehabt. Angst vor der heimtückischen Krankheit, welche die Familie getötet hatte. Aber Mary war nicht krank. Sie war müde und hungrig, aber nicht krank. „Wir werden auf euch in Fort Laramie warten!“, hatten die anderen versprochen. „Es ist ja nicht mehr weit. Da könnt ihr uns bald wieder einholen!“
Fort Laramie? Für Mary war es nur ein weiterer unbekannter Ort, irgendwo in dieser Graswüste. Tupfen rupfte gerade ein Büschel und kaute es zufrieden. „Ob Menschen auch Gras essen können?“, überlegte Mary. Dann blickte sie wieder auf die Wagenspuren, die sich tief in den Boden gegraben hatten. „Du musst nur den Spuren folgen!“, hatte die Mutter noch gemahnt. „Dann wirst du die anderen finden. Sie werden dich bestimmt aufnehmen! Du bist doch so ein braves Mädchen!“
„Ich will nicht von hier weg!“, hatte Mary protestiert.
„Kind! Es ist bereits spät im Jahr. Der Herbst ist nah. Es kommen keine Wagenzüge mehr vorbei. Sonst hätten wir sie längst bemerkt. Du darfst nicht allein hierbleiben, sonst überrascht dich der Winter und du erfrierst. Hörst du?“ Mutters Stimme war nur noch ein Hauch gewesen und dann hatte sie nichts mehr gesagt.
Mary entfernte sich von dem Planwagen und setzte sich in die Nähe des Flusses, damit ihr Pony etwas trinken konnte. Wie sehr sie die Reise in dem Planwagen gehasst hatte. Wieso waren sie nicht im Osten geblieben? Dort, wo es Straßen und Wege, Häuser und Schulen gab. Wochenlang war sie neben dem Wagen durch das hohe Gras gelaufen und hatte den Staub geschluckt, der durch die anderen Wagen aufgewirbelt worden war. Manchmal war sie auf ihrem Pony geritten, aber das war auch nicht besser gewesen, denn sie hatte sich von dem Zug der Planwagen nicht entfernen dürfen. „Indianer!“, hatte man sie gewarnt.
Abends gab es immer das Gleiche zu essen und irgendwann schmeckte alles ranzig und faul. Manchmal gab es frisches Fleisch, wenn ein Jäger etwas gejagt hatte, aber diese Mahlzeiten waren eher selten gewesen.
Mary kniete sich an das Wasser und trank einige Schlucke. Das half auch ein bisschen gegen den Hunger. Dann setzte sie sich an den Stamm eines Baumes und wickelte die Decke um ihre Schultern. Nachts hatte sie Angst allein zu sein.
Hoffentlich sind die anderen nicht so weit gefahren, dachte sie sehnsüchtig. Vielleicht kann ich sie morgen einholen?
Im Sitzen döste sie eine Weile, träumte dabei von einem gedeckten Tisch an den Sonntagen. Kuchen hatte es damals gegeben, und Braten. Wie lange hatte sie schon keinen Kuchen mehr gegessen?
Die ganze Idee in den Westen zu ziehen, war für sie ohnehin sehr seltsam gewesen. Wieso wollten ihre Eltern eine so weite Reise unternehmen? Wieso wollten sie in dem fernen Land „Oregon“ ein neues Leben anfangen? Sie hatten doch eine kleine Farm gehabt.
„Sie wirft nicht genug für uns ab!“, hatte der Vater erklärt.
„Vater will, dass wir ein besseres Leben haben“, hatte Mutter dann gesagt. „In Oregon ist der Boden viel besser als hier und wir werden viel mehr anpflanzen können. Hier regnet es oft zu wenig und die Ernte verdorrt. In Oregon ist es wie im Paradies!“
Die ganze Reise über hallten diese Worte in ihrem Kopf: „Paradies“. Wie wohl das Paradies aussah?
Nun wollte sie nicht mehr dorthin. Sie wollte zurück zu ihrer kleinen Farm und sie wollte Mama zurück.
Am Morgen wurde sie von ihrem Pony geweckt, das ihr aufmunternd ins Gesicht schnaubte und ungeduldig mit dem Huf scharrte. Ein wenig steif rappelte sich Mary auf und streckte sich. In der Nacht war sie an dem Baumstamm zusammengesunken und hatte sich wie eine Katze zusammengerollt. Der Boden war hart gewesen, und nun spürte sie jeden Knochen in ihrem Leib. Wieder stupste sie das Pony ungeduldig an die Schulter und schnaubte auffordernd. „Hey“, schimpfte sie, „willst du Hafer? Komm, Tupfen, wir müssen los! Wir müssen die anderen einholen!“
Sie packte ihre Decke zusammen und legte sie wie einen Sattel auf den Rücken des Ponys. Dann zog sie Tupfen zu einem umgestürzten Baumstamm, stellte sich auf den Stamm und kletterte vorsichtig auf den Rücken des Ponys. Es gelang ihr aufzusitzen, ohne dass die Decke verrutschte und zufrieden schnalzte sie mit der Zunge, damit ihr Pony vorwärtsging. Tupfen hatte kein richtiges Zaumzeug, sondern nur ein Halfter mit einem Strick, sodass es nicht ganz einfach war, ihn in die richtige Richtung zu lenken. Aber vielleicht wusste das Pony auch so, wohin es gehen sollte, denn es folgte den ausgefahrenen Spuren im Gras. Ihre Hand hatte sich in die Mähne des Ponys gekrallt und manchmal klopfte sie ihm ihre Fersen in die Flanken, damit es etwas schneller ging. Tupfen war ein nettes Pony und manchmal trabte es sogar voller Übermut. Vielleicht fühlte es sich einsam und wollte schnell die anderen Pferde einholen.
Der Wind wehte durch Marys Haare und sie schüttelte unwillig den Kopf, als ihr einige Locken ins Gesicht wehten. Mary hatte schöne braune Haare, doch im Moment waren die Locken eher unpraktisch. Mama würde mir nun bestimmt einen Zopf flechten, dachte Mary traurig. Sie biss die Lippen zusammen und blickte starr geradeaus. Nicht daran denken, mahnte sie sich.
Stundenlang folgte sie den Wagenspuren, die sich hügelauf und hügelab über den Boden zogen. Manchmal hatten sie sich sogar in den Felsen eingegraben, wenn der Weg nicht mehr durch ebene Wiesen, sondern über felsiges Gestein führte. Einmal musste Mary absteigen, so sehr wunderte sie sich über die Spuren. Dass Wagenräder sich sogar in Felsen eingraben konnten! Seltsam, dachte Mary, als sie sich einigen rötlich schimmernden Felsen näherte. Wie aus dem Nichts waren plötzlich diese seltsamen Felsformationen und Hügel aufgetaucht. Oben flach, ansonsten mit zackigen Formen, Kanten und Ecken, wie die Zacken eines riesigen Drachen, den sie einmal in einem Buch gesehen hatte. Lag dort vielleicht ein versteinerter Drache? Die Wagenspuren führten genau darauf zu und wanden sich an den Wänden der Felsen entlang. Kiefern wuchsen zwischen den Felsen und Vögel kreisten darüber. Mary hatte schon lange keine Vögel mehr gesehen. Aber hier, zwischen den Felsen, fanden sie offensichtlich Futter und konnten ihre Nester an die Felswände bauen. Mary blickte nach oben und sah ganze Kolonien von Schwalbennestern, die in die Felsnischen geklebt worden waren. Winzige Vogelköpfe lugten heraus und warteten darauf, dass die Elternvögel wieder heimkehrten.
Zwischen den Kiefern und Wacholderbäumen wuchsen bunte Blumen, und Mary staunte über die vielen Farben, die hier zu finden waren. Sonst gab es nur das gelblichbraune Gras, manchmal mit kleinen Kakteen darin, die grässlich stachen, wenn man auf sie trat, aber hier schienen selbst die Felsen bunt zu sein. Weiße und rote Linien zogen sich durch das graue Gestein, und einige schimmerten sogar gelblich oder hatten schwarze Flecken. Mein Pony passt hier gut dazu, dachte sie schmunzelnd. Es hieß nämlich so, weil es lauter braune und schwarze Flecken auf seinem weißen Fell hatte. Die Leute meinten oft, dass es wie ein Zirkuspferd aussähe. Mary lächelte dann immer und meinte, dass es ja auch Kunststücke wie ein Zirkuspferd könne.
Tupfen konnte sich nämlich hinlegen und tot stellen, wenn sie es wollte. Und das Pony hob sein Vorderbein, wenn man „Hallo“ sagte, so, als wollte es einem die Hand schütteln. Das war eigentlich schon alles. Sonst benahm sich Tupfen wie ein ganz normales Pferd.
Mary war müde und beschloss, eine kleine Rast einzulegen. Zwischen einigen Felsen sprudelte eine kleine Quelle und Tupfen tauchte sein Maul in das Wasser, um zu trinken. Mary schöpfte ebenfalls Wasser mit der hohlen Hand und trank einige Schlucke. Ihr Magen knurrte laut und sie überlegte, ob es hier wohl einige Früchte gab. Suchend blickte sie sich um und kletterte zwischen die Felsen. Sie fand einige Büsche mit roten Beeren, doch sie zögerte unsicher. Auch die anderen waren hier vorbeigekommen und hatten die Beeren nicht gepflückt. Vielleicht waren sie giftig? Sie zog Tupfen zu einem Felsen, um von dort auf seinen Rücken zu klettern, dann trieb sie ihn wieder an. Ein roter Vogel flatterte schimpfend empor, als sie zu nahe an ihm vorbeiritt, dann wurde es wieder still. Immer hatte sie in den letzten Wochen das Klirren der Wagen oder das Schimpfen der Männer gehört. Hier musste sie horchen, um überhaupt etwas zu hören. Grillen zirpten im Gras, der Wind rauschte durch die Bäume, sonst war nichts zu hören. Mary ritt durch die Felsenlandschaft, bis sie nach einer Weile an einem Rastplatz vorbeikam. Überall waren erloschene Feuerstellen zu sehen und das Gras war im weiten Umkreis niedergetrampelt oder abgefressen worden. Hier hatten die anderen gerastet, schoss es durch ihren Kopf. Sie freute sich, dass sie auf so deutliche Spuren gestoßen war. Andererseits bedeutete es, dass die anderen wesentlich weiter entfernt waren, als sie gedacht hatte. Jetzt war bereits Nachmittag! Wenn die anderen hier gerastet hatten und am Morgen weitergezogen waren, dann würde sie die Planwagen niemals vor Anbruch der Dunkelheit einholen! Sie musste eine weitere Nacht hier draußen verbringen! Allein! Ihr Herz wurde eng bei dem Gedanken und Tränen traten in ihre Augen.
Mary setzte sich an die alte Feuerstelle und tastete mit der Hand nach der Asche. Sie war kalt. Hier hatte schon lange niemand mehr gekocht. Mary seufzte niedergeschlagen. Wenn sie wenigstens ein Feuer entfachen könnte, aber sie wusste nicht, wie sie das machen sollte. Der Platz wirkte düster und leer. Man sah, dass Menschen hier gelagert hatten, aber außer Unrat und niedergetrampeltem Gras hatten sie nichts hinterlassen. Mary beschloss, noch ein wenig zu reiten und sich einen anderen Platz für die Nacht zu suchen. Irgendwo zwischen den Felsen würde sie bestimmt einen geschützten Platz mit Wasser und frischem Gras finden. Nachts wurde es bereits empfindlich kalt und ganz tief in ihrem Kopf wusste sie, dass es gefährlich für sie wurde. Nicht nur, dass hier überall wilde Tiere und Klapperschlangen lauerten, nein, auch der kommende Herbst brachte Gefahren mit sich. Außerdem brauchte sie Nahrung!
Im flachen Gras fand sie keine Möglichkeit aufzusitzen und so zerrte sie das Pony an dem Strick hinter sich her. Sie führte es zurück zu den Felsen und suchte nach einer Möglichkeit, um auf seinen Rücken zu klettern. Tupfen war unruhig und spielte wachsam mit den Ohren. Außerdem warf das Pony den Kopf aufgeregt hin und her. In Mary stieg die Angst hoch. Lauerte hier ein Puma oder Wolf? Zum ersten Mal dachte sie darüber nach, dass sie eigentlich nur ein kleines Mädchen war. Sie war zehn Jahre alt und viel zu klein, um allein in der Wildnis zu überleben. Sie konnte ein wenig lesen und schreiben, aber nichts hatte sie auf ein Leben hier draußen vorbereitet. Bald würde die Nacht kommen und sie wäre den wilden Tieren hilflos ausgeliefert. Wie hatte sie sich nur auf ein kleines Pony verlassen können? Panisch vor Angst zerrte sie Tupfen hinter sich her, rannte blindlings zwischen den Felsen umher und stolperte dabei mehrfach über Wurzeln und Steine. Ihr langes Kleid blieb an Ästen und Sträuchern hängen und es kam ihr vor, als würden Monster mit ihren Armen nach ihr greifen. „Hilfe!“, schrie sie mit gellender Stimme. „Hilfe!“
Das Echo ihrer Stimme hallte von den Felswänden wider, sonst hörte niemand ihre verzweifelten Rufe.
Allein in der Wildnis
Irgendwann nach diesem irrsinnigen Lauf fiel sie keuchend zu Boden. Sie hatte Seitenstechen und bekam kaum noch Luft. Ihre Hand hielt krampfhaft den Strick, mit dem sie Tupfen hinter sich hergezerrt hatte. Das Pony stand abwartend über ihr, nun wieder ganz ruhig und mit neugierigen braunen Augen, die sich ein wenig über seine kleine Freundin zu wundern schienen. Mary raffte sich auf und blickte sich ängstlich um. Nichts war zu sehen. Keine Monster, die nach ihr griffen, keine Pumas und Wölfe. Alles, was Tupfen beunruhigt hatte, schien verschwunden zu sein. Verspielt stupste das Pony sie an und schnaubte vergnügt. Wahrscheinlich war alles nur ein Spiel gewesen. Marys klopfendes Herz beruhigte sich langsam und sie knuffte dem Pony in den Hals: „Du wolltest mich wohl erschrecken, was?“
Prüfend musterte sie die Umgebung und versuchte, etwas Vertrautes in der Landschaft zu sehen. Die Sonne begann sich nach Westen zu neigen und sie musste sich für die Nacht einen Lagerplatz suchen. Der Himmel färbte sich rot und zum Glück waren keine Wolken zu sehen. Während ihrer gesamten Reise hierher hatte es kaum geregnet und das beruhigte sie ein wenig. Regen war das letzte, was sie nun brauchte. Einige Steine rollten davon, als sie den Pfad hinunterkletterte, dann machte der Weg eine Biegung und sie trat auf einen freien Platz zwischen den Felsen. Grünes Gras wucherte überall und in den Felsen befand sich eine Mulde mit Wasser. Es sah klar aus und sie trank einige Schlucke. Hier war ein guter Platz für die Nacht! Zwischen den Felsen wuchsen wieder die verkrüppelten Kiefern und darunter befand sich wunderbarer trockener und weicher Boden. Tupfen stand schon bis zum Bauch in dem hohen Gras und kaute zufrieden. Wenigstens er bekam etwas zu essen. Mary setzte sich unter die Kiefer und umschloss ihre Knie. Sie war hungrig und der Hunger ließ sie frösteln. Noch war es warm, aber der Wind würde die Hitze des Tages schnell vertreiben. Sie hasste den ewigen Wind. Stetig pustete er über das Land, ließ das Gras im Wind wehen, sodass es wie die Wellen eines Ozeans aussah. Der Wind fuhr durch die Haare, kroch unter die Kleidung und ließ einen nachts nicht schlafen. Nie war es wirklich still. Hier wütete immer ein Wind, der woanders Sturm hieß.
Mary war ganz froh, dass sie zwischen den Felsen etwas Schutz gefunden hatte. Die Sonne versank in einem wahren Feuerball und tauchte den Himmel plötzlich in ein dunkles Lila, das langsam in das Schwarz der Nacht überging. Erste Sterne funkelten am Himmel und fast augenblicklich wurde es kalt. Mary wickelte die Decke um ihren Körper und drückte sich an die Rinde des Baumes. Sie hatte Angst, die Augen zu schließen und doch war sie zu müde, um sie aufzuhalten. Wieder rannen ihr die Tränen über das Gesicht, als die Einsamkeit sie übermannte. Gab es irgendwo Menschen, die ihr helfen würden? Ihre Lippen zitterten etwas und ihr Blick suchte nach ihrem Pony. Dort stand es, unter einem Felsen und wedelte sacht mit dem Schweif hin und her, um Fliegen abzuwehren. In der Dunkelheit sah sie nur einen Schatten und den Schwanz, der sich hin und her bewegte. Trotzdem war das Pony da und sie fühlte sich nicht mehr so allein. In die Decke eingewickelt stand sie auf und trat näher zu ihm. Sanft streichelte sie über das Fell. Es war weich und warm. Ob sie sich an dem Pony wärmen konnte? Bisher war „Toter Mann“ Spielen nur Spaß gewesen, aber vielleicht konnte es ihr jetzt zu etwas nutzen?
„Leg dich hin!“, befahl sie drängend und wartete gespannt darauf, dass Tupfen ihr gehorchte. Das Pony legte die Ohren an, schüttelte unwillig den Kopf, doch dann knickte es seine Beine ein und begann sich hinzulegen. Aufmerksam beobachtete es seine Herrin, ob sie ihm weitere Befehle geben würde. „Gutes Pony!“, lobte Mary das Tier. „Leg dich!“, wiederholte sie den Befehl, dann setzte sie sich vorsichtig an Tupfens Bauch. Es war warm! Das Pony schnüffelte mit dem Nüstern nach dem Kind, dann ließ es den Kopf zur Seite fallen und schien schlafen zu wollen. Mary drückte sich an den warmen Bauch des Ponys und schloss ebenfalls die Augen. So war es viel gemütlicher und sicherer.
Irgendwann am Morgen wachte Mary wieder auf. Tupfen war längst aufgestanden und graste in der Nähe. Die Sonne kletterte bereits über die Hügel und berührte mit ihren warmen Strahlen die Welt unter sich. Blinzelnd kniff Mary die Augen zusammen und blickte sich um. Bei Tageslicht wirkte alles friedlich und kaum bedrohlich. Der Wind hatte etwas nachgelassen und so legte sie die Decke ordentlich zusammen.
„Komm, Tupfen!“, lockte sie das Pony. „Wir müssen weiter!“
Mit Hilfe eines Felsens, auf den sie sich stellte, kletterte sie wieder auf den Rücken des Ponys, dann führte sie es in die Ebene zurück. Suchend sah sie sich nach den Wagenspuren um und es dauerte eine Weile, ehe sie die Abdrücke im Gras fand.
Unsicher sah sie sich um. In welche Richtung musste sie den Spuren nun folgen? Mit den anderen waren sie immer den Anweisungen der Männer gefolgt, doch nun wünschte sie, dass sie besser aufgepasst hätte. In welche Richtung musste sie gehen? Nach Westen? Gewiss! Aber wo lag Westen? Die Sonne geht im Osten auf, erinnerte sie sich, also musste sie in die entgegengesetzte Richtung gehen.
Ohne weiter zu überlegen, wandte sich Mary in die Richtung, von der sie glaubte, dass es Westen sei und folgte den Wagenspuren, die ihr hügelauf und hügelab den Weg wiesen. Aber sie war ein kleines Mädchen und sie wusste nichts vom Spurenlesen und so merkte sie nicht, dass diese Wagenspuren längst nicht so tief im Boden eingegraben waren wie die anderen. Sie folgte einer Fährte nach Norden, die sie immer weiter von den anderen entfernte. Eigentlich hätte sie es merken müssen, denn der Weg verlief nicht mehr an den seltsam geformten Felsen entlang, sondern führte über einen kleinen Bach in eine ganz andere Richtung. Aber Marys Aufmerksamkeit wurde abgelenkt. An diesem Bach fand sie nämlich einige Bäume. Pflaumenbäume! Mary war sich ganz sicher, denn Pflaumen kannte sie! Mama hatte daraus immer Marmelade gekocht oder Kuchen gebacken! Sie pflückte einige Früchte und biss in das fruchtige Fleisch. Es war wunderbar süß. Sie war so hungrig, dass sie das Obst gierig in ihren Mund stopfte und kaum die Zeit fand, die Kerne wieder auszuspucken. Mary pflückte noch einige Handvoll Pflaumen und knotete sie in den weiten Saum ihres Kleides. Sie kam sich groß und erwachsen vor, weil sie an Vorräte dachte.
Wieder sah sie sich nach einer Möglichkeit um, wie sie sich auf den Rücken ihres Pferdes schwingen konnte. Nirgends sah sie einen Felsen oder umgekippten Baumstamm und so kletterte sie auf den unteren Ast eines Baumes. „Komm!“, lockte sie Tupfen. „Komm!“
Mary nahm Maß, dann ließ sie sich auf Tupfens Rücken fallen. Das Pony warf empört den Kopf hoch und riss dabei den Strick ab, mit dem es an dem Ast festgebunden war. Es machte einige kurze Sätze, buckelte übermütig, dann schnaubte es unwillig. Mary klammerte sich an der Mähne fest, beugte sie sich hinunter und bekam den Strick zu fassen, der dem Pony vor die Beine fiel. Die ganze Sache war nicht bedeutend, aber die schönen Pflaumen waren dabei zu Matsch verarbeitet worden. Der Saum ihres Kleides tropfte und kurz schoss der Gedanke durch ihren Kopf, dass sie bestimmt geschimpft werden würde. Sie ließ die matschigen Pflaumen in dem Saum ihres Kleides, denn lieber würde sie später Pflaumenmus essen als nichts.
Die Spur der Räder führte eine Weile am Bach entlang und sie folgte ihnen, nicht ahnend, dass gerade das Wasser ihr Überleben sichern würde. Gegen Mittag wurde es heiß und sie saß ab, um Wasser vom Bach zu schöpfen. Auch Tupfen tauchte sein Maul in das Wasser und trank mit durstigen Zügen. Mary war müde und setzte sich ins Gras, um ein wenig zu rasten. Sie knüpfte den Saum ihres Kleides auf und besah sich die Bescherung. Fast alle Pflaumen waren zerdrückt und der Saft war als klebriger Brei in den Stoff des Kleides eingedrungen. Mary stopfte sich einige Früchte in den Mund, den Rest schüttete sie auf den Boden. Dann ging sie zum Bach und wusch die Flecken aus dem Stoff. Ihr Kleid war in einem zarten Rosa mit dunkelroten Rosen, doch an der Stelle, an der die Pflaumen das Kleid verschmutzt hatten, war es nun unansehnlich lila verfärbt. Sie hatte keine Seife dabei, so konnte sie die Flecken auch nicht entfernen. Aber wenigstens klebte es nicht mehr und irgendwie hatte sie das Gefühl, wieder sauber zu sein. Eifrig rubbelte sie ihre Hände und spritzte sich Wasser ins Gesicht.
Tupfen fand das wohl lustig, denn er watete ins Wasser und begann mit seinen Hufen zu planschen. Einige Spritzer trafen Mary und sie quietschte empört. „Pass auf, du machst mein Kleid ganz nass!“ Sie wagte es nicht, sich auszuziehen, denn das gehörte sich einfach nicht. Man durfte sich nicht nackt zeigen, selbst wenn kein Mensch in der Nähe war. Mary ging einige Schritte zurück, dann lockte sie ihr Pony wieder näher. „Komm, komm! Wir müssen weiter!“ Mary war ein wenig beunruhigt, denn seit dem Morgen war sie auf keinen Lagerplatz mehr gestoßen. Wie sollte sie die anderen einholen, wenn sie nicht einmal mehr die Lagerplätze fand? Sie wusste nicht, dass sie längst auf einem ganz anderen Weg war!
Dann senkte sich die Scheibe der Sonne dem Horizont zu und Mary wusste, dass ihr eine weitere Nacht hier draußen bevorstand. Die Verzweiflung schwappte spürbar durch ihren Körper und nahm ihr die Luft. Sie wollte nicht allein hier draußen übernachten! Außerdem hatte sie Hunger und Durst. Aber wo war der Bach geblieben?
„Komm, wir reiten zurück!“, murmelte sie verzweifelt. Weiter hinten hatte sie einen Baum gesehen, unter dem sie schlafen wollte. Tupfen schüttelte ungeduldig den Kopf und drängte in die andere Richtung. Er wollte nicht zurück, sondern über einen weiteren Hügel. Mary klopfte wütend mit ihren Schuhen in seinen Bauch und zerrte an dem Strick. „Hörst du! Dreh um!“
Tupfen machte einen Satz nach vorne und zum ersten Mal verlor Mary das Gleichgewicht, rutschte seitlich den Rücken hinunter und landete unsanft im Gras. Tupfen hatte sie abgeworfen.
„Du!“, schrie sie erbost. „Das darfst du nicht! Komm wieder her!“ Tupfen lief einige Schritte weiter und blieb außerhalb ihrer Reichweite stehen. Mary versuchte den Strick zu greifen, aber immer, wenn sie ihn fast fassen konnte, machte das Pony einen Satz und lief einige Schritte weiter. Schließlich drehte es sich um und trabte davon. Tupfen!“, schrie Mary verzweifelt. „Tupfen, bleib stehen!“
Indianer
Das Pony legte stur die Ohren an und verschwand hinter einem Hügel. Mary ließ sich schwach vor Entsetzen ins Gras sinken und starrte ihm hinterher. Sie war allein! Ganz allein. Ihr Pony hatte sie verraten und einfach im Stich gelassen. Mary heulte. Tränen rannen über die Wangen, als sie all ihre Angst, Trauer und Verzweiflung hinausließ. Aber niemand kam, um sie zu trösten oder ihr in ihrer Not zu helfen. Nur der Wind zerzauste ihre Haare und trocknete ihre Tränen. Die Tränen hatten schmutzige Spuren auf ihren Wangen hinterlassen und ihre hellbraunen Augen waren deutlich in dem sonnenverbranten Gesicht zu sehen. Irgendwann hatte Mary keine Tränen mehr und sie wischte sich mit der schmutzigen Hand die Nase ab. Weinen nützte nichts. Hier nicht!
Sie raffte sich auf und blickte in die Richtung, in der ihr Pony verschwunden war. Tupfen! Sie musste ihn wieder finden. Nur mit ihm konnte sie von hier weg. Und sie musste ihn finden, ehe es endgültig dunkel wurde. Stolpernd und hastend rannte sie den Hügel hinauf und sah in das Tal dahinter. Schatten lagen bereits darüber und erinnerten sie daran, dass die Dunkelheit hier schnell kam. Sie rannte den Hügel hinab und versuchte den Spuren zu folgen. Im hohen Gras war gut zu erkennen, wohin das Pony getrabt war. Wieder kletterte Mary einen Hügel hinauf, dann blieb sie erstaunt stehen.
Dort unten stand Tupfen. Friedlich grasend stand er in der Nähe einiger Felsen und Büsche. Marys Herz hüpfte vor Freude. Tupfen! Vorsichtig kletterte Mary den Hügel hinunter, denn sie hatte Angst, das Pony zu erschrecken. Dann stand sie neben ihm und nahm behutsam den Strick in die Hand. Tupfen schnaubte leise und stupste sie mit dem Maul an, dann tauchte er seinen Kopf wieder ins Gras, um weiter zu grasen. Mary war so glücklich, dass sie einfach neben ihm stehen blieb und zuschaute, wie er kaute.
Irgendwann, kurz ehe die Sonne verschwand, hörte sie ein anderes Geräusch. Das leise Plätschern von Wasser. Neugierig zog sie das Pony in die Richtung der Felsen und starrte ungläubig auf die kleine Quelle, die hier hervorsprudelte. Ihr Pony hatte Wasser gefunden! Wasser! Hatte sie nicht ein kluges Pferd? Sie umarmte das Pony voller Glück und streichelte sein geflecktes Fell. „Du bist mein Bester!“, lobte sie es überschwänglich. Nie mehr würde sie es schimpfen oder in eine Richtung drängen, in die es nicht wollte. Es war ja so klug. Dankbar kniete sie nieder und trank in gierigen Zügen. Sie war so durstig. Fast hatte sie ihren Hunger vergessen, denn der Durst war viel schlimmer.
Anschließend suchte sich Mary einen ebenen Platz und wickelte sich in ihre Decke. Sie stank nach Pferd, weil Mary die Decke ja auch immer als Sattel verwendete, aber sie hatte nichts anderes. Wahrscheinlich stank sie selbst inzwischen genauso. Sie konnte sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal gebadet hatte. In dieser Nacht war es wärmer als in den letzten Tagen und sie rollte sich zusammen, um zu schlafen. Ihr war schlecht vor Hunger und in der Nacht hatte sie Alpträume.
Am Morgen fand sie kaum noch die Kraft aufzustehen. Sie beugte sich über die Quelle, um ein paar Schlucke zu trinken, dann wickelte sie sich wieder in die Decke und schloss die Augen. Sie war so müde! Selbst der Hunger schien vergessen zu sein.
Mary döste eine Weile und blinzelte manchmal durch ihre Wimpern, um zu sehen, wie die Sonne am Himmel höher kletterte. Sie wollte nicht weiterreiten. Wohin denn? Sie dachte nicht daran, dass sie sterben würde, wenn sie hier einfach liegen blieb. Sie dachte an gar nichts mehr. Eine seltsame Müdigkeit überfiel sie und wieder legte sie sich hin, um ein wenig zu schlafen. Im Schlaf hatte sie keinen Hunger. Manchmal wachte sie auf, wenn der Magen zu laut knurrte und dann ärgerte sie sich, dass sie wieder in die Wirklichkeit zurückkehren musste. Sie wollte eigentlich nicht mehr aufwachen. Schlafen war viel schöner. Im Schlaf hörte sie Mama und es gab genug zu essen. Vielleicht ging sie auch in den Himmel? Da gab es bestimmt genug zu essen. Da war ja das Paradies. Vielleicht gab es das Paradies gar nicht in Oregon oder auf Erden, sondern nur im Himmel?
Sie fühlte im Halbschlaf, wie ihr Körper angehoben wurde und weigerte sich die Augen zu öffnen. Hier war ja niemand, also konnte es nur ein Traum sein. Wieder fühlte sie fremde Hände an ihrem Rücken und leise Stimmen drangen an ihre Ohren. Menschen!
Sie versuchte zu blinzeln, obwohl sie so müde war, dass sie die Augen kaum aufbrachte. Sie blickte in dunkle, fast schwarze Augen in einem tiefbraunen Gesicht. Als nächstes sah sie lange schwarze Haare, die zu zwei Zöpfen geflochten waren und im Haarschopf wehten zwei Federn. Ein Indianer!
Sie hatte nicht einmal Angst. Sie war einfach nur froh, dass jemand sie gefunden hatte. Die Lippen des Mannes verzogen sich zu einem leichten Lächeln, als er sah, dass das Kind erwacht war. „Ohan“, murmelte er. „Wintschintschala kin kikta yelo!“ Es klang irgendwie so, als freute sich der Indianer, dass sie endlich aufgewacht war.
Ein weiteres dunkles Gesicht beugte sich über Mary und sah sie prüfend an. Noch ein Indianer! Er war jünger, als der Mann, der sie im Arm hielt und trug seine langen Haare offen. Sie fielen über seine Schultern und wehten im Wind, genauso wie einige Federn, die er im Haar trug.
Er hielt Tupfen am Strick und klopfte ihm den Hals. „Schunka wakan nitawa ho?“, fragte er, dabei deutete er auf das Pony und dann auf Mary. Sie verstand, dass er sie fragte, ob es ihr Pony sei. Mary nickte nur kurz und über das Gesicht des Indianers huschte ein vergnügtes Lächeln.
„Wana, schunka wakan mitawa kin!“, meinte er herausfordernd. Mary verstand auch das! Nun ist es sein Pferd, hatte der Indianer gesagt.
Mary schüttelte empört den Kopf. Dann deutete sie mit dem Finger auf ihre Brust. „Mitawa!“, wiederholte sie das Wort in der seltsamen Sprache der Indianer. Meins!
Die beiden Indianer lachten vergnügt und schienen alles für einen guten Spaß zu halten. Schließlich beugte sich der jüngere Indianer zu ihr hinunter, tippte ihr an die Brust und meinte: „Waschté! Nitawa kin!“ Dann drückte er ihr den Strick in die Hände. Wie eine Ertrinkende klammerte sich Mary an das Letzte, was ihr noch geblieben war. Niemand durfte ihr das Pony wegnehmen.
Der ältere Indianer kramte einen Beutel hervor und zog etwas hervor, das wie ein Keks aussah. „Loyatschin ho?“, fragte er.
Dann führte er den Keks an den Mund, als wollte er ihn essen. Mary hatte solchen Hunger! Natürlich wollte sie etwas essen. Misstrauisch nahm sie den Keks in die Hand und biss hinein. Sie nahm sich nicht die Zeit zu probieren, was sie da aß, sondern schluckte die Krümel sofort hinunter. Gierig biss sie das zweite Stück ab, doch der Indianer legte ihr den Zeigefinger auf den Mund und bedeutete ihr zu warten. Er kaute übertrieben und zeigte ihr so, dass sie den Keks langsam essen sollte. Gehorsam behielt Mary den Bissen im Mund und kaute ihn gründlich. Es schmeckte nach Fleisch und Beeren. Als sie eine breiige Flüssigkeit im Mund hatte, schluckte sie schließlich. Erst dann nahm sie einen weiteren Bissen.