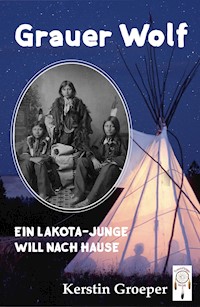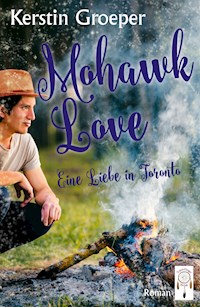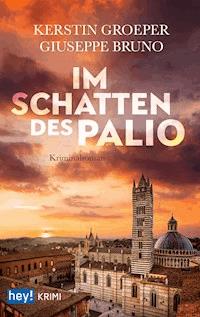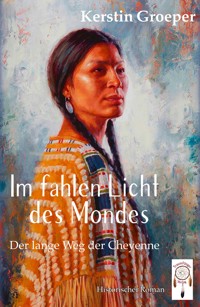
4,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Winter 1876. Nach der Schlacht am Little-Bighorn-Fluss und dem Sieg über General Custer haben sich die Cheyenne wie gewohnt in ihre Winterlager zurückgezogen. Auch Moekaé, eine junge Frau, freut sich auf die Ruhe des Winters. Als eines Morgens Kugeln in ihr Tipi schlagen, beginnt für sie eine verzweifelte Flucht. Nach schweren Kämpfen werden die Cheyenne schließlich gestellt und ins Indianer-Territorium deportiert. Dort siechen die Menschen unter schrecklichen Bedingungen dahin. Sie sind das Klima nicht gewohnt, zudem reichen die gelieferten Lebensmittel kaum aus, um den ärgsten Hunger zu lindern. Mit einigen Entschlossenen bricht Moekaé auf, um wieder in ihre angestammte Heimat im Norden zurückzukehren. Mitten im Winter sind die Cheyenne so geschwächt, dass ein Teil der Menschen sich nach einem entbehrungsreichen Weg schließlich im Fort Robinson ergibt. Dort verschlimmert sich die Lage so sehr, dass die verzweifelten Menschen den Ausbruch wagen, unter ihnen auch Moekaé. Sie ist hochschwanger, als sie mitten im Schneesturm von einer Kugel getroffen wird … denn die Soldaten und weißen Siedler beginnen eine gnadenlose Hetzjagd auf die verhassten Indianer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Im fahlen Licht des Mondes
Der lange Weg der Cheyenne
Historischer RomanvonKerstin Groeper
Impressum
Im fahlen Licht des Mondes, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2015
1. Auflage eBook Februar 2022
eBook ISBN 978-3-948878-19-1
Lektorat: Michael Krämer
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: James Ayers@2015
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG, Hohenthann
Inhalt
Moekaé
Heskovetse
Crazy-Horse
Darlington Agentur
Aufbruch
Kansas
Sappa-Bach
Platte-Fluss
Camp Robinson
Hunger
Flucht
Biber-Bach
Eve
Moekaé
Rahel
Büffel
Monika
Fleisch
Little-Wolf
Inhaftierung
Ranchleben
Fort Robinson
Missverständnis
Monika und Collins
Tatanka-ohitika
Wambli-canté
Inipi
Red Cloud Agentur
Collins
Dull-Knife
Kapitulation
Zivilisation
Militärgericht
Stacheldraht
Viehtrieb
Diebe
Gold
Ranch
Connor
Der weiße Mann führte zwei Kriege. Einen, um uns zu töten. Und einen, um die Erinnerung daran auszulöschen.
Black Kettle, Cheyenne-Häuptling, 1867
Dieses Buch ist für das Volk der Cheyenne und gegen das Vergessen
Moekaé
Moekaé kniete am Feuer im Tipi und starrte sinnend in die Glut. Die Hände ruhten in ihrem Schoß, untätig, und doch waren sie schwielig und kräftig, gewohnt schwere Arbeit zu verrichten. Moekaé genoss die Ruhe. Nur gedämpft drangen die Geräusche der umliegenden Zelte an ihr Ohr. Leise, fröhliche Stimmen waren zu hören und dazwischen das Knurren von Hunden, die sich um irgendwelche Knochen balgten.
Moekaés geschwungene Lippen zeigten ein zartes Lächeln, als die junge Frau den Stimmen des Dorfes zuhörte. Ansonsten blieben die Augen ernst, als ob sie schon zu viel Leid gesehen hätten. Mit einer fahrigen Bewegung strich die Frau eine Haarsträhne nach hinten, die sich aus den Zöpfen gelöst hatte. Die Zöpfe fielen über ein geblümtes Kleid, das mit einem Gürtel gerafft wurde, an dem einige Utensilien hingen: ein Messer in einer bestickten Scheide, ein buntes Täschchen mit Feuersteinen und Zunder und ein Ahlenbeutel mit Nähnadeln und Fäden. Als sie sich nach vorne beugte, um Feuerholz nachzulegen, baumelten lange Ohrringe aus elfenbeinfarbenen Dentaliumschnecken hin und her, die fast bis zum Gürtel hinabhingen und das ovale Gesicht auf würdevolle Weise einrahmten. Sie bildeten einen schönen Kontrast zu den dunklen Gesichtszügen der Frau und den fast schwarzen Augen. Gegen die Kälte, die von der Wand des Tipis strahlte, hatte die Frau sich mit einer blauen Decke geschützt, die lose über die Schultern hing und kaum die schlanke Gestalt verbarg.
Moekaés Blick löste sich von den züngelnden Flammen, die nach dem Holz griffen, und blieb an den buntbemalten Taschen hängen, die überall am Rand des Tipis gestapelt lagen. Sie waren gefüllt mit Vorräten und Kleidung für den Winter. Die Jagd im Herbst war gut gewesen, obwohl sie mehrmals den weißen Soldaten hatten ausweichen müssen, die ihnen nach der Schlacht am Little-Bighorn-Fluss hartnäckig gefolgt waren. Jetzt lag bereits der erste Schnee und die Cheyenne hatten sich bis in die Bighorn-Berge zurückgezogen, um den Soldaten zu entkommen. Moekaé lächelte, als sie an den großen Sieg am Little-Bighorn dachte. Sie war über das Schlachtfeld gegangen und hatte den gefallenen Soldaten die Waffen abgenommen. Ihr Mann besaß nun ein neues Gewehr mit viel Munition und sie selbst trug einen Revolver unter ihrem Kleid. Einige Frauen hatten Custer gefunden und ihm das Trommelfell mit ihren Ahlen durchstochen, damit er sich auch im Jenseits daran erinnerte, dass es besser war, seine Versprechen einzuhalten. Einst hatte er im Zelt des Bewahrers der Heiligen Pfeile versprochen, nie wieder Krieg gegen die Cheyenne zu führen. Nun, er hatte dieses Versprechen gebrochen und dies hatte den Untergang für ihn und seine Soldaten herbeigeführt.
Moekaé schaute auf, als ihr Ehemann Heskovetse die Türklappe hob und in das Tipi kletterte. Er trug eine Decke aus warmem Büffelfell um die Schultern, die er nun achtlos zu Boden gleiten ließ. Darunter trug der junge Mann ein buntes Hemd aus Baumwolle, warme Winterleggins und einen Lendenschurz aus blauem Deckenstoff, den er über einen Conchogürtel geschlagen hatte. Seine Haare fielen lose über die Schultern und waren durch den Wind, der draußen tobte, durcheinander-gewirbelt. Er schlug sich mit einem breiten Grinsen auf seinen Bauch und deutete an, dass er kurz vor dem Platzen war. „Noch einen Bissen und ich sterbe“, meinte er gut gelaunt.
Die junge Frau deutete auf den vollen Kochtopf und lächelte ebenfalls. „Nimm!“
„Uah!“, stöhnte der junge Krieger und ließ sich dann schwerfällig auf ein Fell plumpsen. „Ich sterbe bereits bei dem Gedanken an Fleisch!“
„Die Jagd war gut.“ In Moekaés Stimme lag Zufriedenheit und die Hoffnung, dass alles wieder so werden würde wie einst.
„Wahrhaftig“, stimmte Heskovetse ihr zu. „Obwohl die Herden der Büffel an Zahl abnehmen. Die Gier der Weißen vernichtet alles, was es sonst im Überfluss gegeben hat.“
Moekaé senkte den Blick und ihr Lächeln verschwand. Für diesen Winter hatten sie genug Vorräte, doch sie wusste, dass alle sich Sorgen machten, wie es in Zukunft weitergehen sollte. Weise Menschen sprachen bereits davon, dass es besser wäre, in die Reservationen zu gehen, doch die jungen Krieger wollten davon nichts hören. Sie warf ihrem jungen Ehemann einen unsicheren Blick unter ihren langen Wimpern zu und musterte ihn prüfend. Er war jung und drahtig, gewohnt zu kämpfen. Seine Augen waren stolz und wild, nur wenn er sie musterte, verloren sie ein wenig diesen gefährlichen Schein. Er liebte sie, auch wenn er manchmal rücksichtslos und unnahbar wirkte. Sie war ihm im Frühling zur Ehefrau gegeben worden und seitdem war wenig Zeit geblieben, um sich näher kennenzulernen. Er gehörte der Gesellschaft der Blue-Soldiers an und trug stolz seinen geschnitzten Talisman aus Hirschhorn in der Hand, wenn er in den Kampf zog. Die Blue-Soldiers hießen eigentlich Elkhorn Scrapers, doch nachdem sie nach einem Kampf mit Soldaten die blauen Jacken erbeutet hatten, trugen sie nun diesen Namen. Vorher gab es diesen Namen auch schon, aber da war er spöttisch gemeint, und so hatten die Krieger es vorgezogen, die alte Bedeutung zu vergessen. Moekaé senkte den Blick und dachte an frühere Zeiten zurück, als die Männer noch ihre Zeremonien gefeiert und ihre besondere Kriegsausrüstung getragen hatten. Sie erinnerte sich an die Kappen aus Rabenfedern der Dogsoldiers und an die Bemalung der Kit-Foxes, die sich den Oberkörper und das Gesicht mit gelber Farbe und die Beine schwarz bemalt hatten. All dies war nun vergangen. In all den Kämpfen war keine Zeit mehr geblieben, sich für den Kriegszug zu schmücken, sondern es ging um das Überleben.
Meist war ihr Mann, bekleidet mit einer blaue Uniformjacke, mit den Blue-Soldiers unterwegs, um gegen das Eindringen der weißen Soldaten oder Siedler zu kämpfen.
Sie hingegen war damit beschäftigt gewesen, seine Mokassins zu flicken, seine Hemden und Leggins zu nähen und seine Proviantbeutel zu füllen, wenn er nach einer kurzen Rast wieder aufbrechen musste. Sie zählte ungefähr siebzehn oder achtzehn Winter, so genau wusste das niemand. Ihre Eltern hatten erzählt, dass sie nach dem Vertrag von Fort Laramie bei den hundert Zelten geboren worden war. Damals waren die Zeiten gut gewesen und die Weißen hatten mit Geschenken darum gebuhlt, durch das Land der Cheyenne ziehen zu dürfen. Inzwischen waren die Cheyenne geschwächt von den ewigen Kämpfen und den Seuchen, die ihr Volk hart getroffen hatten.
Moekaé freute sich auf den Winter. Er versprach Ruhe und Frieden. Endlich würde ihr Ehemann zuhause sein und sie konnten vielleicht ihr Eheleben beginnen. Noch wuchs kein Kind in ihrem Leib und die anderen Frauen munkelten, ob sie vielleicht unfruchtbar wäre.
Moekaé biss die Lippen aufeinander und schob diesen Gedanken beiseite. Wie sollte ein Kind entstehen, wenn der Ehemann nie bei ihr lag? Heskovetse hatte nur selten mit ihr geschlafen. Es war kurz und ungeschickt gewesen und hatte ihr wehgetan. Nun hoffte sie, dass der Winter ihn sanft machte und er in ihr mehr seine Frau sah und nicht einen Feind, den man unter sich bezwingen musste. Die Mutter hatte ihr einen alten Trick verraten, wie man die Schmerzen vermeiden konnte und wie eine Frau es schaffte, dass auch der Mann seine Frau liebkoste. „Nimm Fett“, hatte ihre Mutter geflüstert. „Und streichle seinen kleinen Mann, damit auch er sich Zeit lässt und dich streichelt. Dann wird es schöner zwischen euch beiden sein.“
Sie hatte geprustet vor Lachen, doch dann hatte sie über die Worte nachgedacht. Schon lange hatte sie sich vorgestellt, wie sie zu ihm sein würde, wenn er endlich bei ihr lag, und diese Vorstellung hatte ihre Ängste weniger werden lassen. Sie würde nicht wie ein Brett unter ihm liegen wie bisher, sondern die Initiative ergreifen. Auch Cheyennefrauen waren mutig. Sie kicherte plötzlich und erntete einen erstaunten Blick ihres Mannes.
„Warum lachst du?“, fragte Heskovetse misstrauisch. Manchmal schien er wirklich nicht viel von Frauen zu wissen oder vermutete, dass er irgendwelchen Spott auf sich zog.
Moekaé lächelte freundlich und streichelte ebenfalls über ihren Bauch. „Ich fühle mich auch kugelrund, aber ich wünschte, es wäre aus einem anderen Grund!“
Der misstrauische Blick ihres Mannes wurde plötzlich sanft und Moekaé staunte über die Veränderung.
„Warte nur, mein Grasmädchen“, flüsterte er in ihr Ohr. „Auch ich wünsche mir ein Baby. Bald!“
Sie zuckte kichernd zusammen und freute sich über diese Worte. Endlich dachte er mal nicht an Kampf und Krieg! Sie nahm die Spielerei mit ihrem Namen auf und neckte ihn ebenfalls: „Dann darfst du mich aber nicht nur mit deinen Stacheln stechen, mein Stachelschwein, sondern mit deinem anderen Ding!“
Heskovetse grinste breit und staunte nicht schlecht über diese Anzüglichkeit bei seiner sonst so keuschen Ehefrau. „So, so! Ich bin also dein Stechschwein!“, murmelte er frech.
„Hmh!“, antwortete Moekaé. Dann öffnete sie ihre Beine und zeigte provozierend auf ihre weibliche Stelle. „Hier, genau hier!“
„Uah!“, schimpfte Heskovetse empört. „Als ob ich das nicht wüsste!“ Mit einem Satz warf er sich auf seine junge Ehefrau und zog mit einem Ruck ihr Kleid in die Höhe. Doch dann nahm er sie plötzlich ganz sanft in die Arme und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Kichernd lagen sie engumschlungen da, fast wie jung Verliebte, die noch nicht wussten, was Liebe eigentlich ist.
„Noch nicht!“, flüsterte Heskovetse. „Noch nicht!“
Moekaé drückte sich an ihn und nickte. Sie wusste, dass die Männer noch ihre Reinigungsrituale machen mussten. Zu viel Blut war geflossen und die Geister mussten erst besänftigt werden. Ein Kind war eine hohe Verantwortung und durfte nicht gedankenlos gezeugt werden.
Sie lag mit offenen Augen neben ihrem Mann und sah zu, wie das Feuer langsam niederbrannte. Ihr Tipi war klein, aber sie war froh, dass sie es mit niemandem teilen musste. Ihre Eltern lebten im Zelt nebenan, zusammen mit ihrer Schwester und den Kindern. Ihre Schwester war bereits Witwe und hatte keinen neuen Mann mehr gewählt. Ein Bruder war letztes Jahr gefallen und hatte ebenfalls eine Frau und zwei Kinder hinterlassen, die nun versorgt werden mussten. Ihr Volk hatte schlimme Zeiten erlebt und sie dachte an all die Menschen, die bereits von ihr gegangen waren. Ihre Großeltern waren beide bei einem Überfall der Soldaten getötet worden, ebenso wie eine kleine Cousine und ein weiterer Bruder. Er war noch ein Kind gewesen, keine zwölf Winter alt, und doch hatten die Soldaten kein Mitleid gehabt. Sie hatte nun keine Brüder mehr. Warum schossen die Soldaten auf Frauen und Kinder? Dafür gab es keine Erklärung. Wahrscheinlich waren es keine wahren Menschen, sondern böse Geister aus einer anderen Welt.
Sie war zu müde, um aus dem Kleid zu schlüpfen, und döste mit offenen Augen. Sie wollte ihren Mann nicht wecken, der immer noch einen Zipfel ihres Kleides um seine Hand geschlungen hatte. Es war ein Kleid aus geblümtem Baumwollstoff, das ihnen bei irgendwelchen Friedensgesprächen als Geschenk überreicht worden war. Sie glaubte nicht mehr an Frieden. Zu oft hatte sie erleben müssen, dass Menschen ihres Volkes trotz dieses Friedens zusammengeschossen worden waren. Weiße hielten sich nicht an Verträge oder das gegebene Wort. Für Moekaé war das unverständlich. Worte, die unter den Heiligen Pfeilen oder der Anwesenheit des Bündels von Sweet Medicine, des Propheten, gesprochen wurden, waren heilig. Sweet Medicine war vor Generationen auf den Heiligen Berg, den Bear Butte, gestiegen und hatte dort von Mahéo die Anweisungen erhalten, wie die Cheyenne zu leben hatten, um Mahéo zu gefallen. Die Regeln und Verhaltensweisen waren seither für jeden Menschen klar gewesen und jeder hielt sich daran. Selbst Gefangene fielen unter diesen Schutz und konnten auf Mitleid hoffen. Weiße Menschen hatten keine Regeln und Wertvorstellungen. Selbst Wölfe kümmerten sich um Ihresgleichen, doch weiße Menschen fielen übereinander her und verschonten selbst Babys in den Tragewiegen nicht. Sie waren wie die Spinnen, bei denen das Weibchen nach der Paarung das Männchen frisst, wenn es nicht schnell genug flüchtete. Sie breiteten sich in dem Land der Cheyenne aus wie die Spinne ihr Netz.
Die Zerstörung des Landes und der Lebewesen darin war für Moekaé unvorstellbar und ging einher mit dem Niedergang ihrer Sitten und Bräuche. Frauen fühlten dies eher als die Männer, die oft noch damit beschäftigt waren, mit Waffengewalt das Unvermeidbare aufzuhalten. Aber die Frauen erlebten, dass Sitten verrohten, Männer sich nicht mehr an die alten Überlieferungen und Rituale hielten oder im Kampf abstumpften. Längst ging es nicht mehr um Ruhm und Ehre, sondern um das bloße Überleben. Viele der Älteren, deren Aufgabe es wäre, die Geschichten und Überlieferungen weiterzugeben, waren getötet worden und so ging Wissen, das sonst von Generation zu Generation überliefert wurde, auf immer verloren. Vielleicht hatte sich deshalb ihr Bauch noch nicht gerundet? Welches Kind wollte schon in eine solche Welt geboren werden? Doch ein Kind bedeutete auch Hoffnung. Ein Kind bedeutete, dass das Volk der Cheyenne weiterexistieren würde. Ja, in den Frauen lebten die kommenden Generationen.
Moekaé schlief ein und träumte davon, an einem See zu sitzen und ihr Baby im Arm zu halten. Dieses Gefühl war unbeschreiblich schön. Ganz deutlich spürte sie das Gewicht des Kindes in ihrem Arm, fühlte den warmen Körper, doch dann fuhr sie plötzlich schweißgebadet auf, als dieses Baby seine seltsamen blauen Augen öffnete und sie das Gefühl hatte, in diesem Blau ertrinken zu müssen. Augen in der Farbe des Sees! Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und horchte auf ihr pochendes Herz. Auch ihr Mann wurde unruhig und blinzelte sie verschlafen an.
Im gleichen Augenblick zerriss eine Salve die Stille des angehenden Morgens. Kugeln zerfetzten das Leder des Zeltes und zischten über Moekaés Kopf hinweg, ohne wirklich Schaden anzurichten. Schreie hallten durch das Dorf, Pferde wieherten und das ohrenbetäubende Brüllen von angreifenden Soldaten ließ die Menschen für einen kurzen Augenblick in Lähmung verfallen. Moekaé sah schreckensbleich auf ihren Mann, der ebenso entsetzt neben ihr kauerte.
„Lauf!“, befahl Heskovetse. „Lauf!“ Er schlüpfte in seine Uniformjacke, als würde dies ihn irgendwie beschützen. Dann schnappte er sich sein Gewehr und einen Munitionsgürtel, hängte sich eine Decke um die Schultern und schlüpfte aus dem Tipi. Mit fliegenden Händen packte Moekaé ebenfalls eine Decke, griff nach einem Proviantbeutel und einer Tasche, als bereits die nächste Salve durch das Tipi jagte und sie sich instinktiv in die Decken fallen ließ. Kriechend schob sie sich zum Eingang des Zeltes und ließ sich hinausrollen. Die Tasche blieb liegen. Moekaé wickelte die Decke um ihren Körper und hängte sich den Beutel um den Hals, während sie neben ihrem Mann kniete, der mehrere Schüsse in die Front der angreifenden Soldaten jagte. Überall war Rauch, sodass kaum zu erkennen war, ob die Schüsse irgendwelchen Schaden anrichteten.
„Zum Wald!“, herrschte Heskovetse sie an und zeigte mit den Lippen in die ungefähre Richtung. Er hatte sich bereits einen kleinen Überblick verschafft und hoffte auf einen Fluchtweg für die Frauen und Kinder.
Moekaé schlüpfte an ihm vorbei und begann mit weichen Knien zu laufen. Kugeln flogen an ihr vorbei und nur aus den Augenwinkeln sah sie, wie Menschen neben ihr zu Boden stürzten. Ihr Mann blieb genau hinter ihr und drängte sie, immer weiterzurennen. „Schneller! Lauf schneller!“
Neben ihnen lief Moekaés Schwester mit ihren beiden Kindern. Sie schrie hysterisch und hielt das kleinere Kind gegen ihre Brust gepresst. Moekaé nahm ihren Neffen an der Hand und zog das Kind rücksichtslos mit. Der kleine Junge war erst vier Jahre alt und konnte mit seinen kurzen Beinen kaum mithalten. Seine Augen waren weit vor Furcht und er weinte seine Angst heraus. Am Himmel erschien die erste Morgenröte und tauchte das Tal in ein gespenstisches Licht. Überall waren die braunen Uniformmäntel aus Büffelfell der Soldaten zu sehen, die zu Fuß oder zu Pferde durch das Dorf der Cheyenne jagten und wahllos auf alles schossen, was sich bewegte. Die Soldaten trugen Pelzmützen und Fellhandschuhe, die sie vor der Kälte schützten, während die Indianer zum Teil nur leicht bekleidet in die Kälte des Morgens flüchteten. Manche waren fast nackt, als sie schlaftrunken aus den Tipis wankten und dort von Kugeln getroffen zusammensackten.
Moekaé sah, wie ihre Schwester nach vorne fiel und dabei ihre Tochter fallen ließ. „Steh auf!“, bat Moekaé verzweifelt und zog ihre Schwester am Arm. Blut sickerte aus dem Mund der Schwester, dunkel und schwallweise, dann brachen die Augen und alles wurde schwer. Moekaé war so entsetzt, dass sie zu keinem Gedanken fähig war. Neben ihr schrie der kleine Junge nach seiner Mutter und sie nahm es kaum wahr. „Schwester!“, rief Moekaé. „Schwester, bitte steh auf!“
Heskovetse riss das kleine Mädchen hoch und stürzte mit ihr davon. „Lauf weiter!“, schrie er mit überschnappender Stimme. „Du kannst ihr nicht mehr helfen. Nimm den Jungen mit!“
Wie in Trance griff Moekaé nach der Hand des Jungen und zog ihn mit sich fort. Wieder peitschten Kugeln neben ihr in den Boden und sie schlug einen Haken. Dann tauchte sie unter einige Bäume, änderte leicht die Richtung und rannte tiefer in den Pinienwald. Überall rannten Frauen und Kinder um ihr Leben. Manche überschlugen sich, als würde eine riesige Hand ihnen von hinten einen kräftigen Schlag versetzen, aber Moekaé wusste, dass sie nie wieder aufstehen würden. Im Dämmerlicht konnte sie nicht erkennen, wer fiel, und sie wollte es auch gar nicht wissen. Hier ging es nur noch um ihr eigenes Überleben.
Heskovetse hielt plötzlich an und drückte ihr das kleine Mädchen in die Arme. Sie war fast noch ein Baby, keine zwei Winter alt, und wurde von der Mutter noch gestillt. Sie weinte schluchzend und drückte ihr nasses Gesicht an Moekaés Hals. „Sei leise“, flüsterte Moekaé. Sie rannte weiter, während ihr Mann hinter einem Baum in Deckung ging und mit anderen Männern eine Schützenlinie bildete, um den Rückzug der Frauen und Kinder zu decken. Kurz stockte der Angriff der Soldaten und dies gab den Menschen Zeit, tiefer im Dickicht des Waldes zu verschwinden. Viele hatten es nicht geschafft. Die Soldaten gingen nun dazu über, die wenigen Überlebenden im Dorf zusammenzutreiben und hatten ihren offensichtlichen Spaß an ihrer Überlegenheit. Schreie erklangen, als Frauen misshandelt und verletzte Männer einfach erschossen wurden. Dann konnten die Flüchtenden einen hellen Feuerschein im Tal erkennen, als die Soldaten damit begannen, die Zelte mitsamt aller Ausrüstung in Brand zu stecken.
Moekaé rannte weiter und setzte sich dann völlig außer Atem neben andere Frauen und Kinder, die hinter einigen Felsen Schutz gesucht hatten. „Sie brennen alles nieder!“, wimmerte eine ältere Frau.
Moekaé dachte an die Vorräte, die sie in mühevoller Arbeit angelegt hatte, und an die warme Kleidung. Aber mehr noch dachte sie an all die Menschen, die nun dort unten lagen und ihr Leben gelassen hatten. Ihre Schwester war tot und sie wusste nicht, ob es ihre Eltern und Freundinnen geschafft hatten. Tröstend drückte sie die beiden Kinder an sich und stellte fest, dass sie zumindest voll bekleidet waren. Sie hießen Kleiner-Biber und Rotes-Blatt. Kurz schoss der Gedanke durch ihren Kopf, dass sie nun die Mutter für diese beiden Kinder sein würde und die Verantwortung lastete wie ein schwerer Stein auf ihrem Herzen. Wie sollte sie die Kleinen ernähren? Kleiden? Warm halten? Wo sollten sie nun hin? Ein ängstliches Raunen ging durch die Ansammlung der Frauen und Kinder, als Schritte zu hören waren, doch es waren nur einige Krieger, die schwer atmend zu ihnen aufschlossen. „Schnell! Weiter! Die Soldaten folgen uns!“, zischten sie warnend. Hastig sprangen alle auf und liefen weiter in die dichte Wildnis. Sie verteilten sich und jeder suchte sich allein einen Weg nach Norden, um den Soldaten die Verfolgung so schwer wie möglich zu machen.
Moekaé trug Rotes-Blatt auf ihrer Hüfte und zog Kleiner-Biber an der Hand hinter sich her. Der Junge war erschöpft und jammerte leise.
„Sei still!“, zischte Moekaé mahnend. „Wir müssen ganz leise sein, damit die bösen Vehoe uns nicht finden.“
„Wo ist meine Mutter?“, fragte Kleiner-Biber bittend. Er hatte plötzlich Angst vor dieser Tante, die sonst immer so freundlich und liebevoll gewesen war.
„Sie ist gestürzt und kann nicht mehr aufstehen“, antwortete Moekaé schnell. Es hatte keinen Sinn, dem Kind jetzt erklären zu wollen, dass die Mutter nie wiederkommen würde.
„Was machen dann die Vehoe mit ihr?“, jammerte Kleiner-Biber weiter. „Ich will nicht, dass wir ohne sie fortgehen.“
„Wir müssen!“, drängte Moekaé. „Und nun komm!“
Widerstandslos ließ sich das Kind mitziehen. Doch manchmal drehte es den Kopf und sah mit großen Augen den Feuerschein und die Rauchwolken, die sich in der Ferne abzeichneten. Immer noch waren Gewehrschüsse zu hören und jedes Mal zuckte das Kind zusammen und klammerte sich furchtsam an Moekaés Hand.
Die Sonne stieg höher und ein Teil der Frauen und Kinder kletterte in eine tiefe Schlucht. Leise folgten sie einem reißenden Bach, der sich ebenfalls seinen Weg durch die Schlucht bahnte. Das Jammern und Klagen hatte aufgehört, stattdessen waren nur die leisen Schritte der Menschen zu hören. Manchmal rollte ein Kieselstein unter den Füßen weg und ein Rabe krächzte, als wäre es ein ganz normaler Morgen. Das Gewehrfeuer in der Ferne war verstummt, vielleicht hatten die fliehenden Menschen aber auch genügend Abstand zwischen sich und den Ort des Grauens gebracht. Von hinten erklang Hufgetrappel und panisch vor Angst drängten sich die Flüchtenden zwischen einige Felsen. Doch es waren ein paar junge Krieger, denen es gelungen war, einen Teil der Ponyherde zu retten. Leise frohlockend kamen die Frauen aus ihren Verstecken und nahmen zum Teil in Streifen gerissene Decken her, um den Pferden einfache Zügel anzulegen. Schnell saßen alle auf den Ponys und die Flucht ging nun schneller voran. Hufe klapperten gegen den steinigen Boden, ansonsten war es wieder still.
Moekaé hatte Kleiner-Biber hinter sich auf das Pony gesetzt und der Junge klammerte sich an ihr fest. Vor sich im Arm hielt sie Rotes-Blatt, die vor Erschöpfung eingenickt war. Das Kind lag schwer in ihrem Arm und Moekaé schob es in eine aufrechte Position, um den Arm zu entlasten. Der Kopf wackelte dabei haltlos hin und her, bis er schließlich wieder in ihrer Armbeuge ruhte. Kurz hatte Moekaé den Verdacht, dass das Kind vielleicht doch irgendwie verletzt war, aber sie konnte nichts feststellen. Still folgte sie den anderen Frauen, die sie nun im Tageslicht besser erkennen konnte. Vor ihr ritt Eiserne-Zähne, eine ältere Frau, die ebenfalls ein Kleinkind im Arm hatte. Ein siebenjähriges Mädchen saß hinter der Mutter und hielt den Bauch der Mutter umklammert. Weiter vorn erkannte Moekaé ihre Freundinnen Sommer-Regen und Büffelkalb-Frau. Ein Krieger drängte sich an ihr vorbei und sie fragte ihn besorgt nach ihren Mann. „Hinten!“, signalisierten seine Hände, dann trabte er davon. Moekaé war beruhigt und trieb das Pony zu einem schnelleren Schritt an. Heskovetse würde bestimmt bald kommen!
Der Bauch des Ponys wärmte sie ein bisschen und Moekaé war froh, dass sie wenigstens dieses Pferd hatte. Der Atem war deutlich als Nebel zu sehen und dies erinnerte sie daran, wie kalt es eigentlich war. Das Pony trottete dahin und irgendwann wachte das kleine Mädchen wieder auf und weinte leise nach seiner Mutter. Moekaé griff in den Beutel und zog etwas Trockenfleisch hervor, um das Kind abzulenken. Auch Kleiner-Biber verlangte nach etwas zu essen und sie drückte ihm einen Streifen Fleisch in die Hand. „Iss langsam! Wir haben nicht viel!“, warnte sie das Kind. Rotes-Blatt kaute ebenfalls an dem trockenen Fleisch und wieder kullerten dicke Tränen über das Gesicht des Kindes. „Nahgo?“, fragte sie immer wieder nach ihrer Mutter.
Moekaé schwieg. Sie wollte nicht lügen und sie wollte nicht die Wahrheit sagen. Irgendwann würden die Fragen aufhören, wenn keine Antwort kam.
Die Stille wurde von Schüssen durchbrochen und sofort brach Panik unter den Menschen aus. Oben waren Soldaten in Stellung gegangen und hatten die verzweifelten Menschen in der Schlucht unter Beschuss genommen. Schreie hallten durch die Luft, brachen sich an den Wänden und kehrten als schauerliches Echo zurück. Moekaé rutschte vom Rücken des Ponys und riss Kleiner-Biber ebenfalls herunter. Der Junge kreischte vor Angst und klammerte sich so an der Tante fest, dass sie kaum noch laufen konnte. Rotes-Blatt hatte den Mund weit aufgerissen und brachte keinen Ton mehr heraus. Wieder schlugen Kugeln in die Bäume, prallten an den Felsen ab und heulten als Querschläger durch die Schlucht. Moekaé zerrte das Pony neben sich her und benutzte es als Deckung. Es wieherte angstvoll und versuchte tänzelnd, sich loszureißen. Moekaé konnte es unmöglich halten und so rutschte der provisorische Zügel durch ihre Hände. Wiehernd galoppierte das Pony davon und Moekaé tauchte zwischen einige Bäume, um den Kugeln zu entgehen. Sie hastete geduckt dahin, den Jungen rücksichtslos hinter sich herziehend, während sie das Mädchen gegen ihre Brust drückte. Sie stolperte mehr als sie lief und sah immer wieder, wie Menschen um sie herum zu Boden stürzten. Sie waren nur noch so wenige und auch diese fielen den Kugeln zum Opfer. Dann verschwand sie endlich hinter einigen großen Felsen, die ihr besseren Schutz gaben, und duckte sich in eine Felsnische. Beide Kinder schrien ihre Angst heraus und auch ihr Herz schlug so schnell, dass es aus ihrer Brust zu springen drohte. Zwei Männer sprangen neben ihr in Deckung und nahmen die Soldaten unter Beschuss. Es war Heskovetse, der seiner Frau mit einem Nicken den Befahl gab, sich weiter zurückzuziehen. Moekaé krabbelte davon und zerrte die weinenden Kinder hinter sich her. Sie war panisch vor Angst. Gleichzeitig hatte sie eine Todesangst um ihren Mann. Es waren nur noch zwei Männer, die dort bei den Felsen den Rückzug der wenigen Überlebenden sicherten. Immer wieder hörte sie wütendes Gewehrfeuer und sie wusste, dass ihr Mann dort niemanden vorbeilassen würde, solange er noch lebte.
Die Schlucht gabelte sich nach Norden und Westen und Moekaé wählte eine steile Passage in westlicher Richtung nach oben, um der Todesfalle zu entkommen. Selbst wenn einige Soldaten am Grat der Schlucht entlangliefen, um ihr den Weg abzuschneiden, würden sie eher an der nördlichen Seite warten. Sie hätten erst in die eine Schlucht hinabsteigen müssen, um zu der westlichen Seite zu gelangen. Wahrscheinlich hatten sie die Abzweigung überhaupt nicht gesehen.
Moekaé schnaufte unter dem Gewicht des Kindes, doch sie kletterte weiter den steilen Pfad bergan. Vor ihr rannten Eiserne-Zähne mit ihren Kindern und ein Stückchen weiter erkannte sie ihre Freundin Büffelkalb-Frau. Sie hinkte stark und schien verletzt zu sein. In der Hand hielt sie einen Revolver. Moekaé beeilte sich, um ihre Freundin einzuholen und zu stützen. Sie balancierte das Kind auf ihrer linken Hüfte und legte den Arm von Büffelkalb-Frau um ihre Schulter. Kleiner-Biber klammerte sich an einen Zipfel ihres Kleides und lief tapfer mit. Er weinte nicht mehr, vielleicht hatte er erkannt, dass dies ohnehin nichts nützte. Büffelkalb-Frau lehnte sich schwer auf Moekaés Schulter und zog mit zusammengepressten Lippen ihr Bein hinterher. „Eine Kugel hat mich erwischt“, stöhnte sie leise.
„Ist es schlimm?“, fragte Moekaé besorgt.
„Nein, aber ich muss die Blutung stoppen. Mir wird schlecht!“
„Noch nicht! Lass uns erst aus dieser Schlucht herauskommen. Die Soldaten sind zu nahe!“, weigerte sich Moekaé.
Ehe sie es verhindern konnte, sackte ihre Freundin zusammen und glitt zu Boden. Ihr Gesicht war aschfahl und Moekaé hatte Angst. Sie wusste, dass die Soldaten ihnen auf den Fersen waren. Immer noch waren Gewehrschüsse zu hören, obwohl sie sich zu entfernen schienen. Moekaé setzte das Kind ab und kniete sich zu ihrer Freundin. „Lass sehen!“, meinte sie hastig. Büffelkalb-Frau schob das Kleid aus blauem Wollstoff hoch, das sich an einer Seite bereits dunkel vom Blut gefärbt hatte, und tastete nach dem Oberschenkel. Eine hässliche, blutige Schramme zog sich quer durch das Fleisch. Die Wunde blutete stark, schien aber eher oberflächlich zu sein.
„Uh!“, stöhnte Büffelkalb-Frau, dann sackte ihr Kopf kraftlos nach hinten. Moekaé wusste, dass nur der Blutverlust dieser Frau die Kraft nahm, denn Büffelkalb-Frau war gewohnt zu kämpfen. Noch im Frühjahr hatte sie beim Kampf am Rosebud ihren Bruder aus der Gefahrenzone gerettet. Sie galt als Kriegerfrau und ihre Tapferkeit war an den Lagerfeuern besungen worden. Das alles zählte nun nicht mehr. Hier waren sie nun die Gejagten und wenn Büffelkalb-Frau nicht aufstand, dann würden die Soldaten über sie herfallen.
Moekaé schlug ihr mit der Hand ins Gesicht und brachte sie so wieder zur Besinnung. „Du kannst hier nicht bleiben!“, warnte sie eindringlich. Energisch riss sie einen Streifen Stoff aus ihrem eigenen Kleid und band damit die Wunde notdürftig ab. Dann half sie ihrer Freundin wieder auf die Beine. „Komm!“, mahnte sie drängend. „Du weißt, was diese Vehoe mit uns Frauen machen!“
Büffelkalb-Frau nickte und humpelte eilig neben Moekaé her. Die Kälte schien den Schmerz zu lindern und sie nahm Kleiner-Biber an der Hand, sodass Moekaé sich besser um das kleine Mädchen kümmern konnte. Moekaé blieb hinter der Freundin, um besser sehen zu können wenn sie eventuell stürzte. Außerdem war der Pfad zu schmal, um nebeneinander zu gehen. Sie war froh, dass auch Büffelkalb-Frau eine Decke dabei hatte, um sich warm zu halten. Von hinten waren von den Frauen nur der Scheitel und die Ansätze der Zöpfe zu sehen. Ansonsten waren die zähen Körper von den Decken verhüllt. Schließlich hatten die beiden Frauen den Grat der Schlucht erreicht und schauten sich vorsichtig um. Auf der einen Seite war ein breites Tal, doch auf der anderen Seite begann dichter Pinienwald. Hastig liefen die beiden Frauen mit den Kindern darauf zu, immer in der Angst, dass doch einige Soldaten sie entdeckten und niederschossen. Schwitzend tauchten sie in den Schutz der Bäume und drangen tiefer in das Dickicht ein. Erschöpft setzten sie sich unter einige Bäume und verhielten sich ruhig.
„Wir gehen in der Nacht weiter“, wisperte Moekaé.
Büffelkalb-Frau nickte wortlos und legte sich auf die Seite. Ihre Hand glitt prüfend über den Verband. „Und wohin gehen wir dann?“, fragte sie. Ihre schwarzen Augen ruhten fast bittend auf dem Gesicht von Moekaé. Die Hand der Kriegerfrau zitterte, als sie die Decke fester um ihren Körper zog.
„Nach Norden! Dort werden wir die anderen finden“, versicherte Moekaé. Sie erkannte, dass Büffelkalb-Frau nicht aus Angst zitterte, sondern wegen der Verletzung.
„Und was machen wir dann?“ Das runde Gesicht von Büffelkalb-Frau zeigte plötzlich Hass und Wut.
Moekaé zuckte die Schultern und machte eine vage Handbewegung. „Vielleicht finden wir ein anderes Dorf? Die Lakota haben im Herbst auch die Büffel gejagt. Sie werden noch in der Nähe sein. Vielleicht finden unsere Männer einen Lagerplatz von ihnen?“
„Hoffentlich“, murmelte Büffelkalb-Frau. „Es ist kalt.“ Sie zitterte nun vor Kälte und schien orientierungslos zu sein.
Moekaé sagte nichts dazu. Mehr Sorgen bereitete ihr, wie sie überhaupt zu einem Dorf gelangten und ob sie dort freundlich aufgenommen wurden. Sie hüllte die beiden Kinder unter ihre Decke und spürte das Zittern. Es war kalt und ohne Decken und Unterschlupf würden sie den Winter hier draußen nicht überleben.
Es war zu gefährlich, ein Feuer zu entfachen, und so hockten sie eng beisammen, um sich gegenseitig zu wärmen. Moekaé kramte etwas Trockenfleisch aus dem Beutel und alle aßen dankbar. Moekaé kaute es für Rotes-Blatt weich, damit das Kind es besser schlucken konnte. Dann kümmerte sie sich um die Schussverletzung ihrer Freundin. Zum Glück hatte die Blutung aufgehört und so wickelte Moekaé nur einen neuen Stofffetzen um das Bein. Die Dämmerung kam bereits und die beiden Frauen hatten Angst vor der kommenden Nacht. „Sollen wir weitergehen?“, fragte Büffelkalb-Frau. „Vielleicht finden wir eine geschützte Stelle, wo wir Feuer machen können?“
„Nein!“, wehrte Moekaé entschieden ab. „Wir sind noch zu nahe. Vielleicht setzen sie Kundschafter ein, um uns aufzuspüren. Die Soldaten sehen unsere Spuren und auch den aufsteigenden Rauch eines Feuers nicht, aber ihre Kundschafter schon. Wahrscheinlich haben sie Crow- oder Arikara-Scouts dabei. Wie sonst haben sie unser Dorf gefunden?“
Über das Gesicht von Büffelkalb-Frau huschte plötzlich ein Anflug von Scham. „Ich bin nur noch gerannt, ohne mich umzusehen. Ich weiß nicht, was mit meiner Familie ist und ob mein Bruder noch lebt.“
Moekaé biss die Lippen zusammen. „Meine Schwester ist tot. Ich weiß nicht, was mit meinen Eltern ist. Und mein Mann lag dort hinten bei den Felsen und versuchte die Soldaten aufzuhalten. Ich weiß nicht, ob er noch lebt.“ Sie drückte die Kinder fester an sich und seufzte tief. „Morgen gehen wir weiter nach Norden und treffen hoffentlich auf andere.“
Es wurde dunkel und die Frauen dösten eine Weile. Dann wurde die Kälte unerträglich. Die Kinder jammerten und Moekaé fühlte mit ihren Händen die Kälte in den kleinen Körpern. „Wir müssen weiter!“, befahl sie energisch.
„Jetzt?“, flüsterte Büffelkalb-Frau. Die Verletzung raubte ihr die Kraft.
„Ja, wir werden erfrieren, wenn wir uns nicht bewegen!“
Wieder rafften sich die Frauen auf und Moekaé band sich Rotes-Blatt vor sich an die Brust, um sie mit ihrer Decke warm zu halten. Kleiner-Biber schlotterte vor Kälte, aber sie hatte nichts, um ihn warm zu halten. „Geh mit Büffelkalb-Frau zusammen! Wenn du dich bewegst, wird dir bald wärmer!“
Kleiner-Biber kroch unter die Decke von Büffelkalb-Frau und stolperte müde neben ihr her. Seine Füße waren Klumpen aus Eis und er konnte kaum noch auftreten. „Meine Füße tun so weh!“, klagte er.
„Gleich wird es besser!“, versuchte Moekaé ihn zu trösten. Vorsichtig tasteten sich die Frauen durch die Dunkelheit, dann wurde der Wald wieder lichter und sie sahen die Sterne am Himmel. Trotzdem war es gefährlich, denn in der Dunkelheit konnte man kaum die Hand vor den Augen erkennen. Mehrmals stolperten sie über unebene Stellen und Gestrüpp. Es war still und so suchte Moekaé wieder den Rand des Waldes, weil dort das Vorwärtskommen leichter war. Niemand würde sie entdecken, solange sie im Schutz der Dunkelheit liefen, aber die Sicht wäre unter dem Licht der Sterne etwas besser. Kleiner-Biber setzte sich schließlich auf den Boden und weigerte sich weiterzugehen. Moekaé sah ein, dass sie eine Pause machen mussten und kniete sich neben das frierende Kind. Vorsichtig zog sie ihm die Mokassins aus und rieb seine eisigen Füße. Dann steckte sie die kleinen Füße unter ihr Kleid und drückte sie zum Wärmen gegen ihren Bauch. „Besser?“, fragte sie.
Kleiner-Biber nickte und schaute auf seine schlafende Schwester. „Bei dir ist es warm!“
Moekaé fühlte nach den Füßen von Rotes-Blatt und stellte fest, dass sie warm waren. Sie lächelte: „Ja, bei mir ist es warm.“ Dann wandte sie sich an ihre Freundin: „Du könntest Rotes-Blatt tragen. Sie ist nicht so schwer. Dann kann ich Kleiner-Biber unter meiner Decke tragen!“
Büffelkalb-Frau nickte nur. Sie wusste, dass es um das Überleben der Kinder ging.
Nach einer Weile brachen sie wieder auf. Rotes-Blatt hing nun in einem Tuch festgebunden vor Büffelkalb-Frau und Kleiner-Biber saß in die warme Decke gehüllt auf dem Rücken von Moekaé. Er wurde schwer und Moekaé kam nur noch langsam voran. Immer noch war es stockdunkel und der Morgen fern.
Den Rest der Nacht liefen die Frauen am Rand des Waldes dahin, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Sie hatten kein Gefühl mehr, welche Entfernung sie zurückgelegt hatten. Sie konnten nur hoffen, dass die Soldaten die Suche aufgegeben hatten.
Sie kuschelten sich unter einer Pinie zusammen und schliefen eng umschlungen ein. Die ersten Strahlen der Morgensonne tanzten über den Waldboden, brachen sich in den Ästen und wurden von glitzernden Eiskristallen an der dunklen Rinde reflektiert.
Heskovetse
Heskovetse war hinter dem Felsen in Deckung gegangen und gab Schuss um Schuss auf die Soldaten ab. Er versuchte, seine Munition nicht zu verschwenden und zielte genau. Immer wieder sackte ein Körper zusammen und die Soldaten wurden vorsichtiger. Querschläger jaulten durch das Tal, dann nahm der Beschuss ab. Heskovetse wusste, dass die Soldaten versuchen würden, ihn zu umgehen, und gab seine Position auf. Mit einem Tippen auf die Schulter gab er auch Hohes-Pferd zu verstehen, dass er sich lieber zurückziehen sollte. „Schnell, in den Wald!“, zischte er.
Heskovetse feuerte noch einige Schüsse in Richtung der Soldaten, dann rannten die beiden Krieger den Pfad entlang. Auch sie entdeckten die schmale Schlucht, die sich westwärts wandte, und kletterten in ihr empor. Sie liefen keuchend, so schnell sie konnten, und ließen sich schnaufend in das Gras fallen, als sie schließlich den Grad erreichten. Durch das breite Tal stapften bereits Soldaten, ihre Gewehre im Anschlag, und Heskovetse wusste, dass die Frauen wahrscheinlich Deckung im Wald suchen würden. Wieder nahm er die Soldaten unter Beschuss, damit sie nicht den Wald erreichen konnten. Es war ihm gleichgültig, ob sie ihn einkesselten oder abknallten, alles was zählte war, den Frauen einen kleinen Vorsprung zu verschaffen. Er wusste, dass Moekaé vor ihm war und noch lebte. Für sie zu sterben, war vielleicht der einzige Sinn, den sein Leben noch hatte. Rauch stieg vor seinen Augen auf und nahm ihm die Sicht. Er kniff die Augen zusammen und schoss auf die vereinzelten Schatten, die manchmal vor ihm auftauchten.
Die Soldaten hatten Abstand davon genommen, den Wald zu erreichen, und versuchten nun, die Krieger zu überwältigen. Sie wussten nicht, dass es nur zwei waren, die ihnen mit dem Mut der Verzweiflung ihre Kugeln entgegenschickten.
„Ich habe fast keine Munition mehr!“, rief Hohes-Pferd warnend. Heskovetse nickte und gab das Zeichen, dass der Krieger sich zurückziehen sollte. „Ich halte sie noch eine Weile auf und folge dir dann!“
Heskovetse feuerte mehrere Schüsse hintereinander, damit Hohes-Pferd in einer kleinen Rinne verschwinden konnte. Kriechend bewegte sich der Krieger auf den Wald zu und verschwand schließlich zwischen den Bäumen. Heskovetse grinste, denn niemand hatte seinen Freund gesehen. Wieder gab er mehrere Schüsse ab, dann erhielt er plötzlich Unterstützung von der anderen Seite des Tals. Auch dort waren offensichtlich Krieger in Stellung gegangen und nahmen die Soldaten unter Beschuss. Dort brach heilloses Durcheinander aus. Wenig geordnet zogen sich die Soldaten zurück und sammelten sich am Ende des Tales, um sich zu beraten. Heskovetse nutzte die Gelegenheit, um ebenfalls zu verschwinden. Geduckt rannte er die Rinne entlang und tauchte schließlich mit einem Satz unter die Bäume. Hohes-Pferd wartete bereits auf ihn und deutete mit seinen Lippen zu der anderen Seite des Tales. „Sie werden die Soldaten noch ein bisschen aufhalten. Lass uns das Tal umgehen und zu ihnen stoßen. Gemeinsam sind wir stärker!“
Heskovetse nickte und im Dauerlauf drangen die beiden tiefer in den Wald vor, um nach einem Weg zu suchen, der sie an der anderen Seite des Tales wieder zu ihren Freunden führen würde. Hin und wieder erklang Gewehrfeuer, aber sie konnten nicht sagen, ob es die Soldaten oder die Cheyenne waren, die dort schossen.
Die beiden liefen im lockeren Dauerlauf durch den Wald und fühlten die Wärme, die in ihnen hochstieg. Heskovetse hatte die wärmende Decke längst während der Kämpfe verloren und die Kälte hatte nach ihm gegriffen, als er schießend am Boden lag. Selbst die blaue Uniformjacke bot keinen ausreichenden Schutz gegen die unbarmherzige Kälte. Schnee lag in der Luft und er wusste, dass es bald schneien würde. Dann würde es noch schwerer werden, ohne Schutz hier draußen zu überleben. Die Finger waren bereits blau und manchmal hatte er versucht, die Hände mit seinem Atem zu wärmen. Jetzt strömte das Blut schneller durch die Adern und brachte das Gefühl in die tauben Finger und Füße zurück.
Zum ersten Mal konnte Heskovetse ihre Situation überdenken. Überhaupt wunderte es ihn, dass er noch am Leben war. Den ganzen Tag hatte er nichts anderes getan, als den Rückzug der Frauen und Kinder zu decken. Schießen, laufen, in Deckung gehen, schießen. Er hatte mitangesehen, wie ihr Dorf in Flammen aufgegangen war, und war hilflos vor Wut zur Untätigkeit verdammt gewesen. Er hatte miterlebt, wie Freunde und Familienangehörige gestorben waren, und hatte nicht einmal Zeit gehabt, Trauer zu empfinden. Auch jetzt ließ er dieses Gefühl nicht zu. Für Trauer war jetzt keine Zeit. In seinen Gedanken wirbelte es, als er an die nächsten Schritte dachte, die nun zu tun waren. Sie mussten die Frauen und Kinder sammeln, vielleicht einige Ponys einfangen und sich zu den nächsten Dörfern durchschlagen. Sein Atem formte weiße Wolken vor seinem Gesicht und erinnerte ihn daran, dass er vollkommen ungeschützt war. Sein Tipi mit all den Vorräten und der Kleidung darin waren verloren und die Ponyherde in alle Winde verstreut, wenn die Soldaten sie nicht zusammengeschossen hatten.
Kurz dachte Heskovetse an seinen Medizinbeutel und den Talisman aus Hirschhorn. Beides hatte ihm spirituelle Kraft verliehen und ihn immer daran erinnert, was es hieß, ein Cheyenne-Krieger zu sein. Immer ging es im Kampf um Ehre und Tapferkeit, doch all diese Werte waren plötzlich nichtig geworden. Die Weißen kannten keine Gnade. Die Grausamkeit, mit der die Soldaten auch gegen Frauen und Kinder vorgingen, war so unfassbar und bedrohlich, dass die Cheyenne langsam an den eigenen Untergang glaubten. Seitdem die heilige Büffelhaube im Zorn von einer eifersüchtigen Frau zerstört worden war, hatte das Glück die Cheyenne verlassen. Sie hatten das Wohlwollen Mahéos verwirkt. Wie sollten sie nun weiterleben? Sollten sie sich dem Schicksal fügen? Aufgeben?
Seltsam. Heskovetse hatte nach der Schlacht am Little-Bighorn ein solches Hochgefühl erlebt. Sie hatten den verhassten Weißen eine Niederlage erteilt und Custer getötet. Doch keine fünf Monate später hatten sie nun dafür büßen müssen und es waren hauptsächlich Frauen und Kinder gewesen, die im Kugelhagel der Soldaten gestorben waren. Heskovetse dachte an Moekaé, die hoffentlich irgendwo in diesem Wald Zuflucht gefunden hatte. Ob die beiden Kinder noch lebten? Es war selbstverständlich, dass er nun für die Kinder verantwortlich war. Er hatte gesehen, wie seine Schwägerin gestorben war, und er hatte doch nichts tun können. Wie schon so oft.
Vor ihm hielt Hohes-Pferd in seinem Lauf inne und deutete auf den Boden. „Sieh, zwei Frauen und ein Kind sind hier gelaufen!“
Heskovetse nickte und folgte den Spuren. „Sie sind allein. Lass uns ihnen folgen. Vielleicht ist es Moekaé.“
Es wurde dunkel und so wurde es schwierig, noch irgendwelche Spuren zu finden. Aber die beiden wussten, dass die Frauen einen Weg in nördlicher Richtung suchen würden. Hinter ihnen war es still geworden. Vorsichtig wechselten sie die Richtung und suchten die Krieger am Ende des Tales. Nichts. Auch die Soldaten hatten sich offensichtlich zurückgezogen und die Cheyenne ihrem Schicksal überlassen. „Wir gehen weiter nach Norden“, meinte Hohes-Pferd.
„Ja, aber wir bleiben am Waldrand. Die anderen werden auch einen Weg nach Norden suchen. Vielleicht haben die Lakota ihre Dörfer dort.“
Wieder machten sich die Männer auf den Weg. Manchmal gingen sie langsam, doch bereits nach kurzer Zeit griff die Kälte nach ihnen und so setzten sie ihren Dauerlauf fort, wenn es der unebene Boden zuließ. Ihre Schatten verschmolzen mit der dunklen Wand des Waldes und ihre Blicke waren auf den Boden geheftet, um Unebenheiten zu erahnen. Heskovetse dachte an Moekaé. Er war froh, dass sie noch kein Kind hatten und auch, dass Moekaé kein Kind unter ihrem Herzen trug. Dann dachte er an Rotes-Blatt und Kleiner-Biber, die so plötzlich ihre Mutter verloren hatten. Er war nun für die zwei Kinder verantwortlich. Wer wohl noch entkommen war? Er zählte erst fünfundzwanzig Winter und er dachte an die unzähligen Menschen, die bereits der weißen Gier nach Land zum Opfer gefallen waren. Die älteren Männer hatten ihm noch von den alten, ehrenvollen Kriegszügen erzählt. Wo es üblich war, Ponys zu rauben, und nur die Geschicklichkeit zählte. Mit leuchtenden Augen hatten sie von ihren Heldentaten erzählt. Eine Attacke gegen den Feind reiten und ihn mit dem Coupstick berühren, das waren die Geschichten, die ihm als Kind erzählt worden waren. Immer hatte er davon geträumt, ebensolche Heldentaten zu begehen. Sich im Kampf Mann gegen Mann mit dem Feind zu messen. Aber die Weißen hatten keine Moral. Sie kamen mit ihrer überlegenen Feuerkraft und töteten erbarmungslos. In ihm brodelte ein solcher Hass, dass er Mühe hatte zu atmen und kurz anhielt, um zu verschnaufen.
Die Sterne verblassten und am Horizont ließ ein heller Streifen den kommenden Tag erahnen. Bald würde die Sonne aufgehen und er hoffte, dann seine Frau zu finden. Sie bewegten sich nun vorsichtiger, denn die Helligkeit bot keinen so großen Schutz mehr wie zuvor die Dunkelheit. Alles blieb still, erstarrt in der ersten Kälte des Winters. Nicht einmal Vögel zwitscherten. Frierend bewegten sich die beiden nun langsam und vorsichtig vorwärts. In der einen Hand hielten sie ihre Gewehre, die andere Hand hatten sie unter die Hemden gesteckt, um sie wenigstens etwas zu wärmen.
Wieder war es Hohes-Pferd, der mit einer ruckartigen Kopfbewegung auf einige Fußabdrücke im Raureif des Morgens zeigte. Hier war erst vor kurzem jemand entlanggelaufen. Heskovetses Gesicht entspannte sich, als er mit den Augen der Spur folgte und unter Pinien einige Gestalten liegen sah. Sie waren in dunkle Decken gehüllt und hatten sich eng aneinandergekuschelt. Er drehte ab und bewegte sich in Richtung der Gruppe.
Eine der Gestalten richtete sich erschrocken auf, hatte das leichte Knirschen unter seinen Mokassins gehört. Er erkannte Moekaé und lächelte erleichtert. Die Furcht in ihren Augen verschwand und wich einem erleichterten Gesichtsausdruck. Sie blieb sitzen, um das Kind an ihrer Seite nicht zu wecken.
„Bist du verletzt?“, wisperte sie besorgt. Auch die andere Frau richtete sich ein wenig auf und blickte ihm erleichtert entgegen. „Wo sind die Soldaten?“, fragte sie.
„Die Soldaten sind weit hinter uns. Ich glaube nicht, dass sie uns folgen. Dafür ist es ihnen zu kalt. Aber wir können nicht zurück. Sie haben das Dorf und alles darin verbrannt.“
Moekaé nickte. „Wir haben das Feuer gesehen.“ Ihre Stimme war fast tonlos. „Wo sind die anderen?“
Heskovetse zuckte die Schultern. „Wir haben niemanden gesehen. Die Überlebenden werden nach Norden gehen. Wir müssen ein anderes Dorf finden, oder wir werden sterben.“ Er stellte das Gewehr gegen einen Baumstamm und steckte seine kalten Hände unter sein Hemd. Moekaé wickelte sich aus ihrer Decke und reichte sie ihrem Mann. „Hier! Wärme dich etwas auf! Soll ich ein Feuer machen?“
Heskovetse nagte an seinen Lippen, dann schüttelte er den Kopf. „Zu gefährlich!“
Er setzte sich mit Hohes-Pferd unter eine Pinie und schmiegte sich eng an seinen Freund, während Büffelkalb-Frau und Moekaé die andere Decke teilten. Kleiner-Biber setzte sich ebenfalls zu den Männern und die Decke reichte nur knapp für die drei Personen.
Heskovetse musterte seinen Freund von der Seite und kniff die Lippen zusammen. Hohes-Pferd war deutlich unterkühlt und sein dunkles Gesicht wirkte stumpf und fleckig. Sein Freund starrte fast blicklos vor sich hin und schien zum ersten Mal an all die Menschen zu denken, die gestorben waren. Heskovetse senkte den Blick und ließ seinen Freund in der Trauer allein. Sie alle hatten schwere Verluste zu verkraften.
Sie schliefen erschöpft ein, während leichter Reif ihre Spuren verdeckte und den Wald in eine glitzernde Zauberwelt verwandelte.
Am Spätnachmittag aßen sie Trockenfleisch, dann machten sie sich wieder auf den Weg. Die Sonne hatte sie etwas gewärmt, doch nun fürchteten sie sich vor der Kälte der Nacht. Die Männer gaben den Frauen die Decke zurück und machten sich im Dauerlauf auf den Weg. Vorsichtig liefen sie nach Norden und sicherten wachsam die Umgebung, während die Frauen und Kinder ihrer Spur folgten. Unterwegs stießen die beiden Männer auf Eiserne-Zähne und ihre Kinder und brachten sie zu der Gruppe zurück. Kurze Zeit später fanden sie eine weitere Frau und einen Krieger. Es war Schwarzer-Kojote, der eine Schusswunde am Arm hatte, die behandelt werden musste. Sie versorgten die Wunde und Heskovetse musterte den Krieger schweigsam. Auch er trug nur das Nötigste am Leib und war unterkühlt. Sie brauchten dringend Decken! In der Dämmerung fanden die beiden Krieger noch zwei kleine Mädchen, die jämmerlich zu weinen anfingen, als sie endlich gefunden wurden. Sie wussten nicht, ob sonst jemand überlebt hatte. Heskovetse fühlte eine solche Wut in sich aufsteigen, dass er kaum in der Lage war, die beiden Kinder zu trösten. Was hätte er auch sagen sollen? Die beiden Mädchen waren zumindest in warme Decken gehüllt und schienen unverletzt zu sein. Vertrauensvoll schlossen sie sich der Gruppe an und klammerten sich an Büffelkalb-Frau, um dort etwas Trost zu finden. Über ihre Wangen liefen lautlose Tränen der unendlichen Verlassenheit und Trauer. Sie waren nicht fähig, das Erlebte in Worte zu fassen, und so drückte Büffelkalb-Frau die Kinder lediglich fest an sich. Wie sollten Kinder so etwas überhaupt verstehen?
Heskovetse drängte die kleine Gruppe unbarmherzig zur Eile an. Im Dunkeln kamen sie nicht schnell voran, aber es war sicherer, im Schutz der Dunkelheit weiterzugehen. Wolken hatten sich vor die Sterne geschoben und es hatte begonnen zu schneien. Wenn erst dichter Schnee lag, wäre ein Vorwärtskommen noch schwieriger. Moekaé hatte Kleiner-Biber wieder Huckepack genommen und stolperte manchmal unter dem Gewicht des Kindes, aber er konnte es nicht ändern. Seine Aufgabe war es, die Frauen und Kinder zu schützen und einen sicheren Weg für sie zu finden.
Die ganze Nacht liefen die Menschen nach Norden, nur manchmal machten sie eine kurze Pause. Schweigend und erschöpft saßen sie dann unter den Bäumen, mit eisigen Wangen und Füßen. Schneefall setzte ein und die Decken boten keinen ausreichenden Schutz mehr. Besonders die Krieger litten unter der eisigen Kälte. Aber auch Rotes-Blatt war merkwürdig still und rührte sich kaum noch im Arm von Büffelkalb-Frau. „Ich kann sie nicht warmhalten!“, jammerte Büffelkalb-Frau hilflos.
„Wenn es Tag wird, machen wir ein Feuer“, erklärte Heskovetse. „Im Tageslicht wird uns der Schein des Feuers nicht verraten, aber jetzt ist es noch zu dunkel.“
Schweigend machten sie sich wieder auf den Weg. Die Bewegung war besser als das Herumsitzen und half gegen die Kälte. Alle sehnten den Sonnenaufgang herbei und hofften auf ein wärmendes Feuer. Kurz vor der Morgendämmerung fand Heskovetse eine Gruppe verschreckter Ponys. Leise lockend näherte er sich den vier Tieren und griff schließlich nach einem herabhängenden Seil. „Ganz ruhig!“, flüsterte er beruhigend. Sein Herz schlug höher vor Freude, denn mit den Ponys würden sie nun schneller vorankommen. Außerdem konnte man sich an ihren Körpern wärmen oder zur Not das Fleisch essen. Die Ponys waren zutraulich und ausgesprochen froh, wieder menschliche Gesellschaft gefunden zu haben. Er führte die Ponys zu den anderen zurück und erfreute sich an den dankbaren Gesichtern. Dann ordnete er eine Rast an. „Sucht trockenes Holz! Ich muss meine Füße wärmen!“
Die Frauen führten die Ponys auf eine kleine Lichtung und banden ihnen die Vorderbeine zusammen, damit sie nicht weglaufen, aber trotzdem grasen konnten. Unter den Bäumen lag noch kein Schnee und die Pferde rupften das gelbliche Gras. Dann sammelten die Frauen trockene Zweige und entzündeten ein kleines Feuer, während die Männer einige Äste zu einem Windschutz aufschichteten. Schließlich hockten alle um das Feuer und streckten ihre Füße in Richtung der angenehmen Wärme. Auch Rotes-Blatt wurde wieder lebhafter und verlangte nach etwas zu essen. Moekaé sah auf ihre schwindenden Vorräte und teilte gerecht das letzte Trockenfleisch. Wortlos schüttelten die Männer die Köpfe und deuteten an, dass sie das Fleisch lieber für die Kinder aufsparen sollte. So fütterte Moekaé nur Kleiner-Biber, Rotes-Blatt, die beiden Mädchen und die Kinder von Eiserne-Zähne, während die Erwachsenen auf Nahrung verzichteten. Die Krieger waren es gewohnt zu fasten. Sie genossen es, ihre Hände und Füße zu wärmen. Die Frauen schichteten Zweige am Boden auf, um sich gegen die Kälte zu schützen, und schließlich kuschelten sich alle unter die wenigen Decken, um etwas zu ruhen.
Im Laufe des Tages stießen weitere Menschen zu ihnen, sodass die Gruppe auf über zwanzig Personen wuchs. Unter den Neuankömmlingen waren auch die Tante der Mädchen und eine Verwandte von Büffelkalb-Frau, sodass sich stille Freude ausbreitete. Trotzdem blieb die Angst, wer wohl noch überlebt hatte oder doch den Kugeln der Soldaten zum Opfer gefallen war.
„Solange unsere Frauen und Mädchen überleben, wird unser Volk leben!“, überlegte Heskovetse laut.
„Nicht, wenn die Soldaten über sie herfallen!“, widersprach Hohes-Pferd. Sein hageres Gesicht war vom Hass verzerrt. Er lud sein Gewehr und zählte die Kugeln, die er noch übrig hatte. Jede Kugel bedeutete einen toten Soldaten.
Heskovetse senkte den Blick und rieb seine steifen Finger. Vielleicht hätte er schon längst dafür sorgen sollen, dass in Moekaés Bauch sein Kind heranwuchs und nicht das Kind eines Soldaten, wenn er seine Frau nicht mehr schützen konnte. Warum hatte er so lange gezögert? Sinnend musterte Heskovetse seine Frau, die unter der Decke kaum zu sehen war. Rotes-Blatt hatte sich an sie gekuschelt, so als wäre Moekaé bereits die Mutter. Moekaé war seit dem Frühjahr seine Frau und er hatte erst zweimal Liebe mit ihr gemacht. Natürlich konnte sich so der Bauch einer Frau nicht runden. Aber er war abgelenkt gewesen. Ständig hatten die Blue-Soldiers zu Kämpfen aufgerufen und er war ihrem Ruf willig gefolgt. Dann hatte die Büffeljagd seine ganze Aufmerksamkeit gefordert und seine Frau war bis in die Dunkelheit hinein beschäftigt gewesen, das Fleisch und die Felle zu verarbeiten. Sie hatte nach Blut und Schweiß gerochen und war abends todmüde in die Felle gefallen. Für was? All diese Dinge waren nun verloren. Ein Kind in ihrem Bauch wäre etwas Bleibendes. Etwas, für das es sich zu kämpfen lohnen würde. In den Kindern lag die Zukunft des Volkes. Er musste dafür sorgen, dass wenigstens sein Neffe und seine Nichte überlebten. Heskovetse stützte sinnend seinen Kopf in die Hände und stieß einen Zweig in das Feuer. Die Welt änderte sich so schnell. Überall schossen die Siedlungen der Weißen aus dem Boden und ihre Ackergeräte zerstörten die Mutter Erde. Zäune und Koppeln grenzten das Land ein und ließen keinen Platz mehr für die Cheyenne und die wilden Tiere dieses Landes. Wohin sollten sie gehen? Mit plötzlicher Klarheit erkannte er, dass es keinen Ort mehr gab, wo sie ihr bisheriges Leben fortsetzen konnten. Die Büffel verschwanden ebenso wie das andere Wild und die Weißen schossen auf jeden Indianer, der sich zeigte. Wut erfüllte ihn. Grenzenloser Hass. Es waren ihre Jagdgründe, die ihnen von Mahéo anvertraut worden waren! Die Weißen hatten hier nichts zu suchen. Seine Zehen brannten und er wusste, dass er leichte Erfrierungen hatte. Er konnte es nicht ändern. Hohes-Pferd und den anderen ging es genauso. Es würde besser werden, wenn sie reiten konnten, denn dann würde der Bauch des Ponys sie wärmen.
In der Dunkelheit brachen sie wieder auf. Alle hatten sich erholt und das Feuer hatte sie erwärmt. Noch war der Hunger erträglich und die Kinder schienen etwas kräftiger zu sein. Sie saßen auf den Ponys und hielten sich an der Mähne fest. Heskovetse verzichtete auf ein Pony und lief wieder mit Hohes-Pferd im Dauerlauf voran. Der verletzte Krieger hockte auf einem Pferd und hatte Kleiner-Biber vor sich. Heskovetse war froh darum, denn nun musste Moekaé das Kind nicht mühsam auf ihrem Rücken tragen. Sie führte ein Pony mit zwei Kindern und machte einen erholten Eindruck.
In der Nacht erreichten sie offene Prärie und nutzten die Dunkelheit, um weiterzugehen. Dieses Mal wandten sie sich nach Osten, in Richtung der Black Hills. Entweder sie fanden ein Dorf der Lakota oder sie mussten sich doch in Camp Robinson den Soldaten ergeben. Der Wind peitschte ungebremst über das Land und die Menschen liefen mit gebeugten Häuptern. Immer wieder rasteten sie an den Flussläufen und wärmten sich an kleinen Feuern. Einmal schlachteten sie ein Pony, weil der Hunger zu groß wurde. Die Frauen rösteten das Fleisch und teilten dann das übrige Fleisch als Wegzehrung auf. Zum ersten Mal seit Tagen konnten sich alle wieder sattessen und die Kinder verbrannten sich fast die Finger, als sie das heiße Fleisch in ihre Münder stopften.
Eine weitere Gruppe mit Flüchtlingen stieß zu ihnen und sofort teilten die Frauen das Fleisch auch mit diesen Menschen. Die Situation war verzweifelt und noch hatten sie kein anderes Dorf gefunden. In der Nacht tobte ein Schneesturm und sie schlachteten ein weiteres Pony, nahmen die Gedärme heraus und steckten ein Baby und Rotes-Blatt in die warme Bauchhöhle, um die Kinder zu wärmen. Die anderen versteckten sich unter den Decken und ließen sich dann einschneien, um so die Wärme zu halten. Alle hatten am Morgen Erfrierungen an den Füßen und es wurde schwierig, die Kinder aus dem Bauch des Ponys hervorzuholen, weil es steifgefroren war. Doch die beiden Kinder lebten und so machten sich die Menschen wieder auf den Weg. Die beiden anderen Pferde waren im Schneesturm davongelaufen und so mussten nun alle zu Fuß gehen. Es war mühsam, weil der Schnee das Vorwärtskommen erschwerte. Die Cheyenne liefen nun tagsüber, weil es im Grunde gleichgültig war, ob jemand sie entdeckte. Einen weiteren Schneesturm würde keiner überleben.
Der eisige Wind tobte erbarmungslos um die Menschen und besonders die Kinder litten unter der grimmigen Kälte. Heskovetse hatte sich in der Not das Fell des Ponys abgezogen und trug es nun um seine Schultern. Nach außen war es blutig und steif, aber es hielt zumindest den Wind ab. Niemand hatte mehr die Kraft, als Kundschafter vorauszulaufen.
Gegen Abend war das Baby in den Armen der Mutter erfroren. Selbst unter der Decke war es für das Neugeborene zu kalt gewesen. Niemand weinte, niemand klagte. Selbst die Mutter nicht. Sie legten das Kind in die Astgabel eines abgestorbenen Baumes und gingen einfach weiter. Es war nun bei Mahéo. Dort war es warm und sonnig und all die Verwandten würden es mit offenen Armen aufnehmen. Eine Frau brach zusammen und weigerte sich weiterzugehen. Auch sie sehnte sich nach Frieden und Wärme. Die Menschen gingen mit gebeugten Köpfen an ihr vorbei und ließen sie zurück. Wahrscheinlich würde es ihnen in Kürze ebenso ergehen. Längst war Moekaé zu erschöpft, um noch auf andere Menschen zu achten. Ihre Füße waren Klumpen des Schmerzes und schienen gar nicht mehr zu ihrem Körper zu gehören.
Heskovetse und Hohes-Pferd trieben die Menschen so gut es ging weiter. Wer jetzt aufgab, dem konnten sie nicht helfen. Heskovetse hatte Kleiner-Biber auf seinen Rücken gebunden, weil das Kind nicht mehr laufen konnte. Der Umhang aus dem Fell des Ponys bot kaum Schutz, denn der Wind fasste darunter und ließ alles erstarren. Heskovetse wusste, dass der Junge am Erfrieren war. Er zitterte nicht mehr und das war ein schlechtes Zeichen. Rotes-Blatt hing wieder vor der Brust von Moekaé und er hoffte, dass dies das Kind ein wenig wärmen würde. Sie schleppten sich die ganze Nacht vorwärts, mühsam einen Schritt vor den anderen setzend. Irgendwann merkte Heskovetse, dass der Junge aufgehört hatte zu atmen. Seine Arme waren bereits steif und er hatte Mühe, ihn von der Schulter zu nehmen. Sanft legte er das Kind in den Schnee, betrachtete das starre Gesicht mit den vereisten Wimpern. Er war froh, dass er noch keinen Sohn hatte, den er auf diese Weise zurücklassen musste, doch die Wut war die gleiche. Das Zelt war warm gewesen, gefüllt mit Vorräten, genauso wie sein eigenes, ehe die Soldaten gekommen waren. Der Junge hätte nicht sterben müssen. Moekaé hielt neben ihn und starrte schweigend auf ihren Neffen. Ihr Gesicht war eine starre Maske, unfähig noch irgendein Gefühl auszudrücken. Heskovetse tastete sanft nach ihrer Schulter. „Lebt Rotes-Blatt noch?“
Moekaé nickte und erst jetzt sah Heskovetse im fahlen Licht des Mondes die Eiskristalle, die in ihren Wimpern hingen. Menschen drängten sich an ihnen vorbei, die keine Augen für den kleinen Jungen hatten, der dort im Schnee lag. Auch er war nun bei Mahéo.
„Komm“, flüsterte Heskovetse mit rauer Stimme. „Wir müssen weiter!“
Moekaé setzte sich schlurfend in Bewegung und Heskovetse folgte ihr. Sein Rücken, der vorher durch den Körper des Jungen geschützt worden war, fröstelte nun. Immer noch fiel Schnee und die ungeschützten Menschen hatten nichts mehr, um sich gegen die Natur zu wehren.
Gegen Morgen erreichten sie schließlich ein weites Tal, das von mehreren Hügeln gesäumt wurde. Ein Späher stand auf dem höchsten Felsen und stieß einen Warnruf aus. Nur mühsam konnte Heskovetse den Kopf heben, doch dann blieb er abrupt stehen und hob die Hand. Zelte! Dort vorne standen Zelte. Wärme! Sein einziger Gedanke galt dem Feuer, das bestimmt in diesen Zelten brennen würde, und ganz kurz traf ihn die Trauer, dass der Junge nicht ein wenig länger überlebt hatte. Jetzt hätte man ihn am Feuer wärmen können! Aber vielleicht war es noch nicht zu spät für Rotes-Blatt, Moekaé und die anderen. Einige Krieger kamen misstrauisch auf ihn zu und er erkannte, dass es Lakota waren. Sie waren vollkommen überrascht, die Flüchtlinge zu sehen. Schnell breitete sich das Entsetzen in den Gesichtern der Männer aus, als sie sahen, in welch verheerendem Zustand die Ankömmlinge waren. Frauen wurden gestützt, Kinder im Laufschritt in die Zelte getragen und den Männern noch auf den letzten Schritten Decken um die Schultern gelegt.
Heskovetse blieb bei Moekaé und ließ sich mit seiner Frau in ein Zelt führen. „Welches Dorf?“, fragte er in der Sprache der Lakota. „Crazy-Horse!“, lautete die freundliche Antwort.