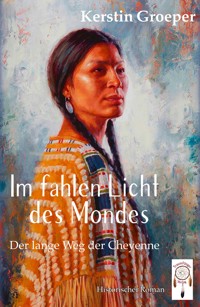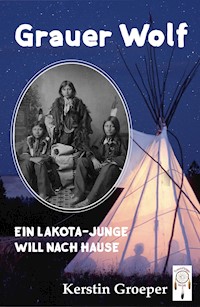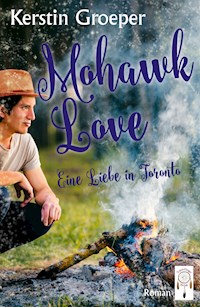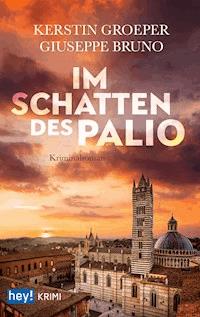Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Maisblüte, ein junges Mädchen der Choctaw-Indianer am Alabama-Fluss, wächst wohlbehütet im Dorf ihres Vaters auf. Ihr Häuptling Tuscalusa ist ein mächtiger Mann, der von den Nachbarvölkern gefürchtet wird. Gleichzeitig bereitet sich im hohen Norden der Schildkröteninsel ein junger Mann der Menominee namens Machwao auf seine erste große Handelsreise in den Süden vor. Ihre beiden Leben nehmen eine dramatische Wendung, als Männer aus einem fernen Land mit seltsamen Helmen und auf bedrohlichen vierbeinigen Monstern mordend und brennend durch das Land ziehen. Die Spanier zerstören auf ihrer Suche nach Gold alles, was sich auf ihrem Weg befindet; doch die schlimmste Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist unsichtbar: Krankheiten dezimieren die Urbevölkerung und zerstören dabei blühende Kulturen. Auch Maisblüte gerät als Sklavin in die Fänge der spanischen Conquistadores, die auf ihrem Weg nach Norden auch bald für Machwao zur Bedrohung werden. Die Schicksale dieser beiden Menschen verknüpfen sich auf abenteuerliche Weise. Ein historischer Roman über eine fast unbekannte Zeit: Die Ankunft der Spanier um das Jahr 1540 in Nordamerika
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1026
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kerstin Groeper
Donnergrollen im Landder grünen Wasser
Für Rain, Blaize, Quintin, Cedar und Wade Jr.und das Volk der Menominee, auf dass sie nicht vergessenwerden!
Donnergrollen im Landder grünen Wasser
Historischer RomanvonKerstin Groeper
Impressum
Donnergrollen im Land der grünen Wasser, Kerstin Groeper TraumFänger Verlag, Hohenthann 2018
eBook ISBN 978-3-941485-65-5Lektorat: Michael KrämerSatz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal VerlagDatenkonvertierung: Readbox, DortmundTitelbild: Andrew Knez jrCopyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels Kg,HohenthannProduced in Germany
Inhalt
Maisblüte
Die Menominee
Maisernte
Machwao
Maiswinter
Hechtfluss
Der Kampf um Mabila
Juan de Anasco
Gefangenschaft
Steinemacher
Gewalt
Nach Norden
Hirschjagd
Über den Fluss
Tennessee Fluss
Awässeh-neskas
Winterlager
Verraten und verkauft
Ho-Chunk
Angriff
Rache
Witcawa
Ruhepause
Nomähpen kesoq – Die Rückkehr der Störe
Die Barrikade
Alibamo
Sopomahtek – Ahornsaft
Ohio-Fluss
Die große Reise
Casqui
Begegnungen
Pacaha
Folter
Terre de Haute
Neue Freunde
Chicago
Sekakok
Michigan-See
Quiguate
Shawano-Nuki
Beute
Die Portage
Illiniwek
Die Kaskaskia
Das Medizin-Spiel
Der große Fluss
Kaskaskia
Coligua
Wahkayoh
Vernichtung
Wasserlilie und Witcawa
Wanähsen Nuki
Heimreise
Chatah-Winter
Portage am Großen See
Regen
Heimkehr am Manomäh-Sipiah
Winteranfang am Menominee-Fluss
Wohin der Ahnherr sie führt
Das Versprechen
Der große weiße Bär
Winter bei den Menominee
Die Mounds der Ahnen
Awässeh Pameh
Nachwort und historischer Hintergrund
Die Schildkröteninsel/Florida/alias USA
Maisblüte
(Mabila im Süden der Schildkröteninsel)
Es war bereits das Ende des Sommers, der Frauenmond nahte und die Menschen freuten sich auf die Ernte des Maises und die Zeit des Überflusses. Maisblüte hielt die Spindel in kreisender Bewegung, während ihre Finger die Baumwollflocken zu langen Fäden zupften. Hin und wieder rollte sie den Faden auf die Spule. Sie summte vor sich hin und freute sich auf die kommenden Tage. Sie war als Jungfrau auserwählt worden, die Zeremonien vor der Maisernte zu begleiten. Der Mais stand hoch in den Feldern und die Kolben hatten bereits gelbe Blätter. Einige Wochen zuvor hatte sie das Fest des grünen Korns begleitet, um für eine gute Ernte zu beten. Doch jetzt würde die Ernte eingebracht werden und alle freuten sich auf die Erneuerung der Feuer und den Beginn des neuen Lebens.
Neben Maisblüte saß die Mutter an einem einfachen Holzrahmen und webte bereits an einem hellen Tuch. Ihre Hände waren alt und runzelig, trotzdem wand sie den Faden geschickt auf und ab und klopfte ihn mit einem Kamm aus Holz fest, sodass die Fäden eng beieinander lagen. So entstand ein langes Tuch, aus dem man Kleidung herstellen konnte. Sie lächelte, als sie ihre Tochter summen hörte. „Bist du schon aufgeregt?“
Maisblüte nickte. „Ja, es ist eine hohe Ehre, dem Heiligen Mann und Hashtali, dem Sonnenvater, zu dienen! Hoffentlich mache ich nichts falsch.“
Die Mutter nickte ernst. „Die Zeremonien sind wichtig! Wir werden eine gute Ernte haben und müssen beten, dass das Saatgut über den Winter nicht fault. Die Zeiten sind gut und dafür müssen wir danken. Auch die Männer haben viel Fleisch erlegt, sodass wir in der Zeit, in der das Gras stirbt, nicht hungern müssen.“ Ihre Stimme klang zufrieden.
Die beiden schwiegen, als sie sich wieder ihren Arbeiten widmeten. Es war bereits spät im Jahr und doch wehte eine laue Brise in die Chukka. Sie stand erhöht auf einem künstlich errichteten kleinen Hügel, sodass bei Regen oder Hochwasser das Innere der Behausung trocken blieb. Die Wände und das Dach waren aus einem Gestell aus Ästen erbaut worden, die mit Schilfmatten bedeckt wurden. Das Dach war so stabil, dass Männer darauf stehen konnten. Nur wenige Häuser waren erhöht, die anderen waren ebenerdig. Es zeugte von dem hohen Stand ihrer Familie, denn nur einige Chukkas hatten dieses Privileg. Ihr Dorf bestand aus gut zweihundert Hütten, die von einem stabilen Palisadenzaun umgeben waren.
Ihr Volk waren die Chatah oder auch Hacha hatak, das Volk vom Fluss, und ihr Minko war ein gefürchteter Krieger namens „Tuscalusa“, der schwarze Krieger. Zugleich war er auch der oberste Priester, der all das Wissen der Ahnen in seiner Person vereint hatte und so mit ihnen in Verbindung stand. Er war es, der die Gebete zum Sonnenvater schickte und für das Wohl des Volkes betete. Ihm zur Seite standen mehrere Hopaii, Heilige Männer, die die Zeremonien leiteten und den Minko unterstützten. Tuscalusa war ein mächtiger Mann, und damit war auch sein Volk stark und mächtig, sodass die letzten Winter eine Zeit des Friedens gewesen waren. Kaum ein Feind wagte es, die befestigten Dörfer anzugreifen. Tuscalusa griff mit harter Hand durch und ließ sich diesen Schutz von den anderen Dörfern mit Tributen bezahlen. Fremde, die in friedlicher Absicht kamen, wurden mit großer Gastfreundschaft bewirtet, doch Feinde wurden zur Abschreckung grausam gefoltert und die Überlebenden versklavt. Tuscalusa zählte auf Stärke und Abschreckung und nicht so sehr auf Verhandlungen.
Maisblüte genoss diesen Schutz. Als Mädchen konnte sie ungefährdet zum Badeplatz am Fluss gehen, im Wald Holz und Beeren sammeln oder auf den Feldern mit den anderen Frauen arbeiten. Sie erntete den weichen Flachs, der sich unter der Rinde des Maulbeerbaumes verbarg, und sammelte die Wolle der Baumwollpflanze, um daraus die Kleidung herzustellen. Sie konnte aber auch das Fell gerben und das Fleisch von der Jagdbeute verarbeiten, die der Vater brachte. Ihr Vater hieß „Große-Schlange“, und er gehörte zu den bevorzugten Kriegern des Häuptlings. Noch war er kräftig genug, um die Lanze oder den Bogen zu führen. Maisblüte hatte einen älteren Bruder, der bereits im Haus der unverheirateten Männer lebte.
Außerdem kümmerte sie sich um den kleineren Bruder, der erst sechs Winter zählte. Er hieß „Nanih Waiya“, Lehnender Hügel, in Erinnerung an die Herkunft ihres Volkes. Die Legende erzählte, dass ihr Volk einst weit im Westen gelebt hätte. Ein Hopaii, ein Heiliger Mann, führte sie über schneebedeckte Berge immer weiter nach Osten. Jeden Abend stellte er einen rotbemalten Stock in die Erde, der sich am Morgen stets nach Osten neigte. Erst, wenn der Stock aufrecht stehenbleiben würde, hätten sie ihre neue Heimat erreicht. So hatten sie diese Ebene mit ihren fruchtbaren Böden und fischreichen Flüssen gefunden. Damals hatte der Stamm zwei Brüder als Anführer gehabt. Der eine hieß Chatah, und die Legende besagte, dass auch dies auf ihren Stammesnamen zurückführte. Der andere hieß Chicksaw, der seine Leute nach Norden führte, um dort zu siedeln. Chatah hatte an der Stelle, an der der rotbemalte Stock aufrecht stand, einen Hügel aus Sand aufschütten lassen. Dort hatten die Menschen ihre Ahnen bestattet, deren Knochen sie auf der langen Reise mitgeschleppt hatten. Sie waren in Zedernholzrinde gewickelt und ehrenvoll zur letzten Ruhe gebettet worden. Frauen hatten in mühsamer Arbeit den Sand in Körben vom Flussufer herbeigeschleppt, und die Männer hatten Zedern gefällt und daraus einen hohen Hügel errichtet. Anschließend war der Hügel mit schwarzer Erde bedeckt und mit Baumschösslingen bepflanzt worden, damit Regen und Schnee das künstliche Bauwerk nicht abtrugen.
Nanih Waiya war ein symbolträchtiger Name, aber für Maisblüte war der kleine Bruder einfach nur ein ungezogenes Kind, das ihr an den Haaren zog oder die mühsam gesäuberte und weichgeklopfte Maulbeerbaumrinde durcheinanderbrachte, wenn er mit seinen Freunden in die Hütte stob, um sich etwas zu essen zu holen. Sie schimpfte nicht, denn das stand ihr als Schwester nicht zu. Auch die Mutter schimpfte nie, weil sie den Geist des Kindes nicht brechen wollte. „Er wird einmal ein großer Krieger!“, lächelte sie stets.
„Ja, groß darin, alles umzuwerfen!“, lästerte Maisblüte dann.
„Du musst Geduld haben, wenn du einst Mutter wirst!“
Maisblüte erwiderte daraufhin nichts. Ihre Mutter hatte ja recht. Also nahm sie ihren Bruder stets liebevoll in die Arme und bat ihn flüsternd um mehr Aufmerksamkeit. „Sieh nur, wie viel Arbeit das macht. Bitte, mach es nicht kaputt! Sonst habe ich ja gar keine Zeit, um dir etwas Leckeres zu kochen!“
Das half immer, denn ihr kleiner Bruder hatte einen schier unstillbaren Hunger. Sein kleiner brauner Körper drückte sich dann vertrauensvoll an sie heran, im Sommer nur mit einem kurzen Lendenschurz bekleidet, und seine Haare im kurzen Schnitt der kleinen Jungen.
Der Vater hatte die langen Haare eines Kriegers, die er zu einem hohen Zopf zusammendrehte und mit einem Haarband zusammenhielt. Auch er trug im Sommer nur einen kurzen Lendenschurz, aber seine Haut war teilweise mit Tätowierungen verziert, die davon zeugten, welch gefürchteter Krieger er war, denn die Tätowierungen waren Auszeichnungen für Tapferkeit. Wenn er die Hütte betrat, strahlte er Präsenz und Kraft aus. Alle Arbeiten ruhten dann und die Aufmerksamkeit richtete sich auf die Bedürfnisse des Vaters.
Maisblüte hatte schon früh gelernt, dem Vater das Essen zu reichen, die Muskeln zu massieren oder die Kleidung zu richten. Die Aufgaben waren verteilt, nur im Mond des Windes halfen die Männer auf den Feldern, weil das Umgraben der Felder oder das Anlegen neuer Felder für die Frauen zu anstrengend war. Die Aussaat und Pflege der Felder dagegen war Frauenarbeit, aber die Ernte wurde wieder von allen eingebracht, sogar von den Kindern, und ehe die frechen Vögel sich zu sehr bedienten. Die Kinder sammelten auch die Pekannüsse, aus denen schmackhafte Fladen gebacken wurden, oder sammelten andere Nüsse, Früchte und Beeren. Die Körbe waren bereits gut gefüllt, und die erhöhten Vorratsspeicher warteten auf den Mais. In der Sonne vor den Hütten trocknete Fisch auf hölzernen Gestellen und am Ufer wurden die Fischnetze für das nächste Frühjahr geflickt. Der Hash Tek Inhashi, der Frauenmond, war eine Zeit des Überflusses, aber auch der Feste und des Dankes an den Sonnenvater.
Maisblüte legte die Spindel zur Seite und hob prüfend das Gewand, das sie am nächsten Tag für die Zeremonie anziehen würde. Es war aus heller Baumwolle gewoben und mit einigen Fäden der dunklen Maulbeerbaumrinde durchsetzt. Das ergab ein schönes Muster. Sie wickelte das Tuch um ihren Körper und band es über der linken Schulter zu. Gehalten wurde das Tuch mit einem einfachen Gürtel aus einem breiten Stück Leder. So hatte sie beide Hände frei, um die Schalen und heiligen Dinge des Hopaii, des Heiligen Mannes, zu tragen. Ihre langen schwarzen Haare blieben offen und flossen in natürlichen Wellen über den hellen Stoff. Sie hatte dreizehn Mal das Gras sterben sehen, und bald würde sie ihre ersten Riten haben, die sie zur Frau machten. Sie war groß und schlank, noch mit der jugendlichen Spannkraft eines Kindes, aber bereits mit weiblichen Rundungen. Ihre Brüste standen hoch, noch nicht ausgezehrt vom Stillen der Kinder. Ihre Gesichtszüge waren fein, mit hochstehenden Wangenknochen, einer hohen Stirn und ausdrucksvollen schwarzen Augen. Sie war eine Zierde für jeden Mann, und ihr Vater erwartete als mögliche zukünftige Schwiegersöhne nur die besten Krieger. Noch galt sie als Kind, aber sie genoss bereits die bewundernden Blicke unverheirateter und manchmal auch verheirateter Männer. Im Sommer trug auch sie nur einen Schurz, der nichts von ihrer schlanken Gestalt verbarg.
„Du bist hübsch!“, lobte die Mutter bewundernd. Sie hieß „Langes-Schilf“ und ihre immer noch schlanke Figur betonte die Herkunft ihres Namens. Sie gehörte zum Isha des Wolfes, zum Clan des Wolfes, ebenso wie alle ihre Kinder, die den Status vor ihr geerbt hatten. Ihr Vater gehörte zum Clan des Windes.
Maisblüte kicherte und drehte sich einmal im Kreis. „Nicht wahr?“, forschte sie lobheischend.
Sie würde mit den anderen Mädchen durch die Reihen des Maises gehen und dem Hopaii die Schale reichen, mit dem der Mais gesegnet wurde. Erst dann würde das Volk die Kolben brechen und die Ernte in geflochtenen Körben einbringen. Jeder bekam seinen Anteil, doch ein Teil der Ernte würde in den Vorratsspeichern gestapelt werden. Die Chatah fürchteten Schlangen und bevorzugten daher hohe Plätze für ihre Vorräte. Maisblüte hatte auch noch andere Aufgaben, sodass sie in diesem Herbst nicht viel bei der Ernte helfen würde. Diese Ehre erhielt ein Mädchen nur einmal in seinem Leben.
Bereits im Hash Bissi, im Mond der Schwarzbeeren, hatte sie die Felder gesegnet und dabei einen Tropfen ihres Blutes vergossen, damit der Sonnenvater ihre Ernsthaftigkeit erkannte und ihnen eine gute Ernte bescherte. Wenn die Zeiten schwer waren, war auch schon mal ein Gefangener geopfert worden, von dem das Blut auf den Feldern verteilt worden war. Der Heilige Mann hielt das nicht für nötig, und so war seit längerem darauf verzichtet worden. Maisblüte konnte sich nicht daran erinnern, dass zu ihren Lebzeiten je ein Gefangener geopfert worden wäre. Aber jedes Mädchen schnitt sich in den Finger und gab sein Blut, um den Sonnenvater um den Segen zu bitten. Vielleicht war es ja besser, das eigene Blut zu geben, um zu flehen, und nicht das Blut eines Gefangenen, der um sein Leben gekämpft hatte.
Sie hatte schon erlebt, dass Gefangene ins Dorf gebracht und brutal getötet worden waren. Mit Keulen war auf sie eingeschlagen worden, bis sich keiner mehr rührte. Gleichgültig ob Männer, Frauen oder Kinder, Tuscalusa kannte kein Erbarmen mit ihnen. Maisblüte taten die Kinder leid, die sich an ihre Mütter klammerten und vor Entsetzen schrien. Meist reichte ein Schlag, und es wurde still, während der Todeskampf der Männer länger dauerte. Auch, weil man mit ihnen kein Mitleid hatte und somit die ersten Schläge nicht tödlich waren. Maisblüte hatte in diesem Sommer einmal einer solchen Zeremonie beigewohnt und anschließend beobachtet, wie die Seele eines Getöteten besänftigt worden war. Manchmal trat auch jemand vor und forderte einen Gefangenen für sich.
Maisblüte sah dies als gute Sache an, denn sie wusste von einigen, die inzwischen wertvolle Mitglieder des Stammes waren. Die Chatah waren ein reiches Volk, das es sich leisten konnte, ein paar Mäuler mehr durchzufüttern.
* * *
Im Westen neigte sich die Sonne über die Ebene und der kühle Abendwind ließ die Menschen frösteln. Tagsüber war es noch warm, aber nachts kühlte es merklich ab. Die Winter hier waren mild, meist ohne Schnee, aber mit langen Regenzeiten und kühlem Wind, der vom Meer her die salzige Luft brachte.
Die Mutter beugte sich über die Glut und blies vorsichtig hinein, um das Feuer wieder anzufachen. Sie brach einige trockene Zweige ab und wartete, bis sie Feuer fingen, und legte dann einige Scheite nach. Der Vater würde bald kommen und so machte sie sich daran, eine einfache Mahlzeit zuzubereiten. Sie hatte aus den ersten Pekannüssen in diesem Jahr gemischt mit Maismehl einige Fladen gebacken, die sie mit Fleisch füllte. Der Vater liebte dieses Essen! Der süßliche Geschmack des Fladenbrotes mischte sich mit dem herzhaften Geschmack des Fleisches und gab ihm so eine ganz eigene Würze.
Zwei weitere Frauen, die in ihrem Haushalt lebten, betraten die Hütte und setzten sich in den Hintergrund. Sie waren Sklavinnen, die tagsüber auf den Feldern arbeiteten oder andere niedere Dienste verrichteten. Die Mutter ignorierte sie, denn als hohe Frau sprach sie fast nie mit den Untergebenen. Sie ignorierte es auch, wenn der Mann sich manchmal zu ihnen legte, um seine körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Ein schwächliches Mädchen war bereits geboren worden, das aber den ersten Winter nicht überlebt hatte. Der Status der Frau hätte sich dadurch verbessern können, aber mit dem Tod des Kindes stand ihr dieses Privileg nicht mehr zu. Ihr Leib hatte sich wieder gerundet, und so hoffte der Mann auf einen weiteren Sohn. Langes-Schilf stand dem neuen Leben wohlwollend gegenüber und sorgte dafür, dass die Sklavin genug zu essen erhielt. Ein Kind hätte nicht den Status ihrer eigenen Kinder, aber es wäre ein vollwertiges Stammesmitglied, das auch den Status der Mutter ändern würde. Sie wäre dann eine untergeordnete Zweitfrau.
Der kleine Bruder schoss in die Hütte und ließ sich müde auf eine Matte gleiten. „Ich habe Hunger!“, maulte er.
Kommentarlos drückte ihm die Mutter einen Fladen in die Hand. Kinder durften immer essen, während die Frauen meist warteten, bis der Mann seinen Hunger gestillt hatte. Nanih Waiya stopfte das Essen hungrig in seinen Mund und erzählte dann kauend von seinen Heldentaten. „Wir haben heute Krebse gefangen!“
„Wirklich?“ Die Mutter lächelte gutmütig. „Und was habt ihr damit gemacht?”
„Na, eine Suppe gekocht! Wir haben alle aufgegessen!“
„Und dennoch hast du so einen Hunger?”, wunderte sich die Mutter.
Der Junge nickte wichtig. „Na, wir waren doch so viele!“ Er hob seine beiden Hände hoch, um die Zahl anzuzeigen. „Da bleibt nicht so viel für einen.“
Maisblüte kicherte hinter vorgehaltener Hand. „Wie viele Krebse habt ihr denn gefangen?“
„Vier Hände voll!“, erklärte der Junge stolz. „Jeder bekam zwei.“
„Nun, davon wird man wahrlich nicht satt!“, stimmte Maisblüte zu. „Das nächste Mal solltest du alleine fischen gehen. Dann kannst du alle Krebse essen und bist satt.“
„Das macht aber nicht so viel Spaß!“, weigerte sich das Kind. „Ich jage lieber mit meinem Stamm.“
„Aha, und wer ist dein Stamm?“
„Na, alle meine Freunde! Wir teilen alles!“
„Das ist lobenswert!”, meinte die Mutter. „Aber dann hungert ihr auch alle.“
„Nächstes Mal fangen wir mehr Krebse. Jetzt wissen wir ja, wie es geht!“ Nanih Waiya grinste frech. „Nächstes Mal bleibt so viel, dass ich euch auch was bringen kann!“ Er streckte seinen runden Bauch vor und strotzte vor Selbstbewusstsein.
„So, so!“ Die Mutter schüttelte ungläubig den Kopf. „Woher willst du das wissen?“
„Vater hat gesagt, dass er uns helfen wird!“
Die Mutter und Maisblüte lachten schallend und ernteten einen tadelten Blick des Jungen. „Wirklich!“, beteuerte er.
Die Mutter kicherte immer noch und strich ihrem Sohn über die Haare. „Aber sicher. Ich glaube dir und freue mich für dich. Ich möchte wirklich gerne etwas von dieser Krebssuppe probieren!“
Ihr Lachen erstarb, als der Vater die Hütte betrat. Seine eindrucksvolle Erscheinung flößte sofort Respekt ein. Er ließ sich auf einer Matte nieder und lächelte freundlich. „Warum habt ihr gelacht?“ Die Mutter zeigte auf den Sohn. „Er hat uns von seinem Jagderfolg erzählt. Und dass er wohl bald die ganze Familie ernähren kann!“
Der Vater schmunzelte erheitert. „Ja, ich zeige den Jungen morgen, wie sie Reusen bauen können, damit ihnen nicht so viele Krebse entwischen.“
„Siehst du!“, strahlte der Junge. „Vater hilft uns!“
Der Mann nahm den Jungen auf seinen Schoß und strich ihm über die Haare. „Du wirst einmal ein großer Jäger!“, bestätigte er den Eifer des Kindes.
* * *
Dann wurde es wieder still, als ein weiterer Mann die Hütte betrat. Aller Augen richteten sich voller Erstaunen auf den Ankömmling. Es war Tuscalusa, der Minko des Dorfes. Sofort verschwanden die Frauen und Kinder im Hintergrund, um den Gast im Gespräch mit dem Vater nicht zu stören. Es war verwunderlich, dass der Häuptling eigens zu ihnen kam, also musste es wichtig sein. Doch manchmal besprach er seine Pläne erst mit seinem Ersten Krieger, dem Tishominko, ehe er seine Entscheidung im Rat mitteilte. Als Tishominko leitete Große-Schlange auch Zeremonien für den Minko und galt als sein Sprecher.
Große-Schlange legte bescheiden den Kopf zur Seite und wartete, was Tuscalusa mit ihm besprechen wollte. Sie waren seit ihrer Kindheit miteinander befreundet, und Große-Schlange hatte noch nie das Vertrauen des Minkos verraten. Er behielt Stillschweigen über alles, was Tuscalusa ihm anvertraute, und verlangte das Gleiche von seiner Familie. Mit einer Handbewegung schickte er den Jungen nach draußen zum Spielen. Er war noch zu klein, um Geheimnisse zu hüten.
Gehorsam huschte Nanih Waiya aus der Chukka und hoffte, noch einige Freunde zu finden, mit denen er ein weiteres Abenteuer erleben konnte. Was die Erwachsenen zu erzählen hatten, war bestimmt langweilig. Auf ein Nicken hin verschwanden auch die beiden Sklavinnen. Große-Schlange tätschelte kurz über den Bauch der Frau und schenkte ihr ein wohlwollendes Lächeln, ehe sie durch den Türvorhang verschwand.
Tuscalusa nickte dankbar und griff dann nach einer kleinen Pfeife, die Große-Schlange ihm reichte. Die beiden Männer schwiegen eine Weile, dann runzelte Tuscalusa besorgt die Stirn. „Ich habe Kunde von den Völkern im Osten”, begann er langsam. „Sie erzählen merkwürdige Dinge.“
Große-Schlange senkte den Blick und hörte aufmerksam zu. Sie hatten ein weitreichendes Handels- und Nachrichtennetzwerk, und so war es nicht ungewöhnlich, dass sie über Ereignisse informiert wurden, die in anderen Teilen des Landes stattfanden.
„Reisende aus einem fernen Land sind unterwegs zu uns”, erzählte der Minko weiter. „Sie kommen nicht von unserer Insel, sondern aus einem Land jenseits des Meeres. Sie tragen seltsame Kleidung, die an den Panzer eines Käfers erinnert, und sie haben fremde Waffen und seltsame Tiere bei sich. Sie sind sehr kriegerisch und unterwerfen die Dörfer, durch die sie kommen. Sie plündern die Vorräte, nehmen sich die Frauen und Männer und versklaven sie.“ Der Häuptling zögerte verunsichert. Man konnte sehen, dass er nicht wusste, wie er diese Nachrichten einordnen sollte.
„Und sie sind auf dem Weg hierher?“, fragte Große-Schlange.
„Ja! Mir wurde berichtet, dass Häuptling Coosa gefangen gehalten wird und dass viele seines Volkes für die Fremden die Lasten tragen müssen. Die Fremden wandern den Piachi-Fluss entlang und stehen kurz vor Talisi.“
Große-Schlange machte eine abfällige Handbewegung. „Wir sind nicht wie Coosa! Sollen sie nur kommen!“
Tuscalusa lächelte ohne Humor. „Es kann nicht schaden, erst einmal zu spähen, wer diese Fremden sind! Ich kämpfe nicht gern gegen einen Gegner, den ich nicht kenne. Erst muss ich wissen, wie viele Fremde es sind, welche Waffen sie tragen und wie ihre Kampfkraft ist. Ich sehe es als Warnung, dass es ihnen gelungen ist, Coosa gefangen zu nehmen. Diese Fremden sind gefährlich, denn wenn sie erst den Minko eines Dorfes haben, dann versklaven sie auch das Volk.“
Große-Schlange runzelte die Stirn und warf einen Zweig ins Feuer. Sein Häuptling war nicht nur stark, sondern auch vorsichtig und überlegt. „Und wenn du einen Boten schickst? Du könntest eine Einladung schicken und inzwischen den Feind ausspähen, während du Vorbereitungen für einen Angriff triffst.“
Tuscalusa verzog schmunzelnd die Mundwinkel. „Ich dachte genau das! Ich werde meinen Sohn schicken, als Zeichen meiner Wertschätzung, aber du wirst die Krieger der anderen Dörfer hier in Mabila zusammenziehen. Vielleicht gehe ich diesen Fremden sogar entgegen und wiege sie in Sicherheit. Doch sollten sie mich dabei gefangennehmen, dann vertraue ich darauf, dass du mich wieder befreist. Für das Wohl des Volkes und für das Andenken an die Ahnen.“
„Ein Minko sollte sich dieser Gefahr nicht aussetzen. Du solltest ihnen nicht zu weit entgegengehen!“, warnte Große-Schlange seinen Freund.
Tuscalusa zischte abfällig durch die Zähne. „Nur bis Atahachi. Das Dorf ist befestigt und die Chukka des Minkos dort bietet einen würdigen Rahmen, um diese Fremden zu begrüßen. Von dort locke ich sie nach Mabila. Dann werden wir wissen, wie ihre Kampfkraft ist. Ich werde den Hopaii und die Jungfrauen mitnehmen, um unsere Dörfer vor Hexerei und bösem Zauber zu schützen. Außerdem wird es die Fremden in Sicherheit wiegen.“
Große-Schlange schloss für einen kurzen Augenblick die Augen, denn das würde bedeuten, dass auch seine Tochter den Minko begleitete. Wäre sie in Sicherheit? Andererseits war es ihre Pflicht, dem Minko und dem Hopaii zu dienen und das Volk vor Unheil zu bewahren. Er warf einen Blick in den Hintergrund der Chukka, wo seine Tochter still an irgendetwas arbeitete. Auch sie hatte innegehalten und blickte ihn erschrocken an. Dann senkte sie die Augen und arbeitete weiter. Sie würde gehorchen und das tun, was von ihr erwartet wurde. Dann entspannte sich Große-Schlange wieder. Der Minko würde sicherlich nicht sein Leben gefährden. Und das des Hopaii auch nicht. Große-Schlange machte eine abschließende Handbewegung. „Ich werde dich nicht enttäuschen und alles für einen Kampf vorbereiten.“
„Nur wenn es nötig ist!“, meinte Tuscalusa sinnend. „Aber die Nachrichten meiner Kundschafter sind beunruhigend. Es ist besser, wir sind vorbereitet.“
„Was ist mit der Ernte?“, fragte Große-Schlange nachdenklich.
Der Minko seufzte schwer. „Nichts. Wir segnen morgen die Felder und bringen die Ernte ein. Es werden Tage vergehen, ehe mein Sohn die Fremden erreicht. Ich selbst werde in einigen Tagen aufbrechen, um sie in Atahachi zu empfangen. Das gibt auch dir Zeit, die Krieger zu versammeln. Die Maisernte ist wichtig. Erst dann schicke Boten aus, die die Männer zusammenrufen.“ Mit einer schnellen Bewegung stand er auf, und auch Große-Schlange erhob sich, um seinem Freund Respekt zu zollen. Der Häuptling umarmte seinen Freund kurz und flüsterte ihm eine Warnung ins Ohr: „Pass auf! Meine Träume sind nicht gut!“
Große-Schlange erschrak zutiefst und sah seinem Freund nach, als dieser die Hütte verließ. Schlechte Träume waren immer eine Bedrohung.
Die Menominee
(Manomäh-Sipiah, Menominee-Fluss im Norden)
Machwao, der Schwarze Wolf, stieß das Kanu langsam durch die grünen hohen Halme des wilden Reises, die überall in Ufernähe des Manomäh-Sipiah, des Wildreis-Flusses, im Wasser wuchsen. Der Fluss hatte sich an dieser Stelle so verbreitert, dass er fast wie ein See anmutete. Wolkenfetzen bewegten sich darüber hinweg und eine leichte Brise wehte über das Wasser und ließ die Halme des Wildreises rauschen. Machwao benutzte zum Vorankommen einen langen Stock, mit dem er das Kanu vorwärts stieß; langsam, fast meditativ, steuerte er das Kanu zwischen den Halmen hindurch.
Es war Pawahan Kesoq, jener Mond, in dem das wilde Korn von der Ähre geschlagen wird. Noch war es tagsüber warm, doch einige Bäume hatten bereits begonnen, ihr Farbkleid zu wechseln. Sie funkelten in Rot, Braun und Gelb im Sonnenlicht, als wollten sie sich vor dem langen Winter ein letztes Mal aufbäumen und sich in ihrem besten Licht zeigen. Noch waren die Bäume voller Laub, sodass der Fluss in einem glitzernden Grün schimmerte, gemischt mit den Farben des nahenden Herbstes. Machwaos Haut glänzte in dem dunklen Braunton einer Kastanie, und sein langes Haar fiel wie das Gefieder des schwarzen Raben über seinen Rücken. Es glänzte leicht, denn er schmierte das Haar mit Fett ein, so wie es bei ihnen Gewohnheit war. Er zählte um die zwanzig Winter, und sein Körper war schlank und sehnig, seine Lenden nur von einem kleinen Schurz bedeckt. Sein rundes Gesicht war ebenmäßig, ohne die Falten eines entbehrungsreichen Lebens, überstrahlt von zwei blitzenden schwarzen Augen, die von winzigen freundlichen Lachfältchen umgeben waren.
Vor ihm knieten seine Schwester Kämenaw Nuki, Regenfrau, und seine Mutter, Nepewin Nuki, Wassergeistfrau. Seine Schwester hatte den zierlichen Körpers eines Mädchens, das noch nicht ganz zur Frau geworden war. Sie zählte erst dreizehn Winter. Sie hatte das gleiche freundliche Gesicht wie ihr Bruder und ebenso schwarze Haare, nur dass sie dem Mädchen bis weit über den Rücken fielen. Die Mutter war älter, mit Runzeln und Falten im Gesicht, die ihre eigenen Geschichten erzählten. Auch sie war schlank, fast hager, und ihre Hände zeugten von harter Arbeit. Beide Frauen trugen Kittel aus weichem Leder, die über den Schultern von zwei Trägern gehalten wurden. Sie arbeiteten flink und harmonisch zusammen, als hätten sie diese Aufgabe schon oft gemeinsam erledigt. Eine bog die Halme mit einem Stab über die Bordwand des Kanus, während die andere mit einem Schläger aus Zedernholz den Wildreis von den Halmen schlug. Die hellgrünen Körner fielen auf den Boden des Kanus, viele landeten auch einfach im Wasser und bildeten die Saat für die nächste Ernte. Die Frauen blieben still, als sie sich ihrer Arbeit widmeten.
Der „Manomäh“ war wertvoll für ihr Volk. In den Zeiten des langen kalten Winters würde er überlebensnotwendig sein, ebenso wie der Ahornsirup, den die Bäume ihnen schenkten, oder die Nahrungsmittelvorräte, die sie sonst anlegen konnten. In den Vorratsgruben, die neben ihren Gärten lagen, hatte die Familie schon Bohnen, getrocknete Früchte und Kürbisse gelagert. Der braune Reis würde ein weiteres willkommenes Nahrungsmittel sein, ebenso wie der Mais. Den ganzen Sommer hatten sie bereits Vorräte angelegt, nur darauf bedacht, den extrem langen Winter in diesen nördlichen Breiten zu überleben. Die Mutter hatte Fisch und Fleisch getrocknet, Beeren gesammelt, würde Nüsse und Pilze ernten, den Wildreis trocknen, Kürbisse lagern und darauf hoffen, dass ihr Sohn auch im Winter noch Beute nach Hause brachte.
Machwao dachte an die Zeremonien, die der Ernte des Wildreises vorangegangen waren. Tagelang hatten sie gesungen, bis der Wildreis-Häuptling schließlich mitgeteilt hatte, dass die Zeit der Ernte gekommen war. Eine Gruppe weiser Männer hatte beschlossen, welche Bereiche abgeerntet werden sollten, und die Familien waren diesen Anweisungen gefolgt. Voller Ehrerbietung hatten sie den Wassergeistern Tabakopfer gegeben, um eine gute Ernte zu erhalten und Schaden abzuhalten. Seit Urzeiten sammelte das Volk auf diese Weise den braunen Reis, und es hatte sich als erfolgreich herausgestellt. Machwao lächelte kurz, als er seine Schwester beobachtete. Sie war das erste Mal dabei und sie war stolz auf diese wichtige Aufgabe. In einiger Entfernung vermutete Machwao die anderen Kanus, doch durch das hohe Schilf und Gras waren sie nicht zu sehen. Bis auf das leise Plätschern des Wassers und das Schlagen auf die Halme war es friedlich. Nur Myriaden von Mücken umschwärmten das Kanu und bildeten eine Gasse, als es ruhig durch die hektisch tanzenden Wolken glitt. Es roch nach modrigem Wasser und nach dem schweren Duft der Kiefern und Fichten.
Manchmal schwamm eine aufgeschreckte Ente vor ihnen davon, und jedes Mal war der Krieger versucht, nach seinem Bogen zu greifen, der am Boden des Kanus zur Verteidigung bereit lag. Die Enten und Gänse hatten Fett angesetzt für ihre lange Reise in den Süden. Auch sie wären eine willkommene Beute. Mit seinen Lippen deutete Machwao auf einige Enten, die arglos zwischen den Halmen davonschwammen. „Die Wahkayoh sind so fett, dass sie kaum fliegen können. Sie wären ein guter Braten!“
Seine Schwester hielt kurz inne, um in Richtung der Enten zu blicken. Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht, als sie sich auffordernd zum Bruder umdrehte. „Warum jagst du sie nicht? Sie wären eine schöne Abwechslung zum Hirschfleisch.“ Ihr rundes Gesicht strahlte vor Aufregung.
„Meinst du?“ Der Krieger grinste, als er den hungrigen Blick seiner Schwester sah. Aber auch die Mutter schien von der Idee ganz angetan zu sein. Er nannte sie respektvoll Ne’äh, während seine Schwester sie noch in der Kindersprache mit Mamah anredete.
Es war nicht üblich, sich beim Namen zu nennen, sondern man wählte die Verwandtschaftsbezeichnung, um zu zeigen, dass man mit Mäc-awätok, dem höchsten spirituellen Wesen, verwandt war.
So nannte Machwao seine kleine Schwester stets Nekoqsemäh, meine kleine Schwester, und sie rief ihn Näknäh, großer Bruder. Die Frauen hielten in ihrer Arbeit inne, als Machwao mit einer ruhigen Bewegung nach seinem Bogen griff. Das Kanu glitt still durch das Wasser und schaukelte schließlich sanft hin und her. Die Enten ließen sich nicht stören, sondern gründelten nach Futter. Auch sie suchten nach dem wilden Korn. Ein wohlgezielter Pfeil traf eine Ente durch den Körper, während die anderen aufgeschreckt davonflatterten. Sofort nahm der Mann den Stab wieder auf und stakste das Kanu in Richtung der Beute.
Die Schwester griff nach dem Vogel und zerrte ihn ins Kanu. Ihre Augen funkelten vergnügt, als sie sich zu ihrem Bruder umdrehte. „Ich werde sie dir braten!“
„Und ich lasse dich auch mal abbeißen!“, bot Machwao großzügig an. Ein kleiner Schatten verdüsterte das Gesicht des Mädchens und Machwao lachte dunkel. „Also gut, vielleicht auch zweimal …“
„Oder …”, er zögerte, um seine Schwester ein wenig zu necken.
„Oder ich erlege noch eine …!“
„Noch eine, noch eine!“, rief seine Schwester aufgeregt. Sie zappelte hin und her und Machwao balancierte das Kanu vorsichtig aus. „Hey, wir werden die ganze Ernte verlieren, wenn du weiter hier herumhüpfst. Sitz still!“ Das Kanu lag schon tief im Wasser, denn die Frauen hatten bereits einen wahren Berg an Wildreis geerntet.
Gehorsam kniete sich Kämenaw Nuki hin und Machwao tauschte einen belustigten Blick mit seiner Mutter. In aller Ruhe nahmen sie ihre Tätigkeit wieder auf, denn es würde eine Weile dauern, ehe sie auf die nächsten unvorsichtigen Enten stoßen würden. Der Krieger lenkte das Kanu durch die hohen Halme und blinzelte, als die tiefer stehende Sonne ihn blendete. In einiger Entfernung sah er ein weiteres Kanu, das von einem seiner Freunde gelenkt wurde. Es war Awässeh-neskas, Bärenkralle, der mit seiner jungen Frau unterwegs war.
Sie war im Frühjahr von einem anderen Dorf zu ihnen gestoßen. Sie hieß Regen-auf-dem-Wasser und gehörte dem Kranichclan an, während ihr Mann, ebenso wie Machwao und seine Schwester, dem Bärenclan angehörten.
* * *
Seitdem der Ahnherr ihres Volkes, der große weiße Bär, aus seiner Höhle emporgestiegen war und sich in einen Menschen verwandelt hatte, wurde die Blutlinie des Clans über den Vater bestimmt. Der Bärenclan war der älteste Clan. Aus ihm wurden immer die Sprecher des Volkes und die Häuptlinge erwählt. Machwao gehörte zum Bärenclan, so wie sein Vater vor ihm und dessen Vater vor dessen Vater. Ihre Linie konnte bis zu dem Ahnherrn zurückverfolgt werden. Es war nicht möglich, einen Angehörigen des gleichen Clans zu heiraten, und meist lebten die Familien eines Clans in einem Dorf zusammen, sodass eine junge Frau das Dorf verlassen musste, wenn sie heiratete.
Machwao wusste, dass andere Stämme dies ungewöhnlich fanden, denn meist wurde die Blutlinie dort über die Mutter bestimmt. Aber die Menominee, die Menschen des wilden Reises, stellten ihr Erbe nicht in Frage. Sie folgten ihren Traditionen, so wie Mäc-awätok es von ihnen seit Urzeiten erwartete. Deswegen hießen sie auch Kiash Matchetiwuk, die Ältesten. Ihr Leben wurde bestimmt aus den Notwendigkeiten des Lebens, dem Verlauf der Jahreszeiten und den Zeremonien, die es für alle Bereiche des Lebens gab. Durch sie war es möglich, mit den Geistern zu sprechen und um Schutz vor der Unbill der Natur zu bitten. Nur durch Schutzgeister und Talismane war es möglich, den verheerenden Kräften zu entgehen, die allerorts auf einen lauerten. Selbst vor der Ernte des wildes Reises hatte er um Schutz gefleht, denn in den Seen und Flüssen lauerte sonst die gehörnte Schlange, Meqsekenupik, die nur zu gerne Kanus umwarf und die Insassen unter Wasser zerrte, um sie aufzufressen. Niemand wagte sich auf das Wasser hinaus, ohne vorher um Schutz gebetet zu haben.
Machwao stakste langsam in Richtung seines Freundes, auch wenn das bedeutete, dass er heute wohl keine Ente mehr erlegte. Ein frischer Wind kam auf und das Wasser kräuselte sich vor dem Bug des Kanus. Leichte Wellen schlugen gegen den Rand und trotz der drei Insassen schaukelte es leicht. Seine Mutter und seine Schwester waren immer noch darin vertieft, das Korn von den Halmen zu schlagen. Er schnalzte leise mit der Zunge und als er ihre Aufmerksamkeit hatte, zeigte er mit gespitzten Lippen in Richtung des anderen Kanus. „Sie gehen bereits an Land. Wir sollten ihnen folgen und morgen weitermachen.“
Die Mutter nickte ihr Einverständnis und so stieß Machwao das Kanu etwas schwungvoller vorwärts. Die Halme bogen sich auseinander, als es durch sie hindurchglitt und schließlich gegen den sandigen Boden des Ufers stieß. Er hüpfte ins Wasser und schob das Kanu mit einem kräftigen Ruck ins Trockene, sodass seine Schwester und seine Mutter trockenen Fußes an Land gehen konnten. Als sie ausgestiegen waren, zog er das Kanu vollends an Land. Dann beugten sie sich über die Schilfmatten, in denen sie das Korn gesammelt hatten, und hoben sie vorsichtig aus dem Kanu. An einer sonnigen Stelle legten sie die Matten aus und verteilten das Korn gleichmäßig zum Trocknen.
Machwao überließ die weitere Arbeit den Frauen und ging zu der Stelle, an der sein Freund bereits ein kleines Lager aufschlug. Sie waren nicht weit von ihrem Dorf entfernt, doch da sie am nächsten Tag weiterarbeiten wollten, hatten sie beschlossen, die Nacht hier zu verbringen. Noch war es warm, sodass sie die nächtliche Kälte nicht fürchten mussten. Sein Freund hieß Awässeh-neskas, Bärenkralle, und er ähnelte dem Bären nicht nur äußerlich mit seiner tapsigen Art. Es amüsierte das Volk, wie sehr der Name auf die Persönlichkeit abfärbte.
„Ich habe eine Ente erlegt!“, verkündete Machwao.
„Ich auch! Und wir haben etwas Trockenfleisch dabei. Kommt doch her, dann brauchen wir nur ein Feuer!“
Machwao warf seinem Freund einen anzüglichen Blick zu.
„Wirklich? Ich dachte, du möchtest vielleicht ein wenig Ruhe mit deiner jungen Frau.“ Er rollte vielsagend die Augen und bewegte sein Becken auf beredte Weise vor und zurück. Die Lachfältchen um seine Augen wurden tief.
Awässeh-neskas zeigte seine Zähne und legte mit zusammengekniffenen Augen den Kopf schief. „Such du dir mal lieber eine eigene Frau und schau dir nicht die Augen nach den hübschen Frauen deiner Freunde aus.“
„Tss! Noch bestimme ich, welche Frauen hübsch sind oder nicht. Ich sagte nur, dass deine Frau jung ist!“
Die junge Frau, die in seinen Augen vielleicht nicht hübsch genug war, warf ihm einen vernichtenden Blick zu. Entschuldigend hob er die Hände und lächelte versöhnlich. „Ich lasse mir nur keine Worte in den Mund legen! Ich entscheide selbst, mit welchen Worten ich eine Frau beschreibe.“
„Und welche Worte findest du für mich?“ Ihr Blick war immer noch finster.
„Nun“, er überlegte scharf und musterte sie kurz von oben bis unten. „Vielleicht wäre wunderschön passender? Oder …” Sein Satz blieb unvollendet, als er in die schwarzen Augen seines Freundes blickte. Er schien dies nicht mehr lustig zu finden. „Hör bloß auf!“, zischte er warnend.
Machwao musste so lachen, dass sein Freund ihn empört in den Bauch boxte. Schnaufend schnappte Machwao nach Luft und trat einige Schritte rückwärts, um sich aus der Reichweite von Awässeh-neskas Fäusten zu bringen.
„Warte nur, bis du eines Tages eine Frau hast. Dann kannst du froh ein, wenn ich sie nicht mit einer Schildkröte vergleiche!“, knurrte Bärenkralle.
„Schildkröte!“ Wieder prustete Machwao los. „Ich suche mir doch keine Schildkröte!“
„Wir werden sehen!“, prophezeite Awässeh-neskas. „In meinen Träumen sah ich sehr merkwürdige Dinge.“
Sofort wurde Machwao ernst. „Welche Dinge?“ Er wusste, dass sein Freund oft Träume hatte, und glaubte an dessen Vorahnungen. Aus einer witzigen Bemerkung war plötzlich Ernst geworden und seine Lippen wurden schmal, als er einen Schatten im Gesicht des Freundes bemerkte.
Awässeh-neskas zuckte mit den Schultern und winkte mit einem Lächeln ab. „Wir können uns ja später über deine Schildkröte unterhalten. Lass uns ein Feuer machen und die Enten braten. Ich habe Hunger.“
Machwao nickte und kehrte zu seinem Kanu zurück, um seine Sachen zu holen. Sein Freund hatte die kurze Andeutung mit einem Scherz abgetan und das beruhigte ihn. Wenn es etwas Wichtiges in seinen Träumen gab, würde er es ihm bestimmt mitteilen.
Aber sicherlich nicht, wenn Frauen und Kinder mit dabei waren. Es war Erntezeit und keine Zeit für tiefschürfende Gespräche.
Er warf die Ente vor die Füße seiner Mutter, damit sie die Federn rupfte und sie ausnahm, während er mit seiner Schwester Holz für das Feuer sammelte. Awässeh-neskas half ihm dabei und kurze Zeit später saßen sie bereits um das Feuer und beobachteten, wie die Flammen nach dem Fleisch griffen. Die Mutter wendete den Braten hin und her, damit das Fleisch von allen Seiten garte. Machwao lag auf der Seite und beobachtete die Funken, die hochstoben, wenn manchmal etwas Fett in das Feuer tropfte. Inzwischen war es dunkel geworden und ein heller Vollmond schob sich über die Spitzen der Fichten, die am Ufer standen. Der Mond spiegelte sich im Wasser und schickte ein leicht verzerrtes Bild nach oben zurück.
Awässeh-neskas musterte seinen Freund aus den Augenwinkeln und ließ sich ebenfalls auf die Seite sinken, sodass er fast neben Machwao lag. Er kaute an einem Grashalm und schien zu überlegen, wie er das Gespräch beginnen sollte. Regen-auf-dem-Wasser hatte sich am Feuer zu schaffen gemacht, sodass keine der Frauen auf das Gespräch der Männer achtete. Die Mutter unterhielt sich leise mit der Frau seines Freundes und Kämenaw Nuki stand im Fluss und beobachtete den Aufgang des Mondes. Ihre Füße wühlten den Schlamm auf, als sie einige Schritte auf und ab ging. „Bald kommt der Winter!“, begann Awässeh-neskas umständlich. Manchmal machte er seinem Namensvetter, dem Bären, wirklich alle Ehre.
Machwao grinste breit. Was für eine Tatsache! „Ja, und dann kommt wieder der Frühling …!“
Auch der Freund lächelte, als er merkte, dass er vielleicht zu weit ausholte. Er wedelte mit der Hand und konzentrierte sich wieder auf seine Worte. „Nun, dann kommt der Frühling!“, wiederholte er die Worte Machwaos. „Und Wapus möchte auf eine Handelsreise gehen. In den Süden.“ Er verstummte und schaute den Freund von der Seite an.
Machwao seufzte tief. Eine Handelsreise! Das bedeutete, dass er viele Monde unterwegs sein würde. Natürlich war es abenteuerlich und auch interessant, aber wollte er wirklich so lange von seinem Dorf getrennt sein? Andererseits war er jung genug, um so eine Reise zu wagen. Und er war noch nicht verheiratet, sondern versorgte nur eine Mutter und eine Schwester. Seine Familie war groß und so konnte er die beiden unbesorgt der Obhut seiner Onkel und Tanten überlassen. Auch sein Vater war Händler gewesen, ehe feindliche Anishinabe ihn bei einem Angriff getötet hatten.
Die Menominee versuchten mit allen Menschen in Frieden zu leben, aber manchmal gelang das nicht. Machwao hatte seinen Vater gerächt, indem er einen Mann der Feinde im Zweikampf getötet hatte. Nun verlangte dessen Familie nach Rache. Es war ein ewiger Kreislauf aus Tod und Rache, der sich kaum unterbrechen ließ. Irgendwann würde auch sein Dorf wieder das Ziel eines Angriffs sein, gleichgültig, ob es Anishinabe oder Ho-Chunk waren. Als Händler dagegen konnte er versuchen, die Beziehungen zu verbessern. Es gab sogar schon Ehen zwischen Menominee und Ho-Chunk, oder Menominee und Anishinabe. Meist handelte es sich um geraubte Frauen, aber es gab auch Ehen, die durch Handelskontakte entstanden waren.
Awässeh-neskas spuckte den Grashalm aus und fuhr mit seinen Überlegungen fort. „Ich dachte daran, ihn zu begleiten, und wollte auch dich fragen. Wakoh, der Fuchs, wird uns ebenfalls folgen.“
„Hmh, das ist gut!“ Machwao überlegte sich seine nächsten Worte. Wapus, der weiße Hase, war ein überlegter Mann, der bereits den Weg eines Medizinmannes eingeschlagen hatte. Er gehörte zur Metewin-Gesellschaft, den Medizinmännern, die ihr Wissen vom Morgenstern selbst erhalten hatte. Er hütete ein Bündel aus Otterfell, in dem sich sein geheimster Talisman in Form einer Muschel, Heilkräuter und andere Kleinigkeiten befanden. Mit diesem Bündel war es ihm möglich, sein Leben oder das Leben anderer zu verlängern oder ihnen in spiritueller Weise zu helfen. Ja, und Wakoh war ein gefährlicher Kämpfer, ein unbarmherziger Krieger, der sich gerne solchen Reisen anschloss, weil er dann die unsicheren Blicke im Dorf vermied, die ihm immer wieder zugeworfen wurden. Er galt als rücksichtslos und unbeherrscht, aber als guter Kämpfer. Ihn an seiner Seite zu wissen, war keine schlechte Sache. In Gesellschaft von Männern war er eigentlich ganz brauchbar. Er machte gute Scherze und war ein verlässlicher Freund. Nur Frauen gingen ihm lieber aus dem Weg, weil sie sein kriegerisches und unbeherrschtes Verhalten, aber auch sein angsterregendes Aussehen fürchteten. Er trug seltsame Tattoos im Gesicht und scherte sich wenig um die Meinung anderer.
„Wohin will Wapus denn gehen?“, erkundigte er sich zögernd. Awässeh-neskas zeigte mit einem Rucken seines Kopfes in Richtung Süden. „Weit nach Süden. Vielleicht bis zu den Illiniwek. Wir könnten unsere grünen Steine mitnehmen. Und wir könnten Felle und Muscheln tauschen. Sie haben viele schöne Dinge, die weit aus dem Süden kommen. Vielleicht auch Tabak!“
„Das würde bedeuten, dass wir erst diese grünen Steine holen müssen!“, wandte Machwao ein.
„Der Winter ist lang!“, meinte Awässeh-neskas altklug. „Aber wir schaffen es vielleicht noch im Herbst. Ich wollte aufbrechen, wenn der Manomäh und der Mais in den Gruben ist.“
Machwao hob zwei Finger. „Du redest von zwei Reisen. Eine im Herbst und eine im Frühjahr.“
Der Freund schenkte ihm ein Grinsen und zuckte die Schultern. Machwao nickte in Richtung der Frauen. „Und was sagt deine neue Frau dazu? Was wird sie denken, wenn du immer weg bist?“
„Ich muss mich ein wenig ablenken!“ Awässeh-neskas machte ein triumphierendes Gesicht. „Von mir wird verlangt, dass ich enthaltsam bin. Wenn ich unterwegs bin, wird mir das leichter fallen!“
„Ah!“ Machwao dehnte den Ausruf in die Länge. „Ach so!“ Er schlug seinem Freund wohlwollend auf die Schulter. „Sehr gut!“ Dann warf er ihm einen fragenden Blick zu. „Aber wirst du denn zurück sein, bis das Baby kommt?“
„Wenn wir früh genug aufbrechen …“ Awässeh-neskas lachte breit. „Und anfangs sind sie ohnehin so klein, dass sie den Vater nicht bemerken. Ich muss dafür sorgen, dass meine Frau gut untergebracht ist, aber mein Clan wird sich gut um sie kümmern.
Ich werde meinen Sohn sehen, ehe ich in den Süden ziehe.“
„Hmh.“ Es klang nicht so überzeugt.
„Was?“
„Nichts!“ Machwao hob die Schultern. Es war nicht seine Sache. Sein Freund entschied selbst, was für ihn wichtig war oder nicht. Er selbst würde jedenfalls keine Frau, die von ihm ein Kind erwartete, alleine lassen. Wenn er je die Richtige fand. Seine Familie hatte bereits zweimal versucht, eine Ehe für ihn zu stiften, aber beide Male war nichts daraus geworden. Mäc-awätok hatte wohl andere Pläne für ihn. Vielleicht hatte er aber auch noch nicht genug Signale ausgesendet, dass er eine Ehefrau wollte. Ihm war es im Moment genug, seine Mutter und Schwester zu versorgen. Er war noch jung und hatte Zeit.
Maisernte
(Mabila, im Süden der Schildkröteninsel)
Maisblüte erwachte in aller Früh und ließ sich von einer der Dienerinnen die Haare kämmen. Dann schlüpfte sie in ihr Festgewand und legte ihren Schmuck aus Knochenperlen und Muscheln an. Nebel lag über den Feldern und einige Schwaden streiften über die Dächer der Hütten. Es war frisch und Maisblüte fröstelte, als sie vor den Eingang trat. Im Osten schimmerte der Nebel heller und ließ die Sonne dahinter erahnen. Der Tag würde schön werden. Langes-Schilf trat neben die Tochter und legte den Arm um die schmalen Schultern des Mädchens. „Sei mit deinen Gedanken bei deinen Gebeten, damit die Ernte gesegnet wird!“, mahnte die Mutter eindringlich.
Maisblüte wusste um die wichtige Aufgabe, die ihr anvertraut war. Das Wohlergehen des ganzen Volkes hing davon ab. Der Heilige Mann und die Jungfrauen trugen die Wünsche zu den Geistern und der Sonne. An der Seite ihrer Mutter ging Maisblüte zu der Chukka des Hopaii, der ebenfalls auf einer Erhöhung wohnte. Sie stand in der Mitte des Dorfes, gleich neben der stattlichen Behausung des Minkos, die alle anderen Hütten überragte. Tuscalusa war nicht nur der Häuptling dieses Dorfes, sondern er hatte viele Dörfer unter seiner Macht vereint. Er lebte abwechselnd hier oder in dem Dorf Piachi. Sein Hügel hier in Mabila war neu errichtet worden, mit einem besonders großen Haus, das seiner Stellung gerecht werden sollte. Auch die Palisaden, die das Dorf umgaben, waren hoch und stark und die Wände mit Maisstroh und Lehm verputzt. Das hatte den Vorteil, dass Pfeile nicht durch die Zwischenräume ins Innere geschossen werden konnten. An der inneren Palisadenwand gab es sogar einen einfachen Wehrgang, von dem aus die Krieger angreifende Feinde abwehren konnten. Der Eingang war mit einem Tor geschützt, das man erst durch einen Wehrgang erreichte, der von beiden Seiten befestigt war. Von hier konnte man Angreifer sogar von zwei Seiten her unter Beschuss nehmen. Die Menschen fühlten sich sicher hinter diesen Wänden.
Maisblüte hielt ihren Blick sittsam gesenkt, als sie durch die Menschen schritt, die ihr ehrerbietig Platz machten. Dann stieg sie die Stufen zur Chukka des Hopaii empor. Auch andere Mädchen folgten ihr und verschwanden im Inneren. Die Mütter blieben draußen und warteten auf den Beginn der Zeremonien. Der Hopaii war ebenso in sein prächtigstes Gewand gekleidet. Er trug einen Schurz aus Jaguarfell, das von Stämmen weiter westlich gehandelt worden war. Seine Schultern waren mit einem Poncho aus kostbar gewebtem Stoff bedeckt und auf dem Kopf trug er eine Haube aus Federn. Am Gürtel hing ein Köcher mit Pfeilen und am Rücken trug er einen reich verzierten Bogen, der nicht so sehr zum Jagen oder Kämpfen diente, sondern wiederum seinen Status betonte. Es hieß, dass seine Pfeilspitzen mit dem Gift der Klapperschlange benetzt waren und daher besonders tödlich wären. Seine heiligen Utensilien trug er in einem Korb, der aus Bast geflochten war. So ausgestattet wartete er in aller Ruhe, bis sich die Menschen in der Mitte des Dorfes versammelt hatten oder bereits den Weg zu den Feldern säumten.
Mit wichtiger Miene schritt der Hopaii die Stufen hinunter, gefolgt von zwanzig Jungfrauen, die bereits die Schalen mit Sand und den Glutstücken trugen. Ein Sklave entzündete das Räuchergut und legte es dann in die Schalen, sodass sich sofort aromatischer Rauch ausbreitete. Die Prozession setzte sich in Bewegung und führte die Menschen aus dem Dorf heraus. Singend gingen sie zu den Feldern, in denen der Mais bereits hoch stand. Körbe standen am Feldrand, in denen später die Kolben geerntet werden sollten. Zwischen den Maisfeldern standen kleine Gerüste, auf denen die Wächter saßen und die Ernte vor den Krähen schützten. Aber auch Waschbären und Dachse machten sich gern an den leckeren Maiskolben zu schaffen. Die Bohnen und Kürbisse, die stets mit dem Mais gemeinsam gepflanzt wurden, waren bereits geerntet worden, nur einige Sonnenblumen säumten noch die einzelnen Felder.
Hinter dem Hopaii ging der Minko. Auch er trug kostbar hergestellte Kleidung und einen hohen Federschmuck, der ihn wie einen Riesen erscheinen ließ. Tuscalusa war ohnehin schon ein Hüne, aber die Federn ließen ihn noch größer und eindrucksvoller erscheinen. Sein muskulöser Körper war mit Öl eingeschmiert, sodass er kriegerisch und gefährlich wirkte. Auch sein Körper war voller Tattoos, sodass manchmal die ursprüngliche Farbe seiner Haut nicht mehr zu erkennen war. Er war sich seiner Wirkung bewusst und umgab sich mit dieser Aura aus Gefahr, Bedrohung und gleichzeitig Schutz. Die wichtigsten Krieger begleiteten ihn, die seine Würde noch unterstrichen. Hier schritt ein Häuptling, der wahre Macht ausübte.
Maisblütes Augen fanden den Vater, der die Prozession des Hopaii begleitete. Sie war stolz auf ihn und sie hoffte, dass er sie einst einem ebensolchen Mann gab. Noch war sie zu jung, um zu heiraten, obwohl es durchaus üblich war, schon junge Mädchen zu verheiraten, um sie abzusichern. Aber sie entstammte einer geachteten Familie und ihr Vater wollte abwarten, bis sie ihre ersten Riten hatte. Maisblüte sah wieder auf die Schale in ihren Händen und blies hinein, um das Räucherwerk anzufachen. Aromatischer Rauch stieg auf und sie lächelte zufrieden. Mit einem Fächer wedelte sie den Maispflanzen den Rauch zu, während sie anmutig durch die Reihen schritt. Die Jungfrauen hatten sich verteilt, sodass zwanzig Mädchen durch die Reihen gingen.
Die Menschen standen am Rand und sangen ein Lied zu Ehren des Maises und schlugen dazu kleine Trommeln. Der Heilige Mann schritt ebenfalls durch die Reihen und schlug mit einer Keramiktrommel, die mit Leder überzogen und mit Wasser gefüllt war, einen gleichmäßigen Rhythmus, um mögliche böse Geister zu verscheuchen. Es dauerte den ganzen Vormittag, die Felder abzuschreiten. Erst dann gab der Hopaii das Zeichen, die Felder abzuernten. Singend schritten die Menschen mit ihren Körben durch die Reihen und brachen die Kolben von den Stängeln. Andere hieben die Stängel um, die später als Dünger oder als Baumaterial verwendet wurden. Alles verlief geordnet und mit ruhigen Bewegungen, weil die Menschen dies schon oft gemacht hatten. Die Aufgabe der Jungfrauen war getan und so kehrte Maisblüte mit den anderen Mädchen ins Dorf zurück, um sich umzuziehen. Dann eilte sie zu den Feldern zurück und half dabei, den Mais zu ernten.
* * *
Tage vergingen, in denen geerntet, der Mais von den Kolben geschabt und zum Teil zum Trocknen in die Sonne gelegt wurde. Fast hatte Maisblüte das Gespräch ihres Vaters mit dem Minko vergessen, so sehr war sie mit ihren Arbeiten beschäftigt. Nur die Ankunft weiterer Krieger aus Nachbardörfern zeugte davon, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Die Täler am Piachi-Fluss waren fruchtbar und daher dicht besiedelt. Jedes Dorf schickte Männer zur Verteidigung, während andere auch dort die Ernte einbrachten. Dann kam ein Kundschafter, den der Sohn des Häuptlings geschickt hatte, mit beunruhigenden Nachrichten zurück. Er berichtete von dem schnellen Vorwärtskommen der Fremden und mit welcher Brutalität sie dabei vorgingen. „Sie haben jedes Dorf auf ihren Weg ausgeraubt und geplündert! Meine Kundschafter erzählen auch von den Dörfern noch weiter im Osten. Dort sind im letzten Jahr seltsame Krankheiten ausgebrochen, die viele Menschen dahingerafft haben. Sie glauben, dass es die Fremden sind, die Tod und Zerstörung bringen. Wir müssen uns vorbereiten.“
Maisblüte hörte von ihrem Vater über diese besorgniserregenden Nachrichten. Große-Schlange schüttelte energisch den Kopf.
„Wir müssen diese Fremden aufhalten, ehe sie Tod und Zerstörung zu uns bringen! Der Heilige Mann soll seinen Zauber über sie ausbreiten, damit wir sie vernichten können!“
Maisblüte erkannte sehr wohl die Gefahr, in die sie sich begab. Aber sie war eine Jungfrau und so war es ihre Aufgabe, das Volk zu schützen. Es war nicht mehr nur eine abenteuerliche Reise, sondern eine heilige Handlung. Sie musste packen, damit sie am nächsten Tag ihre Reise antreten konnte. Ihr war seltsam zumute, denn sie war noch nie von ihrem Dorf entfernt gewesen. Atahachi lag drei bis vier Tagesreisen von Mabila entfernt und mindestens einmal mussten sie einen Fluss überqueren. Sie hatte keine Ahnung, wie diese Fremden, von denen der Häuptling gesprochen hatte, sein würden. „Mutter!“, bat sie mit bangem Herzen. „Was wird von mir erwartet, wenn wir diesen Fremden begegnen?“ Die Mutter faltete einen Umhang zusammen und legte ihn bedächtig in einen Tragekorb. „Du wirst es wissen, wenn du dort ankommst! Mach dir keine Sorgen! Der Heilige Mann wird dir sagen, was zu tun ist. Und es werden so viele Krieger dabei sein, die euch schützen werden.“
„Und wenn es zum Kampf kommt?“
„Tuscalusa wird nicht in Atahachi kämpfen! Er lockt diese Fremden hierher. Warte nur ab!“ Die Mutter klang so zuversichtlich, dass Maisblüte ihre Zweifel beiseite schob. Es wäre respektlos, ihre Mutter weiter zu ängstigen.
„Außerdem sind auch unsere anderen Dörfer befestigt. Wir haben überall Krieger, die sich zu verteidigen wissen“, fuhr die Mutter fort. „Du darfst dich nicht mit zu vielen Gedanken quälen, denn sonst kommt Impashilup und frisst deine Seele. Denke an gute Dinge, denn das wird dich schützen!“
Maisblüte schob sich eine Strähne ihres Haares nach hinten, die ihr vor die Augen gefallen war. „Ach, ich bin einfach nur aufgeregt“, murmelte sie entschuldigend. Sie sagte nicht, dass auch die Dörfer der Stämme weiter im Osten befestigt gewesen waren. Dort hatten sich die Menschen nicht schützen können.
Die Mutter lächelte. „Tochter! Ich wäre auch aufgeregt, wenn ich so eine Reise machen dürfte. Du wirst die anderen Dörfer sehen und viele Menschen treffen. Du hast eine wichtige Aufgabe!“
Maisblüte nickte geschmeichelt. „Ja, ich weiß. Man ist nur einmal die Jungfrau des Heiligen Mannes. Bald werde ich eine Frau sein und heiraten, dann kann ich diese Dinge nicht mehr tun.“
„Erinnere dich an die Tugenden und an die Aufgabe, die dir anvertraut wurden. Du begleitest den Hopaii und den Minko, um diesen Fremden zu begegnen und Schaden von uns abzuwenden. Das ist ehrenvoll.“
Maisblüte senkte den Blick. „Ich weiß. Ich werde tun, was von mir verlangt wird.”
„Hier, diese Sachen ziehst du auf der Reise an, damit deine schönen Gewänder geschont werden.“ Die Mutter gab Maisblüte einen einfachen Schurz und einen Umhang aus Hirschfell. Es wurde bereits kühl, sodass es klug war, an wärmere Kleidung zu denken. Außerdem reichte sie ihr Mokassins, die mit einer weiteren Sohle verstärkt waren. Meist liefen die Menschen einfach barfuß, aber der Weg war lang und steinig. Es gab Wege zwischen den Dörfern, doch für einen langen Fußmarsch war es besser, Mokassins zu tragen. Zwischen Mabila und dem nächsten Dorf musste ein Berg überwunden werden, der als unwegsam galt. Dann wickelte die Mutter ein wenig Wegzehrung in Maisblätter. Sie vertraute darauf, dass die Krieger unterwegs Wild jagten, aber ein bisschen getrocknetes Fleisch und Fladen würden Maisblüte unterwegs guttun. Dann suchte sie einen ausgehöhlten Kürbis, in dem Maisblüte Wasser mitführen konnte. Anschließend führte sie ihre Tochter zur Chukka des Hopaii. Dort würde sie mit den anderen Mädchen die Nacht verbringen, um dann am Morgen die Reise anzutreten.
Maisblüte verabschiedete sich mit einer Umarmung von ihrer Mutter, dann winkte sie ihrem Bruder zu, der am Fuß des Hügels stand und sich nicht traute, die Stufen emporzusteigen. Er war traurig, dass sie ging. Sie winkte ihm zu, um ihn aufzuheitern, und trat dann in die Chukka. Im Inneren saßen bereits die anderen Mädchen. Einige waren ihre engsten Freundinnen, andere waren aus anderen Dörfern zu ihnen gestoßen. Auch das war auf die Politik des Häuptlings zurückzuführen. Er verlangte aus allen Dörfern die edelsten Jungen und Mädchen, die mit großer Ehrerbietung behandelt wurden, aber nichtsdestotrotz Geiseln waren. Der Häuptling war großzügig und erlaubte Besuche, sodass es mehr ein Austausch von Beziehungen war. Auch zwei seiner eigenen Töchter wuchsen in zwei anderen Dörfern heran, um einst einen dortigen Häuptlingssohn zu heiraten.
Maisblüte erkannte einer ihrer Freundinnen und suchte ihre Nähe. Mit einem Lächeln setzte sie sich neben Nebel-am-Morgen und legte ihre Bündel ordentlich neben die Schlafmatte. Auch Vogel-im-Bach kam näher und bat schüchtern darum, neben ihnen liegen zu dürfen. Sie war etwas jünger als die beiden Freundinnen, eigentlich noch ein Kind. In Maisblüte erwachte der Beschützerinstinkt und sie nahm das Mädchen an der Hand. „Bleib nur bei uns! Wir passen auf dich auf!“
Vogel-im-Bach nickte beruhigt. „Habt ihr von diesen Fremden gehört?”, flüsterte sie.
Maisblüte schlug sich die Hand vor den Mund. „Hasch! Wir sollten nicht darüber reden. Allein laut darüber zu sprechen, kann schon Unheil auf uns lenken. Wir tun, was der Heilige Mann uns befiehlt. Mehr nicht!“
Alle Mädchen schwiegen plötzlich und starrten Maisblüte mit großen Augen an. „Schlaft jetzt!“, befahl Maisblüte. „Morgen haben wir einen langen Weg vor uns.“
Die Mädchen legten sich wie geheißen auf ihre Matten und schlossen die Augen. Einige waren müde und schliefen tatsächlich, andere lagen noch lange wach, und in ihren Gedanken spukten Bilder von den Fremden, denen sie begegnen würden, im Kopf herum.
* * *
Am Morgen wurden sie von lautem Rufen geweckt. Der Heilige Mann begrüßte die Sonne, die Wärme und ewiges Leben schenkte. Eilig packten die Mädchen ihre Bündel und stellten sich auf die Terrasse, die sich vor der Hütte befand. Mit großen Augen blickten sie auf die Abordnung, die sich am Fuß des kleinen Hügels zum Aufbruch formierte. Vorn stand der Häuptling inmitten seiner Krieger, dann folgten der Heilige Mann und seine Träger. Auf einen Ruf hin ordneten sich die Mädchen in den Zug, ebenfalls von Kriegern und Dienerinnen umgeben. An die zweihundert Personen machten sich auf den Weg nach Osten, um diesen Fremden zu begegnen. Der Häuptling sicherte sich nach allen Richtungen ab, denn zehnmal hundert Fremde waren eine gewaltige Bedrohung.
Nachdem sie die unmittelbare Nähe des Dorfes verlassen hatten, schritten sie durch schattige Wälder. Einige Blätter verfärbten sich bereits rot und gelb, sodass es in der Sonne ein prächtiges Farbenspiel gab. Moskitos schwirrten um die Menschen, die mit zügigen Schritten in Richtung Osten marschierten.
Sie folgten einem Trampelpfad, der zeitweise in der Nähe eines Flusses verlief. Das Tempo war schnell, sodass den Mädchen der Atem fehlte, um sich zu unterhalten. Dann wurde der Weg steiler, als sie einen Berg erklommen. Gegen Mittag schlugen sie eine kurze Rast ein und blickten schweigend über das Land, das sich unter ihnen ausbreitete. Sie hatten fast den Kamm erreicht und genossen den Ausblick. Wälder wechselten sich ab mit Dörfern und Feldern. In den Flussniederungen löste sich der Nebel auf, sodass ein leichter Schleier über dem Land lag. Es war ein reiches Land, in dem sie lebten. Die Wälder waren voller Wild, die Flüsse voller Fische und der Boden fruchtbar.
Maisblüte wischte sich den Schweiß von der Stirn und trank einige Schlucke aus der Kalebasse. Einige Gänse flogen am Himmel über sie hinweg und sie wedelte mit der Hand in Richtung des Schwarms. „Sie kommen, um zu überwintern!“
Vogel-im-Bach kicherte. „Stell dir vor, wir müssten immer so von Norden nach Süden ziehen!“
Maisblüte zuckte mit den Schultern. „Auch wir sind einst einen weiten Weg gewandert, um hierher zu gelangen. Vielleicht haben diese Vögel ihre Heimat noch nicht gefunden?“
„Meinst du?“ Die Augen des Mädchens wurden groß. „Es gibt so viele Vögel, die hin und her wandern! Vielleicht haben die alle ihre Heimat noch nicht gefunden?“
Maisblüte kicherte. „Oder sie finden es einfach nur lustig. Es muss doch schön sein, wenn man dort oben fliegt und die Erde unter einem dahingleitet. Fast so wie jetzt …!“ Sie deutete mit ihrer Hand auf die Landschaft.
„Oh, da würde mir schlecht werden …!“, wehrte Vogel-im-Bach ab. „Das ist mir zu hoch.“
Ihre Unterhaltung verstummte, denn die Krieger drängten erneut zum Aufbruch. Der Weg war nicht mehr so beschwerlich, denn es ging bergab.
Am Abend lagerten sie am Ufer eines Baches und Maisblüte nutzte die Gelegenheit, ihre Kürbisflasche wieder mit frischem Wasser zu füllen.
Am nächsten Tag erreichten sie das Dorf Piachi und übernachteten in einer Hütte, die eigens für sie hergerichtet worden war. Der Minko verbrachte die Nacht in seiner stattlichen Behausung, die ebenfalls auf einem künstlichen Hügel errichtet worden war. Maisblüte staunte, denn dieses Haus war noch größer und stattlicher als das Haus in Mabila, wenn das überhaupt noch möglich war. Das Dorf lag auf einem Hügel am Fluss Piachi, den sie am Morgen mit Kanus überqueren wollten. Auch dieses Dorf hatte Palisaden und schien wegen seiner erhöhten Lage kaum einnehmbar zu sein.
* * *