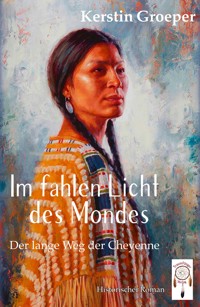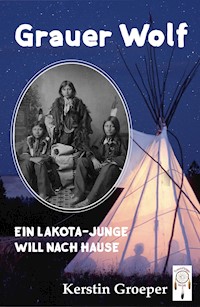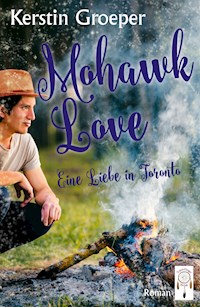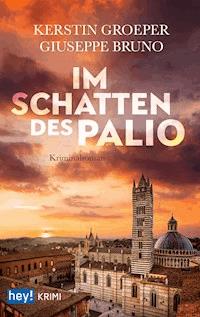4,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Frau und ihre Vision! Kranichfrau, eine junge Frau der Blackfeet-Indianer, trauert fassungslos um ihren getöteten Bruder. In einer Vision wird ihr befohlen, als Kriegerin zu leben. Sie beginnt Männerkleidung zu tragen und schließt sich einem Rachefeldzug gegen die Feinde an. Schwer verletzt bleibt sie zurück und wird von Nata-He-Yukan, einem Krieger der Lakota, gefunden. Von seinem Volk aufgrund der Intrige seines ärgsten Widersachers in die Verbannung geschickt, verschont Nata-He-Yukan das Leben des fremden Mädchens und nimmt sie entgegen ihrer Vision zur Frau. Bedroht von feindlichen Stämmen, beginnt für beide ein Kampf ums nackte Überleben in der Wildnis. Doch auch zwischen Kranichfrau und Nata-He-Yukan eskaliert der Konflikt, denn zu unterschiedlich sind ihre Herkunft und Bestimmung…Der Roman handelt um 1830 und basiert auf historischen Ereignissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für meinen Vater, den Schriftsteller Klaus Gröper,der mich lehrte zu träumen …und sicherlich mit einem Schmunzeln vom Himmelauf uns hinunterblickt!
Kranichfrau
Die Geschichteeiner Blackfeet Kriegerin
Historischer RomanvonKerstin Groeper
Impressum
Kranichfrau, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2012
1. Auflage eBook Februar 2022
eBook ISBN 978-3-948878-16-0
Lektorat: Ilona Rehfeldt
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: Marion und Doris Arnemann
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG, Hohenthann
Inhalt
Die Pecuni
Die Lakota
Der Kriegszug
Die Verbannung
Winyan-o‘hanschitscha
Jean Baptiste
Vogelmädchen
Kleine-Krähe
Die Höhle in den Bergen
Schnee in den Bergen
Der Verrat
Rote-Haut
Die Reise
Der große Fluss
Am Bärenfluss
Fort Piegan
Hunka
Fort McKenzie
Watet-im-Fluss
Stern-der-brennt
Bleza-Si
Die Pecuni
(Nördliches Montana, 1830)
Kranichfrau starrte fassungslos auf ihren toten Bruder. Steif lag er vor ihr, verschmiert mit getrocknetem Blut. Ein tiefer Schnitt zog sich über seine Kehle, die ihm ein Krieger vom Stamm der Crow durchgeschnitten hatte. So war das also! Sein junges Leben beendet in seinem ersten Kampf gegen die Feinde. Nur drei seiner Freunde waren von dem Kriegszug zurückgekehrt, drei von acht jungen Pecuni-Kriegern, die ausgezogen waren, um Ruhm zu ernten. Klageschreie drangen aus den anderen Zelten, aber Kranichfrau war still. Zu tief saß der Schock über den Tod des Bruders. Warum nur?
War er nicht gut auf den Kampf vorbereitet worden? Hatte seine Medizin versagt? Hatte er nicht genügend gebetet? War der Sonnenhäuptling so erzürnt über ihn gewesen, dass er ihm seinen Schutz versagt hatte?
Mit zitternden Händen begann sie ihren Bruder zu waschen, rieb geduldig das getrocknete Blut von seinem Gesicht. Dann zog sie ihm die verdreckte Kleidung aus. Sie musste sein Hemd aufschneiden, denn seine Arme waren bereits steif und so konnte sie ihm das Gewand nicht über den Kopf ziehen. Vorsichtig knüpfte sie die Knoten an den Fransen seines besten Kriegshemdes auf und legte ihm die saubere Kleidung an. Dann bückte sie sich über den Körper und knüpfte das Hemd unter den Achseln wieder zusammen. Ihr Bruder sollte nur mit seinen besten Sachen ins Jenseits ziehen.
Es dauerte lange, bis er vollständig bekleidet war. Zärtlich bemalte sie sein Gesicht mir roter Farbe, dann wickelte sie ihn in eine schöne Schwarzhornrobe.
Apathisch ruhten ihre Hände in ihrem Schoß, jetzt, wo es nichts mehr zu tun gab.
Ihre Gedanken flogen. Was würde jetzt aus ihr werden? Ohne Mutter und Vater? Ihr Bruder hatte sie versorgt, denn noch wollte sie nicht im Zelt eines Mannes wohnen, fühlte sich noch nicht bereit, die Pflichten einer Ehefrau zu übernehmen. Jetzt blieb ihr wohl keine andere Wahl mehr!
Zwei Krieger steckten ihre Köpfe in das Zelt und blickten sie abwartend an. Sie machte eine hilflose Geste mit ihrer Hand, erlaubte ihnen den Leichnam hinauszutragen. Dann bemalte sie ihr Gesicht mit weißem Lehm und schnitt ihre langen Haare bis auf Schulterlänge zurück. So zeigte sie ihre Trauer um den Bruder.
Leiser Klagegesang erklang von draußen und mit steifen Beinen erhob sie sich, um sich den Trauernden anzuschließen. Langsam bewegte sich der Zug zu den nahen Bäumen und regungslos nahm sie wahr, wie ihr Bruder in einer Astgabel bestattet wurde. Ihre großen Augen sahen ausdruckslos zu ihm auf, keine Tränen sammelten sich in ihnen, denn sie wollte nicht weinen. Sie brauchte keine Tränen, um ihrem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Sie wollte Rache!
Mit festem Schritt ging sie in ihr Tipi zurück und setzte sich an die erloschene Feuerstelle. Dort hing sie ihren Gedanken nach, kaute unablässig an ihren Lippen. Mit ihrem weiß bemalten Gesicht, aus dem nur die großen, fast schwarzen Augen leuchteten, und den blutroten geschwungenen Lippen wirkte sie wie ein klappriger Geist, der bereit war, die Träume der Schlafenden heimzusuchen.
Eine ältere, rundliche Frau mit gutmütigem Gesicht, ebenso mit weiß bemalter Stirn als Zeichen der Trauer, steckte den Kopf herein. Es war Zedernsängerin, ihre Tante, die sich um ihre Nichte sorgte. Doch Kranichfrau winkte energisch ab, wollte die Tante verscheuchen, wie man einen schlechten Traum wegwischt. Sie wollte keinen Trost, niemand konnte ihr den Bruder wieder zurückgeben.
Trotzdem setzte sich die beleibte Tante schnaufend auf den Platz neben ihr. „Ich verstehe deine Trauer, aber du musst jetzt bei uns wohnen!“ Es war keine Einladung, sondern ein Befehl.
Natürlich war es unmöglich, dass ein unverheiratetes Mädchen allein lebte. Sie nickte gehorsam. Ihr Onkel war jetzt für sie verantwortlich und würde entscheiden, was für sie am besten war.
„Liebe Tante, ich komme gleich“, murmelte sie leise.
„Lass dir Zeit, mein Kind.“
Dankbar blickte Kranichfrau ihrer Tante hinterher. Sie wollte noch ein wenig ihren Gedanken nachhängen, in Ruhe ihre Habseligkeiten packen. Traurig sah sie sich in dem Zelt um, das so lange ihre Heimat gewesen war. Wie ein Schattenspiel bewegten sich die bemalten Zeltwände im ewigen Wind und verliehen den Tierfiguren ein lebendiges Aussehen. Die Zeichnungen der Otter hatten sie stets beschützt. Jetzt würde das Tipi ihrem Onkel und ihrer Tante gehören, zumindest solange, bis sie heiratete.
Mit einem tiefen Seufzer begann sie methodisch ihre Sachen zu packen. Die meisten Dinge lagen sowieso ordentlich verstaut in ihren bunten Taschen.
Schweren Herzens ging sie zu dem Zelt ihres Onkels.
Das weiß schimmernde Gesicht ihres Onkels glänzte ihr ebenso traurig, aber auch ein wenig unwillig entgegen. Im Gegensatz zu seiner Frau wirkte der Körper ihres Onkels geradezu asketisch. „Willkommen in meinem Zelt. Du hättest schon längst bei mir wohnen sollen!“ Der Vorwurf war deutlich zu hören.
„Ja, Onkel“, antwortete sie, ohne ihre Stimme zu heben. Sie hatte nicht die Kraft schon wieder mit ihrem Onkel über dieses Thema zu streiten.
„Wenn deine Trauerzeit beendet ist, werden wir dir einen guten Ehemann suchen!“, versuchte er sie aufzuheitern, aber genau diese Worte wollte sie eigentlich nicht hören.
„Jetzt lass sie doch erst mal!“, schimpfte ihre Tante resolut. Betreten senkte der Mann seinen Kopf. Eigentlich wurde von ihm als Medizinmann mehr Rücksichtnahme erwartet. Er seufzte tief, als er in Trauer die Augen schloss. Auch er litt unter dem Verlust seines Neffen. „Zu viele junge Männer haben ihr Leben gelassen! Wir werden einen großen Kriegszug schicken, um es den Crow heimzuzahlen! Auch ich werde reiten, um deinen Bruder zu rächen!“
Kurz leuchteten die Augen in dem Gesicht des Mädchens auf. Ja, ihr Onkel würde ihren Bruder rächen! Das waren die Worte, die sie hören wollte, die sie fest in ihrem Herzen aufnahm. Mit plötzlicher Hochachtung ruhten ihre Augen auf ihrem Onkel, denn er war Medizinmann, ein Bewahrer des heiligen Biberbündels, längst dem Alter entwachsen, in dem er noch auf Kriegszüge ging. Seine Stirnhaare waren zu einem dicken Knoten zusammengebunden, in dem einige rote Federn steckten, Zeichen seiner hohen Würde, aber eigentlich konnte man es eher mit einem Vogelnest vergleichen. Seine Stirn war wie bei Zedernsängerin mit weißem Lehm eingeschmiert, die Haare bis auf Schulterlänge gekürzt. Ferner-Bär wurde er gerufen. Bär wegen seiner Stärke und Kraft, Fern, weil er ein Vielgesichtsmann war, einer, der Visionen hatte und Verbindungen zur Geisterwelt unterhielt.
Kranichfrau breitete ihre Decken neben den zwei Töchtern von Ferner-Bär aus und verstaute mit ruhigen Bewegungen ihre Taschen an der Zeltwand, dann versank sie in ihren Gedanken.
Die nächsten Tage vergingen für Kranichfrau wie im Traum. Nur von fern vernahm sie die Geräusche in dem Zelt, gleichmäßig plätscherten die Stimmen der Familie ihres Onkels dahin, für sie ohne Bedeutung.
Wie ein Geist saß sie da, unfähig etwas zu tun. Die beiden Mädchen im Alter von acht und zwölf Wintern machten einen Bogen um sie, denn das ausdruckslose Gesicht ihrer Cousine flößte ihnen Angst ein. Schließlich machte ihre Tante dem ein Ende, indem sie ihr einfache Aufgaben übertrug: „Bitte, hole mir doch Wasser!“, oder, „Bitte, hole mir doch Holz!“
Unwillig und nicht bereit in ihren Träumen gestört zu werden, machte sie sich jedes Mal auf den Weg, vergaß manchmal nach einigen Schritten, was sie eigentlich tun sollte. Dann ging sie wie abwesend durch das Dorf, geistig und körperlich entrückt. Mitleidige Blicke begleiteten sie und manchmal führte eine Frau das Mädchen zurück zu ihrem Zelt.
Zedernsängerin machte sich Sorgen um ihre Nichte. Immer wieder sprach sie mit ihrem Mann über das hohlwangige Mädchen: „Sie muss auf andere Gedanken kommen. Vielleicht wäre eine Ehe gut für sie?“
Nur zu gern willigte Ferner-Bär ein: „Vielleicht, aber im Moment sieht sie nicht gut aus. Wer sollte um sie werben?“
„Sie magert zu sehr ab, warum redest du nicht mit ihr?“
„Du bist doch die Frau! Du findest bestimmt treffendere Worte als ich.“
Scherzhaft schlug ihm seine Frau auf die Schulter und meinte: „Du bist der Onkel!“
„Ai!“ Seine runzeligen Züge verzogen sich zu einem freundlichen Grinsen. Selbst als Medizinmann war er in seinem eigenen Zelt zuerst einmal Ehemann und Vater.
Drei Tage schlich Ferner-Bär um das junge Mädchen herum und suchte nach einer passenden Gelegenheit, um mit seiner Nichte zu reden. Schließlich packte er sie am Arm und führte sie zu einem umgestürzten Baum. „Komm, ich will mit dir reden!“
Mit gesenktem Kopf setzte sich Kranichfrau neben ihren Onkel und wartete ab.
„Fühlst du dich wohl bei uns?“, fragte Ferner-Bär umständlich. Kranichfrau nickte fast unmerklich. „Ja, eure Gegenwart spendet mir Trost.“
Ferner-Bär schluckte schwer. „Ich möchte mit dir über deine Zukunft reden.“
„Meine Zukunft?“
Sie hatte keine Zukunft, sie lebte in der Vergangenheit.
„Ja, denkst du nicht manchmal an eine eigene Familie?“
„Nein!“, kam es knapp und kurz von seiner Nichte.
„Aber du zählst siebzehn Winter! Es wird Zeit für dich, nach einem Mann Ausschau zu halten!“
„Das ist nicht mein Weg!“, wehrte sie ab.
„Nicht dein Weg? Was ist dann dein Weg?“, bohrte er nach.
„Ich weiß nicht“, wich sie aus.
„Du weißt es nicht?“ Langsam verlor der Onkel die Geduld. Das seltsame Verhalten seiner Nichte ging über seinen Verstand, trotz ihrer Trauer. Ihr Vater hatte sie als Lieblingskind behandelt, ihr immer wieder Sonderrechte eingeräumt, und auch ihr Bruder hatte diese Tradition nach dem Tod des Vaters fortgesetzt. Solche Kinder galten als schwierig, hielten sich nicht an überlieferte Traditionen, doch auch sie hatten ihren Platz in der Gesellschaft.
„Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich einen anderen Weg beschreiten muss.“
Nachdenklich lehnte sich der Onkel ein wenig zurück, dann warf er einen unsicheren Blick auf seine Nichte. Ihr fast knabenhafter Körper, ausgehungert von der langen Trauer, wirkte nicht besonders einladend auf Männer. „Vielleicht solltest du dich in die Einsamkeit zurückziehen und beten? Vielleicht erhältst du dann eine Antwort?“, fragte er vorsichtig.
Ihr spitzes Kinn zitterte. Jetzt, als sie so dicht neben ihrem Onkel saß, war deutlich die Familienähnlichkeit zu sehen.
„Vielleicht. Würdest du dann diese Antwort achten?“
„Du bist meine Nichte. Wenn du eine Antwort auf deine Fragen bekommst, so werde ich dir nicht im Wege stehen!“
„Dann ist es gut. Ich werde beten!“
Mit einer leichten Geste erlaubte Ferner-Bär dem Mädchen sich zu entfernen und schaute ihr nach. Er hatte dabei ein mulmiges Gefühl im Bauch. Was sie jetzt wohl vorhatte?
Seine Nichte war wirklich schwierig. Anders herum, sagten die Frauen. Meistens arbeitete sie mit ihrer linken Hand, obwohl ihre Mutter versucht hatte, ihr das abzugewöhnen. Selbst bei ihren ersten Riten hatte sie mit ihrer linken Hand gestickt, und die Frauen hatten den Kopf geschüttelt.
Anders herum! Wie sehr hatte Kranichfrau die Belehrungen bei ihrer ersten Menstruation gehasst, aber nur gut unterwiesene Mädchen durften Quillarbeit machen, sonst würden sie erblinden. Sie wollte überhaupt nicht sticken, sondern viel lieber mit ihrem Bruder jagen gehen. Ihr Bruder, jetzt war er tot!
Am nächsten Morgen war Kranichfrau verschwunden.
Beunruhigt wandte sich Ferner-Bär an seine Frau: „Wohin ist Kranichfrau gegangen?“
Zedernsängerin legte sich die dünnen Zöpfe hinter ihre Ohren und blinzelte verlegen. „Sie wollte um eine Vision beten. In einigen Schlafen ist sie zurück!“
„Aber sie ist doch viel zu schwach für ein solches Unternehmen!“, ärgerte sich Ferner-Bär. Eigentlich fühlte er sich schuldig, weil er ihr diesen Vorschlag gemacht hatte. Aber wie hätte er ahnen können, dass dieses widerspenstige Kind sofort aufbrach!
„Offensichtlich nicht, denn sie ist gegangen“, bemerkte die Tante ruhig und vertiefte sich wieder in ihre Näharbeit.
Kopfschüttelnd trat der Mann aus dem Zelt und blickte in die Ferne. Wohin seine Nichte wohl gegangen war? Eine Visionssuche war schon für gesunde Menschen anstrengend, aber Kranichfrau war alles andere als geistig und körperlich stark. Besorgt holte er sein Pferd und machte sich auf die Suche.
Kranichfrau saß in einem kleinen Tal und betete zu dem Sonnenaufgang. Sie hatte keine Augen für die Schönheit des erwachenden Morgens, sondern flehte inbrünstig um die Gnade einer Vision: „Ich weiß nicht, wer ich bin! Ich weiß nicht, wohin ich gehe! Hilf mir, meinen Weg zu finden!“
Unablässig flüsterte sie die kurzen Sätze, bat um eine Vision, die ihr sagte, wie sie weiterleben konnte. In der Ferne leuchteten schemenhaft die Berge, „Das Rückgrat der Welt“, wie ihre Leute sie nannten. Darüber tanzten Wolkenfetzen, die sich wie die Schaumkronen einer riesigen Welle auf sie zu bewegten. Am liebsten wollte sie darin versinken, für immer in diesem weichen Nebel verschwinden.
Am ersten Tag war sie noch bei klarem Verstand, achtete auf das Vogelgezwitscher in der näheren Umgebung, ob die gefiederten Freunde ihr etwas sagen wollten.
Leise singend schaukelte sie mit erhobenen Augen hin und her, flehte inbrünstig um eine Erleuchtung. Selbst als die kalten Finger der Nacht nach ihr griffen, hielt sie nicht inne. Zitternd vor Kälte sang sie heiser ihr Visionslied. Am nächsten Tag bereits rebellierte ihr geschwächter Körper gegen den Hunger und Durst. Grelle Blitze flimmerten vor ihren Augen und ihre Zunge lag geschwollen wie ein Fremdkörper in ihrem Mund. Fast unhörbar krächzte sie ihr Lied, wie in Trance schaukelte sie unablässig hin und her, nahm längst ihre Umwelt nicht mehr wahr. Erinnerungsfetzen stiegen in ihr hoch, Bilder aus ihrer frühen Kindheit, als ihr Vater sie maßlos verwöhnt hatte. Sie war das dritte Kind gewesen, das ihm geboren worden war. Eine ältere Schwester war bereits gestorben, und so steckten die Eltern alle Liebe in diese Tochter. Selbst ihr Bruder widmete sich hingebungsvoll dieser kleinen Schwester, lehrte sie Bogenschießen und Reiten. Warum musste ihr Leben eine solche Wendung nehmen? Ihr die Eltern, die Schwester und dann noch den geliebten Bruder nehmen? Was hatte der Sonnenhäuptling für sie vorgesehen? Welches Schicksal ihr zugedacht?
Die rote Nachtflamme zeigte sich am Firmament, ließ das Sternbild der Sieben Menschen fast verblassen. Wo war der Wolfspfad, wo der Stern, der still steht? Alles verschwamm um sie herum und kraftlos kippte sie auf die Seite.
In der Nacht bekam sie hohes Fieber und hatte längst nicht mehr die Kraft ins Dorf zurückzukehren. Hilflos lag sie am Boden, wurde von Fieberträumen geschüttelt. Ameisen krabbelten über ihr Gesicht und im Unterbewusstsein wollte sie sich dem schwarzen Nichts ergeben, das nach ihr griff.
Dann tauchte vor ihr plötzlich das lächelnde Gesicht ihres Bruders auf, der sich über sie beugte. Es war so klar und deutlich, dass sie glaubte, er wäre da. Sie wollte ihn begrüßen, doch ihr ausgetrockneter Mund brachte keinen Ton heraus. Er bewegte seine Lippen und mühsam versuchte sie, sich darauf zu konzentrieren, was er sagte. Es war so wichtig!
Langsam verschwand ihr Bruder und verzweifelt griff sie nach ihm, wollte ihn nicht fortlassen. Ein letztes Mal lächelte er, drückte ihr seinen Bogen in die Hand, dann wurde seine Stimme klar: „Tötet-die-Crow, folge meinem Weg!“, beschwor er sie, ehe seine Umrisse verblassten.
Sie spürte nicht mehr, wie eine Hand die Ameisen von ihrem Gesicht wischte, ihr Körper sanft hochgehoben und nach Hause getragen wurde. Traumlos schlief sie in dem Zelt ihres Onkels, schluckte benommen den Tee, der ihr vorsichtig eingeflößt wurde.
Sie fühlte sich um vieles gealtert, als sie endlich die Augen aufschlug und die freundlichen Gesichter ihrer Tante und ihres Onkels über sich erblickte.
„Wie komme ich hierher?“, fragte sie benommen.
„Haijah, du wärst eine leichte Beute für die Ameisen gewesen!“, meinte Ferner-Bär tadelnd, aber seine feuchten Augen verrieten, welche Sorgen er sich um seine Nichte gemacht hatte.
Sie schloss müde die Augen. Was redete er da? Sie konnte sich an keine Ameisen erinnern. Eine Schale berührte ihre Lippen und sie schlürfte hungrig die lauwarme Suppe.
„Onkel“, murmelte sie erschöpft, „ich hatte einen seltsamen Traum!“
„So? Möchtest du ihn mir erzählen?“
Sein spitzes Kinn berührte fast ihre eingefallene Wange, als er sich niederbeugte, um ihre schwache Stimme zu vernehmen.
„Ja! Ich träumte von meinem Bruder. Er lachte und es war so schön, ihn wiederzusehen. Ich wollte ihn nicht weglassen, wollte ihm folgen in die Sandhügel!“ Zögernd hielt sie inne, als sie an den deutlichen Traum dachte.
„Gut, dass du es nicht getan hast!“, seufzte ihr Onkel, ehrlich betroffen.
„Er nannte mich Tötet-die-Crow. Er hat mir seinen Bogen gegeben und mich gebeten, dass ich seinem Weg folge!“
Entsetztes Schweigen herrschte nach ihren Worten und die Tante schlug sich die Hand vor den Mund.
Ihr Onkel fing sich als Erster: „Das ist eine starke Vision!“
Sie nickte nur mit dem Kopf und schloss wieder erschöpft die Augen, während Ferner-Bär sich nachdenklich zurücklehnte. Prüfend musterte er seine Nichte, runzelte die Stirn über ihr knabenhaftes Aussehen. War das ihr Weg? Manchmal wählten Frauen von sich aus wie ein Krieger zu leben, Frauen, mit dem Herzen eines Mannes. Vielleicht war sie eine solche Frau? Ihre Vision konnte nicht ignoriert werden. Der Sonnenhäuptling hatte ihren Weg gewählt und es wäre falsch, ihm nicht zu gehorchen!
„Onkel?“
„Ja?“
„Was bedeutet dieser Traum?“
Ferner-Bär schloss die Augen, seine Stimme wurde ernst. „Ich kenne nun deinen Weg. Du wirst wieder in deinem Zelt leben, als Krieger. Ich werde allen sagen, dass du nun mein Neffe bist und Tötet-die-Crow heißt.“
„Bin ich nun ein Mann?“
Ferner-Bär zögerte sichtlich. „Das wird der Sonnenhäuptling entscheiden. Dein Bruder gab dir seinen Bogen, damit du ihn rächst. Wir werden beide gegen die Crow ziehen, wenn du soweit bist. Wenn du deinen Bruder gerächt hast, wirst du wissen, was deine Bestimmung ist.“
Beruhigt schloss Kranichfrau die Augen. Morgen würde sie als Tötet-die-Crow aufwachen und ihr neues Leben beginnen.
Sie war oft mit ihrem Bruder zur Jagd gegangen, hatte wissbegierig seinen Worten gelauscht, fast wie ein kleiner Bruder. Jetzt würde sie dieser kleine Bruder sein. Selbst wenn sie nicht den Körper eines Mannes hatte, so würde sie doch wie ein Krieger leben. So ein großer Unterschied zu ihrem Leben vorher war das nicht, denn alle Mädchen lernten Bogenschießen, damit sie sich gegen Feinde verteidigen konnten. Wie oft hatte ihr Onkel missbilligend die Stirn gerunzelt, wenn sie eher wie ein Junge herumtobte, anstatt sittsam bei ihrer Tante zu sitzen und nähen zu lernen. Aber die Erziehung sah Strafen nicht vor, wenn sie einfach von ihren Arbeiten verschwand, um mit ihrem Bruder zur Jagd zu gehen. Manchmal hatten sie über dessen Verantwortungslosigkeit geschimpft, ihn gebeten das Mädchen in ihr Zelt zu geben, damit sie auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereitet wurde. Aber ebenso stur hatte er dies abgelehnt: „Kranichfrau bleibt bei mir! Sie wird schon lernen, was sie später einmal braucht. Sie ist ja oft genug bei ihrer Tante!“
„Ja, aber jedes Mal, wenn sie gerben oder nähen soll, verschwindet sie mit dir!“
Ihr Bruder hatte nur gelacht und seine Schwester mit einem Zwinkern eingeladen ihm zu folgen. Oh, wie hatte sie ihn geliebt und ihm nachgeeifert! Jetzt würde sie in seine Fußstapfen treten!
Die Frauen im Dorf waren entsetzt. Ein Mädchen, das wie ein Mann leben wollte! Sie fürchteten den schlechten Einfluss auf ihre Töchter und redeten auf die Tante ein, diesen Unsinn zu unterbinden. Auch die Tante wehrte sich mit Händen und Füßen, fürchtete um ihren Einfluss bei den Frauen und um den Status ihrer Familie.
„Wie kannst du uns nur so etwas antun?“, schimpfte sie mit ihrem Mann.
„Denk doch an unsere Töchter! Ich möchte nicht, dass sie ebenso werden! Alle werden über uns reden!“
„Sie hatte eine Vision! Das kann ich doch nicht ändern!“, verteidigte sich Ferner-Bär.
„Aber sie kann doch nicht als Mädchen allein in einem Zelt leben!“
„Sie lebt neben uns und außerdem ist sie jetzt ein Krieger!“
„Ein Krieger!“, zischte die Tante empört, ihre schmalen Lippen verzogen sich zu einem dünnen Strich. „Sie sieht wahrlich nicht aus wie ein Krieger!“
„Dann nähe ihr eben Männerkleider!“
„Ai, wenn sie ein Krieger ist, dann kann sie sich ja selbst Männerkleider nähen!“ Ganz bestimmt wollte die Tante diesen Weg nicht auch noch unterstützen. Wutentbrannt schob sie ihre breiten Hüften an ihm vorbei und stürmte aus dem Zelt, schimpfte leise murmelnd vor sich hin.
Also nähte sich Tötet-die-Crow einfache Männerkleider, und ihr Onkel lehrte sie, wie man Pfeil und Bogen herstellte. Außerdem fertigte er ihr ein Medizinschild, den er mit dem Zeichen der Sonne verzierte. „Der Sonnenhäuptling gab dir diese Vision, also wird er dich auch beschützen!“, lächelte er.
Trotzdem wurde sie immer wieder daran erinnert, dass sie im Grunde eine Frau war. Weit vor dem Sonnenaufgang ging sie zu dem Badeplatz der Frauen, um sich zu waschen.
Natürlich tuschelten die Frauen über ihr ungehöriges Benehmen, und so wich sie ihnen aus. Trotzdem blühte sie auf in ihrer neuen Kleidung, lebte ungebunden und ohne die Zwänge, die sonst jungen Mädchen auferlegt waren.
Die Männer behandelten sie nach anfänglichem Zögern wie einen der Jungen, der sie bald auf dem Kriegszug begleiten würde. Doch oft war sie auch das Opfer derber Späße, obwohl sich diese Späße selten gegen ihre Weiblichkeit richteten, sondern eher gegen ihre Unwissenheit, wie bei allen anderen Jungen auch.
Unter diesen Gleichaltrigen fand sie noch am ehesten wirkliche neue Freunde, die fast vergaßen, dass sie ein Mädchen war.
Wiesel-gefangen-am-Schwanz oder Freund-der-Otter wurden gute Freunde, maßen sich mit ihr in vielen Wettkämpfen. Im Laufen hielt sie locker mit, aber im Ringen war sie selbst diesen gleichaltrigen Jungen hoffnungslos unterlegen. Manchmal verlor sie den Mut, wenn sie übersäht mit blauen Flecken an ihrem Feuer saß, aber dann besann sie sich auf ihre Stärken. Sie konnte den Bogen genauso gut wie die anderen spannen, und wenn ihre Treffsicherheit zunähme, wäre sie ein gefährlicher Gegner. Nur den Kampf Mann gegen Mann musste sie vermeiden, solange sie noch einen so mädchenhaften Körper hatte! Sie stählte ihren Körper, damit sie eines Tages stark genug war, um ihren Bruder zu rächen. Sie glaubte fest an ihre Vision, hatte ein großes Vertrauen darauf, dass der Sonnenhäuptling sie beschützen würde. Solange sie sich nicht den Gefühlen einer Frau hingab, konnte ihr nichts geschehen.
Aber sie hatte den Körper einer Frau, und auch bei ihr setzte regelmäßig die Monatsblutung ein, die sie in ihr Zelt verbannte. Bei einem Kriegszug wäre das ein Problem, denn dann musste sie abseits der Männer reiten, damit sie nicht deren Kraft schwächte. Wäre sie doch nur als Junge geboren worden!
Ohne sich um die missbilligenden Blicke der Frauen zu kümmern, ging sie zur Jagd. Sogar ein Schwarzhorn, wie ihr Volk die Büffel nannte, hatte sie bereits erfolgreich erlegt, obwohl ihr Onkel ihr noch nicht erlaubte auf die große Treibjagd mitzugehen. Aber das war auch den anderen Jungen verboten.
Kranichfrau versorgte umsichtig ihren Büffelläufer, eigentlich ein Pony, das Ferner-Bär ihr geschenkt hatte, und gewöhnte es an ihre Schenkel. Letztendlich musste sie sich bedingungslos auf ihr Pony verlassen können, wenn es zum Kampf kam. Sie arbeitete gern mit dem Pony, denn im Gegensatz zu den Männern spielte es keine Streiche mit ihr. Überschwänglich lobte sie es, als sie sich eines Nachmittages von seinem Rücken gleiten ließ und es schweißgebadet zum Stehen kam.
„Komm, genug für heute!“, tätschelte sie es, dann tauchte sie in den kühlen Fluten des nahen Bärenflusses unter und ließ sich eine Weile treiben. Die Kälte ging ihr durch und durch und frierend kletterte sie wieder ans Ufer.
Verärgert fing sie den spöttischen Blick eines fremden Mannes ein, der zweifelsfrei ihren fraulichen Brüsten galt und zischte ihn böse an: „Was grinst du so frech!“
Der Krieger zuckte nur die Schultern und meinte: „Gleichgültig wie gut du reitest, du wirst immer eine Frau bleiben!“
Wütend zog sie das Hemd über und legte den Lendenschurz um, doch dann traf sie die Wahrheit seiner Worte. Sie würde immer in diesen fraulichen Körper stecken! Mit trauriger Stimme drehte sie sich zu ihm um: „Du hast Recht. Wie sehr beneide ich dich, denn du hast den Geist eines Mannes und den Körper eines Mannes! Mein Geist dagegen steckt für immer in diesem Körper einer Frau! Doch ich kann mein Schicksal nicht ändern, sondern muss mit dem zufrieden sein, was der Sonnenhäuptling für mich vorsieht.“
Verlegen senkte der Mann die Augen und machte eine entschuldigende Bewegung mit der Hand. „Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich wünschte nur, dass das Schicksal einen einfacheren Weg für dich gewählt hätte, denn du wärst eine wundervolle Ehefrau für jeden Mann dieses Dorfes! Das ist alles!“
Sie lächelte freundlich und strich sich die feuchten Haare aus dem Gesicht. „Nun, so werde ich eben ein wundervoller Kampfgefährte, meinst du nicht?“
Schallendes Gelächter antwortete ihr, doch dann wurden seine Augen ernst. „Ich bin Zwei-Pferde, du kannst mir gern den Rücken freihalten, wenn wir in den Kampf ziehen!“
Ihre Brust schwoll vor Stolz, dann richtete sie ihre feurigen Augen auf ihn. „Ai, du reitest mit?“
Sein Gesicht verdunkelte sich merklich: „Ja, auch ich habe einen Bruder durch die Crow verloren, und meine Schwester haben sie entführt. Ich habe wahrlich Grund genug, die Weiber der Crow zum Weinen zu bringen!“
Kurz streiften ihre Augen die schlanke Gestalt des Mannes. Er hatte viel Ähnlichkeit mit ihrem Bruder: langes offenes Haar, einige Lachfalten um seinen Mund und schwarze Augen, in denen sich die Sonnenstrahlen spiegelten. Eigentlich sah er ganz nett aus, musste sie sich eingestehen, aber auf so etwas durfte sie jetzt nicht mehr achten. Allein seine Kampfkraft zählte.
„Wir werden uns wiedersehen!“, verabschiedete sie sich und sprang gewandt auf ihr Pony.
In den nächsten Tagen trafen sich die Krieger in dem großen Versammlungszelt und berieten über den kommenden Kriegszug. Hitzige Reden über die Grausamkeit der Crow stachelten alle an und sie waren sich einig darüber, dass die Feinde eine harte Strafe verdienten. „Nie wieder darf sich ein Crow in unsere Jagdgründe trauen!“
„Wir müssen so hart zuschlagen, dass sich ihre Weiber und Kinder nicht mehr aus den Zelten wagen, wenn sie unseren Namen hören!“
„Wir werden so viele unserer Feinde töten, dass ihre Weiber noch lange um ihre Männer trauern!“
„Wir sollten ihre Frauen am besten gleich mitnehmen, damit sie nicht verhungern müssen!“, spottete ein anderer Krieger und löste schadenfrohes Gelächter aus.
„Ja, und dann gebären die Crowfrauen unsere Kinder!“
In den Zelten senkten die Frauen beschämt die Köpfe, denn ihnen blühte das gleiche Schicksal, wenn ein übermächtiger Gegner ihr Dorf überfiel. Viele verabscheuten den Krieg und sahen es nicht gern, wenn ihre Männer auszogen, Tod und Verderben über andere zu bringen. Die Blackfeet, aufgeteilt in drei große Untergruppen aus Pecuni, Siksika und Kaihnah, waren die größte Macht auf den nördlichen Plains, ihre Jagdgründe reichten von dem Missouri-Fluss im Süden bis weit über den Saskatchewan im Norden. Grundsätzlich kämpften sie gegen alle Nachbarstämme, aber mit den Crow verband sie seit Langem ein unversöhnlicher Hass.
Die Lakota
(Gebiet des Little-Bighorn-Flusses)
Nata-He-Yukan ging schnellen Schrittes durch das Dorf, dessen Zelte verstreut an der Biegung eines Flusses lagen. Er strotzte vor Selbstbewusstsein, und sein ausholender Gang verriet, wie stolz sein Volk auf ihn sein konnte. Nata-He-Yukan, Kopf mit Hörnern, allein der Name besagte schon, dass er sich Respekt verschaffte. Niemand legte sich ungestraft mit ihm an. Aber warum auch? Bei seinem Volk, den Oglala-Lakota, die ihre Jagdgründe, mehr oder weniger, zwischen dem Platte-Fluss im Süden und dem Yellowstone im Norden sahen, galt er als guter Jäger und viel versprechender junger Kämpfer.
Sein ganzer Körper spiegelte sein kriegerisches Leben: schlank und groß, wie alle seines Volkes. Seine offenen tief-schwarzen Haare fielen ihm bis ins Kreuz, als Haarschmuck trug er den Roach seines Kriegerbundes: eine ovale Platte, gefertigt aus dem Brustbein des Hirsches, an dem senkrecht schwarzes Pferdehaar und die rot gefärbten Haare des Weißwedelhirsches befestigt waren, geschmückt mit zwei Adlerfedern, die ihn als fähigen Späher auszeichneten. Jetzt im Spätsommer trug er nur einen Lendenschurz, der rhythmisch seine Beine umspielte, als er gut gelaunt in sein Tipi glitt.
Verglichen mit dem gleißenden Sonnenlicht draußen, wirkte der sanfte Halbschatten in dem Tipi angenehm. Eine leise Brise wehte durch die geöffneten Zeltwände aus Büffelhäuten, die wegen der Hitze vom Boden weg nach oben geschlagen worden waren.
„Hau, Ina!“, grüßte er kurz.
„Han, Mitschinkschi!“, antwortete die verhaltene Stimme seiner Mutter.
Nata-He-Yukan setzte sich auf seinen Platz und wartete darauf, dass seine Mutter ihm etwas zu essen gab. Er lehnte sich gemütlich gegen seine Rückenstütze aus Weidenzweigen und sah zu, wie seine Mutter aus dem Tipi schlüpfte, um aus dem Büffelmagen, in dem die Suppe mit heißen Steinen erhitzt wurde, einige Fleischstücke zu fischen. Im Sommer kochte seine Mutter immer vor dem Zelt, auch weil der Bisonmist, den sie zum Feuern verwendete, entsetzlich qualmte. Mit einer Schüssel kehrte sie zurück und reichte sie ihm mit einem Lächeln. Ihre Zöpfe waren ordentlich geflochten und fielen über ihre Schultern nach vorne. Sie trug keinerlei Schmuck und doch hatte ihr einfaches Kleid etwas Festliches. Am Halsausschnitt war es mit einer blauen Borte aus gefärbten Stachelschweinborsten verziert, und auch ihre Mokassins führten das gleiche einfache Muster.
„Habt ihr Büffel gesehen?“, versuchte seine Mutter ein Gespräch zu beginnen.
Lässig winkte Nata-He-Yukan ab: „Nein, noch nicht! Heute Abend tanzen wir den Büffeltanz, um das Büffelvolk zu rufen. Ich werde wieder als Späher reiten und nach ihnen Ausschau halten!“
„Ma, das ist gut!“
Hungrig schlang der junge Mann das Fleisch hinunter, dann fiel ihm die offensichtliche Ruhe in dem Zelt auf. „Wo ist meine Schwester?“
„Bei ihrer Freundin.“
„So?“, amüsierte er sich. Seit dem Tod seines Vaters vor drei Wintern fühlte er sich verantwortlich für das kleine Mädchen. Sein Vater hatte sie nicht mehr gesehen, denn er war kurz vor der Geburt bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen. Seither kümmerte sich Nata-He-Yukan um die beiden, übernahm die Vaterrolle für seine kleine Schwester und war im Stillen froh, dass seine Mutter nicht einen neuen Mann genommen hatte. So wurde er bestens versorgt, und musste sich keine Gedanken machen irgendein Mädchen zu heiraten. Oft lebte er in dem Zelt der Kit-foxes, seines Kriegerbundes, achtete darauf seinen Ruf als Krieger zu stärken, ging auf jeden Kriegszug mit, der sich anbot, jedoch ohne sich Sorgen um eine Familie machen zu müssen.
Ein kleines nacktes und ziemlich schmutziges Mädchen steckte seine Nase in das Zelt und funkelte ihn strahlend an. „Mitiblo!“, mein Bruder!
„Mitankschi!“, meine Schwester, lächelte er zurück.
Sofort setzte sich das zierliche Wesen auf seinen Schoß und sperrte fordernd den Mund auf: „Lo watschin!“, ich habe Hunger.
„Hier, mein kleiner Hund!“ Er stopfte ein Stück Fleisch zwischen ihre blitzenden Zähne. Noch wurde zwischen den beiden nicht die Zurückhaltung erwartet, wie sie später zwischen Bruder und Schwester üblich war, denn das Kind galt noch als Baby, das tun und lassen durfte, was es wollte.
„Ich bin kein Hund! Ich bin Machpiya-ska, die Weiße-Wolke!“, empörte sich das Mädchen.
„Nein, du bist mein kleines Vielfraß!“, ärgerte er sie weiter.
„Nein, ich heiße Machpiya-ska!“ Sie stand ihm an Sturheit in nichts nach.
„Nein, du bist Mitankschi, meine kleine Schwester!“
Stirnrunzelnd starrte das Kind ihn an, etwas verwirrt von seiner Logik, aber wild entschlossen nicht klein beizugeben.
„Ich bin Machpiya-ska und Mitankschi“, bot sie schließlich als Kompromiss an.
Nata-He-Yukan lachte hellauf: „Das ist wahr! Du bist Machpiyaska, Mitankschi!“ Oh, er liebte dieses kleine Mädchen und er war froh, dass es noch lange dauern würde, ehe ein Mann um ihre Hand anhalten durfte. Er war jetzt schon eifersüchtig!
Wieder ernst wandte er sich an seine Mutter:
„Lege meine schönsten Sachen bereit, denn ich möchte das Büffelvolk angemessen begrüßen, wenn ich losgeschickt werde, um sie zu suchen.“
Sie nickte nur, stolz über die wichtige Aufgabe, die ihr Sohn erfüllen sollte. „Vielleicht solltest du dich reinigen und beten?“, meinte sie fürsorglich.
Mit einem Lächeln sah er in ihre freundlichen Augen, in denen sich deutlich ihre Liebe und ihre Bewunderung widerspiegelten.
„Vielleicht. Wenn mich dieser kleine Hund hier gehen lässt!“
„Ich heiße Weiße-Wolke!“, schnappte seine Schwester sofort.
„Na gut, du kleine Wolke, dann puste ich dich eben weg!“, drohte er und warf das Kind auf das dichte Fell neben sich.
„Du bist so ein guter Bruder! Es wird Zeit, dass du dir eine Frau suchst und eigene Kinder hast!“, wünschte sich seine Mutter sehnsüchtig.
„Hohch, aber nein! Dafür bin ich noch zu jung!“, wehrte er entsetzt ab.
„Zu jung! Du zählst zehn und acht Winter. Du brauchst eine Frau, die dir deine Kleider näht, für dich kocht und deine Lenden erfreut!“
Nata-He-Yukan hasste dieses Thema. Er wollte noch keine Frau, für was denn? Seine Mutter versorgte ihn und so recht wusste er nicht, was denn seine Lenden erfreuen sollte. Wenn er ein unerklärliches Gefühl verspürte, dann ging er eben auf einen Kriegszug, oder eine gefährliche Jagd, das kühlte sein Begehren wieder ab. Den Mädchen im Dorf ging er ganz bewusst aus dem Weg, denn noch war er kein reicher Mann, um den möglichen Schwiegereltern entsprechende Geschenke zu bieten. Seine Familie galt als arm. Mit nur zwei Pferden, die er dringend für die Jagd benötigte, konnte er unmöglich an eine Ehefrau denken.
Vielleicht schob er diesen Gedanken aber auch ganz bewusst von sich, weil so ein lausiger Miniconjou Krieger ihm das Mädchen Grashüpfer weggeschnappt hatte.
Noch einmal wollte er keine solche Schlappe erleben! Nein, erst musste er sich noch als fähiger Krieger beweisen, vielleicht noch einige Pferde von ihren Feinden den Crow, Shoshone, Ute oder Pawnee rauben. Bisher hatte er sich durch Mut einen Namen verdient, bereits seinen ersten Coup errungen, was sich aber weniger in seinem Besitz auszeichnete. Ihm war es wichtiger, einen Feind zu berühren oder zu töten als irgendwelche Pferde zu rauben.
Seine Mutter dagegen hoffte endlich auf eine junge Schwiegertochter, die ihr bei der Arbeit helfen konnte, und der es vielleicht gelang, ihren wilden Sohn zu zähmen. Jedes Mal zitterte sie um sein Leben, hatte Angst davor, endgültig allein dazustehen, wenn er von einem Kriegszug nicht mehr heimkam. Sorgenvoll blickte sie hinter ihm her, als er ohne zu antworten aus dem Zelt kletterte und einfach verschwand.
Nata-He-Yukan wandte sich zum Fluss. Dort sammelten seine Freunde bereits biegsame junge Weiden, um die rituelle Schwitzhütte zu bauen. Für jeden abgeschnittenen Ast legten sie ein Tabakopfer nieder, um sich bei Wakan-tanka, dem großen Geheimnis, für diese Gabe zu bedanken. In der Mittagshitze lief ihm sofort der Schweiß herunter und lästige Moskitos umschwirrten ihn. „Warum überhaupt eine Schwitzhütte bauen?“, dachte er mit einem flüchtigen Lächeln. Hier draußen war es vermutlich genauso heiß wie später in der Hütte, wenn der Feuerhüter die erhitzten Steine in das Innere rollte.
Zusammen mit dem Medizinmann und dessen Gehilfen half er den anderen die Zweige zu biegen und miteinander zu verbinden, sodass eine Halbkugel entstand, über die sie die Felle legten. Alles geschah mit ruhigem Gemurmel und voller Konzentration, denn diese Zeremonie war ein Gebet, eine rituelle Reinigung, damit die Jagd von Erfolg gekrönt sein würde.
Dann stellte der heilige Mann in jeder der vier Himmelsrichtungen einen Stab auf, der mit einer Adlerfeder geschmückt war, und hängte Tabakopfer daran. Ein Helfer des Medizinmannes entzündete die Pyramide aus Feuerholz, in der die Steine erhitzt wurden. Schweigend warteten alle darauf, dass die Steine die nötige Hitze für die Zeremonie erreichten. Der Feuerhüter wartete geduldig, bis das Feuer fast heruntergebrannt war, ehe er das Zeichen für den Beginn der Zeremonie gab. Der Medizinmann legte seine Kleider ab und wirkte plötzlich alt und zerbrechlich.
Nata-He-Yukan schluckte schwer, während er selbst seinen Lendenschurz ablegte und sein Geschlecht mit Salbeizweigen bedeckte. Er achtete den Medizinmann, aber selbst dessen Macht war nicht unbegrenzt. Trauer erfüllte ihn, als er daran dachte, wie sein Vater hatte sterben müssen, weil die Heilkünste des Medizinmannes nicht ausgereicht hatten. Aber er empfand keinen Hass gegen den heiligen Mann, erkannte nur, dass auch dessen Wissen und Medizin nicht allumfassend war. Nata-He-Yukan verließ sich lieber auf Dinge, die er sehen und fühlen konnte, nicht auf magischen Zauber, der dann doch versagte, wenn man ihn brauchte. So entstand eine Kluft in ihm, denn einerseits glaubte er an das Überirdische, an all die Geister, die ihn umgaben, andererseits glaubte er nicht an einen besonderen Schutz, der ihm helfen könnte in dieser Welt zu bestehen. Seine Waffen und sein starker Arm, das waren die Kräfte, denen er vertraute. Jeder Mann musste seinen eigenen Weg wählen.
Der Medizinmann kroch als erster in die winzige Hütte, dann folgten in einer Kreisbewegung nacheinander die anderen. Schweigend drängten sich die Männer um die kleine Grube und der Feuerhüter rollte die ersten sieben Steine herein. Das Eingangsfell fiel zu und plötzliche Dunkelheit umhüllte die Männer. Nur die rot glühenden Steine in der Grube wirkten wie das Nest eines gefährlichen Untiers.
Aromatischer Duft breitete sich aus, als Salbei verbrannt wurde, um die bösen Geister zu vertreiben. Leise sang der Medizinmann das Lied für die vier Winde, dann lud er mit einem Geistlied die guten Geister ein zu ihnen zu kommen. Süßlicher Geruch breitete sich aus, als er Süßgras verbrannte, um die guten Geister anzulocken. Anschließend spritzte ein Helfer Wasser auf die Steine und heißer Dampf stieg auf. In der zweiten Runde rollte der Feuerhüter fünf Steine in die Grube. Wieder stieg Dampf auf, dann wurde die Pfeife entzündet. Lieder wurden gesungen, um sich bei den Geistern zu bedanken. Ihr Volk gedieh, keine Krankheiten schwächten sie und die Jagd war gut. Sie hatten viele Gründe dankbar zu sein.
Ein weiteres Mal wurde das Fell hochgeschlagen und die nächsten Steine wurden hereingerollt. Nata-He-Yukan lief der Schweiß in Strömen herunter, als weiterer Dampf die winzige Hütte erfüllte. Doch tapfer betete er für eine gute Jagd, bat die Geister darum, ihnen die Büffel zu schicken.
Ein letztes Mal wurden die Steine hereingerollt und eine gewisse Apathie breitete sich aus. Schwer atmend saßen alle beisammen, plötzlich eins mit dem Herzschlag von Mutter Erde. In einem leisen Gesang wurden die Geister verabschiedet und der Medizinmann beendete die Zeremonie mit den Worten „Mitakuyeoyas´in.“ Dann verließ er die Hütte und fast erleichtert folgten ihm die anderen.
Nata-He-Yukan hatte jedes Mal Brandblasen auf der Haut, wenn er schließlich, gequält von der entsetzlichen Hitze und Atemnot, wieder heraus kroch, um in den kalten Fluss zu springen.
Erfrischt kletterten die Männer an das Ufer und schlüpften wieder in ihre Lendenschürze. Alle freuten sich auf den abendlichen Tanz, wenn sie als Büffel verkleidet um das Feuer tanzen würden.
„Ich bin auch als Späher erwählt worden!“, verkündete Bleza-Si mit vor Stolz geschwellter Brust. Ohne die Miene zu verziehen streifte Nata-He-Yukan den jungen Mann mit einem flüchtigen Blick, vermied den direkten Augenkontakt.
Entenfuß! Eigentlich sein ärgster Gegner, denn seit Kindheit an maß er sich mit ihm, wer von ihnen der Beste, der Schnellste, der Tapferste war. Es war ein ewiger Kampf um die Gunst des Häuptlings und der älteren Krieger. Als Folge ihrer harten Wettkämpfe verunstaltete eine gespaltene Lippe das Gesicht von Bleza-Si. Er war bei einem harten Wettrennen vom Pferd gestürzt und mit seinem Gesicht auf einen spitzen Stein geprallt. Den seltsamen Namen hatte er erhalten, weil er immer mit nach außen gedrehten Fußspitzen ging, sodass der Eindruck entstand, er watschle wie eine Ente.
Bleza-Si hasste diesen Namen, aber bisher war noch niemand auf die Idee gekommen, ihm einen anderen zu geben, obwohl auch er begierig war, seinen Mut zu beweisen, damit sie ihn endlich änderten.
Beide Krieger lächelten sich höflich zu. Sie kontrollierten ihre Gesichtszüge, damit sie nicht ihre weniger freundlichen Gedanken verrieten. Dann drehten sie sich einfach um und gingen zu ihren Zelten, um sich für den Tanz anzukleiden. Niemand wunderte sich über das Benehmen der beiden, denn alle kannten den Ehrgeiz, der diese Männer antrieb. Allein Tapferkeit zählte und es war nur natürlich, sogar erwünscht, dass Männer sich untereinander maßen. Sie waren ein kriegerisches Volk. Aber wo lag die Grenze zwischen Ehrgeiz und Hass?
Nata-He-Yukan machte sich darüber keine Gedanken, für ihn waren die Geplänkel mit Bleza-Si von jeher etwas rauere Wettspiele, wie sie unter Knaben und jungen Männern eben üblich waren.
Im Zelt steckte seine Mutter das zappelnde Mädchen bereits in ihr Festgewand und staunend nahm Nata-He-Yukan das frisch gewaschene Kind an beiden Händen und drehte sie hin und her. „Eh, was habe ich für eine schöne Schwester!“, lobte er lächelnd.
„Du musst dich auch schön anziehen!“, piepste sie zurück.
„Wan, alles was ich anziehe, ist bestimmt nicht so hübsch wie dein Kleid!“, entgegnete er und erntete ein glückliches Lachen seiner Schwester. Aber auch seine Mutter bot einen schönen Anblick in ihrem hellbraunen Hirschlederkleid, dessen gesamte Schulterpartie mit blau gefärbten Stachelschweinborsten bestickt war. Ihre festlichen Mokassins und Leggins waren vollständig bestickt, außerdem trug sie eine lange Kette aus weißen Dentaliumschnecken. Mit ihren zehnmal drei und sieben Wintern wäre sie auch jetzt noch eine gute Partie für einen Krieger.
Neugierig beugte sich Nata-He-Yukan über die Kleidung, die sie für ihn herausgesucht hatte. Ein sorgfältig gefertigtes Hemd, reichlich bestickt und mit Fransen verziert, dazu passende Leggins. Er hatte gesehen, dass sie den ganzen Winter daran gearbeitet hatte, und jetzt staunte er über die wunderschöne Arbeit, die in ihren Händen entstanden war. „Nape-waschte-win!“, Frau mit den guten Händen, so war ihr Name und sie führte ihn zu Recht.
„Nape-waschte-win. Meine Mutter“, flüsterte er dankbar und fühlte einen dicken Kloß in seiner Kehle.
Fast schüchtern schlüpfte er in das wunderschöne Hemd und ließ es zu, dass seine Mutter voller Stolz an ihm herumzupfte.
Freudig erregt verließ Nata-He-Yukan das Tipi und führte sein Pferd zu dem Tanzplatz. Voller Erwartung nickte er seinen Freunden zu, die ebenso ihre Pferde herbeiführten.
Ein riesiger Feuerball verschwand hinter den Hügeln und die tanzenden Strahlen der Sonne streichelten über die hoch aufgerichteten Tipis, ehe die Nacht hereinbrach.
Langsam versammelten sich die Menschen um das große Feuer, bestaunten die Männer, die sich als Büffel verkleidet hatten. Die Sänger saßen um die große Trommel und schlugen gleichmäßig den dumpfen Rhythmus, der wie ein Herzschlag alle Menschen erfasste. Der Gesang schwoll an, von kreischend hohen Tonlagen sank er tiefer, bis er fast den dunklen Ton der Trommel erreichte.
Mit langsamen Schritten bewegten sich die Frauen und Mädchen im Kreis, flehten um die Güte des Büffelvolkes, während die Männer die stampfenden Bewegungen der Büffel nachahmten. Ja, die Büffel nährten sie gut, mit ihrer Hilfe würden sie auch den kommenden Winter überleben.
Nata-He-Yukan wartete mit den anderen drei Reitern auf das Zeichen des Medizinmannes, dann würden sie in alle vier Himmelsrichtungen ausschwärmen und Ausschau halten, ob die Büffel bereits kämen. Schließlich gab der Medizinmann das Zeichen und die jungen Reiter stoben davon.
Die anderen tanzten weiter. Abwechselnd würden sie solange tanzen und flehen, bis ein Reiter zurückkäme und endlich die ersehnte Ankunft der Büffel verkündete.
Nata-He-Yukan spürte die Muskeln seines Ponys unter sich und erfreute sich an dessen Kraft. In der Dämmerung erlaubte er, dass es im vollen Galopp über die Steppe sauste, erst später würde er langsamer reiten, damit es nicht in einem Loch stolperte. Der Wind war angenehm und langsam trocknete der Schweiß an seinem Körper. Unermüdlich ritt er nach Westen, bewunderte, wie die Farben des Himmels von einem dunklen Rot in ein sanftes Lila wechselten. In den Senken des hügeligen Landes herrschte bereits Tiefschatten, der die lange Nacht erahnen ließ.
Mit einem Ruck an den Zügeln hielt er sein braun geflecktes Pony auf der Kuppe eines Hügels an. Sorgfältig ließ er seinen Blick über das Land schweifen, vernahm jede Bewegung. Er hoffte auf ein Zeichen, ehe es zu dunkel wurde etwas zu erkennen. Unschlüssig hockte er im Sattel und überlegte, welche Richtung er jetzt einschlagen sollte. Wo würde er hingehen, wenn er ein Büffel wäre? Als Adler würde er immer weiter in den Sonnenuntergang hinein fliegen, versuchen die letzten Strahlen zu erhaschen, aber als Büffel? Wasser wäre schön und hohes, grünes Gras. Er verzog wehmütig die Mundwinkel, ja, als Büffel würde er ein schönes Tal suchen!
Er wandte sich nord-westwärts, folgte dem Lauf eines kleinen Baches. Der Vollmond tauchte das Grasland in ein silbergraues Licht, hell genug, dass er zumindest Umrisse erkennen konnte. Dösend saß er auf dem Pony, hing seinen Gedanken nach, ohne wirklich auf den Weg zu achten. Manchmal stieg er auch ab und ließ das Pony ein wenig grasen. Er hatte es nicht eilig. Bisher waren die Büffel immer gekommen und er verließ sich auf die heiligen Gesänge, die das Büffelvolk herbeiriefen.
In den frühen Morgenstunden wurde es kalt.
Nebel stieg auf und die Feuchtigkeit ließ ihn frösteln. Die Sterne verblassten und in der ersten aufkommenden Morgendämmerung ließ er sein Pony angaloppieren, um wieder warm zu werden. Die Silhouette eines abgestorbenen Baumes zeichnete sich deutlich gegen den blassen Himmel ab, dann schob sich der Rand der Sonnenscheibe über den Horizont und tauchte ihn von einem Moment in den anderen in ein warmes Orange, durchzogen von lila Wolkenstreifen.
Nata-He-Yukan hielt neben dem Baum und hob seine Arme der Sonne entgegen. Leise flüsterte er ein Gebet, bat Wakan-tanka, das große Geheimnis, um Hilfe für seine Aufgabe. Warme Strahlen kitzelten sein Gesicht und er seufzte wohlig. Mit seinen Schenkeln dirigierte er sein Pferd den Hügel hinunter, dann ließ er es scharf angaloppieren, um auf der anderen Seite einen Hang zu erklimmen.
Dahinter schlängelte sich ein klarer Fluss durch ein breites Tal. Zu beiden Seiten des Ufers standen Pappeln und Büsche, die willkommenen Schatten spenden würden. Saftiges Gras, jetzt mit morgendlichem Nebel bedeckt, wuchs in den Niederungen und hob sich deutlich von dem sonst so braunen und verdorrten Steppengras ab.
Wie er es vermutet hatte, weideten in der Nähe die Büffel. Er genoss den Anblick der gewaltigen Tiere, schaute belustigt zu, wie sich riesige Stiere in Schlammkuhlen wälzten und kalumetrote Kälber um ihre Mütter sprangen. Mit einem frohen Grinsen zog er vorsichtig sein Pony zurück, um die Herde nicht aufzuschrecken, und machte sich auf den Rückweg. Bei Tage kam er wesentlich schneller voran und oft ließ er das Pony in einen ausdauernden Trab fallen. Gegen Mittag hörte er von fern den Trommelschlag seines Stammes. Hoka! Also war er der erste! Wakan-tanka war ihm wohl gesonnen! Er schmierte sich Staub in das Gesicht, damit es ein wenig theatralischer wirkte, vergaß auch nicht sein Pferd ordentlich mit Dreck einzuschmieren und sauste im gestreckten Galopp durch das Dorf. „Die Büffel, die Büffel!“, spielte er das Spiel, wie es von jeher von den erfolgreichen Spähern erwartet wurde. Es verfehlte seine Wirkung nicht. Sein verdrecktes Äußeres und die Erschöpfung waren glaubhaft genug und er sonnte sich in der Bewunderung, die ihm von allen Seiten zuteil wurde. Wohlwollende Hände klopften ihm auf die Schulter, freundliche Frauen steckten ihm Leckerbissen zu. Die Ältesten lächelten zufrieden und gaben das Zeichen zum Aufbruch.
In aller Ruhe brachen die Frauen das Lager ab und innerhalb kürzester Zeit bildete sich die Marschordnung. Trotz seiner eher geringen Stellung im Stamm, durfte seine Mutter gleich nach den Ältesten reiten, denn ihr Sohn hatte die Büffel gefunden. Nape-waschte-win genoss es sichtlich. Zum ersten Mal musste sie nicht den Staub des gesamten Lagers schlucken, der aufwirbelte, wenn sich die Pferde mit den beladenen Travois in Bewegung setzten. Nata-He-Yukan hielt seine kleine Schwester vor sich auf dem Pferd und ritt stolz neben dem Häuptling und dem Medizinmann.
„Hast du deine Gebete verrichtet?“, fragte der Medizinmann besorgt, denn die kleinste Missachtung konnte verheerende Folgen haben.
„Ja, beim Sonnenaufgang habe ich gebetet!“, beruhigte ihn Nata-He-Yukan.
„Das ist gut! Und was geschah dann?“
„Hinter dem nächsten Hügel fand ich die Herde!“
„Eh, du siehst, Wakan-tanka belohnt dich gut!“
Sichtlich enttäuscht schlossen am Abend die erfolglosen anderen drei Reiter zu dem Stamm auf. Auch sie hätten sich gern in dem Ansehen gesonnt, als erste die Büffel gefunden zu haben! Nata-He-Yukan bemerkte nicht den Hass, der kurz in den Augen von Bleza-Si aufloderte, als er ihn und seine Mutter an der Spitze reiten sah. Stattdessen begrüßte er vergnügt die anderen Späher, die sicherlich das nächste Mal wieder erfolgreicher sein würden. Nur Bleza-Si verschwand in der Reihe der Travois und ließ seinen Unmut an seiner gefangenen Shoshonefrau aus. „Warum hast du nichts zu essen für mich?“, herrschte er sie an.
Mit einer Routine, wie sie jedem Nomadenvolk zu eigen ist, errichteten die Frauen das Lager für die Nacht. Kochfeuer wurden vor den Tipis entfacht und es summte wie in einem Bienenstock. Männer sprachen über die besten Jagdtaktiken, Frauen beratschlagten, wie man am schnellsten das Fleisch zerteilen konnte, ehe die Hunde über die wertvolle Beute herfielen.
Jungenbanden spitzten ihre Pfeile und hofften, dass viele Kälber übrig blieben, die sie zum Schluss erlegen durften. Denn so ungefährlich war auch das nicht. Die allgemeine Unruhe erfasste sogar die Babys in ihren Wiegen, die ihre Eltern die ganze Nacht hindurch wach hielten.
Am Morgen herrschte hektische Betriebsamkeit. Mit Lendenschürzen bekleidete Krieger bemalten sich mit Schutzzeichen für die Jagd, dann schmückten sie ihre Ponys mit Federn, und bemalten deren Beine mit ebensolchen Zeichen. Das war wichtig, denn wenn ein Pferd stolperte, konnte das tödlich für Pferd und Reiter sein.
Auch Nata-He-Yukan verließ sich ganz gern auf solche Schutzzeichen und kniete geduldig vor seinem Pony, um die Beine mit roten Streifen zu versehen. Was nützen ihm seine Reitkünste, wenn sein Pferd stürzte? Ansonsten kleidete er sich für die Jagd eher spärlich: Lendenschurz und Mokassins, sonst brauchte er nichts. Seine Haare hatte er in einfache Zöpfe geflochten und dick mit Fett eingerieben, damit sich während der Jagd keine Strähnen lösten und ins Gesicht wehten. Auf dem Rücken trug er seinen Köcher mit Pfeilen, in der Hand hielt er locker seinen Bogen. Ansonsten hatte er nur eine Messerscheide am Gürtel. Er war bereit! Schon saß ein Trupp Jäger auf ihren Ponys und mit einem Hochgefühl schloss sich Nata-He-Yukan ihnen an. Büffelvolk, wir kommen!
Unruhe brach unter den braunen Kolossen aus, als sich die Jäger näherten, aber noch dachten sie nicht an Flucht. Erst das schrille Geschrei ließ sie unwillig schnauben und erste Tiere setzten sich langsam in Bewegung. Den Lakota gelang es, einen Keil in die Herde zu treiben und eine kleine Gruppe der Tiere abzuspalten. Jetzt begann die Jagd. Einzelne Jäger hielten ihre Ponys Schulter an Schulter mit den Büffeln, gut gezielte Pfeile fanden den Weg in den empfindlichen Nacken des Tieres. Staub wirbelte auf, wenn so ein Koloss zusammenbrach und der Jäger geistesgegenwärtig sein Pferd zur Seite riss.
Han! Sie waren gute Jäger!
Nata-He-Yukan hatte bereits das dritte Tier erlegt, als er bemerkte, wie seitlich von ihm ein Mann mit seinem Pferd stürzte. Sofort wirbelte er herum, um ihm zu Hilfe zu kommen, doch von der anderen Seite näherte sich bereits Bleza-Si. Beruhigt bemerkte er, wie dieser sicherlich schneller bei dem gestürzten Mann sein würde, und setzte die Jagd fort. Sein Pony zeigte bald die ersten Anzeichen von Erschöpfung. Vielleicht sollte er es wechseln? Aber das andere seiner Pferde hatte längst nicht so viel Erfahrung, und so trieb er seinen Schecken wieder an. Noch ein oder zwei Büffel und er hätte Jagdbeute genug.
In dem aufgewirbelten Staub der fliehenden Herde konnte er fast nichts mehr sehen, nur schemenhaft erkannte er die Umrisse der anderen Jäger. Hier und da tauchte ein Horn auf, dann der schwarze Schwanz eines Pferdes. Irgendwie nahm er nur einzelne Körperteile wahr, manchmal einen Kopf, dann einen Arm, wie dieser den Bogen hob. Diese Jagd war irgendwie unwirklich, fast gespenstisch. Kein Blöken war zu hören, nur das Trommeln tausender Hufe. Er verschoss seine letzten zwei Pfeile und ließ sein Pferd ausgaloppieren. Plötzliche Stille umgab ihn, kein Vogelzwitschern, kein Zirpen, einfach nichts.
Als ob die Natur vor Schreck erstarrt wäre, als die unhaltbare Flut brauner Leiber alles niedertrampelte. Nata-He-Yukan fühlte seinen schnellen Herzschlag in der Brust, spürte das Blut, das in seinen Adern pulsierte. Dankbar klopfte er den schweißnassen Hals seines Ponys und flüsterte beruhigende Worte. Langsam lenkte er es zum Fluss, dann ließ er es durch das klare Wasser plantschen. Durstig tauchte das Pony seine Nase in das kalte Nass und ebenso durstig ließ sich Nata-He-Yukan vom Rücken gleiten, um einige Handvoll zu schöpfen. Er war völlig verschwitzt und in einem Impuls tauchte er mitsamt seinem Lendenschurz unter. Wan, das tat gut! Bei der Hitze würden seine Sachen blitzschnell wieder trocken sein, nur seine Mokassins trieften und er musste sie auswringen, sonst wären sie ihm von den Füßen gerutscht.
Erste Frauen liefen bereits über das Feld, um die gejagten Tier auszunehmen, aber ihn interessierte das nicht sonderlich. Seine Aufgabe war getan, alles andere war jetzt Frauensache.
Überhaupt, sein Magen knurrte und erinnerte ihn daran, dass er seit dem Morgen nichts gegessen hatte. Er schaute sich nach den anderen Jägern um, doch er konnte niemanden sehen. Immer noch war es merkwürdig still, keine Jubelschreie, nichts war zu hören. Seltsam!
Etwas beunruhigt schwang er sich wieder auf sein Pferd und trottete in Richtung Dorf zurück. Eine Mauer finsterer Blicke und eisigen Schweigens empfing ihn. Unsicher drehte er sich um, ob vielleicht irgendwelche Feinde hinter ihm her waren, aber die deutliche Ablehnung galt offensichtlich ihm. Er schluckte schwer und wartete einfach ab. Mehrere Akitschitas, Krieger mit Ordnungsfunktion, kamen drohend auf ihn zu und herrschten ihn an: „Komm mit ins Beratungszelt!“
Er war völlig fassungslos. Was hatte er getan? Ungläubig starrte er auf die Männer, die noch am Morgen seine Freunde gewesen waren. „Warum?“, krächzte er mühsam.
„Du hast Kalter-Stein im Stich gelassen. Die Büffel haben ihn zu Tode getrampelt!“
Nata-He-Yukans Augen schlossen sich vor Entsetzen. Aber Bleza-Si … Eine entsetzliche Ahnung stieg in ihm auf. Hatte er …? Mühsam blinzelte er zu dem Krieger mit der gespaltenen Lippe. Ein hämisches Grinsen huschte kurz über dessen Gesicht, für die anderen nicht zu sehen. Wie gelähmt folgte Nata-He-Yukan den Akitschitas, doch seine Gedanken wirbelten. Was war passiert?
Drohendes Schweigen schlug ihm entgegen, als er in das große Versammlungszelt schlüpfte und ihn beschlich ein unangenehmes Gefühl.
Der Häuptling musterte ihn scharf, seine listigen Augen waren hart, als er mit seiner Hand auf Bleza-Si deutete. „Er beschuldigt dich! Du hast Kalter-Stein im Stich gelassen, hast dich einfach abgewandt, als ein Mann deine Hilfe brauchte!“
Nata-He-Yukan warf Bleza-Si einen kalten Blick zu. Ihm wurde schlecht vor dessen Falschheit. „Ich habe Kalter-Stein nicht im Stich gelassen!“, brachte er mühsam hervor.
Der Häuptling runzelte irritiert die Stirn: „Hast du gesehen, dass Kalter-Stein gestürzt ist?“
Nata-He-Yukan nickte nur und ein empörtes Murmeln war von den anderen zu hören.
„Warum hast du ihm dann nicht geholfen?“
„Ich sah, dass Bleza-Si zu ihm reiten wollte!“, belastete er den anderen Mann. Er erkannte sofort, dass er einen Fehler machte, denn in den ungläubigen Augen der anderen erkannte er, dass sie ihm kein Wort glaubten.
„Bleza-Si konnte ihm nicht helfen, denn ein Büffel hatte sein Pony aufgespießt!“
Bleza-Si trat vor und zeigte anklagend auf den jungen Mann. „Ja, ich wollte Kalter-Stein helfen, aber auch mein Pferd wurde von einem Büffel getötet. Nur mit Müh und Not konnte ich entkommen, aber Kalter-Stein wurde zu Tode getrampelt! Kalter-Stein wurde getötet, weil Nata-He-Yukan sich abgewandt hat!“
Mit gerunzelter Stirn und unsagbar traurig schaute der Häuptling in die Runde, denn die Anschuldigung lastete schwer auf Nata-He-Yukan. Trotzdem richtete er seinen drahtigen Körper auf, strahlte die Autorität eines Anführers aus, der eine schwere Entscheidung fällen musste. „Wer kann etwas dazu sagen?“
Ein anderer Mann erhob sich und alle Augen waren wie gebannt auf ihn gerichtet, als er leise seine Stimme erhob: „Ich habe gesehen, wie Bleza-Si neben seinem toten Pony stand und nach Nata-He-Yukan gerufen hat! Dann kamen die Büffel!“
Ein entsetztes Raunen ging durch die Runde und alle senkten beschämt ihre Augen, vermieden den Blickkontakt mit dem jungen Mann, der bis zu diesem Moment beliebt gewesen war. Nata-He-Yukan blinzelte vor Überraschung, denn das war eine offensichtliche Lüge. Er hatte gesehen, dass das Pony von Bleza-Si unverletzt war, aber dann? „Das Pony war nicht verletzt!“, erklärte er lahm. Wütende Stimmen erhoben sich: „Wir haben das tote Pferd gesehen! Du hast zwei Krieger im Stich gelassen! Du gehörst nicht mehr zu uns!“
Nata-He-Yukans Ohren dröhnten plötzlich, als ihm kalte Abneigung entgegenschlug. Was war hier geschehen?
Der Häuptling senkte betroffen den Kopf und fasste die Anschuldigungen zusammen: „Hast du gesehen, dass Kalter-Stein gestürzt ist?“
Nata-He-Yukan biss die Zähne zusammen. „Ja!“
„Hast du ihm geholfen?“
Es war eine so einfache Frage, aber sie entschied alles. Er hatte als Freund und Gefährte versagt! „Nein“, gestand er leise.
Alles, was er jetzt noch sagte, würde gegen ihn verwendet werden, würde ihn als Feigling dastehen lassen.
Sein Freund Langes-Messer machte eine Bewegung, als wollte er etwas sagen, aber Nata-He-Yukan schüttelte unmerklich den Kopf.
Trotzdem stand der Krieger auf und zeigte mit seinen Lippen auf seinen Freund. „Wir alle kennen Nata-He-Yukan. Er ist ein guter Jäger und ein tapferer Krieger. Wir sollten gut überlegen, was wir nun tun!“
Der Häuptling richtete sich schweren Herzens auf und machte eine auffordernde Handbewegung. „Nata-He-Yukan, warte draußen! Wir werden über deine gerechte Bestrafung beraten!“ Nata-He-Yukans Herz sank in den Staub. Bestrafung! Er wusste, was das bedeutete! Das Blut schoss ihm ins Gesicht, als er vor das Zelt trat und die Umstehenden erblickte. Hilflos suchten seine Augen nach seiner Mutter und Schwester. Was würde aus ihnen werden?
Deutlich waren die Stimmen aus dem Zelt zu hören, aber er versuchte sie zu ignorieren. Bleza-Si! Warum hatte er gelogen? Aufgeregte Rufe erschallten und er hörte, dass seine Freunde versuchten ihn zu verteidigen. Im Stillen dankte er, dass sie für ihn eintraten, doch immer wieder fiel die schneidende Stimme von Bleza-Si dazwischen. „Verräter, Feigling!“, zischte sein Widersacher und andere murmelten beifällig „Aho“. Einen anderen Krieger im Stich zu lassen galt als schlimmstes Vergehen, gleichzusetzen mit Mord! Bewegungslos stand Nata-He-Yukan vor seinem Pferd, sein Blick folgte den Bussarden, die über den getöteten Büffeln schwebten. „Ich bin kein Feigling!“, schrie seine innere Stimme.
Nach einer Ewigkeit traten die Krieger vor das Zelt und einige spuckten ihm verächtlich vor die Füße. Der Häuptling nickte ihm zu und seine Stimme war ernst: „Wir sind Lakota. Wir müssen einander vertrauen und wir müssen füreinander kämpfen. Du hast Kalter-Stein und Bleza-Si im Stich gelassen! So eine Tat schadet unserem Volk. So jemanden können wir nicht mehr bei uns dulden. Deshalb sollst du gehen! Du bist hier nicht mehr willkommen!“
Nata-He-Yukan schluckte schwer, als der Häuptling das aussprach, was er befürchtet hatte. „Meine Mutter und meine Schwester?“, wagte er zu fragen.
„Ihr Zelt und all dein Besitz geht an die Familie von Kalter-Stein! Deine Mutter und deine Schwester werden in einem anderen Zelt leben. Jetzt geh!“
Verbannung! Sie straften ihn mit Verbannung. Das kam einem Todesurteil gleich! Er wusste, was das bedeutete.
Vier Winter durfte er nicht zu seinem Stamm zurückkehren.
„Du bist hier nicht mehr willkommen. Iyaya-yo! Geh!“, wiederholte ein anderer Mann und gab ihm einen Stoß.
Nata-He-Yukan unterdrückte den Impuls zurückzuschlagen und sein Herz wurde schwer. Sein Blick schweifte über die Menschen, die sich demonstrativ umdrehten und ihm die kalte Schulter zeigten.
„Ich werde überleben und wiederkommen!“, drohte Nata-He-Yukan mit vor Wut verzerrter Stimme.
Im Hintergrund wurde das Grinsen von Bleza-Si noch unangenehmer. Noch nie hatte dieser gehört, dass ein einzelner Mann vier Winter allein in der Wildnis überlebt hätte.
Höhnisch leuchteten seine grauen Augen, ein Erbe seines weißen Vaters. Er hatte lange auf diesen Augenblick gewartet, doch nun sah er befriedigt, wie der Sohn des Mannes, der seinen Vater vor Jahren in einem Streit getötet hatte, in die Verbannung geschickt wurde. Endlich war er seinen Rivalen los!
Der Kriegszug
(Montana, nördlich des Missouri)
In vollem Kriegsschmuck brachen gut einhundert Männer der Pecuni auf, eine gewaltige Streitmacht, bereit über die Dörfer der Crow herzufallen. Eine eindrucksvolle Parade marschierte einmal um das Dorf, begleitet von den Hochrufen und den Wünschen der Frauen. So manch eine steckte ihrem Liebsten noch gute Medizin zu, so mancher Rat wurde noch schnell von dem Großvater an den Enkel weitergegeben, dann verschwand der Kriegszug gen Süden.
Tötet-die-Crow ritt neben ihrem Onkel, ein wenig flau im Magen war ihr jetzt doch. Noch nie hatte sie einen Menschen getötet und jetzt war sie auf dem Weg genau dies zu tun. Wie würde es sein, wenn ihre Keule einen Kopf zerschmetterte, ihr Pfeil in einen Körper surrte? Konnte sie jetzt noch zurück?
Nein, denn dann würde sie sicherlich bestraft werden! Niemand verriet seine Vision!
Ihre Anspannung wich schnell einem Gefühl von Langeweile, denn die Jagdgründe der Crow lagen weit entfernt. Tagelang ritten sie gemächlich dahin, ließen den Milch- und den Sonnenfluss hinter sich, zogen dann am Großen Fluss entlang, bis sie eine Stelle fanden, wo sie ihn überqueren konnten. Sie folgten den endlosen Wäldern, manchmal versteckten sie sich, rasteten dann in irgendwelchen Senken, überließen Tötet-die-Crow und einigen Jungen das Wasserholen und Kochen.