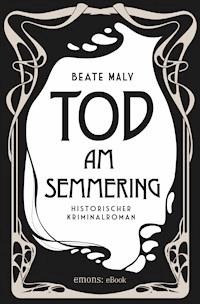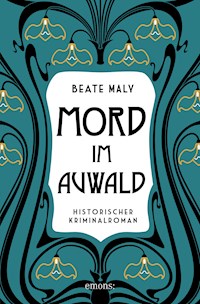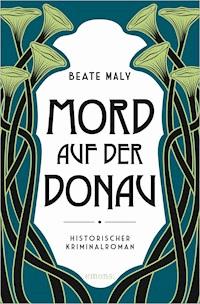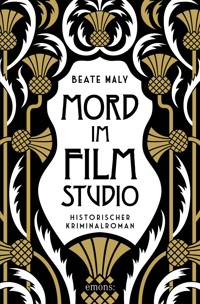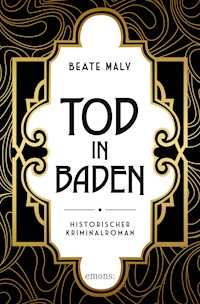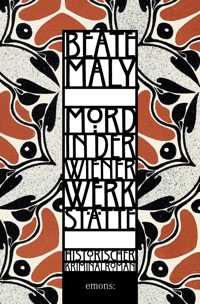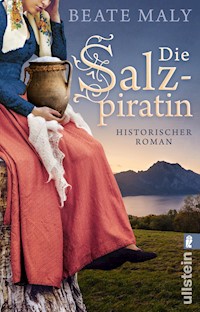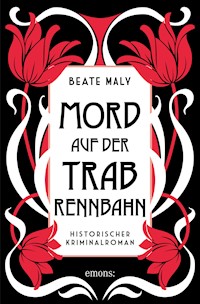8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Wien 1683. Die junge Hebamme Anna und ihre Tante Theresa helfen den Frauen der Stadt bei schwierigen Geburten. Dem Prediger Abraham a Santa Clara ist ihre Arbeit verdächtig: Kann es mit rechten Dingen zugehen, dass sie so oft Mutter und Kind retten können? Ist da Hexenwerk im Spiel? Doch ehe er die Hebammen auf den Scheiterhaufen bringen kann, überfallen die Türken die Stadt. Und es gibt einen Mann, der Anna liebt und die beiden Frauen unbedingt retten will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Hebamme von Wien
BEATE MALY, geboren in Wien, ist Bestsellerautorin zahlreicher Kinderbücher, Krimis und historischer Romane. Ihr Herz schlägt neben Büchern für Frauen, die entgegen aller Widerstände um ihr Glück kämpfen.
Von Beate Maly sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Hebamme von WienDie Hebamme und der GauklerDer Fluch des SündenbuchsDie DonauprinzessinDer Raub der StephanskroneDie SalzpiratinDie KräuterhändlerinFräulein Mozart und der Klang der LiebeDie Frauen von SchönbrunnDie Bildweberin
Wien 1683. Die junge Hebamme Anna und ihre Tante Theresa helfen den Frauen der Stadt bei schwierigen Geburten. Dem Prediger Abraham a Santa Clara ist ihre Arbeit verdächtig: Kann es mit rechten Dingen zugehen, dass sie so oft Mutter und Kind retten können? Ist da Hexenwerk im Spiel? Doch ehe er die Hebammen auf den Scheiterhaufen bringen kann, überfallen die Türken die Stadt. Und es gibt einen Mann, der Anna liebt und die beiden Frauen unbedingt retten will.
Beate Maly
Die Hebamme von Wien
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Dezember 20085. Auflage 2014© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2008Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, MünchenAutorenfoto: © Fabian Kasper E-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-1131-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
NACHWORT
Leseprobe: Die Bildweberin
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
1
Jänner 1683
DIE FENSTERLÄDEN KLAPPERTEN, und die neuen, sündhaft teuren Glasscheiben vibrierten bedrohlich in ihren massiven Bleirahmen. Warum setzten Stürme oft so unerwartet ein? Noch vor wenigen Stunden war der Himmel wolkenlos und sternenklar gewesen, nichts hatte auf das kommende Unwetter hingedeutet. Hoffentlich hielten die Scheiben dem Schneesturm stand. Anna hatte vergangenen Sommer darauf bestanden, die grünen Butzengläser, von denen man wusste, dass sie robust genug waren, um Schnee, Eis und Wind zu trotzen, gegen diese hellen, zerbrechlich wirkenden Fensterscheiben einzutauschen. Jetzt lag sie wach in ihrem Bett und warf ängstliche Blicke in die Dunkelheit, als könnte sie auf diese Weise das kostbare Material vor dem Zerbrechen bewahren. Eine neue Sturmböe warf sich mit aller Gewalt gegen das Fenster. Anna begann zu zittern. Das hatte sie wieder einmal von ihrem Starrsinn. Warum hatte sie sich auch unbedingt gegen den Willen ihrer Tante durchsetzen müssen?
Ein dunkler Körper plumpste auf ihre Decke und schlich sich schnurrend in Richtung Kopfkissen. »Du mochtest die Butzengläser, nicht wahr?« Die schwarze Katze streckte sich behaglich aus, scheinbar völlig unbeeindruckt von dem Unwetter. »Du denkst, es geschieht mir ganz recht, wenn ich jetzt nicht schlafen kann?« Die Katze stieß mit ihrem rabenschwarzen Kopf gegen Annas Hand, die ganz automatisch mit dem Streicheln begann. »Du hast ja recht, das grüne Waldglas war praktisch, aber es machte das Zimmer so dunkel. Und du weißt, wie sehr ich die Dunkelheit hasse.« Die Katze schnurrte zustimmend.
Plötzlich mischte sich in den Lärm des Sturms noch ein weiteres Geräusch. Jemand pochte wie wild gegen die Haustür. Oder war es doch das Geräusch zerbrechenden Glases? Anna setzte sich auf. Nein, es bestand kein Zweifel, das Klopfen kam eindeutig von unten, und es waren die ungeduldigen Fäuste eines Menschen. Bekam etwa die Goldschmiedin schon ihr Kind? Es wäre um vier Wochen zu früh. Blitzschnell sprang die Katze vom Bett und schlüpfte zur Tür hinaus.
Ein weiteres Geräusch drang herauf, die Stimme ihrer Tante Theresa. »Ist ja gut, ich komme schon!«, rief ihre Tante. Offenbar hatte der Lärm sie geweckt, und nun kletterte sie die enge Holztreppe hinunter. Anna schlüpfte ebenfalls aus dem Bett, wickelte sich die Decke um die Schultern und hockte sich auf den oberen Treppenabsatz. Ja, sie war eine fürchterlich neugierige Person. Sie wusste das, sah sich aber außerstande, daran etwas zu ändern. Anna beobachtete ihre Tante, die an der letzten Glut im Ofen eine Kerze entzündete.
Das Pochen war noch so heftig wie zuvor. »Ich komme schon!«, rief die alte Frau jetzt ungehalten. Kraftvoll schob sie den schweren Riegel zurück und öffnete die Haustür. Ein heftiger Windstoß, gefolgt von feinen Schneeflocken, riss ihr die Tür aus der Hand, eiskalte Luft fegte ins Haus und ließ die massige Holztür gegen die Hausmauer krachen.
Augenblicklich schob sich ein hagerer Junge herein. Er war in einen viel zu dünnen Mantel gehüllt, der ihm sicher seit Jahren zu klein war. Seine schlaksigen Arme und Beine waren damit nur notdürftig vor der Kälte geschützt, die nackte Haut, die hervorlugte, war blaugefroren. Theresa versuchte, die Tür wieder zu schließen, was wegen des Windes gar nicht so einfach war. Sie kannte den Jungen vom Sehen, hatte aber keine Ahnung, was er von ihr wollte.
»Die Hafnerin liegt in den Wehen und braucht Eure Hilfe!«, keuchte der Bursche, dabei trat er von einem Fuß auf den anderen, rieb seine eisigen Finger gegeneinander, formte zwei hohle Fäuste und blies hinein, um etwas Wärme in seine Glieder zu bringen.
»Die Hafnerin?«, fragte Theresa erstaunt. »Die Hafnerin wird doch von Gudrun betreut. Sie hat ihr schon bei den ersten fünf Kindern beigestanden. Du hast die falschen Hebammen aus dem Schlaf gerissen!« Verärgert wandte Theresa sich wieder zur Tür und wollte sie öffnen, um den Jungen auf die Straße hinauszuschieben.
»Halt!«, rief dieser und drängte zurück in die Stube. »Die Hebamme ist schon seit gestern bei der Meisterin, aber sie kann ihr nicht helfen. Der Meister hat mich geschickt, denn der Bäckermeister Wandel behauptet, Ihr seid die Einzigen, die Mutter und Kind noch retten können.«
Theresa zog die Augenbrauen finster zusammen. »Wollt Ihr uns Hebammen gegeneinander ausspielen? Meine Nichte und ich können auch nicht mehr machen, als Gudrun bereits tut. Der gute Wandel soll den Teig für seine Semmeln gewissenhaft abwiegen und uns Hebammen in Ruhe arbeiten lassen. Und jetzt verschwinde und richte deinem Meister einen schönen Gruß von mir aus!«
»Ich darf nicht ohne Euch zurückkommen!«, rief der Junge. In seiner Stimme lag Verzweiflung. »Der Meister würde mich sofort wieder herschicken, und dann verbringe ich die ganze Nacht in der eisigen Kälte auf der Straße. Gudrun hat gesagt, die Hafnerin und ihr Kind werden sterben, weil seit Stunden nichts weitergeht. Das Kind steckt fest. Bitte kommt mit!«
»Gudrun ist eine erfahrene Hebamme, sie weiß, was sie tut. Bestimmt unternimmt sie alles, was möglich ist.« Theresas Gesicht nahm einen drohenden Ausdruck an. »Und jetzt lass uns endlich weiterschlafen.«
Der Junge überlegte panisch, wie er die Hebamme dazu bewegen könnte, ihn zu begleiten, doch es fiel ihm nichts Rechtes ein. Egal, was in dieser Nacht geschah, sein Lehrherr würde auch ihm die Schuld daran geben.
Währenddessen wurde es Anna auf den kalten Stufen immer unbequemer. Sie hielt es auf ihrem heimlichen Lauschposten nicht mehr aus und schlich, beinahe so geräuschlos wie die schwarze Katze, die Treppe hinunter. Selbst die alte, knarrende Holztreppe schwieg unter ihren nackten Füßen, die sich mittlerweile wie Eisklumpen anfühlten.
»Ist die Hafnerin bei Bewusstsein?«, fragte sie und ließ damit Theresa und den Jungen gleichzeitig zusammenfahren. Der Junge sah Anna an, als wäre sie ein Gespenst, das aus den Wänden dieses kleinen Hauses gestiegen war, um unschuldige Lehrlinge zu erschrecken.
Nach einem kurzen Augenblick der Überraschung fuhr Theresa ihre Nichte verärgert an: »Was machst du hier unten?« Anna lächelte. »Wie soll man schlafen, wenn du den armen Jungen so anschreist.«
»Ich schreie nicht«, sagte Theresa betont leise und sichtlich beleidigt. »Du hast schon wieder keine Schuhe an und wirst dir den Tod holen. Wir sind ohnehin fertig. Der Bursche geht wieder.« Manchmal sprach Theresa mit Anna wie mit einem kleinen Kind. Dabei war sie mit ihren dreiundzwanzig Jahren schon lange erwachsen und seit vier Jahren eine ehrbare Witwe.
»Vielleicht können wir Gudrun unterstützen und der Hafnerin helfen«, sagte sie in vorsichtigem Ton, um ihre Tante nicht noch mehr zu verstimmen. Die Sache mit den Schuhen ignorierte sie.
»Zu viele Köche verderben den Brei, und zu viele Hebammen bringen einander auf den Scheiterhaufen«, zischte Theresa.
Anna machte einen Schritt auf ihre Tante zu, nahm sie beim Arm und zog sie zur Seite. »Denkst du nicht, dass wir die Pflicht haben, es zu versuchen?«, flüsterte sie so leise, dass nur Theresa sie verstehen konnte.
Ein verächtliches Schnaufen war die Antwort. »Wenn ich das Wort Pflicht nur höre, kommt mir schon das Abendessen hoch!«
Neue Hoffnung schöpfend, machte der Junge einen weiteren Schritt in die Stube, um nur ja nicht wieder auf die Straße geschoben zu werden.
»Ich finde, wir müssen es probieren.« Anna warf ihrer Tante einen vielsagenden Blick zu, den nur sie verstehen konnte.
Die Hände in die Hüften gestemmt, richtete Theresa sich auf. Die Jahre hatten ihrer Figur nicht viel anhaben können, sie war nach wie vor groß und schlank. Bloß das allmählich ergrauende Haar und zahlreiche Fältchen im Gesicht verrieten ihr Alter.
»Willst du mir vorschreiben, was ich zu tun habe?«
»Das würde ich niemals wagen.« Etwas in Annas Stimme deutete darauf hin, dass sie ihre Antwort nicht ganz ernst meinte. Ausdruckslos hielt sie dem ärgerlichen Blick der Tante stand.
»Man übernimmt keine Geburt, bei der eine andere Hebamme schon ihre Hände im Spiel hatte«, erklärte Theresa. Anna wusste, wie groß die Gefahr war, die Schuld für eine Totgeburt zugeschoben zu bekommen, und wie leicht ihr Berufsstand in Verruf geraten konnte. Erst vorige Woche hatte man in Wiener Neustadt eine Hebamme vor den Richter gebracht, weil die Frau eines angesehenen Bürgers bei der Geburt gestorben war.
Schließlich seufzte Theresa laut und sagte in resigniertem Tonfall: »Meinetwegen. Sehen wir uns die Hafnerin an.«
Der Junge verstand nicht, was hier eben vorgefallen war, aber er machte sich auch nicht die Mühe, länger darüber nachzudenken. Vielleicht hatte sein Lehrherr ja recht mit der Behauptung, dass Denken nicht seine Stärke war. Erleichtert machte sich der Bursche mit der guten Nachricht, die Hebamme komme gleich, auf den beschwerlichen Weg zurück zum Hafnersteig.
Nachdem Anna sich ihr dunkelblaues Wollkleid angezogen hatte, ging sie in die Küche. Auf der Treppe band sie ihre roten Locken zu einem Zopf zusammen und schüttelte sie nachlässig zu einer halbwegs ansehnlichen Frisur. Manchmal hatte sie den Eindruck, dass es egal war, wie viel Mühe sie sich mit dem Frisieren gab. Innerhalb kürzester Zeit machten die Locken ohnehin, was sie wollten.
In der Küche trat sie zu der schweren, dunklen Truhe aus Nussholz, die meist unbeachtet in einer Ecke stand. Zuerst nahm sie einen Kerzenleuchter, der erschreckend staubig war, und einen Korb voll Nüsse von der Truhe und stellte beides auf den Boden. Dann hob sie den schweren Deckel und fing an, allerlei Küchengerät herauszuräumen und ebenfalls auf den Holzfußboden zu legen. Schließlich lockerte sie vorsichtig den doppelten Boden der Truhe. Behutsam holte sie einen dicken Samtsack heraus. Auch er war staubig.
Wie um alles in der Welt gelangte der Staub in die geschlossene Truhe? Das Möbelstück hatte außer dem Deckel, der nur selten angehoben wurde, keinerlei Öffnung. Anna hielt kurz inne und überlegte.
»Was immer gerade in deinem Kopf vorgeht, es hat sicher nichts mit der Hafnerin zu tun«, sagte Theresa ernst. Trotz des spärlichen Lichts im Raum sah Anna das Funkeln in ihren klaren, hellgrünen Augen. Annas Augen waren so ganz anders: dunkelgrün und unergründlich wie ein Teich an einem trüben Herbsttag.
»Liebste Tante, du weißt, dass die Kirche es nicht gerne sieht, wenn Frauen sich im Gedankenlesen versuchen.«
Theresa schüttelte den Kopf. »Die Kirche sieht auch den Inhalt dieses Sackes nicht gerne. Dennoch müssen wir die Zange gründlich reinigen, sie liegt schon seit Monaten unbenutzt in der Truhe.« Anna nickte. Niemand außer ihnen beiden durfte dieses Gerät sehen. Allein der Besitz der Zange konnte für die beiden Hebammen den Tod bedeuten.
Ihr Erfinder, der Engländer Peter Chamberlen, hatte vor einigen Jahren aus Paris flüchten müssen, weil eine Frau nach drei Tagen Wehen auch mit seiner Zange nicht hatte gerettet werden können. Jetzt war der Gebrauch der Geburtszange in ganz Europa verboten. Nur in England verwendete Chamberlen sie weiter mit Erfolg, hütete sich aber, sein Geheimnis preiszugeben. Theresa gehörte zu den wenigen Hebammen, die von der Zange wussten. Sie hatte bei einer Hebamme in Augsburg gelernt, die im Besitz einer solchen Zange gewesen war. Brunhilde hatte Theresa beigebracht, wie man bei schwierigen Geburten die Gebärenden mit Chamberlens Erfindung unterstützen konnte.
»Die Zange ist Segen und Fluch zugleich«, stöhnte Theresa, während Anna einen Topf mit Wasser am Herd zum Kochen brachte und sie selbst Kräuter, Nadeln, Fläschchen und Tücher zusammenpackte. »Sie kann Leben retten und uns Hebammen für den Versuch, Leben zu retten, auf den Scheiterhaufen bringen.« Voll Bitterkeit dachte sie an Brunhilde, deren Leben auf so sinnlose und barbarische Weise beendet worden war. Während sich die schrecklichen Bilder aus der Vergangenheit in ihrem Kopf drehten, sah sie Anna dabei zu, wie sie ein sauberes Tuch holte, um damit die Zange zu säubern.
»Manche der anderen Hebammen ahnen, dass wir die Zange haben und benutzen. Wüssten sie es mit Sicherheit, würden sie entweder alles tun, um ebenfalls in den Besitz der Zange zu gelangen, was eine gute Sache wäre, oder sie würden alles daran setzen, uns vor den Stadtrichter zu bringen. Und das hätte schlimme Folgen für uns.« Theresa spuckte die letzten Worte regelrecht aus. Sie dachte an einen ganz bestimmten Prediger, dem sie seit Jahren ein Dorn im Auge war. Anna ahnte nichts davon, doch auch sie zweifelte nicht an der Aussage der Tante. Es gab viele Neider auf dieser Welt, auch unter den Hebammen.
»Das reicht, pack die Zange ein.«
Anna wickelte das Gerät in ein frisches Tuch, das sie zu einem Päckchen zusammenschlug. Theresa nahm ihr das kostbare Bündel so vorsichtig ab, als handelte es sich um ein Neugeborenes, und verstaute es in ihrem Korb, wo bereits eine Reihe anderer Hilfsmittel lagen.
»Falls die Hafnerin trotzdem stirbt, wird Gudrun versuchen, uns die Schuld zuzuschieben?«, fragte Anna, plötzlich gar nicht mehr so sicher, eine kluge Entscheidung getroffen zu haben.
»Kann sein. Ich kenne Gudrun nicht so gut wie andere Hebammen.«
Anna hielt ihre Tante kurz am Arm fest. »Du wärst auch gegangen, wenn ich nichts gesagt hätte. Habe ich recht?«
»Lass uns jetzt endlich gehen, die Sache ist längst entschieden.« Theresa trat hinter Anna auf die Straße, weshalb diese ihren amüsierten Gesichtsausdruck nicht sehen konnte. Immer häufiger ertappte sie sich dabei, dass sie in Anna die Tochter sah, die das Leben ihr vorenthalten hatte. Dabei hatte Theresa mit Annas Mutter Hermine nie das Band einer schwesterlichen Liebe verbunden. Im Gegenteil: Ihr Verhältnis zueinander war geprägt von gegenseitigem Unverständnis, Gleichgültigkeit und sogar Gefühlskälte. Später hatte eine unglückliche Verkettung von Zufällen das Verhältnis völlig zerstört.
Vom Tag ihrer Geburt an war Theresa unter den Ihren eine Außenseiterin gewesen, die dritte Tochter in einer Familie ohne Sohn. Während die Mutter sie sehr geliebt hatte, war sie vom Vater und den beiden Schwestern missachtet worden. Nachdem der Vater, ein wohlhabender Kaufmann, die ersten beiden Töchter mit großzügiger Mitgift ausgestattet hatte, war bei Theresa das Geld knapp geworden, aber für sie war ohnehin das Kloster vorgesehen. Kurz vor dem bevorstehenden Klostereintritt, gegen den Theresa sich heftig gewehrt hatte, war die geliebte Mutter gestorben. Theresa hatte nur einen Ausweg gesehen: ihre Sachen zu packen und davonzulaufen. In Augsburg hatte sie dann Brunhilde getroffen, eine alte, erfahrene Hebamme, die sie bei sich aufgenommen und das Handwerk einer Hebamme gelehrt hatte.
Bei ihrer Rückkehr nach Wien vor fünf Jahren war Theresa zum ersten Mal Anna begegnet. Die Nichte hatte eines Tages vor ihrer Tür gestanden. Im Schlepptau hatte sie einen Notar, der ihr half, den Nachlass der Familie zu regeln. Die große Pest hatte alle Familienmitglieder bis auf Anna und Theresa ausgelöscht, auch Annas Gemahl, mit dem diese eine unglückliche Ehe geführt hatte.
Schon nach dem ersten Treffen war Anna klar gewesen, dass Theresa ihr einen Weg in eine unabhängige Zukunft bieten konnte. Die Erfahrungen, die sie während ihrer ersten Ehe gemacht hatte, reichten für ein Leben. Nachdem alle Schulden beglichen und die Gläubiger ausbezahlt waren, war den beiden Frauen ein hübsches Häuschen mit Garten mitten in Wien, in der Tuchlauben, geblieben. Sie hatten sich die Frage nach dem Verkauf nie gestellt und waren gemeinsam eingezogen. Seither ging Anna bei ihrer Tante in die Lehre, um einen Beruf zu erlernen, der ihr eine weitere Ehe ersparte.
Die Hebammen brauchten für den Weg zum Hafnersteig länger, als sie erwartet hatten. Der Schneesturm war heftiger geworden und hatte kniehohe Schneeverwehungen aufgehäuft, die das Weiterkommen beschwerlich machten. Vom Komfort der gepflasterten Straßen Wiens war in dieser Nacht nicht viel zu merken, denn durch den Schnee waren selbst diese Wege beinahe unpassierbar geworden.
Anna steckte ihre Hände unter den Umhang und wickelte sie gegen die Kälte ein. Dennoch hatte sie Angst, die Finger könnten taub werden. Ihre Hände waren ihr wichtigstes Instrument. Anna hatte rasch begriffen, dass sie es schützen musste, denn ohne Hände war eine Hebamme hilflos.
Sehen konnte sie nicht viel, der Wind hatte die ohnehin nur spärliche Straßenbeleuchtung ausgeblasen. Ein unverkennbares Geräusch zeigte den Frauen an, dass sie endlich am Ziel waren. Es war das Kratzen von gebranntem Ton, der an einer Hausmauer rieb. Von früheren Besuchen wussten sie, dass über der Eingangstür eine kunstvoll gearbeitete Tonscheibe hing, auf der drei bunte Tontöpfe aufgemalt waren, und an ihr rüttelte der Sturm jetzt bedrohlich. Anna dachte erneut sorgenvoll an ihre gläsernen Scheiben.
Noch bevor eine der Hebammen an die Tür klopfen konnte, wurde diese geöffnet. Offenbar hatte Meister Krüger hinter dem Fenster auf die beiden gewartet. »Ich danke Euch, dass Ihr gekommen seid.«
Der Hafner war ein großer, kräftiger Mann, mit riesigen Händen und ebenso großen Füßen. In seinem kleinen Haus wirkte er irgendwie unpassend, wie ein ungelenker Riese in einem winzigen, verwinkelten Zwergenbau. Ob sein krummer Rücken daher rührte, dass er seinen völlig kahlen Kopf immer etwas gebeugt halten musste, damit er nicht an die Decke stieß?
Theresa nickte bloß, und der Hafner führte die beiden Frauen rasch durch seine Werkstatt. Hier standen Regale, die über und über mit Tongefäßen in allen nur erdenklichen Größen und Formen gefüllt waren. In einer kleinen Nische neben der Hintertür, die in den Hof führte, stand die Töpferscheibe, das wichtigste Werkzeug des Hafners. Direkt vor der Töpferscheibe befand sich ein außergewöhnlich großes Fenster, das für genügend Licht bei der Arbeit sorgte.
»Meine Frau liegt in der Schlafkammer«, sagte Meister Krüger. Kaum hörbar fügte er hinzu: »Der Priester ist bei ihr.« Er stieg die schmale Holztreppe hinauf ins erste Stockwerk, wo es so eng war, dass der Eindruck von einem Riesen unter Zwergen noch verstärkt wurde. Unter der Treppe führte eine Tür in die Küche, aus der man leise, verhaltene Kinderstimmen hörte. Sie war angelehnt, die Tür zur Schlafkammer hingegen stand offen. Auf einem hohen Holzbett hinter dicken Vorhängen lag wimmernd und zusammengekrümmt die Hafnerin. Neben ihrem Bett saß ein Geistlicher in der Ordenstracht der Franziskaner. Anna erkannte ihn sofort. Es war Pater Anselm, ihr Beichtvater und Leiter des kleinen Hospitals im Franziskanerkloster.
Als er die beiden Hebammen sah, erhob er sich und kam ihnen lächelnd entgegen. Er war trotz seines hohen Alters ein großer, hagerer Mann mit einem schmalen Gesicht und gütigen Augen. Anna konnte sich keinen besseren Beichtvater vorstellen. Zu keinem anderen Mann der Kirche hatte sie so viel Vertrauen.
»Gut, dass Ihr gekommen seid«, sagte er und ergriff mit seinen schlanken, kräftigen Fingern zuerst Annas, dann Theresas Hand.
»Seit wann versucht Ihr Euch in der Geburtshilfe?«, fragte Theresa, bereute angesichts des Ernstes der Lage jedoch augenblicklich ihre spöttische Bemerkung. Sie sah sich suchend um: »Wo ist Gudrun?«
»Ich habe sie aus dem Haus gejagt«, brummte der Hafner grimmig. Er stand hinter Theresa. »Sie wollte einen Arzt holen, damit er meine Frau aufschneidet, sobald sie tot ist. Ich habe stattdessen nach Pater Anselm gerufen. Mit Gottes Hilfe und Eurem Wissen wird meine Frau überleben. Sie ist seit zwei Stunden immer wieder ohne Bewusstsein.« Bei den letzten Worten traten Tränen des Zorns und der Trauer in die Augen des großen Mannes.
»Und wenn Gott andere Pläne hat und auch wir ihr nicht helfen können, jagt Ihr uns dann ebenfalls weg oder hetzt uns gar den Stadtrichter auf den Hals?«, wollte Theresa wissen.
Währenddessen war Anna zum Bett der Hafnerin getreten, hatte energisch die Vorhänge weggezogen und die schlaffe Hand der gebärenden Frau ergriffen. Meister Krügers Blick folgte zuerst Anna, dann blieb er auf seiner Frau hängen, die erschöpft und blass auf dem Bett lag. Die Sorgen und Ängste des Hafners waren unübersehbar, und seine Verzweiflung rührte Anna.
Meister Krüger murmelte fast tonlos: »Ich will, dass meine Frau am Leben bleibt. Ich habe drei gesunde Kinder, zwei hat Gott von der Pest holen lassen, natürlich freue ich mich über ein viertes, aber ich will vor allem meine Frau behalten.« Der Hafner warf einen verzweifelten Blick zum Bett. »Ich will nicht wissen, wie Ihr es macht oder womit Ihr meine Frau rettet, aber bitte rettet sie.«
Pater Anselm, der sich leise in den dunklen hinteren Teil der Kammer zurückgezogen hatte, trat nun wieder in den Schein der Kerzen und meinte leise: »Meister Krüger, gebt acht! Das sind gefährliche Worte.«
Theresa klang weitaus weniger gedämpft: »Wir tun nichts anderes, als alle anderen Hebammen auch tun würden, und falls Ihr daran Zweifel habt, verlassen wir augenblicklich Euer Haus.« Obwohl Theresa eine große Frau war, reichte sie dem Hafner gerade bis zur Schulter.
»Jedes Wort über besondere Hilfsmittel oder außerordentliche Fähigkeiten ist gelogen und bringt mich und meine Nichte auf den Scheiterhaufen. Ich hoffe, dass dies auch dem Bäckermeister Wandel klar ist.«
Der Hafner nickte betroffen und meinte mit brüchiger Stimme: »Der Bäckermeister hat nur die allerbesten Dinge von Euch und Eurer Nichte erzählt. Bitte rettet meine Frau.« Als er sich umdrehte, um die Kammer zu verlassen, hielt Theresa ihn zurück: »Egal, was Ihr in den nächsten Stunden hören werdet, ich will nicht, dass Ihr hereinkommt. Aufgeregte, ängstliche Gesichter können wir im Moment nicht brauchen. Kommt erst, wenn Anna oder ich Euch rufen.«
Er wirkte verwundert, nickte aber nur schweigend.
»Eure Magd soll uns zwei Eimer voll heißem Wasser bringen und dann ebenfalls unten warten.«
»Zwei Eimer heißes Wasser«, wiederholte der Hafner, um irgendetwas zu sagen, und ging in die Küche, wo seine drei gesunden Kinder, der Lehrjunge und eine Magd eng gedrängt beim Tisch saßen und warteten, dass der Kampf endlich ausgestanden war. Pater Anselms hagere Gestalt folgte ihm, er zog die Tür leise hinter sich zu und murmelte: »Ich bin in der Küche, falls Ihr mich braucht.«
Theresa nickte ihm zu und trat neben Anna. Die Hafnerin war nicht ohnmächtig, wie der Lehrjunge behauptet hatte. Sie war in einen Erschöpfungsschlaf gefallen, während die Wehen ausgesetzt hatten. Theresa fühlte den Puls der geplagten Frau, tastete den Bauch ab, horchte auf die Geräusche des ungeborenen Kindes und untersuchte den Schoß der Gebärenden.
»Der Puls ist schwach, aber das Kind lebt«, sagte sie dann. »Wir müssen die Hafnerin aufwecken, die Wehen wieder beschleunigen und dann das Kind so rasch wie möglich holen. Aus irgendeinem Grund ist diesmal der Geburtskanal zu eng, die Wehen reichen nicht aus. Vielleicht hat das Kind einen größeren Kopf als die anderen fünf Kinder, auf alle Fälle steckt das arme Würmchen fest.«
»Hast du bemerkt, wie riesig der Hafner ist?«
Theresa verzog das Gesicht: »Es war nicht zu übersehen.«
»Und sieh nur, wie klein und zart seine Frau ist. Wenn das Kind nach seinem Vater gerät, muss es doch viel zu groß für die arme Frau sein. So als wollte ein Rind einen Elefanten zur Welt bringen.«
»Sie hat schon fünf Kinder von diesem Mann zur Welt gebracht. Aber du hast recht, vielleicht ist dieses Kind größer.« Theresa kniff die Augen zusammen. »Egal, lass uns beginnen.«
»Blauer Hahnenfuß?«, fragte Anna.
Theresa überlegte kurz: »Ja, aber misch ihn mit schwarzer Schlangenwurzel, damit die Wehen regelmäßig kommen!«
Während Anna die Tinktur mischte, versuchte Theresa, der Hafnerin ein kreislaufstärkendes Mittel zu verabreichen, damit sie wieder zu sich kam und mitarbeiten konnte. Riechsalz, ein kräftiger Ingwertee und aufrechte Position halfen, die Gebärende zu wecken. Anna war nicht sicher, ob die Frau tatsächlich bei Bewusstsein war. Die grauen Haare hingen ihr schweißverklebt in leere, teilnahmslose Augen. Anna tropfte ihr die Flüssigkeit auf die Zunge.
»Wenn die Medizin wirkt, werden die Wehen wieder einsetzen.« Angstvoll schüttelte die Hafnerin den Kopf. Sie hörte also doch, was man zu ihr sagte.
»Wenn die Schmerzen zu groß werden, geben wir Euch etwas dagegen.«
Die Worte, die von den aufgesprungenen, blutigen Lippen der Hafnerin kamen, waren so leise, dass Anna sie bloß erahnen konnte: »Mein ganzer Leib ist ein einziger Schmerz«. Anna betupfte die Lippen mit selbstgemischter Ringelblumensalbe und bereitete anschließend ein Schmerzmittel vor. Dafür mischte sie Wacholder, Kamille, Beifuß, Arnika mit einer winzigen Spur der Mohnpaste.
Ein Klopfen an der Tür ließ sie hochschrecken. »Das wird die Magd mit dem Wasser sein. Soll ich sie bitten, in der Küche Gundelrebe und Fenchel für warme Leibwickel zu kochen?« Theresa schüttelte den Kopf: »Dazu ist keine Zeit mehr, der Hahnenfuß wirkt.«
Anna nahm der Magd die Eimer mit dem Wasser ab, doch kaum hatte sie die Tür wieder geschlossen, setzten plötzlich und mit unerwarteter Heftigkeit die Wehen wieder ein. Eine Schmerzwelle überrollte die Frau und ließ sie laut aufschreien, niemand hätte ihr diese Lautstärke noch zugetraut.
»Wer so schreien kann, kann auch pressen«, sagte Theresa und tätschelte die eiskalte, verschwitzte Hand. Kurz hatte es den Anschein, als würde die Hafnerin tatsächlich das Bewusstsein verlieren, sie rollte die Augen nach oben. »Maria Krüger, Ihr dürft nicht einschlafen, Ihr müsst mithelfen.«
Der Kopf des Kindes war bereits zu ertasten, aber als die nächste Wehe den Körper der Frau durchzuckte, bewegte sich das Kind kein Stück vorwärts. Allein mit den Wehen würde es unmöglich sein, es aus dieser Position zu befreien. Anna und Theresa sahen einander schweigend an. Beide wussten, was zu tun war.
»Wir müssen sie auf den Rücken legen«, sagte Theresa. Anna reagierte sofort, hob den Kopf der Hafnerin an, die fast teilnahmslos alles mit sich geschehen ließ, und zog die Kissen unter ihr weg, damit sie flach auf dem Bett lag. Im nächsten Moment krampfte sich ihr Körper erneut zusammen, und auf ihrer Stirn bildeten sich winzige Schweißtropfen. Ihre Gesichtsfarbe glich dem weißen Leintuch, auf dem sie lag.
Anna ging zur Tür, öffnete sie einen Spalt und versicherte sich, dass niemand vor der Kammer stand. Der Gang lag völlig im Dunkeln, die Tür zur Küche war verschlossen. Erst als Anna sie wieder zugezogen hatte, holte sie die Zange aus dem Korb. Theresa machte in der Zwischenzeit den Geburtskanal der Hafnerin mit Rosenöl geschmeidig. Die letzten zwei heftigen Wehen hatten das Kind kein Stückchen weiter nach unten rutschen lassen. Anna flößte der Frau das Schmerzmittel ein und stellte sich so hin, dass die Gebärende die Zange nicht sehen konnte. Mit klopfendem Herzen, aber ohne zu zögern, führte Theresa die Zange ein.
Wieder einmal ärgerte sie sich über deren plumpe Verarbeitung. Wie gern hätte sie jetzt Brunhildes feingeschmiedetes Werkzeug gehabt, das dem Hexenwahn zum Opfer gefallen war. Dennoch bahnte sich Theresa mit der Zange so geschickt einen Weg zum Kopf des Kindes, als verfügte sie über eine verlängerte Hand. Es war gut, dass die Hafnerin schon fünf Kinder zur Welt gebracht hatte und so der Geburtskanal breiter war als bei Erstgebärenden. Theresa fasste das Köpfchen seitlich über den Schläfen, genau wie es sein sollte.
»Jetzt kräftig pressen«, sagte Theresa, als sie die nächste Wehe kommen spürte. Anna begann zur Unterstützung einen tiefen Ton zu summen. Die Hafnerin tat es ihr nach und presste, so gut es ging. Das Kind setzte sich tatsächlich in Bewegung. Theresa zog vorsichtig, aber im nächsten Moment war die Wehe vorüber und das Kind steckte wieder fest. Ein Wimmern und Stöhnen der Hafnerin folgte.
»Bei der nächsten Wehe wieder pressen, Ihr macht das ganz großartig«, sagte Theresa. Anna wischte mit einem kühlen Tuch über die schweißbedeckte Stirn der überanstrengten Frau. Die nächste Wehe setzte ein, Anna brummte wieder, aber diesmal gelang es der Hafnerin nicht, sich mitreißen zu lassen. Theresa zog etwas fester als beim ersten Mal, und kurz darauf kam der Kopf mit einer schnellen Bewegung bis an die Scheide. »Gleich ist es überstanden. Nicht aufgeben. Immer schön tief einatmen. Nächste Woche werden alle Eure Freunde und Verwandte kommen, beladen mit Honigkuchen und Schmalzbroten, und sich über das neue Menschenkind freuen.«
Die nächste Wehe ließ nicht lange auf sich warten. Theresa lockerte mit einer Hand den Griff der Zange, während sie mit der anderen den Kopf ertastete. Dann ließ sie die Zange los, und diese fiel mit lautem Klirren zu Boden. Die Hafnerin öffnete kurz die Augen, schloss sie aber gleich wieder.
»Bei der nächsten Wehe ist das Kind da«, sagte Theresa, um die Hafnerin von dem Metallgeräusch abzulenken. Anna reagierte blitzschnell und schob mit dem linken Fuß die Zange unter ihren Rock. Als sie wieder aufsah, setzte die nächste Wehe ein. Sie war kurz, fast nur noch ein Zucken. Theresa zog an den Schultern des Kindes und hielt kurz darauf ein Neugeborenes in den Händen.
Anna betrachtete es ungläubig. Es war ein riesiger dunkelrot-blauer Junge mit einer Unzahl von langen schwarzen Haaren auf seinem großen Kopf. Wie klug von dir, Kind, dachte Anna, so sind die Spuren der Zange schön verdeckt. Theresa dachte offenbar an das Gleiche, denn sie kontrollierte sofort den Kopf des Neugeborenen. Wie durch ein Wunder hatten die Löffel der Zange kaum Spuren hinterlassen.
»Ihr habt einen ungewöhnlich großen, gesunden Jungen«, sagte Theresa und legte das blutige Bündel Mensch auf den Bauch der Hafnerin. Der Mund der Mutter verzog sich zu einem glücklichen Lächeln, doch die Erschöpfung hinderte sie daran, ihr Kind in Augenschein zu nehmen. Anna nutzte den Augenblick, um nach der Zange zu greifen, sie rasch in ein Tuch zu wickeln und ganz unten im Korb zu verstauen.
Sie ließ sich ein wenig Zeit, bevor sie die Nabelschnur durchtrennte und den übrigen Nabel mit einem Faden abband. Danach wusch sie das Kind in einem der Eimer, während Theresa auf die Nachgeburt wartete. Nach dem Baden legte Anna einen in Olivenöl getränkten Verband auf den Restnabel, ließ je einen Tropfen Öl in die Augen des Jungen fallen, säuberte seine Nase und Ohren und wickelte ihn schließlich in ein warmes, sauberes Leintuch. Seine samtigen Bäckchen waren vor Anstrengung noch rotgefleckt, aber die bläuliche Färbung war weg.
Die Nachgeburt kam problemlos. Theresa untersuchte sie sofort. Es schien alles in Ordnung, die große Gefahr schien gebannt. Gemeinsam wechselten Anna und Theresa das Laken und zogen der Hafnerin ein frisches Hemd an, dann erst legte Anna ihr das Kind in den Arm. Kaum roch der Kleine die Milch der Mutter, riss er den Mund suchend auf. Anna half der völlig entkräfteten Frau, das frische Hemd zu öffnen und das Kind anzulegen. Sofort hörte man zufriedene Schmatzgeräusche.
Theresa ging zur Tür und rief den Vater. Augenblicklich polterte der Hafner die Treppe herauf und kam in die Kammer gestürmt. Kaum erblickte er seine Frau, lebendig und mit dem neuen Kind im Arm, begann er vor Erleichterung zu weinen.
»Es ist ein Wunder. Wie kann ich Euch jemals danken?«, stammelte er und blickte von einer Hebamme zur anderen.
»Eure Frau und Euer Sohn sind gesund, aber Eure Frau ist sehr schwach und braucht dringend Ruhe. Sie muss das Wochenbett einhalten und einige Tage liegen bleiben, sie darf auf keinen Fall arbeiten.«
Der Hafner nickte eifrig. »Vielleicht kann Else, die Schwägerin, für ein paar Tage kommen und helfen, wie sie es versprochen hat«, überlegte er laut.
»Das wäre gut. Anna oder ich werden morgen wieder nach Eurer Frau sehen. Aber haltet Euch unbedingt an unsere Anweisungen, selbst wenn sie sich stark genug fühlen sollte, um aufzustehen.«
Mutter und Kind waren beide eingeschlafen. Meister Krüger trat leise zum Bett und nahm vorsichtig sein jüngstes Kind in den Arm. Er sah den schlafenden Jungen glücklich an. »Hubert wirst du heißen«, sagte er liebevoll und stolz zugleich.
Der Hafner bot einen ungewöhnlichen Anblick. Nur selten nahmen Väter ihre Kinder gleich nach der Geburt in den Arm und betrachteten sie mit so viel Zärtlichkeit. Ein glatzköpfiger, gutmütiger Riese mit seinem dunkelroten, großen Kind. Kein Maler hätte sich die Mühe gemacht, die beiden auf einer Leinwand zu verewigen, dennoch hätte es ein großartiges Kunstwerk werden können. Würde der Hafner die roten Male entdecken, die den Gebrauch der Geburtszange verrieten?
»Ihr habt den beiden das Leben gerettet. Den Rest schaffen wir.« Die Stimme des Hafners klang belegt. Er schien das Wunder, das seiner Familie widerfahren war, immer noch nicht fassen zu können.
Pater Anselm war ebenfalls leise ins Zimmer getreten. Die Freude auf seinem Gesicht war nicht zu übersehen.
»Ich denke, wir können von einer Nottaufe Abstand nehmen und in aller Ruhe einen Termin in ein paar Wochen ansetzen«, sagte er sichtlich erleichtert.
Der Hafner drehte sich strahlend zu ihm. »Ja, das können wir und wir würden uns freuen, wenn Ihr Huberts Taufvater werdet.«
Pater Anselm lachte: »Nach dieser anstrengenden Nacht würde ich jede andere Entscheidung als Beleidigung verstehen.«
Während die beiden Männer über einen passenden Termin nachdachten, suchte Theresa in ihrem Korb nach Gundermannblättern und Katzenminze für die Nachwehen. Beides gab sie dem Hafner. »Lasst Eurer Frau einen Tee zubereiten, und falls die Schmerzen unerträglich werden, gebt ihr ein paar Tropfen hiervon.« Sie drückte dem Hafner eine kleine Flasche Schmerzmittel in die Hand. »Sollte sich der Zustand von Mutter oder Kind verschlechtern, was wir alle nicht hoffen, lasst uns sofort rufen.«
Als Anna und Theresa den Heimweg antraten, hatte der Schneesturm sich gelegt. Unter ihren Schritten knirschte der Schnee leise und gedämpft, die Luft roch wunderbar klar, und die Stadt sah so sauber aus, als hätte ein ganzer Putztrupp die Nacht über gearbeitet. Die unangenehmen Gerüche waren verschwunden. Ein leichter Westwind, der so typisch für Wien war und fast unaufhörlich das Donautal entlangwehte, beförderte winzige, feine Schneekristalle von einem Schneehaufen zum anderen. Es schien, als erlaubte sich der Wind ein Spiel mit den Anwehungen, in dem es darum ging, ihnen eine möglichst perfekte Form zu verleihen. Anna atmete tief ein, sie fühlte sich benommen von der hellen, klaren Schönheit, die die verschneite Stadt im Moment bot.
Plötzlich öffnete sich ein Fensterladen und krachte donnernd gegen eine Steinfassade. Hinter Anna kippte jemand seinen Nachttopf aus dem Fenster. Um ein Haar hätte er sie damit getroffen und damit die friedliche Stimmung dieses ganz besonderen Morgens zerstört. Ganz genau so, wie Annas Ehemann jeden Augenblick des Friedens und der Ruhe zerstört hatte. Mit dem Gedanken tauchte sofort auch das Bild ihres verstorbenen Ehemanns vor ihr auf, und sie hätte es gerne wieder verdrängt. Ihre Ehe war schmutzig, verdorben und hässlich gewesen. Sie hatte körperliche und seelische Narben hinterlassen, die vielleicht nie wieder heilen würden. Nichts, was sich im Moment ihren Augen darbot, passte zu diesen unerfreulichen Erinnerungen. Warum musste sie ausgerechnet jetzt an dieses dunkle Kapitel ihres Lebens denken?
Es waren ihre Eltern gewesen, vor allem ihre Mutter, die sie in den sechs Monate andauernden Alptraum mit einem wohlhabenden, aber gewalttätigen Kaufmann gezwungen hatten. Eine Peitsche aus Leder hatte noch zu den harmloseren Spielzeugen des kranken Mannes gehört. Schon nach der ersten Woche klebte so viel von Annas Blut daran, dass ihre Bänder hart wie Nägel waren. Als ihr Ehemann Monate später die erste Pestbeule an seinem Körper entdeckt hatte, waren in Anna die ersten Keime der Hoffnung gesprossen. Drei Tage später war Anna erlöst gewesen. Niemals zuvor hatte der Tod eines Menschen das Gefühl der Befreiung in ihr ausgelöst, noch heute schämte sie sich für die empfundene Erleichterung. So sehr, dass sie es nicht einmal wagte, sich während der Beichte davon zu befreien.
Ein zweiter Topf wurde entleert. Diesmal direkt vor Theresas Füße. Sie blickte nach oben und rief erbost: »Habt Ihr die Infektionsordnung vergessen? Oder hat Euch etwa die letzte Pestepidemie nicht gereicht?« Als Antwort wurde auch die zweite Hälfte des Fensterladens geräuschvoll aufgeschlagen. Anna zog die Tante rasch weiter.
Die Turmuhr von St. Stephan schlug die siebente Stunde, und ein langsam hell werdender Himmel kündigte den Tagesbeginn an. Die beiden Frauen beeilten sich, nach Hause zu kommen, wo eine Menge Arbeit und ein hoffentlich heil gebliebenes Fenster auf sie warteten. Sie stiegen den Hafnersteig empor, durch verwinkelte, enge Gassen, über die Schönlaterngasse immer Richtung Stadtmitte. Plötzlich spürte Anna, wie eine bleierne Müdigkeit von ihr Besitz ergriff. Vielleicht würde ein wohlverdientes Frühstück ihre Lebensgeister wieder wecken.
In der vorderen Bäckerstraße machten sie halt, um frische Semmeln zu kaufen. Zuerst wollte Anna wie gewohnt zum Bäcker Wandel gehen, doch Theresa hielt sie zurück. Anna verstand sofort und entschied sich für einen anderen Bäckerladen, wo sie für zwei Kreuzer zwei Semmeln erstand.
Als die beiden endlich zu Hause ankamen, war ganz Wien erwacht und auf den Beinen. Das kleine Häuschen der Hebammen befand sich hinter St. Peter unter den Lauben. Es war ein kleines, aber solides Steinhaus, das inmitten der reichen Kaufmannshäuser wie ein fremder Eindringling wirkte. Theresa sperrte das Schloss der schweren Türe aus Eichenholz auf und trat ein. Sofort umstreifte die schwarze Katze Annas Beine. Es war ungewöhnlich kalt, und sie merkten bald, wieso: Das Feuer in der Küche war ausgegangen. Anna fachte es wieder an, während Theresa den Korb auspackte und alle Utensilien verstaute. Während sie die Geburtszange mit Wasser und einem weichen Tuch säuberte, stieß sie erneut einen tiefen Seufzer aus.
»Diese Zange ist nicht annähernd so gut wie die Zange meiner Lehrherrin.« Wieder musste sie daran denken, wie das feingearbeitete Gerät mitsamt seiner klugen und großzügigen Besitzerin auf dem Scheiterhaufen gelandet war.
»Vielleicht finden wir jemanden, der nach einer neuen Zeichnung eine verbesserte Zange herstellt«, meinte Anna. Endlich brannte das Feuer im Ofen, und sie setzte einen Kessel mit Wasser auf.
»Vielleicht«, brummte Theresa. Sie dachte an das Versprechen, das Brunhilde ihr im Augsburger Stadtgefängnis abverlangt hatte: »Versprich mir, dass du eine Zange anfertigen lässt, die noch feiner und sauberer verarbeitet ist als meine. Setze die Zange ein und gib dein Wissen darüber weiter. Das sinnlose Sterben der Frauen bei der Geburt muss ein Ende haben.«
Nur zu gut erinnerte sich Theresa daran, wie kompliziert es gewesen war, einen Gesellen zu finden, der ihr zumindest dieses plumpe Werkzeug anfertigte. Der Bursche hatte dabei seinen Arbeitsplatz und seinen Kopf riskiert. Dinge, die den Frauen die Geburt erleichterten, wurden von der katholischen Kirche strengstens verboten, und alle, die es wagten, sich über dieses Verbot hinwegzusetzen, liefen Gefahr, angezeigt zu werden.
Eines Tages würde Theresa ihr Versprechen einlösen. Doch dafür musste sie erst einen Schmied finden, der nicht nur sein Handwerk verstand, sondern zudem bereit war, den ungewöhnlichen Auftrag auszuführen. Und dem sie vertrauen konnte.
2
Komorn, Jänner 1683
SEIT STUNDEN TRIEBEN DIE BEIDEN REITER ihre Pferde durch die unwirtliche Winterlandschaft. Ein langer und beschwerlicher Weg lag hinter ihnen. Kälte, Schnee und Sturm hatten ihre Reise in den letzten Stunden zu einer Tortur werden lassen. Wie winzig kleine, spitze Nadelstiche bohrten sich die unzähligen Eiskristalle in die Haut ihrer Wangen. Unbarmherzig wirbelte der Wind immer wieder neue Schneeböen auf und trieb sie ihnen mit voller Wucht entgegen, so dass die Pferde nur langsam vorankamen. Inzwischen hatte das dichte Schneetreiben etwas nachgelassen, und als jetzt zwischen den grauen Wolken die Stadtmauer Komorns auftauchte, atmeten beide Männer erleichtert auf. Der Ritt durch die Straßen der Stadt zu Graf Starhembergs Quartier war nur noch ein Kinderspiel. Auf dem gepflasterten Innenhof des Palais spritzte grauer Schnee unter den Hufen der Pferde weg, und nach dem langen Ritt über verschneite Waldwege klang das Geklapper der Pferde wie Musik in ihren Ohren.
Lorenzo schwang sich als Erster aus dem Sattel. Er war durchgefroren und bewegte sich schwerfällig. Sein Freund Rudolf folgte ihm. Augenblicklich lief ein kleiner, pummeliger Stallbursche in den Hof und nahm den erschöpften Kurieren die Pferde ab.
»Der Graf wartet schon seit gestern auf Euch«, sagte er. Der Vorwurf in seiner Stimme war nicht zu überhören. Wenn sich der Stallbursche diesen Tonfall erlaubte, wie würde erst der Graf auf ihre Verspätung reagieren?
Lorenzo warf Rudolf einen vielsagenden Blick zu. Doch dieser hob nur gelassen die Schultern. »Von mir erfährt der Graf nichts über den kleinen Zwischenfall. Und du solltest ihn besser auch nicht erwähnen, du kennst seine Meinung über dich als Kurier.«
Niedergeschlagen ließ Lorenzo den Kopf hängen. Ja, er wusste, dass der Graf ihn nur ungern als Kurier einsetzte, denn eigentlich war Lorenzo Jurist. Und wieder einmal war er es gewesen, der sich und seinen Freund in eine gefährliche Situation gebracht hatte. Was Rudolf als kleinen Zwischenfall bezeichnete, war ein Überfall gewesen. Es war allein Lorenzos Schuld gewesen, dass die kleine Gruppe herumziehender Tartaren auf sie aufmerksam geworden war. Begeistert von der Schönheit der schneebedeckten Weinberge, war er unvorsichtig geworden. Er hatte die Spuren im Schnee übersehen und war ihnen geradewegs gefolgt. Als Rudolf den Fehler bemerkt hatte, war es bereits zu spät gewesen. Die beiden waren in eine Falle getappt. Wären sie rechtzeitig ausgewichen, hätten sie sich den erbärmlichen Kampf und die halsbrecherische Flucht erspart. Die wichtigen Dokumente aus Polen, die sie bei sich trugen, wären nicht eine Sekunde gefährdet gewesen.
»Du bist eben ein lausiger Kurier!«, lachte Rudolf und klopfte Lorenzo so fest auf die Schulter, dass dieser fast stolperte. »Dafür aber ein schneller Reiter. Dein Vater hat vermutlich gut daran getan, dich nach Siena zum Jurastudium zu schicken.« Seine Worte sollten den Freund aufheitern, bewirkten aber das Gegenteil.
»Hat er nicht!«, zischte Lorenzo ungehalten. Er war sich seiner Fehler als Kurier durchaus bewusst, aber das hieß noch lange nicht, dass er seinem Vater recht geben musste.
Im Augenblick blieb ihm keine Zeit, länger darüber nachzudenken. Der Stallbursche bedeutete den Männern, ins Haus zu gehen, da sie bereits erwartet wurden.
Hinter einem kleinen Empfangsraum befand sich die Tür zum Arbeitszimmer des Grafen. Noch bevor Lorenzo die Tür öffnete, hörte er die ungeduldigen Schritte seines Auftraggebers. Die Absätze der hohen Reitstiefel hallten auf dem Fliesenboden wider.
Als die Tür aufging, blieb der Graf abrupt vor dem massiven Eichentisch stehen, auf dem ungeordnet Papiere und Landkarten in unterschiedlichsten Größen lagen, und starrte die beiden Kuriere verärgert an. Sie hatten keine Gelegenheit gehabt, sich umzuziehen oder auch nur notdürftig zu säubern. Ihre langen Mäntel waren mit Schlamm bespritzt, und ihre Gesichter trugen dicke Schmutzkrusten. Rudolfs blondes Kinnbärtchen war kaum noch zu erkennen, und Lorenzos Wangen, die er stets glattrasierte, waren voller dunkler Bartstoppeln.
»Martecelli, Geiger, Ihr kommt später als verabredet«, donnerte der Graf, sah dabei jedoch ausschließlich Lorenzo an, so als habe er nur auf ihn gewartet oder bereits von seinem Missgeschick erfahren.
»Das Wetter zwang uns, langsamer zu reiten«, sagte Rudolf.
Graf Starhemberg warf dem Kurier einen eisigen Blick zu.
»Ich weiß über das Wetter Bescheid, schließlich habe ich Augen im Kopf und kann aus dem Fenster schauen.«
»Wir wurden überfallen«, sagte Lorenzo.
Rudolf seufzte und verdrehte die Augen. Gleich würde Graf Starhemberg die beiden wütend aus dem Zimmer werfen. Aber nichts dergleichen passierte. Ganz im Gegenteil, er machte eine wegwischende Bewegung mit der Hand, und für den Bruchteil eines Augenblicks glaubte Lorenzo auf dem Gesicht des Grafen so etwas wie Zufriedenheit zu erkennen. Als er weitersprach, klang seine Stimme nicht mehr ganz so verärgert.
»Ich nehme an, dass Ihr die Briefe aus Polen nicht verloren habt und sicher bei Euch tragt.« Auf den Überfall ging er nicht weiter ein. Er musste bereits davon erfahren haben. Aber wie und von wem?
»Die Briefe sind alle in dieser Tasche«, sagte Rudolf und klopfte stolz auf seine alte Umhängetasche aus braunem Ziegenleder. Auf seinem Gesicht machte sich ein Lächeln breit.
»Gut«, sagte Starhemberg. »Dann bringt sie einem der Sekretäre und ruht Euch aus, Euer nächster Ritt führt Euch im Auftrag des Kaisers nach Krakau.«
Erstaunt über diese kurze Unterhaltung, drehten Rudolf und Lorenzo sich zur Tür. Aber der Graf winkte Lorenzo zurück.
»Martecelli, Ihr bleibt noch!« Also würde es doch noch eine Strafpredigt wegen des Überfalls geben.
Mit einem hilflosen Schulterzucken verließ Rudolf das Arbeitszimmer. Er hätte dem Freund gerne beigestanden, sah aber im Moment keine Möglichkeit zu bleiben. Als die Tür sich hinter Rudolf schloss, umrundete Starhemberg seinen Tisch und nahm dahinter Platz. Mit einer einladenden Geste deutete er Lorenzo an, ebenfalls Platz zu nehmen.
Ein eigenartiger Beginn für ein zurechtweisendes Gespräch. Verunsichert nahm Lorenzo Platz. Er strich sich die schweißverklebten schwarzen Locken aus dem Gesicht und legte sie hinter die Ohren. Was hatte der Graf vor?
»Martecelli, Ihr seid mein fähigster Jurist. Bis jetzt habe ich Euren unsinnigen Wünschen nachgegeben und Euch mit Geiger quer durch Europa geschickt. Aber es ist eine Verschwendung Eures Potentials …«
Lorenzo setzte zu einem Widerspruch an, doch Starhemberg winkte ungeduldig ab.
»Mit Eurem bedingungslosen Hang zur Ehrlichkeit gefährdet Ihr meinen besten Kurier. Auch seinen Verlust kann ich mir im Augenblick nicht leisten.«
Lorenzo schluckte hart. Dagegen konnte er nichts einwenden.
»Hartenberg, mein Jurist in Wien, hat sich bei einem Sturz vom Pferd sämtliche Knochen gebrochen. Jemand muss ihn ersetzen, bis er wieder einsatzbereit ist. Ihr seid der Einzige, der diese schwierige Aufgabe übernehmen kann.«
Eigentlich sollte Lorenzo sich freuen, dass der Graf so viel Vertrauen in ihn setzte, aber die Freude wollte sich nicht einstellen.
»A Vienna?«, murmelte er beinahe fassungslos. Der Graf warf ihm einen verständnislosen Blick zu.
Lorenzo wünschte sich weit weg von diesem Raum. Er musste nachdenken, aber genau das konnte er im Moment nicht, da der Graf das Thema wechselte und auf ihn einredete, als sei die Sache mit Wien schon entschieden. Lorenzo fiel es schwer, sich auf die Worte Starhembergs zu konzentrieren. Er sah sich selbst hinter einem Schreibtisch sitzen und langweilige Verträge aufsetzen. Und das alles in Wien, ausgerechnet in der Geburtsstadt seines Vaters.
» … Ich habe eine genaue Aufstellung von Waffen, Munitionsvorräten, Spezialisten und Handwerkern der Stadt verlangt, erhalten habe ich nichts davon. Wenn es zum Krieg mit den Türken kommt, wird Oberungarn niedergewalzt und Komorn und Raab dem Erdboden gleichgemacht.« Starhemberg warf energisch den Kopf in den Nacken, wodurch die hohe silbergraue Lockenperücke bedenklich ins Wanken geriet. Er warf Lorenzo einen kritischen Blick zu. »Ihr hört mir überhaupt nicht zu!«, schrie er verärgert. Auf seiner Stirn bildeten sich rote Flecken.
»Verzeiht«, sagte Lorenzo und schüttelte seinen Kopf, als könnte er damit seine Gedanken über seinen Vater vertreiben.
»Habt Ihr Neuigkeiten aus Polen?«, fragte Starhemberg.
Lorenzo berichtete, dass Sobieski, der polnische König, das Bündnis mit dem österreichischen Kaiser befürwortete. Sollte Österreich von den Türken besiegt werden, würde Polen das nächste Opfer sein. Ein Bündnis zwischen den beiden Ländern garantierte beiden mehr Sicherheit.
Starhemberg grunzte zufrieden und nickte. »Gut, und jetzt zu den Informationen, die mir noch nicht bekannt sind.« Er sah den jungen Mann eindringlich an.
»Die Entscheidung ist noch nicht endgültig gefallen, und im Moment versuchen die Franzosen das Bündnis noch mit allen Mitteln zu verhindern. Sie intrigieren im polnischen Adel und sammeln Stimmen gegen Sobieskis Entscheidung«, erklärte Lorenzo.
Starhemberg trommelte mit den Fingern laut und ungehalten auf seine Schreibtischplatte. »Diese verdammten Franzosen. Für sie wäre es die größte Freude, wenn Leopolds Reich von den Osmanen überrollt werden würde und der Name Habsburg für immer ausgelöscht wäre.«
Lorenzo nickte, der ewige Streit zwischen Frankreich und dem Habsburgerreich war nichts Neues. Der französische König Ludwig würde nichts unversucht lassen, um dieses Schutzbündnis zu verhindern. Dass ein riesiger Osmanenstaat im Herzen Europas über kurz oder lang auch für Frankreich eine Bedrohung darstellen würde, schien ihm nicht bewusst zu sein.
»Aber Sobieski hat von der geplanten Intrige erfahren und versucht nun, Beweise für das infame Spiel zu erhalten, damit er gegen die Verräter vorgehen kann. Er hat seinen Geheimdienst auf die beiden französischen Abgesandten De Vitry und Morsztyn angesetzt«, erklärte Lorenzo.
»Das ist gut! Wir wollen hoffen, dass der Geheimdienst zügig arbeitet, denn die Zeit wird knapp, verdammt knapp. Sie läuft uns überall davon, und unser Kaiser ist sich der Gefahr, in der sich das ganze Reich befindet, nicht im Geringsten bewusst. Er widmet sich seinen geliebten Opern und vergisst dabei, seine Länder vor eindringenden Feinden zu schützen.«
Lorenzo bemühte sich, keine Reaktion zu zeigen. Es stand ihm nicht zu, über den Kaiser zu urteilen. Aber er wusste, dass Starhemberg recht hatte. Dem Kaiser war die drohende Gefahr aus dem Osten nicht bewusst. Die Bewohner seiner eigenen Länder im Osten waren seit Jahrzehnten unzufrieden. Das brutale Vorgehen gegen die Luthersche Kirche war den Menschen noch in grauenvoller Erinnerung. Viele von ihnen waren bereit, die Osmanen zu unterstützen und sich ebenfalls gegen das Haus Habsburg und somit gegen die katholische Kirche aufzulehnen, anstatt das Land gegen die Hohe Pforte zu verteidigen.
»Martecelli, Ihr werdet heute noch nach Wien aufbrechen.«
Heute noch? Lorenzo war müde und erschöpft, er wollte sich einfach hinlegen und schlafen.
»Vorher werdet Ihr ein Schreiben aufsetzen, in dem ich von der Hofkammer ausdrücklich die Säuberung des Verbindungskanals verlange, der innerhalb der Basteien vom Zeughaus zum an der Stadt vorbeifließenden Donauarm führt. Wir müssen den ungehinderten Transport von Waffen und Munition aus dem Arsenal per Schiff sichern.«
Manchmal war es schwierig, den Gedankensprüngen dieses vielbeschäftigten Mannes zu folgen. Hatte er nicht gerade noch über die Intrigen am polnischen Hof gesprochen?
»Das Schreiben muss am Nachmittag fertig sein, damit ich es unterzeichnen kann. Seid in Eurer Wortwahl nicht zimperlich, die Dringlichkeit muss erkannt werden. Sobald es fertig ist, könnt Ihr unverzüglich aufbrechen.« Mit einer Handbewegung zeigte Starhemberg an, dass Lorenzo nun entlassen war, und widmete sich wieder seinen Papieren auf dem Tisch.
Lorenzo verbeugte sich kurz und ging zur Tür. Als er die Türklinke schon in der Hand hielt, rief ihm Starhemberg, ohne von seinen Papieren aufzublicken, zu: »Martecelli, wenn Ihr in Wien seid, besorgt Euch endlich eine anständige Perücke, die Eurer Stellung gebührt. Ihr seht aus wie ein Tagelöhner.«
»Ich werde darüber nachdenken«, sagte Lorenzo. Er war kaum noch in der Lage, seinen Unmut zurückzuhalten. Graf Starhemberg grinste.
Lorenzo fand Rudolf in der Küche. Der Freund hatte sich bereits vom ärgsten Schmutz befreit, gekämmt und rasiert, saß an einem Tisch und unterhielt sich auf Ungarisch mit der Küchenmagd. Ohne Frage kokettierte er mit dem Mädchen. Die Magd warf Rudolf verführerische Blicke zu und legte ihm eine Extraportion Fleisch auf den Teller.
»Setz dich, mein Freund. Ich sehe, du hast die Strafpredigt überlebt und deinen hübschen südländischen Kopf behalten dürfen.« Rudolf schob für Lorenzo einen Sessel zum Tisch.
Sollte Lorenzo sich ebenfalls waschen, bevor er zu essen begann? Nein, er fühlte sich elend und wollte einen Schluck Wein trinken.
So als könnte er die Gedanken seines Freundes lesen, griff Rudolf nach dem Weinkrug und schenkte Lorenzo einen Becher voll. »Dieser Tropfen wird dir schmecken«, sagte er und prostete ihm zu.
Lorenzo nahm einen kräftigen Schluck. Es war ein schwerer, ungarischer Wein, der ihn an Maulbeeren erinnerte. Lorenzo stimmte Rudolf zu, dieser Wein war tatsächlich hervorragend. Ein schwacher Trost nach dem Gespräch mit dem Grafen.
»Nun spann mich nicht weiter auf die Folter und erzähl, was der Graf so lange mit dir besprochen hat.« Rudolf schnitt mit seinem Messer das große Stück Fleisch in handliche Happen und ließ einen davon im Mund verschwinden. Dann stellte er den Teller zwischen sich und Lorenzo auf den Tisch und ermutigte den Freund, ebenfalls zuzugreifen. Der nahm lieber noch einen kräftigen Schluck aus seinem Becher.
Wehmütig dachte er an den Wein aus Montepulciano. Auf dem Weingut seiner Eltern wuchsen die Reben für einen kräftigen, würzigen Wein, der die Sonne der Toskana in sich trug. Vielleicht hätte er nie weggehen sollen. Aber sein Vater hätte ihm niemals erlaubt, Weinbauer zu werden. Er wollte, dass Lorenzo eine juristische Laufbahn einschlug. Deshalb hatte er schon früh darauf bestanden, dass der Sohn drei Sprachen lernte, und ihn direkt nach der Klosterschule nach Siena zum Jurastudium geschickt. Anders als seine vier älteren Schwestern durfte Lorenzo nicht auf dem Weingut bleiben, um von einem Privatlehrer unterrichtet zu werden. Lorenzos Vater war ein ehrgeiziger Mann, der es trotz widriger Umstände weit gebracht hatte. Nach einem abgebrochenen Studium war er auf das Weingut seines Onkels nach Krems gezogen und hatte dort das Handwerk eines Winzers erlernt. Doch während der Schwedenkriege war alles rund um die Stadt zerstört worden, und Lorenzos Vater war in den Süden geflüchtet, wo er seine zukünftige Frau kennengelernt hatte. Die junge, kinderlose Witwe, die sich in den jungen Mann aus dem Norden verliebte. Innerhalb weniger Jahre hatten die beiden das Weingut verdreifacht und machten den besten Wein der ganzen Umgebung. Bis nach Hamburg wurden ihre Fässer verschickt.
Lorenzo hatte sich stets den Wünschen seines Vaters gefügt. Als er jedoch schließlich von ihm verlangte, die langweilige Tochter eines verarmten Adeligen zu heiraten, sah Lorenzo nur noch eine Möglichkeit: die Flucht. Er packte kurzerhand seine Sachen, verließ nachts das elterliche Haus und hinterließ bloß einen kurzen Brief, in dem er erklärte, warum er nicht bleiben konnte.
Rudolf beobachtete mit gerunzelter Stirn den Freund: »Also erzählst du mir jetzt, was der Graf von dir wollte?«
Lorenzo griff nach einem Stück Fleisch. »Er will, dass ich mir eine Perücke kaufe.«
»Wie bitte?«, fragte Rudolf.
Lorenzo nahm ein weiteres Stück Fleisch, lehnte sich zurück und begann dann, seinem Freund sein Herz auszuschütten.
3
»ES HAT SCHON WIEDER ZU SCHNEIEN BEGONNEN.« Anna kam mit einem vollen Einkaufskorb zur Tür herein. Sie klopfte sich den frischen Schnee von den Schultern und schüttelte ihn von der Haube.
»Mach rasch die Tür zu, bevor die ganze Stube eingeschneit ist«, sagte Theresa. Sie legte Holz in den Ofen nach, damit das Feuer nicht ausging und die Linsensuppe genug Hitze zum Köcheln hatte. Die Aufgabe nahm Theresa voll in Anspruch. Mühselig kam sie wieder auf die Beine. Mit vierzig machten sich die ersten Boten des Alters bemerkbar. Seit ein paar Jahren fiel es ihr schwer, vom Boden aufzustehen, ihre Gelenke schmerzten. Dieser Zustand war bei Kälte besonders schlimm. Lange Zeit hatte sie die Schmerzen ignoriert, aber jetzt ging es nicht mehr. Besonders hart traf sie die Tatsache, dass ihre Finger an nasskalten Tagen dick angeschwollen waren und sie nicht so geschickt zugreifen konnte wie gewohnt.
»Wenn es so weiterschneit, müssen wir am Nachmittag noch einmal Schnee schaufeln«, seufzte Theresa. Ihr Rücken schmerzte noch von gestern. Sie hatte den ganzen Nachmittag damit verbracht, den Bereich vor dem Haus freizulegen. In Zukunft musste Theresa ihre Nichte darum bitten, diese Arbeiten zu übernehmen, so schwer ihr das auch fallen würde.
Sie beobachtete Anna, wie sie die Einkäufe aus dem Korb räumte. Einen Kohlkopf, Butter, Brot und Nussschnecken mit Honigguss. Missbilligend betrachtete Theresa das süße Gebäck.
»Es grenzt an ein Wunder, dass deine Zähne noch nicht schwarz und löchrig sind«, sagte sie abfällig. Anna wusste selbst, dass sie zu viel Zuckerwerk aß. Aber sie konnte einfach nicht widerstehen, wenn sie beim Bäcker die süßen Köstlichkeiten sah und zufällig einen Kreuzer zu viel in der Tasche einstecken hatte. Theresa wollte noch weiter über Annas enormen Zuckerverbrauch schimpfen, als ein Klopfen an der Tür sie unterbrach.
»Wollte die Hutmacherin nicht erst nach Mittag kommen?«
»Es ist nicht die Hutmacherin.« Vor der Tür stand ein dünner, schmutziger Knabe. »Es ist Hannes, und er sieht noch erbärmlicher aus als sonst.«
Der Junge grinste Theresa müde aus einem verrußten Gesicht an. Das Weiß der Augen, das sich sonst so strahlend von der Schmutzschicht abhob, war von roten Äderchen durchzogen.
»Bitte, habt Ihr etwas zu essen für mich? Ich habe seit Tagen keine richtige Mahlzeit mehr bekommen«, stammelte er und sah trotz der Kälte verschwitzt aus.
»Meinetwegen«, schnaubte Theresa und verfolgte ihn mit aufmerksamen Blicken. Irgendetwas stimmte mit dem Jungen heute nicht. »Setz dich an den Tisch, es gibt Linsen mit Speck.« Freude spiegelte sich auf seinem Gesicht wider, das müder wirkte als sonst. »Aber wasch dir zuvor die Hände. Unter der Stiege steht ein Eimer mit Wasser.«
Der Junge machte sich daran, den Eimer zu suchen. »Dein Gesicht könnte auch etwas Wasser vertragen«, rief ihm Theresa hinterher.
Hannes war eines der zahlreichen elternlosen Kinder, die allein auf den Straßen Wiens lebten. Die große Pestepidemie vor vier Jahren hatte sie zu Waisen gemacht. Sie hausten in Kellerlöchern und Unterschlüpfen, verdienten sich hin und wieder ein paar Kreuzer mit Botengängen, die sie für reiche Bürger erledigten, und schlugen sich so mehr schlecht als recht durchs Leben. Es gab niemanden, der sich um sie kümmerte. Wenn sie beim Stehlen erwischt wurden, warf man sie ins Gefängnis und sperrte sie weg. Die Kinder hatten keine Zukunft, sie lebten von einem Tag auf den anderen und von der Hand in den Mund. Einige von ihnen schlossen sich zu kleinen Banden zusammen.
Hannes, der sehr klein und ungewöhnlich zart für seine zehn Jahre war, gehörte zu keiner Bande. Er versuchte, allein durchzukommen. Kurz vor Weihnachten hatte er die beiden Hebammen kennengelernt. Der Schmied hatte ihn dafür bezahlt, die beiden zur Niederkunft seiner Frau zu holen. Seit Hannes wusste, dass es Anna und Theresa gab, kam er regelmäßig. In der Tuchlauben bekam er immer zu essen und konnte sich kurz aufwärmen. Es war wenig, was er den Frauen an Gegenleistung anbieten konnte, er erzählte den neuesten Klatsch der Stadt und überbrachte Nachrichten für die beiden.
Als Hannes zurück zum Tisch kam, war sein Gesicht fast sauber, wodurch er unnatürlich blass und ungesund aussah. Während Anna weiter den Tisch deckte, warf auch sie ihm einen beunruhigten Blick zu. Sie holte drei Holzschalen, Löffel und Tonbecher. Anschließend schnitt sie das frische Brot in dicke Scheiben. Es war noch lauwarm und duftete nach Anis und Fenchel. Normalerweise konnte Hannes es kaum erwarten, den ersten Bissen davon in den Mund zu stecken. Heute setzte er sich langsam, beinahe vorsichtig auf seinen Hocker. Er zitterte.
»Was tut sich Neues auf den Straßen unserer Stadt?«, fragte Anna und reichte ihm das Randstück vom Brot. Es war besonders knusprig. Der Junge nahm es, konnte sich aber lange nicht dazu entschließen, davon abzubeißen.
»Gestern Nacht ist im Springer’schen Haus am Bauernmarkt der Hofkanzler an der Schwindsucht gestorben«, sagte Hannes.
»Johann Paul Hocher?«, fragte Theresa.
Hannes biss nun endlich vom Brot ab und nickte, er kaute eine Ewigkeit an seinem Bissen, so als würde die gekaute Masse sich in seinem Mund verdoppeln. Theresa holte den heißen Topf vom Herd und stellte ihn in die Mitte des Tisches. Ein würziger Duft nach Linsen, Lorbeerblatt und deftigem Speck stieg von ihm auf. »Ungarn wäre einiges erspart geblieben und wir müssten jetzt nicht Angst vor der Hohen Pforte haben, wenn Gott den Mann früher zu sich geholt hätte«, sagte Theresa, während sie den heißen Eintopf auf die Schüsseln verteilte. Hocher war einer jener gewesen, die für die Verfolgung der Protestanten in Ungarn eingetreten waren und ihren eigenen Besitz und den der Hofkammer erheblich aufgebessert hatten, in dem sie riesige Besitztümer und Ländereien hatten konfiszieren lassen. Die Erinnerungen an diese Gräueltaten waren in vielen Dörfern noch sehr frisch, denn Männer waren in die Sklaverei geschickt worden und fehlten den Familien immer noch als wertvolle Arbeitskräfte.