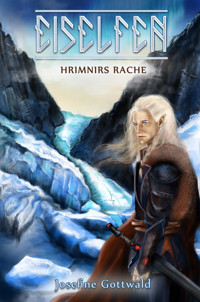3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Abenteuer geht weiter: Piper und ihre Freunde sind in einen Hinterhalt geraten und werden von Soldaten an den Hof des Königs von Drakónien gebracht, der über ihr weiteres Schicksal entscheiden soll. Gemeinsam mit zwei seltsamen Fremden und ihren Drachen schmieden sie Fluchtpläne in ihrem Verlies, um den Vampiren über die Meere der Ewigen Welten zu folgen – bis in Liliths Reich, einen düsteren Urwald, in dem ihr Tempel des Blutes verborgen liegt. Doch die Krieger müssen sich beeilen, denn die Vampire verfolgen ihre eigenen Pläne. Im dritten Teil der Fantasy-Reihe erfahren die Freunde aus Texas die Magie der Ewigen Welten am eigenen Leib. Ein starker Zauber, der die Erde zum Beben bringt, scheint die feindlichen Vampire zu schützen, doch das Schwert einer Amazone, der Stab eines Magiers und das Feuer ihrer Drachen geben den Kriegern neue Kraft auf ihrer Mission, die Träume der Menschen zu verteidigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Prolog
I Piper
II Andy
III Brendan
IV Robin
V Gillian
VI Andy
VII Piper
VIII
IX Piper
X
XI Gillian
XII Piper
XIII Robin
XIV Joice
XV
XVI Brendan
XVII Piper
XVIII Dina
XIX Piper
XX Piper
XXI Robin
XXII Andy
XXIII Piper
XXIV
XXV Joice
XXVI Dina
XXVII Gillian
XXVIII Andy
XXIX Piper
XXX
XXXI Piper
XXXII Gillian
XXXIII Joice
XXXIV Piper
XXXV Andy
XXXVI Piper
XXXVII
XXXVIII Piper
XXXIX Piper
Epilog
Personenverzeichnis
Die Autorin
Fortsetzung folgt ...
Wie alles begann ...
Josefine Gottwald
DIE KRIEGER DES HORNS
NEBELMOND | Band 3
Ein Figurenverzeichnis findet sich am Ende des Buches!
IMPRESSUM
ISBN-13: 9783757923563
Überarbeitete Ausgabe 2023
Copyright © 2010, 2017, 2023 Josefine Gottwald
Schlachthofgäßchen 1 | 01796 Pirna | [email protected]
Umschlaggestaltung: Tobias Roetsch, GTGraphics.de
Lektorat/Korrektorat: Jana Isabella Treuter
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
Nebelschwaden kriechen durch den Nachtwald. Ich sehe nichts als die Schemen der Bäume, die mich von allen Seiten umschließen. Dahinter liegt die Ungewissheit. In alle Richtungen breitet sich der Dunst aus, umfasst meine Waden wie fließender Dampf, sodass ich weder Weg, noch Wald, noch den Boden unter mir erkennen kann.
Ich drehe mich und versuche herauszufinden, wo meine Freunde sind. Konzentriert lausche ich in die Nacht hinein, um irgendein Geräusch zu entdecken, das mir helfen kann. Aber da ist nichts, was auf sie hinweist – oder anderes Leben in der Dunkelheit.
Plötzlich zerreißt ein Wiehern die Stille. Wie ein Schrei hallt es in meinen Ohren, und meine Gedanken überschlagen sich: Luna ist in Gefahr!
Der Hilferuf kann nicht von weit hergekommen sein, und ich überlege fieberhaft, wohin ich laufen soll. Erneut schallt es angsterfüllt – diesmal leiser – durchs Geäst. Mein Einhorn kämpft um sein Leben! Getrieben von der Furcht, die mir im Nacken sitzt, suche ich irgendeinen Weg und schlage mich durchs Unterholz. Ich komme viel zu langsam voran, aber das Wiehern – das helle, panische Quieken – nähert sich, und endlich erkenne ich die Umrisse von Luna.
Zitternd und erschöpft steht sie vor mir, das weiße Fell blutüberströmt, die blauen Augen in Todesangst verdreht. Sie wirft sich herum und versucht zu fliehen, doch ihre Feinde versperren ihr den Weg.
Flink und gewandt wie sie sind, tauchen sie immer wieder kurz im Nebel auf. Sie haben die Erscheinung von Katzen, aber ich kenne ihre wahre Gestalt und muss mir ins Gedächtnis rufen, dass sich hinter der harmlosen Fassade grausame schwarze Magie verbirgt. Sie sehen aus wie zwei kleine Mädchen, aber sie verwandeln sich in alles, was ihnen hilft, anderen Schaden zuzufügen.
Die Gestalt der roten Katzen half ihnen auch zu fliehen, als sie uns in dem verlassenen Dorf angriffen und Destino töteten, ein unschuldiges Einhorn. Und nun wollen sie auch Luna.
Von allen Seiten stürzen sie sich auf die Stute und reißen mit ihren Krallen tiefe Wunden in das Fell. Verzweifelt bäumt sich das Einhorn auf und schlägt mit den Hufen, gleichzeitig senkt es den Kopf mit dem tödlichen Horn. Wie ein Licht strahlt die Magie aus seiner Spitze und flutet den Wald, bis der Nebel sie schluckt. Das Lachen des Sieges hallt von den Bäumen wider, während das Licht immer schwächer wird …
Ich rufe nach Luna und will ihr helfen, aber plötzlich bin ich nicht mehr in der Lage, mich von der Stelle zu bewegen. Ich versuche, zu ihr zu gelangen, doch je mehr Schritte ich mache, desto weiter scheint sich die schreckliche Szene von mir zu entfernen. Schneller und schneller laufe ich, bis ich nur noch blind vorwärts stolpere und schließlich um Atem ringend anhalte. Mein Einhorn bleibt unerreichbar, und die Hexen setzen ihm immer weiter zu.
Ich versuche, mein Schwert zu ziehen, doch als ich danach greife, ist es verschwunden. Auch das Shel, das ich um den Hals trage, ist abgerissen. Keine Möglichkeit zur Verteidigung.
Luna verschwindet im dichter werdenden Nebel. Schutzlos ausgeliefert geht sie in die Knie, während die Katzen an ihr hochspringen und fauchend ihre Krallen in das Fleisch graben. Wieder und wieder fallen sie sie an.
Ich schreie noch immer ihren Namen, in dem verzweifelten Versuch, ihr wenigstens Hoffnung geben zu können. Sie hält sich kaum noch auf den Beinen. In Todesangst wirft sie sich noch einmal herum und versucht, ihre Feinde abzuwehren, sie von sich zu schleudern, zu treten oder zu beißen.
Aber schließlich haben sie ihr Ziel erreicht. Vollkommen erschöpft ist das Einhorn an seinen Grenzen angelangt. Ein qualvolles Wiehern in den letzten Sekunden, dann bricht Luna zusammen, und der Nebel umhüllt sie wie ein Leichentuch.
IPiper
„Nein!“ Ich reiße die Augen auf. Wieder und wieder verfolgen mich die Hexen. Sogar in meinen Träumen suchen sie mich heim, als wollten sie auf diesem Weg ihren Plan vollenden, bei dem wir sie störten.
„Was ist los?“, fragt Andy und sieht mich besorgt an. „Du hast geweint im Schlaf …“ Er streichelt mir tröstend das Haar.
Ich umarme ihn und versuche ruhig zu atmen und den Schreck aus meinen Zügen zu vertreiben. Zum Glück lebt Luna noch.
„Wie geht es ihr?“, frage ich.
„Sie ist tapfer“, antwortet er und streicht mit dem Finger über meinen Nasenrücken, „so wie du.“
Ich lächele zaghaft. Selbst in dieser Situation schafft er es, dass ich mich besser fühle.
„Ich habe keine Angst“, behaupte ich, „du bist ja da und kannst mich beschützen!“
Das entlockt ihm ein kleines Lächeln, auch wenn wir wissen, dass sein Schutz für uns beide nicht reichen wird. Ich küsse ihn kurz, dann krieche ich zum Ende der Kutsche, wo Dina sich auf dem Boden zusammengerollt hat. Die anderen schlafen noch – sogar Robin, von dem ich dachte, dass er während der ganzen Fahrt kein Auge zu tun würde. Er hat sich gegen eine der Kisten gelehnt, Brendan und Annikki schlafen Rücken an Rücken. Eine viel zu friedliche Szene für eine Hand voll gefangen genommener Staatsfeinde, die nicht wissen, was auf sie zukommt. Nur Andy hat sich scheinbar seit unserem Aufbruch in dem verlassenen Dorf keine Sekunde ausgeruht.
„Du hättest mich ruhig wecken können“, flüstere ich, um die anderen nicht zu stören. „Dann hätte ich mit dir Wache gehalten, und du wärst nicht so allein gewesen.“
„Ich war nicht allein“, sagt er leise, „du warst da und hast die ganze Zeit mit mir geredet.“ Erstaunt hebe ich die Augenbrauen. „Aber es war nichts Schönes“, fügt er mit anklagender Miene hinzu. Nach einer kurzen Pause, in der sein Blick ziellos über den Boden wandert, kehrt der sorgenvolle Ausdruck zurück. „Du hast von den Hexen geträumt, nicht wahr?“
„Mach dir keine Sorgen!“, verlange ich. „Bestimmt finden wir irgendwie einen Weg. Wenn Luna das durchsteht, kann ich es auch. Und am Ende werden wir alle erleichtert und froh sein, dass wir Fortuna und Nube retten konnten.“ Ich versuche ein Lächeln und erwarte seine Reaktion.
„Ich bin froh, dass du so denkst, Piper“, sagt er ernst. „Als wir in den Wolf Forest aufgebrochen sind, wolltest du überhaupt nicht mit, und noch vor ein paar Stunden dachte ich, du würdest am liebsten fortlaufen.“ Er kratzt sich am Ohr vor Verlegenheit, diesen Gedanken zugeben zu müssen.
Ich schüttele den Kopf. „Und die Einhörner im Stich lassen? Das dürfen wir nicht. Deswegen sind wir schließlich die Krieger des Horns und niemand anderes.“ Ich bin nicht halb so überzeugt davon, wie ich es gerne wäre. Vielleicht muss ich es mir nur immer wieder einreden, um es irgendwann zu glauben. Ich wünschte, ich wäre so optimistisch wie Dina. Wieder schweift mein Blick über die friedlich Schlafenden. Wenn man die entspannten Gesichter sieht, könnte man wirklich glauben, wir hätten uns lediglich eine Weile auf eine andere Art zu reisen verlegt und wären nicht gefangen in einem schaukelnden Gefährt, das uns wer weiß wohin bringen wird …
Ich beschließe, nach Luna zu sehen, und krieche zu dem Vorhang an der Rückseite des Planwagens. Ich schiebe den Leinenstoff ein Stück beiseite und werfe einen Blick nach draußen. Das Einhorn trabt keuchend neben der Kutsche her, sein Blick fleht mich an, es von diesem mühseligen Trott zu erlösen. Ich muss die Tränen unterdrücken, die mir in die Augen steigen, und die Erkenntnis trifft mich wie eine kalte Dusche: Nichts wird wieder gut werden. Luna kämpft noch immer um ihr Leben.
Von der Wurzel ihres Stirnhorns breiten sich Strahlen dunkelroten Blutes über den gesamten Kopf aus und laufen das Fell hinab, bis zu den Nüstern, wo sich die Tropfen der wieder aufgerissenen Wunde sammeln, um von Zeit zu Zeit eine Spur auf dem Pfad durch die Grasberge zu hinterlassen. Der Verband an ihrem Bein ist blutgetränkt. Ihre Augen sind grau und traurig geworden, und auch das Fell ist stumpf und strahlt nicht mehr in dem leuchtenden Weiß wie zuvor, als wir noch keinen Gedanken an die Hexen verschwendeten – und die Gefahr, die von ihnen ausging. Diesen Leichtsinn bezahlte Destino mit dem Leben.
Ich bemerke, dass Andy mich beobachtet, und winke ihn heran. Mein Blick sucht nach dem Hauptmann, der nun nicht mehr auf meiner Seite des Wagens reitet, sondern mit seinem smaragdgrünen Drachen die Karawane anführt, die uns in die Hauptstadt des Königreichs Drakónien bringen soll.
Luna schnauft und schüttelt den Kopf, den sie unentwegt am Boden hält. Leise rollt eine Träne über meine Wange. Der Drachenreiter neben mir wird aufmerksam, als ich ein Schluchzen unterdrücke und mir auf die Hand beiße.
„Mach, dass du wieder reinkommst! Wo sind überhaupt deine Fesseln?“
Ich blicke ihn hasserfüllt an, worauf er drohend seine Lanze schwenkt. Als wir alle in die drakónische Kutsche eingestiegen waren, begann Robin sofort, unsere Stricke mit seinen telekinetischen Fähigkeiten zu lösen, sodass wir uns besser in dem schaukelnden Gefährt bewegen konnten. Bewacht von den Drachen und ohne unsere Waffen, ergaben wir uns irgendwann unserem Schicksal.
Andy greift nach meiner Hand. Seine Züge verhärten sich, als er Luna sieht und den stechenden Blick des Soldaten.
„Gibt es Probleme?“, ruft Hauptmann Estruhl nach hinten und lässt die Reiter und die Schimmel vor der Kutsche halten.
„Sie können das nicht machen!“, fahre ich ihn an ohne nachzudenken. „Die Einhörner sind das Wichtigste in unserer Welt für die Menschen – und sehen Sie, wie Sie mit ihnen umgehen! Die Hexen haben Luna schwer zugesetzt, und anstatt ihr eine Pause zu lassen, treiben Sie sie zu Höchstleistungen an! Wenn sie an ihren Verletzungen stirbt, werden Sie daran schuld sein! Sie kommen einfach daher und nehmen uns gefangen, ohne dass uns klar ist, weshalb! Und dann bringen Sie uns meilenweit von unserem Weg ab, nur um zu überprüfen, ob wir verdächtig sind! Damit dauert unsere Reise Tage, vielleicht Wochen länger, und wir werden es nie rechtzeitig schaffen, vor Gillian und Joice bei Lilith einzutreffen und die Einhörner vor ihr zu retten! Ihnen ist überhaupt nicht klar, was Sie da tun!“ Erregt blitze ich ihn an.
Der Hauptmann nimmt mich mit ernstem Ausdruck zur Kenntnis und mustert das Innere der Kutsche durch den offenen Vorhang. Andy hat sich hinter mir aufgerichtet und sieht ihm ebenfalls fest in die Augen. Von der Erschütterung des haltenden Gefährts erwacht, regen sich nun auch die anderen und erscheinen nacheinander an der Öffnung des Wagens.
„Was ist denn los, sind wir schon da?“, fragt Dina verschlafen, aber ich antworte ihr nicht. Annikki scheint sich zu ärgern, überhaupt eingeschlafen zu sein; sie überschaut die Lage mit einem Blick. Robin beobachtet misstrauisch die Soldaten, und ich bin überzeugt, dass er auf jeden kleinen Fehler sofort anspringen wird.
Erwartungsvoll starre ich den Hauptmann an und hoffe, dass meine Gebete erhört werden.
Bitte.
Für Luna.
„Wir machen eine Pause“, sagt er endlich an seine Männer gewandt, und ich atme erleichtert auf. Sofort greife ich nach meinem Rucksack und springe aus dem Wagen. Ohne mich noch einmal nach den anderen umzudrehen, bin ich im nächsten Augenblick bei meinem Einhorn. Erschöpft vom Laufen hält Luna noch immer den Kopf gesenkt und blickt mich dankbar aus ihren müden Augen an, als ich sie losbinde und von den Drachenreitern und der Kutsche wegführe. Unter einer hohen Fichte lasse ich sie grasen und reibe ihren verschwitzten Hals mit einer Satteldecke ab, die mir Andy bringt.
Danach setze ich mich neben ihr ins Moos, während Andy nach seinem eigenen Einhorn sieht. Ich folge ihm mit den Augen und merke dabei, wie erleichtert ich bin, dass er mit mir hier ist. Ein weiterer Grund, um zu überleben. Für Luna und für Andy, und natürlich unseren Auftrag.
Ich beobachte das Einhorn beim Grasen und denke daran, wie ausgehungert ich selbst bin. Annikki nähert sich mir und reicht mir einen Apfel, als hätte sie nichts anderes erwartet. Die Schmetterlingsflügel auf ihrem Rücken sind vom Schlafen zerknittert, und obwohl sie sonst so fröhlich flattern, hängen sie jetzt träge herab. Sie ist eine Zwölfe, erinnere ich mich, verwandt mit den Elfen, sie kann fliegen und beherrscht die Magie – nicht gerade etwas, woran man sich schnell gewöhnt.
„Sind die anderen in Ordnung?“, frage ich. Sie nickt und schlägt beruhigend die Augen nieder. Allen geht es gut.
„Denk nicht so viel darüber nach“, meint sie.
„Es ist schwer, das nicht zu tun, nach allem was passiert ist.“ Ich höre die Bitterkeit in meiner eigenen Stimme.
„Jetzt ist es vorbei“, sagt sie ruhig. „Wir sind vorübergehend in Sicherheit. Sie werden uns nicht verfolgen und riskieren, es mit einer Hand voll Soldaten und uns gleichzeitig aufzunehmen. Am Tag trauen sie sich ohnehin kaum aus dem Schutz ihrer Schatten. Ebenso wie unsere anderen Feinde …“
Ich erinnere mich an das Heulen der Wölfe und bin froh, dass es uns gerade nicht verfolgt. Gleichzeitig bemerke ich, dass wir nun schon eine ganze Hand voller Gegner haben. Ich frage mich, ob das je aufhören wird.
„Wenn ich überlege, was uns noch bevorsteht, mache ich mir Sorgen“, gestehe ich. Mein Blick wandert über das smaragdfarbene Gras, das so weich aussieht, dass ich mit der Hand darüber streichen muss. Es macht es mir leichter, über meine Angst zu sprechen. „Kann Luna diese Reise überhaupt unbeschadet durchstehen? Sie ist so schlimm verwundet … Gibt es keine Möglichkeit, ihr diesen Weg zu erleichtern?“ Flehend blicke ich in Annikkis Augen.
In ihrem Gesicht liegt so viel Güte, als hätte sie tatsächlich die Macht, eine Entscheidung zu treffen. „Es gibt eine Möglichkeit“, erklärt sie. „Es wäre sehr sinnvoll, deine Stute zu schonen, damit sie wieder zu Kräften kommt. Sie würde uns auf unserem Weg sonst behindern …“
Bei ihrem sachlichen Ton muss ich schlucken, aber dann gebe ich ihr recht. Noch immer bin ich mir nicht sicher, welche Ziele die seltsame Zwölfe verfolgt. Aber bisher hat sie uns geholfen.
„Erinnerst du dich an den Jäger? In meinem Haus?“, fragt sie.
„Das Phantom?“ Obwohl ich in der Sonne sitze, spüre ich einen Schauer auf meinem Rücken, als ich an die Begegnung zurückdenke. Ein schwarzer Reiter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Vampire zu vernichten. Ein Auftragsmörder, könnte man sagen. Aber sind wir das nicht auch?
„Uns vereint eine telepathische Verbindung“, erklärt Annikki. Wie immer kein Wort mehr als nötig. Ich blicke sie fragend an. „Der Jäger folgt uns in einigem Abstand. Er wird wissen, wie er sich um sie kümmern muss.“
Plötzlich sehe ich ganz neue Möglichkeiten. „Er hilft uns?“, frage ich hoffnungsvoll.
Annikki nickt ernst. „Ihr seht ihn vielleicht nicht, aber er ist in den Wolken über uns und in den Wäldern und Schluchten, die zurückliegen.“
Ich blicke auf die Berge in der Ferne und versuche, den Weg zu erkennen, den wir gekommen sind. Es ist nicht schwer: Die felsige Straße schlängelt sich immer auf dem sichersten Pfad um die steilen Wände herum. Vielleicht ist es ein Handelsweg, überlege ich. Vielleicht sind wir sogar schon anderen Reisenden begegnet – oder anderen Gefangenen.
Annikki lenkt meine Aufmerksamkeit zurück auf die Soldaten. „Die Drachen können ihn und sein Pferd riechen“, sagt sie, fast belustigt.
Ich beobachte die Männer, die ihre Tiere füttern oder grasen lassen, während andere, die zur Wache abgestellt sind, zu uns herüberblicken, die Lanzen fest in ihren Fäusten. Es scheint sie nicht zu stören, dass ihre Reittiere immer wieder die Köpfe wenden und in den Wind wittern. Einer der Drachen stößt einen Schrei aus, aber niemand reagiert.
Als hätte Annikki meine Gedanken gelesen, schüttelt sie fast unmerklich den Kopf. „Sie werden ihn nicht bemerken, Piper. Er hat sich daran gewöhnt, in der Unsichtbarkeit zu leben; er ist wie ein Schatten, der leise zuschlägt. Selbst die Menschen sehen ihm niemals an, was er eigentlich ist.
„Fast ein bisschen wie ich“, sage ich lächelnd, während das Wort unsichtbar in meinem Kopf nachhallt.
Die Zwölfe lächelt gutmütig. „Also was sagst du?“
Ich mustere mein Einhorn besorgt und nicke langsam. „Es sieht so aus, als wäre er unsere einzige Chance.“
Annikki erhebt sich. „Wir schaffen uns selbst eine Chance.“ Ich erkenne, dass sie das Thema abgeschlossen hat, als sie mir aufhilft und Luna genauer begutachtet. „Bis dahin besorgen wir Luna noch ein bisschen Zeit.“
Die Stute hat den Kopf gehoben und schaut in die Ferne. Vorsichtig befühle ich ihre Stirn. Sie ist heiß und geschwollen; am Ansatz des Horns klebt das trockene, dunkelrote Blut. Die Wunde beginnt zu eitern, und ich spüre neben der Hitze ein stetiges Pochen unter der Schwellung.
„Ich werde dafür sorgen, dass die Fahrt sie nicht bis an ihre Grenzen beansprucht. Ich gebe ihr etwas, das ihr die Schmerzen nimmt und die Schwellung zurückgehen lässt.“
Es sieht aus, als hätten die Hexen versucht, das Horn von der Seite her anzusägen. Sie kamen beinahe bis zur Hälfte; vielleicht hätten sie es dann abgebrochen, und Luna wäre verloren gewesen. Dann hätte selbst Annikkis geheimnisvolles Phantom nichts mehr ausrichten können.
Die Zwölfe wandert umher, als würde sie etwas suchen. „Vielleicht kann ich eine Kompresse auflegen“, murmelt sie, „mit Magie würde sie halten, und hier wachsen viele Kräuter. Wir sollten die Stelle auch kühlen und die Wunde ein wenig reinigen, sie eitert viel zu stark. Wahrscheinlich ist Schmutz hineingekommen. Ebenso das Bein …“ Sie macht eine beiläufige Bewegung in Lunas Richtung. Einen Augenblick später scheint sie uns fast vergessen zu haben. Auf der Suche nach den richtigen Zutaten entfernt sie sich langsam, und ich gestehe mir ein, dass ich im Moment nur warten und meinem Einhorn Gesellschaft leisten kann.
„Kannst du dich nicht mit Magie heilen?“, frage ich Luna.
Sie schnaubt, und es klingt abfällig.
Ich lächele. Wenn sie sarkastisch sein kann, geht es ihr wahrscheinlich schon besser.
Dann sehe ich, dass die Soldaten begonnen haben, missmutig ihren Proviant mit meinen Freunden zu teilen. Vielleicht bleibt mir noch ein Moment, bis sie mich holen.
Während das Einhorn neben mir grast, nehme ich das lederne Buch aus meinem Rucksack, das mir Andy gab. Ein guter Moment, um den ersten Eintrag zu machen.
Seit drei Tagen sind wir nun unterwegs. Wir haben unsere Suche begonnen und wurden doch gleich wieder von ihr abgebracht. Während die Vampire Gillian und Joice zwei unserer Einhörner zu Liliths Tempel bringen, werden wir von einer drakónischen Patrouille in die Hauptstadt dieses Landes eskortiert, das außer Krieg nicht viel zu kennen scheint.
Wir müssen abwarten, was uns hinter den Toren Dracgstadts erwartet. Wie man dort über unser Schicksal entscheidet. Aber ich bin froh, dass ich nicht allein bin.
Ich fordere Luna auf, zurück zu den anderen zu gehen, und sie fragt mich unterwegs, was ich geschrieben habe.
„Kannst du etwa nicht lesen?“, necke ich sie. Sie schubst mich mit ihrer Nase, aber im selben Moment verzieht sie das Maul vor Schmerzen. Ich streiche ihr tröstend über den Hals und suche mit den Augen nach Annikki.
Beim Wagen werden die Stimmen lauter. Robin hat sich vor den Soldaten aufgebaut und ist scheinbar auf dem besten Weg, sich ernsthaft mit ihnen anzulegen. Ohne Zweifel stand uns das seit unserem Zusammenstoß bevor; er ergab sich nur uns zuliebe, doch insgeheim habe ich geahnt, dass er früher oder später auf die Barrikaden gehen würde.
„Was ist passiert?“, erkundige ich mich bei Brendan, und er erklärt mir die Entwicklung der Auseinandersetzung.
„Einer der Soldaten meinte zum Hauptmann, er fände es reine Zeitverschwendung, die Gefangenen hier einfach anhalten und aussteigen zu lassen, zumal wir bald in Dracgstadt wären. Darauf sagte Hauptmann Estruhl, niemand außer ihm habe zu entscheiden, ob und wo wir halten und eine Pause machen. Der Soldat bezeichnete ihn als leichtsinnig, uns hier frei herumlaufen zu lassen, und der Hauptmann wies ihn zurecht und sagte, dass wir keine Feinde wären, wogegen der andere schon protestieren wollte. Hier mischte sich Robin ein und forderte eine Erklärung für unsere Gefangennahme, wenn wir doch nicht als Verdächtige angesehen werden. Ein ganz einfaches Dilemma.“ Er zuckt mit den Schultern.
„Ich kann mir gut vorstellen, was er davon hielt“, sage ich – unschlüssig, ob ich das Ganze leichtfertig abtun kann. Gedankenverloren murmele ich: „Hoffentlich macht er keine Dummheiten!“
Wahrscheinlich streiten sie schon eine Weile. Jetzt geht es gerade darum, ob der Hauptmann einen Fehler gemacht hat, indem er uns mitnahm oder aber wir uns nur zur falschen Zeit am falschen Ort befanden. Sicher stimmt beides irgendwie. Vielleicht hätten wir uns mit unserem Auftrag rechtfertigen können, doch von den Einhörnern scheinen die Männer kaum beeindruckt. Aber dürfen sie uns denn einfach so festnehmen und abtransportieren? Dabei fällt mir ein, dass wir die Gesetze in diesem Land gar nicht kennen. Wer weiß, wozu man hier noch alles berechtigt ist? Oder wofür man eingesperrt wird …
Während Hauptmann Estruhl immer wieder auf seinen Befehl von oberster Stelle verweist, der ihn eindeutig dazu auffordert, alle verdächtigen Personen im Umkreis in die Hauptstadt zu bringen, beharrt Robin stur auf seiner Sichtweise, nach der es für unsere Schuld – selbst einen Verdacht – keinen Hinweis gibt. Sein Blick ist finster, und seine Stirn liegt in Falten. Ich bemerke, wie ich nur darauf warte, dass er irgendetwas mit seinen Gedanken davonfliegen lässt. Als deutliche Drohung, oder vielleicht sogar als direkten Angriff.
Aus dem Augenwinkel fixiert er den Drachen, in dessen Satteltaschen unsere Waffen verstaut wurden. Im nächsten Moment hält er ein Schwert in der Hand. Die Soldaten weichen erschrocken zurück, als die Waffe durch die Luft und über ihre Köpfe hinweg in seine Hände gleitet. Der Hauptmann blickt ihn überrascht an.
„Was ist …“, stammelt er, doch Robin lässt ihn nicht ausreden. Estruhl hat seine Lanze beiseite gestellt und trägt nun nur noch ein Kurzschwert an seinem Gürtel, womit er dem Anderthalbhänder eindeutig unterlegen ist. Er pariert einige Angriffe, doch schon nach kurzem Kampf sieht er sich der Klinge Shiraana gegenüber, die auf seine Brust gesetzt ist, und lässt seine Waffe sinken. Noch immer verblüfft blickt er Robin direkt in die Augen.
Mir stockt der Atem, und ich vergesse für einen Moment, dass ich mich um mein Einhorn kümmern wollte. Ich wage nicht, daran zu denken, was als nächstes passiert.
„Hör auf mit dem Blödsinn!“, höre ich Andy sagen und sehe seinen Bruder verächtlich die Nasenflügel blähen.
„Wieso?“, fragt Robin scharf und geht noch einen Schritt auf den entwaffneten Hauptmann zu.
„Das ist kein fairer Kampf mehr“, entgegnet Andy in einem fast schon gleichgültigen Ton. „Er hat kein Schwert, das kann doch jeder. Kinderkram, Robin. Warum hältst du dich damit auf?“
Ungeachtet der übrigen Drachenreiter, die uns mit ihren Lanzen einkreisen, verwendet er diese banalen Argumente, um Robin wieder zur Vernunft zu bringen. Er würde nicht einsehen, dass er keine Chance hat, erkenne ich. Ich dränge mich dichter an Andy heran und taste nach seinen Fingern. Robins Blick springt zu uns.
Ich sehe das besorgte Gesicht von Annikki, die mit einem Strauß harziger Zweige und fremder Kräuter zurückgekehrt ist und nun ein bisschen enttäuscht, aber auch hoffnungsvoll Robins Reaktion beobachtet. Dina sieht man deutlich die Entrüstung über seine Unbeherrschtheit und den Wunsch einzugreifen an, Brendan hingegen blickt unsicher von einem zum anderen. Ihm ist gar nicht wohl bei dem Gedanken, hier demnächst Reste von sich gegenseitig umbringenden Verrückten entsorgen zu müssen. Zumal wir dann vermutlich selbst die nächsten wären.
„Bitte, Robin“, sage ich leise. „Du machst es uns nur schwerer.“
Und endlich lässt er Shiraana sinken und wendet seinen Blick von dem immer noch ruhigen Hauptmann ab. Die Soldaten mustern ihn misstrauisch, als er ihnen den Rücken zukehrt. Dina verpasst ihm eine Ohrfeige für sein Benehmen – ihre Art, ihm zu zeigen, wie töricht sie es findet, sich mit den drakónischen Drachenreitern ein Duell zu liefern. Mit einer geschickten Bewegung greift Robin sie am Arm und hält sie fest.
„Lass das bleiben!“, fährt er sie an und schiebt sie unsanft von sich weg.
Andy hat nur einen strengen Blick für ihn übrig und gibt ihm mit einem Nicken zu verstehen, wieder in die Kutsche einzusteigen. Annikki nimmt mir Luna ab und bedeutet mir, den beiden zu folgen. Wir müssen uns alle ein wenig beruhigen.
IIAndy
Wenige Augenblicke später fliegt unsere Kutsche wieder auf den engen Wegen weit über das Land dahin, gezogen von drei trabenden Schimmeln, die es mehr denn je eilig zu haben scheinen, die legendäre Stadt zu erreichen.
Der smaragdgrüne Drache trägt den Hauptmann neben dem Planwagen her – immer ein Auge frei für die Gefangenen. Und auch unsere Pferde, der Drache Clip und die Einhörner werden nun heftig angetrieben, das restliche Stück des Weges in kürzester Zeit zurückzulegen.
Piper sitzt neben mir und notiert etwas in das Buch, das ich ihr gab. Ich lehne mich bei ihr an und genieße ihre Nähe. Gleichzeitig versuche ich, alles um mich herum im Auge zu behalten.
Die Kutsche verlässt die Bergkette, und die Karawane begleitet uns in einem unermüdlichen und nie enden wollenden Trab.
„Am Abend erreichen wir die Stadt“, sagt mir der Hauptmann, als er bemerkt, dass ich ihn beobachte. Ich gebe die Nachricht sofort ins Innere des Wagens weiter.
Wiesen und Wälder fliegen an mir vorüber, während ich die Dämmerung und mit ihr die hoch aufragenden Mauern von Dracgstadt erwarte.
Clip protestiert mit einem vogelartigen Schrei, und Robins Anspannung kehrt sofort zurück. Ich sehe seinen Zügen an, dass er mit den Zähnen knirscht. Der Blick, den er mir zuwirft, ist kühl, aber ich lasse ihm die Zeit, die er braucht. Für den Moment bin ich stolz darauf, dass er überhaupt über seinen Schatten springen und nachgeben konnte.
Piper klappt das Buch zu und legt den Arm um mich. Wir sehen nach draußen, auf Luna und die Soldaten, während sich die Sonne immer mehr zum Horizont neigt. Es ist dieselbe wie in unserer Welt, und in ihrem Abendlicht ziehen wir einen langen Schatten hinter uns her.
Wir durchqueren eine Senke von gelbem, trockenem Gras, das mich an die Steppe daheim erinnert, die Prärie von Texas. Und mit ihr kehrt der Gedanke an die Ranch und meine Pferde, an meinen Vater, meine Cousine und Tante und an meine einsame Mutter zurück, die noch immer um ihre Tochter trauert. Alles was wir tun können, ist, ihr nicht noch mehr zu nehmen. Ich muss besser auf Robin aufpassen.
Der Blick, mit dem er jetzt nach draußen sieht, ist weicher geworden, fast melancholisch. Wahrscheinlich denkt auch er an zu Hause. Er zeigt es niemandem, doch wenn ich ihn anschaue, fühle ich es. Es ist das Blut, das uns beide verbindet. Und ich kann verstehen, was er denkt.
Um uns herum sehe ich viele Drachen vorbeiziehen. Solche, die auf Feldern arbeiten, vor einfache Pflüge oder Eggen gespannt. Drachen, die ihre Besitzer auf dem Rücken tragen und hoch über den Wiesen ihre Bahnen ziehen. Kontrollflüge, denke ich automatisch.
Einige Drachen stehen aber auch ruhig in Ställen, aus denen sie herausschauen und uns nachblicken. Wir passieren viele kleine Orte, Dörfer, aber auch einzeln verstreute Bauernhöfe – alle von Armut gezeichnet, die Einfachheit selbst. Gegerbt von Wetter, Krankheit und Entbehrung. Vom Krieg.
Unsere Reise ist von immer wiederkehrenden Bildern geprägt. Familien mit vielen kleinen Kindern. Junge, misstrauische Mütter, die uns furchtsam hinterher sehen. Hart arbeitende Väter, selbst erfahren von der kalten Grausamkeit der Schlacht. Manchmal gar keine Väter. Und niemals ältere Söhne, keine jungen Männer.
In meinem Kopf spielen sich Schicksale ab, die vielleicht auch mich und Robin erwartet hätten, wären wir hier geboren worden. Zur falschen Zeit am falschen Ort.
Es wird dunkel und kühl auf unserer Reise. Mich überläuft ein Schauer, wenn ich in die Augen dieser Menschen blicke. Sie strahlen so viel Kälte aus, dass man friert. Kälte und Leere. Und Härte, die man sie lehrte.
Sie alle sehen uns nach, als würden sie uns bedauern. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl, was uns erwartet.
Ich schaue nach Piper. Sie ist an meiner Schulter eingeschlafen, ruhiger diesmal. Ich küsse sie auf die Augenlider. Sie ist ein wahrhaftiger Engel, mehr als mir irgendetwas sonst bedeutet. Ich werde alles tun, um sie zu schützen. Um keinen Preis werde ich sie verlieren. Eher würde ich mein Leben für sie geben, auch wenn ich es nicht ertragen könnte, sie allein in dieser Welt zurückzulassen, schutzlos allen dunklen Abgründen ausgeliefert, all den Schrecken und finsteren Mächten. Eine unheimliche Ahnung sagt mir, dass wir noch längst nicht alles gesehen haben.
Draußen setzt langsam die Dämmerung ein, wir müssen bald da sein. Die Soldaten lassen ihre Drachen beschleunigen. Auch die Pferde vor unserer Kutsche scheinen die Nähe der Stadt zu spüren und sich nach ihrem Stall zu sehnen.
Die letzte Stunde unserer Reise verläuft schweigsam. Unsere Begleiter trotten ernst neben dem Wagen her und ich starre hinaus in die Ferne des Landes. Eine aufkommende Brise verrät mir, dass wir uns dem Meer nähern: Ein seichter, salziger Wind. Und tatsächlich taucht nach wenigen Meilen die See vor uns auf. Dann sehe ich auch den Strand; feiner weißer Sand, der sich eng an die Pflasterstraße herandrängt. Links und rechts von uns liegen felsendurchsetzte Dünen, auf der einen Seite im Meer verschwindend, auf der anderen an eine steile Felswand aus Sandstein grenzend. Unendlich hoch ragt sie neben uns auf, wie die kompromisslosen Mauern, die Dracgstadt umschließen – undurchdringlich, unüberwindbar und für niemanden zu passieren, wenn die Stadt es nicht will.
Auch die Natur in dieser Gegend scheint wenig erschlossen, lediglich das Stück des felsigen Strandes hat sie den Menschen abgetreten, um darauf die Hauptstadt ihres Landes zu errichten. Danach folgt die Wildnis. Die Menschen hier sind in ihren Mauern eingesperrt. Und wir vielleicht auch bald.
Majestätisch und mächtig thront sie vor uns, die kalte Festung des Königs. Kalt wie das Land, wachsam, drohend. Beim Anblick der bewehrten Türme stellen sich mir die Nackenhaare auf.
Im Zentrum von Dracgstadt ragt die Burg des Herrschers auf. Aus grob gehauenem Sandstein erbaut, scheint sie das älteste Stück der Hauptstadt zu sein. In ihren Herzen thront der Bergfried. Hinter den Schießscharten vermute ich Soldaten, genau wie auf den Ecktürmen des Walls – dort kann ich sie sogar gut erkennen. Es gibt keine Kuppeln, sondern nur eine flache Landefläche, die mit dunkelgrün oder blau schimmernden Drachen besetzt ist. Dazu wiederum Soldaten, mit Armbrüsten, Katapulten und Fahnen, die die Abstammung des Königsgeschlechts zeigen. An den Masten weht ein blutroter Drache, in einem Wappen, das zur Hälfte violett, zur Hälfte smaragdgrün gefärbt ist. Der Farbton des Wappentiers entspricht wohl der Moral der Soldaten, denke ich zynisch, doch dann werde ich mir der nahenden Tore bewusst. Aufgebracht, aber vorsichtig, wecke ich Piper, indem ich leise mit ihr rede und sie streichele. Eine Sekunde lässt sie mich ihren verschlafenen Blick genießen, dann schreckt sie hoch und reißt die Augen auf.
„Bin ich eingeschlafen?“ Verwirrt sieht sie sich im Wagen um. Die anderen sind noch da, und es geht ihnen gut. Das scheint sie zu beruhigen.
„Wir sind fast da“, sage ich und ziehe den Vorhang noch ein Stück weiter zurück. „Jetzt fahren wir fast schon einen ganzen Tag …“
„Ein ganzer Tag, der uns fehlt und den Vampiren mehr Vorsprung gibt.“
„Daran können wir nichts mehr ändern. Alles, was uns bleibt, ist der Versuch, sie einzuholen. Aber mit jeder Nacht, die sie uns voraushaben, wird das unwahrscheinlicher …“
„Wir kennen ja nicht einmal den genauen Weg“, murmelt Piper.
Nun drängen sich auch die anderen wieder dicht um den Eingang der Kutsche. Die Silhouette der mysteriösen Stadt – jetzt nur noch in geringer Ferne – beeindruckt uns alle. Sie ist zumindest von außen so trostlos, wie das Land es verspricht, und wir sind gespannt, wie sie aus der Nähe aussieht. Ich hoffe das Beste, aber erwarte das Schlimmste.
Die Pflasterstraße begleitet uns weiter, bis in die Hauptstadt hinein. Und auch der feine Sand folgt ihr; in den Ritzen zwischen den runden Steinen wird er vom Wind hin und her geweht und kommt auf ihr und neben ihr in kleinen Dünen zum Liegen. Es sieht aus, als würde die Natur versuchen, die Stadt zurückzuerobern.
Wir passieren das erste Tor. Links und rechts davon stehen Wachposten mit Drachen, die Clip und den Pferden missmutig entgegenschnauben. Und auch auf dem Tor thront ein Drache aus Obsidian, der uns mit seiner steinernen Klaue droht.
Danach folgen ein breiter Wassergraben und darüber eine befestigte Holzbrücke, die an zwei starken Ketten in wenigen Augenblicken hochgezogen werden kann. Dann wieder ein Tor in einer Mauer. Danach noch ein Graben. Und wieder ein Tor. Die halbe Stadt ist von drei Wällen mit unzähligen Wachtürmen und zwei Gräben umgeben. Die andere Hälfte grenzt an die Felswand. Ich sehe nach oben, um herauszufinden, wie weit es dort hinaufgeht. Gleichzeitig erwäge ich mögliche Fluchtoptionen. Doch die Felsen scheinen bis in den Himmel zu ragen. Dort hoch kommt man wirklich nur mit Drachen. Mit den Mitteln, die die Völker hier haben müssen, erscheint mir die Stadt uneinnehmbar. Wir müssen einen anderen Weg finden, um hier rauszukommen.
Die Seeseite von Dracgstadt formt ein weites Hafenbecken; gleich daneben dehnt sich ein Markt aus, wo die Waren verladen werden. Das Salzwasser lässt man durch rostige Eisentore in der Mauer ein, durch welche auch die Schiffe in den Hafen kommen und ihn nach abgeschlossenem Handel wieder verlassen. Selbst das Hafenbecken ist also ummauert …
Piper zeigt auf einen gewaltigen Leuchtturm, der sich draußen vor der Küste aus dem Meer erhebt. Er ist wie alle Häuser der Stadt aus den runden Steinen aufeinandergeschichtet, die das Meer bearbeitet hat. Auf der Dachplattform entfacht ein Drachenreiter ein Leuchtfeuer, indem er sein kräftiges Reittier mit den Schwingen Luft in die Glut fächeln lässt. Meine Lippen bleiben offen vor Erstaunen.
Unsere Straße führt auf den bunten Marktplatz, direkt vorbei am Hafen. Ich beobachte das Treiben zwischen den stoffbespannten halboffenen Zelten. Geschäftige Figuren, die mein Auge an ein Mittelalterfest erinnern, eilen zwischen den Ladentischen umher – die einen Körbe und Säcke tragend, andere Reittiere wie Esel, Pferde und vor allem voll beladene Drachen für den Transport führend. Auf den Tischen liegen dicke Stoffrollen, exotische Tierfelle und große Haufen Schafs- oder Schweinswolle. In einer anderen Ecke befinden sich Heuballen und Säcke mit Getreide, ebenso verschiedene weitere Lebensmittel. Es gibt Körbe gefüllt mit Gemüse, Nüssen und Obst. Stapel von Kürbissen, Gurken, Birnen oder Walnüssen. Ebenso Eier von Vögeln und solche, die wahrscheinlich von Drachen stammen, sanft gepolstert auf kleinen Kissen.
Überall an den Ständen verteilt bieten die Händler auch Tiere zum Verkauf an: Aufgeregt flattern Hühner in engen Käfigen, eine blinde Frau will sich mit einem alten Esel ein Essen verdienen. Schlacht- und Mastvieh, von Ziegen und Ferkeln bis hin zu Hochlandrindern und sogar Lamas und Meerschweinchen kann ich erkennen. Wahrscheinlich Importe aus fernen Ländern.
An einem Stand kann man Zauberutensilien erwerben: Besen und knorrige Stäbe, Hühnerkrallen, getrocknete Eidechsen, Fledermausflügel und Kröten in Gläsern, glitzernde Pulver und staubige Bücher, alles angeboten von der Hexe deines Vertrauens – original mit nur drei Zähnen. Die Situation kommt mir grotesk vor, aber als würde die Alte meinen Blick spüren, wandern ihre zusammengekniffenen Augen zu der Kutsche und zu mir. Ihr fast zahnloser Mund formt ein hämisches Grinsen, und ein bedächtiges Nicken folgt dem Wagen, während wir uns entfernen. Was für ein herzliches Willkommen..
IIIBrendan
In der Burg hatte ich wohl so etwas wie ein Empfangskomitee erwartet. Doch nichts dergleichen ist zu sehen, als wir der gebogenen Pflasterstraße hinauf in den Innenhof folgen und das letzte Tor passieren. Danach durchfahren wir einen langen Zwinger, bis wir schließlich am Torhaus vorbei in den Burghof gelangen. Doch keine Königsfamilie, keine Soldaten, keine Kerkermeister erwarten uns dort. Nur über den Hof verstreutes Gesinde. Knechte, die Dreck und Stroh zusammenfegen; Mägde mit Schürzen und Hauben, die Hühner und Schweine füttern und Körbe mit Gemüse über den Hof tragen. Ein in dunkelblaue Seide gekleideter Geistlicher, der ein Gebet murmelnd zur Kapelle hinüberschreitet. Schilder verraten die Werkstätten von Sattler, Schuster und Schmied. Eine dicke Köchin verlässt voll beladen das Zeughaus und watschelt zur Burgküche – fast frei von jeglicher Sicht, die ihr der Sack Mehl und das Netz Rüben nehmen. Aus einem kleinen Schornstein auf dem schiefen Dach steigt dort bereits Rauch auf, der das Abendmahl ankündigt.
Soeben eilt eine Gruppe bunt gekleideter Musikanten die Treppen zum Herrenhaus hinauf und betritt durch eine breite Flügeltür den großen Saal. Zwei Wachen stehen links und rechts des Portals und lassen die Gruppe passieren. Doch niemand widmet uns seine Aufmerksamkeit.
„Was ist hier los?“, frage ich, unfähig, diese Situation zu begreifen. Dabei sehe ich Annikki an, in der Hoffnung, dass sie mehr Ahnung von diesem Land hat als wir.
„Was habt ihr denn gedacht?“, fragt sie verständnislos und zuckt mit den Schultern. „Glaubt ihr, dass sie uns umbringen wollten? Das hätte man schon längst tun können!“
Das klingt zwar einleuchtend, aber ich bin noch immer misstrauisch. Wir werden den weiten Weg kaum umsonst zurückgelegt haben …
Hauptmann Estruhl lässt seine Männer absitzen. „Steigt aus!“, weist er uns an und wirkt dabei ein wenig angespannt. „Der König soll nun entscheiden, was weiter mit euch geschieht.“
Bei diesen Worten positionieren sich je zwei der Soldaten mit ihren Lanzen vor und hinter uns und treiben uns weg von unseren Pferden und Einhörnern. Auch der Drache bleibt zurück bei der Kutsche und sieht uns traurig hinterher.
Dem Hauptmann folgend treten wir zusammen mit den Soldaten durch die hohe Eichentür und hinein in den Thronsaal des Königs.
Uns erwartet ein Anblick, den ich mir nicht hätte träumen lassen. Einen so prunkvollen Saal bekommt man in unserer Welt nur noch im Film zu sehen. An den langen Seitenwänden reihen sich Säulen aneinander, an denen sich detailliert gemalte Bohnenranken emporwinden. Alle Wände sind mit wollenen Wandteppichen geschmückt, die Heldentaten von Rittern mit Drachen zeigen. Doch nicht im Kampf gegen sie, sondern gemeinsam mit ihnen. Allein diese Tatsache fasziniert mich.
Fünfzehn Fuß über uns wölbt sich eine pastellfarbene Kassettendecke und darunter – in die hohe Seitenwand eingefügt – prangen runde Bleiglasfenster, die einen Blick auf die im Meer versinkende Sonne und den Leuchtturm im Abendlicht erlauben.
Unter uns auf dem Boden breitet sich ein Mosaik aus, das das Wappen der Stadt zeigt. Eine ganze Menschenmenge trampelt auf dem backsteinroten Drachen herum, während die Musiker, die ich eben noch auf dem Hof sah, ein dramatisch klingendes Lied spielen. Dazu singen sie von sterbenden Menschen, brennenden Feuern und fliegenden Drachen. Aber die Leute hier scheinen diese Lieder völlig normal zu finden und schreiten weiter im Tanz umeinander.
Edel gekleidete Damen mit komplizierten Steckfrisuren – Wulsten, Schnecken und Hörnern – bewegen sich geschmeidig zum Klang der fremdartigen Instrumente, die für mich wie Dudelsäcke, eckige Pauken und Tambourins mit Muschelschalen aussehen. Die Männer und auch die Frauen tragen schweren, bestickten Samt oder Brokat und auffälligen Schmuck. Die Damen zeigen ausnahmslos tiefe Dekolletés, und auf ihren Köpfen sitzen Hauben und Schleier, unter denen ihre seltsamen Frisuren stecken.
Ich komme mir vor wie in der Zeit zurückversetzt, umgeben von so vielen seltsamen Erscheinungen. Auch meine Freunde bekommen die Münder vor Erstaunen kaum zu und sehen sich um, als würden sie die Welt nicht mehr verstehen.
Uns gegenüber, an der kurzen Seite des Saals, ist ein runder Tisch aufgebaut, um den mindestens ein Dutzend eigenartig aussehender Leute sitzen: Manche mit grüner oder blauer Haut, einige mit seltsamen Auswüchsen auf den Köpfen. Ein paar von ihnen ähneln Menschen, doch einer hat den Kopf eines Affen und ein anderer den eines Fischs und darüber ein Goldfischglas mit Wasser – wohl, um atmen zu können! Eine Frau trägt statt Haaren rote Korallen, die sich wie ein Baum verzweigen und hoch aufragen. Die mit Abstand merkwürdigsten Leute, die ich je sah. Und das, obwohl ich selbst die Pooka und die Vilvuks im Wolf Forest kennengelernt habe! Ungläubig schüttele ich den Kopf. Doch die fremden Wesen bemerken uns kaum, da sie völlig vertieft zu sein scheinen in das, was sich auf dem Tisch abspielt.
In einem schweren fellbezogenen Thron sitzt der König und denkt nach, das Kinn auf die Faust und den Ellbogen auf den Tisch gestützt. Auf seinem Haupt trägt er einen edelsteinbesetzten Silberreifen als Krone.
Für uns hat er überhaupt keine Augen. Er scheint noch nicht einmal bemerkt zu haben, dass wir eingetreten sind, doch bei der Menschenmasse, die uns in ihrem Treiben regelmäßig die Sicht verdeckt, sind ein paar unscheinbare Krieger wohl auch nicht nebenbei zu registrieren.
„Seid gegrüßt, König Sevard vom marmornen Fels und Königin Solae, Sonne des Ostens!“, spricht der Hauptmann mit fester Stimme und übertönt sogar die Musik, was die Künstler irritiert einhalten lässt, den König jedoch nicht einmal dazu bewegt, den Blick zu heben.
Die Frau neben ihm nickt dem Hauptmann wohlwollend zu – hier muss es sich wohl um die Königin dieses Reichs handeln. Mäßig interessiert folgt auch sie dem Geschehen auf dem Tisch, doch der König selbst scheint ganz und gar gebannt davon.
Er starrt auf ein großes Feld, das wie eine Karte aussieht, die direkt in die Tischplatte geschnitzt wurde: Berge und Täler lassen sich ausmachen, und sogar Flüsse und Meere, in denen Wasser fließt! Ich recke neugierig den Hals und erkenne, dass verschiedene Teile der Karte mit Beschriftungen wie Drakónien, Surália und Vineta versehen sind. Auf einigen der Felder stehen winzige modellierte Burgen aus Lehm oder Ton, manche zerfallen, manche in Beschuss. Überall auf dem Feld sind kleine Armeen aus lebenden Figuren verteilt, die umherlaufen, schwere Belagerungswaffen schieben und mit etwas wie brennenden Streichhölzern schießen, was gelegentlich einige von ihnen umkippen lässt.
König Sevard gibt noch immer keine Antwort. Doch plötzlich scheint ihm ein Einfall gekommen zu sein. Er geht eifrig zu Werke, verschiedene Armeen hin- und herzuschicken, und gibt den Befehl: „Sturm auf die Burg! Das wäre doch gelacht, wenn wir nicht Vierströme noch erobern würden!“
Erfreut reibt er sich die Hände und richtet sich dann an uns, wobei er das erste Mal von seinem Schlachtfeld aufsieht.
„Was gibt es, Hauptmann?“, fragt er ungeduldig. „Ich befinde mich im Kriegszustand!“
„Mein König, dies sind Verdächtige, auf die wir an der westlichen Grenze stießen, in den inneren Limithen.“
„Nun, wie Waldmenschen der Grasberge sehen sie nicht gerade aus!“, lacht er; und der ganze Tisch stimmt mit ein.
„Was befehlt Ihr, soll mit ihnen geschehen, mein König?“
„Ich habe jetzt keine Zeit, selbst Entscheidungen zu treffen, holt meinen Entscheidungsfäller!“, meint der König ungehalten. „Oder noch besser: Sperrt sie einfach ins Verlies, vielleicht wird sich später jemand darum kümmern.“ Plötzlich stößt er einen Freudenschrei aus: „Sieg! Die Südlande gehören mir! Jetzt ist es nicht mehr weit bis Atlantis!“
Jubelnd reibt er sich die Hände und schiebt seine Armee ein Feld vor, wobei die kleinen Figuren hilflos durcheinanderstolpern und stürzen. Dann nimmt er erst einmal einen kräftigen Schluck aus einem silbernen Bierkrug.
„Was wollt Ihr denn mit diesem Reich der Dichter und Denker?“, äußert die Königin belustigt. „Ihr habt doch gar keinen Sinn für die Kunst!“
„Aber für den Handel und den Krieg!