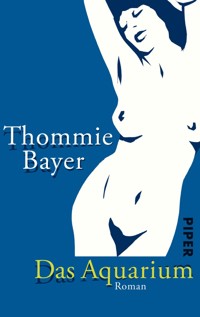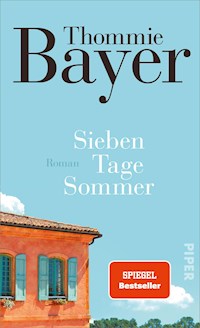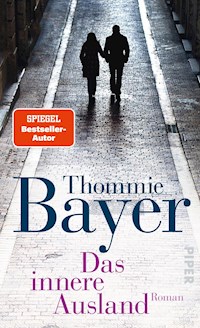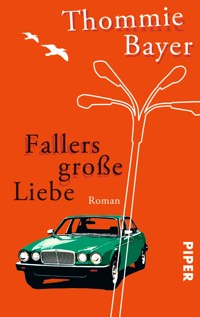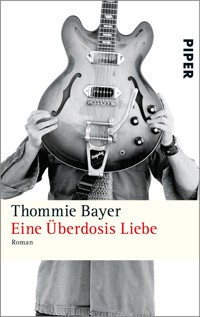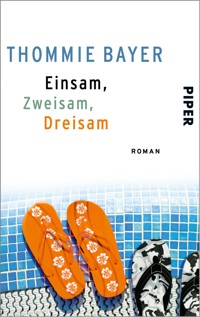9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Silvie hat ihren Mann verloren, Simon seinen Vater. Und nicht nur die Trauer verbindet die beiden, vor allem Simon empfindet eine große Seelenverwandtschaft für die um Einiges ältere Silvie. Er ist sich schnell sicher, dass es Liebe ist. Doch er glaubt warten zu müssen, auch weil Silvie zu sehr vom Tod ihres Partners verwirrt ist. Er wartet, bis der richtige Moment verstrichen ist, bis zuviel geschehen ist, das sich so leicht nicht mehr rückgängig machen lässt. Aber das Schicksal und die gegenseitige Zuneigung führen die beiden immer wieder zusammen. »Die langen und die kurzen Jahre« ist die klassische Geschichte zweier Liebender. Thommie Bayer erzählt von der tragischen Ungleichzeitigkeit der Liebe und schreibt dabei einen äußerst zeitgemäßen Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Jone
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
ISBN 978-3-492-96606-1
© 2014 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.de Umschlagmotiv: Kornelia Rumberg (Blätter); Hagen Keller / tale of years (Karusell) Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Es gibt Anblicke, von denen ich nicht weiß, ob sie mir gut- oder wehtun, ob ich hinsehen darf oder den Blick abwenden soll, und irgendwann habe ich den Blick abgewandt und bin beschäftigt damit, mir selbst zu erklären, dass das eben Gesehene kein Zeichen war, keine Botschaft an mich, sondern einfach das Leben, an dem jeder zumindest mal vorbeikommt, falls er, wie ich, nicht mehr daran beteiligt ist.
Der Bahnsteig in Singen füllt sich mit denen, die aus meinem Zug aussteigen, unter ihnen ein vielleicht vierzigjähriger Mann mit kleinem Gepäck, offenem Gesicht, Lederjacke und blonden Locken.
Ich sehe, wie er seine Tasche fallen lässt, die Arme ausbreitet, strahlt und ein kleines Mädchen, vielleicht sechs, vielleicht sieben, in diese Arme springt, die Beine um seine Taille klammert, die Arme um seinen Hals und wie ein Kätzchen Kinn und Wange an seiner Schulter reibt.
Als der Zug seine Fahrt nach Stuttgart fortsetzt, sind die beiden längst verschwunden, aber ich behalte ihr Bild noch bei mir bis Schwäbisch Gmünd, wo ich, am Ende meiner Reise, aus dem Taxi steige, auf das große Gebäude eines ehemaligen Klosters zugehe, immer langsamer, je näher ich dessen Tür komme, und ich wünschte, ich müsste da nicht hinein, aber das Wünschen hilft schon lange nicht mehr, die Zeiten sind vorbei.
1964
Als das Wünschen noch half, war ich zwölf und wollte, dass mein Vater stirbt. Irgendwas musste ich aber falsch gemacht haben, denn es erwischte meine Mutter. Sie war im Garten und grub Küchenabfälle in den Komposthaufen ein, damit mein Vater sie nicht sehen und über das verschwenderische Wegschneiden der äußeren Salatblätter meckern würde, etwas kitzelte sie am Hals, sie hielt es für eine Schmeißfliege und schlug danach, aber es war eine Hornisse.
Ich saß in der Pergola und zeichnete einen Indianer, als ich ihren Schrei hörte und sah, wie sie die Treppe herab zum Haus rannte, ich folgte ihr und fand sie im Flur am Telefon, wo sie die Nummer des Arztes von einem kleinen Notizblock ablas, der an der Wand an einem Bastfaden mit Reißzwecke hing.
Die Telefone waren damals noch schwarz und hatten Wählscheiben, man steckte einen Finger in ein Loch und drehte bis zum Anschlag, dann ließ man los, und ein filigranes Rasseln ertönte, bis die Wählscheibe sich wieder in ihre Ausgangsposition zurückbewegt hatte. Ich bin froh, dieses Rasseln heute nirgendwo mehr hören zu müssen.
Sie schickte mich zu den Nachbarn, die ein Eisfach im Kühlschrank hatten, denn sie wollte die einem verrutschten Kropf ähnelnde Schwellung am Hals mit Eiswürfeln kühlen. Ich rannte los, klingelte, aber niemand machte auf, ich rannte weiter zum nächsten Haus und hatte Glück. Man gab mir eine rechteckige Blechschale mit einem Gitter darin, das ich nur herausziehen müsse, dann könne ich einzelne Eiswürfel abbrechen. Als ich zurückkam, war sie tot.
»Geh raus, Junge«, sagte der Arzt, der sich über sie gebeugt hatte und, wie ich später verstand, einen Luftröhrenschnitt versuchte, ich gehorchte und setzte mich vor die Haustür, es war Ende Oktober, und die Luft roch nach Kartoffelfeuern. Ich hörte wieder das Rasseln des Telefons und war stolz auf das Drama, das ich erlebte, und gespannt darauf, wie sich echte Trauer anfühlen würde.
1974
Als mein Vater dann viel später wirklich starb, waren die Telefone grün, rot oder beige, und ich wünschte mir nichts mehr. Nicht nur, weil es beim letzten Mal so schiefgegangen war und ich mir eigentlich hätte Vorwürfe machen müssen, schließlich hatte ich meine Mutter auf dem Gewissen. Aber ich machte die Vorwürfe nicht mir, sondern meinem Vater, der sich irgendwie aus der Schusslinie meines Fluchs gebracht und ihn auf meine Mutter umgeleitet hatte, und ich wusste längst, dass Wünsche nur etwas für Frauen und Kinder sind. Männer haben Pläne.
Ich war zweiundzwanzig und verdiente mein Geld als Klavierstimmer, nachdem ich von der Musikhochschule abgelehnt worden und aus einer Lehre als Klavierbauer rausgeflogen war.
Ein Polizist stand morgens um elf im Musikladen, wo ich gerade neue Geigensaiten einsortierte, das war mein Nebenjob, immer wenn ich keine Stimmaufträge hatte, half ich im Laden aus. Der Polizist fragte nach Herrn Stiller, ich sagte, der sei ich, und er änderte seinen Gesichtsausdruck von neutral auf besorgt.
»Ihr Vater wurde ermordet«, sagte er.
Ich sagte nichts, weil das absurd war. Mord gab es nur im Fernsehen und in Büchern, genauso wie Liebe und Spionage. Nicht dass ich viel ferngesehen oder gelesen hätte in dieser Zeit, aber früher hatte es Phasen gegeben, in denen die wirkliche Welt an dem, was ich erlebte, nur geringfügig beteiligt gewesen war.
Irgendwas musste ich mit dem Polizisten geredet haben, zumindest er mit mir, denn als er irgendwann wieder gegangen war, sah ich durch den Nebel in meinem Kopf das Bild zweier erschlagener Männer vor der Hütte am Feldberg, die mein Vater von seinem Vater geerbt und in der er seit einiger Zeit als Rentner gelebt hatte. Ohne Strom und Telefon. Und ohne Kontakt zu mir. Unser letztes Treffen lag schon Monate zurück.
Diesmal war ich nicht stolz auf das Drama, aber Trauer, wie sie mich nach dem Tod meiner Mutter bald mit Macht eingeholt und monatelang zu einer Art Roboter gemacht hatte, empfand ich nicht. Nicht nach der Nachricht und auch nicht später am Grab – mein Vater war mir so fremd geworden, dass ich nur eine Art inneres Achselzucken für ihn zustande brachte. Die Erinnerungen an meine frühe Kindheit hielt ich längst für Einbildung. Auch die wenigen Fotos aus der Zeit, bevor er angefangen hatte, meine Mutter zu drangsalieren mit seiner ätzenden ständigen Kritik und seinem noch ätzenderen tagelangen Schweigen, schienen mir keine Beweiskraft mehr zu haben – die jüngere Vergangenheit hatte sich über die ältere gelegt und alles verdeckt, was daran schön gewesen sein mochte.
~
Ich fuhr mit dem Simca meiner Freundin zum Feldberg mit offenem Fenster, weil es August und sehr heiß war und ich außerdem rauchte, was sie nicht riechen sollte – sie hatte es verboten, um den Wiederverkaufswert des Autos nicht zu schmälern. Die meiste Zeit kroch ich hinter Lastwagen her, weil ich es nicht wagte zu überholen. Als ich durch Geisingen fuhr, sagte der Moderator im Autoradio, dies sei der heißeste Tag seit hundertvierundzwanzig Jahren, dann lief Jessica von den Allman Brothers und danach Monika von Hannes Wader.
Ich wollte die Hütte verkaufen und mir vorher ein Bild davon machen, was ich alles ausräumen und abtransportieren müsste, ob ich eine Umzugsfirma brauchen oder selbst mit einem gemieteten Transporter klarkommen würde.
Es war mein zweiter Versuch. Ich hatte diesen Weg schon einmal vor zehn Tagen gemacht, zusammen mit Astrid, so hieß meine Freundin, aber wir waren nicht weiter als bis zur Lichtung gekommen, weil ich auf einmal einen Widerwillen dagegen verspürt hatte, das Haus zu betreten, die Stelle zu sehen, an der mein Vater gelegen hatte, vielleicht noch irgendwo Leichengeruch zu riechen – es war einfach unmöglich gewesen weiterzugehen. Astrid hatte mich angesehen, als wäre ich ein Idiot in ihren Augen, aber ich war ein Idiot, den man schonen musste. Ein Idiot, dessen Vater gerade ermordet worden war. Sie spottete nicht und meckerte nicht, sondern fuhr bereitwillig mit mir zum Titisee, wo es mir zu kalt zum Schwimmen war und sie sich endlich darüber lustig machen konnte, dass ich ein Weichling sei.
Ich parkte im Wald neben dem weißen Renault 16 meines Vaters und einem hellgrünen VW-Käfer und ging den Rest des Weges zu Fuß, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mit dem Simca ohne Achsenbruch oder Loch in der Ölwanne über die Wurzeln und Steine bis zur Hütte gekommen wäre. Es gab keinen offiziellen Weg, nur Förster, Jäger, Pilzsammler, mein Vater und ich wussten, in welcher Richtung die kleine Lichtung lag, neben der sich das Häuschen an den Hang schmiegte.
Das Gras auf dem Vorplatz stand schon wieder hoch. Seit der Polizist mich informiert hatte, waren drei Wochen vergangen. Es gab kein Blut und keine Spuren, die Hütte sah aus wie eh und je, leicht vergammelt mit hier und da ein paar zerbrochenen Schindeln, sie hockte irgendwie vorläufig, wie zu einer kurzen Rast, als wolle sie gleich weiter, in der Nachmittagssonne, die sich schon den Baumwipfeln genähert hatte und bald dahinter verschwunden sein würde.
Ein Liebespaar hatte die Leichen gefunden, Sportler, eine Handballerin und ein Zehnkämpfer, die im nahen Trainingszentrum untergebracht und sicher zu Enthaltsamkeit verdonnert worden waren. Sie hatten im Wald nach einem Platz gesucht und vielleicht voller Vorfreude die Lichtung entdeckt, aber dann musste ihnen die Lust aufeinander vergangen sein, als die vielen Fliegen von den beiden leblosen Körpern aufstoben. Ich stellte mir den Anblick vor, aber außer Ekel löste das nichts bei mir aus.
Ich schloss auf, ging durch alle Räume und öffnete die Fenster, zuerst unten im Wohn- und Esszimmer mit der kleinen Küche, dann oben im Schlafzimmer unterm Dach, dann drehte ich mir eine Zigarette und ließ meinen Blick über die Regale schweifen, auf der Suche nach Büchern, die ich behalten wollte.
Dann hörte ich die Schreie einer Frau. Sie konnten von der Quelle kommen, die ihr stetiges Rinnsal am Hang unterhalb der Hütte in einen hölzernen Trog ergoss, den mein Großvater gebaut und mein Vater repariert hatte. Ich rannte nach draußen, ums Haus und in Richtung der Schreie, aber stoppte dann abrupt, weil mir der Gedanke kam, dass die Frau vielleicht angegriffen wurde und ich mich in eine gefährliche Lage brachte. Ich schlich, so schnell ich konnte, von oben heran, um erst mal zu sehen, was sich abspielte, dabei ließ ich den Blick schweifen nach einem Stück Holz, das als Waffe infrage käme, aber ich fand nichts.
Vorsichtig näherte ich mich der Stelle oberhalb der Quelle, und als ich die Szene vor Augen hatte, verstand ich, was an den Schreien ungewöhnlich gewesen war: Sie klangen nicht verzweifelt, schmerz- oder angsterfüllt.
Einerseits wollte ich sofort zurückweichen, als ich sah, dass die Frau nicht in Gefahr war, aber andererseits war sie nackt. Sie wusch sich am Trog, und ihre Schreie kamen vom eiskalten Wasser, das sie sich immer wieder mit den Händen an verschiedene Stellen ihres Körpers warf. Sie hatte rotes langes Haar, leuchtender, als man es mit Henna hinbekam, und außerdem verifiziert durch den nur wenig blasser leuchtenden kleinen Schamhaarbusch, von dem ich den Blick nur wandte, um den Rest ihres Körpers nicht zu verpassen.
Ich stand schief, in einer Haltung zwischen Nach-vorne-Stürzen und Schnell-Verschwinden, und ich stand auf moosigem Boden, also rutschte ich aus und fiel auf den Hintern. Meine Hoffnung, damit auch aus ihrem Blickfeld verschwunden zu sein, erfüllte sich nicht, sie sah mich – ihr Schrei klang jetzt anders, erschrocken, empört, zornig –, sie bückte sich nach ihren Jeans, um diese irgendwie vor sich zu halten, bedeckte aber damit nur ihre Brüste – der rote Schambusch lugte zwischen den Hosenbeinen hervor. Ich musste unendlich blöd dreinschauen, während ich mich aufrappelte und meinen Blick höflich zur Seite wandte.
»Was machen Sie hier?«
»Ich dachte, Sie seien in Not oder so«, sagte ich.
Ich sah nicht hin, aber ich hörte sie nach einer kurzen Pause lachen: »Stimmt ja irgendwie. Das Wasser ist so saukalt, dass man blaue Flecken davon kriegt.«
Ich hörte, wie sie zu mir hochkam, und sah wieder in ihre Richtung. Sie war angezogen und trug eine Umhängetasche aus indischem Stoff mit Goldfäden und kleinen Spiegelchen über der Schulter. Mir fiel ein, dass ich keine Unterwäsche gesehen hatte, nur noch ein T-Shirt und die labbrige gehäkelte Jacke, die jetzt über ihrem Arm hing.
»Und was machen Sie hier?«, fragte ich.
»Ich bin von Menzenschwand hier hochgewandert und war total verschwitzt.«
»Ich meine, warum sind Sie hier hochgewandert?«
»Mein Mann hat hier gewohnt, sein Auto muss hier irgendwo sein, das will ich abholen.«
»Ihr Mann? Dann müssten Sie meine Stiefmutter sein. Das wüsste ich dann doch.«
»War das Ihr Vater? Der hier ermordet wurde?«
»Ja«, sagte ich. Das zweite Todesopfer musste ihr Mann gewesen sein und der grüne Käfer ihm, das heißt jetzt ihr gehören.
Sie reichte mir ihre Hand. »Sylvie«, sagte sie. »Spengler. Das tut mir leid mit Ihrem Vater.«
»Stiller«, sagte ich, »Simon.«
»Wir haben dieselben Initialen.«
»Ja. Keine schönen.«
»Doch. Die Buchstaben können nichts für ihre Bedeutung im Dritten Reich.«
»Na ja«, sagte ich, »ein Monogramm würd ich mir nicht in die Wäsche sticken lassen.«
Ihr Mann und mein Vater waren vor Kurzem hier ermordet worden, und wir plauderten über die Anfangsbuchstaben unserer Namen. Das war absurd. Aber es war auch ein Weg, die peinliche Situation, in der ich wie ein Spanner ausgesehen hatte, vergessen zu machen. »Wollen Sie einen Kaffee?«, fragte ich.
»Gibt’s das hier?«
»Wenn ich den Herd ankriege. Und wenn Sie Nescafé ertragen können. So, wie ich meinen Vater kenne, hat er keinen richtigen da.«
Als ich die Flamme mit dem ersten Streichholz anbekam, ohne groß mit der Propangasflasche herumhantieren zu müssen, und zwei Teelöffel in dem kleinen Gitter neben der Spüle stehen sah, kam mir zu Bewusstsein, dass mein Vater mitten in seinem Alltag einfach aus dem Leben geschlagen worden war, und es fühlte sich wie ein Kreislaufzusammenbruch an. Ich stand da und starrte auf die Flamme, bis ich die Stimme von Frau Spengler hörte: »Was ist?«
»Weiß nicht.«
Sie sah mich prüfend an, nahm mir den kleinen Topf mit Wasser aus der Hand und stellte ihn auf die Gasflamme.
»Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Vater?«
»Bis vor etwa zwölf Jahren ja, seither gar keines.«
Sie schwieg und öffnete, so als kenne sie sich aus, als gehöre sie hierher, die Tür des Schränkchens an der Wand, um zwei Porzellanbecher herauszunehmen. Auf einmal ärgerte mich ihre Frage. Vielleicht ärgerte mich auch meine Antwort, vielleicht war es auch der Kreislaufabsturz – ich hatte den Wunsch, gegen etwas zu treten, aber ich beherrschte mich, und der Wutanfall ging vorüber.
»Kannten Sie meinen Vater?«, fragte ich, um durch höfliche Konversation einem Rückfall vorzubeugen.
»Um Gottes willen. Nein.«
»Wieso um Gottes willen?«
Sie sah mich schon wieder so forschend an, schwieg eine Zeit lang und sagte dann leise: »Sie wissen es also nicht.«
»Was weiß ich nicht?« Der Wutanfall wollte zurückkommen, ich spürte es genau. Ich stemmte nicht wie ein Volksschauspieler die Hände in die Hüften, aber ich fühlte mich irgendwie sprungbereit oder alarmiert. Ich würde bellen oder beißen, wenn sie jetzt was Falsches sagte.
»Ihr Vater und mein Mann waren ein Liebespaar«, sagte sie, »sie waren …«
Sicher wusste sie nicht, welches Wort sie verwenden sollte, Homos, Tunten, vom anderen Ufer, warme Brüder oder Schwule. Das hätte ich auch nicht gewusst. Ich hatte das Gefühl, darauf achten zu müssen, dass ich wieder Luft bekam – mein letztes Einatmen schien mir eine ganze Weile her zu sein. Sie sah mich an.
»Tut mir leid«, sagte sie.
Das Wasser kochte. Ich stellte den Herd ab. Sie löffelte Nescafé in die Becher, und ich goss das sprudelnde Wasser darüber. Wir blieben in der Küche stehen, bliesen über die Oberflächen unserer Kaffees, stellten die Tassen nicht ab, sahen beide aus dem kleinen Fenster auf die Heidelbeeren, Farne und Fichtenschösslinge davor und schwiegen.
»Er hatte den David von Michelangelo in seinem Arbeitszimmer hängen«, sagte ich irgendwann.
»Das passt.«
»Ja.«
Sie trank einen Schluck von ihrem Kaffee und verzog das Gesicht.
»Schmeckt scheiße?«, fragte ich.
»Na ja«, sagte sie.
»Gehen wir raus?«
~
Auf dem Vorplatz wollten wir nicht sitzen. Dort waren sie gefunden worden. Ich führte Frau Spengler ums Haus herum, an der Längsseite stand noch eine Bank. Hier war Schatten. Ich drehte ihr eine Zigarette, dann mir eine, dann zündeten wir beide an und sahen dem Rauch hinterher.
Sie war älter als ich. Vielleicht dreißig, dachte ich, aber ich war nicht geübt darin, das Alter von jemandem zu schätzen, und ich war auch nicht geübt im Umgang mit Frauen, die man danach nicht fragen durfte. Nein, das war falsch. Beim Klavierstimmen hatte ich oft mit den Damen des Hauses zu tun, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, ihr Alter wissen zu wollen. Außer einmal, bei dieser Oberarztgattin mit dem Bösendorfer aus Rosenholz, aber das gehört nicht hierher. Sylvie Spenglers Anwesenheit neben mir auf der Bank war beruhigend und irritierend zugleich. Beruhigend war, wie sie die Stille ertrug, wie sie schwieg, ohne nervös zu werden oder mich nervös zu machen, wie sie einfach dasaß, die Ellbogen auf den Knien, und vor sich hinstarrte, ohne irgendetwas wie Düsterkeit um sich zu verbreiten, obwohl wir doch am Schauplatz des Mordes an unseren Angehörigen waren. Irritierend war, dass sie keine Unterwäsche trug und ich wusste, wie sie unter den Kleidern aussah.
Erst nach einiger Zeit begann sie zu erzählen. Die Polizei sei schon dreimal bei ihr gewesen und habe sie befragt, offenbar verdächtige man sie, weil Konrad, ihr Mann, erst vor einem halben Jahr eine Lebensversicherung zu ihren Gunsten abgeschlossen habe. Direkt nach seiner Eröffnung, dass er einen Mann liebe. Er hatte sie angefleht, bei ihm zu bleiben und trotzdem Kinder mit ihm zu bekommen, er wollte ihr seine Apotheke überschreiben, das hatte sie aber abgelehnt, und stattdessen war er eines Abends mit der Police in der Hand dagestanden.
Eine Zeit lang schwieg sie wieder, bis sie tief einatmete und mich ansah: »Sylvie«, sagte sie, »wir sind doch jetzt irgendwie verwandt.«
»Simon.«
»Wie alt bist du?«
»Zweiundzwanzig, wieso?«
»Nur so«, sagte sie.
Ich fragte nicht nach ihrem Alter.
»Ich habe mich immer bedeckt gehalten. Ich habe Konrad nie reinen Wein eingeschenkt. Er ist gestorben in dem Glauben, ich würde bei ihm bleiben.«
»Und das wolltest du nicht?«
»Auf keinen Fall. Die Vorstellung, dass er mit seinem …«
Ich wartete. Vielleicht wollte sie ja weiterreden. Und wenn nicht, dann würde ich nicht nachfragen. Sie redete weiter.
»Die Vorstellung, dass er mit einem Mann zusammen war und dann mit mir ein Kind machen will, hat mich geekelt.«
Vielleicht hatten wir dasselbe vor Augen. Ich stellte mir einen Mann vor, der einen anderen Mann penetriert. Keiner der beiden hatte das Gesicht meines Vaters. Eigentlich hatten sie beide kein Gesicht. Nur die für den Vorgang notwendigen Körperteile.
»Bist du …«, fing ich an, aber ich wusste nicht, wie weiter, also versuchte ich es noch mal anders: »Tut er dir leid?«
»Irgendwie schon«, sagte sie, »aber es ist auch so neutral, so weit weg, es ist, als wäre da jemand gestorben, der mir nichts bedeutet. Es tut mir nur noch für ihn leid, nicht mehr für mich.«
»So ähnlich geht’s mir mit meinem Vater«, sagte ich.
Sie ging nicht darauf ein. Das war mir recht. Meine fehlende Sohnesliebe war kein vergleichbares oder irgendwie relevantes Thema, es war ihrer Bitterkeit, der Verletzung, Enttäuschung, oder was auch immer sie fühlen musste, nicht ebenbürtig.
»Er hieß übrigens Klaus«, sagte ich nach einer Weile. »Sie hatten auch dieselben Initialen.«
~
Fast eine halbe Stunde lang saßen wir da und betrachteten den Boden zwischen unseren Füßen, rauchten Zigaretten, die ich uns drehte, und schwiegen.
Irgendwann sagte sie: »Die ermitteln jetzt vielleicht in die falsche Richtung, die wissen nichts von der Homobeziehung, die haben keine Ahnung davon und halten sich, obwohl nichts weggekommen ist, an der These vom Raubmord fest. Die mit mir als Täterin müssten sie inzwischen aufgegeben haben. Seit der Todeszeitpunkt feststeht, hab ich ein Alibi und käme höchstens noch als Auftraggeberin infrage.«
»Und du hast ihnen nichts davon gesagt?«
»Nein.«
»Wieso nicht?«
»Zuerst dachte ich, ich wollte Konrads Andenken nicht beschmutzen, aber das war Heuchelei. Ich will in Wirklichkeit nicht dastehen als die verschmähte Frau.«
Ich schwieg eine Weile, denn mit ihr über Sex zu reden machte mich verlegen. Aber schließlich sagte ich: »Du bist doch aber für jeden Mann ein Traum. Tröstet dich das nicht?«
»Für diesen einen war ich eher der Albtraum.« Sie lächelte mich an. Dann fuhr sie mir mit einer fahrigen, vorläufigen Bewegung kurz durch die Haare und drehte sich wieder weg.
»Bis jetzt tröstet’s mich noch nicht«, sagte sie ein wenig später, »aber das kann ja noch kommen. Danke für die Idee.«
»Das ist keine Idee«, sagte ich und sah nicht zu ihr hin. Ich wusste, dass sie wieder lächelte.
»Wenn jetzt irgendjemand die beiden mal gesehen hat, ein Wanderer oder so, vielleicht haben sie sich geküsst oder was weiß ich, kann der dann nicht auf die Idee gekommen sein, mit einem Eisenrohr oder so was wieder herzukommen, um diese unsittlichen Sünder aus der Welt zu schaffen?«
»Soll ich es der Polizei sagen?«
»Nein.«
»Wieso gehen die eigentlich von Raubmord aus, wenn nichts fehlt, das ist doch bescheuert.«
»Sie haben jetzt die Theorie, dass der Mörder vielleicht überrascht wurde und floh, bevor er was mitnehmen konnte.«
»Nicht sehr überzeugend.«
Wieder schwiegen wir, sie gelassen und ich durcheinander, weil mir Gedanken durch den Kopf rasten, die ich nicht festhalten konnte. Es blitzte oder wetterleuchtete durch mein Gehirn, dass ich neben einer Mordverdächtigen saß, die ich vor Kurzem nackt gesehen und durch meinen Trostversuch zum Traum aller Männer, in Wirklichkeit vor allem zu meinem Traum erklärt hatte, dass mein Vater mit einem Mann zusammen gewesen war, dass der Mörder jederzeit wieder auftauchen konnte, um den Rest der verkommenen Familie vielleicht auch noch zu erledigen, dass wir vielleicht über Nacht hierbleiben konnten und …
»Schläfst du hier, oder fährst du nach Hause?«, fragte sie.
»Weiß nicht«, sagte ich.
»Ich mach mich jedenfalls langsam auf. Ich muss noch einkaufen, wenn ich daheim bin.«
»Wo ist das?«
»Lindau.«
Jetzt wurde mir bewusst, dass der grüne Käfer eine Lindauer Nummer hatte. Das war mir aufgefallen, aber nicht im Gedächtnis geblieben.
»Du solltest nachschauen, ob es hier noch verderbliche Sachen gibt«, sagte sie, »nicht dass dir das Haus noch von innen her verfault.«
~
Wir fanden in dem kleinen Keller, der hinter der Hütte in den Hang gebaut und auch im Hochsommer kühl genug für Lebensmittel war, einiges: Butter, Brot, Eier, einen schimmligen Käse, Marmelade, eine Salami und ein Stück Schinkenspeck. Ich packte alles außer Speck und Salami in eine Plastiktüte, die ich dem nächsten Papierkorb anvertrauen wollte, dann gingen wir durchs Haus, und Sylvie suchte nach Dingen, die ihrem Mann gehört hatten, fand aber nur einen Waschbeutel mit Rasierzeug, ein Zigarettenetui und ein kleines Kofferradio. Sie legte alles nebeneinander auf den Tisch.
Als wir vor dem Einbauschrank standen, strich sie über ein paar Jacken und Hosen, die dort hingen, und fragte mich, ob ich die brauchen oder wegwerfen könne.
»Verschenken vielleicht«, sagte ich.
»Versteh ich«, sagte sie.
Ich brachte sie zu den Autos, und sie versuchte, den Käfer zu starten, aber der gab nur keuchende, röchelnde Geräusche von sich, anstatt anzuspringen, und nachdem ich Astrids Simca und den Renault meines Vaters vergeblich nach einem Starterkabel durchsucht hatte, gab ich ihr den Schlüssel des Renault und meine Adresse, und wir verabredeten uns für den nächsten Samstag, an dem sie mich damit abholen sollte, dann würden wir gemeinsam wieder hierherfahren und den Käfer flottmachen.
Als sie zuerst über die Wurzeln und dann über die Wiese geholpert war und den Motor dabei mehrfach abgewürgt und neu gestartet hatte, ging ich zur Hütte zurück und versuchte, Dinge zu finden, die ich gleich ins Auto legen und mit nach Hause nehmen konnte, aber außer zwei Fotoalben, in denen ich bei flüchtigem Durchblättern Bilder von mir als Kind gesehen hatte, und einigen Packungen mit Nudeln nahm ich nichts mit. Von den Kleidern meines Vaters würde ich kein einziges Stück anziehen, obwohl ich jetzt mit neuem Blick sah, dass zwei Jacketts, zwei Anzüge und einige Hosen von sehr guter Qualität waren. Auch in drei Jacketts, von denen ich glaubte, dass sie seinem Freund gehört hatten, fand ich auf den eingenähten Etiketten Namen, die mir etwas sagten. Valentino, Cardin, Saint Laurent. Ich würde das alles dem Roten Kreuz überlassen.
~
Ich merkte es nicht sofort, aber irgendwann auf der Fahrt, immer weiter auf ein Gewitter zu, das sich von der Schweiz her über dem See zusammenschob, kam mir zu Bewusstsein, dass ich aufgehört hatte, meinen Vater zu verachten. Sein gewaltsamer Tod hatte das nicht vermocht, aber die Nachricht, dass er homosexuell gewesen war, änderte auf einmal alles. Jetzt war es Schicksal und nicht mehr nur Gemeinheit, wie er meine Mutter behandelt hatte. Er musste sich geschämt haben dafür, dass er sie als Fassade für ein normales Leben missbrauchte, dass er sie belog, dass er sie nicht begehren konnte, obwohl sie doch alles hatte, worum ihn andere Männer beneideten – sie war attraktiv und gewandt gewesen, eine gute Tänzerin und, solange er sie noch hofiert hatte, ein fröhlicher Mensch – das wusste ich von ihrer Schwester, bei der ich nach dem Tod meiner Mutter ein Jahr lang gelebt hatte – mein Vater musste sich gehasst haben für das, was er ihr antat, aber es war ihm nicht möglich gewesen, sich anders zu verhalten, die Chemie seines Gehirns hatte das vereitelt. Er tat mir leid.
Chemie? Mir wurde schlecht, als ich mich fragte, ob ich das geerbt haben könnte. Ich musste rechts ranfahren, weil ich mich so zittrig fühlte, dass ich glaubte, das Lenkrad nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Aber ich kam nicht mehr dazu, mich dieser Angst zu überlassen, denn ich hatte einen Tramper mit Gitarrenkasten übersehen, der vielleicht dreißig Meter entfernt an einer Einfahrt stand und jetzt mit freudigem Gesichtsausdruck zu mir herkam.
Er lenkte mich für den Rest der Fahrt nach Konstanz von meinen panischen Gedanken ab, erzählte mir, dass er im Beese Miggle spiele, einer kleinen Konzertkneipe, die ich kannte, weil ich dort einmal im Jahr das Klavier stimmte. Er lud mich für den Abend ein und versprach, mich auf die Gästeliste zu setzen, und wir unterhielten uns über Musik im Allgemeinen und seine Musik im Besonderen, sodass ich tatsächlich vergaß, mich zu fürchten, ich könnte auf Männer abfahren – auf ihn schon mal nicht, er roch nicht besonders gewaschen, und schließlich, als ich ihn am Hafen aussteigen ließ, lachte ich über mich selbst. Ich hätte das doch schon früher gemerkt. Ich musste nicht erst das Bild der nackten Sylvie vor mein inneres Auge holen, um zu wissen, wie meine Gehirnchemie beschaffen war.
~
Dass ich Streit mit Astrid bekam, schien mir ganz folgerichtig. Ich war ein anderer Mensch nach dieser Fahrt auf den Feldberg, nicht mehr der, den sie kannte, obwohl der Anlass des Streits sich meiner Erinnerung nach eher einer Art Überdruss verdankte und nichts mit Überraschung oder Veränderung zu tun hatte. Ich rückte mal wieder das Bild an der Wand, einen Druck von Dante Gabriel Rossetti, gerade. Sie hasste es, wenn ich das tat, ich hasste es, das immer wieder tun zu müssen. Entsprechend übellaunig reagierten wir beide aufeinander, als sie mich einen analen Zwangscharakter nannte und ich abfällig antwortete, ich täte das freiwillig und es gehe nicht um Ordnung, sondern um Schönheit.
Ein Wort gab das andere, die Türen knallten, und die letzte knallte hinter mir, als ich losging, um meinen Ärger im Beese Miggle zu ertränken.
Mein Tramper war witzig und ein guter Gitarrist, er unterhielt die knapp zwanzig Zuhörer mit seinen Eigenkompositionen, und es spielte keine Rolle mehr, wie er roch, jedenfalls nicht für mich, denn ich saß drei Stuhlreihen von der Bühne entfernt und drehte mir eine Zigarette nach der anderen, trank drei Gläser Beaujolais Primeur, spielte später am Abend, als alle Gäste gegangen waren, mit dem Tramper zusammen Wild Horses und Hey Jude und torkelte dann durch den Gewitterregen nach Hause.
Astrid war nicht da. Ich riss mir die Kleider vom Leib, fiel ins Bett und träumte fürchterlich. Irgendetwas mit Angst und Flucht und Lähmung, aber dann penetrierte ich einen Männerhintern, und dann hatte der Mann langes rotes Haar, wandte sich mir zu und war kein Mann mehr, sondern Sylvie, die entgeistert schrie: »Was machst du da? Bist du verrückt?« Und ich hatte Lust empfunden.
Zum Glück lag Astrid nicht neben mir. Ich hätte mich vor ihr noch mehr geschämt als vor mir selbst, obwohl man für Träume nichts kann. Aber schwuler Sex stand auf einem anderen Blatt. Das hätte ja ein verdrängter Wunsch sein können.
Sie lag nicht neben mir, weil sie die Nacht mit einem anderen verbracht hatte. Aus lauter Wut war sie genauso losgezogen wie ich, um unseren Streit zu vergessen, und hatte einen Kommilitonen getroffen, den sie aus lauter Wut auf einmal ganz nett fand und aus lauter Wut irgendwann küsste, um ihm dann aus lauter Wut auf seine Bude zu folgen und mit ihm zu schlafen. Sie erzählte es mir am späten Vormittag unter Tränen, ließ aber keinen Zweifel daran, dass ich schuld sei und sie nichts dafür könne.
Ich nutzte die Gelegenheit, um mit ihr Schluss zu machen, denn mir war schlagartig klar geworden, dass wir einander nicht mal richtig mochten. Wir waren ein Paar gewesen, weil wir eben ein Paar gewesen waren, zufällig aufeinandergetroffen und zufällig beieinandergeblieben, zärtlich genug, um nicht viel zu vermissen, aber nicht zärtlich genug, um nicht mehr zu ersehnen. Ihre Tränen wichen schnell einer neu aufflackernden Wut, und das machte es uns leicht auseinanderzugehen. Ich gab meine Erleichterung nicht zu, ich tat, als wäre ich traurig, während sie erklärte, ich sei nur ein Intermezzo gewesen, an mich habe sie sich ohnehin nicht verschwenden wollen. Besser so, dachte ich, aber ich sagte: »Ein schönes Leben weiterhin.«
»Arschloch«, sagte sie und fing an, ihre Sachen zu packen, denn die kleine Wohnung gehörte mir. Das heißt, ich hatte den Mietvertrag unterschrieben, und sie musste sich was Neues suchen.
~
Ende der Leseprobe