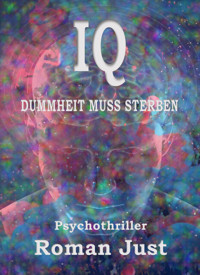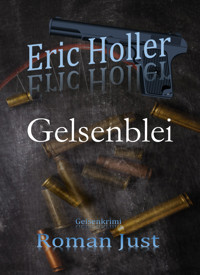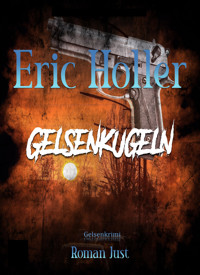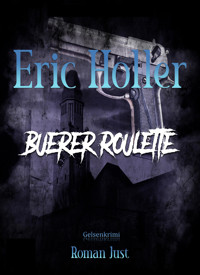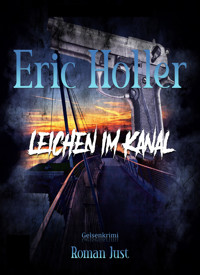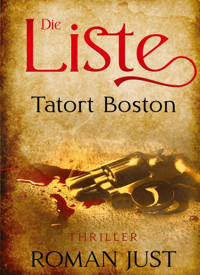
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gelsenecke
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Detektiv Forrest Waterspoon bekommt es mit Todesfällen zu tun, die zunächst in keinem Zusammenhang zu stehen scheinen. Die Ermittlungen führen ihn von einem Rätsel zum anderen, ebenso zu Opfern, die ihm privat und beruflich zusetzen. An der Belastungsgrenze angekommen, erfährt er Einzelheiten zu seinem aktuellen Fall, die er für unmöglich gehalten hätte. Wird ihm das erlangte Wissen bei der Aufklärung der Morde helfen? Es zeigt sich, wie eng Glück und Pech zusammenhängen und welche Rolle der Zufall einnehmen kann, aber das Leben schreibt sein eigenes Buch, und deckt auf, dass kein Mensch unfehlbar ist. Wird es Forrest gelingen, weitere Todesopfer zu verhindern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Epilog
Reale Serienkiller
Veröffentlichungen des Autors:
Kontakt zum Autor:
Impressum
Die Liste
Thriller
von
Roman Just
Prolog
E
s war Sonntag, aber ebenso hätte es ein turbulenter und hektischer Tag mitten unter der Woche sein können. Der Anlass für die Ausschüttung der Stresshormone bei Dustin und seiner Frau Bridget lag nicht an ihren beruflichen Verpflichtungen. Das Ehepaar war sich einig: Lieber hätten sie die vergangenen Stunden auf dem Arbeitsplatz verbracht, als sich der Situation zu stellen, mit der sie konfrontiert wurden. Der Stress hatte Wochen zuvor begonnen. Der Auslöser dafür waren die Hochzeitspläne ihrer Tochter Marilyn. Der erste negative Adrenalinstoß stellte sich bei Dustin und seiner Frau während dem erfolglosen Versuch ein, ihr die Trauung auszureden. Kein Argument, das sie gegen die Ehe vorbrachten, hatte bei ihr eine positive Wirkung erzielt. Im Gegenteil: Es kam zu einem Streit, bei dem sie unmissverständlich zu hören bekamen, dass ihre Tochter die Heirat ohne ihren Segen einzugehen bereit war.
Marilyn war zweiundzwanzig Jahre alt, damit dem Willen und den Anweisungen der Eltern nicht mehr untergeordnet und somit in der deutlich besseren Verhandlungsposition. Letzteres lag in erster Linie daran, dass Dustin und Bridget einen Narren an ihrer Tochter gefressen hatten, schließlich war sie ihr einziges Kind. Das wiederum hatte dazu geführt, dass die Eheleute ihrem Mädchen nie einen Wunsch abgeschlagen hatten. Die Quittung dafür hatten sie von Marilyn bei dem Gespräch über die Hochzeitspläne erhalten. Entgegen ihrer Überzeugung, dass ihre Tochter ihnen ebenso wenig eine Bitte abschlagen würde, kam sie ihrem Anliegen nicht nach und zeigte sich nicht bereit, die Heirat zu überdenken oder zumindest aufzuschieben. Dustin und Bridget gehörten keiner elitären Klasse an und sie waren weder Snobs noch Besserwisser oder Leute, die sich zu wichtig nahmen. Eigentlich zählte das Ehepaar Wyler zu den Menschen, die von der Politik als Normalbürger angesehen wurden. Das hieß in diesem Fall, die Familienmitglieder gingen einer Arbeit nach, verdienten in den Augen des Staates gut, aber nicht zu viel und jeder, der dem Familienkreis angehörte, war nie mit dem Gesetz auffällig in Konflikt geraten. Um die Statistik von diesem Status positiv zu färben, wurden Jugendsünden, die deutlich unterhalb einer schweren Straftat lagen, ausgenommen und ebenso Strafzettel für zu schnelles Fahren oder falsches Parken nicht berücksichtigt. Wäre es anders gehandhabt worden, dann hätte Dustin Mühe gehabt, als unbescholtener Bürger durchzukommen. In seiner Jugend hatte er eine Menge Mist gebaut und besann sich erst, nachdem er Bridget kennengelernt hatte. All das interessierte heute nicht mehr. Es lag schon zu lange zurück und die Gegenwart war bedeutend wichtiger als die Vergangenheit. Dem Ehepaar Wyler lag viel an seinem Ruf und ob ihm der Leumund manchmal wichtiger war als seine Tochter Marilyn, danach hatte bisher niemand gefragt. Unübersehbar blieb, dass sich die beiden, wie die Nachbarschaft, der gehobenen Mittelschicht zugehörig fühlten und in dieser sozialen Schicht zu verbleiben gedachten. Der Kontakt und der Umgang mit den Nachbarn durfte durch nichts gestört oder gar nachhaltig geschädigt werden. Genau darin lag das Problem, das Dustin und Bridget mit der bevorstehenden Ehe ihrer Tochter hatten. Auf ein intaktes Verhältnis zu Leuten in der näheren Umgebung konnte keiner verzichten und die zwei hatten nicht vor, dieses zu gefährden. Der Auserwählte von ihrem einzigen Kind war in ihren Augen ein Nichtsnutz und wollte ihrer Ansicht nach durch die Heirat nur eines erreichen: den sozialen Aufstieg.
Marilyn hatte empört auf diese Worte reagiert und der Haushalt der Wylers wurde von einer schweren Krise erschüttert. Es kam, wie es zu erwarten war und wie es bei neunundneunzig von einhundert Familien passiert wäre: Die Tochter hatte sich nach zahlreichen Wortgefechten mit ihrem Ehewunsch durchgesetzt. Dustin und Bridget gaben gezwungenermaßen ihren Widerstand auf. Sie akzeptierten Freddy als ihren angehenden Schwiegersohn; prompt fing der Stress an. Marilyns Eltern ließen es sich nicht nehmen, die Hochzeit mit der Braut zusammen zu planen und, was ihnen wichtiger war, die Trauung und die anschließende Feier auszurichten. Diesmal hatten die Erziehungsberechtigten das letzte Wort behalten. Im Gegensatz zu ihrem Mädchen bestanden sie auf einer denkwürdigen Zeremonie, die für ihre Tochter unvergesslich bleiben würde.
Ursprünglich hatten die Brautleute eine Eheschließung im kleinen Kreis geplant. Sie gaben aber den beschwörenden Worten nach und es wurden einige Dutzend Einladungskarten zu nahen und entfernten Verwandten verschickt. Das „nah und fern“ bezog sich sowohl auf die Entfernung als auch auf den Verwandtschaftsgrad. Obwohl die Wylers bis zu einem gewissen Punkt zu keinen finanziellen Einschränkungen gezwungen waren, ließ es sich das Familienoberhaupt nicht nehmen, die unmittelbaren Anwohner in dem Stadtteil, in dem die Familie ein Haus besaß, persönlich einzuladen. In seinen Augen war es eine Form der Höflichkeit, die er mit dem dazugehörigen Anstand betrieben und überflüssiges Porto für die Briefmarken zudem gespart hatte. Dustin war selbstständig, seit vielen Jahren ein erfolgreicher Autohändler und Bridget hatte einen Job als Sekretärin in einer Rechtsanwaltskanzlei. Die Einladungskarten schreiben, vervielfältigen und verschicken – so hatte der Stress begonnen. Das Brautkleid aussuchen, die geeignete Lokalität finden und buchen und die vielen Kleinigkeiten, die es bei einer solchen Feier zu organisieren galt, nahmen Dustin und Bridget zeitlich dermaßen in Anspruch, wie sie es vorher nicht für möglich gehalten hätten. Bei den Hochzeitsvorbereitungen war es ersichtlich geworden, dass es den Eltern fernlag zu protzen. Ihre Bemühungen hatten ausschließlich das Wohlergehen ihres Kindes zum Ziel. Die Vorbereitung der Hochzeit und die Zeit, die sie für die Organisation des gesamten Ereignisses aufgebracht hatten, waren anstrengend und zeitraubend. Trotzdem ließen sich Dustin und Bridget in ihrem Willen nicht beirren, ihrer Tochter einen Hochzeitstag zu bescheren, der bei jedem Ehestreit den Gedanken an eine Scheidung im Nu vertrieben hätte. Sie trugen den Wunsch in sich, dass Marilyn eine ebenso wundervolle Ehe führen sollte, wie es ihnen vergönnt war. Es wurde bald deutlich, dass sich ihr großer Aufwand für die Trauung und die Feier gelohnt hatte, daran konnte auch das kalte Wetter nichts ändern. Die Hochzeitsgäste brachten eine gute Stimmung mit und alles verlief nach Plan, zumindest bis sich die Runde der geladenen Gäste langsam aufzulösen begann. Die ersten Leute, die gegangen waren, hatten die Braut zu ihrem Bedauern nicht gefunden. Etwas später blieb es anderen Gästen ebenfalls versagt, sich von ihr zu verabschieden. Einige Hochzeitsteilnehmer waren eine Stunde vor dem Abendessen aufgebrochen. Es war Sonntag und von daher nachvollziehbar, dass nicht jeder bis zum Schluss der Veranstaltung bleiben würde. Die Braut wurde zu diesem Zeitpunkt nicht vermisst, sie hatte sich lediglich für kurze Zeit entschuldigt und zurückgezogen, um in aller Ruhe ihren Bedürfnissen nachzugehen. Niemand hatte eine Ahnung, weder ihre Eltern noch ihr Mann: Marilyn, der Stolz und Sonnenschein von Dustin und Bridget, besaß ein gravierendes Problem. Sie war abhängig und ein regelmäßiger Konsument von irgendwelchen, und bedauerlicherweise verschiedenen, medizinischen Präparaten. Die Sucht war inzwischen dermaßen weit fortgeschritten, dass es keine Rolle mehr für sie spielte, welche Pillen sie zu sich nahm. Die Tragik wurde durch den traurigen Umstand offensichtlich, dass für sie ein normales Leben ohne Tabletten untauglich war. Unerträglich wurde es, wenn Marilyn sie nicht zur Hand hatte. In diesem Fall reagierte sie hysterisch, verfiel in eine unkontrollierbare Panik und wurde fähig, unüberlegt sowie gewalttätig zu handeln. Sie hütete ihre Abhängigkeit wie ein Staatsgeheimnis und war außerstande zu erkennen, dass die Krankheit längst die Kontrolle über sie gewonnen hatte. Ihrer Meinung nach hatte sie die Sucht im Griff, tatsächlich verhielt es sich umgekehrt. Durch die Tablettenabhängigkeit war aus der zweiundzwanzigjährigen Frau eine unberechenbare Person geworden. Zwar vermochte sie jedem einen gesunden und vitalen Eindruck zu vermitteln, die unsichtbare Realität sah jedoch anders aus: Kränker als sie waren nur Menschen, die durch ein körperliches Leiden zum Sterben verurteilt waren. Die Hochzeitsfeier fand in Sichtweite des Charles River Basins statt, das an den Stadtteil Beacon Hill grenzte und in dem die Familie Wyler privat und beruflich ansässig war. Das Lokal, das Dustin ausgewählt hatte, bot einen Blick auf den Segelboothafen, in dem ein paar kleine und große Jachten einen Anlegeplatz fanden. Hinter dem Restaurant in östlicher Richtung, lag das Zentrum der City.
Am anderen Ufer des Charles River Basins befand sich die weltberühmte Universitätsstadt Cambridge. Mittlerweile war sie ein Teil von Greater Boston und gehörte damit zu der vier Millionen Menschen zählenden Metropolregion. Aufgrund der Tatsache, dass einige Gäste wegen ihrer Verpflichtungen am kommenden Tag die Feier früher zu verlassen beabsichtigt hatten, wurde das Abendessen um achtzehn Uhr serviert. Fast einhundertdreißig Gerichte á la carte verließen die Küche, für jeden Koch ein Horrortrip. Der Küchenmeister glänzte an diesem Tag und trug dadurch dazu bei, dass die Stimmung nach dem Essen noch besser wurde, als sie es in der Kirche mit dem Ja-Wort schon geworden war. Eine Liveband begleitete mit sanften Klängen die Speisenden bei den himmlischen Gerichten. Im Anschluss an den Nachtisch wurde das frisch vermählte Brautpaar vom Bandleader aufgefordert, den Eröffnungstanz zu zelebrieren. Alles lief nach Plan und die Zeit schritt voran. Dementsprechend stolz und zugleich erleichtert gaben sich die Eltern der Braut, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt hatten, dass ihre Tochter von Freddy verzweifelt gesucht wurde. Marilyn schien sich in Luft aufgelöst zu haben und war nirgendwo zu finden.
Plötzlich gab es einen dumpfen Knall. Das Gebäude, in dem sich das Lokal befand, erzitterte, eine Fensterscheibe zerbarst und die Gläser auf der Theke vibrierten oder kippten um und einige fielen aus den Regalen. Ein Teil der Hochzeitsgesellschaft blieb wie angewurzelt auf der Tanzfläche stehen, ein anderer rannte ins Freie, um nachzusehen, was geschehen war.
Ω
G
edankenverloren und ohne ein bestimmtes Ziel schritt er durch die Straßen. Es war nicht seine Stadt, er war zwar in Boston groß geworden, aber nicht hier geboren. Es gab nichts, was ihn in die Metropole an der Ostküste zurückgezogen hätte. Er hatte niemanden und keine Gegenstände zurückgelassen, die ihm wichtig gewesen wären.
Mit zwanzig hatte er der Stadt den Rücken gekehrt, war zum Militär gegangen und nach seiner Dienstzeit im Süden der Staaten hängen geblieben. Jetzt war er vierzig Jahre alt, bewegte sich wie ein Sechzigjähriger und in seinem Kopf kam er sich noch älter vor. Für einen Moment hatte er sich in den Labyrinthen von Boston einsam gefühlt, die kurzzeitige Emotion wich einer unsagbaren Erleichterung.
Er hatte eben die letzte Pflicht gegenüber seiner Mutter erfüllt. Dass er ungestört sein Spiegelbild in den Schaufenstern betrachten konnte, war der Leere auf den Gehwegen geschuldet. Kein Mensch kam ihm entgegen, niemand war unterwegs. Nur gelegentlich sah er Leute, die es eilig hatten, nach Hause zu kommen. Es befreite ihn, da die Stadt seine Seele in den Jugendjahren aus unerklärlichen Gründen trotz ihrer Größe stets eingeengt hatte. Seine Beziehung zu den Straßenschluchten und Häusern bestand aus Erinnerungen, von denen er ausgegangen war, sie vergessen zu haben. In der Burbank Street war der Spielplatz verschwunden, auf dem er als Kind unzählige Stunden verbracht hatte. Er durchschritt die Straßen in der unmittelbaren Nähe; hier war er herangewachsen. Danach gelangte er über die Massachusetts Avenue in die Stadtteile Back Bay West und East, die er längst aus seinem Kopf gestrichen hatte.
Merkwürdigerweise waren sie fähig, ihn wie einen Magneten anzuziehen. Er kam an der Tankstelle vorbei, die er mit fünfzehn überfallen hatte; nur aus dem Grund, um seinen Mitschülern zu imponieren. Statt der ersehnten Anerkennung erfuhr er eine größere Ignoranz, als ihm vor dem Raubzug entgegengebracht wurde. Nur wenige Schüler waren von seiner Straftat angetan und wie er landeten sie später in einer Jugendstrafanstalt oder in einem Camp, in dem mit den jugendlichen Übeltätern ganz und gar nicht zimperlich umgegangen wurde. Es war eine Lektion, die ihn nicht einschüchtern konnte. Manchmal blieb er an einer Straßenkreuzung stehen und sah sich um. Erinnerungen stellten sich beim Anblick eines Gebäudes oder eines Straßenschildes an diese Tage ein. Es waren Momentaufnahmen, die er in der Fremde vergessen hatte und von denen er vor Ort eingeholt wurde. In der Arlington Street, direkt gegenüber dem Boston Public Garden, stand ein Haus, in dem er kurz nach seiner Haftentlassung in eine Wohnung eingebrochen war. Die Bewohnerin, eine alte Dame, hatte ihm gutgläubig geöffnet und Zutritt gewährt. Mit falschem Namen und als Mitarbeiter einer nichtexistierenden Schülerzeitung hatte er sich vorgestellt. Im rustikal eingerichteten Wohnzimmer legte er ihr seine wahren Absichten dar und ohne etwas angerichtet zu haben, brach die Frau wie ein gefällter Baum zusammen. Beim Hinfallen schlug ihr Kopf gegen die unnachgiebige Kante des massiven Wohnzimmertisches und platzte wie eine Melone auf. Minutenlang stand er regungslos da, sah sie an und dem Rinnsal des Blutes nach. Nachdem der erste Schock aus seinen Gliedern und aus seinem nicht übermäßig ausgeprägten Verstand gewichen war, wurde ihm bewusst, dass seinem jungen Leben ein jähes Ende bevorstehen konnte. Deswegen blieb er in der Wohnung, bis es Mitternacht wurde, berührte nichts und verließ sie auf Zehenspitzen ohne Beute. In der darauffolgenden Zeit ließ er sich in der Gegend öfter blicken. An einem dieser Tage bekam er zu hören, dass die alte Dame von ihrer Tochter aufgefunden worden war. Tränenreich hatte sie in einem Fischladen die tragische Geschichte ihrer Mutter erzählt. Ein Herzinfarkt hatte sie umgebracht und angeblich war sie bereits tot, bevor sie gegen den Tisch geknallt war. Dieses Ereignis hinderte ihn in der Folge nicht daran, weitere Raubzüge zu unternehmen. Von irgendetwas musste er schließlich leben. In der Schule ließ er sich selten blicken und wenn, dann nur, um ausschlafen zu können. Zwangsläufig wurde er des Feldes verwiesen.
Mit siebzehn wurde er erneut inhaftiert, diesmal fiel die Strafe härter aus und er wurde zu zwei Jahren Jugendhaft verdonnert. Nach der Entlassung aus der Haft, die er inklusive der Bewährungsstrafe vollständig verbüßt hatte, ereilte ihn ein Gedanke, durch den ihm womöglich ein lebenslanger Arrest oder ein Todesurteil erspart geblieben worden war: Er bewarb sich bei der Armee und entgegen seiner Erwartung und trotz seiner Vorstrafen wurde er angenommen. In der Uniform entwickelte er Fähigkeiten, die ihm niemand und er selbst sich nicht zugetraut hätte. Er war neunzehn Jahre lang ein hervorragender Soldat gewesen, pflichtbewusst, loyal und unerschütterlich. Eine Granate im Irak hatte seine Laufbahn beendet und hinterließ bleibende Schäden, mit denen er allerdings gut zurechtkam. Das künstliche Kniegelenk rechts behinderte ihn kaum, mehr die Prothese, die ihm das linke Bein ab dem Oberschenkel zu ersetzen hatte. Die Narben an seinem Körper waren verheilt und taten nicht weh, die eine Wunde, die in der Seele, die war unheilbar und hatte kein Mitleid mit ihm. Sie verursachte Schmerzen, jede Minute, Stunde und an sämtlichen Tagen. Er war aus der Armee ohne große Ehrung und ohne eine besondere Anerkennung ausgeschieden. Der gottlose Undank, die erhaltene Entlassungsurkunde und die Gleichgültigkeit gegenüber seiner Person und seinen Verletzungen waren es, die ihn innerlich zerrissen hatten. Er war ein Veteran, einer von vielen, ein Soldat, der wie eine überflüssige Zitrone ausgepresst worden war und nun nicht mehr gebraucht wurde. Niemals hätte er eine Bewerbung beim Militär abgegeben, wenn sein Leben anders verlaufen wäre. Mit Ausnahme der erwähnten Überfälle hatte er nie jemanden bestohlen und betrogen. Niemand in seiner Familie war bereit, ihm zu helfen und seinen Hunger und Durst zu stillen, nachdem er seine Mutter verloren hatte. Sie war eine schöne, aber komische Frau gewesen. In der engen Zweizimmerwohnung lief sie immer halbnackt herum, stets dann, wenn sein Vater nicht zu Hause war. Meistens zeigte sie sich oben ohne, oft nur in einem durchsichtigen Slip und gelegentlich sogar nackt. Als er acht geworden und sie eines Tages hüllenlos in das Badezimmer getreten war, hatte sich Merkwürdiges ereignet: Das Ding zwischen seinen Beinen wurde plötzlich größer und sie lächelte deswegen. Zu zärtlich begann sie, ihn zu waschen.
Zuerst den Rücken, den Bauch, die Füße und zum Schluss auch das Bambusrohr, wie sie sein Glied fortan bezeichnete. Schließlich nahm sie seine Hände und streichelte mit seinen Fingern ihre Brustwarzen. Auch sie wurden größer und härter, so wie das Teil zwischen seinen Beinen, über das er keine Kontrolle hatte. Im Anschluss an dieses Ereignis kam es selten vor, dass er die Möglichkeit besaß, allein in der Wanne zu liegen. Ab irgendeinem Tag nahm sie seinen Penis regelmäßig in den Mund oder zwang ihn, in sie einzudringen. Manchmal setzte sie sich auf ihn, ein anderes Mal lag er auf ihr, bis sein Vater unerwartet früher von der Arbeit nach Hause kam. Es war einer der wenigen Tage, die er niemals im Leben vergessen würde. Er hatte Geburtstag, seinen zwölften. Im Wohnzimmer, in dem er immer auf dem Sofa geschlafen hatte, war eine kleine Feier vorbereitet worden. Sein Vater traute seinen Augen nicht, als er den Wohnraum betrat und seine Frau nackt auf dem Schoß seines Sohnes sitzen sah. Er riss sie mit aller Gewalt von ihm herunter und prügelte mit den Fäusten auf sie ein, bis ihr Gesicht völlig entstellt war. Dann, ungeachtet der Tatsache, dass sein Kind ihm dabei zusah, holte er ein Messer aus der Küche und stach zu. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern so lange, bis aus der ansehnlichen Frau ein Klumpen aus Fleisch und Blut geworden war. Schließlich hatte er sie in eine Decke eingewickelt und in den einzigen Luxusgegenstand geworfen, den sie besaßen. Es war die Gefriertruhe in der Küche, die neben dem Gasherd stand. Manchmal war der Deckel der Truhe für die ermordete Hausfrau aus Platzmangel zu einer Arbeitsfläche umfunktioniert worden: Entweder wurde auf ihr Gemüse geschnitten oder sie hatte sich als Sitzfläche für einen Akt mit ihrem Sohn und Mann bewährt. Als sein Vater seine Mutter in die Kühltruhe gelegt hatte, wurde er von ihm gezwungen, das Wohnzimmer sauber zu machen. Zum Dank war ihm eine Tracht Prügel verabreicht worden, die durch eine Bewusstlosigkeit unterbrochen wurde.
Es endete damit, dass ihm sein Erzeuger den Penis zur Hälfte abschnitt. Im Anschluss daran wurde er drei Monate lang vom Vater dermaßen „liebevoll“ behandelt wie nie zuvor. Statt ihn in eine Klinik zu bringen, nahm er sich der Wunde am Geschlechtsteil an. Neunzig Tage wurde er von ihm wie ein Hund in der Wohnung gefangen gehalten. An einem der rostigen Heizkörper wurde er angebunden. Wie ein Tier musste er stets aus derselben und mit der Zeit verdreckten Schüssel Wasser trinken und das hingeworfene Essen vom Boden auflecken. Es war die einzige Phase seines Lebens, in der er von dem Mörder seiner Mutter so etwas wie eine Zuwendung bekommen hatte. Nachdem die Verletzung verheilt war und er sich ohne sichtbare Einschränkungen bewegen konnte, wurde er aus der Wohnung geworfen und zum letzten lebenden Onkel verwiesen. Aus Angst begab er sich dorthin. Er wusste, dass der Bruder seines Vaters eine weitaus dreckigere Seele besaß und schäbiger wohnte, als er es von zu Hause her kannte. Entgegen seiner Befürchtung wurde er von ihm einigermaßen anständig behandelt. Zu ernähren hatte er sich trotzdem selbst. Sein nächster Verwandter gab grundsätzlich das wenige Geld, das ihm zur Verfügung stand, nur für Alkohol und Drogen aus. Das Militär wurde sein Retter und Zuhause. Der Undank und die Art, wie er aus dem Militärdienst verabschiedet worden war, veränderten die Sichtweise, die er sich in all den Jahren bei der Armee angeeignet hatte. Seine zu dieser Zeit gesunde Einstellung zum Leben und zu seiner Vergangenheit verlor sich in einer Bitterkeit, die ihn aufzufressen begann. Es war der Grund, warum er Boston aufgesucht hatte.
Mit einem festen Ziel begab er sich zu seinem in Pension befindlichen Vater, der von Beruf ein Krankenpfleger gewesen war. Von ihm erfuhr er, dass sein Onkel vor Jahren das Panorama aus der Grube dem des Lebens vorgezogen hatte, wobei die Information ihn nicht zu berühren vermochte. Stattdessen trat das Gegenteil ein und er überwältigte seinen Erzeuger, indem er ihn beinahe erschlug. Danach zog er den bewusstlosen Mörder aus, band ihn im Wohnzimmer auf einen Stuhl und versah seine Lippen mit einem Klebeband. Eine Schale Wasser reichte aus, um den Ohnmächtigen in die Realität zu holen. Als Erstes schnitt er ihm den Schwanz ab, nachfolgend die linke und die rechte Pulsader auf und schließlich durchtrennte er das Band, mit dem er ihn an den Stuhl festgezurrt hatte. Er wollte sehen, ob sein Erzeuger imstande sein würde, sich das Leben zu retten. Er, ein ehemaliger Berufssoldat, wusste, dass kein Sanitäter auf der Welt die Blutungen der Wunden auf einmal versorgen konnte, schon gar nicht, wenn er selbst betroffen war. Sein Vater unternahm nichts dergleichen, verhielt sich typisch und blieb reglos sitzen. Er beließ das Klebeband auf dem Mund und sah tatenlos zu, wie das Leben aus seinem Körper entwich. Nachdem sein Erzeuger verblutet war, begab er sich in die Küche, um feststellen zu müssen, dass seine Mutter immer noch in der Truhe lag. Ihr starrer Leichnam war mit Gefrierbrandwunden übersät. Offenbar war die Rente seines Vaters derart gering gewesen, dass er die Stromrechnung nicht regelmäßig bezahlen konnte. Der Anblick der Frau, die ihn zur Welt gebracht und ihm die Unschuld genommen hatte, offenbarte, dass es an der Zeit war, den Ort seiner Kindheit zu verlassen. Wahllos betätigte er einen der Druckknöpfe des Gasherdes und ohne eine weitere Aktion verließ er die Wohnung, die ihm noch enger als früher vorgekommen war. Schließlich begann er, ziellos und gedankenverloren durch die Stadt zu schlendern, und die Erinnerungen holten ihn mancherorts ein. In Gedanken war er an der Charles River Esplanade angekommen. Zu Hause hatte es in all den Jahren nicht ein liebes Wort, keine elterlichen Zärtlichkeiten, weder Geborgenheit noch Wärme gegeben. Der Kerl, der ihn gezeugt hatte, war ein selbstsüchtiges, herrisches und gewalttätiges Schwein, das sich genommen und getan hatte, was es wollte. Wie sein Vater gestorben war, wurde zunehmend befriedigender als der Sex mit seiner Mutter. Er hatte dafür gesorgt, dass der Mistkerl dazu gezwungen wurde, dabei zusehen zu müssen, wie ihm das Blut aus den Adern geronnen war. Er hatte keine Rache verübt, stattdessen einen Akt der Gerechtigkeit begangen.
Seine Mutter war ein guter Mensch gewesen und hatte den Tod nicht verdient, schon gar nicht in der Art. Ihr Fehler war, dass sie sich nach Liebe und Zuneigung gesehnt und nichts davon von ihrem Mann bekommen hatte. Durch diese Sehnsucht wurde sie zu ihrem Sohn getrieben; und wegen den Zärtlichkeiten, der Nähe und Wärme, die ihr vorenthalten wurden, musste sie sterben. Er fragte sich, ob es einen erbärmlicheren Grund für den Tod eines Menschen geben konnte. Gier, Machtsucht, Hass, all das war er fähig zu kapieren. Dass die Begierde nach Liebe den Tod einer Frau verursacht hatte, fand keinen Platz in seinen Kopf. Nein, er hatte es niemals darauf abgesehen, mit seiner Mutter zu schlafen und es nie gemocht. Aber sein Bambusrohr hatte nicht auf seinen Verstand gehört, sondern sich selbständig gemacht. Er war eben ein Mann und sie eine anziehende Frau. Sie zudem die einzige weibliche Person, mit der er eine intime Beziehung eingegangen war. Danach hatte er nie wieder Sex. Es lag an der Verstümmelung seines Gliedes und den Komplexen, die ihn deswegen befallen hatten. Auf eine merkwürdige Art und Weise war er außerdem in seine Mutter verliebt gewesen, ihr allerdings nicht verfallen. Seitdem sie tot war, besaß er eine Abneigung gegenüber dem weiblichen Geschlecht. Es widerte ihn nicht an, aber er hatte einen inneren Ekel entwickelt, den er unfähig war abzulegen. Obwohl er an dem Liebesspiel mit seiner Mutter mit zunehmendem Alter Gefallen gefunden hatte, war ein Begehren nach Liebesabenteuern bei ihm nicht vorhanden. Bald wurde klar, dass sein deformiertes Geschlechtsteil Schuld daran hatte. Womöglich wäre er von einer Frau ausgelacht, nicht angefasst und stehen gelassen worden, aber all das blieb ihm durch die Abneigung gegenüber dem weiblichen Geschlecht erspart. Er sah in die Dunkelheit, die ihn umgab, und seine Augen blieben einen Augenblick auf dem unruhigen Gewässer des Charles River Basins hängen. Auf der anderen Seite des Hafens lag Cambridge und er hätte gern studiert. Leider besaß er nicht die nötigen Qualifikationen. Besonders schlau war er nicht, das wusste er, aber dafür hatte er sich als ein überaus tapferer und qualifizierter Soldat erwiesen. Ein Blick zum Himmel, der sich hinter einer grauen Wolkendecke verbarg, brachte ihn seiner Mutter näher. Sonderbarerweise fielen ihm in diesem Moment einige Geschichten ein, die er von ihr in Kindertagen gehört hatte. Eine Erzählung war ihm stets in Erinnerung geblieben, die von den Engeln, die niemals weinen. Er war sich sicher, dass sie sich das Märchen für ihn ausgedacht hatte. Als ob seine Mutter ihn und seine Sehnsüchte vernommen hätte, fing es an zu schneien. Dicke Schneeflocken fielen vom Himmel herab und deckten den gefrorenen Boden zu. Im Radio hatten die Meteorologen in den vergangenen Tagen über die Kälte an der Ostküste geklagt und hinreichend vor Glätte auf den Straßen gewarnt. Es war unangenehm frisch, was vor allem an dem böigen und eisigen Wind lag. Er sah über seine Schulter hinweg und ungeachtet der Wetterlage setzte er sich auf eine der Promenadenbänke, die trotz der Jahreszeit noch nicht abgebaut worden waren. Der Schneefall hatte etwas Magisches an sich und die Ruhe empfand er wie einen himmlischen Segen. Die Flocken wurden immer dichter. Kurz bevor der liegengebliebene Schnee auf seiner Jacke den Kragen erreicht hatte, erhob er sich, schüttelte die weiße Pracht ab und nahm Schritt in Richtung des Jachthafens auf. Später hatte er vor, über die Cambridge Street in die Innenstadt zu gelangen und von der Union Station mit dem Zug die Heimreise anzutreten. Dass er aufgrund des Mordes an seinem Vater gesucht, gefunden und verhaftet werden könnte, hielt er für ausgeschlossen. Er hatte keine Spuren hinterlassen. Die Gasexplosion, die durch einen kleinen Funken, die Betätigung eines Lichtschalters oder wegen einer anderen Handlung ausgelöst werden sollte, würde den Behörden die Ermittlungen erschweren. Ihm war es ohnehin gleichgültig, ob er bei einer Mordermittlung für die Beamten als Täter in Betracht kam oder für sie zu den Hauptverdächtigen gehörte. Er war Soldat, er hatte seine Pflicht erfüllt und wie einst besaß er deshalb keine Ziele mehr. Seine Wohnung am Stadtrand von New Orleans war eine Bruchbude, die der seiner Eltern in jeglicher Hinsicht glich. Ihn störte es nicht. Selten war er in den vergangenen Jahren länger als zwei Wochen zu Hause gewesen. In seinem Rücken, weit hinter ihm, durchbrach eine Detonation die nächtliche Stille. Im gleichen Augenblick vernahm er aus der Umgebung vor ihm leise Musik, die schlagartig etwas lauter wurde und genauso abrupt endete. Zwischen kahlen Bäumen sah er eine hell erleuchtete Hausfassade, im Erdgeschoss ein Lokal, in dem eine Band ihr Bestes gegeben hatte. Die melodischen Klänge wurden durch unverständliches Stimmengewirr ersetzt. Offenbar hatten die Lautstärke und die Wucht der Explosion eine Veranstaltung unterbrochen und die Gäste ins Freie gelockt. Er drehte sich in die Richtung, aus der die heftige Detonation bis zu seinen Ohren gedrungen war. Am Nachthimmel, dort, wo der Stadtteil Back Bay West lag, sah er Rauchschwaden aufsteigen. Ebenso konnten es Wolken oder eine Einbildung sein. Unabhängig davon, was er zu sehen glaubte, im selben Moment erfüllte ihn eine Leere, wie er sie nie zuvor empfunden hatte. Er war kein Soldat mehr, seiner Mutter gegenüber hatte er Gerechtigkeit verübt, was und wer wartete noch auf ihn und wo? Nichts und niemand, nirgendwo! Er sah zu den Booten, die in dem Hafen vor Anker lagen. Kleine und größere Jachten wogten auf dem Wasser sanft auf und ab und die meisten wurden durch Planen vor dem Wind und dem eisigen Wetter geschützt. Der Winter hatte noch gar nicht begonnen, trotzdem erinnerte nichts daran, dass der Herbst erst in zwei Wochen von der kältesten Zeit des Jahres abgelöst werden sollte. Erneut nahm er Platz auf einer Bank, setzte sich in den Schnee, der sie bedeckte, und bewunderte ein Boot, das der Community Boating gehörte und winterfest gemacht worden war. Es lag direkt am Kai neben dem Hauptgebäude der gemeinnützigen Organisation, bei der Leonard Nimoy in jungen Jahren das Segeln erlernt hatte. Bei der Community Boating in Boston handelte es sich um das älteste Segelprogramm in den Staaten, das seit 1946 ohne Unterbrechung betrieben wurde. Es galt für jedermann als erschwinglich und war für alle Personen zugänglich. Die Mitgliedsgebühr basierte auf dem Einkommen eines Interessenten. Ihm war es egal, nicht einmal bekannt, dass Leonard Nimoy in der Rolle des Mister Spock an Bord des Raumschiffes Enterprise weltberühmt geworden war. Dafür faszinierte ihn das Boot vor seinen Augen. Wie es sich im Wind bewegte, wie es sich hob und senkte, vermittelte es ihm den Eindruck, als ob es auf ihn warten und ihn zu seiner Mutter bringen würde. Der Gedanke gefiel ihm, da er die Leere und die daraus entstandene Kälte in seinem Körper vertrieben hatte. Von einem Moment zum nächsten wurde es auf eine unerklärliche Weise surreal.
Ein Ast brach, Schneeknirschen wurde hörbar und bevor er sich den Geräuschen zuwenden konnte, blickte er in ein Gesicht, das dem seiner Mutter ähnlich sah. Plötzlich stand sie vor ihm. Er hatte sie nicht kommen sehen, zu tief war er in seinen Gedanken versunken gewesen. Sie sah wie ein Engel aus, aber seine Vorstellung von einem weiblichen Himmelsboten erhielt durch die Tränen auf ihren Wangen einen Dämpfer. Nie hätte er gedacht, dass ein himmlisches Wesen zu weinen fähig war. Vielleicht hoben sie sich die Klageflüssigkeit nur auf, um die Trauer und das Leid auf der Erde loszuwerden. Den Gedanken verwarf er sofort, natürlich weinten Engel auch im Himmel, wie hätte es sonst regnen können. Er sah nach oben, aber die Eingangspforte in das Paradies versteckte sich wie zuvor hinter den Wolken, die durch die Lichter der Stadt in eine seltsame orange Farbe getaucht wurden. Oder gab ihm seine Mutter ein Zeichen?
Hatte der Engel eine Botschaft an ihn? Eines sprach dafür: Dicke Schneeflocken fielen herab und deckten den Erdboden zu, wie eine Mutter ihr Kind, wenn sie es ins Bett gebracht hatte. Er sah wieder die weibliche Gestalt an und dann in die Richtung, aus der sie gekommen war. Durch den Wind wurde die Musik über die Straße zu ihnen geweht, es waren Klänge, die eine Hochzeit vermuten ließen. Der weinende Engel hatte tatsächlich ein wunderschönes Brautkleid an, allerdings passten die Tränen nicht zu einem glücklichen Tag. Er stand auf, reichte der am ganzen Körper zitternden Frau seine Jacke und sie setzte sich auf die Stelle, von der er sich eben erhoben hatte. Er nahm neben der Braut Platz und besaß die Geduld, sich ihr Leid anzuhören. Die Sätze des Engels hätten ebenso von seiner Mutter stammen können. Er hörte die Stimme der Engelsgestalt, vernahm ihren Kummer und er verstand, warum sie die Hochzeit verlassen hatte und davongelaufen war. Sie beichtete, dass der Mann, dem sie das Ja-Wort wenige Stunden zuvor gegeben hatte, plötzlich zu einem herrischen Sadisten geworden war. Während der Feierlichkeiten hatte er sie in den Keller des Lokals gezerrt, um sie sich zu nehmen. Wegen der Uhrzeit und des Ortes hatte sie sich geweigert, sich ihm hinzugeben, woraufhin er sie geschlagen und vergewaltigt hatte. Jetzt saß sie neben ihm und gestand sich ein, den größten Fehler ihres Lebens begangen zu haben. Ihr Glaube und die Familienehre hatten es ihr verboten, sich den Eltern und Hochzeitsgästen zu offenbaren. Die Quittung dafür waren die roten Flecken auf ihren Wangen, ihrer Schulter und die bläulichen zwischen ihren Oberschenkeln. Tröstend legte er einen Arm um sie und drückte sie an sich. Erneut fing sie heftig an zu weinen und er presste ihr Gesicht in seine Schulterpartie. Seine andere Hand hatte er auf ihren Hinterkopf gelegt und der ausgeübte Druck wurde stärker. Immer fester drückte er ihre Mund- und Nasenpartie an seinen Oberkörper. Sie begann sich zu wehren, versuchte der Umklammerung zu entkommen, aber gegen seine Kräfte war sie machtlos. Ihre Bewegungen ebbten ab, wurden zu einem mehrmaligen Zucken und fanden ein abruptes Ende.
Als sie sich nicht mehr bewegte, sah er zum Himmel. Jetzt war nicht allein seine Pflicht erfüllt, sondern zu einer guten Tat vollbracht worden. Er hatte dem Engel im Brautkleid ein ähnliches oder schlimmeres Schicksal als das seiner Mutter erspart. Bestimmt war seine einzige intime Beziehung stolz und rief ihn mit den Schneeflocken zu sich. Mit dem Boot, das er bewundernd betrachtet hatte, war er in Begleitung der Himmelsbotin bereit, dem Firmament entgegenzusegeln. In dem Himmelsboot sitzend, sah er in den Lauf einer Pistole. Es war kein Geräusch zu hören, als die Kugel abgefeuert wurde. Danach musterte er das Einschussloch an der Stelle, wo das Herz bei Liebeskummer jedem Enttäuschten gewaltige Schmerzen zufügte.
Er sah mit schwindenden Gedanken erneut zu dem Mann, der die Waffe in der Hand hielt. Eine weitere Kugel traf ihn in die Stirn, es wurde dunkel und er segelte in Begleitung des Engels zu seiner Mutter in den Himmel.
Sein Name war Darryl, aber sein Vater hatte ihn stets mit Devil zu sich gerufen.
1. Kapitel
Montag
E
s klopfte an der Bürotür des Detectives und ohne eine Erlaubnis abzuwarten, trat Joshua Jason Calbott in den Raum. Dessen Job hatte Forrest kurzfristig ausgeübt und er hatte nicht vor, ihn um den Posten des Dezernatsleiters zu beneiden. Sein dunkles, veraltetes, zum Innenhof des Departments gelegenes Büro war ihm ans Herz gewachsen, obwohl es keinen Tag gab, an dem er die vier Wände nicht verfluchte. Mit grimmiger Miene sah er den Eindringling an, der nun sein Vorgesetzter war. Mit einigen Sätzen wurde er von ihm in Belanglosigkeiten eingeführt und schließlich gebeten, ihn zu begleiten. Der Detective nickte, griff nach seinem Hut und bereute eine Minute später, dass er mit Joshua mitgegangen war. »Was habe ich damit zu schaffen?«, fragte Forrest, nachdem er darüber aufgeklärt worden war, wie es um das Personal im Department stand. Ein Fünftel der höherrangigen Beamten befand sich im Krankenstand, auf Lehrgängen oder war trotz der dünnen Personaldecke gezwungen worden, die aufgelaufenen Überstunden abzufeiern. Er war nicht allein wegen dieser Umstände heilfroh, dass Joshua Jason Calbott in seine Fußstapfen als Morddezernatsleiter getreten war. Manchmal waren die Anordnungen der Leute von ganz oben nicht nachzuvollziehen, trotzdem wurden sie ausgeführt, um nicht selbst negativen Konsequenzen ausgesetzt zu werden. Die Welt war eben ungerecht und die Kompetenz der Mächtigen unantastbar. In eine ähnliche Situation war er von seinem Boss gebracht worden.
Sie hatten in einer höher gelegenen Etage ein Zimmer erreicht, welches am Ende des langen Korridors lag. Es war ein steriler und unpersönlicher Raum, in dem drei Personen saßen. Bei ihnen handelte es sich um das Ehepaar Wyler und deren frisch gebackenen Schwiegersohn Freddy. Forrest sah, dass Bridget Wyler geweint hatte und darum bemüht war, die Fassung zu bewahren. Er nahm neben seinem Vorgesetzten der nervlich angeschlagenen Familie gegenüber Platz, nachdem der Morddezernatsleiter ihn den besorgten Leuten vorgestellt hatte. Der Abteilungsleiter bat den Ehemann, die Geschichte zu wiederholen, die ihm bereits zuvor geschildert worden war. Von Dustin Wyler ließ sich Forrest den Ablauf der vergangenen Tage und der Hochzeit erzählen und erfuhr somit, wie anstrengend die Vorbereitungen für derartige Veranstaltungen waren. Es war ein Grund, sich darüber zu freuen, dass seine leiblichen Töchter an den Wohnorten ihrer Männer geheiratet hatten. Die lagen weit weg, dermaßen fern, dass es unmöglich gewesen war, in irgendeiner Weise bei der Umsetzung der Hochzeitspläne zu helfen. Forrest überdachte das Gehörte und vernahm nebenbei die Erläuterungen seines Vorgesetzten. Die nähere Umgebung des Lokals war gründlich ohne Ergebnis abgesucht worden. Die Suche nach der Braut lief auf Hochtouren und die Medien waren in die Suchaktion eingebunden. Der Detective warf einen kurzen Blick auf seine Armbanduhr und sah den Morddezernatsleiter mit erstaunter Miene an. Zwei Ursachen hatten ihn stutzig werden lassen: Zum einen war Marilyn keine vierundzwanzig Stunden verschwunden, zum anderen war ihre Leiche nicht gefunden worden und somit hatte seine Abteilung mit dem Fall nichts zu tun.
Joshua erkannte die Gedanken des Detectives und sagte: »Klar, die Mordkommission ist nicht zuständig. Wir haben keinen Leichnam, aber ich halte die Umstände für ausgesprochen merkwürdig und ungewöhnlich. Da wir die einzige Abteilung sind, die im Moment freie Kapazitäten hat, dachte ich, wir könnten zumindest vorübergehend aushelfen«, rechtfertigte er sein Vorgehen, obwohl es nicht nötig gewesen wäre.
Forrest lächelte grimmig. Der Detective vollführte eine Geste, die besagte, dass er verstand, aber sein Gesicht wies weniger Verständnis für die Verfahrensweise seines Vorgesetzten auf.
Er hatte genug Arbeit und Joshua Jason Calbott war dieser Umstand bekannt. »Dann handelt es sich bei meiner Person um die freie Kapazität, oder wie?«
»Wir haben sonst niemanden«, versicherte der Abteilungsleiter.
Forrest wandte sich von ihm ab und den drei Mithörenden zu. Er verschränkte die Arme auf der Tischplatte und sah nacheinander den Vater, die Mutter und den Ehemann der verschwundenen Marilyn an. Wie er es befürchtet hatte, fing Bridget wieder an zu weinen. Verlegen fasste er in die Tasche seiner Anzugjacke und reichte der Frau ein Papiertaschentuch.
Tröstend ergriff er das Wort: »Ich verstehe, dass Sie sich sorgen, Mrs Wyler. Sie brauchen Ihren Kummer nicht zu verbergen, aber im Moment wäre Zuversicht wichtiger. Bewahren Sie sich jede erdenkliche Hoffnung. Ich weiß, es ist leicht gesagt. Allerdings wird Ihre Tochter keine acht Stunden vermisst und wir haben weder sie noch eine Spur von ihr gefunden, das ist durchaus ein gutes Zeichen.«
Dustin Wyler legte den linken Arm um die Schulter seiner Frau und fragte: »Wie darf ich Ihre Aussage verstehen, Detective?«.
Forrest sah im Sitzen aus dem Fenster, danach den Vater der verschwundenen Marilyn an. »Das Wetter ist gegen uns, es schneit. Unabhängig davon, wenn Ihrer Tochter in der Umgebung des Lokals etwas zugestoßen wäre, dann hätten die Suchmannschaften irgendetwas gefunden«, antwortete er im Wissen, dass seine Aussage nicht der Wahrheit entsprach.
Dafür wurde die Wirkung erzielt, auf die er gehofft hatte.
Die Mutter beruhigte sich schlagartig etwas und sah ihn an. »Glauben Sie?«, prallte die Hoffnung in ihrer Stimme von den Wänden des Zimmers zum Tisch zurück.
»Detective Waterspoon ist ein erfahrener Mann, wenn er etwas sagt, hat es Hand und Fuß«, kam der Morddezernatsleiter dem Ermittler mit einer Antwort zuvor.
Forrest hätte wegen der vorher ausgesprochenen Worte ohnehin eine weitere positive Äußerung vermieden. Er warf seinem Vorgesetzten einen undankbaren Blick zu und wandte sich an den frisch vermählten Freddy. »Wann genau haben Sie bemerkt, dass Ihre Frau nicht mehr im Lokal anwesend ist?«
Der Ehemann zuckte mit den Schultern. »Gegen Mitternacht«, antwortete er nachdenklich. »Eher später.«
»Wie ist es vor sich gegangen und was haben Sie unternommen?«, erkundigte sich der Ermittler und ließ Freddy nicht aus den Augen.
»Ich habe sie gesucht, was sonst?«
Mit einem Brummen nahm Forrest die Aussage zur Kenntnis. Er kannte Freddy nicht, hatte ihn vorher nie gesehen, aber der Mann, der um die dreißig Jahre alt war, hinterließ bei ihm einen fragwürdigen Eindruck. Zwar konnte er ihn nicht einschätzen, wusste nichts über seine Gewohnheiten und Vorlieben, doch für jemanden, der erst vor knapp vierundzwanzig Stunden geheiratet hatte, war er zu sorglos. Für ihn gab sich der Bräutigam zu entspannt, fast so, als ob ihm der Verbleib seiner Frau gleichgültig wäre. Deswegen hatte er sich über den Ton der letzten Antwort gewundert, er war barsch und das widersprach der körperlichen Haltung, die seltsam steif war.
Wie Freddy saß, wie er sich bewegte, das alles besaß für Forrest etwas Unnatürliches. Es konnte die Nervosität, die der Mann in sich trug und zu verstecken versuchte, nicht verbergen. Es war möglich, dass die Unruhe des Ehemannes durch das Verschwinden seiner Frau ausgelöst worden war, doch das bezweifelte der Detective. Zu oft hatte er Kerle wie Freddy gesehen und kennengelernt. Forrest war es nicht verborgen geblieben, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren. »Sie haben sie gesucht und nicht gefunden«, stellte er mit einem Ton fest, dem seine Skepsis anzuhören war. »Was geschah dann? Bitte erzählen Sie so ausführlich wie möglich, jedes Detail kann wichtig werden.«
»Ich habe die anderen, die anwesend waren, informiert und wir haben alle mit der Suche nach Marilyn begonnen. Das hat bestimmt eine Stunde gedauert, danach hat mein Schwiegervater die Polizei verständigt.«
»Verstehe! Ist Ihnen oder jemandem, der an der Suche teilgenommen hat, etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«
Freddy schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. Außerdem wurde jeder von der Polizei dazu befragt.«
»Okay, das war es für heute. Ich denke, wir haben erfahren, was von Bedeutung sein könnte. Wir werden unser Bestes geben, um Marilyn zu finden«, beendete der Detective mit seiner tiefen Stimme das Gespräch, nachdem ihm von seinem Vorgesetzten bestätigt worden war, dass alle erforderlichen Informationen über die verschwundene Frau vorlagen.
Auf dem Weg zurück in sein Büro wurde Forrest von Joshua Jason Calbott begleitet und erntete, kaum dass die Familie Wyler ihrem Blick entschwunden war, einen Vorwurf. »Was hatte das eben für einen Sinn? Sie haben den Ehemann wie einen Verbrecher angesprochen, so als ob er am Verschwinden seiner Frau schuld wäre! Sind Sie noch bei Trost?«
Vor der Bürotür blieb Forrest stehen und öffnete sie bewusst nicht. Keinesfalls wollte er seinen Vorgesetzten länger um sich haben als nötig. Er hatte nichts gegen ihn, aber er mochte es nicht, überflüssige Diskussionen mit ihm zu führen. »Der Ehemann verschweigt uns etwas. Er weiß definitiv mehr, als er uns gesagt hat«, war er sich sicher.
»Ist das Ihr siebter Sinn oder Ihr Bauchgefühl?«, Joshua gab sich nach wie vor ungehalten.
»Beides, und dazu kommt meine Erfahrung mit solchen Kerlen. Ich denke, er hatte schon öfter mit der Polizei zu tun, und er hat befürchtet, dass ich ihn vollständig durschauen könnte.«
Der Morddezernatsleiter winkte ab. »Sie glauben nicht im Ernst daran, dass der Bräutigam die Braut verschwinden hat lassen?«
Forrest wog den Kopf hin und her. »Das ist eine Vermutung, die ich vorerst nicht ausschließen kann.«
Joshua Jason Calbott ließ den Detective stehen, legte einige Meter zurück und im ausreichenden Abstand drehte er sich ihm zu. »Sie übernehmen die Leitung des Falles, bis Mike sich aus dem Krankenstand zurückmeldet. Ich denke, er wird übermorgen wieder im Einsatz sein«, übertrug er Forrest vorübergehend die Verantwortung und verschwand mit einer herablassenden Handbewegung. Waterspoon betrat sein Büro und wurde einige Minuten später erneut gestört. Diesmal wurden ihm die vorhandenen Akten gebracht, die über Marilyn, ihren Mann und ihre Eltern in den wenigen Stunden vorher angelegt worden waren. Mit Absicht war das Gespräch mit Freddy von ihm abgebrochen worden. Gerne hätte er ihn nach dem Verbleib des Zierknopfes gefragt, der am Kragen seines Hochzeitsanzugs gefehlt hatte. Dafür konnte es tausend harmlose Gründe geben. Zudem waren die Umstände nicht geeignet, um einen Zwist zwischen den Eltern und ihrem Schwiegersohn herbeizuführen.
Dazu besaß er zu wenig Hintergrundinformationen von den Ereignissen vor, während und nach der Hochzeit. Ebenso über die Familie und den Ehemann. Dieses Manko galt es schleunigst zu beheben. Es ließ sich nicht vermeiden, die Hochzeitsgäste zu befragen, auch die Nachbarn der Wylers. Was war in den Tagen vor der Trauung geschehen, welchen Ruf hatten sie und wie sah ihr Umfeld aus? Dem Detective wurde bei den Recherchen wieder einmal vor Augen geführt, wie falsch Vorurteile waren. Freddy, dessen Art und Verhalten waren ihm unsympathisch, zumal von dem Bräutigam eine Sorge vorgegeben wurde, die nur seine Lippen, jedoch nicht sein Herz betroffen hatte. War das ein ausreichender Grund, um ihn zu verdächtigen? Mit Widerwillen fing er an, Nachforschungen anzustellen und nahm dazu den PC zu Hilfe.
Er kam ins Staunen, dass er Dustin Wyler im Computer der Polizeibehörde wiedergetroffen hatte, aber ausgerechnet der Schwiegersohn dieser Sitzung ferngeblieben war. Die Computerkenntnisse des Detectives waren besser geworden, dennoch eingeschränkt. Es lag nicht an seinen PC-Kenntnissen, dass er null Einträge über den Ehemann von Marilyn gefunden hatte, sondern daran, dass es keine zu finden gab. Es war für Forrest erstaunlich, dass der frisch Vermählte nicht einen dunklen Fleck auf seiner weißen Weste hatte. Nicht einmal in seiner Jugend war eine Ordnungswidrigkeit von ihm begangen worden. Entgegen seiner Erwartung hatte dafür der Schwiegervater einiges auf dem Kerbholz. Zwar waren es überwiegend Bagatellen, trotzdem fiel Forrest eines auf: Der Vater der Verschwundenen war anständig geworden, nachdem er geheiratet hatte. Wie hätte sich Dustins Lebensweg gestaltet, wenn Bridget ihm nicht über den Weg gelaufen wäre? War es möglich, dass er Freddy aus einer falschen Perspektive begutachtet und der Bräutigam mehr Sorgen um seine Frau hatte, als es von ihm wahrgenommen wurde? Der Detective erhob sich, begab sich ans Fenster und sah nachdenklich dem Schneetreiben zu. Die gewonnenen Erkenntnisse besaßen keinen Einfluss auf die Sachlage. Freddy war innerlich ungemein nervös gewesen, hatte versucht, es mit einer aggressiveren Wesenseinstellung zu überspielen. Das musste einen Grund haben, aber welcher konnte es sein?
Forrest verließ trotz des Schneefalls das Präsidium und begab sich an den Ort, an dem Marilyn verschwunden war. Er kannte sich rund um das Charles River Basin gut aus. Obwohl er sich durch seine Anwesenheit keine neuen Erkenntnisse versprach, hatte er vor, einen Blick auf die Gegend zu werfen. Zwei Stunden später, seit geraumer Zeit vor dem Hauptgebäude des Segelboothafens stehend, rief er einen sinnlos herumstehenden Polizeifotografen zu sich. Taucher waren im Einsatz und auf der Suche nach Marilyn, deswegen war der Mann zugegen. Forrest bat ihn, vom Hafen und der näheren Umgebung Bilder anzufertigen und sie ihm zukommen zu lassen. Es war eine Anweisung, die er instinktiv veranlasst hatte. Dass er dafür im neuen Jahr einen Lohn ernten würde, war in diesem Moment nicht absehbar. Er verließ den Segelboothafen und trat den Weg ins Department an. Von dem kurzfristigen Abstecher in eine andere Abteilung hatte er jetzt schon genug. Er war Ermittler in Mordfällen und seine Aufgabe war klar definiert, sie lautete: Finde den Mörder. Es gab ein Opfer und einen Täter, den es zu überführen galt. Im Augenblick hatte er nichts, weder eine Leiche noch einen verdächtigen Gewaltverbrecher. Die Ungewissheit über Marilyns Verbleib begann ihn zu quälen. Forrest war ebenfalls Vater und nicht gewillt, sich in die Gefühlswelt der Eltern zu versetzen. Es verstand sich von selbst, dass sie im Moment die seelische Hölle durchzustehen hatten. Wieder sah er sich darin bestätigt, dass es egal war, in welcher Abteilung er den Dienst versah. Der Tod, das Grauen und das unsagbare Leid waren immer und überall vorhanden.
In seinem Revier war er moralisch sogar leicht im Vorteil. Normalerweise wusste er, wo sich die Opfer befanden. Er war nicht fähig zu beurteilen, ob er die Unwissenheit, wie sie ihn im Moment belastete, auf Dauer ertragen würde und freute sich schon jetzt auf die Rückkehr ins Morddezernat. Bis dahin wollte er sein Bestes geben und auf jeden Fall erneut mit Freddy sprechen, allerdings unter vier Augen. Die Nervosität des unbescholtenen Bräutigams ging Forrest nicht aus dem Kopf. Vielleicht hatte Marilyn nach einem Streit mit ihrem Mann während der Hochzeitsfeier das Fest verlassen oder ein anderer Vorfall hatte sie in die Flucht getrieben. Genau das waren die Punkte, die der Detective als äußerst deprimierend empfand. Es waren Fragen, auf die er keine Antworten parat hatte und damit das Gefühl nicht loswurde, ein Ratespiel ähnlich einer Quizshow zu betreiben. Bei einem Ermordeten gab es nichts zu enträtseln, eine Leiche war tot und das Opfer entweder eines natürlichen oder eines gewaltsamen Todes gestorben. Wenn Letzteres vorlag, dann kam er ins Spiel und war bereit, den Täter zu finden. So einfach klang es im Morddezernat und deswegen hatte er vorgehabt, sein Büro bis zur Rente mit keinem anderen Arbeitsplatz zu tauschen. Die aktuelle Situation gab ihm das Gefühl, zu alt und trotz seiner Erfahrung nicht kompetent genug zu sein. Eine Leiche verschwand nicht spurlos, sie lief nicht davon, um sich zu schützen oder zu verstecken. War Marilyn davongerannt?, fragte er sich. Das Leben hatte sich wieder einmal mit dem Mantel des Schicksals und des Zufalls angezogen. Dem Detective erging es nicht anders als so vielen Menschen auf dieser Erde. Zur falschen Zeit den verkehrten Ort zu erreichen, war Pech. Allerdings hatte solch eine Begegnung einen wesentlichen Unterschied zu Aufeinandertreffen, die jeden Augenblick eskalieren könnten. Es gab keine Verletzten oder Toten, nur den Vorfall eines scheinbar harmlosen Ehestreits. Auf dem Weg ins Präsidium wurde Forrest in ein derartiges Ereignis verwickelt.
Ω
U
nterdessen war die Adoptivtochter des Detectives in ihrem Element. Der Grund dafür war, dass sie sich nach der Unterstützung ihres Verlobten endlich wieder in ihrem Gewässer wiederfand, was ihr berufliches Standbein betraf. Molly hatte Wochen und Monate ihrem Freund Adam geholfen, den von ihm geerbten Radio- und Fernsehsender umzustrukturieren. Ihre eigentliche Hauptaufgabe, damit ihr ursprünglicher Job, geriet dabei ins Hintertreffen.
Bei der Ausstrahlung von Wiederholungen ihrer über die Stadtgrenze hinaus bekannten Tagesgeschichten war es deutlich an den Einschaltquoten abzulesen. Mit neuen Storys hatte sie nun vor, die Zuschauer zurückzugewinnen, um der von ihr erfundenen Sendung die alte Popularität zu verleihen. Molly wollte die Geschichten in einem modernen Gewand präsentieren und ihr Konzept beruhte darauf, in Zukunft kritischer mit den gegebenen Missständen in der Stadt umzugehen. Ihr bisheriges Schema hatte sie aufgegeben und dafür mit einem zeitgemäßen Motto versehen: Nach wie vor brav, aber nicht mehr bieder. Kontroverser zu sein, energischer zu hinterfragen, war ihr Ziel. Bis in den Dezember des letzten Jahres war die Tagesgeschichte vor allem aus einem Grund beliebt: Molly hatte nicht ständig über Probleme und tragische Ereignisse berichtet, sondern den Zusehern auch die schönen Seiten und Wunder des Lebens ins Wohnzimmer gebracht.
Die Grundidee wollte sie keinesfalls ändern, damit hätte sie ihre Fans maßlos enttäuscht. Stattdessen hatte sie sich vorgenommen, an den künftigen Beiträgen und ihrer Person zu feilen. Der erste Schritt war durchgeführt worden und nach einer heißen Diskussion mit ihrem Verlobten wurde ihr eine längere Sendezeit genehmigt. Die einhundertzwanzig Sekunden waren für Laien unbedeutend, aber die zusätzliche Zeit eröffnete der Journalistin ungeahnte Möglichkeiten. Es war eben ein großer Unterschied, ob einem Beitrag sieben oder neun Minuten zur Verfügung standen. Seit einer Woche war sie mit ihrer neuen alten Tätigkeit beschäftigt und glücklich darüber. Adam bei der Umstrukturierung des erfolgreichen, aber mit keinem erfreulichen Ruf ausgestatteten Senders zu unterstützen, war für sie von vornherein selbstverständlich gewesen. Es nahm mehr Zeit in Anspruch, als sie und ihr Verlobter es im Vorfeld vermutet hatten. Geplant für den Wandel waren höchstens acht, maximal zehn Wochen, benötigt wurden elf Monate. Molly hatte es sich zu Beginn an der Seite ihres Freundes anders vorgestellt. Ihm zu helfen war klar, aber zugleich hatten es ihre Pläne vorgesehen, an der eigenen Sendung weiterarbeiten zu können. Bereits nach wenigen Tagen wurde die Umsetzung des Gedankens zeitlich unmöglich. Termine im ganzen Land, Gespräche und Verhandlungen, die sich über Stunden hinwegzogen, und tausend andere Hürden verhinderten jede journalistische Tätigkeit ihrerseits. Erschwerend kam hinzu, dass Molly das Ruder bezüglich der Themen der Tagesgeschichten nicht aus der Hand zu geben gedachte. Bevor Adam den Sender aus heiterem Himmel und dementsprechend fassungslos geerbt hatte, war sie eine Art Vorgesetzte von ihm gewesen. Sie bildeten ein Duo, in dem Molly als Reporterin die Führungsrolle innehatte. So hatten sie sich kennengelernt, so wurden sie Freunde und schließlich ein Liebespaar, das mittlerweile verlobt war. Zusammen hatten sie drei erfolgreiche Dokumentationen produziert und Preise gewonnen. Die Story des Tages, die in den Mittagsnachrichten gesendet wurde, besaß in Mollys Leben einen hohen Stellenwert. Sie war bis zu dem Nachlass stets mit Adam auf der Suche nach Themen gewesen. Sie hatten die Viertel der Stadt aufgesucht und wurden meistens fündig. Er war ihr mit der Kamera wie ein Bodyguard gefolgt, um Situationen und Gespräche aufzunehmen, die dem Fernsehzuschauer Tränen oder Lachfalten ins Gesicht gezaubert hatten. Mit der Erbschaft erfuhr diese Phase ihres Lebens ein Ende und keiner von beiden konnte sagen, wie es sich auf ihre Beziehung auswirken würde.
In den vergangenen sieben Tagen hatte Molly ihr Büro und ihre Unterlagen auf Vordermann gebracht. Um mit den Arbeiten an den Tagesgeschichten beginnen zu können, benötigte es nur noch einen Kameramann. Adam kam aus zeitlichen Gründen nicht in Betracht. Am Vormittag hatte sie mit zwei Kameraleuten des Senders ein Gespräch geführt; beide entsprachen nicht ihrer Vorstellung. Sie waren fähig, gaben sich freundlich und interessiert, aber Molly hatte bei ihnen das gewisse Feuer vermisst, das sie von ihrem Verlobten kannte und gewohnt war. Erst durch ihn hatte sie erkannt und verstanden, wie wichtig eine variable Kameraführung sein konnte. Oft und gern erinnerte sie sich an Interviews, die Adam aufgezeichnet hatte. Stets war sie erstaunt, wie er mit seiner Kamera umgegangen war. Die Bilder, die er mit zwei sitzenden oder stehenden Personen aufzunehmen vermochte, schienen mehr Leben zu besitzen als ihre Gesprächspartner. Ihre Erinnerung an brisante Unterhaltungen wurde dadurch getrübt, dass die auf ihre Fragen antwortenden Leute nicht die Menschen waren, für die sie gehalten wurden. Molly nahm sich vor, an diesem Tag mit keinem Kameramann mehr zu sprechen. Die hinter ihr liegenden Gespräche hatten sie ermüdet. Stattdessen setzte sie sich an ihren Schreibtisch und atmete tief durch, nachdem sie einen Stift und Block auf die Arbeitsplatte gelegt hatte. Es war ein Akt, mit dem für sie ein neuer Lebensabschnitt eingeläutet wurde. Sie lehnte sich in ihrem Bürostuhl zurück und dachte über Themen für ihre kommenden Sendungen nach. Wurde ein Gedanke in ihrem Kopf präsenter, fing sie an, sich stichwortartige Notizen aufzuschreiben. Nach dem Mittagessen wollte sie durch die Stadt schlendern und wie früher nach Themen Ausschau halten. Es kam anders als geplant. Die Suche nach einer rührenden oder explosiven Story blieb ihr erspart, stattdessen wurde sie mit einer Geschichte konfrontiert, die das Telefon läuten ließ. Molly hob den Hörer ab, bestätigte ihre Identität, indem sie angab, die Reporterin zu sein, die der Anrufer sprechen wollte, und hörte der Stimme am anderen Ende der Leitung aufmerksam zu. Es war ein Mann, den sie an der Strippe hatte. Er gab an, ihr brisantes Material zuspielen zu können, forderte dafür eine beträchtliche Summe, deren Höhe der Journalistin für einen Moment die Sprache raubte. »Erstens kann ich das nicht entscheiden, zweitens muss ich bei diesem Betrag wissen, wer Sie sind und um welche Dokumente es sich handelt«, antwortete sie, nachdem der erwähnte Geldbetrag zumindest gedanklich von ihr verdaut worden war.
Der Anrufer schwieg einen Augenblick. »Solange ich keine verbindliche Zusage habe, werde ich Ihnen Hinweise zu den Papieren und meinen Namen nicht geben.«
Molly schüttelte ungläubig den Kopf. »Wie stellen Sie sich das vor? Sie rufen hier an und erwarten, dass ich sofort Feuer und Flamme bin? Die Kompetenzen meinerseits reichen zum einem nicht so weit, zum anderen brauche ich mehr als nur Ihre Worte. Wie würden Sie sich bei einem solchen Anruf verhalten und verfahren?«
Die Stimme antwortete prompt. »Begeben Sie sich bitte in den Empfangsbereich des Senders und warten Sie dort. Ich rufe wieder an!«
Molly hörte ein Knacken in der Leitung und sah verstört den Hörer an. War das ein Streich eines Witzbolds?, fragte sie sich. Einen ähnlichen Anruf hatte sie noch nie in ihrem Leben erhalten. Es hatte ein paar Telefonate gegeben, die verstörend waren, nicht jedoch in dieser Form. Sie legte den Hörer auf und überdachte das eben Gehörte. Die Stimme war ihr fremd und sie wurde von unsicheren Schwingungen begleitet. Sie hatte eine undefinierbare Zurückhaltung vernommen, vielleicht sogar Angst, auf jeden Fall eine Art von Panik und Hektik. Hätte sie die Tonlage und Redensart beschreiben sollen, wäre sie zu folgendem Schluss gekommen: Der Mann war eingeschüchtert und befand sich in einer Lage, über die er die Kontrolle verloren hatte. Molly sah auf die Uhr an ihrem Handgelenk, die ihr von Adam geschenkt worden war. Die Gespräche mit den Kameramännern und die Gedanken zu den Tagesgeschichten hatten sie die Zeit vergessen und somit den Mittagstisch versäumen lassen. Sie blickte aus dem Fenster und lächelte. Der Schneefall gefiel ihr. Ohne Hast zog sie sich ihren Mantel an und begab sich in das Erdgeschoss des Senders.
In der Empfangshalle war die Handschrift von Adam und Molly deutlich zu sehen. Aus einer Bahnhofshalle der zweiten war eine VIP-Lounge für Reisende der ersten Klasse geworden. Für das Paar war es ungemein wichtig, dass jeder, der den Sender betrat, sich umgehend willkommen fühlte. Das betraf die Kunden und die Angestellten. Nach den Jahren der Sklaverei unter dem Vorbesitzer Richard Steve Bakster sollte in ihren Augen das Personal für die Hetzjagden und die Willkür entschädigt und neu motiviert werden. Eine Kantine war entstanden, dazu ein Fitnessraum und eine Saunaanlage. Die wesentlichste Veränderung, die Molly und Adam vollzogen hatten, war die Namensänderung des Senders. News Channel existierte nicht mehr, das Unternehmen hieß neuerdings AM News. Wofür oder besser gesagt, für wen die zwei Buchstaben standen, wusste innerhalb und außerhalb des Gebäudes bald jeder. Molly war stolz auf das Geleistete, blieb jedoch bescheiden wie eh und je. Das bezog sich ebenso auf ihre Beziehung zu Adam. Privates und Berufliches hatte sie strikt getrennt und war so geblieben, wie ihre Kollegen sie von Anfang an geschätzt hatten. Es ließ sich nicht vermeiden, dass Molly für den ein oder anderen Mitarbeiter ein Sprachrohr gegenüber Adam wurde. Wenn sie es für notwendig hielt, dann stellte sie sich als Vermittlerin zur Verfügung. Besonders in den ersten Monaten war ihr Verlobter mit der gewaltigen Aufgabe, den Sender zu leiten und umzugestalten, sichtbar überfordert. Es hatte zu Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und den Redakteuren sowie Intendanten geführt, aber inzwischen lief das meiste reibungslos ab. Auch darauf war Molly stolz und somit zugleich auf ihren Lebensgefährten. In der Empfangshalle herrschte chaotischer Betrieb. Leute eilten von links nach rechts, stiegen in Aufzüge oder verließen diese und hier und dort fanden Gespräche unter vier oder mehreren Augen statt. Es waren viele fremde Gesichter in der Halle anwesend, aber keines, das Molly in irgendeiner Weise unangenehm aufgefallen wäre. Sie drehte sich langsam um ihre Achse, doch niemand gab ihr ein Zeichen, um ihr zu signalisieren, dass er der Anrufer war. Mit einem Gefühl, das zu einer Mixtur aus emporsteigender Verärgerung und Enttäuschung wurde, blieb sie mitten in der Empfangshalle stehen und ließ den Eingangsbereich nicht aus den Augen. Irgendwie kam sich Molly lächerlich vor und zugleich begann sie sich zu tadeln. Weshalb hatte sie so dumm reagiert und war auf den Anruf hereingefallen? Bestimmt hatte sie aus Spaß irgendein Kerl hinters Licht führen wollen und dem Scherzbold war es gelungen. Unmerklich schüttelte sie den Kopf und nahm Schritt in Richtung des Eingangs auf, als sie plötzlich von einer Person am Arm gezogen wurde. Es war ein Teenager von achtzehn oder neunzehn Jahren. »Sind Sie Miss Waterspoon?« Molly nickte und nahm den Umschlag entgegen, den er ihr entgegenhielt. Bevor sie dem Jungen eine Frage stellen konnte, war er ins Freie gerannt. Sie lief ihm nach und wurde vor dem Gebäude enttäuscht. Der Jugendliche war in der Menschenmenge untergetaucht. In Mollys Rücken betraten und verließen Leute den Sender und sie konnte nicht ahnen, dass sich der ominöse Anrufer dazwischen befand. Er hatte Molly aus einer der Telefonzellen in der Eingangshalle angerufen. Kaum war die Journalistin im Erdgeschoss aufgetaucht, hatte er seinem Sohn ein Zeichen gegeben und war somit unerkannt geblieben. Die Reporterin sah das Kuvert in ihren Händen an und fasste den Entschluss, die Straßenseite zu wechseln. Gegenüber dem AM News-Gebäude befand sich ein Lokal, das Molly früher häufiger aufgesucht hatte. Die Lokalität war eine Mischung aus einer Bar, einem Restaurant und einem Café. Sie und Adam waren fast so etwas wie Stammgäste gewesen und hatten dort regelmäßig die hinter und vor ihnen liegenden Arbeiten besprochen. Seitdem ihr Lebensgefährte den Sender geerbt hatte, waren weder sie noch er in dem Lokal mehr zu Gast gewesen. Molly nahm an einem der Tische Platz, an dem sie einst öfter gesessen hatten, bestellte sich ein Wasser und einen Rohkostsalat und öffnete neugierig den Umschlag. Sie zog den Inhalt heraus, bei dem es sich um ein einziges Blatt handelte. Mit einer gewissen Enttäuschung sah sie es sich an, wobei ihr nicht klar war, was sie erwartet hatte. Bereits dieser Gedanke ließ sie ihr Verhalten sowie ihre Erwartungshaltung überdenken. Warum war sie enttäuscht? An welche Dokumente hatte sie gedacht? Etwa an einen Skandal wie Watergate damals? Sie schüttelte den Kopf und hatte das Empfinden, sich lächerlich gemacht zu haben. Schließlich versuchte sie, die Motive des Anrufers zu ergründen: Weshalb hatte er ausgerechnet sie