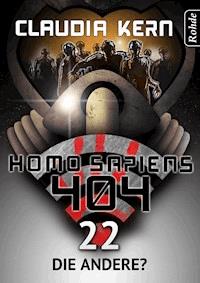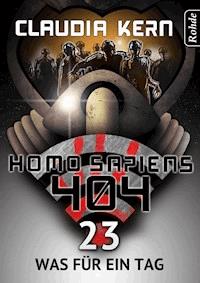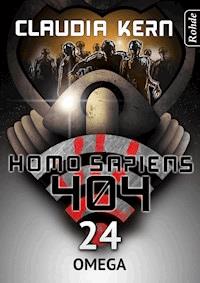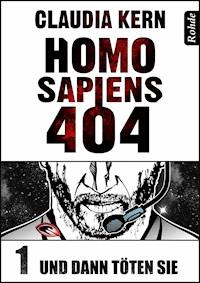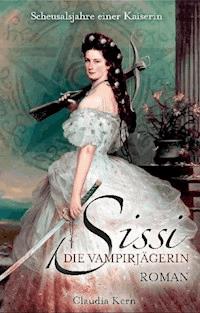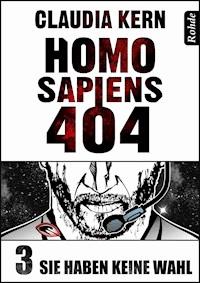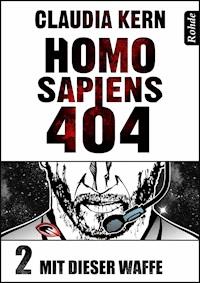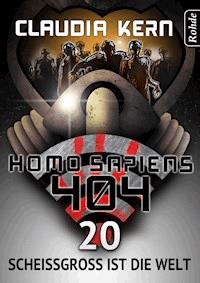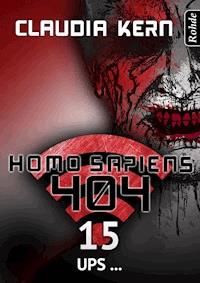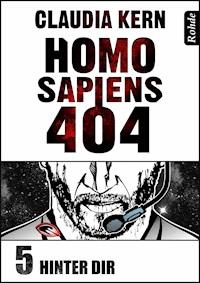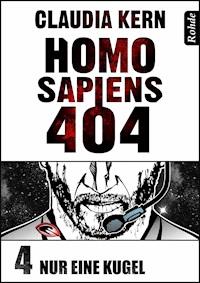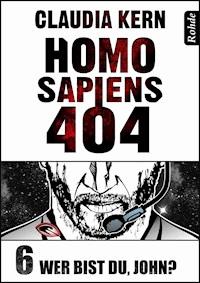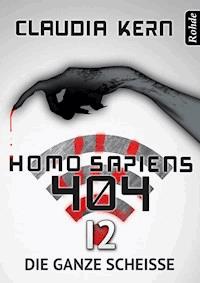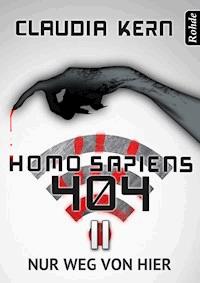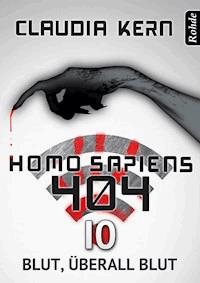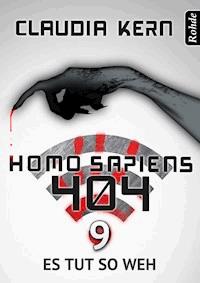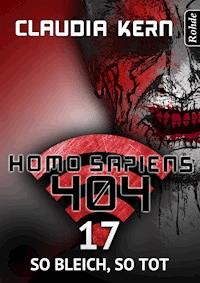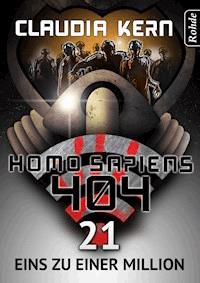8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schicksal in dunklen Zeiten
- Sprache: Deutsch
In Köln tanzt der Schwarze Tod. Köln, 1348. Ketlin ist noch nicht lange Novizin in einem Kölner Kloster, als sie sich in den Apothekerlehrling Jacob verliebt. Getrieben von der vagen Hoffnung, dass anderswo ein gemeinsames Leben möglich ist, wollen sie Köln verlassen. Da erreicht die Schwarze Pest die Stadt, und die Tore werden geschlossen. Köln ist zu einer Todesfalle geworden, aus der es kein Entkommen gibt. Doch als auch Jacob erkrankt, gelingt es Ketlin, ihn zu heilen, und neue Hoffnung keimt in dem jungen Paar – für Köln und für ihre Liebe ... Eine fesselnde Liebesgeschichte zur Zeit der verheerendsten Epoche des europäischen Mittelalters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
In Köln tanzt der Schwarze Tod …
Köln, 1348. Ketlin ist noch nicht lange Novizin in einem Kölner Kloster, als sie sich in den Apothekerlehrling Jacob verliebt. Getrieben von der vagen Hoffnung, dass anderswo ein gemeinsames Leben möglich ist, wollen sie Köln verlassen. Da erreicht die Schwarze Pest die Stadt, und die Tore werden geschlossen. Köln ist zu einer Todesfalle geworden, aus der es kein Entkommen gibt. Doch als auch Jacob erkrankt, gelingt es Ketlin, ihn zu heilen, und neue Hoffnung keimt in dem jungen Paar – für Köln und für ihre Liebe.
Eine fesselnde Liebesgeschichte zur Zeit der verheerendsten Epoche des europäischen Mittelalters.
Über Claudia Kern
Claudia Kern, geboren in Gummersbach, studierte Anglistik, Philosophie und Vergleichende Religionswissenschaften an der Universität Bonn und arbeitete jahrelang als Kolumnistin und Redakteurin für Fernsehen und Zeitschriften.Nach Ausflügen ins Fantasy-Genre etablierte sie sich mit dem Roman »Das Schwert und die Lämmer« als Autorin historischer Romane. Sie lebt seit 2008 mit ihrem Lebensgefährten in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Claudia Kern
Die Nonne und der Tod
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Epilog
Impressum
Prolog
In letzter Zeit denke ich oft an den Toten im Weiher. Die Erinnerung ist so lebendig wie ein Traum, aus dem man mitten in der Nacht hochschreckt.
Es war der erste frostfreie Tag des Jahres, und ich stand hinter der Scheune und sah zu, wie ihn unser Knecht Michael aus dem Wasser zog. Ich spürte das feuchte Gras unter den dünnen Sohlen meiner Lederschuhe, die kleinen Steine dazwischen, und hörte das Knirschen des Eises auf dem Weiher.
Der Tote konnte noch nicht lange im Wasser gelegen haben. Die Fische hatten seine Augen gefressen und seine Lippen, aber ich erkannte ihn an der langen Narbe auf der Stirn. Es war Utz. Ich wusste nicht mehr, woher die Narbe stammte, nur noch, dass er eines Abends an unserer Tür gestanden hatte, gestützt von seinen Töchtern Erika und Anne, und meine Mutter um Hilfe bat. Sie hatte das Blut von seinem Gesicht gewaschen, die Wunde mit der Nadel, mit der sie sonst meine Kleider stopfte, genäht und ihm einen Kräutersud gekocht. Sie wusste viel über solche Dinge, über Wunden und Kräuter, Wehwehchen und wie man sie lindert. Heute glaube ich, dass man uns nur deshalb nicht aus dem Dorf jagte.
Michael zog Utz mit seiner Angel aus dem Weiher. Wir waren allein. Mutter war schon vor dem Morgengrauen zum Markt nach Coellen aufgebrochen, um Stoff für meinen neuen Rock zu kaufen. Sie sagte, ich würde schneller wachsen als das Unkraut in den Beeten. Wäre sie zuhause gewesen, hätte sie mich weggeschickt, hätte mich davon abgehalten, in das aufgeschwemmte grinsende Gesicht zu blicken, von dem Wasser wie Tränen ins Gras tropfte. Aber sie war nicht zuhause. Und so stand ich am Weiher, die Enden des Stricks, der meinen zu kurzen Rock zusammenhielt, um die Finger geschlungen und sah zu, wie Michael den Umhang des Toten über dessen Gesicht ausbreitete.
»Gott sei deiner Seele gnädig, Utz«, sagte er und wischte sich die nassen Hände an der Hose ab.
Ich runzelte die Stirn, verstand nicht, wieso er so traurig klang.
»Hat Gott ihn nicht ins Wasser gestoßen?«, fragte ich.
Michael musterte mich, dachte wohl darüber nach, wie viel ich von dem mitbekommen hatte, was geschehen war. »Weshalb sollte Gott etwas so Schreckliches tun?«
Ich streckte den Arm aus und zeigte auf den Weg, der vor unserem Haus verlief und durch das ganze Dorf führte. An seinem Ende, hinter Brombeerhecken und flachen Hüttendächern, ragten schwarz verkohlte Balken empor. »Deshalb.«
»Und was glaubst du, ist da passiert?«
Ich zögerte. Uns Kindern hatte man erzählt, Räuber wären in der Nacht vor Utz’ Hütte aufgetaucht, aber wir wussten es besser, hatten die letzten Tage damit verbracht, uns unsere eigene Geschichte zusammengereimt aus dem, was die Erwachsenen sich zuflüsterten, wenn sie glaubten, allein zu sein. Es war nicht schwer gewesen, schließlich wurde seit jener Nacht über nichts anderes im Dorf geredet.
»Ich glaube«, sagte ich, »dass Utz seine Familie erschlagen hat, weil er hungrig war und sie ihm alles wegaßen. Und dann wollte er zu unserem Haus, aber weil wir immer beten und zur Messe gehen, hat Gott ihn in den Weiher geworfen.«
Ärger zog wie eine Wolke über Michaels Gesicht, verschwand dann aber wieder. »Du bist zu jung und zu …« Er unterbrach sich. Damals wusste ich nicht, was er sagen wollte, doch heute kann ich es mir denken.
»… um das zu verstehen«, fuhr er fort. »Utz war ein guter, anständiger Mann. Du solltest für ihn beten, nicht über ihn tratschen.« Er warf einen kurzen Blick auf den Toten unter dem Umhang, als würde er von ihm Zustimmung erwarten. »Utz hat sein Weib und seine Kinder geliebt. Mehr musst du nicht wissen.«
Michael hob seine Angel auf und wandte sich ab.
»Dann waren es doch Räuber?«
Er blieb stehen. Einen Moment lang sagte er nichts, aber ich sah, wie sich seine Hand fester um die Angel schloss. Dann drehte er sich zu mir um. Der Ärger war in sein faltiges, raues Gesicht zurückgekehrt. »Weißt du, was Hunger heißt, Kind? Weißt du, was es heißt, morgens aufzuwachen und deine Kinder vor Hunger schreien zu hören? Wenn du das letzte Huhn geschlachtet und die Saat für das Frühjahr aufgegessen hast und dein Feld brachliegen muss?«
Er machte einen Schritt auf mich zu. Ich wich zurück. Noch nie hatte ich Michael so wütend gesehen.
»Du und deine Mutter, mit euren zwei Mahlzeiten am Tag und einem Stall voller Ziegen, ihr wisst nichts. Ihr werdet nie verstehen, dass ein Mann einen Stein in die Hand nimmt und seinen Kindern und seinem Weib den Schädel einschlägt, weil er es nicht ertragen kann, sie verhungern zu sehen! Aber Gott versteht es – ist mir scheißegal, was die Pfaffen dazu sagen! Gott weiß, dass Utz das Richtige getan hat.«
Ich senkte den Kopf, um Michaels Blick auszuweichen. Ohne es zu merken, hatte ich den Strick so eng um die Hand geschlungen, dass sich meine Finger weiß gefärbt hatten. Ich versuchte mir vorzustellen, was Utz gefühlt haben musste, aber es gelang mir nicht.
»Warum hat er Mutter nicht um Essen gebeten?«
Michael antwortete nicht. Es wurde so still, dass ich die Bauern auf ihren Feldern reden hörte. Dann lachte er kurz und trocken, schüttelte den Kopf und ließ mich allein mit dem Toten zurück.
Utz hatte gefragt, das verstand ich damals schon, auch wenn ich es mir nicht eingestand. Ich erzählte niemandem davon, weder Mutter noch den anderen Kindern noch dem Priester, der zwei Wochen später zum ersten Mal nach dem Winter ins Dorf kam und die Toten segnete, die das Frühjahr nicht mehr erlebt hatten.
Mit der Zeit erholte sich das Dorf von der Tat. Die Hütte, die Utz angezündet hatte, wurde durch eine neue ersetzt, und frisches Saatgut ging auf seinem Feld auf. Die Erwachsenen begannen über anderes zu reden, über Geburten und Krankheiten, das Wetter und die kleinen Skandale im Dorf. Doch ab und zu, wenn wir Kinder unbeachtet zwischen ihnen spielten, hörte ich jemanden sagen: »Er hat das Richtige getan«, und ich wusste immer, wer damit gemeint war.
So ging es bis zu dem Tag, an dem die Schausteller kamen.
Kapitel 1
Es war der Oktober im Jahr 1347.
»Holt euer Weibsvolk rein! Die Schausteller kommen!«
Knuts Stimme hallte durch den Regen, überschlug sich beinahe vor Aufregung. Neben mir meckerten die Ziegen. Ich legte die Holzschaufel weg, mit der ich ihren Stall hatte säubern wollen, schlug die Kapuze meines Umhangs hoch und trat nach draußen.
»Schausteller!«, rief Knut. Die Brombeerhecke, die neben unserer Hütte am Weg wuchs, war in den letzten Jahren so dicht geworden, dass ich ihn nur hören, aber nicht sehen konnte. Neugierig ging ich auf den Klang seiner Stimme zu.
Ich war nicht die Einzige, das bemerkte ich, als die Hecke mir nicht mehr die Sicht nahm. Auch aus den anderen Hütten traten Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Die letzte Ernte war vor Tagen eingeholt worden, es gab kaum noch Arbeit auf den Feldern. Die Männer nutzten die Gelegenheit, um sich ein paar Pfennige beim Steinebrechen oder Holzhacken zu verdienen, während die Frauen zuhause blieben und das Gemüse für den Winter einlegten. Sie dürsteten ebenso nach Abwechslung wie ich.
»Schausteller!«
Knut tauchte zwischen einigen Hütten und Hühnerställen auf, sprang über die Deichsel eines Karrens hinweg und lief auf den Weg. Matsch spritzte an seinen teuren Lederstiefeln empor. Als er all die Frauen und Mädchen vor den Hütten sah, blieb er stehen. Die Kapuze seines Umhangs war ihm beim Lauf vom Kopf gerutscht. Regenwasser tropfte ihm aus den Haaren. Er stemmte die Hände in die Hüften und betrachtete uns missbilligend.
»Schausteller«, wiederholte er zwischen zwei keuchenden Atemzügen. »Habt ihr mich nicht gehört? Bringt euch in Sicherheit.«
»Ach, halt die Klappe, Knut«, sagte ich so laut, dass es jeder im Dorf hören konnte. Einige lachten, Knut natürlich nicht. Er und ich waren im selben Jahr geboren worden, aber er benahm sich immer noch wie ein Kind. Sein Vater, Bauer Josef, der reichste Mann im Dorf und in Abwesenheit des Fronherrn unser Vorsteher, pflegte zu sagen, Gott habe ihn für seine Sünden mit einem ältesten Sohn bestraft, der nicht einmal zum Ziegenhüten tauge.
Knut sah mich an, öffnete den Mund, als wolle er zu einer Antwort ansetzen, schloss ihn aber direkt wieder und schüttelte nur stumm den Kopf. Sein Gesicht war so rund und hell wie der Mond, seine Lippen voll wie die eines Mädchens. Hinter seinem Rücken nannten wir ihn »Knutine«.
»Ihr werdet schon sehen«, sagte er, als er die Daumen hinter den Gürtel hakte und sich abwandte. »Vorlautes Weibsvolk.«
Die letzten Worte flüsterte er, aber ich verstand sie trotzdem.
Else und Erna, Töchter eines Tagelöhners, die mir gegenüber vor ihrer kleinen Hütte standen, sahen mich erwartungsvoll an. Ich hob die Schultern, wollte Knut nicht noch mehr provozieren. Schon öfter hatte er sich bei seinem Vater über jemanden im Dorf beschwert, auch über mich. Mutter mochte es nicht, wenn ich bei denen, die über uns standen, unangenehm auffiel.
Das Quietschen von Wagenrädern und das Knallen einer Peitsche unterbrachen meine Gedanken. Ich trat auf den Weg und rückte die Kapuze meines Umhangs zurecht, sodass sie Haar und Stirn bedeckte. Auch die anderen Frauen und Mädchen tasteten nach ihren Kopfbedeckungen. Einige Mütter ergriffen die Hände ihrer Kinder und wichen zurück, als der erste Ochsenkarren ins Dorf rollte.
Zwei Männer, verborgen unter schweren, schlammbespritzten Umhängen, gingen vor ihm her. Einer trug einen langen Stecken, von dem eine tote Krähe hing. Der andere schwankte hin und her wie ein Betrunkener. Auf dem Kutschbock saß ein dritter, ebenfalls verhüllter Mann. Hinter ihm stapelten sich Kisten und Säcke unter einer Plane aus Segeltuch. Kleinere Kisten hingen an den Seiten des Karrens. Er wirkte überladen, die Holzräder gruben sich tief in den Matsch.
Ein zweiter Ochsenkarren folgte dem ersten. Die Menschen, die neben und vor ihm gingen, konnte ich nicht erkennen. Sie hatten ihre Umhänge geschlossen, selbst ob es sich um Männer oder Frauen handelte, blieb mir verborgen. Meine Selbstsicherheit verflog, wurde ersetzt durch eine ängstliche Unruhe, als mir klar wurde, dass es außer Knut und einigen Greisen keinen Mann im Dorf gab. Nur wenige Male in meinem Leben hatte ich den Vater, den ich nie hatte, vermisst, doch in diesem Augenblick wünschte ich mir, er würde aus der Hütte treten und sich der unheimlichen Prozession stellen.
Die Karren rollten nacheinander durch das Dorf. Es waren insgesamt vier, alle so überladen wie der erste. Eine der Gestalten, die sie begleiteten, zog eine Flöte hervor und begann darauf zu spielen. Es war eine düstere, schwerfällig klingende Melodie, als würde ein Toter an uns vorbeigetragen. Die Gestalten bewegten sich schleppend und langsam wie Kranke oder Geister. Keiner von ihnen sagte etwas, ich hörte nur das klagende Pfeifen der Flöte und das rhythmische Klirren der Schellen, das sich nun daruntermischte. Am liebsten hätte ich mich umgedreht und wäre ins Haus gelaufen, aber mein Stolz hielt mich davon ab. Solange die anderen nicht die Türen hinter sich zuschlugen, würde auch ich meine Angst nicht zeigen, aber sobald der erste …
»Flieht!« Knut sprang durch eine Lücke in der Brombeerhecke und verschwand hinter den Hühnerställen. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich die Frauen vor ihren Hütten. Keine von ihnen folgte ihm. Niemand tat ja, was Knut sagte. Es war wie ein ungeschriebenes Gesetz.
Auch ich blieb stehen, obwohl mein Herz mit jedem Schritt, den die Fremden ins Dorf taten, schneller klopfte. Es war ein kleines Dorf, gerade mal ein Dutzend Häuser, und die Ochsenwagen nahmen nun fast seine gesamte Länge ein. Es fühlte sich an, als habe eine Armee, der wir nichts entgegenzusetzen hatten, uns erobert.
Die Melodie der Flöte änderte sich. Es geschah so unauffällig, dass ich es erst bemerkte, als auch der Takt der Schellen schneller wurde und die Gaukler im Rhythmus zu nicken begannen. Ihre Kapuzen wippten dabei auf und ab.
Und dann, mit einem Ruck, warf der, den ich für ihren Anführer hielt – der Mann mit dem seltsamen Wanderstab –, den Kopf in den Nacken und lachte. Die Kapuze rutschte ihm in den Nacken. Ich blickte in ein braun gebranntes, hageres Gesicht mit scharf geschnittenen Zügen und hohen Wangenknochen. Seine Haut war mit teils schwarzen, teils blau verblassten Linien durchzogen, Tätowierungen, die auf mich beinahe magisch wirkten.
Aus tiefblauen Augen warf er einen Blick über die versammelten Frauen und Kinder. Auch mich sah er einen Moment lang an. Als er sprach, war es so, als würde er seine Worte nur an mich richten.
»Hat eure Angst euch die Kehlen zugeschnürt?«, rief er. »Dachtet ihr, wir bringen den Tod?«
Auch seine Begleiter schlugen die Kapuzen zurück. Ich blickte in die Gesichter von Männer und Frauen, von denen viele kaum älter als ich waren. Doch sie wirkten älter, so wie die Lehrlinge, die manchmal auf ihren Wanderungen durch unser Dorf kamen.
Der Anführer der Gaukler hob seinen Stab und ließ ihn kreisen, bis die Krähe, die darin hing, zu fliegen schien.
»Dann freut euch nun!«, rief er. »Freut euch, denn wir bringen das Leben, den Tanz und das Spiel!«
Auf einmal hatten alle Gaukler Instrumente in der Hand, Flöten und Lauten und Trommeln. Sie begannen darauf zu spielen, fröhlich und so schnell, dass sich meine Füße ohne mein Zutun zu bewegen begannen.
Frauen lachten, Kinder nahmen sich bei den Händen und tanzten zwischen Ochsenkarren und aufgescheuchten Hühnern, als sich ihre Angst mit einem Mal auflöste wie ein dunkler Traum beim ersten Sonnenstrahl. Wir alle kannten das Lied, das die Gaukler angestimmt hatten, und sangen die Strophen mit. Es ging darin um einen armen Tagelöhner, der die Tochter des reichsten Bauern der ganzen Gegend zu seiner Frau machen will. Wir sangen es oft bei der Arbeit.
Ich nahm einige der kleineren Kinder bei der Hand und tanzte mit ihnen. Die Gaukler hatten ihre Ochsenkarren angehalten, tanzten und sangen mit uns, während sie auf ihren Instrumenten spielten. Unsere Stimmung war ausgelassen, spiegelte die Erleichterung wider, die wir nach dem unheimlichen Auftritt spürten. Ich glaube nicht, dass wir uns ohne diese Furcht so gefreut hätten.
Meine Füße wirbelten Matsch und kleine Steine auf, der lange Wollrock, den ich trug, schlug bei jeder Drehung gegen meine Schenkel, das Haar hing mir ins Gesicht. Ich begann zu schwitzen, die Wolle stach und brannte auf meiner Haut, aber ich tanzte weiter. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass der Mann mit dem Wanderstab als Einziger nicht mit uns tanzte, sondern auf der Deichsel des vordersten Ochsenkarrens stand und uns beobachtete.
Soll er doch, dachte ich. Er sieht nichts Unanständiges …
Mit einem lauten Knall krachte die Tür hinter mir gegen die kleine Holzbank vor unserer Hütte. Eine Hand griff nach der Kapuze meines Umhangs, die mir, ohne dass ich es bemerkt hätte, über die Schultern gerutscht war, und zog daran. Ich taumelte, ließ die Hände der Kinder los und rang einen Moment lang um mein Gleichgewicht. Die Hand zog weiter an meinem Umhang. Ich versuchte rückwärtszugehen, stolperte jedoch über meine eigenen Füße und lag im nächsten Moment im kalten, feuchten Matsch.
»Mutter!«, schrie ich. »Hör auf!«
Aber sie hörte nicht auf. Mit beiden Händen zog sie mich auf die Tür zu, ächzte und keuchte bei jedem Schritt. Ich wehrte mich nicht und ließ sie gewähren. Alles andere hätte es nur noch schlimmer gemacht. Die Dorfbewohner und Gaukler starrten mich an. Einige lachten. Ich wich ihren Blicken aus, spürte, wie meine Wangen heiß und rot wurden, und dann ertastete ich erleichtert den Holzboden unserer Hütte unter meinen Händen.
Mutter ließ meine Kapuze los, stieg über mich und zog die Tür an dem Strick, der dort als Griff diente, zu. Schlagartig wurde es dunkel in der kleinen Küche. Der Vorhang vor dem kleinen Fenster über der Küchenbank blieb im Winter stets geschlossen, damit die Wärme der Feuerstelle nicht verflog.
»Was hast du dir dabei gedacht?« Mutter stemmte die Hände in die Hüften. Sie war eine kleine, dünne Frau, die ihr Haar stets eng am Kopf geflochten trug. In den letzten Jahren war es grau geworden. »Habe ich eine Dirne erzogen?«
Draußen vor der Tür spielten die Gaukler weiter. Ich war froh darüber. Normalerweise lauschte das halbe Dorf, wenn Mutter mich zurechtwies.
Ich setzte mich auf. »Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht, nur ein wenig …«
Sie ließ mich nicht ausreden. »Getanzt hast du!«, schrie sie. »Mit offenem Haar vor fremden Männern.« Mutter fuchtelte umher, suchte wohl nach einem passenden Vergleich. »Wie die Hure Babylons!«, stieß sie dann hervor.
Sie hatte mich schon öfter so genannt, und es traf mich jedes Mal. Unwillkürlich tastete ich nach meinem Haar. Es war feucht vom Regen. »Kein anderes Mädchen hat eine Haube getragen.«
Es war die falsche Antwort, das begriff ich in dem Moment, als ich die Worte aussprach. Mutter brachte mich immer wieder dazu, das Falsche zu sagen.
»Die anderen Mädchen haben dich nicht zu interessieren. Keine von ihnen hat dein Blut!«
Ich setzte mich auf und versuchte, den Matsch aus meinem Umhang zu schlagen, aber er war zu nass. Ich rieb ihn nur tiefer in die Wolle.
»Hör auf!« Mutters Tonfall wurde noch barscher als zuvor. »Verstehst du überhaupt, was ich dir sagen will?«
Ich ließ die Hand sinken. »Ja, Mutter.«
»Und warum handelst du dann nicht danach? Habe ich nicht nur eine Dirne, sondern eine dumme Dirne erzogen?«
»Nein, Mutter.« Es war besser, sich nicht mit ihr zu streiten.
Sie machte einen Schritt auf mich zu. Unwillkürlich zuckte ich zusammen, als sie sich bückte, aber sie schlug mich nicht, sondern setzte sich ebenfalls auf den Fußboden der Küche. Dann nahm sie meine Hand in die ihre und hob sie an ihre Brust. Ihre Finger waren beinahe so rau wie der Stoff ihres Umhangs.
»Diese Mädchen sind nicht viel besser als Tiere«, sagte sie, und ihre Stimme klang auf einmal weich, beinahe flehend. »Du weißt doch, wie sie leben. Mit dem Vieh liegen sie im Schmutz, sie können nicht lesen und wissen nichts von der Welt.« Mit der freien Hand drehte sie mein Gesicht zu sich, sodass ich sie ansehen musste. Im Halbdunkel der Küche wirkten ihre Augen so grau wie ihr Haar. »Diese Mädchen sind froh, wenn ein Tagelöhner sie besteigt wie ein Ziegenbock, wenn er ihnen ein Kind macht, das genauso auf den Feldern schuften muss wie sie selbst.«
Ich versuchte, mein Gesicht abzuwenden und aufzustehen, aber Mutter ließ es nicht zu. Das Thema war mir unangenehm. »Das sind meine Freundinnen«, sagte ich. »Warum redest du so schlecht über sie?«
Draußen vor der Tür wurde die Musik allmählich leiser. Ich hörte einzelne Worte einer Unterhaltung, konnte aber nicht verstehen, worum es ging.
Mutter seufzte und schloss die Finger fester um meine Hand. »Nicht schlecht, nur ehrlich. Ich möchte, dass du verstehst, welches Geschenk dieses Blut ist, das in dir fließt. Gäbe es deinen Vater nicht, würden wir im Dreck leben wie all die anderen, und ich hätte dich schon längst an einen Viertelhüfer oder Tagelöhner verheiraten müssen. Das hätte mir das Herz gebrochen.« Ihr Blick glitt über mein Gesicht wie eine zärtliche Berührung. »Sein Gold gibt dir Freiheit. Ich will, dass du sie nutzt.«
Ich wusste, dass sie recht hatte. Die Goldmünze, die uns jedes Jahr zu Weihnachten von einem Kurier überbracht wurde, ermöglichte uns ein sorgenfreies Leben. Lange hatte ich es nicht zu schätzen gewusst, doch je älter ich wurde, desto deutlicher erkannte ich die Unterschiede zwischen unserem und dem Leben der meisten anderen Dorfbewohner.
»Werde ich ihn je kennenlernen?«, fragte ich nicht zum ersten Mal.
Mutter schüttelte den Kopf und wandte den Blick ab. Sie kämpfte stets mit den Tränen, wenn sie von meinem Vater sprach. »Du weißt, dass ihm seine hohe Stellung nicht ermöglicht, dich anzuerkennen. Aber er liebt dich, sonst würde er uns nicht noch nach all den Jahren mit solcher Großzügigkeit unterstützen.«
Und du liebst ihn, dachte ich. Mutter hätte jeden im Dorf haben können, aber sie hatte sich geweigert, bis sie irgendwann niemand mehr umwarb. Ich war das einzige Mädchen im Dorf, das keine Geschwister hatte, und das einzige, das lesen konnte.
Bis heute glaube ich, dass Mutter dachte, eines Tages würde Wilbolt von Overstolzen, Bürgermeister der Stadt Coellen, zu ihr zurückkehren.
»Schon bald«, sagte sie nach einem Moment, als sich die Ochsenkarren draußen rumpelnd in Bewegung setzten, »wird dein Vater einen jungen Mann schicken, einen Krämer vielleicht oder sogar den Sohn eines Apothekers. Er wird um deine Hand anhalten und uns mitnehmen nach Coellen.« Sie tätschelte meine weiche Hand mit ihrer harten. »Bis dahin musst du rein bleiben und keusch sein, verstehst du?«
So oft hatte ich die Worte schon gehört, dass ich ohne nachzudenken nickte und antwortete, wie es von mir erwartet wurde: »Er wird auf einem Pferd reiten und Kleidung aus reinem Samt tragen, und alle werden ihn anstarren, wenn er vor unserer Hütte absteigt und mich fragt, ob ich Ketlin, Tochter von Magda sei. Und dann wird er sich vor mir verneigen und sagen, ich sei das hübscheste Mädchen, das er je gesehen habe.«
»Und das reinste«, fügte Mutter wie immer hinzu. Sie ließ meine Hand los und stand auf. Ihre Knie knackten. »Vergiss das nie.«
»Nein, Mutter.«
Sie ließ mich nicht mehr aus dem Haus an diesem Tag. Gegen Nachmittag kam Schwester Johannita, so wie jeden Mittwoch seit zwei Jahren. Sie war eine dicke, streng wirkende Frau, die nach Schweiß und Erde roch und eine saubere, vornehm wirkende Nonnentracht trug. Ihr Alter war unter der eng anliegenden Haube, die ihr Doppelkinn nach vorn schob und sie zum Nuscheln zwang, kaum zu erahnen, aber ich schätzte, dass sie älter als Mutter war. Ihre Haare hatte ich noch nie gesehen.
Wir hatten das Geld, das der Bürgermeister uns zukommen ließ, lange sparen müssen, um uns ihre Besuche leisten zu können. Bei Schwester Johannita lernte ich Lesen und Schreiben, Rechnen und vor allem Benehmen. Stundenlang stand sie mit einem Stock in der Hand hinter mir, während ich so tat, als säße ich bei einem hochherrschaftlichen Bankett, als müsse ich mit Adligen reden und wie eine Dame essen. Wenn ich einen Fehler machte, wenn ich mehr vom Teller nahm, als es sich geziemte, oder mich in von Johannita erfundene Unterhaltungen einmischte, die eine Dame nichts angingen, schlug sie mir mit dem Stock auf die Fingerknöchel. In der ersten Zeit hatte ich häufig blaue Flecke auf den Händen, doch irgendwann verstand ich, was von mir erwartet wurde. Wie ein Kätzchen musste ich essen und wie ein Kalb mit großen Augen schweigend lauschen.
Das Lesen bereitete mir größere Freude. Ich lernte zuerst Buchstaben, dann Worte, dann ganze Sätze. Sie setzten sich in meinem Kopf zu Bildern zusammen, wenn Schwester Johannita sie mit ein wenig Kreide auf dem Schieferstück niederschrieb, das wir einem Mann aus dem Steinbruch abgekauft hatten.
An diesem Nachmittag musste ich die Namen von Heiligen niederschreiben, die Schwester Johannita, wie immer hinter mir stehend, mit monotoner Stimme diktierte.
»Abachum. Anastasius. Gervanius …«
Ich schrieb und wartete auf den Stock.
»… Pankratius. Nikomedes. – Gut.«
Beinahe hätte ich das letzte Wort auch noch geschrieben, dann fiel mir auf, dass Schwester Johannita mich gelobt hatte. Das geschah so selten, dass ich nicht daran gewöhnt war.
»Du machst Fortschritte, Kind«, sagte sie. Ich hörte, wie sie mit dem Stock leicht in ihre Handfläche schlug. Es klang, als würde sie klatschen. »Wenn deine Mutter uns weitere Stunden pro Woche gewähren würde, könntest du dich bald mit den reichen Kaufmannsfrauen in Coellen messen.«
Aus den Augenwinkeln sah ich zu Mutter hinüber, die all unsere Stunden von der Küchenbank aus verfolgte. Ich selbst saß auf einem Hocker in der Mitte des Raums, das Schieferstück lag auf meinen Knien.
»Ich glaube nicht, dass wir uns das leisten könnten«, sagte ich, als sie der Nonne nicht antwortete.
Schwester Johannita ging um mich herum. Ihre Holzschuhe schlugen bei jedem Schritt hart auf den Boden. Sie hatte den Stock wie einen Dolch in das Seil gesteckt, das sich um ihren Bauch spannte. »Gott hat dir den Verstand geschenkt, das geschriebene Wort zu verstehen.« Sie setzte sich neben Mutter auf die Küchenbank, beugte sich beinahe verschwörerisch zu ihr herüber. »Ich kenne andere … Höhere … bei denen das nicht so ist. Wäre es nicht eine Sünde, einen solchen Verstand brachliegen zu lassen wie einen ungepflügten Acker?«
Mutter senkte den Kopf und betrachtete ihre Hände. Sie waren rot und rau, hatten noch nie ein Stück Kreide gehalten oder gar damit geschrieben.
»Wenn«, begann sie, »Ihr die Zeit finden könntet, auf Eurem Weg zwischen Burg und Kloster ab und zu hier vorbeizukommen und meine Tochter zu unterrichten, würde ich es Euch mit einer guten Mahlzeit und einem warmen Bett vergüten.«
Schwester Johannita stieß den Atem durch die Nase aus. Ich kannte dieses Geräusch nur zu gut. Sie machte es immer, wenn sie enttäuscht war, und einen Moment lang erwartete ich, sie würde ihren Stock aus dem Gürtel ziehen und Mutter auf die Fingerknöchel schlagen.
»Keinen weiteren Pfennig ist dir deine Tochter also wert«, sagte sie stattdessen. »Das hätte ich nicht gedacht.«
Mutter zuckte kurz zusammen. Ich sah ihr Zögern und ahnte, dass sie nachgeben würde, auch wenn wir es uns nicht leisten konnten. Selbst Bauer Josefs Söhne hatten nie lesen und schreiben gelernt.
»Aber wenn es eine Sünde ist, den Verstand, den Gott mir gegeben hat, brachliegen zu lassen«, sagte ich rasch, bevor sie antworten konnte, »warum unterrichtet Ihr mich nicht umsonst, Schwester?«
»Weil das, was nichts kostet, auch nichts taugt.« Ihre Antwort verwirrte mich. Ich öffnete den Mund, um nachzufragen, aber Johannita kam mir zuvor. Sie verschränkte die Arme über ihrem Bauch und sagte: »Ich bin jetzt bereit für mein Abendessen.«
Mutter stand so schnell auf wie eine Magd, die von ihrem Herrn beim Schlafen erwischt worden war. »Ich kümmere mich sofort darum.«
Es klang unterwürfig, aber ich hörte den Ärger in ihrer Stimme. Hätte sich Johannita nicht als Einzige bereiterklärt, die uneheliche Tochter einer unverheirateten Frau zu unterrichten, wäre Mutters Antwort wohl anders ausgefallen.
Ich stand auf, um ihr zu helfen. Schweigend senkten wir den Kessel an seiner Kette über das Feuer. Der Eintopf darin war voller Gemüse, Knochenmark und Fett. In anderen Hütten wäre das ein Weihnachtsmahl gewesen, aber als wir Schwester Johannita schließlich den dampfenden Holznapf vorsetzten, aß sie ihn ohne ein Wort des Dankes leer. Dann einen zweiten. Und einen dritten. Für Mutter und mich blieb kaum etwas übrig.
Wir warteten, bis sie fertig gegessen hatte und sich zum Beten ins hintere Zimmer zurückzog, bevor wir unsere eigenen Näpfe nahmen und die Reste aus dem Kessel kratzten. Mutter lächelte, als ich unter die Küchenbank griff und einen in Stoff eingeschlagenen halben Brotlaib hervorholte. Wir kannten Schwester Johannita lange genug, um zu wissen, dass man Essen vor ihr verstecken musste, wollte man nicht hungrig schlafen gehen.
»Ich brauche nicht noch mehr Unterricht«, sagte ich leise. Durch die geschlossene Tür hörte ich Schwester Johannita beten. Wenn die Tage kürzer wurden, übernachtete sie bei uns. Es war zu gefährlich, im Dunkeln zum Kloster zurückzukehren, und wir hatten genügend Platz. Unser Strohlager befand sich in dem Zimmer hinter der Küche, ebenso wie der Schrank, in dem wir unsere Kleidung und Wertsachen aufbewahrten. Wir und die Familie von Bauer Josef waren die einzigen Menschen im Dorf, die nicht ständig nach Rauch und Vieh stanken. Alle anderen teilten sich das einzige Zimmer ihrer Hütten mit den Ziegen, Schafen und Hühnern.
Mutter legte ihren Holzlöffel beiseite und starrte einen Moment ins Feuer des Kamins. Schatten tanzten über ihr Gesicht. Draußen war es längst dunkel und ruhig geworden.
»Es ist wichtig, dass du Benehmen lernst«, erwiderte sie ebenso leise. »Und rechnen, solltest du einen Krämer heiraten. Sie schätzen Frauen, die etwas mit dem Kopf, der auf ihren Schultern sitzt, anzufangen wissen.«
»Wenn mein zukünftiger Ehemann meinen Kopf so sehr schätzt, wird er Schwester Johannita schon bezahlen.«
Mutters Mundwinkel zuckten, aber sie lächelte nicht. »Geh jetzt schlafen«, sagte sie. »Das Feuer geht bald aus.«
Ich stand auf und faltete die beiden Wolldecken auseinander, die Mutter vor Johannitas Ankunft aus unserem Zimmer geholt hatte. Wenn die Nonne übernachtete, schliefen wir in der Küche, Mutter vor dem Kamin, ich auf der Bank unter dem Fenster. Das gehörte sich so, hatte Mutter mir erklärt.
Wir zogen die Schuhe aus, wuschen uns die Hände in dem Wassereimer, der neben dem Kamin stand, und legten uns hin. Das Feuer knackte, Holzscheite glühten rot in der Dunkelheit. Ich spürte die Wärme des Kamins auf meinem Gesicht, schloss die Augen und lauschte auf die Geräusche des Abends.
»Ketlin?«
Ich zuckte zusammen. Die Stimme kam von der anderen Seite des Vorhangs und klang so dumpf, dass ich sie erst erkannte, als sie meinen Namen wiederholte.
»Ketlin?«
»Else?«, flüsterte ich und setzte mich auf. Meine Kleidung raschelte, und die Wolldecke, die ich im Halbschlaf zur Seite gezogen haben musste, rutschte zu Boden. »Was machst du hier?«
»Ich will mir die Gaukler ansehen.« Else wusste, dass ich in der Küche schlief, wenn meine Lehrerin im Dorf war. Wir führten nicht zum ersten Mal eine Unterhaltung durch den geschlossenen Vorhang. »Kommst du mit?«
Ich drehte den Kopf. Mutter war nur ein unförmiger schwarzer Schatten vor dem roten Glühen des Kamins; sie bewegte sich nicht.
»Ich darf nicht«, flüsterte ich zurück.
»Aber sie haben gesagt, dass wir dabei sein dürfen, wenn sie ihre Lieder üben. Und es kostet auch nicht viel, nur etwas zu essen wollen sie. Einen Apfel oder so.«
Den du natürlich nicht hast, dachte ich.
»Komm doch mit.« Elses Stimme klang flehend. »Ich würde sie so gern sehen, aber allein traue ich mich nicht.«
Ich dachte an den Mann mit den seltsamen Tätowierungen im Gesicht, an die Instrumente und all die wundersamen Dinge, die sich bestimmt in den Kisten auf den Ochsenkarren befanden. Ein Teil von mir wusste, dass Else mich nur fragte, weil sie einen Apfel brauchte, doch dem anderen, weitaus größeren Teil war das egal.
»Warte«, flüsterte ich, während ich bereits nach meinen Schuhen griff und die Decke wie einen Umhang über mich legte. »Ich komme mit.«
Auf Zehenspitzen verließ ich unsere Hütte.
Kapitel 2
»Wo lagern denn die Gaukler?«, fragte ich. Wir hatten uns so weit von unserer Hütte entfernt, dass ich es wagte, normal zu reden. Die Nacht war klar, aber nicht so kalt, dass ich den Atem vor meinem Gesicht hätte sehen können. Meine Schürze hatte ich zusammengerafft. Ein halbes Dutzend Äpfel lagen darin. Sie stammten aus einem Fass in unserem Vorratsschuppen. Die Ernte war so gut ausgefallen, dass weder Mutter noch Knecht Michael den Verlust bemerken würden. Trotzdem hatte ich ein merkwürdiges Gefühl bei der ganzen Sache, das ich mir nicht ganz erklären konnte. Vielleicht war es die Furcht, erwischt zu werden, vielleicht aber auch das schlechte Gewissen.
»Auf der Allmende«, sagte Else. Sie war genauso alt wie ich, aber klein und mager wie ein Kind. Seit dem Sommer war sie mit dem Viertelhüfer Hans verheiratet, den alle wegen seines Buckels den krummen Hans nannten. Er war ein ruhiger, freundlicher Mann und für die Tochter eines Tagelöhners eine gute Partie.
»Weiß Hans, wo du bist?«, fragte ich. »Hat er nichts dagegen, dass du nachts zu den Gauklern gehst?«
Else war nicht das klügste Mädchen im Dorf. Es hätte mich nicht gewundert, wäre ihr dieser Gedanke noch gar nicht gekommen.
Sie winkte ab. »Er schläft tief und fest. Wenn er den ganzen Tag Holz gehackt hat, fällt er abends um, als hätte man ihn selbst gefällt.«
Die Allmende, die sich alle Bauern des Dorfs teilten, befand sich auf der anderen Seite des Dorfes, nicht weit entfernt von Bauer Josefs Haus. Der Boden taugte nur als Weide und lag im Winter, wenn das meiste Vieh geschlachtet worden war, brach. Wir gingen über die schmale, dunkle Straße zwischen schmalen, dunklen Hütten und lauschten in die Nacht hinein. Ich hörte nichts, keine Instrumente, keinen Gesang.
»Bist du sicher, dass sie uns eingeladen haben?«, fragte ich.
Else nickte, aber im Licht des Mondes wirkte ihr Blick verunsichert. Immer wieder sah sie sich um, als befürchte sie, beobachtet zu werden. Wir wussten, dass es sich für Mädchen und Frauen nicht schickte, allein unterwegs zu sein, schon gar nicht nach Einbruch der Dunkelheit.
»Vielleicht sollten wir zurückgehen«, sagte ich. »Was wir tun, kommt mir nicht richtig vor.«
»Nein.« Else berührte meinen Arm. Aufgeregt deutete sie nach vorn. »Guck doch mal, da hinten sind Feuer.«
Sie hatte recht; ich sah den rötlichen Schein über der Allmende ebenfalls.
Wäre Else nicht bei mir gewesen, hätte ich mich trotzdem zurück ins Haus geschlichen, aber sie zog mich am Ellenbogen weiter, redete von den Liedern, die wir gleich hören würden, und den Kunststücken, die man uns zeigen würde. Doch je näher wir der Allmende kamen, desto leiser wurde ihre Stimme, und als wir schließlich auf dem Weg standen, der an der Weide vorbeiführte, und auf die unförmigen Schatten der Ochsenkarren blickten, verstummte sie ganz.
Irgendwo stöhnte jemand. Wir blieben stehen.
»Und sie haben wirklich von heute Abend gesprochen?«, hakte ich nach.
Else ließ meinen Arm los. »Ich dachte schon, aber vielleicht meinten sie auch morgen.«
Das Stöhnen wurde lauter, dann sagte jemand mit rauer Stimme etwas, das ich nicht verstand, und das Stöhnen brach ab.
Mein Herz begann wieder laut zu klopfen. »Dann kommen wir wohl besser morgen wieder, oder?«
»Ja.« Else drehte sich so hektisch um, dass sie mir auf den Fuß trat.
Erschrocken stieß ich sie an. »Pass doch auf!«
»Wer ist da?«
Dieselbe raue Stimme wie zuvor. Ich hörte Zweige knacken und Geflüster, konnte jedoch nichts erkennen. Die Feuer brannten auf der anderen Seite der Karren. Doch ich sah, wie sich ein roter Schein von ihnen löste und näher kam. Einer der Gaukler musste ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer genommen haben und benutzte es als Fackel.
Ich wich zurück.
»Wer ist da?«, rief die Stimme erneut. Ich erkannte sie als die des Mannes mit den Tätowierungen.
»Komm«, flüsterte Else. Sie hatte sich geduckt, so als versuche sie, sich hinter dem knöchelhohen Gras zu verstecken. Ich drehte mich zu ihr um, aber die Stimme des Gauklers hielt mich zurück.
»Zeigt euch!«, rief sie. »Wir haben eine Hexe in unserer Truppe. Sie wird euch verfluchen, wenn ihr euch nicht zeigt!«
»Nein!«
Else und ich antworteten gleichzeitig. Wir hatten beide nicht vergessen, dass die alte Großmutter Gretchen von einem Schmied verflucht worden war, den sie nicht bezahlt hatte. Am Morgen darauf war sie aufgewacht und hatte nur noch die linke Hand bewegen können. Der Fluch des Schmieds hatte ihr alles genommen, sogar die Sprache. Nach diesem Morgen hatte sie nicht mehr lange gelebt. Wir wussten also, was Flüche ausrichten konnten.
Der Fackelschein bewegte sich an den Karren vorbei auf uns zu. Else ergriff meine Hand und hielt sie so fest, dass es schmerzte.
»Wer seid ihr?«, fragte der Gaukler. Mit langen Schritten ging er über die Wiese.
»Mein Name ist Ketlin«, sagte ich. Meine Stimme zitterte, was mich wie ein kleines Mädchen klingen ließ. »Und das ist Else. Wir stammen aus dem Dorf.«
Der Gaukler blieb vor uns stehen und streckte den Arm aus, in dem er die Fackel hielt. Die Wärme des Feuers strich über mein Gesicht.
»Ja, ich erkenne euch wieder.« Er senkte die Fackel und deutete eine Verbeugung an. »Der Auftritt deiner Mutter, Ketlin, hat meinen weit übertroffen. Dafür sollte ich dir eigentlich böse sein.«
»Ich hatte nicht die Absicht …«
Sein Lachen unterbrach mich. »Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht nachtragend. Kommt mit, wir freuen uns über jeden Gast.«
Ich zögerte und hielt Else an der Hand zurück, als sie losgehen wollte. »Sind wir die Einzigen, die eure Einladung angenommen haben?«
»Ja, so ist das manchmal eben, vor allem in kleinen Dörfern. Die Leute sind misstrauisch, wenn sie einen nicht kennen.« Der Gaukler zeigte mit seiner Fackel auf die Karren. »Wir haben ein warmes Feuer und dünnes, heißes Bier. Das teilen wir gern mit euch.«
»Und wir haben Äpfel.« Else griff mit ihrer freien Hand in meine Schürze. »Aber nicht viele.«
»Sechs Stück«, fügte ich hinzu.
»Was immer ihr geben könnt.« Der Gaukler ging ein paar Schritte voran, aber ich blieb stehen und mit mir auch Else.
Nach einem Moment drehte er sich zu uns um. Sein Blick glitt von Else zu mir, und seine Stimme wurde weicher. »Hast du Angst vor mir, Ketlin?«
»Nein, aber …« Etwas in seinem Blick zwang mich, die Wahrheit zu sagen. »Meine Mutter will, dass ich einen anständigen Mann heirate und meinen Ruf nicht ruiniere. Es gehört sich nicht für zwei Frauen, nachts an einem fremden Feuer zu sitzen.«
Ich hatte erwartet, dass er lachen würde, doch das tat er nicht. »Eine berechtigte Sorge.« Er kratzte sich am Kopf. »Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass deine Heiratspläne scheitern, obwohl niemand hier ist, der euch verraten würde. Und den Affen könnt ihr euch auch ein anderes Mal ansehen.«
Er wandte sich ab.
»Den was?«, fragte Else. Sie sah mich an, aber ich hob nur die Schultern. Ich wusste nicht, was das war.
»Den Affen«, sagte der Gaukler, ohne sich umzudrehen. Ich musste mich anstrengen, um ihn zu verstehen. »Das ist ein sündiger Mensch, den Gott mit Kleinwuchs, Dummheit und Fell gestraft hat. Ihn sich anzusehen, kostet einen Pfennig, aber da außer euch niemand hier ist, würde ich eine Ausnahme machen.« Er hatte die Karren fast erreicht. »Gute Nacht.«
Elses Blick traf den meinen.
»Warte«, sagte ich und folgte dem Gaukler hinter die Karren.
Er war winzig, nicht einmal so groß wie mein Unterarm lang. Ich saß neben Else auf der schmalen Kiste, die Richard – so hatte sich uns der Gaukler vorgestellt – ans Feuer gezogen hatte, und starrte den Affen an. Seine Augen waren dunkel und funkelten im Licht der Flammen. Er hatte ein grünliches langes Fell, das wie Laub wirkte, und ein haarloses Gesicht. Seinen Schwanz hatte er um Richards Hals gewickelt, in den kleinen Händen hielt er ein Stück Apfel. Während er daran nagte, sah er sich immer wieder um, als habe er Angst, jemand könnte es ihm wegnehmen.
»Und das war wirklich einmal ein Mensch?«, fragte ich.
Richard nickte. »Gottes Zorn kann furchtbar sein.«
»Wieso hat Gott ihm das angetan?« Else saß so dicht neben mir, dass ihre Hüfte gegen die meine drückte. Seit wir am Feuer der Gaukler saßen, wirkte sie verschüchtert und sagte kaum etwas.
Richard schnitt ein weiteres Stück des Apfels mit einem alten, schartigen Dolch ab. »Weil er ein schrecklicher alter Mann war, der sein Gold mit niemandem teilen wollte und die Bettler auf seiner Türschwelle verhungern ließ. Nun hat Gott ihm gezeigt, wie es ist, von der Gnade anderer abhängig zu sein.«
Else reichte mir den Holzbecher mit warmem Bier, den wir uns teilten, aber ich schüttelte den Kopf und streckte langsam die Hand nach dem Affen aus. »Er sieht so traurig aus.«
Richard öffnete den Mund, aber ein anderer Gaukler kam ihm zuvor. »Er ist nicht traurig, sondern verdammt wütend. Fass ihn an, und er beißt dir den Finger ab.«
Erschrocken zog ich die Hand zurück.
Richard schüttelte langsam den Kopf. Ich sah den Gaukler an, der mich vor dem Affen gewarnt hatte. Er hockte mit angezogenen Knien auf einer Kiste. Sein Kopf war groß wie der eines Erwachsenen, seine Arme und Beine kurz und pummelig wie die eines Kindes. Die anderen Gaukler nannten ihn »Kurzer«, ich wusste nicht, wie er wirklich hieß.
Neben ihm saß ein Junge, der etwas älter als ich sein musste. Er hielt eine Laute in der Hand, ohne darauf zu spielen. Ab und zu, wenn er glaubte, dass ich nicht hinsah, glitt sein Blick zu mir. Er hieß Matthias.
»Hör nicht auf den Kurzen«, sagte Richard. »Der Affe ist sein bester Freund, und darum will er nicht, dass du ihn anfasst.«
Eine Frauenstimme lachte schrill, ich verstand nicht, warum. Sie gehörte Maria, der einzigen Gauklerin, die bei uns saß. Es gab noch ein zweites Feuer neben einem der anderen Karren, doch von dort kam niemand zu uns.
»Richard hat recht«, sagte Maria. »Du kannst ihn ruhig streicheln.«
»Vielleicht später.« Ich legte die Hände in meine Schürze.
Else reichte mir erneut den Holzbecher. Dieses Mal trank ich daraus, schluckte das warme, bittere Bier schnell hinunter, damit sich der Geschmack nicht in meinem Mund ausbreiten konnte. Ich mochte kein Bier. Zuhause legte mir Mutter meist einen Viertel Apfel oder ein paar Kirschen hinein, aber ich wagte nicht, die Gaukler nach etwas Obst zu fragen. Es wäre sicherlich unhöflich gewesen, die gebrachten Geschenke direkt wieder einzufordern.
Es wurde still an unserem Feuer. Ich lauschte auf das Knacken des brennenden Holzes und überlegte, wie ich mich am höflichsten von den Gauklern verabschieden konnte. Auch Else war still; aus den Augenwinkeln sah ich, wie sie den Affen anstarrte, als glaubte sie, er würde sich jeden Moment in einen Menschen zurückverwandeln.
Ich verfluchte sie innerlich. Sie musste etwas missverstanden haben, denn wir waren zwar willkommen an diesem Feuer, aber nicht erwünscht. Die Gaukler wussten nicht, worüber sie mit uns reden sollten, und wahrscheinlich hatten sie Angst, dass jemand aus dem Dorf uns sah und glaubte, sie hätten uns verschleppt.
Ich bin so dumm, dachte ich. Warum bin ich nicht zu Hause geblieben?
Selbst der Affe mit seinen seltsam menschlichen Bewegungen konnte mich nicht von dem Gedanken ablenken, etwas falsch gemacht zu haben.
Vom anderen Feuer drang Gelächter zu uns herüber, dann eine betrunkene Männerstimme. Ich hob den Kopf, als ich sie erkannte, und drehte mich unwillkürlich nach ihr um.
Die Planen auf dem Karren neben dem zweiten Feuer bewegten sich. Ich hörte eine Frau lachen. Ein Mann kroch unter den Planen hervor und stieg ungeschickt über die Deichsel des Karrens. »Ich komme wieder«, rief er. Das Mondlicht spiegelte sich auf seinem kahlen Schädel. »Du kriegst schon noch, was du verdienst.«
Die Frau lachte erneut. »Gib es mir, wenn du kannst.«
Der Mann drehte sich um. Das Feuer erhellte sein Gesicht.
»Bauer Josef?« Else war so überrascht, dass sie beinahe schrie.
Der alte Bauer drehte sich taumelnd zu uns um. Sein Blick traf den meinen, bevor ich mich abwenden oder ducken konnte. Einen Moment blieb Josef stehen und starrte zu uns herüber, dann verschwand er zwischen den Karren in Richtung des Weges.
Mit gesenktem Kopf sprang ich auf und ergriff Elses Hand. »Wir müssen weg. Komm.«
Else sträubte sich. Sie hatte mehr Bier getrunken als ich und bewegte sich unsicher. »Aber ich will nicht.«
»Er hat uns gesehen! Weißt du, was das heißt?«
Nun stand auch Richard auf. Der Affe auf seiner Schulter quietschte wie eine Maus. »Du musst dir keine Sorgen machen, Ketlin, es wird nichts passieren.«
Ich ließ Else los und fuhr herum. »Euch vielleicht nicht, mir schon!« Mein Ärger war wie ein Windstoß, der durch eine plötzlich aufspringende Tür fuhr. Er traf Richard so unvorbereitet, dass er einen Schritt zurücktrat. »Ihr habt nichts zu verlieren, wenn man sich über euch den Mund zerreißt! Aber wenn Josef erzählt, dass er mich hier gesehen hat, werde ich in diesem Dorf verrotten, so wie Mutter es prophezeit hat!«
Ich holte tief Luft.
»Er wird nichts erzählen.« Richards Stimme klang beruhigend, als würde er auf ein verängstigtes Kalb einreden.
»Und warum nicht?« Ich schrie ihn an. Mutters Stimme tobte wütend durch meinen Kopf.
»Weil du ihn auch gesehen hast.«
Die Überzeugung, mit der er die Worte aussprach, brachte mich zum Schweigen.
»Oh«, sagte Else neben mir und begann zu kichern, aber ich verstand erst, wovon eigentlich die Rede war, als sie eine unanständige Geste machte. Die Gaukler lachten, der Affe kratzte sich. Ich wurde rot.
Mit einem Pfiff lud Richard die Gaukler am anderen Feuer zu uns ein. Ich nahm an, dass sie für Josefs Unterhaltung zuständig gewesen waren. Unter ihnen war auch eine junge Frau, die nach dem Bauern aus dem Karren geklettert war. Sie war hübsch und hatte langes braunes Haar, aber ich brachte es kaum über mich, sie anzusehen. Sie schien mein Unwohlsein zu bemerken, denn sie richtete kein einziges Wort an mich.
Die Stimmung änderte sich rasch, als sich die zweite Gruppe zu uns setzte. Matthias begann auf seiner Klampfe zu spielen, Else und ich sangen die Lieder mit, die wir kannten, und hörten bei denen zu, die uns fremd waren. Richard schien der Anführer der Gaukler zu sein, denn wenn er sprach, unterbrachen alle anderen ihre Unterhaltungen und lauschten seinen Worten. Er hatte eine tragende, laute Stimme, die er, wie er sagte, auf »den großen Bühnen dieser Welt« ausgebildet hatte. Als ich ihn bat, davon zu erzählen, verdrehten einige Gaukler zwar die Augen, hörten ihm aber trotzdem zu.
Seine Stimme war wie ein Schiff, das mich mit auf eine Reise nahm. Richard erzählte von den Orten, die er gesehen, und den seltsamen Wesen, die er getroffen hatte. Ich hörte Namen, die ich nur aus der Bibel kannte, Rom und Jerusalem, Kamel und Löwe. Er hatte mit Königen gespeist und mit Bettlern gerungen; sogar den Papst hatte er gesehen.
Irgendwann schlief Else ein, den Kopf an meine Schulter gelehnt, aber ich konnte nicht genug von den Geschichten bekommen, die zuerst Richard und später auch die anderen Gaukler erzählten. Vieles verstand ich nicht, anderes erschien mir geradezu schockierend. Doch das war egal, ich genoss die Reise und wollte keinen einzigen Augenblick verpassen.
Doch schließlich lehnte sich Richard mit dem Rücken gegen den Karren und sah mich an. Der Affe hatte sich auf seinen Oberschenkeln zusammengerollt und schlief. »Du weißt jetzt so viel über uns, aber wir wissen nichts über dich. Das ist unhöflich von uns, wir sollten auch dich zu Wort kommen lassen.«
Ich schüttelte den Kopf und senkte den Blick, als sich mir alle Gesichter zuwandten. Sogar der Affe erwachte und sah auf.
»Über mich gibt es nichts zu erzählen«, sagte ich. »In meinem ganzen Leben bin ich nie weiter als bis Coellen gekommen.«
»Coellen ist eine schöne Stadt.«
Es klang fast so, als wolle Richard mich trösten. Etwas in mir, das ich vorher nie wahrgenommen hatte, begehrte dagegen auf.
»Ja, sie ist schön.« Ich hob den Kopf und sah Richard in die Augen. »Und schon bald werde ich dort leben als Frau eines wohlhabenden Mannes.«
Richard schien meine Antwort zu überraschen. Er hob die Augenbrauen. »Es gibt viele Mädchen, die sich so etwas wünschen.«
»Aber ich habe etwas dafür getan. Ich nehme Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen, und ich weiß, wie man sich bei Tisch zu benehmen hat.«
»Dann steht der Krone ja nichts mehr im Weg«, murmelte Maria so leise, dass mir erst später, als ich in unserer Hütte lag und nicht einschlafen konnte, klar wurde, was sie gesagt hatte.
Richard brachte sie mit einem Blick zum Schweigen. »Unterrichtet dich jemand aus deiner Familie?«
»Nein, eine Nonne aus dem Zisterzienserkloster.«
Die anderen Gaukler lauschten unserer Unterhaltung. Matthias legte die Laute beiseite und griff nach dem Bierkrug, den die Asche des Feuers warm hielt. Ohne zu fragen, schüttete er mir nach.
»Das ist sicher sehr teuer«, sagte Richard.
Ich nickte, stolzer, als ich es hätte sein dürfen. Die Worte sprudelten aus mir heraus wie das Bier aus dem Krug. »Eine halbe Goldmünze kostet es im Jahr, und ich lerne schon seit zwei Jahren. Meine Mutter sagt immer, wer eine gute Ernte einbringen will, darf nicht am Saatgut sparen.«
»Deine Mutter ist eine kluge Frau.« Richard drehte den Holzbecher, aus dem er schon den ganzen Abend trank, nachdenklich zwischen den Händen. »Und was sagt dein Vater dazu?«
Ich öffnete den Mund. In meinen Gedanken stand die Antwort, die ich ihm geben wollte und die ihm das überlegene Lächeln aus dem Gesicht gewischt hätte, doch im letzten Moment schreckte ich vor ihr zurück und sagte stattdessen das, was Mutter mir eingebläut hatte. Das, was niemand glaubte. »Mein Vater ist tot, aber er hat uns ein wenig Land und ein kleines Vermögen hinterlassen.«
»Genügend Land und Vermögen, dass es euch leichtfällt, den Unterricht zu zahlen?« Der Schein des Feuers flackerte über Richards Gesicht.
Ich log nicht noch einmal. »Nein.«
»Wäre es dann nicht vernünftiger, das Gold für deine Mitgift zu sparen, damit nicht nur dein Bräutigam von deiner Schönheit und Anmut hingerissen ist, sondern auch sein Vater die Vorteile eurer Heirat zu schätzen weiß?«
Ich konnte seinen Ausführungen kaum noch folgen. Mein Kopf war so schwer, dass Worte ihn nicht mehr durchdringen wollten. Ich stellte den Becher mit dem warmen Bier ins Gras und fuhr mir mit den Händen übers Gesicht. Meine Finger waren kalt und vertrieben die Müdigkeit wenigstens für einen Moment.
»Wenn wir es sparen könnten, würden wir es tun«, sagte ich, ohne zu wissen, wie viel Zeit seit der Frage vergangen war.
»Aber ihr könnt.« Mit einer Handbewegung verscheuchte Richard den Affen von seinen Beinen und stand auf. »Ich sehe, dass du müde bist. Matthias und Maria werden euch nach Hause begleiten. Bis dahin nur so viel: Ich könnte dich unterrichten. Ich kann lesen, schreiben und beherrsche nicht nur das Rechnen, sondern die griechische Mathematik.« Er sah mich an. »Und ich spreche Latein, die Sprache der Könige …« Sein Lächeln warf kleine Falten um seine Augen und schob die Tätowierungen zusammen. »… und Königinnen.«
Maria begann zu kichern. Kurzer schlug ihr mit seiner dicken Kinderhand auf den Hintern und lachte. Ich nahm an, dass es sich um einen Witz handelte, den nur sie verstehen konnten, denn niemand fiel in ihr Gelächter ein. Die meisten anderen Gaukler waren ebenso wie Else längst eingeschlafen. Nur Richard, Maria und Kurzer waren noch wach.
Ich versuchte, über das nachzudenken, was Richard gesagt hatte, aber die Müdigkeit holte mich bereits wieder ein.
»Was verlangst du für deinen Unterricht?«, fragte ich.
»Darüber reden wir ein anderes Mal. Wir haben viel Zeit, um uns etwas zu überlegen. Im Winter kann man nur schlecht durchs Land ziehen.« Richard stieß den schlafenden Matthias mit der Spitze seines Lederstiefels an. »Steh auf und bring die Mädchen nach Hause«, sagte er.
Matthias zuckte zusammen und rieb sich den Schlaf aus den Augen, widersprach aber nicht. Gähnend stand er auf. Ich berührte Elses Wange. »Wir müssen nach Hause.«
Ich erhielt keine Antwort. Else hatte viel mehr Bier getrunken als ich; es war nicht nur die Müdigkeit, die ihr die Augen schloss. Ich versuchte es noch einmal, aber sie murmelte nur etwas Unverständliches und schmiegte sich wieder an meinen Arm.
»Ich mach das schon.« Maria stieß Kurzers Hand zur Seite und kam zu uns herüber. Mit einer Bewegung, die wirkte, als würde sie diese öfter ausführen, griff sie Else unter die Achselhöhlen und zog sie hoch. »Wir stützen sie. Wenn sie erst mal läuft, wird sie schon aufwachen.«
Und so war es.
Matthias und Maria mussten sie nur bis zum Weg stützen, dann war Else wach genug, um allein zu gehen, auch wenn sie dabei taumelte und immer wieder stolperte. Ich legte meine Wolldecke über den Kopf und schlang sie mir um den Körper. Ohne das schützende Feuer bemerkte ich erst, wie kalt die Nacht geworden war.
»Spricht Richard wirklich Latein?«, fragte ich.
Matthias hob die Schultern. »Wenn er es sagt, dann spricht er es.«
Wir verließen den Weg und gingen über einen kleinen Hof zu der Hütte von Else und dem krummen Hans. Sie war windschief und klein, schon zweimal hatten Herbststürme sie zerstört, aber Hans baute sie jedes Mal wieder auf, worauf sie jedes Mal schiefer und die Wände winddurchlässiger gewesen waren. Ich hörte das leise Gackern eines Huhns, dann das Meckern einer Ziege, als Else die zusammengehämmerten Bretter, die der Hütte als Tür dienten, an die Wand lehnte.
Drinnen war es dunkel. Der Geruch nach Vieh und kaltem Rauch schlug mir entgegen. Stroh raschelte, ein unförmiger Schatten, bei dem es sich nur um Hans handeln konnte, schmatzte im Schlaf.
Else drehte sich zu mir um. »Danke«, flüsterte sie. Im Mondlicht leuchteten ihre Zähne weiß. »Danke.«
Dieses eine Wort galt nicht nur unserem heimlichen Ausflug, sondern auch dem, was sie erlebt und gesehen hatte und ihrer sicheren Rückkehr. Das alles würde unser Geheimnis bleiben. Sie konnte es Hans nicht erzählen und ich nicht meiner Mutter.
Sie verschwand in der Hütte, und ich stellte die Bretter wieder vor den Eingang, um sie zu verschließen, dann verabschiedete ich mich von Matthias und Maria, schlich heim und versuchte zu schlafen.
Die Gedanken tanzten in meinem Kopf, kreisten um all die Dinge, die Richard gesagt hatte. Ich fragte mich, was ich ihm anbieten konnte, damit er mir Latein beibrachte und mich von Schwester Johannita mit ihrem Stock befreite.
Gegen Morgen, als der erste Hahn krähte, fiel mir die Antwort ein.
Kapitel 3
Schwester Johannita verließ uns früh, nahm sich aber wie immer genügend Zeit, um unsere Milchsuppe zu essen und mit uns ein kurzes Gebet zu sprechen. Sie wirkte immer noch verstimmt, als sie sich von uns verabschiedete, ihren Wanderstab nahm und mit langsamen Schritten das Dorf verließ.
Wir verbrachten den Vormittag in der Stube. Mutter zog die Kräuter, die sie am Vortag gesammelt hatte, mit einer Schnur auf, ich hängte sie an den Dachbalken. Es waren Gewürze darunter, Petersilie und Rosmarin, aber auch Heilkräuter wie Schafgarbe und Eisenhut und solche, die keinen Namen hatten und die ich nur an ihrem Aussehen erkannte.
Ab und zu hörte ich Stimmen im Dorf, Kinderlachen und fröhlich klingende Glocken. Durch einen Spalt zwischen den Vorhängen sah ich den Kurzen und Matthias, wenig später Maria und einen jungen Gaukler namens Friedrich. Ihre Auftritte waren nicht so beeindruckend wie am Vortag. Sie jonglierten ein wenig mit Wollknäueln und Messern, gelegentlich hörte ich ein Lied. Ich nahm an, dass Richard sie geschickt hatte, um den Leuten im Dorf das Misstrauen zu nehmen. Sie klopften an Türen, sangen für die, die öffneten, und erklärten, wer sie waren. Nur an unsere Tür klopfte niemand.
»Willst du nicht rausgehen und ihnen zusehen?«, fragte Mutter, als Matthias ein Lied anstimmte. Es war eine dieser Fragen, die einer vorsichtigen Antwort bedurften.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Ich habe mir deine Worte zu Herzen genommen. Meine Zukunft ist wichtiger als mein Vergnügen.«
Mutter sah von ihrer Arbeit auf, musterte mich einen Moment und senkte dann den Blick wieder. »Du siehst müde aus«, sagte sie, ohne auf meine Antwort einzugehen. »Iss etwas von dem Bitterkraut links von dir, und wenn es dir zu viel wird, ein wenig Petersilie.«
»Ja, Mutter.«
Das Bitterkraut trug seinen Namen zu Recht. Es zog mir den Mund zusammen, bis ich glaubte, nicht mehr schlucken zu können, doch die Petersilie half nach nur zwei Bissen.
»Es geht dir gleich besser.« Mutter reichte mir eine Schnur voller grüner Pflanzen. Das ganze Zimmer roch nach Minze. »Hast du schlecht geschlafen?«
»Ja. Schwester Johannitas Schnarchen hat mich wach gehalten.« Ich log nicht gern, und doch schien ich an diesem Tag nichts anderes zu tun.
Mutter lächelte. Sie war in einer guten, entspannten Stimmung. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und knotete ein Ende der Schnur um einen Dachbalken. Dabei beobachtete ich sie aus den Augenwinkeln und fragte mich, ob ich riskieren sollte, die Sache mit meiner Mitgift zur Sprache zu bringen.
»Was Schwester Johannita betrifft …«, begann ich, aber ein leises Klopfen an der Tür unterbrach mich.
Mutter stand auf. »Wenn das ein Gaukler ist, gehst du sofort nach hinten«, sagte sie. Dann zog sie die Tür auf.
»Gott zum Gruß«, sagte Richard.
Ich ließ die Schnur los, und sie baumelte vor meinem Gesicht.
»Ketlin«, sagte Mutter, ohne ihm zu antworten.
Ich senkte den Blick und ging ins Nebenzimmer. Der Geruch nach Minze und Lavendel folgte mir, als ich die Tür schloss. Nervös legte ich das Ohr ans Holz und lauschte. Hatte ich Richard gesagt, dass ich heimlich auf die Allmende gekommen war, genau wie Else? Ich wusste es nicht mehr.
Das Holz der Tür war so dick, dass ich die Stimmen zwar hören, aber die Worte nicht verstehen konnte. Zuerst sagte Mutter etwas, sehr kurz, aber es klang ärgerlich, dann sprach Richard, länger und ruhiger. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, wartete darauf, dass die Tür aufgerissen wurde und Mutter mich schreiend und weinend in die Stube zerrte, doch die Stimmen redeten weiter, wurden ruhiger und leiser.
Nach einer Weile begann mein Ohr zu schmerzen. Ich trat ein paar Schritte zurück und setzte mich auf unser Lager. Die Matratze bestand aus einem mit Stroh gefüllten Sack, und auf dem lagen ein dünnes Leinentuch und einige Decken.
Ich legte mich darauf und wartete. Der Raum roch immer noch nach Schwester Johannita. Es gab nur ein winziges Fenster, mehr einen Spalt in der Rückwand, den ein Vorhang verdeckte. Im Sommer zogen wir den Vorhang auf, damit die Sonne uns wecken konnte, im Winter war es meistens Mutter, die vor mir aufwachte und mich vom Lager trieb.
Ich fragte mich, worüber sie und Richard im Nebenraum sprachen. Dass sie sich etwas zu sagen hatten, was länger als ein paar Sätze in Anspruch nahm, war kaum vorstellbar.
Und doch dauerte das Gespräch an. Die Stimmen wechselten sich ab, ich hatte nicht den Eindruck, dass einer auf den anderen einredete. Nur zu gern hätte ich ihnen zugehört, aber ich wagte es nicht, mich Mutters Befehl zu widersetzen.
Irgendwann schloss ich die Augen. Ich dachte, das Bitterkraut würde mich daran hindern einzuschlafen, doch als ich die Augen wieder öffnete, war es still im Nebenzimmer und so dunkel, dass sich die braune Holztruhe, in der wir unsere Kleidung und meine spärliche Mitgift aufbewahrten, kaum noch von der Lehmwand abhob.
Ich stand auf und ging zur Tür. Einen Moment lauschte ich, und als ich nichts hörte, öffnete ich sie. Mutter saß am Küchentisch und zog Kräuter auf eine Schnur. Außer ihr und mir war die Stube leer.
»Ich habe dich schlafen lassen.«
»Danke.« Ich setzte mich neben sie auf die Küchenbank und nahm mir eine Schnur. Die, die ich losgelassen hatte, als Richard im Türrahmen stand, hing immer noch von einem der Dachbalken. »Was wollte er?«, fragte ich.
»Wer?«
»Ri… der Gaukler an der Tür.« Ich hasste es, wenn Mutter so tat, als wisse sie nicht, wovon ich sprach, obwohl es offensichtlich war.
»Nichts Besonderes.« Sie schwieg und zupfte braune Stellen aus einem Strang Petersilie. Jahrelang hatte sie dieses Spiel mit mir gespielt. Ich wollte etwas wissen, sie verweigerte mir die Antwort, und ich musste betteln, bis sie schließlich nachgab. Doch in den letzten Monaten hatte ich damit aufgehört. Wenn sie es mir nicht sagen wollte, sollte sie es eben für sich behalten. Irgendwie würde ich es schon herausbekommen.