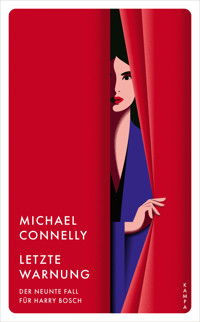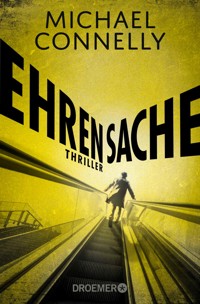12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Harry Bosch
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eigentlich sieht alles nach einem natürlichen Tod aus. Dennoch bittet die Witwe des Ex-Polizisten Terry McCaleb Harry Bosch, Nachforschungen anzustellen. Die Hinweise führen Bosch nach Nevada, wo er auf FBI-Agentin Rachel Walling trifft. Eine Nachricht des seit Jahren tot geglaubten »Poeten«, einem Serienmörder, der Gedichtzeilen von Edgar Allan Poe an den Tatorten hinterließ, hat sie hierher verschlagen, zu einem Massengrab in der Mojave-Wüste gleich hinter der kalifornischen Grenze. Die beiden Außenseiter tun sich zusammen: Walling, die beim FBI in Ungnade gefallen ist, nachdem sie den Poeten zwar angeschossen hat, er aber entkommen konnte, und Bosch, der als Privatdetektiv ermittelt, dem ohne Dienstmarke aber mitunter die Hände gebunden sind. Beide Ermittler glauben, dem hochintelligenten Serienkiller dicht auf den Fersen zu sein. Aber für den Poeten gelten nur seine eigenen Regeln, und er hat noch eine Rechnung mit Walling offen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Ähnliche
Michael Connelly
Die Rückkehr des Poeten
Der zehnte Fall für Harry Bosch
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Zum Gedenken an Mary McEvoy Connelly Lavelle,
die verhinderte, dass sechs von uns ins Engstellen gerieten
Sie haben nur ein Ungeheuer gegen ein anderes ausgetauscht. Statt eines Drachen haben sie in den Narrows jetzt eine Schlange. Eine riesige Schlange, die in dieser Engstelle schläft und auf den richtigen Moment wartet, um ihr Maul aufzusperren und jemanden zu verschlingen.
John Kinsey, Vater eines in den Narrows umgekommenen Jungen,
Los Angeles Times, 21. Juli 1956
Vielleicht weiß ich auf dieser Welt nur eines. Nur eines mit Sicherheit. Und das ist, dass einen die Wahrheit nicht frei macht. Nicht, wie ich es von anderen gehört und selbst unzählige Male gesagt habe, als ich in kleinen Zimmern und Gefängniszellen saß und abgerissene Männer drängte, mir ihre Sünden zu beichten. Ich habe sie belogen und betrogen. Die Wahrheit rettet einen nicht und macht einen auch nicht wieder heil. Sie gestattet einem nicht, sich über die Last der Lügen und Geheimnisse und Herzenswunden zu erheben. Die Wahrheiten, die ich erfahren habe, halten mich nieder wie Ketten in einem dunklen Zimmer, einer Unterwelt voller Gespenster und Opfer, die sich wie Schlangen um mich winden. Es ist ein Ort, wo die Wahrheit nichts ist, was man ansieht oder betrachtet. Es ist der Ort, wo das Böse lauert. Wo es einem seinen Atem, jeden Atemzug, in Mund und Nase bläst, bis man ihm nicht mehr entkommen kann. Das ist, was ich weiß. Das Einzige.
Das wusste ich, als ich an dem Tag losfuhr, an dem ich den Fall übernahm, der mich in die Narrows führen sollte. Ich wusste, dass mich meine Mission im Leben immer an die Orte führen würde, wo das Böse wartet, an die Orte, wo die Wahrheit, die ich finden würde, etwas Hässliches und Schreckliches sein würde. Und trotzdem zog ich ohne Zögern los. Ich zog los, obwohl ich nicht auf den Moment gefasst war, in dem das Böse aus seinem Versteck kommen würde. In dem es mich wie ein Tier packen und in das schwarze Wasser hinabziehen würde.
1
Sie befand sich in völliger Dunkelheit, trieb auf einem schwarzen Meer, über sich einen sternenlosen Himmel. Sie konnte nichts hören und nichts sehen. Es war ein vollkommener schwarzer Moment, doch dann schlug Rachel Walling die Augen auf.
Sie blickte an die Decke. Sie lauschte dem Wind im Freien und hörte die Azaleenzweige über das Fenster scharren. Sie fragte sich, ob es das Kratzen auf dem Glas oder ein anderes Geräusch aus dem Haus gewesen war, das sie geweckt hatte. Dann läutete ihr Handy. Sie erschrak nicht. Ruhig streckte sie die Hand nach dem Nachttisch aus. Sie hielt das Telefon an ihr Ohr und war hellwach, als sie sich meldete. Ihrer Stimme war nicht anzuhören, dass sie geschlafen hatte.
»Agent Walling«, sagte sie.
»Rachel? Hier Cherie Dei.«
Rachel war sofort klar, dass das kein Reservat-Anruf wäre. Cherie Dei bedeutete Quantico. Das letzte Mal lag vier Jahre zurück. Rachel hatte gewartet.
»Wo sind Sie gerade, Rachel?«
»Zu Hause. Wo sollte ich sonst sein?«
»Ich weiß, dass Sie inzwischen für ein großes Gebiet zuständig sind. Ich dachte, vielleicht sind Sie …«
»Ich bin in Rapid City, Cherie. Was gibt’s?«
Sie antwortete erst nach einem längeren Schweigen.
»Er ist wieder aufgetaucht. Er ist zurück.«
Rachel spürte, wie eine unsichtbare Faust gegen ihre Brust schlug und dann dort verharrte. Ihr Verstand beschwor Erinnerungen und Bilder herauf. Schlechte. Sie schloss die Augen. Cherie Dei brauchte keinen Namen zu nennen. Rachel wusste, es war Backus. Der Poet war wieder aufgetaucht. Was sie sich schon die ganze Zeit gedacht hatten. Wie eine virulente Infektion, die sich, von außen nicht erkennbar, jahrelang im Körper ausbreitet und dann zur Erinnerung an ihre Hässlichkeit durch die Haut bricht.
»Erzählen Sie schon.«
»Vor drei Tagen haben wir in Quantico etwas bekommen. Ein Postpäckchen. Es enthielt …«
»Vor drei Tagen? Sie haben da drei Tage drauf gesessen?«
»Gesessen haben wir auf gar nichts. Wir haben uns damit Zeit gelassen. Es war an Sie adressiert. An Behavioral Sciences. Sie haben es uns von der Poststelle runtergebracht, und wir haben es geröntgt und dann geöffnet. Vorsichtig.«
»Was war drin?«
»Ein GPS-Gerät.«
Ein Ortungsgerät. Längen- und Breitengrade. Rachel hatte im vergangenen Jahr bei Ermittlungen mit einem solchen Teil zu tun gehabt. Eine Entführung draußen in den Badlands, wo eine vermisste Camperin ihre Spur mit einem tragbaren GPS markiert hatte. Sie fanden das Gerät in ihrem Rucksack und verfolgten ihren Weg zu einem Campingplatz zurück, auf dem sie einem Mann begegnet war, der ihr dann von dort gefolgt war. Sie kamen zwar zu spät, um sie noch retten zu können, aber ohne das GPS hätten sie die Stelle überhaupt nicht gefunden.
»Was war drauf?«
Rachel setzte sich auf und schwang die Beine über die Bettkante. Sie führte ihre freie Hand an ihren Bauch und schloss sie wie eine verwelkte Blume. Sie wartete, und bald fuhr Cherie Dei fort. Rachel erinnerte sich, wie grün Cherie einmal gewesen war; sie war ihr im Zug des FBI-Tutorenprogramms zugeteilt worden und bei den Einsätzen lediglich zu Lern- und Beobachtungszwecken dabei gewesen. Inzwischen waren zehn Jahre vergangen, und die Fälle, die ganzen Fälle, hatten tiefe Furchen in ihre Stimme gegraben. Cherie Dei war nicht mehr grün und brauchte keinen Tutor.
»Es war ein einziger Wegpunkt drauf gespeichert. In der Mojave-Wüste. Gleich hinter der kalifornischen Grenze in Nevada. Wir sind gestern hingeflogen und zu der Stelle gefahren. Wir haben Wärmebildtechnik und Gassonden eingesetzt. Gestern Abend haben wir die erste Leiche gefunden, Rachel.«
»Wer ist es?«
»Das wissen wir noch nicht. Sie ist alt. Lag schon lange dort. Wir sind noch ganz am Anfang. Die Ausgrabungsarbeiten gehen langsam voran.«
»Sie sagten, die erste Leiche. Wie viele sind noch dort?«
»Als ich gestern von der Fundstelle wegfuhr, waren es vier. Wir glauben, es sind noch mehr.«
»Todesursache?«
»Dafür ist es noch zu früh.«
Rachel schwieg und dachte nach. Die ersten Fragen, die durch ihre Filter liefen, waren: Warum dort und warum jetzt?
»Rachel, ich rufe nicht bloß an, um Ihnen Bescheid zu sagen. Die Sache ist die: Der Poet ist wieder aktiv, und wir möchten, dass Sie herkommen.«
Rachel nickte. Das verstand sich von selbst.
»Cherie?«
»Ja?«
»Warum glauben Sie, dass er es war, der das Päckchen geschickt hat?«
»Das glauben wir nicht. Das wissen wir. Vor Kurzem haben wir auf dem GPS einen übereinstimmenden Fingerabdruck gefunden. Er hat die Batterien gewechselt, und auf einer war ein Daumenabdruck. Robert Backus. Er ist es. Er ist zurück.«
Rachel öffnete langsam ihre Faust und betrachtete ihre Hand. Sie war so reglos wie die einer Statue. Das Entsetzen, das sie eben noch empfunden hatte, änderte sich jetzt. Sich selbst konnte sie es eingestehen, aber sonst niemandem. Sie spürte, wie der Saft wieder in ihrem Blut zu kursieren begann und es zu einem dunkleren Rot färbte. Fast schwarz. Sie hatte auf diesen Anruf gewartet. Sie schlief jede Nacht mit dem Handy am Ohr. Ja, das gehörte zu ihrem Job. Die Rufbereitschaft. Aber das war der einzige Anruf, auf den sie wirklich gewartet hatte.
»Man kann den Wegpunkten Namen geben«, sagte Dei in die Stille hinein. »Auf dem GPS. Bis zu zwölf Zeichen und Leerstellen. Er hat diese Stelle ›Hallo Rachel‹ genannt. Geht genau auf. Wahrscheinlich hat er immer noch was für Sie übrig. Es ist, als wollte er, dass Sie da rauskommen, als hätte er irgendwas ganz Bestimmtes im Sinn.«
Rachels Gedächtnis förderte das Bild eines Mannes zutage, der rücklings durch eine Glasscheibe und in tiefe Dunkelheit stürzte. In der dunklen Leere darunter verschwand.
»Bin schon unterwegs«, sagte sie.
»Wir operieren von der Außenstelle Las Vegas aus. Dort ist es einfacher, die Sache unter Verschluss zu halten. Seien Sie bitte vorsichtig, Rachel. Wir wissen nicht, was er dabei im Schilde führt. Passen Sie also auf.«
»Mache ich. Mache ich immer.«
»Geben Sie mir Ihre Ankunftszeit durch, und ich hole Sie ab.«
»Mache ich«, wiederholte sie.
Dann drückte sie auf die Taste, die die Verbindung unterbrach. Sie streckte die Hand nach dem Nachttisch aus und machte das Licht an. Einen Augenblick lang erinnerte sie sich an den Traum, an die Stille des schwarzen Wassers und des Himmels darüber, wie schwarze Spiegel, die sich gegenüberlagen. Und sie dazwischen, einfach nur schwebend.
2
Graciela McCaleb wartete vor meinem Haus in Los Angeles neben ihrem Auto, als ich dort ankam. Sie war pünktlich zu unserer Verabredung erschienen, ich nicht. Ich fuhr rasch in den Carport und stieg aus, um sie zu begrüßen. Sie schien nicht sauer auf mich zu sein. Sie schien es gelassen zu nehmen.
»Graciela, es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich wurde im Morgenverkehr auf dem Zehner aufgehalten.«
»Das macht doch nichts. Es war eigentlich richtig schön. Es ist so ruhig hier oben.«
Ich schloss die Haustür auf und versuchte, sie aufzudrücken, aber die Post, die dahinter auf dem Boden lag, verfing sich darunter. Ich musste mich bücken und um die Tür herumlangen, um die Umschläge herauszuziehen und die Tür öffnen zu können.
Nachdem ich mich aufgerichtet und zu Graciela herumgedreht hatte, zeigte ich mit dem Arm ins Haus. Sie ging an mir vorbei und trat ein. Aufgrund der Umstände lächelte ich nicht. Das letzte Mal hatte ich Graciela bei der Trauerfeier gesehen. Diesmal sah sie nur unwesentlich besser aus. In ihren Augen und Mundwinkeln hielt sich der Kummer noch immer.
Als sie in der engen Diele an mir vorbeiging, roch ich einen süßen Orangenduft. Ich konnte mich von der Trauerfeier an ihn erinnern, als ich ihre Hände mit den meinen umfasst, ihr mein Beileid ausgedrückt und ihr meine Hilfe angeboten hatte, falls sie welche benötigte. Damals hatte sie Schwarz getragen. Diesmal trug sie ein geblümtes Sommerkleid, das besser zu dem Duft passte. Ich führte sie ins Wohnzimmer und bat sie, auf der Couch Platz zu nehmen. Ich fragte sie, ob sie etwas zu trinken wolle, obwohl ich außer ein paar Flaschen Bier im Kühlschrank und Wasser aus der Leitung nichts im Haus hatte, was ich ihr hätte anbieten können.
»Nein danke, Mr. Bosch. Nicht nötig.«
»Sagen Sie bitte Harry zu mir. Kein Mensch nennt mich Mr. Bosch.«
Jetzt versuchte ich es mit einem Lächeln, aber es funktionierte nicht bei ihr. Und ich wusste auch nicht, wie ich darauf kam, dass es funktionieren könnte. Sie hatte schon einiges durchgemacht. Ich hatte den Film gesehen. Und jetzt diese Tragödie. Ich setzte mich in den Sessel gegenüber der Couch und wartete. Sie räusperte sich, bevor sie zu sprechen begann.
»Wahrscheinlich fragen Sie sich, warum ich unbedingt persönlich mit Ihnen sprechen wollte. Ich war am Telefon nicht sehr mitteilsam.«
»Das macht doch nichts«, sagte ich. »Allerdings hat es mich neugierig gemacht. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Kann ich etwas für Sie tun?«
Sie nickte und blickte auf ihre Hände hinab, mit denen sie eine kleine, mit schwarzen Perlen besetzte Handtasche in ihrem Schoß hielt. Sie sah so aus, als hätte sie sie für die Trauerfeier gekauft.
»Etwas ist ganz und gar nicht in Ordnung, und ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Von Terry weiß ich zumindest so viel – über ihr Vorgehen, meine ich –, dass ich weiß, ich kann nicht zur Polizei gehen. Noch nicht, jedenfalls. Außerdem werden sie sowieso zu mir kommen. Wahrscheinlich schon bald. Aber bis dahin brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann und der mir helfen wird. Ich kann Sie bezahlen.«
Ich beugte mich vor, stützte die Ellbogen auf die Knie und legte meine Hände aneinander. Ich war ihr nur dieses eine Mal begegnet – bei der Trauerfeier. Ihr Mann und ich hatten uns einmal nahegestanden, aber nicht in den letzten paar Jahren, und jetzt war es zu spät. Ich wusste nicht, woher das Vertrauen kam, von dem sie sprach.
»Was hat Ihnen Terry über mich erzählt, dass Sie mir solches Vertrauen entgegenbringen? Dass Sie sich für mich entschieden haben. Sie und ich, wir kennen uns doch kaum, Graciela.«
Sie nickte, als sei dies eine berechtigte Frage und Meinung.
»In einer bestimmten Phase unserer Ehe hat mir Terry alles über die ganze Geschichte erzählt. Er hat mir von dem letzten Fall erzählt, an dem Sie beide gemeinsam gearbeitet haben. Er hat mir erzählt, was passiert ist und wie Sie sich gegenseitig das Leben gerettet haben. Auf dem Boot. Und deshalb glaube ich, Ihnen vertrauen zu können.«
Ich nickte.
»Einmal hat er mir etwas über Sie erzählt, was ich nie vergessen werde«, fügte sie hinzu. »Er sagte, es gäbe Züge an Ihnen, die er nicht mochte und die er nicht guthieß. Damit meinte er, glaube ich, die Art, wie Sie die Dinge anpacken. Aber alles in allem, sagte er, wenn er sich die ganzen Cops und Agenten so ansähe, die er kannte und mit denen er zusammengearbeitet hatte, alles in allem würde er am liebsten mit Ihnen zusammenarbeiten, wenn er sich jemanden aussuchen könnte, um in einem Mordfall zu ermitteln. Ohne nachzudenken. Er meinte, er würde sich für Sie entscheiden, weil Sie nie aufgeben.«
Ich spürte, wie sich mein Gesicht um die Augen herum zusammenzog. Es war fast so, als könnte ich es Terry McCaleb sagen hören. Ich stellte eine Frage, obwohl ich die Antwort bereits wusste.
»Was soll ich nun für Sie tun?«
»Ich möchte, dass Sie seinen Tod untersuchen.«
3
Obwohl ich wusste, dass sie das sagen würde, verschlug mir Graciela McCalebs Bitte die Sprache. Terry McCaleb war einen Monat zuvor auf seinem Boot gestorben. Ich hatte es in der Las Vegas Sun gelesen. Es war wegen des Films in die Zeitung gekommen: »FBI-Agent jagt nach Herztransplantation den Mörder seiner Spenderin«. Es war eine Geschichte ganz nach dem Geschmack von Hollywood, und die Rolle spielte Clint Eastwood, obwohl er zwei Jahrzehnte mehr auf dem Buckel hatte als Terry. Der Film wurde bestenfalls ein bescheidener Erfolg, aber er verhalf Terry trotzdem zu dem Maß an Berühmtheit, das einen Nachruf in den Zeitungen des Landes zur Folge hatte. Ich war eines Morgens in meine Wohnung in der Nähe des Strip zurückgekommen und hatte die Sun durchgeblättert. Terrys Tod war eine Kurzmeldung am Ende des ersten Teils.
Ein heftiges Zittern durchlief mich, als ich sie las. Ich war überrascht, aber auch nicht so überrascht. Terrys Leben hatte schon immer auf gestundeter Zeit beruht. Aber nichts von dem, was ich gelesen oder auf der Trauerfeier in Catalina gehört hatte, war mir verdächtig vorgekommen. Es war sein Herz – sein neues Herz – gewesen, das versagt hatte. Es hatte ihm sechs gute Jahre geschenkt, mehr als der Durchschnitt bei einem Patienten mit einem neuen Herz, aber dann war es den gleichen Faktoren erlegen, die dem Original den Garaus gemacht hatten.
»Das verstehe ich nicht«, sagte ich zu Graciela. »Er war auf dem Boot, eine Chartertour, und er brach zusammen. Sein Herz … hieß es.«
»Ja, es war sein Herz«, sagte sie. »Aber inzwischen hat sich etwas Neues ergeben. Ich hätte gern, dass Sie sich der Sache annehmen. Ich weiß, Sie sind nicht mehr bei der Polizei, aber letztes Jahr haben Terry und ich in den Nachrichten gesehen, was hier passiert ist.«
Sie ließ ihren Blick durch das Zimmer wandern und machte eine entsprechende Handbewegung. Sie spielte auf das an, was ein Jahr zuvor in meinem Haus passiert war, als die ersten Ermittlungen nach meiner Pensionierung ein so schlimmes und blutiges Ende genommen hatten.
»Ich weiß, dass Sie immer noch Ermittlungen anstellen«, sagte sie. »Sie sind wie Terry. Er konnte es auch nicht lassen. Manche von Ihnen sind so. Als wir in den Nachrichten sahen, was hier passiert war, sagte Terry übrigens, er würde Sie nehmen, wenn er sich jemanden aussuchen könnte. Damit wollte er mir vermutlich sagen, dass ich mich an Sie wenden sollte, wenn ihm etwas zustoßen sollte.«
Ich nickte und blickte zu Boden.
»Sagen Sie mir, was sich Neues ergeben hat, und ich werde Ihnen sagen, was ich tun kann.«
»Sie fühlen sich ihm doch verpflichtet, oder?«
Ich nickte wieder.
»Sagen Sie es mir.«
Sie räusperte sich. Sie rutschte an den Rand der Couch und begann zu erzählen.
»Ich bin Krankenschwester. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, aber im Film haben sie eine Bedienung aus mir gemacht. Das stimmt nicht. Ich bin Krankenschwester. Ich habe also Ahnung von Medizin. Ich kenne mich mit Krankenhäusern aus, mit dem ganzen Drumherum.«
Ich nickte und sagte nichts, um sie nicht aufzuhalten.
»Sie haben Terry in der Gerichtsmedizin obduziert. Es gab zwar keinerlei Hinweise, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte, aber auf Bitte Dr. Hansens – Terrys Kardiologe – haben sie doch eine Obduktion vorgenommen, weil er wissen wollte, ob sie vielleicht feststellen könnten, woran es gelegen hatte.«
»Und?«, sagte ich. »Was haben sie gefunden?«
»Nichts. Ich meine, nichts Strafbares. Das Herz hörte einfach zu schlagen auf … und er starb. So was soll vorkommen. Bei der Autopsie zeigte sich, dass sich die Muskeln der Herzwände zusammenzogen, dass sie enger wurden. Myokardiopathie. Der Körper stieß das Herz ab. Sie machten die üblichen Blutuntersuchungen, und damit hatte es sich. Dann haben sie ihn mir überstellt. Seine Leiche, meine ich. Terry wollte nicht begraben werden – das hat er immer wieder gesagt. Deshalb ließ ich ihn bei Griffin und Reeves einäschern, und nach der Trauerfeier fuhr Buddy mit den Kindern und mir mit dem Boot raus, und wir taten, worum Terry uns gebeten hatte. Wir nahmen Abschied von ihm, streuten seine Asche ins Meer. Es war sehr intim. Es war schön.«
»Wer ist Buddy?«
»Ach so, das ist der Mann, mit dem Terry in der Charterfirma zusammenarbeitete. Sein Partner.«
»Ach ja, richtig. Ich erinnere mich.«
Ich nickte und ging ihre Geschichte noch einmal durch, um nach dem Ansatzpunkt zu suchen, nach dem Grund, weshalb sie mich aufgesucht hatte.
»Die Blutuntersuchung bei der Autopsie«, sagte ich. »Was haben sie dabei festgestellt?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Es ist eher, was sie nicht festgestellt haben.«
»Wie bitte?«
»Sicher wissen Sie noch, dass Terry sehr viele Medikamente nehmen musste. Jeden Tag, Pillen, Tropfen, alle möglichen Mittel. Sie hielten ihn am Leben – ich meine, bis er dann starb. Das Blutbild war ungefähr eineinhalb Seiten lang.«
»Das haben Sie bekommen?«
»Nein, sie haben es Dr. Hansen zugeschickt. Er rief mich an und erklärte mir, dass bestimmte Medikamente, die in Terrys Blut hätten sein sollen, nicht darin enthalten waren. CellCept und Prograf. Sie waren nicht in seinem Blut, als er starb.«
»Aber sie waren wichtig.«
Sie nickte.
»Richtig. Er nahm jeden Tag sieben Kapseln Prograf. CellCept zweimal täglich. Das waren seine wichtigsten Medikamente. Sie schützten sein Herz.«
»Und ohne sie musste er sterben?«
»Drei, vier Tage. Länger hätte er ohne sie nicht überlebt. Es hätte sehr schnell zu dekompensierter Herzinsuffizienz geführt. Und genau das ist dann auch passiert.«
»Warum hat er aufgehört, diese Mittel zu nehmen?«
»Das hat er nicht, und genau das ist der Grund, warum ich Sie brauche. Irgendjemand hat sich an seinen Medikamenten zu schaffen gemacht und ihn so umgebracht.«
Ich drehte alle ihre Angaben noch einmal durch den Fleischwolf.
»Zuallererst, woher wollen Sie wissen, dass er seine Medizin tatsächlich genommen hat?«
»Weil ich es gesehen habe, und Buddy hat es auch gesehen, und sogar der Charterkunde, der Mann, mit dem sie ihre letzte Tour gemacht haben, sagte, er hätte ihn seine Medizin nehmen sehen. Ich habe sie nämlich gefragt. Ich sagte Ihnen doch, ich bin Krankenschwester. Ich hätte es gemerkt, wenn er seine Medizin nicht genommen hätte.«
»Also gut, Sie sagen also, er nahm seine Medikamente, aber es waren gar nicht seine richtigen Pillen. Irgendjemand hat sich an ihnen zu schaffen gemacht. Wie kommen Sie darauf?«
Ihre Körpersprache signalisierte Frustration. Ich machte nicht die logischen Schritte, die ich ihrer Meinung nach hätte machen sollen.
»Vielleicht sollte ich etwas weiter ausholen«, sagte sie. »Eine Woche nach der Trauerfeier, als ich das alles noch nicht wusste, räumte ich, um wieder eine gewisse Normalität einkehren zu lassen, den Schrank aus, in dem Terry seine ganzen Medikamente aufbewahrt hatte. Dazu müssen Sie wissen, diese Medikamente waren sehr, sehr teuer. Ich wollte sie nicht einfach wegwerfen. Es gibt Leute, die sie sich kaum leisten können. Wir konnten sie uns kaum leisten. Terrys Versicherung war abgelaufen, und wir brauchten MediCal und Medicaid, nur um seine Medikamente bezahlen zu können.«
»Deshalb haben Sie die Medikamente gespendet?«
»Ja, das ist bei Transplantationspatienten so üblich. Wenn jemand …«
Sie blickte auf ihre Hände hinab.
»Ich verstehe«, sagte ich. »Sie geben alles zurück.«
»Ja. Um anderen zu helfen. Es ist alles sehr teuer. Und Terrys Vorrat hätte mindestens noch neun Wochen gereicht. Er wäre für jemand anderen Tausende von Dollars wert gewesen.«
»Verstehe.«
»Deshalb packte ich die ganzen Medikamente ein und fuhr mit der Fähre aufs Festland ins Krankenhaus. Alle waren sehr dankbar dafür, und ich dachte, damit wäre die Sache erledigt. Ich habe zwei Kinder, Mr. Bosch. So schwer es mir auch fiel, das Leben musste weitergehen. Ihretwegen.«
Ich dachte an die Tochter. Ich hatte sie nie gesehen, aber Terry hatte mir von ihr erzählt. Er hatte mir ihren Namen gesagt und warum er ihn ihr gegeben hatte. Ich fragte mich, ob Graciela diese Geschichte kannte.
»Haben Sie Dr. Hansen davon erzählt?«, fragte ich. »Wenn sich jemand an den Medikamenten zu schaffen gemacht hat, müssen Sie sie warnen, damit …«
Sie schüttelte den Kopf.
»Jede Packung wird genau untersucht. Sie wissen schon, ob die Fläschchen noch versiegelt sind und dass sie noch nicht abgelaufen sind, und die Chargennummern werden auf mögliche Rückrufaktionen hin geprüft. Es wurde jedoch nichts Auffälliges festgestellt. An den Medikamenten hatte sich niemand zu schaffen gemacht. Zumindest nicht an denen, die ich ihnen gebracht hatte.«
»Aber?«
Sie rutschte noch weiter an den Rand der Couch. Jetzt würde sie damit herausrücken.
»Auf dem Boot. Die angebrochenen Packungen, die ich nicht gespendet habe, weil sie die im Krankenhaus nicht nehmen dürfen. Vorschrift, wissen Sie?«
»Und an denen hat sich jemand zu schaffen gemacht.«
»In einem Fläschchen war noch eine Tagesration Prograf, und CellCept war noch für zwei Tage da. Ich packte beide Mittel in eine Plastiktüte und brachte sie in die Avalon-Klinik. Dort hatte ich mal gearbeitet. Ich dachte mir eine Geschichte aus – eine Freundin hätte die Kapseln in den Sachen ihres Sohnes gefunden, als sie sie waschen wollte, und sie würde gern wissen, was er nahm. Sie analysierten die Kapseln, und es waren lauter Placebos. Mit einem weißen Pulver gefüllt. Gemahlener Haiknorpel, wenn Sie’s genau wissen wollen. Wird in Spezialgeschäften und übers Internet vertrieben. Leicht verdaulich und harmlos. Da sich das Pulver in einer Kapsel befand, hätte Terry den Unterschied im Geschmack nicht gemerkt.«
Sie holte einen gefalteten Umschlag aus ihrer Handtasche und reichte ihn mir. Er enthielt zwei Kapseln. Beide weiß, mit einem kleinen rosafarbenen Aufdruck auf der Seite.
»Stammen die aus der letzten Packung?«
»Ja. Diese zwei habe ich aufbewahrt, vier habe ich meiner Freundin in der Klinik gegeben.«
Ich machte mich daran, eine der Kapseln über dem offenen Umschlag zu öffnen. Die beiden Hälften ließen sich mühelos auseinanderziehen, ohne dass eine beschädigt wurde. Das weiße Pulver, das sie enthielten, rieselte in den Umschlag. Mir wurde sofort klar, dass es nicht schwierig gewesen wäre, den ursprünglichen Inhalt der Kapseln zu entfernen und durch ein wirkungsloses Pulver zu ersetzen.
»Damit sagen Sie also, Graciela, dass Terry auf seiner letzten Chartertour Pillen nahm, von denen er dachte, sie hielten ihn am Leben, während sie in Wirklichkeit vollkommen wirkungslos waren. In gewisser Weise haben sie ihn also tatsächlich getötet.«
»Genau so ist es.«
»Woher hatten Sie diese Kapseln?«
»Die Fläschchen kamen aus der Krankenhausapotheke. Aber es hätte sich bei allen möglichen Gelegenheiten jemand an ihnen zu schaffen machen können.«
Sie verstummte und ließ das erst einmal eine Weile auf mich einwirken.
»Was wird Dr. Hansen jetzt unternehmen?«, fragte ich.
»Er meinte, er hätte keine Wahl. Falls sich im Krankenhaus jemand an den Medikamenten zu schaffen gemacht hat, muss er der Sache auf den Grund gehen. Es könnten andere Patienten gefährdet werden.«
»Das halte ich für unwahrscheinlich. Sie sagten doch selbst, es wären zwei Medikamente ausgetauscht worden. Das heißt, es ist wahrscheinlich irgendwo außerhalb des Krankenhauses passiert, als sie sich bereits in Terrys Besitz befanden.«
»Ich weiß. Das meinte Dr. Hansen auch. Er sagte, er würde es den zuständigen Behörden melden. Das müsste er. Ich weiß allerdings nicht, wer das ist und was sie tun werden. Das Krankenhaus ist in L.A., und Terry starb etwa fünfundzwanzig Meilen vor der Küste von San Diego auf seinem Boot. Ich weiß nicht, wer …«
»Zuerst geht es vermutlich an die Küstenwache, und die wird es ans FBI weiterleiten. Irgendwann. Aber das wird einige Tage dauern. Sie könnten die Sache beschleunigen, wenn Sie sich gleich an das FBI wenden. Ehrlich gestanden, verstehe ich auch nicht, warum Sie damit zu mir kommen und nicht zu ihnen gehen.«
»Das geht nicht. Noch nicht jedenfalls.«
»Warum nicht? Natürlich geht das. Sie sollten nicht zu mir kommen. Gehen Sie damit zum FBI. Sagen Sie es den Leuten, mit denen er gearbeitet hat. Sie werden sich der Sache bestimmt sofort annehmen, Graciela. Ganz sicher.«
Sie stand auf und ging zur Schiebetür und blickte nach draußen, über den Pass. Es war einer dieser Tage, an denen der Smog so dicht ist, dass er aussieht, als könnte er sich entzünden.
»Sie waren Detective. Überlegen Sie doch mal. Jemand hat Terry ermordet. Diese Kapseln wurden doch sicher nicht aus Versehen ausgetauscht – nicht bei zwei verschiedenen Medikamenten aus zwei verschiedenen Packungen. Dahinter steckt Absicht. Also ist die nächste Frage: Wer hatte Zugang zu seinen Medikamenten? Wer hatte ein Motiv? Ihr Verdacht wird zunächst auf mich fallen, und vielleicht werden sie woanders gar nicht mehr suchen. Ich habe zwei Kinder. Das kann ich nicht riskieren.«
Sie wandte sich ab und sah mich wieder an.
»Und ich war es nicht.«
»Welches Motiv?«
»Geld. Zum einen. Er hatte aus der Zeit beim FBI eine Lebensversicherung.«
»Zum einen? Heißt das, es gibt noch ein zweites Motiv?«
Sie senkte den Blick zu Boden.
»Ich habe meinen Mann geliebt. Aber wir hatten Probleme. Er hatte die letzten paar Wochen auf dem Boot geschlafen. Deshalb hat er vermutlich auch diese lange Chartertour übernommen. Sonst machte er meistens nur Tagestouren.«
»Was waren das für Probleme, Graciela? Wenn ich mich der Sache annehmen soll, muss ich das wissen.«
Sie zuckte die Achseln, als wüsste sie die Antwort nicht, doch dann antwortete sie.
»Wir lebten auf einer Insel, und mir gefiel es dort nicht mehr. Ich glaube, es war kein großes Geheimnis, dass ich aufs Festland zurückziehen wollte. Das Problem war, dass er wegen seiner FBI-Tätigkeit nach wie vor Angst um unsere Kinder hatte. Er hatte Angst vor der Welt. Er wollte die Kinder von der Welt abschirmen. Ich nicht. Ich wollte, dass sie etwas von der Welt mitbekämen und darauf vorbereitet wären.«
»Und das war alles?«
»Da waren auch noch andere Dinge. Ich war nicht glücklich darüber, dass er weiter Fälle übernahm.«
Ich stand auf und stellte mich neben sie an die Tür. Ich schob sie auf, um etwas von der stickigen Luft hinauszulassen. Ich hätte sie öffnen sollen, sobald wir hereingekommen waren. Im Haus roch es abgestanden. Ich war zwei Wochen weg gewesen.
»Was für Fälle?«
»Er war wie Sie. Die, die ungestraft davonkamen, ließen ihm keine Ruhe. Er hatte massenweise Akten unten auf dem Boot, ganze Kisten voll davon.«
Ich war vor langer Zeit mal auf dem Boot gewesen. Im Bug gab es eine Kabine, die McCaleb zu einem kleinen Büro umfunktioniert hatte. Ich konnte mich an die Schachteln mit Akten auf der oberen Koje erinnern.
»Er hat lange versucht, es vor mir geheim zu halten, aber es war ganz offensichtlich, und wir hörten auf, uns was vorzumachen. In den letzten Monaten fuhr er oft aufs Festland. Wenn er keine Charter hatte. Wir stritten deswegen, aber er sagte mir nur, das wäre etwas, was er nicht einfach auf sich beruhen lassen könnte.«
»War es ein einziger Fall oder mehr als einer?«
»Das weiß ich nicht. Er hat mir nie erzählt, woran genau er arbeitete, und ich habe ihn nie gefragt. Es war mir egal. Ich wollte nur, dass er damit aufhörte. Ich wollte, dass er seine Zeit mit seinen Kindern verbrachte. Nicht mit diesen Leuten.«
»Mit welchen Leuten?«
»Mit den Leuten, die ihn so faszinierten, diese Mörder und ihre Opfer. Ihre Familien. Er war richtig besessen von ihnen. Manchmal glaube ich, sie waren ihm wichtiger als wir.«
Sie blickte über den Pass hinweg, als sie das sagte. Durch die geöffnete Tür drang der Verkehrslärm herein. Der Freeway tief unter uns hörte sich an wie ferner Applaus in einem Stadion, in dem die Spiele nie endeten. Ich schob die Tür ganz auf und trat auf die Terrasse hinaus. Ich blickte in das Gestrüpp hinab und dachte an den Kampf auf Leben und Tod, der sich dort im vergangenen Jahr abgespielt hatte. Ich hatte ihn überlebt, um herauszufinden, dass ich, wie Terry McCaleb, Vater war. In den Monaten, die seitdem vergangen waren, hatte ich gelernt, in den Augen meiner Tochter zu finden, was Terry, wie er mir einmal gesagt hatte, in denen seiner Tochter gefunden hatte. Ich wusste, dass ich danach suchen sollte, weil er es mir gesagt hatte. Dafür war ich ihm etwas schuldig.
Graciela kam hinter mir nach draußen.
»Würden Sie das für mich tun? Ich glaube, was mein Mann über Sie gesagt hat. Ich glaube, Sie können mir helfen, und ihm ebenfalls.«
Und vielleicht auch mir selbst, dachte ich, ohne es zu sagen. Stattdessen blickte ich auf den Freeway hinab und sah die Sonne, die von den Windschutzscheiben der über den Pass fahrenden Autos zurückgeworfen wurde. Es war, als beobachteten mich tausend leuchtende Silberaugen.
»Ja«, sagte ich. »Ich werde es tun.«
4
Mein erstes Gespräch hatte ich in der Cabrillo Marina in San Pedro. Ich kam immer wieder gern auf diesem Weg ans Meer hinunter, tat es aber selten. Warum, weiß ich nicht. Es war eins dieser Dinge, die man vergisst, bis man sie wieder macht, und dann erinnert man sich, dass sie einem gefallen. Das erste Mal, als ich dort unten ans Meer kam, war ich ein sechzehnjähriger Ausreißer. Ich kam zum Hafen von San Pedro hinunter und verbrachte die Tage damit, mich tätowieren zu lassen und die einlaufenden Thunfisch-Boote zu beobachten. Die Nächte verbrachte ich damit, in einem Schlepper zu schlafen, der Rosebud hieß und nicht abgeschlossen war. Bis mich ein Hafenmeister erwischte und ich zu meinen Pflegeeltern zurückgeschickt wurde, die Worte Hold fast auf meine Knöchel tätowiert.
Die Cabrillo Marina war jünger als diese Erinnerung. Das war nicht der Industriehafen, in dem ich vor so vielen Jahren gelandet war. Inzwischen bestand die Cabrillo Marina aus Liegeplätzen für Sportboote. Mit den Masten Hunderter Segelboote, die hinter ihren verschlossenen Toren aufragten, sah sie aus wie ein Wald nach einem Buschbrand. Dahinter kamen Reihen von Motorjachten, viele davon mehrere Millionen Dollar wert.
Einige nicht. Buddy Lockridges Boot war kein schwimmendes Schloss. Lockridge, der, wie Graciela McCaleb mir gesagt hatte, der Charterpartner und am Ende der beste Freund ihres Mannes gewesen war, lebte auf einem Zehn-Meter-Segelboot, das aussah, als hätte es den Inhalt eines Zwanzig-Meter-Boots auf Deck. Es war ein richtiger Müllklipper, nicht wegen seiner Eigenschaften als Boot, sondern wegen seines Zustands. Hätte Lockridge in einem Haus gewohnt, hätte es im Garten aufgebockte Autos und im Innern Wände aus Zeitungsstapeln gehabt.
Er hatte mir mit dem Türöffner das Tor aufgemacht und kam in Shorts, Sandalen und T-Shirt aus der Kajüte. Das T-Shirt war so oft getragen und gewaschen, dass der Schriftzug auf der Brust nicht mehr lesbar war. Graciela hatte ihm telefonisch Bescheid gesagt. Er wusste, dass ich mit ihm sprechen wollte, aber nicht genau, weshalb.
»So«, sagte er, als er vom Boot auf den Anleger stieg. »Graciela sagte, Sie stellen wegen Terrys Tod Nachforschungen an. Ist das so eine Versicherungsgeschichte, oder was?«
»Ja, so könnte man es nennen.«
»Sind Sie so ’n Privatdetektiv, oder was?«
»So was Ähnliches, ja.«
Er wollte einen Ausweis sehen, und ich zeigte ihm die eingeschweißte Brieftaschenkopie der Lizenz, die ich aus Sacramento geschickt bekommen hatte. Als er meinen offiziellen Vornamen sah, zog er fragend eine Augenbraue hoch.
»Hieronymus Bosch. Wie dieser verrückte Maler, hm?«
Es kam selten vor, dass jemand den Namen kannte. Das verriet mir etwas über Buddy Lockridge.
»Einige finden, er war verrückt. Andere meinen, er sah sehr genau die Zukunft voraus.«
Die Lizenz schien seine Bedenken auszuräumen, und er schlug vor, wir könnten entweder auf seinem Boot reden oder auf eine Tasse Kaffee zum Hafenshop rübergehen. Eigentlich wollte ich einen Blick in sein schwimmendes Heim werfen – das war ein wichtiges Ermittlungsprinzip –, aber damit es nicht so offensichtlich wäre, sagte ich ihm, ich könnte etwas Koffein vertragen.
Der Hafenshop war ein Laden für Schiffsbedarf, zu dem es von Buddys Liegeplatz zu Fuß etwa fünf Minuten waren. Wir unterhielten uns auf dem Weg dorthin über alles Mögliche, und hauptsächlich hörte ich mir Buddy Lockridges Klagen darüber an, wie er in dem Film dargestellt worden war, der von McCalebs Herztransplantation und der Jagd nach dem Mörder seiner Spenderin handelte.
»Aber Sie haben doch Geld dafür gekriegt, oder nicht?«, sagte ich, als er fertig war.
»Ja, aber darum geht es nicht.«
»Aber klar doch. Streichen Sie das Geld ein, und vergessen Sie den Rest. Es ist doch nur ein Film.«
Vor dem Hafenshop standen ein paar Tische und Bänke, und dort tranken wir unseren Kaffee. Lockridge begann, Fragen zu stellen, bevor ich dazu kam. Ich ließ ihn eine Weile gewähren. Ich war der Ansicht, dass er ein äußerst wichtiger Bestandteil meiner Ermittlungen war, weil er Terry McCaleb gekannt hatte und einer der zwei Zeugen seines Todes war. Ich wollte, dass er sich in meiner Gegenwart wohlfühlte, und deshalb ließ ich ihn drauflosfragen.
»Und wie sieht Ihr Stammbaum aus?«, fragte er. »Waren Sie bei der Polizei?«
»Fast dreißig Jahre. Beim LAPD. Die Hälfte der Zeit im Morddezernat.«
»Mord also. Kannten Sie Terror?«
»Wen?«
»Ich meine, Terry. Ich nannte ihn Terror.«
»Warum?«
»Keine Ahnung. Einfach so. Ich gebe allen Spitznamen. Terry hat den Terror dieser Welt aus erster Hand mitbekommen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich nannte ihn Terror.«
»Und ich? Was kriege ich für einen Spitznamen?«
»Sie …«
Er sah mich an wie ein Bildhauer, der einen Granitblock taxiert.
»Ähm, Sie sind Koffer-Harry.«
»Wie das?«
»Weil Sie so was Zerknittertes haben, als würden Sie aus einem Koffer leben.«
Ich nickte.
»Nicht schlecht.«
»Und? Kannten Sie Terry?«
»Ja, ich kannte ihn. Wir haben bei ein paar Fällen zusammengearbeitet, als er noch beim FBI war. Und dann noch mal bei einem, als er bereits sein neues Herz bekommen hatte.«
Buddy schnippte mit den Fingern und zeigte auf mich.
»Jetzt erinnere ich mich wieder. Sie waren der Cop. Sie waren der, der damals in dieser Nacht hier auf seinem Boot war, als diese zwei Gorillas auftauchten, um ihn umzulegen. Sie haben ihm das Leben gerettet, und dann hat er Ihres gerettet.«
Ich nickte.
»Richtig. Kann ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, Buddy?«
Er breitete die Arme aus, um mir zu verstehen zu geben, dass er mir zur Verfügung stand und nichts zu verbergen hatte.
»Aber klar doch, Mann. Ich hatte nicht vor, mir das Mikro ganz unter den Nagel zu reißen.«
Ich holte meinen Notizblock heraus und legte ihn auf den Tisch.
»Danke. Fangen wir mit der letzten Chartertour an. Erzählen Sie mir davon.«
»Was wollen Sie denn wissen?«
»Alles.«
Lockridge atmete hörbar aus.
»Sie wollen ja nicht gerade wenig.«
Aber er begann, mir die Geschichte zu erzählen. Was er mir zunächst erzählte, deckte sich mit den kurzen Meldungen, die ich in den Zeitungen von Las Vegas gelesen hatte, und mit dem, was ich bei McCalebs Trauerfeier gehört hatte. McCaleb und Lockridge waren mit einem Kunden vier Tage und drei Nächte lang auf einer Chartertour an der Baja California runtergefahren, um Marlins zu fischen. Am vierten Tag, auf der Rückfahrt zum Avalon Harbor auf Catalina, brach McCaleb auf der Brücke zusammen. Sie waren zweiundzwanzig Meilen von der Küste entfernt, auf halbem Weg zwischen San Diego und Los Angeles. Sie schickten einen Funkspruch an die Küstenwache, worauf McCaleb mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Long Beach geflogen wurde, wo allerdings nur noch sein Tod festgestellt werden konnte.
Als Lockridge fertig war, nickte ich, als stimmte alles mit dem überein, was ich gehört hatte.
»Haben Sie gesehen, wie er zusammenbrach?«
»Nein. Gesehen habe ich es nicht. Aber gespürt.«
»Wie meinen Sie das?«
»Na ja, er stand oben am Ruder. Ich war mit dem Charterkunden in der Plicht. Wir hatten Kurs nach Norden genommen, waren schon auf dem Heimweg. Der Kunde hatte genug vom Fischen, deshalb hatten wir nicht mal Leinen ausgeworfen. Das Boot machte volle Fahrt, wahrscheinlich so um die fünfundzwanzig Knoten. Und ich und Otto – das ist der Kunde –, wir waren in der Plicht, als das Boot plötzlich eine Neunzig-Grad-Wendung nach Westen machte. Raus aufs offene Meer, Mann. Mir war sofort klar, dass da was nicht stimmen konnte, deshalb stieg ich die Leiter rauf, um nach Terry zu schauen, und dann sehe ich ihn so über das Ruder gesunken. Er war zusammengebrochen. Ich bin sofort zu ihm, und er lebte noch, aber, Mann, er war nicht mehr bei Bewusstsein.«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Ich war früher mal Rettungsschwimmer. In Venice Beach. Ich weiß noch, wie man Wiederbelebungsmaßnahmen macht. Ich rief Otto nach oben und kümmerte mich um Terry, während Otto das Ruder übernahm und über Funk die Küstenwache verständigte. Ich hab’s nicht geschafft, Terry wieder zurückzuholen, aber ich habe Luft in ihn reingepumpt, bis der Hubschrauber auftauchte. Was übrigens ganz schön gedauert hat.«
Ich machte mir eine Notiz in meinem Block. Nicht, weil es wichtig war, sondern weil ich Lockridge das Gefühl vermitteln wollte, dass ich ihn ernst nahm und dass alles, was er für wichtig hielt, auch für mich wichtig war.
»Wie lange haben sie gebraucht?«
»Zwanzig, fünfundzwanzig Minuten. Wie lange genau, weiß ich nicht, jedenfalls kommt es einem wie eine Ewigkeit vor, wenn man jemanden am Atmen zu halten versucht.«
»Ja. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagten, Sie hätten nichts unversucht gelassen. Und Sie sagen, Terry hat kein Wort mehr gesprochen. Er brach einfach am Ruder zusammen.«
»Genau.«
»Was war dann das Letzte, was er zu Ihnen gesagt hat?«
Lockridge begann an einem Daumennagel zu kauen, als er sich daran zu erinnern versuchte.
»Das ist eine gute Frage. Schätze, das war, als er an die Reling kam, da, wo man in die Plicht runtersieht, und zu uns runterrief, dass wir bis Sonnenuntergang zu Hause wären.«
»Und wie viel Zeit ist danach vergangen, bis er zusammenbrach?«
»Eine halbe Stunde, vielleicht auch mehr.«
»Aber zu diesem Zeitpunkt ging es ihm noch gut?«
»Ja, er war ganz normal, wie immer. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass dann so was passieren würde.«
»Zu diesem Zeitpunkt waren Sie vier Tage ununterbrochen auf dem Boot, ist das richtig?«
»Das ist richtig. War ein bisschen eng auf Dauer, weil der Kunde die Kajüte hatte. Ich und Terry haben in der Bugkabine gepennt.«
»Haben Sie in dieser Zeit gesehen, dass Terry jeden Tag seine Medikamente einnahm? Sie wissen schon, die ganzen Pillen, die er nehmen musste.«
Lockridge nickte mit Nachdruck.
»O ja, er hat brav seine Pillen geschluckt. Jeden Morgen und jeden Abend. Wir haben eine Menge Chartertouren zusammen gemacht. Es war ein richtiges Ritual bei ihm – man konnte seine Uhr danach stellen. Er hat es nie vergessen. Auch auf dieser Fahrt nicht.«
Um nichts sagen zu müssen, machte ich mir ein paar Notizen, damit Lockridge vielleicht weiterredete. Das tat er aber nicht.
»Hat er irgendeine Bemerkung gemacht, dass sie anders schmeckten oder dass er sich anders fühlte, nachdem er sie eingenommen hatte?«
»Ist es das, worauf Sie hinauswollen? Versuchen Sie irgendwie nachzuweisen, dass Terry die falschen Pillen genommen hat, damit die Versicherung nichts zahlen muss? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nie bereit erklärt, mit Ihnen zu sprechen.«
Er wollte von der Bank aufstehen. Ich langte über den Tisch und packte ihn am Arm.
»Bleiben Sie sitzen, Buddy. Darum geht es hier nicht. Ich arbeite nicht für die Versicherung.«
Er ließ sich auf die Bank zurückplumpsen und sah auf seinen Arm, wo ich ihn gepackt hatte.
»Worum geht es dann?«
»Sie wissen doch bereits, worum es geht. Ich will mir nur Gewissheit verschaffen, dass Terrys Tod wirklich das war, was er angeblich war.«
»Was er angeblich war?«
Ich merkte, dass meine Wortwahl nicht sehr glücklich gewesen war.
»Was ich damit zu sagen versuche, ist: Ich will sichergehen, dass niemand nachgeholfen hat.«
Lockridge sah mich eine Weile forschend an und nickte dann bedächtig.
»Sie meinen, ob die Pillen vielleicht nicht in Ordnung waren oder ob jemand sich daran zu schaffen gemacht hat?«
»Zum Beispiel.«
Lockridge biss entschlossen die Zähne zusammen. Es erschien mir aufrichtig.
»Brauchen Sie Hilfe?«
»Möglicherweise ja. Ich fahre morgen früh nach Catalina rüber. Mir das Boot ansehen. Könnten Sie sich dort mit mir treffen?«
»Aber sicher.«
Er schien begeistert, und mir war klar, dass ich dem irgendwann einen Riegel würde vorschieben müssen. Aber vorerst wollte ich seine uneingeschränkte Kooperation.
»Gut. Dann hätte ich noch ein paar weitere Fragen. Speziell zu diesem Charterkunden. Kannten Sie diesen Otto schon vorher?«
»Na klar. Wir nehmen Otto jedes Jahr ein paarmal mit raus. Er lebt drüben auf der Insel. Das ist der einzige Grund, weshalb wir diesen Mehrtagecharter bekamen. Wissen Sie, das war das Problem mit unserer Firma. Aber Terror war das egal. Er war vollauf zufrieden, in dem kleinen Hafen dort drüben zu liegen und auf Halbtagsaufträge zu warten.«
»Nicht so schnell bitte, Buddy. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen.«
»Ich rede davon, dass Terry das Boot drüben auf der Insel liegen hatte. Unsere Kunden dort waren Leute, die einen Ausflug nach Catalina machten und ein paar Stunden zum Fischen rausfahren wollten. Große Charter bekamen wir so nicht. Keine Drei-, Vier-, Fünftagetouren, bei denen man ordentlich verdient. Otto war eine Ausnahme, weil er drüben auf der Insel wohnt. Er wollte ein paarmal im Jahr nach Mexiko runter, zum Fischen und einen draufmachen, Sie wissen schon.«
Lockridge gab mir mehr Informationen, als ich auf einmal verarbeiten konnte. Ich konzentrierte mich weiter auf McCaleb, aber ich würde auf jeden Fall auf Otto, ihren Charterkunden, zurückkommen.
»Sie sagen also, Terry war zufrieden damit, kleine Brötchen zu backen.«
»Genau. Ich lag ihm ständig in den Ohren: ›Bring das Boot hier rüber aufs Festland, schalte ein paar Anzeigen und bemühe dich um gescheite Aufträge.‹ Aber das wollte er nicht.«
»Haben Sie ihn mal gefragt, warum?«
»Klar. Er wollte auf der Insel bleiben. Er wollte nicht ständig von der Familie weg sein. Und er wollte Zeit haben, um sich mit seinen Akten zu beschäftigen.«
»Sie meinen, mit seinen alten Fällen.«
»Ja, mit denen und mit verschiedenen neuen.«
»Welche neuen?«
»Keine Ahnung. Er schnitt ständig Zeitungsartikel aus und legte Ordner an, telefonierte herum, Dinge in der Art.«
»Auf dem Boot?«
»Ja, auf dem Boot. Im Haus ließ es Graciela nicht zu. Das hat er mir erzählt. Sie wollte nicht, dass er das machte. Manchmal ging das so weit, dass er auf dem Boot übernachtete. Am Ende. Ich glaube, es war wegen der Akten. Er steigerte sich total in irgendwas rein, und irgendwann sagte sie ihm dann, er solle auf dem Boot bleiben, bis er darüber hinweg wäre.«
»Das hat er Ihnen erzählt?«
»Das musste er gar nicht.«
»Erinnern Sie sich an irgendeinen Fall oder eine Akte, für die er sich am Schluss besonders interessierte?«
»Nein, in so was hat er mich nicht mehr eingeweiht. Ich half ihm bei der Herzgeschichte, aber danach schloss er mich von diesem ganzen Kram aus.«
»Hat Ihnen das etwas ausgemacht?«
»An sich nicht. Ich meine, ich hätte ihm gern geholfen. Kriminelle zu fangen ist interessanter, als Fische zu fangen, aber mir war klar, dass das seine Welt war und nicht meine.«
Das hörte sich zu sehr nach einer Standardantwort an, so, als wiederholte er eine Erklärung, die ihm McCaleb einmal gegeben hatte. Ich beschloss, es dabei zu belassen, aber auf diesen Punkt würde ich noch einmal zurückkommen.
»Okay, dann wollen wir uns Otto zuwenden. Sie waren mit ihm wie oft fischen?«
»Es war unser dritter – nein, vierter – Charter mit ihm.«
»Immer nach Mexiko runter?«
»Mehr oder weniger.«
»Was macht er beruflich, dass er sich das leisten kann?«
»Er ist pensioniert. Hält sich für Zane Grey und ist ganz heiß aufs Fischen. Will unbedingt einen schwarzen Marlin fangen und bei sich zu Hause an die Wand hängen. Er kann es sich leisten. Er hat mir mal erzählt, er war Vertreter, aber für was, habe ich ihn nicht gefragt.«
»Pensioniert? Wie alt ist er?«
»Keine Ahnung. Mitte sechzig, würde ich sagen.«
»Und wo hat er vorher gelebt?«
»Gleich drüben auf dem Festland. In Long Beach, glaube ich.«
»Was haben Sie vorhin gemeint, als Sie sagten, er wollte zum Fischen nach Mexiko runter und auch sonst einen draufmachen?«
»Genau das, was ich gesagt habe. Wir sind mit ihm fischen gefahren, und wenn wir in Cabo anlegten, ist er immer noch losgezogen, einen draufmachen.«
»Auf der letzten Fahrt sind Sie also jeden Abend in einen Hafen eingelaufen, immer in Cabo.«
»Die ersten zwei Abende legten wir in Cabo an und am dritten in San Diego.«
»Wer bestimmte das?«
»Na ja, Otto wollte nach Cabo, und San Diego lag auf dem Rückweg einfach auf halbem Weg. Bei der Rückfahrt lassen wir uns immer Zeit.«
»Was hat Otto in Cabo gemacht?«
»Ich sagte Ihnen doch, er hatte nebenher was laufen. Er machte sich an beiden Abenden fein und ging in die Stadt. Schätze, er traf sich dort mit einer Señorita. Er hat mit seinem Handy ein paar Anrufe gemacht.«
»Ist er verheiratet?«
»Soviel ich weiß, schon. Ich glaube, deswegen stand er auch auf diese Viertagetouren. Seine Frau dachte, er wäre auf hoher See, fischen. Höchstwahrscheinlich wusste sie nichts davon, dass wir in Cabo auf eine Margarita anlegten – und damit meine ich nicht den Drink.«
»Und Terry? Ging er in die Stadt?«
Er antwortete ohne Zögern.
»Nee, in der Hinsicht lief bei Terry gar nichts, und er ging auch nie vom Boot. Setzte nicht mal einen Fuß auf den Anleger.«
»Wieso?«
»Keine Ahnung. Er sagte nur, das bräuchte er nicht. Ich schätze, er war da ein bisschen abergläubisch.«
»Inwiefern?«
»Sie wissen schon, der Käpt’n bleibt an Bord seines Schiffs, irgendwas in der Richtung.«
»Und Sie?«
»Meistens blieb ich bei Terry auf dem Boot. Aber ab und zu ging ich schon auch mal in die Stadt, in eine der Bars oder so.«
»Wie war das auf der letzten Tour?«
»Da nicht, da blieb ich auf dem Boot. Ich war ein bisschen knapp bei Kasse.«
»Auf der letzten Tour hat also Terry das Boot nie verlassen?«
»Nein.«
»Und außer Ihnen, Otto und ihm war niemand auf dem Boot, richtig?«
»Ja – das heißt, nein. Nicht genau.«
»Wie meinen Sie das? Wer war sonst noch auf dem Boot?«
»Am zweiten Abend, an dem wir in Cabo einliefen, wurden wir von den federales angehalten, der mexikanischen Küstenwache. Zwei Typen kamen an Bord und sahen sich ein paar Minuten um.«
»Warum?«
»Reine Routinekontrolle. Hin und wieder halten sie einen an, lassen sich eine kleine Gebühr zahlen, und damit hat es sich dann.«
»Ein Bestechungsgeld?«
»Ein Bestechungsgeld, ein Schmiergeld, ein kleiner Anreiz, wie Sie es eben nennen wollen.«
»Und das war bei dieser Tour der Fall?«
»Ja, Terry gab ihnen fünfzig Dollar, als sie in der Kajüte waren, und dann zogen sie ab. Es ging alles ziemlich schnell.«
»Haben sie das Boot durchsucht? Haben sie Terrys Medikamente gesehen?«
»Nein, so weit kam es nicht. Dafür gibt man ihnen ja das Geld – um das zu vermeiden.«
Ich hatte mir keine Notizen mehr gemacht. Viel von diesen Informationen war neu und verdiente, dass ihnen weiter nachgegangen würde, aber ich hatte das Gefühl, vorläufig genug erfahren zu haben. Ich würde erst einmal verdauen, was ich hatte, und dann darauf zurückkommen. Mein Gefühl sagte mir, dass mir Buddy Lockridge zur Verfügung stünde, solange ich wollte, wenn ich ihm nur das Gefühl vermittelte, an den Ermittlungen beteiligt zu sein. Ich fragte ihn nach den genauen Namen der Jachthäfen, in denen sie auf der Tour mit Otto angelegt hatten, und schrieb mir alles auf. Danach erinnerte ich ihn noch einmal an unseren Termin auf McCalebs Boot am nächsten Morgen. Ich sagte ihm, ich würde die erste Fähre nach Catalina nehmen, und er sagte, er auch. Dann verabschiedete ich mich von ihm, weil er sagte, er wollte noch in den Laden gehen, um ein paar Sachen zu kaufen.
Als wir unsere Kaffeebecher in den Abfalleimer warfen, wünschte er mir viel Glück bei den Ermittlungen.
»Ich weiß nicht, was Sie herausfinden werden. Ich weiß nicht, ob es überhaupt etwas herauszufinden gibt, aber wenn da jemand bei Terry nachgeholfen hat, möchte ich, dass Sie den Kerl erwischen, der da nachgeholfen hat. Wissen Sie, was ich meine?«
»Ja, Buddy, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Bis morgen.«
»Sie können auf mich zählen.«
5
Als mich an diesem Abend meine Tochter aus Las Vegas anrief, wollte sie, dass ich ihr eine Geschichte erzählte. Gerade mal fünf Jahre alt, wollte sie ständig, dass ich ihr etwas vorsang oder Geschichten erzählte. Ich hatte mehr Geschichten als Lieder in mir. Sie hatte einen schmuddeligen schwarzen Kater, den sie No Name nannte, und am liebsten mochte es Maddie, wenn ich mir Geschichten voller Gefahren und mutiger Taten ausdachte, aus denen No Name als Held des Tages hervorging, weil er das Rätsel löste oder das vermisste Kind oder Haustier fand oder einem bösen Menschen einen Denkzettel verpasste.
Ich erzählte ihr eine kurze Geschichte über No Name, wie er eine vermisste Katze namens Cielo Azul fand. Sie gefiel ihr so gut, dass sie noch eine hören wollte, aber ich sagte ihr, es sei schon spät und ich müsse jetzt Schluss machen. Dann fragte sie mich völlig unvermittelt, ob der Burger King und die Dairy Queen verheiratet seien. Ich lächelte und staunte darüber, wie ihr Verstand arbeitete. Ich sagte ihr, sie wären verheiratet, und sie fragte mich, ob sie glücklich wären.
Man kann sich aus der Welt ausklinken und von ihr abkapseln. Man kann sich für einen ständigen Außenseiter halten. Doch die Unschuld eines Kindes holt einen zurück und gibt einem den Schild der Freude, um sich zu schützen. Das habe ich erst spät im Leben gelernt, aber nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Es tat mir weh, an die Dinge zu denken, die sie über die Welt erfahren würde. Ich wusste nur, dass ich ihr nichts beibringen wollte. Ich fühlte mich befleckt von den Wegen, die ich im Leben eingeschlagen hatte, und von den Dingen, die ich wusste. Ich hatte nichts, von dem ich wollte, dass sie es hätte. Ich wollte nur, dass sie mir etwas beibrächte.
Deshalb sagte ich ihr, ja, der Burger King und die Dairy Queen seien glücklich und führten ein wunderschönes Leben miteinander. Ich wollte, dass sie ihre Geschichten und Märchen hatte, solange sie noch an sie glauben konnte. Denn bald genug würden sie ihr weggenommen werden.
Meiner Tochter am Telefon Gute Nacht zu sagen, hatte etwas Einsames und Deplatziertes. Ich war gerade von einem zweiwöchigen Aufenthalt in Las Vegas zurückgekommen, und Maddie hatte sich daran gewöhnt, mich zu sehen, und ich hatte mich daran gewöhnt, sie zu sehen. Ich holte sie von der Schule ab, ich sah ihr beim Schwimmen zu, ich machte ihr ein paarmal Abendessen in dem kleinen, zweckmäßigen Apartment am Flughafen, das ich gemietet hatte. Abends, wenn ihre Mutter in den Casinos Poker spielte, fuhr ich sie nach Hause und brachte sie zu Bett, um sie dann unter der Aufsicht der im Haus lebenden Kinderfrau zurückzulassen.
Ich war etwas Neues in ihrem Leben. In ihren ersten vier Lebensjahren hatte sie nie etwas von mir gehört, und ich hatte nichts von ihr gehört. Das machte die Schönheit und Schwierigkeit der Beziehung aus. Ich war mit plötzlicher Vaterschaft geschlagen und genoss sie in vollen Zügen und tat mein Bestes. Maddie hatte plötzlich einen weiteren Beschützer, der in ihrem Leben ein und aus ging. Eine zusätzliche Umarmung und ein zusätzlicher Kuss auf ihr Haar. Aber sie wusste auch, dass dieser Mann, der plötzlich in ihr Leben getreten war, ihrer Mutter eine Menge Schmerzen und Tränen bereitete. Eleanor und ich hatten zwar versucht, unsere Diskussionen und manchmal harten Worte von unserer Tochter fernzuhalten, aber manchmal sind die Wände dünn, und Kinder, stellte ich fest, sind die besten Detektive. Sie sind meisterliche Deuter menschlicher Ausstrahlung.
Eleanor Wish hatte mir das Geheimnis schlechthin vorenthalten. Eine Tochter. An dem Tag, an dem sie mir Maddie schließlich vorstellte, dachte ich, auf der Welt sei alles in Ordnung. Zumindest in meiner Welt. Ich sah meine Erlösung in den Augen meiner Tochter, meinen eigenen Augen. Was ich an diesem Tag allerdings nicht sah, waren die Risse. Die Sprünge unter der Oberfläche. Und sie waren tief. Der glücklichste Tag meines Lebens sollte zu einigen der scheußlichsten Tage führen. Zu Tagen, an denen ich nicht über das Geheimnis hinwegkam und was mir so viele Jahre vorenthalten worden war. Während ich einen Augenblick lang dachte, ich hätte alles, was ich mir vom Leben wünschen könnte, stellte ich bald fest, dass ich ein zu schwacher Mensch war, um es festzuhalten, um den dahinter verborgenen Verrat als Gegenleistung für das zu ertragen, was ich geschenkt bekommen hatte.
Andere, bessere Männer könnten so etwas. Ich konnte es nicht. Ich verließ das Zuhause von Eleanor und Maddie. Mein Zuhause in Las Vegas ist eine schmucklose Zweizimmerwohnung über einem Parkplatz neben dem Ort, an dem spielende Millionäre und Milliardäre ihre Privatjets abstellen, um sich mit dezent summenden Limousinen zu den Casinos fahren zu lassen. Ein Standbein habe ich in Las Vegas, das andere hier in Los Angeles, einem Ort, von dem ich weiß, dass ich ihn nicht auf Dauer verlassen kann, jedenfalls nicht, ohne zu sterben.
Nachdem sie Gute Nacht gesagt hatte, gab meine Tochter das Telefon ihrer Mutter, die ausnahmsweise abends mal zu Hause war. Unser Verhältnis war gespannter denn je. Wir lagen wegen unserer Tochter im Clinch miteinander. Ich wollte nicht, dass sie bei einer Mutter aufwuchs, die nachts in den Casinos arbeitete. Ich wollte nicht, dass sie bei Burger King zu Abend aß. Und ich wollte nicht, dass sie das Leben in einer Stadt kennenlernte, die aus ihren Lastern kein Hehl machte.
Aber ich war nicht in der Lage, daran etwas zu ändern. Ich weiß, ich laufe Gefahr, mich lächerlich zu machen, denn ich lebe an einem Ort, wo die Willkür von Verbrechen und Chaos nie weit ist und wo im wahrsten Sinn des Wortes Gift in der Luft liegt. Trotzdem finde ich es nicht gut, dass meine Tochter dort aufwächst, wo sie ist. Ich sehe es als den feinen Unterschied zwischen Hoffnung und Sehnsucht. Los Angeles ist ein Ort, der von der Hoffnung lebt, und daran ist immer noch etwas Unverfälschtes. Es hilft einem, durch die verschmutzte Luft zu sehen. Las Vegas ist anders. In meinen Augen lebt es von der Sehnsucht, und diese Straße führt zu einem unwiederbringlich gebrochenen Herzen. Das möchte ich meiner Tochter ersparen. Ich will es sogar ihrer Mutter ersparen. Ich bin bereit zu warten, aber nicht so lange. Je mehr Zeit ich mit meiner Tochter verbringe, je besser ich sie kennenlerne und je mehr ich sie liebe, desto mehr zerfasert meine Bereitschaft in der Mitte wie eine Seilbrücke, die einen tiefen Abgrund überspannt.
Als Maddie ihrer Mutter das Telefon zurückgab, hatte keiner von uns viel zu sagen, weshalb wir das auch nicht taten. Ich sagte nur, ich würde bei der nächsten Gelegenheit bei Maddie vorbeikommen, und wir legten auf. Als ich das Telefon beiseitelegte, spürte ich einen Schmerz in meinem Innern, an den ich nicht gewöhnt war. Es war nicht der Schmerz von Einsamkeit oder Leere. Diesen Schmerz kannte ich, und ich hatte gelernt, mit ihm zu leben. Es war der Schmerz, der mit der Angst davor kam, was die Zukunft für jemanden bereithielt, der einem so kostbar war, für jemanden, für den man ohne Zögern sein Leben gäbe.
6
Am nächsten Morgen brachte mich die erste Fähre um neun Uhr dreißig nach Catalina. Da ich Graciela McCaleb auf der Überfahrt mit dem Handy angerufen hatte, wartete sie an der Anlegestelle auf mich. Der Tag war sonnig und frisch, und ich konnte den Unterschied in der smogfreien Luft riechen. Graciela lächelte mich an, als ich mich dem Tor näherte, wo Leute auf Ankömmlinge von den Booten warteten.
»Guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind.«
»Kein Problem. Schön, dass Sie sich Zeit für mich nehmen.«
Halb hatte ich erwartet, dass Buddy Lockridge bei ihr wäre. Ich hatte ihn auf der Fähre nicht gesehen und dachte, er sei vielleicht schon am Abend zuvor herübergefahren.
»Ist Buddy noch nicht da?«
»Nein. Kommt er denn auch her?«
»Ich wollte mir auf dem Boot alles mit ihm ansehen. Er sagte, er würde mit der ersten Fähre rüberkommen, aber er ist nicht aufgetaucht.«
»Na ja, es gehen zwei Fähren. Die nächste kommt in fünfundvierzig Minuten an. Wahrscheinlich nimmt er die. Was möchten Sie als Erstes tun?«
»Ich würde mir gern das Boot ansehen, dort anfangen.«
Wir gingen zum Tenderkai und fuhren mit einem Schlauchboot mit einem kleinen Ein-PS-Außenborder in das Becken hinaus, wo die an schwimmenden Ankerbojen festgemachten Jachten synchron in der Strömung dümpelten. Terrys Boot, The Following Sea, war das zweite von hinten in der zweiten Reihe. Mich überkam ein ungutes Gefühl, als wir darauf zufuhren und schließlich am Heckspiegel anlegten. Auf diesem Boot war Terry gestorben. Mein Freund und Gracielas Mann. Früher war es für mich fast eine Selbstverständlichkeit gewesen, einen emotionalen Bezug zu einem Fall zu finden oder herzustellen. Es trug dazu bei, das Feuer zu schüren, und verhalf mir zum nötigen Biss, dorthin zu gehen, wohin ich gehen musste, und das zu tun, was ich tun musste. In diesem Fall musste ich nicht nach diesem Bezug suchen. Es bestand keine Notwendigkeit, ihn herzustellen. Er war bereits Teil der Abmachung. Der Hauptbestandteil.
Ich sah auf den Namen des Boots, der in schwarzer Schrift aufs Heck geschrieben war, und dachte daran, wie Terry ihn mir einmal erklärt hatte. Er hatte mir gesagt, eine following sea, eine von hinten kommende See, sei die Welle, auf die man achten müsse. Sie kam im toten Winkel an, brach von hinten über einen herein. Eine gute Philosophie. Doch jetzt musste ich mich fragen, warum Terry nicht gesehen hatte, was und wer von hinten auf ihn zugekommen war.
Unsicher stieg ich vom Schlauchboot auf den Heckspiegel der Following Sea. Ich griff nach dem Tau, um es festzubinden. Aber Graciela winkte ab.
»Ich komme nicht an Bord«, sagte sie.
Sie schüttelte den Kopf, als wolle sie jegliche Überredungsversuche meinerseits abwehren, und reichte mir einen Schlüsselbund. Ich nahm ihn und nickte.
»Ich will einfach nicht da drauf«, sagte sie. »Das eine Mal, als ich die Medikamente geholt habe, hat mir gereicht.«
»Das kann ich verstehen.«
»Es hat auch den Vorteil, dass das Schlauchboot am Anleger ist und Buddy damit zu Ihnen rüberfahren kann, falls er noch auftaucht.«
»Falls?«
»Er ist nicht gerade der Zuverlässigste. Zumindest hat das Terry gesagt.«
»Und wenn er nicht auftaucht, wie komme ich dann wieder von hier runter?«
»Ach, winken Sie einfach einem Wassertaxi. Sie kommen alle fünfzehn Minuten vorbei. Das ist überhaupt kein Problem. Setzen Sie es mir einfach auf die Rechnung. Da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was ich Ihnen zahlen soll.«
Das war etwas, was sie korrekterweise zur Sprache bringen musste, aber sie wusste so gut wie ich, dass das kein Auftrag war, den ich für Geld machte.
»Das ist nicht nötig«, sagte ich. »Wenn ich das hier mache, möchte ich nur eins als Gegenleistung.«
»Was wäre das?«
»Terry hat mir mal von Ihrer Tochter erzählt. Er sagte, Sie hätten sie Cielo Azul getauft.«
»Das stimmt. Den Namen hat er ausgesucht.«
»Hat er Ihnen mal erzählt, warum?«
»Er sagte nur, er fände ihn schön. Er sagte, er hätte mal ein Mädchen gekannt, das Cielo Azul hieß.«
Ich nickte.
»Das Einzige, was ich dafür möchte, dass ich das hier mache, ist, dass ich sie eines Tages kennenlernen darf – wenn das hier vorbei ist, meine ich.«
Graciela stutzte. Dann nickte sie.
»Sie ist ein richtiger Schatz. Sie wird Ihnen bestimmt gefallen.«
»Da bin ich mir ganz sicher.«
»Harry, kannten Sie sie? Das Mädchen, nach dem Terry unsere Tochter genannt hat?«
Ich sah sie kurz an und nickte.