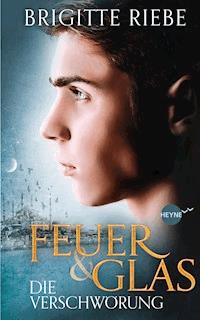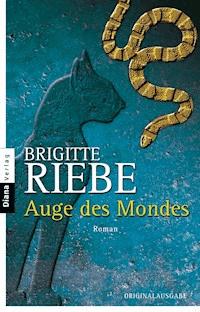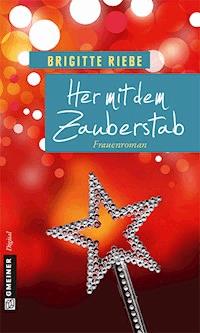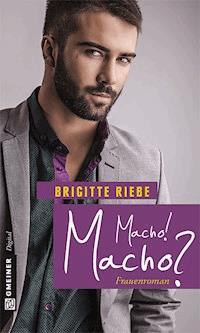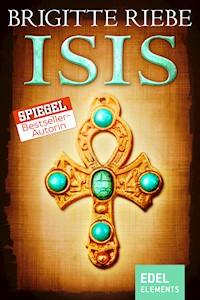5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Jakobsweg-Saga
- Sprache: Deutsch
Ein episches Abenteuer in dunklen Zeiten: Der Historienroman »Die sieben Monde des Jakobus« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe als eBook bei dotbooks. Das streng calvinistische Genf des 16. Jahrhunderts ist kein sicherer Ort für eine Katholikin – und so steht die junge Clara Weingarten nach dem Tod ihres Mannes nicht nur mittellos da, sondern muss auch gegen immer heftigere Anfeindungen und bitteren Verrat kämpfen. Noch dazu gibt es in ihrer Familiengeschichte Geheimnisse, die sie nicht versteht; können ihr die Aufzeichnungen ihrer Vorfahrin dabei helfen, diese zu entschlüsseln? Auf Pilars Spuren wagt Clara darum die gefährliche Reise ins ferne Santiago de Compostela. Zu ihrer eigenen Überraschung schließt sie auf dem Jakobsweg unerwartete Freundschaften: zum Feuerschlucker Bruno, zur schönen Camille mit dem rätselhaften Brandzeichen … und zu Luis Alvar, dem Sohn eines spanischen Eroberers. Doch sie alle verbindet weit mehr als das Ziel ihrer Pilgerreise – ein Rätsel aus der Vergangenheit, dass sie bald in tödliche Gefahr bringt! »Brigitte Riebe weiß die Leser zu verblüffen und zeichnet ein farbenprächtiges, spannendes Gemälde des 16. Jahrhunderts. Das Buch zählt unter den historischen Romanen zu den besten!«, urteilt der Generalanzeiger Bonn Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Roman »Die sieben Monde des Jakobus« von Bestsellerautorin Brigitte Riebe ist der zweite Roman ihrer großen Jakobsweg-Saga, der unabhängig von seinem Vorgänger gelesen werden kann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das streng calvinistische Genf des 16. Jahrhunderts ist kein sicherer Ort für eine Katholikin – und so steht die junge Clara Weingarten nach dem Tod ihres Mannes nicht nur mittellos da, sondern muss auch gegen immer heftigere Anfeindungen und bitteren Verrat kämpfen. Noch dazu gibt es in ihrer Familiengeschichte Geheimnisse, die sie nicht versteht; können ihr die Aufzeichnungen ihrer Vorfahrin dabei helfen, diese zu entschlüsseln? Auf Pilars Spuren wagt Clara darum die gefährliche Reise ins ferne Santiago de Compostela. Zu ihrer eigenen Überraschung schließt sie auf dem Jakobsweg unerwartete Freundschaften: zum Feuerschlucker Bruno, zur schönen Camille mit dem rätselhaften Brandzeichen … und zu Luis Alvar, dem Sohn eines spanischen Eroberers. Doch sie alle verbindet weit mehr als das Ziel ihrer Pilgerreise – ein Rätsel aus der Vergangenheit, dass sie bald in tödliche Gefahr bringt!
Über die Autorin:
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin und arbeitete viele Jahre als Verlagslektorin. 1990 entschloss sie sich schließlich, selbst Bücher zu schreiben, und veröffentlichte seitdem mehr als 50 historische Romane und Krimis, mit denen sie regelmäßig auf den Bestsellerlisten vertreten ist. Heute lebt Brigitte Riebe mit ihrem Mann in München.
Die Website der Autorin: www.brigitteriebe.com
Bei dotbooks veröffentlichte Brigitte Riebe ihre historischen Romane:
»Schwarze Frau vom Nil«
»Pforten der Nacht«
»Liebe ist ein Kleid aus Feuer«
»Die Hexe und der Herzog«
»Die Braut von Assisi«
»Die Prophetin vom Rhein«
»Die schöne Philippine Welserin«
»Der Kuss des Anubis«
»Die Töchter von Granada«
Sowie ihre Jakobsweg-Saga mit den Romanen:
»Die Straße der Sterne«
»Die sieben Monde des Jakobus«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint Brigitte Riebes Roman »Der Wahnsinn, den man Liebe nennt«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Diana Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-432-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die sieben Monde des Jakobus« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Brigitte Riebe
Die sieben Monde des Jakobus
Die große Jakobsweg-Saga
dotbooks.
Für Daxi
Wanderer, es sind deine Spuren,
der Weg, und nichts weiter.
Wanderer, es gibt keinen Weg;
man erschafft ihn im Gehen.
Im Gehen erschafft man den Weg,
und wenn man den Blick zurückwendet,
sieht man den Pfad,
den man nie wieder zu gehen hat.
Wanderer, es gibt keinen Weg – nur Kielspuren
eines Schiffes im Meer.
Antonio Machado
(1875–1939)
(aus dem Spanischen übertragen von B. Haab)
Prolog
BRAUTNACHT
Blätter, vergilbt und brüchig, bedeckt mit einer kühnen, steilen Handschrift.
»Was ist das?«, fragte sie leise. Sie hatte bei ihm gelegen, kannte seinen Geruch und sein Morgengesicht, aber plötzlich war er ihr fremd.
»Er kam wie verabredet mit den Schatten der Dämmerung«, begann er halblaut vorzulesen. Sie liebte seine helle Stimme, die so gut zu seinem umgänglichen Wesen passte. »Mein Herz begann zu rasen, als ich seine hohe Gestalt mit dem rotblonden Haar erblickte, das ihm in Wellen bis auf die Schultern fiel ...«
Schon die ersten Worte berauschten sie. Genauso hatte sie empfunden, als sie Heinrich zum ersten Mal gesehen hatte. Aber woher kannte der unbekannte Schreiber ihre heimlichsten Gefühle?
»Es war wahnsinnig, was wir taten. Es würde uns beide ins Verderben stürzen ...«
»Was ist das?«, wiederholte sie. Eine innere Unruhe hatte sie erfasst, die sie sich nicht erklären konnte. »Was liest du da?«
»Blancas Vermächtnis«, sagte er nachdenklich. Heinrich hielt die Ledermappe mit den vergilbten Blättern in seinen Händen wie einen Schatz. »Und die Kommentare ihrer Tochter Pilar. Aufzeichnungen, die sich schon seit Jahrhunderten im Familienbesitz befinden. Ich habe lange überlegt, was ich damit anstellen soll, aber nun weiß ich es endlich.«
»Und was wird das sein?«, fragte sie.
Er lächelte, wie sie es so an ihm mochte.
»Drucken will ich sie. Ja, ich werde sie drucken, um die Erinnerung für alle Zeiten zu bewahren. Von der Vergangenheit kann man sich ebenso wenig trennen wie von seinem Schatten. Alles, was geschehen ist, gehört zu uns.«
Clara wollte nach den Blättern greifen, er aber legte die Mappe beiseite und nahm stattdessen ihre Hand.
»Das siehst du dir später einmal genauer an. Wenn alles fertig ist. Denn hier ist noch etwas Wichtiges, was zu uns gehört.«
Ihr Herz hatte schneller geschlagen, als er zum ersten Mal das kleine Ladengeschäft ihres Vaters unter den Arkaden betreten hatte, wo es nach Met und Bienenwachs roch, weil der Lebzelter nicht nur die bei allen beliebten Süßigkeiten buk, sondern als Wachszieher auch das Münster mit seinen Kerzen belieferte. Clara hatte gewusst, dass auch sie ihm gefiel, und trotzdem war der Anfang alles andere als einfach gewesen. Zunächst hatte sie Heinrichs Schüchternheit für Hochmut, seine Zurückhaltung für Kälte gehalten. Inzwischen zweifelte sie nicht mehr an seiner Liebe. Und dennoch gab es in ihr noch immer die Angst, es könne trotz allem viel zu schnell vorbei sein.
Der Ring, den er ihr ansteckte, war schwer. Er saß wie angegossen am Mittelfinger ihrer linken Hand.
»Er hat uns stark gemacht, er hat uns schwach gemacht, darin liegt sein Geheimnis«, sagte Heinrich. »So viele Schicksale hat er schon gesehen.«
Zwei Steine, durch ein breites Goldband miteinander verbunden. Milchig blau der eine, von gelben Blitzen durchzogen, sobald sie die Hand bewegte, der andere strahlend grün. Niemals zuvor war ihr solch ein Schmuckstück begegnet.
»Der blaue ist ein Labradorit, den man auch Stein der Wahrheit nennt; er verkörpert die Treue. Der grüne Smaragd gilt als der Stein der Hoffnung. Eins kann ohne das andere nicht existieren, sie brauchen sich gegenseitig, und Liebe verbindet sie. Es sollen einmal zwei Ringe gewesen sein«, fuhr er fort. »Vor langer Zeit. Aber die Spur des anderen hat sich irgendwann verloren. Gefällt er dir?«
Sie nickte, zu überwältigt, um zu sprechen.
»Mit diesem Ring nehme ich dich zu meiner Frau«, sagte er. »Ich verspreche, dich glücklich zu machen bis zum Ende meiner Tage. Und sollte ich es einmal vergessen, dann musst du mich an diese Nacht erinnern. Versprichst du mir das, Clara?«
Sie nickte abermals.
Morgen würde der Priester sie im Freiburger Münster zu Mann und Frau erklären, und sie hatte sich seit Wochen auf das laute Läuten der Angelusglocke gefreut. Tausendmal und mehr war Clara im Geist schon in der kleinen Nikolauskapelle gekniet, wo die Trauung stattfinden sollte, über ihren Häuptern das alte Steinrelief: Apostel Jakobus, der einen Pilger krönte.
Heinrich schien zu erraten, woran sie dachte.
»Ja, morgen sollen alle mit uns feiern«, sagte er, »Verwandte, Nachbarn und Freunde. Morgen werden wir sie bewirten, mit ihnen lachen, trinken und tanzen. Diese Nacht aber gehört uns.«
Endlich war der Bann gelöst. Ihre Augen lächelten, und die Antwort kam einfach und frei.
»Ich verspreche, dich glücklich zu machen bis zum Ende meiner Tage. Mit diesem Ring nehme ich dich zu meinem Mann. Solange ich lebe, bleibt er an meiner Hand.«
Sie hörte seinen Atem, der schneller ging bei ihren Worten, dann berührte er zart ihren Wangenknochen und zeichnete die Konturen nach, als wolle er sie sich für immer einprägen. Clara hatte ihr Gesicht zu seinem erhoben, und als seine Lippen ihre berührten, erwiderte sie seinen Kuss. Sie schlang die Arme um ihn und wollte ihn nicht mehr loslassen – nie mehr.
Erstes Buch:Aufbruch
Kapitel 1
Genf, März 1563
Alle hatten Heinrich geheißen, jeder erstgeborene Sohn in der Familie ihres Mannes. Seit rund drei Jahrhunderten, so bezeugte es die Ahnentafel, die einst ihre Stube geschmückt hatte. Nun lag sie mit einer vergilbten Muschel und dem Rest von Heinrichs Druckwerk in einer Truhe.
Heinrich, so hieß auch ihr Sohn, allerdings erst mit zweitem Namen. Für Clara war es Fügung gewesen, dass er am Geburtstag ihres Lieblingsheiligen zur Welt gekommen war. Schon von Kindheit an verehrte sie den Apostel Jakobus. Seine Statue zierte die sechste Säule im Freiburger Münster; unter seinem steinernen Relief hatten sie geheiratet. Von Gott gesegnet, das bedeutete sein Name, ein Segen, den sie ihrem Sohn zukommen lassen wollte. Deshalb hatten sie mit der Tradition gebrochen und ihn Jakob genannt: Jakob Heinrich Weingarten.
Sie konnte seinen Atem in hellen Wölkchen aufsteigen sehen, so kalt war es in dem Kellergewölbe, in dem sie sich heute Nacht versammelt hatten. Der Geruch von vergorenem Obst schlug ihnen aus den leeren Fässern entgegen, aber das nahmen sie kaum wahr. Sie waren vorsichtig, wählten jedes Mal einen anderen Ort, sofern sie überhaupt eine Zusammenkunft wagten. Allen war bewusst, was sie riskierten. Bei einer Entdeckung drohten mehr als Ausschluss vom Abendmahl oder Verbannung. Im Bannkreis der Stadt Calvins an einer katholischen Messe teilzunehmen, hieß, die Todesstrafe in Kauf zu nehmen.
Den Jungen hatte Clara deshalb so lange wie möglich von allem fern halten wollen. Schlimm genug, dass er als Halbwaise aufwachsen musste, ohne die väterliche Liebe, die er so sehr vermisste. Sie hielt an ihrem Glauben fest, war in Jakobs Gegenwart jedoch zurückhaltend, um ihn nicht zu gefährden. Aber sie hatte die Rechnung ohne ihren Sohn gemacht. Je mehr man vor ihm zu verbergen suchte, umso hellsichtiger schien er zu werden. Dann wurde Clara jedes Mal ängstlich zumute. Denn sie lebten in einer Welt voller Einschränkungen und Verbote.
»Ich weiß längst, wohin du gehst«, hatte Jakob geflüstert, als sie sich aus dem Bett stehlen wollte. »Ich sage nichts. Nicht einmal Suzanne verrate ich ein Wort. Aber ich will mit.«
»Ausgeschlossen! Das ist viel zu gefährlich.« Es kam ihr nicht in den Sinn, zu leugnen. Sie hatte ihren Sohn noch nie angelogen, dazu liebte sie ihn viel zu sehr. »Schlaf weiter, Jakob. Ich bin zurück, bevor es hell ist.«
»Ich möchte mit dir gehen.« Er war aufgestanden, stand zerzaust und mager, aber sehr aufrecht vor ihr. Nicht mehr lange, und er würde sie überragen. Das Mondlicht, das durch das Fenster fiel, ließ sie erkennen, dass er sich vorsorglich in seinen Beinlingen schlafen gelegt hatte. »Außerdem habe ich Vater ebenso wenig vergessen wie du.«
Er behauptete stets, sich genau an Heinrich zu erinnern. Dabei war Jakob beim Tod des Vaters nicht einmal fünf gewesen. Aber ihr Mann lebte unübersehbar in ihm weiter. Sie konnte es sehen an dem dichten Schopf, der die abstehenden Ohren verbarg und dessen Farbe sie an herbstliche Eichenblätter erinnerte. An dem weich geschwungenen Mund. Vor allem jedoch waren es die tiefbraunen Augen, in denen manchmal so viel Wissen lag, dass sie sich abwenden musste.
Vielleicht brachte gerade diese Ähnlichkeit ihren Schwager immer wieder dazu, auf Jakob loszugehen. Jean Belot, verheiratet mit Heinrichs Schwester Margarete, hatte Heinrich stets beneidet. Jetzt, wo er tot war, schien Jean geradezu darauf versessen, Jakob zurechtzustutzen, als könne er sich damit endlich vom Schatten seines Schwagers befreien.
Seit acht Jahren lebten sie nun schon in seinem spitzgiebeligen Haus, das ihr ebenso grau und bedrückend erschien wie ganz Genf, in dem Maître Calvin mit eiserner Faust seinen Gottesstaat errichtet hatte. Clara hatte ihre Entscheidung oftmals bereut, und manchmal war sie sogar überzeugt, mit dem Umzug an die freudlose Rhônestadt den Fehler ihres Lebens begangen zu haben. Aber was hätte sie in jenem kalten Frühling auch anderes tun sollen, als Heinrich plötzlich am Fleckfieber gestorben und sie unter der Zinslast, die für seine neuen Druckerpressen anfiel, schier zusammengebrochen war? So niedergeschlagen war sie gewesen, so kraft- und mutlos, dass sie wie eine Schlafwandlerin durch die Tage taumelte.
Ihre Eltern lebten nicht mehr. Sie hätte einen von Heinrichs Zunftgenossen heiraten müssen, um das Handwerk als Meistergattin weiter auszuüben. Damals wie heute jedoch war ihr der Gedanke, ein anderer könne Heinrichs Platz einnehmen, absurd erschienen. Außerdem hatte Jean sein wahres Wesen schlau zu verbergen gewusst, ihr Trost gespendet und sie so lange beschworen, mit ihm, Margarete, den Töchtern Suzanne und der neugeborenen Hannah zu leben, bis sie schließlich nachgegeben hatte.
Clara hatte nicht einen Augenblick daran gedacht, die neue Religion anzunehmen. Aber sie hatte auch keine Vorstellung davon, was sie in Genf erwarten würde. Und selbst, wenn jemand ihr den Alltag in der Stadt am See beschrieben hätte, so hätte sie es vermutlich als übertrieben abgetan. Alles schien damals so klar und einleuchtend: Die Belots waren die nächsten Verwandten. Außerdem stammten ihre Vorfahren aus dem Elsass und sie verstand leidlich Französisch.
Sie wurde erst stutzig, als Jean schon nach wenigen Wochen das Glaubensbekenntnis nach der Lehre Calvins von ihr forderte, Voraussetzung dafür, vollwertige Bürgerin zu werden. Ihr Entschluss, es vorerst beim Status einer geduldeten Fremden zu belassen, war eine Entscheidung mit Konsequenzen gewesen, wie Clara inzwischen wusste. Denn die Genfer, seit Jahren überflutet von Flüchtlingswellen aus Frankreich und Deutschland, behandelten jeden, der sich nicht ganz zu ihnen bekannte, als Gegner.
Dabei lagen ihr Selbstmitleid und Verzagtheit fern. Selbst im tiefsten Schmerz war Clara eine Frau geblieben, die an ein Morgen glaubte. Heinrich war tot – aber es gab Jakob, für den sie sorgen musste. Zudem war sie erleichtert, die Schulden auf diese Weise abtragen zu können. Die junge Witwe schämte sich nicht dafür. Schließlich war sie nicht mit leeren Händen, sondern mit den neuesten Druckerpressen gekommen, auch wenn heute am liebsten niemand mehr etwas davon wissen wollte: weder Jean, der regelrecht besessen davon schien, Mitglied des Consistoriums zu werden, Rat der zwölf Ältesten und damit verantwortlich für die strengen Zuchtgesetze der Stadt. Noch Margarete, zermürbt von Kindbett und Fehlgeburten.
Es war schlimmer geworden seit dem letzten Herbst. Seitdem es mit dem kleinen Jean endlich den ersehnten männlichen Erben gab, schien Jakob seinem Onkel nur noch im Weg zu sein. Der Junge sprach nicht darüber, aber die oftmals zusammengepressten Lippen ihres Sohns ließen Clara ahnen, wie sehr er litt.
»Dominus vobiscum.«
Jeder von ihnen wusste, warum Pater Laurens so leise sprach.
»Et cum spirito tuo.«
Die kleine Gemeinde antwortete ebenso gedämpft. Nicht einmal ihre Kirchenlieder wagten sie mehr anzustimmen, sondern begnügten sich damit, sie zu summen.
Es waren nur ein paar Gläubige, die sich im Schutz der Nacht in diesem Gewölbe versammelt hatten, das einst als Weinkeller gedient hatte: Manon und ihr Mann Robert, der Müller; Alfonse, dem früher ein Wirtshaus gehört hatte, bevor das Consistorium unter Androhung strengster Strafen jede Art von Vergnügungen verboten hatte. Die Schwestern Simone und Marthe, einst die besten Klöpplerinnen der Stadt, als Kleiderordnungen noch nicht das Tragen von Spitzen untersagten und der Klerus ihr Hauptabnehmer gewesen war; Madeleine und ihr Cousin Philippe, der Bäcker, dazu ein paar andere Frauen und Männer. Und natürlich Mathieu Colbin, der weißblonde Apotheker, der niemals fehlte.
»Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilum et invsibilum ...«
Das Glaubensbekenntnis war nur ein Flüstern, kam aber so andächtig von allen, dass Clara Gänsehaut bekam und unwillkürlich die gewalkte Schaube enger um ihre Schultern zog.
Jakob betete lautlos, mit geschlossenen Augen. Sie musste daran denken, wie oft sie früher ihr Gesicht in sein weiches Kinderhaar gedrückt hatte, um seinen Duft einzuatmen. Jetzt warfen die Wimpern Schatten auf seine schmalen Wangen. So jung sah er aus, so verletzlich, dass eine Welle von Liebe und Angst sie zu überfluten drohte.
Clara musste geseufzt haben, denn Mathieu, wie immer neben ihr, berührte leicht ihren Ellbogen und sah sie fragend an. Sie schüttelte den Kopf, aber es dauerte, bis er den Blick wieder nach vorn richtete, wo der provisorische Altar mit dem Kreuz stand, das Calvin zusammen mit allen Bildern und Skulpturen aus den Genfer Kirchen verbannt hatte.
»Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam ...«
Ja, daran glaube ich, an die heilige, katholische Kirche, dachte Clara, während sie im Chor mit den anderen die vertrauten lateinischen Sätze sprach. Niemand wird mich davon abbringen.
Heinrich, der sein Latein in der Freiburger Domschule gelernt hatte, hatte ihr den Text der Messe übersetzt. Er brachte ihr auch Lesen und Schreiben bei, und ihr wachsendes Interesse an allem Schriftlichen hatte wiederum ihn begeistert und gerührt. Dabei schien es ihm nichts auszumachen, dass die Buchstaben sie foppten und Clara einen regelrechten Kampf mit ihnen auszufechten hatte.
»Du bist eben eine Frau der Tat«, tröstete er sie, als sie wütend einen frisch gedruckten Bogen zu Boden schleuderte, weil die Lettern wüsten Schabernack mit ihr trieben. »Du kannst andere Dinge als ich. Und glaube mir, mein Liebes, die sind kein bisschen weniger wert.«
Viele Stunden hatte sie dabei zugesehen, wie er in der Werkstatt mit seinen Gesellen und Lehrlingen die Schwarze Kunst ausübte: das Einheben der Form, das sorgsame Auftragen der Farben, bis dann endlich das Ziehen beginnen konnte, wie der eigentliche Druckvorgang hieß.
Sie bewunderte den leidenschaftlichen Ernst, mit dem ihr Mann seinem Handwerk nachging, und liebte die Geschicklichkeit seiner Hände. Clara vermisste Heinrich, daran hatte auch die Zeit nichts geändert. Er war noch immer bei ihr. Und jeden Frühling, wenn sein Todestag sich jährte, wurde die Sehnsucht nach ihm unerträglicher. Nicht einmal ihr Garten unten am See, der sie sonst für so vieles entschädigte, konnte sie dann davon ablenken.
Tränen liefen über ihre Wangen, als sie die Hostie empfing, und als sie wieder an ihren Platz zurückkehrte, bemerkte Clara, dass auch die Augen der anderen feucht geworden waren. Wenigstens sah Jakob gelöster aus, nachdem der Priester sie mit seinem Segen entlassen hatte.
Sie umarmten sich, bevor sie die kleinen Boote bestiegen. Sie ruderten mit Abstand und legten an verschiedenen Stellen an. Sich irgendwo in Genf zu versammeln, wagten sie nicht mehr, seitdem man Marcel erwischt und Hostien bei ihm gefunden hatte. Zwar hatten in der Fragstatt weder Eiserne Jungfrau noch Spanischer Stiefel den jungen Advokaten zum Reden gebracht, aber er hatte die Tortur nicht überlebt. Mit fatalen Konsequenzen, denn nun mussten sie damit rechnen, dass man beim nächsten Fall noch grausamer vorgehen würde.
Calvins Gott will nicht gefeiert sein, dachte Clara, während sie sich auf die Holzbank setzte. Auch nicht geliebt, sondern nur gefürchtet. Er scheint es für Überheblichkeit zu halten, wenn wir Menschen versuchen, uns ihm in Ekstase zu nähern, anstatt ihm ehrfürchtig von fern zu dienen. Mein Gott aber ist gütig und lebt in meinem Herzen und in dem meines Sohnes.
»Wann kommst du nun endlich in die Apotheke?«, fragte Mathieu Colbin, früher von allen Maître Colbin genannt. Jetzt freilich stand der Ehrentitel nur noch Calvin zu; ihn unrechtmäßig zu verwenden, konnte Kerkerhaft bedeuten. »Michel wird mir mit seiner Langsamkeit allmählich unerträglich, und hören tut er auch immer schlechter. Ich könnte einen neuen, tüchtigen Lehrling gut gebrauchen.«
Jakob versuchte einen Einwand, aber er ließ ihn nicht ausreden.
»Ich weiß doch, wie viel deine Mutter dir von ihrem Kräuterwissen schon beigebracht hat.«
Im Mondschein sah Clara, wie Jakob freudig errötete. Und dennoch wusste sie schon im Voraus, was er erwidern würde.
»Ich will aber Drucker werden«, sagte er. »Wie mein Vater.«
Mathieu Colbin war ein geübter Ruderer. Gleichmäßig glitten die Hölzer in den nachtdunklen See. Clara spürte trotzdem, wie angespannt er war.
»Ihr hättet es beide besser bei mir«, sagte der Apotheker nach einer Weile. »Um vieles besser. Wieso zögert ihr?«
»Ich danke dir, Mathieu«, sagte sie leise. »Aber du kennst die Antwort. Lass uns nicht immer wieder davon anfangen.«
Er schien in sich zusammenzusinken. Dann wandte er sich jäh zu Jakob um. »Drucker willst du werden? Glaubst du wirklich, das wird er zulassen – jetzt, wo er endlich einen eigenen Sohn hat?«
»Ich weiß nicht«, sagte Jakob. »Die Pressen meines Vaters sind genau betrachtet doch nur eine Leihgabe. Vielleicht, wenn ich ...«
»Belot wird nicht ruhen, bis ihm alles gehört. Und dann gnade euch Gott. Denn der Gott, zu dem er betet, kennt keinerlei Gnade.«
Der Tonfall verriet, wie verzweifelt Mathieu war.
»Ich weiß nicht, wie lange wir noch so weitermachen können«, flüsterte er. »Dieser Druck. Die ständige Angst. Und niemals Zeit, auszuruhen. Sogar in den römischen Katakomben haben die Christen schon Ostern und Weihnachten gefeiert – und was tut er? Calvin hat alle Heiligenfeste gestrichen, alle altvertrauten Gebräuche verboten. Was, wenn ich nicht stark genug bin, um auf Dauer dagegenzuhalten? Ich, ein Einzelner, ohne Frau an meiner Seite, ohne Familie?«
»Du hast uns«, sagte sie sanft. »Und du hast Gott. Vergiss das nicht.«
»Wozu das alles, Clara, sag mir, wozu, wenn du doch niemals mit mir leben wirst?«
Der Nebel, der tief über dem See gehangen hatte, lichtete sich, als sie sich dem Ufer näherten. Die Äste der großen Bäume waren noch kahl, aber es konnte nicht mehr lange dauern, bis das erste Grün sich zeigen würde.
»Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass deine Seele bitter wird«, sagte sie. »Such dir eine andere, Mathieu. Eine, die dich lieben kann. Du brauchst eine Frau. Aber nicht mich, ich bin die Falsche.«
»Nein, du bist die Einzige«, flüsterte er, ohne jede Scham vor Jakob, der bislang schweigend zugehört hatte. »Ich will keine andere – niemals!«
»Sie kann nicht, Mathieu«, sagte der Junge jetzt. »Spürst du das nicht? Quäl sie nicht länger.«
Clara warf ihm einen besorgten Blick zu. Ich bürde ihm zu viel auf, dachte sie nicht zum ersten Mal.
Vielleicht gab es doch eine Möglichkeit, nach Freiburg zurückzukehren, wenn sie nur gründlich genug darüber nachdachte. In Jeans Werkstatt wurden auf den Pressen des Verstorbenen viele von Calvins Traktaten gedruckt, die weit über die Grenzen Genfs hinaus Absatz fanden. Die Einnahmen stiegen von Jahr zu Jahr, während die Schulden schmolzen. Allerdings hatte sie die Bücher schon ziemlich lang nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber es gab diese Abmachung zwischen ihnen, und sie war überzeugt, dass nicht einmal er sie anzutasten wagte: die Nutzung der Pressen gegen eine Beteiligung am Gewinn.
Jeans Gegenwart im Tausch gegen Jakobs Zukunft.
Sie war so tief in Gedanken, dass sie erschrak, als sie wieder festen Boden unter dem Kiel spürte. Mathieu blieb sitzen, als sei er zu kraftlos, um aufzustehen.
»Und du bist dir wirklich sicher, Clara?«, sagte er. »Nicht die kleinste Hoffnung für mich?«
»Ich glaube, meine Schwägerin weiß sehr genau, was sie tut.« Drei Köpfe flogen zu der storchenbeinigen Gestalt im dunklen Umhang, die am Ufer auf sie gewartet hatte. Jean Belots Stimme war kalt. »Manchmal vielleicht sogar zu genau. Ich hoffe nur, sie hat auch jetzt eine plausible Erklärung parat, was sie mitten in der Nacht mit dir auf dem See zu schaffen hat. Und das in Gegenwart meines Neffen.«
Clara erhob sich und strich den Rock glatt. Ihr Herz zog sich zusammen, aber es gelang ihr, ruhig zu antworten.
»Die Kleine von Marie Essertine ist endlich zur Welt gekommen«, sagte sie. »Drüben in Pregny.« Jeans Blick glitt zu ihrem Kräuterkorb, das Alibi, ohne das sie wohlweislich zu keiner der heimlichen Messen aufbrach. »Wir waren keinen Augenblick zu früh. Ohne Mathieu hätte es übel für Mutter und Kind ausgehen können.«
»Und mein Neffe?«, sagte Jean barsch. Eine Windböe fuhr in seinen zotteligen Vollbart, mit dem er selbst äußerlich seinem verehrten Vorbild Calvin nacheiferte. »Was hat Jakob ausgerechnet in einer Wöchnerinnenstube zu suchen?«
»Hast du schon vergessen, dass Maries Mann vor drei Monaten vom Baugerüst in St. Pierre zu Tode gestürzt ist?« Allmählich verebbte das Zittern ihrer Knie. Marie hatte tatsächlich eine Tochter entbunden, allerdings früher und ohne ihre Hilfe. Aber sie besuchte wie Clara heimlich die katholische Messe und würde jedes ihrer Worte bestätigen. »Jakob hat auf ihre kleinen Söhne aufgepasst, während wir das Kind geholt haben.«
»Du wirst noch eine Memme aus ihm machen«, erwiderte Jean missmutig, weil er ahnte, dass sie wieder einmal das letzte Wort behalten würde. »Aber ohne mich. Ich werde das zu verhindern wissen. Damit musst du rechnen.«
»Tod und Leben gehören zusammen, Jean«, sagte sie. »Wir beide wissen es, und kein Kind kann es früh genug lernen. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Ich bin so müde, dass ich fast im Stehen einschlafe.«
*
Er schlich sich zum Großvater, wie so oft. Jakob war gern bei ihm, auch wenn der Junge sich nicht sicher war, ob er ihn überhaupt bemerkte. Es störte ihn nicht, dass er seine Augen meistens geschlossen hatte und es nach Alter und Krankheit roch. Für Jakob war die stickige Kammer eine Zuflucht.
Vorsichtig legte er seine Hand auf die runzlige mit den unzähligen braunen Flecken, die sich wie mürbes Pergament anfühlte. Die Haut war warm und schien seine Berührung zu mögen. Jeans Vater hatte wegen seines Zitterns schon jahrelang nicht mehr als Goldschmied arbeiten können, aber es gab im Haushalt der Belots noch ein paar Beweise seiner einstigen Kunstfertigkeit: Becher aus getriebenem Silber, die keiner mehr benutzte, ein paar Broschen mit bunten Edelsteinen, die niemand mehr tragen durfte, weil sie nun als teuflischer Tand verpönt waren.
Sonst war meist nur Stöhnen zu hören, heute jedoch schlug der Alte die Augen auf. Klar und wasserblau sahen sie ihn an.
»Er war wieder da«, sagte er leise. »Die halbe Nacht. Bis es hell wurde. Ich glaube, jetzt ist es bald so weit.«
Jakob verstand, was er meinte. Auch am Bett seines Vaters hatte er damals eine Gestalt gesehen, über ihn gebeugt, als wolle sie ihn halten. Manchmal träumte er davon, diese Umarmung zu spüren. Ein weiches, schwereloses Gefühl, als versinke man in tiefem Wasser.
»Er kommt als Trost«, sagte er. »Du musst keine Angst haben. Er bleibt bei dir – bis zuletzt.«
»Ich habe Singen gehört. Dann Rauschen.« Es war schwer, ihn richtig zu verstehen, denn der alte Mann hatte die meisten seiner Zähne verloren. »Und ich habe Weihrauch gerochen. Wie früher in der Kathedrale. Als alles noch so feierlich lateinisch war.«
Die Hand wurde rastlos. Jakob gab sie frei, und jetzt zitterten die Finger über die Decke, als müssten sie etwas wegwischen.
»Sie hätten nicht alles verbieten sollen. Nicht den Weihrauch und nicht die Musik.« Der Atem ging rasselnd. »Wie sollen die Menschen sonst Frieden finden? Ich sehne mich so sehr danach.«
Die Hand fuhr zu seiner Brust. Unter der Decke schlugen die mageren Beine aneinander wie in einem grotesken Tanz.
»Spürst du wieder die Dornen im Herzen?«, fragte Jakob. »Soll ich dir etwas von Mutters Kräuteraufguss geben, damit die Enge weggeht?«
Clara hatte eine Tinktur aus Borretschblättern und Nieswurz zubereitet, die herzstärkend wirkte, wie sie Jakob erklärt hatte, und dem Alten gut bekam.
»Keine Dornen. Ich bin nur müde. Unendlich müde.« Die Lider flatterten und fielen schließlich ganz zu.
Es wurde still in der Kammer.
»Du siehst ihn?«, murmelte der Großvater, als Jakob schon dachte, er sei eingeschlafen. »Du kannst ihn tatsächlich sehen?«
»Manchmal«, sagte Jakob. »Damals bei Vater. Und neulich, als der kleine Jean so stark gefiebert hat. Er stand neben seiner Wiege und hat ihn gestreichelt.«
»Er wird verrückt, wenn er seinen Sohn verliert«, sagte der Großvater überraschend deutlich. »Jean trägt den Krieg im Herzen. Du musst dich vor ihm hüten.«
»Das versuche ich ja. Aber es ist so viel Zorn in ihm. Warum hasst er mich? Warum tut er mir all die hässlichen Dinge an?«
»Weil du ...« Dumpfes Röcheln. »Weil er nicht wie ...« Der schlaffe, blutleere Mund stand offen. Speichel lief über sein Kinn.
Die Tür sprang auf. Celine, die Magd, brachte die Morgensuppe, frische Windeln und einen Krug mit Wasser. Margarete folgte ihr. Sie runzelte die Stirn, als sie ihren Neffen sah.
»Was hast du dauernd hier zu suchen? Du regst ihn bloß wieder auf«, sagte sie säuerlich, als er sich erhob, um Platz zu machen. »Als hätte ich nicht schon genug am Hals!«
Neben der Magd mit den bräunlichen Wangen und dem Zopf, der sich wie eine dunkle Schlange bis zum Gesäß ringelte, wirkte sie blass. Der Wollstoff, aus dem die schlichten Frauenkleider zu sein hatten, spannte über ihrem Bauch, als sei sie noch oder bereits wieder schwanger. Nur zu Hause durften die Frauen die gestärkte Haube ablegen, doch ihr flachsblondes Haar war keine Zierde, sondern klebte wie feuchte Federn am Kopf Auf der linken Brust prangte ein Milchfleck. Margarete lamentierte ständig, wie schlecht der Kleine trank und welche Pein das Stillen ihr bereitete. Aber Jean hatte ihr verboten, den Jungen zu einer Amme zu geben, und auf Kuhmilch reagierte der Säugling mit Geschrei und Koliken.
Der Großvater drehte den Kopf zur Seite, als Celine ihn füttern wollte.
»Er will nicht«, sagte sie anklagend zu Margarete. »Es liegt nicht an mir. Du siehst selbst, wie störrisch er ist.«
»Wie sollst du denn wieder zu Kräften kommen, wenn du nicht essen willst?« Margaretes Tonfall war süßlich, Jakob aber entging die Schärfe nicht, die darunter lag. Sie setzte sich ans Bett und griff nach seiner Hand, der alte Mann jedoch versteckte sie unter der Decke. »Du musst essen, bitte! Schon deinen Enkeln zuliebe.«
»Später«, murmelte der Großvater. »Vielleicht. Wenn Clara ... Clara soll ...«
»Clara! Immer nur Clara!« Jähe Röte schoss in ihre Wangen. »Was kann sie dir schon geben, was ich nicht kann?« Sie versetzte der Tonkanne einen zornigen Stoß. »Ihre Zauberkräuter werden dich noch ins Grab bringen. Aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Meine Kinder rührt sie jedenfalls nicht an!«
Für einen Augenblick schien sie Jakobs Anwesenheit ganz vergessen zu haben. Der Junge stand an der Tür mit hochgezogenen Schultern. Sein Blick war mitleidig.
»Und du brauchst mich gar nicht so anzuglotzen!«, fuhr sie ihn an. Ihre blassen Lippen zitterten. »Ihr bildet euch ein, etwas Besseres zu sein, du und deine Mutter, aber da irrt ihr euch. Geht doch zurück in euer Pfaffen-Freiburg – von mir aus lieber heute als morgen. Ich bin froh, wenn ich keinen von euch mehr sehen muss.«
Sie brach in wildes Schluchzen aus.
Jakob machte vorsichtig einen Schritt auf sie zu und noch einen, bis er nah genug war, um ihren dünnen Arm zu berühren, während die Magd angestrengt zu Boden starrte.
»Das hab ich nicht so gemeint«, sagte Margarete schließlich und wischte sich die Augen trocken. Ihr Gesicht war noch fleckiger geworden. »Manchmal weiß ich einfach nicht mehr weiter. Meine Kopfschmerzen. Die Kälte. Hannahs Schnupfen. Suzanne, die niemals hören will. Und wenn jetzt auch noch der Großvater stirbt ...«
»Er stirbt nicht«, sagte Jakob leise. »Noch nicht.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil der Todesengel ihn sonst nicht verlassen hätte«, entgegnete Jakob. »Er bleibt bei den Sterbenden. So lange, bis sie beim Himmlischen Vater sind.«
Celine schlug ein hastiges Kreuzzeichen.
»Ich hab dir ja gesagt, welch gotteslästerliche Reden er führt«, sagte sie zu Margarete. »Wenn das der Herr hört, wird er sehr wütend werden. Aber er muss es doch wissen! Und auch, dass Clara wieder Fenchelsamen auf ihren Kammerboden gestreut hat, um die Dämonen zu vertreiben. Von ihren Teufelsnesseln ganz zu schweigen, die sie mir vor ein paar Tagen ins Gesicht geschlagen hat. Ich werd es ihm sagen, wenn er zum Essen nach Hause kommt.«
»Hat Clara dir das beigebracht?«, sagte Margarete zu Jakob, ohne auf Celines Lamento einzugehen. »Und versuch bloß nicht, mich anzulügen!«
»Mutter? Nein. Sie sieht ihn nicht. Außerdem weißt du, dass ich nicht lüge.«
»Mach, dass du endlich in die Schule kommst.« Margarete gab ihm einen hilflosen Stups. »Sobald du zurück bist, hilfst du beim Holzmachen. Bei dieser Kälte brauchen wir neue Vorräte.«
Der Junge schien erleichtert, endlich verschwinden zu können.
»Und du hörst auf, vorlaute Reden zu führen«, herrschte sie Celine an. »Mach dich an die Arbeit und wasch den Großvater! In diesem Haus bestimme immer noch ich, was mein Mann zu hören bekommt, verstanden?«
Der Alte bäumte sich auf bei ihren Worten, zitterte stärker und begann Schleim zu spucken. Margarete beugte sich über ihn. Sie sah den kalten Blick nicht, den die Magd ihr zuwarf.
*
Der Kompost war gut gelungen. Die Feuchtigkeit des Seeklimas hatte Astern und robuste Springkrautstängel verrotten lassen. Auf diese Unterlage hatte Clara eine Heuschicht, dann Blätter, Gräser und feinere Pflanzen geschichtet. Dazu Hühnermist aufgehäuft und die Küchenabfälle schichtweise mit Erde und Sand bedeckt. Jetzt war es Zeit, die Beete zu düngen, um neues Wachstum anzuregen.
Ihren Garten schlossen keine Mauern ein, sondern ihn umgab ein lebendiger Zaun aus Schlehe, Weißdorn und Holler, der sich zunächst selbstständig angesiedelt hatte. Die Beeren bereicherten als Mus den Speiseplan oder ließen sich zu Wein weiterverarbeiten; Rinde, Wurzeln und Blätter halfen gegen verschiedenartige Leiden.
Jedes Jahr gab es eine regelrechte Invasion von Unkraut: Löwenzahn, den sie im Frühling gerne aß, Butterblumen und Kletten. Sie hatte auf dem kleinen Grundstück in Seenähe aber auch Beete angelegt, in denen Küchenkräuter gediehen. Ihre besondere Liebe freilich galt den Heilpflanzen, von denen sie Salbei, Rosmarin und Wermut besonders schätzte. Beinahe abergläubisch, fühlte sie sich aufgefordert, zu hegen und zu pflegen, was sich ansiedeln wollte. Was wachsen will, soll wachsen, so ihre Devise.
Ihr Kräuterwissen basierte nicht allein auf praktischer Erfahrung. Eines der Bücher aus Heinrichs Druckerei war der »Gart der Gesundheit« eines Frankfurter Arztes, in dem Clara Jakob immer wieder nachschlagen ließ, weil das Lesen ihr Mühe machte. Sie hegte das einzige Exemplar, das ihr geblieben war, und hatte sogar gezögert, es dem Apotheker auszuleihen.
Manchmal schämte sie sich beinahe dafür, wie viel Vergnügen ihr diese Arbeit bereitete, und sie hütete sich, den anderen davon allzu viel vorzuschwärmen. Schon genug, dass Jean und Margarete sie scheel musterten, wenn sie spät am Abend zurückkehrte und die Sonne ihre helle Haut verbrannt hatte. Zum Glück hatte Calvin vor einiger Zeit in einer seiner Predigten die menschliche Seele mit einem Garten verglichen, den man pflegen und sauber halten müsse. Seitdem war es etwas einfacher für sie geworden.
Sicherlich war auch nicht unwesentlich, dass Clara ihre Ernte großzügig teilte. Ihre Kräuter würzten den vorgeschriebenen Eintopf, ihre Kompotte waren vor allem im Winter eine willkommene Abwechslung, und nicht einmal jetzt, da der Frühling sich bereits ankündigte, schmeckte das Kraut bei den Belots so muffig wie in anderen Haushalten, weil sie es auf spezielle Weise eingelegt hatte.
Jakob ging ihr gelegentlich zur Hand. Aber auch die kleine Hannah und besonders ihre ältere Schwester Suzanne kamen, wann immer Gelegenheit dazu war, in den Garten, wenngleich Jean es nicht gern sah.
Seit dem letzten Sommer hatte sie noch einen weiteren Helfer, erst als Zaungast, schließlich aber, weil sein stummes Gaffen ihr lästig geworden war, als tüchtigen Handlanger: den krumpen Görgl, der sich nur hinkend bewegen konnte, weil sein linkes Bein nach einem Bruch verkrüppelt geblieben war. Eines Tages war der verwahrloste, geistig zurückgebliebene Junge von irgendwoher aus dem Alemannischen in Genf aufgetaucht, Waise, wie er beteuerte, um vom Bettel zu leben, weil er nicht mehr Heu, sondern lieber Brot essen wolle.
Man hatte Görgl eingesperrt, später der Stadt verwiesen, und abermals eingesperrt, er aber war unverdrossen immer wieder erschienen. Er war zwar auch jetzt noch klapperdürr, aber erstaunlich kräftig, mit wilden, dunklen Brauen in einem Gesicht, das aussah, als sei ein Gewitter hineingefahren; seinen Lebensunterhalt bestritt er inzwischen als Gehilfe des Scharfrichters, vor allem war er mit dem schmutzigen Gewerbe des Abdeckers befasst.
Der Henkergörgl, wie die Kinder ihn boshaft nannten, schien nur darauf gewartet zu haben, dass Clara ihre Gartenarbeit wieder aufnahm. Sie nahm an, dass der Scharfrichter ihn irgendwo in seinem Haus am Stadtrand unterbrachte, aber es war bestimmt nur eine sehr einfache Unterkunft, denn er stank nach Schmutz und alten Lumpen.
»Kann den Mist für dich rühren«, rief er. »Görgl macht’s Stinken nix aus.«
Sie wies ihn an, den Kompost zu lockern und zu belüften, während sie die trockenen Triebe ihrer mehrjährigen Gewürze entfernte. Für die Aussaat neuer Kräuter war es noch zu kühl. Aber am kommenden Freitag war Markttag, und sie hoffte, dass die Bauern aus dem benachbarten Frankreich reichlich Petersilien-, Kerbel- und Dillsamen mitbringen würden.
Als Nächstes wandte sie sich ihren Sträuchern zu. Es war Clara eine Freude, die toten Zweige abzuschneiden. Sie konnte den Anblick der neuen Knospen kurz vor dem Aufspringen kaum noch erwarten. In einer windgeschützten Ecke stand ihr ganzer Stolz. Zärtlich strich sie über seinen schlanken Stamm. Nichts kam ihrer Fantasie vom Paradies so nah wie ein blühender Kirschbaum.
»Wo ist Jakob?«, fragte Görgl, als sie ihn später mit Most, Brot und Pflaumenmus belohnte, das verblüffend schnell zwischen seinen schiefen Zähnen verschwand. Die meisten grauten sich vor dem, was er zu tun hatte, aber ihr tat er irgendwie Leid. Clara gehörte auch zu den wenigen, die nicht wegsahen, wenn Rossin, der Scharfrichter, sie grüßte, ein großer, leicht gebückter Mann mit schweren Lidern. »Hab ihn lange nicht gesehen!«
»In der Schule«, sagte sie ausweichend. Sie hatte Jakob angewiesen, Görgl nicht zu verspotten, wie die anderen Kinder es taten, aber sie hielt auch nichts davon, dass die beiden zusammensteckten.
»Und das schöne Mädchen mit den gelben Haaren?«, sagte er versonnen.
»Zu Hause. Bei ihrer Mutter«, erwiderte sie noch vorsichtiger.
Sie hatte sofort verstanden, wen er meinte: ihre Nichte Suzanne, die vor kurzem dreizehn geworden und ebenso hübsch zu werden versprach, wie einst Margarete es gewesen war. Das Schönste an Suzanne waren die veilchenfarbenen Augen, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, die die Welt aber nicht feindselig, sondern voller Neugierde betrachteten. Jakob und sie waren so unzertrennlich, dass die kleine Hannah manchmal vor Eifersucht weinte.
Es war ein kristallblauer Märztag. Die Sonne wärmte ihren Rücken. Über dem See kreisten Vögel. Clara beschloss, Seidelbast zu pflanzen und noch ein paar Rosen, weil sie den Duft so liebte. Bald würden die Geißblattsträucher ausschlagen und das erste Frühlingsgrün liefern. Dann konnten sie auch endlich wieder Brennnesselsuppe und Bärlauchgemüse kochen. Sie sehnte das Ende von Sauerkraut und wurmstichigen Äpfeln herbei. Clara konnte fast schwermütig werden, wenn die Erde in Schnee gehüllt war, besonders an bleigrauen Tagen. Dann verschmolzen Himmel und See, und sogar die Nadelbäume wirkten schwarz, als sei alle Farbe aus der Welt entschwunden.
»Görgl möcht sie wieder sehen«, dröhnte er in ihre Überlegungen hinein. »Das schöne, gelbe Mädchen. Görgl freut sich.«
»Das lässt du besser bleiben«, sagte Clara, jäh aus ihren Tagträumen gerissen. »Suzanne ist noch ein Kind. Und mein Schwager, ihr Vater, ist sehr, sehr streng.«
»Nein, großes, schönes Mädchen«, beharrte er. »Görgl Sehnsucht. Große Sehnsucht!«
»Schlag dir das aus dem Kopf.« Claras Ton wurde schärfer. »Du lässt sie in Ruhe. Verstanden?«
Er senkte den Kopf. Seine Füße waren schmutzstarrend und unförmig. Claras Blick glitt weiter zu seinen Händen, dann zu den Schultern, über denen der grobe Stoff spannte, schließlich weiter zu seinem Gesicht. Er war längst kein Junge mehr. Vielleicht musste sie deutlicher werden. Sie wollte ihm nicht wehtun, aber sie war sich nie ganz sicher, was sein bisschen Verstand umriss.
»Hör zu, Görgl, du kennst doch die Leute hier. Am eigenen Leib hast du gespürt, wozu sie fähig sind. Willst du etwa wieder in den Kerker oder eines Tages selbst am Galgen landen?«
Kopfschütteln.
Sie war erleichtert. Er schien zu begreifen, gottlob.
»Also tu bitte, was ich sage, und halte dich von dem Mädchen fern. Sonst wirst du ...«
»Görgl hat dich auch gesehen«, fiel er ihr ins Wort. »Und den Weißen. In der Nacht. Wasser. Boote. Viele Boote. Über den See.«
Der Garten schien sich enger um sie zu schließen.
»Was hast du gesehen?«, fragte sie leise.
Seine plumpen Finger zeichneten ein Kreuz in die Luft. Dann brachte er einen seltsamen Laut hervor, der ein verunglücktes »salve« sein mochte.
»Lieder gesungen. Priester gesegnet. Im Keller. Alter Weinkeller.«
Ihr Körper fühlte sich taub an, nur ihr Verstand schien noch zu funktionieren, wie eine präzise, saubere Mechanik.
»Du musst dich irren.« Die eigene Stimme kam ihr ganz fremd vor. »Ich weiß genau, dass du dich irrst, Görgl!«
»Nein. Görgl hat dich gesehen. Dich und den Weißen.« Er fing an, sich zu gebärden, als liefen Feuerameisen unter seinen Achseln. »Görgl still, ganz still. Aber das Mädchen. Görgl will Mädchen – Mädchen!«
Er versuchte, sie zu erpressen!
Clara spürte, wie sie zornig wurde. Aber Görgl war so laut geworden, dass sie Angst bekam. Sie musste ihn zur Ruhe bringen, zu viel stand für alle auf dem Spiel.
»Vielleicht kommt Suzanne ja irgendwann in den Garten.« Es fiel ihr schwer, den Köder auszulegen, denn sie wusste, was sie damit riskierte. »Aber du musst Geduld haben. Das hängt nicht von mir ab.«
Heftiges Nicken. Dann verdrehte er seine Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war.
»Görgl Geheimnis«, stieß er prahlerisch hervor. »Görgl stark. Görgl hat mit dem Deifi getanzt.«
Sie legte einen Finger auf ihre Lippen und musterte ihn streng.
»So etwas darfst du nicht sagen. Niemals! Damit bringst du dich in große Gefahr. Hast du das verstanden?«
»Aber Görgl kann Ferkel machen«, sagte er kleinlauter. »Weiße und rote. Willst sehen?«
»Ich hab jetzt endgültig genug von deinem Unsinn. Und du gehst auch besser nach Hause. Kannst wiederkommen, wenn du klar im Kopf bist.«
Clara nahm Schaufel und Hacke, um sie in dem kleinen Schuppen zu verstauen, er aber packte so fest ihren Arm, dass sie aufschrie und das Werkzeug fallen ließ.
»Görgl kann Ferkel machen«, wiederholte er. »Hat der Deifi ihm gezeigt. Schwarzer Mann. Und kalt!«
»Was hab ich dir eben gesagt?«, fuhr sie ihn an. »Willst du unbedingt auf dem Scheiterhaufen landen? Also halt deinen Mund, beim gütigen Gott! Versprichst du mir das?«
Seine Züge entspannten sich, der Blick wurde wieder klarer.
»Heim«, murmelte er. »Görgl will heim.«
»Ja«, sagte sie. »So ist es gut. Du musst dich nicht aufregen. Geh heim und ruh dich aus. Ich back dir einen schönen Kuchen. Mit Honig und Rosinen. Und du hältst, was du mir versprochen hast. Kein Wort – zu niemandem!«
Er strahlte sie an und nickte eifrig. Dann humpelte er davon.
Clara lehnte sich gegen den Kirschbaum, als er außer Sicht war. Die Taubheit wich allmählich aus ihren Gliedern, aber ihr Herz schlug noch immer viel zu schnell.
*
Die Brotsuppe war hoffnungslos versalzen, aber Jean tat so, als ob nichts daran zu beanstanden wäre. Lustlos tauchte Clara ihren Holzlöffel in die große Schüssel in der Tischmitte. Am liebsten wäre sie aufgestanden und aus dem Haus gelaufen, aber sie musste das verhasste gemeinsame Abendessen noch durchstehen.
Den anderen schien es ebenso wenig zu schmecken. Hannah aß wie ein Vögelchen, Jakob verzog bei jedem Bissen das Gesicht, und Suzanne lächelte angestrengt, wie jedes Mal, wenn Streit in der Luft lag. Jean hatte das Tischgebet mit bleierner Stimme gesprochen. Seitdem schwieg er, fuhr mit seinem Löffel in die Suppe, dass es spritzte, und kaute und schluckte mit wütender Verbissenheit.
Schließlich schob Clara den Stuhl zurück und stand auf.
»Wir essen«, knurrte der Schwager sie an. Seine Augen waren im Schein der Talgfunzel gewitterblau. »Ist das deine Dankbarkeit für die Nahrung, die der Herr uns in seiner Gnade gewährt hat?«
Claras Übelkeit verstärkte sich. Es war wie immer übertrieben eingeheizt, das Einzige, woran Jean niemals sparte. Dazu kam der Gestank nach verbranntem Tierfett, der aus der Schale quoll. Wie sehnte sie sich nach dem Duft der Wachskerzen, in deren Schein sie Abend für Abend mit Heinrich gesessen hatte! Aber sie verlor kein Wort darüber, weil Jean sonst unweigerlich wieder eine seiner Tiraden über die verderbte Eitelkeit einer Metsiedertochter losgelassen hätte.
Stattdessen ging sie schweigend hinaus und kam mit einem kleinen Tongefäß zurück.
»Getrocknete Petersilie.« Sie streute etwas davon in die Suppe. »Jetzt wird sie genießbarer.«
Die Mädchen nickten erleichtert, nachdem sie gekostet hatten, und selbst Margarete griff herzhafter zu. Jean dagegen schien den Appetit verloren zu haben.
»Ich mag deine Kräuter nicht«, sagte er mit drohendem Unterton. »Und noch weniger mag ich, was du damit tust.«
»Geht es vielleicht etwas genauer?«, fragte sie.
Jeans Unterlippe zuckte, wie stets, wenn einer seiner Ausbrüche drohte. Bei seiner Heirat mit Margarete war er stattlich gewesen, ein großer Mann mit kühner, fleischloser Nase und Augen, die keiner vergaß. Jetzt sah er mit seinem räudigen Bart und den eingefallenen Wangen wie eine schlechte Kopie Calvins aus.
»Du bestreust den Fußboden mit Hexenkörnern und benützt Teufelsnesseln, um ...«
»Wanzen und Läuse mögen Fenchelsamen nun einmal nicht besonders«, erwiderte sie. »In ein paar Wochen, wenn es warm und trocken ist, können wir das Stroh lüften und neu aufschütten, aber bis dahin müssen wir uns anders behelfen. Und getrocknete Schafgarbe stillt Jakobs Nasenbluten am besten. Du hast mit Celine gesprochen, nicht wahr? Sie ist wieder mal deine Quelle.« Sie machte eine müde Geste. »Dann hätte sie dir aber auch verraten sollen, dass ich mich strikt geweigert habe, ihr die Zukunft vorauszusagen. Weil ich die Zukunft nämlich nicht kenne.«
Ärgerlich schüttelte er den Kopf.
»Du sprichst mit Bäumen, und du beschneidest nachts deine Kräuter«, beharrte er.
Sie fühlte seinen bohrenden Blick auf ihrem Ring und dachte einen Augenblick sogar daran, die auffallenden Steine nach innen zu drehen. Aber sie tat es nicht. Der Ring war Heinrichs Geschenk; sie trug ihn als Erinnerung an ihren toten Mann.
»Du bist wunderlich, Schwägerin. Manche meinen sogar, mehr als das. Du meidest die Rechtschaffenen und gibst dich mit Gesindel ab. Es gibt Gerede. Das missfällt mir.«
»Lass sie reden.« Sie gab sich alle Mühe, ihren Unmut nicht sichtbar werden zu lassen. »Ich weiß, dass ich nichts Unrechtes tue, und du weißt es auch, Jean.«
»Hast du vergessen, dass ich dich aufgenommen habe – und deinen Sohn?«, sagte er drohend.
»Wie könnte ich das«, erwiderte sie nicht ohne Schärfe. »Es vergeht ja kaum ein Tag, an dem du uns nicht daran erinnerst.«
»Du lebst in meinem Haus, das allen ein Vorbild sein soll. Außerdem besagt die Schrift, dass der Mensch ein Knecht der Sünde ist. Und ein mit Sünde gefülltes Herz kann nichts als die Früchte der Sünde hervorbringen.«
Clara wusste, worauf er es anlegte: dass sie in Tränen ausbrach und ihm demütig zustimmte. Aber sie brachte das Weinen und die erzwungene Reue nicht über sich – nicht an diesem Abend. Alles in ihr schien zu vibrieren, so unruhig war sie. Ihr Kopf glühte, und in ihrem Leib verspürte sie ein Brennen. Wenn sie nicht bald eine Möglichkeit fand, mit Mathieu zu sprechen, konnte es vielleicht zu spät sein.
»Warum so streng, Schwager? So unduldsam? Ist Jesus nicht für unsere Sünden gestorben?«, sagte sie, mühsam beherrscht. »Der Sohn Gottes hat uns vergeben. Also sollten wir uns auch vergeben.«
»Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen!« Jean war wütend aufgesprungen. »Damit versündigst du dich gegen das dritte Gebot. Sein heiliger Name darf durch nichts und niemanden beschmutzt werden.«
Die Kinder starrten ihn erschrocken an, sogar Margarete war noch blasser geworden.
»Ich habe Gott noch nie gelästert.« Clara betonte jedes Wort. »Ich diene ihm auf meine Weise, mit meinem Herzen, meiner Seele – und meiner Arbeit.« Sie nahm ihren Mut zusammen. »Deshalb muss ich jetzt auch zu Colbin. Der Großvater hat Schmerzen. Er braucht dringend neue Medizin.«
»Jetzt?«, murrte Jean.
»Warum nicht ich?«, bot Suzanne eilfertig an. Ihr dreieckiges Gesicht war rosig geworden, so strengte sie sich an, gute Stimmung zu machen. »Ich würde so gern etwas für ihn tun.«
»Kommt nicht in Frage«, sagten Jean und Clara wie aus einem Mund.
Er rang sich zu keinem Lächeln durch, aber sie bemerkte doch, wie seine Miene sich kurz entspannte. Hätte er gewusst, woran sie dachte, er hätte nur noch grimmiger dreingesehen. Allein die Vorstellung, der krumpe Görgl lauere womöglich irgendwo im Schutz der Dunkelheit auf das Mädchen, bereitete ihr großes Unbehagen.
»Aber ich könnte doch gehen, Mutter«, sagte Jakob und sah sie bittend an. »Du musst müde sein, und mir macht es nichts aus. Wirklich nicht!«
»Nein, das erledige ich selbst«, sagte sie abschließend. »Der Großvater soll doch eine ruhige Nacht haben.«
Sie nickte ihrem Sohn aufmunternd zu, der seltsamerweise bei ihren Worten den Kopf senkte und auf den Tisch starrte.
»Dann tu es meinethalben, wenn es wirklich so dringend ist«, sagte Jean. »Aber sorg dafür, dass es nicht wieder vorkommt. Es missfällt mir, dass du dich ständig nachts herumtreibst. Das schickt sich nicht für ehrbare Frauen.«
»Ich beeile mich.«
»Jakob?« Jeans Stimme war ausdruckslos. »Steh auf. Du begleitest mich nach nebenan. Es gibt Arbeit.«
Schon halb im Hinausgehen bemerkte sie, wie der Körper ihres Sohnes noch mehr zusammensank, anstatt der Aufforderung nachzukommen.
»Jakob?«, wiederholte Jean scharf. »Soll ich dir Beine machen?«
»Ich komme.« Der Junge erhob sich schwerfällig wie ein Greis. »Ich komm ja schon.«
*
Er betrat die Kammer so leise, wie er konnte, aber Clara schreckte trotzdem aus dem Schlaf hoch.
»Kein Licht«, sagte er schnell, als sie nach dem Flintstein neben ihrem Bett tastete. »Ich will dich nicht wach machen.«
»Wo warst du denn die ganze Zeit?«, sagte Clara schlaftrunken. »Wieso kommst du erst jetzt?«
»Bei Jean.« Sein Zögern war fast unmerklich. »Es hat eben lange gedauert.«
»Ich frage mich schon seit geraumer Zeit, welche Arbeit er dich eigentlich verrichten lässt.«
»Ein anderes Mal.« Er ließ die Kleider fallen und schlüpfte unter seine Decke. Er hatte sich wieder im Dunkeln ausgezogen, wie immer in letzter Zeit. Es fiel ihr auf, nicht zum ersten Mal, aber sie war zu müde, um diesen Gedanken weiterzuverfolgen. Sie würde ihn danach fragen – morgen, gleich nach dem Aufstehen.
»Was hat der Apotheker gesagt?«
Schon lag ihr die ganze Wahrheit auf der Zunge, aber sie entschied, sie für sich zu behalten. Was machte es für einen Sinn, ihren Sohn mit Görgls Geschwätz zu belasten?
Sie hatte Mathieu nicht bei seinen Salbentöpfen und Flaschen angetroffen. Er sei zu einem Kranken gerufen worden, hatte ihr sein Gehilfe, der wortkarge Michel, mitgeteilt. Sie wagte nicht, zu lange zu warten, und ging, als sie die gewünschte Tinktur erhalten hatte. Sie würde wiederkommen, um mit Mathieu zu reden, sobald wie möglich, ohne Verdacht zu erregen. Aber sie mussten besonders vorsichtig sein, noch vorsichtiger als bisher.
»Er war gar nicht zu Hause. Michel hat mir die Medizin für den Großvater gegeben. Schlaf jetzt, Jakob. Aber vergiss dein Nachtgebet nicht.«
Sie hörte ihn murmeln, dann war eine Weile alles still.
»Gott sieht doch alles, Mutter, oder?«, sagte Jakob plötzlich. »Die guten, aber auch die bösen Dinge? Gott bleibt nichts verborgen.«
»Daran glauben wir. Weshalb fragst du, Jakob? Gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Deine Stimme klingt so seltsam.«
Er zog die Luft zwischen die Zähne.
»Nein, es ist nichts«, sagte er leise. »Ein anderes Mal.«
Sie schlief bereits, als er sich die Decke über den Kopf zog und haltlos zu weinen begann.
*
Ihre Höhle war die schönste von allen, und Jakob war stolz, dass er sie entdeckt hatte. Eigentlich war es Zufall gewesen, als er mit Jeans Gesellen im letzten Sommer zum Holzfällen auf den Salève geschickt worden war, der sich als breiter Bergrücken südlich der Stadt über dem See erhob. Außer Suzanne teilte noch einer sein Geheimnis, André, der Älteste in Jeans Werkstatt; aber André war ein wortkarger Mann und deshalb ein idealer Verbündeter.
Manchmal hatte Jakob schon befürchtet, es würde nie wieder Frühling werden. Der Schnee hatte den Bäumen zu schaffen gemacht; viele Äste waren abgebrochen, und manchmal hatte er unter der bleiernen Wolkendecke der vergangenen Wintermonate das Gefühl gehabt, kaum mehr atmen zu können. Aber jetzt hatten die Nächte und Tage der letzten Woche alle Erinnerungen an die traurige Zeit vertrieben.
Nur mit seinem Feuer war er noch nicht richtig zufrieden. Dabei hatte er alles ganz genauso gemacht, wie André es ihm gezeigt hatte: die Feuersteine fest gegeneinander geschlagen, den trockenen Zunderpilz sorgfältig darunter gebettet, um den Funken aufzufangen. Seine Hände schmerzten schon, so strengte er sich an. Endlich gelang es. Jakob hielt den Zunder an den Glutpunkt und steckte das glimmende Zunderstück in ein lockeres Bündel Heu. Er blies in sein Brennmaterial hinein, wieder und immer wieder.
Die Stichflamme!
Jetzt brauchte er nur noch das vorsorglich höher gelagerte Holz aus der Nische zu holen, das sich als erfreulich trocken erwies. Jakob war zu beschäftigt, es auf die richtige Art und Weise zu schichten, um sie zu hören.
Erst als ihr warmer Atem ihn streifte, bemerkte er sie.
»Suzanne!«
»War gar nicht leicht, mir die passende Ausrede einfallen zu lassen. Aber ich hatte solche Sehnsucht nach unserer Höhle, dass ich einfach kommen musste!«
Jakob nickte, plötzlich zu verlegen, um zu sprechen. Er sah sie jeden Tag, aber sie hier zu treffen, war etwas anderes. Das Mädchen dagegen redete unbefangen weiter.
»Hast du die jungen Marder schon entdeckt?«
Im letzten Jahr hatte die Höhle die Brut eines Steinmarders beherbergt, und beide hofften auf eine Fortsetzung.
»Ich hab noch gar nicht richtig nachgesehen«, sagte Jakob. »Ich wollte zuerst Feuer machen. Ich weiß, du magst es, wenn es hell ist.«
»Lange kann ich aber nicht bleiben. Papa ist so seltsam in letzter Zeit. Ist dir das auch aufgefallen?«
Jakob schüttelte den Kopf. Er hatte Angst, loszuheulen, wenn er erst einmal zu reden anfing. Und er wollte sie doch nicht mit seinen Schatten belasten. Sie liebte ihren Vater. Außerdem war wahrscheinlich alles ohnehin seine Schuld, wie der Onkel ihm immer wieder versicherte. Sein Trotz. Seine Widerworte. Vor allem sein Herz, das einfach nicht rein war.
»Vielleicht hat er Ärger in der Werkstatt«, fuhr das Mädchen fort. Sie war im Winter gewachsen und nun so groß wie Jakob – ein winziges Stück größer sogar, wenn man ganz genau hinsah. »Ich hab ihn und Maman streiten hören. Es ging um einen großen Auftrag, den er gerne hätte. Aber es gibt da wohl Schwierigkeiten. Ein Konkurrent, der ihm Sorgen macht. Letztlich entscheidet ohnehin alles Maître Calvin. Und das ist sicher auch richtig.«
Sie nahm nach kurzem Zögern ihr wollenes Schultertuch ab, faltete es zusammen und legte es auf den Boden.
»Hier«, sagte sie und sah ihn aufmunternd an. »Damit es uns nicht zu kalt wird. Willst du nicht sehen, was ich mitgebracht habe?«
Zu seinem Erstaunen holte sie ein Stück Schinkenspeck aus ihrem Korb, dazu Brot, getrocknete Früchte und einen Krug Apfelsaft.
Jakob starrte begehrlich auf die raren Köstlichkeiten.
»Keine Angst, ich bin nirgendwo eingebrochen.« Suzanne kicherte. »Das sind alles Geschenke. Von Marthe und Simone.«
»Du kennst die beiden Klöpplerinnen?« Ihm war plötzlich ganz heiß geworden, weil er an deren hingebungsvolle Gesichter bei der heimlichen Kommunion denken musste.
»Du nicht? Ich hab ihnen neulich beim Nähen geholfen. Kleider für die Waisenkinder, und sie sagten, ich stelle mich gar nicht ungeschickt an.« Sie steckte sich einen Apfelschnitz in den Mund und kaute genüsslich. »Dabei kann ich Nähen eigentlich nicht ausstehen. Ich würde viel lieber die Akademie besuchen. So wie du. Aber Papa besteht darauf, mich persönlich zu unterrichten.«
Ihr Gesicht wurde ernst.
»Weil ein Mädchen andere Dinge lernen soll. Aber dann hab ich ihn wenigstens mal für mich. Seitdem der kleine Jean auf der Welt ist, sieht er mich ja kaum noch.«
»Stell dir das bloß nicht zu schön vor! Die Lehrer sind streng, die Kameraden rau, und was Mathematik und Physik betrifft, so ...«
»Und warum kannst du es dann Morgen für Morgen kaum erwarten, aus dem Haus zu rennen? Außerdem kenn ich niemanden, den die Zahlen so mögen wie dich. Und jetzt lüg mich bloß nicht an – dafür kenn ich dich nämlich viel zu gut!«
Verlegen zog er die Schultern hoch.
Suzanne konnte er nichts vormachen. Manchmal war sie für ihn die Schwester, die er nie gehabt hatte, weil seine eigene zu schwach gewesen war, zu atmen, als sie geboren wurde. Clara hatte ihm einmal davon erzählt, schon vor langer Zeit, und war inzwischen überzeugt, er hätte es längst vergessen. Aber Jakob, der sich an alles erinnerte, erinnerte sich auch daran.
Und eigentlich stimmte es auch nicht genau. Suzanne war eher seine Freundin, eine Vertraute, der er alles sagen konnte – jedenfalls fast alles. In ihrer Gegenwart fühlte er sich geborgen. Wären da nicht diese seltsamen Gefühle ihr gegenüber gewesen, die ihn in letzter Zeit manchmal ohne Vorwarnung überfielen.
Plötzlich unsicher geworden, stocherte er in der Glut und legte neues Holz nach. Dann zog Jakob sein Messer heraus, von dem außer André niemand etwas wusste, schnitt dünne Scheiben von dem Speck ab und dickere von dem Brot und reichte beides dem Mädchen.
Beide aßen, schweigend, gierig, bis nichts mehr da war. Suzanne warf ihm einen Blick zu, dann begann sie sich die Finger abzulecken, einen nach dem anderen.
Jakob starrte sie an. Ein Kribbeln stieg in seinem Bauch auf und ließ ihn kaum mehr atmen.
»Ich muss gehen«, sagte Suzanne und erhob sich.
»Ich auch.« Jakob stand ebenfalls auf und hoffte, dass sie nicht bemerkte, wie wacklig seine Beine waren.
Sie nahm ihr Tuch, schüttelte es aus und legte es sich um die Schultern.
»Aber die Höhle erkunden wir noch weiter zusammen, eines Tages«, sagte er leise. »Versprochen?«
»Versprochen!« Ihre Stimme war ein Flüstern. »Ich gehe jetzt. Es ist besser, wenn uns niemand zusammen sieht. Du weißt ja, wie die Leute sind.«
Sie bewegte sich nicht. Jakob hielt den Atem an.
Ungelenk legte er schließlich einen Arm um sie. Er hätte weinen können, jubeln, singen. Sie roch nach verbranntem Holz, nach Gras und verströmte zusätzlich einen warmen Duft, der ihn ganz schwindelig machte.
Furchtlos sah sie ihn an. Dann nahm sie seinen Kopf zwischen ihre Hände und zog ihn nah zu sich heran.
Ihre Lippen waren weich, als sie seine berührten. Beide Kinder atmeten tief. Danach blieben sie stehen, aneinander gelehnt, gewärmt, getröstet.
Sie hatten die Augen geschlossen.
Nur wenige Schritte entfernt drückte sich der krumpe Görgl tiefer in die Felsnische. Er musste sich in die plumpe Faust beißen, um nicht gellend zu schreien.
*
Das ohnehin blasse Gesicht des Apothekers wurde so fahl, dass sie Angst bekam, er könnte jeden Moment die Besinnung verlieren.
»Atme, Mathieu, atme«, sagte Clara. »Noch ist ja nichts geschehen.«
»Aber es wird etwas geschehen, das fühle ich, nein, das weiß ich. Etwas Fürchterliches, das uns alle vernichtet. Was haben wir nur getan, Clara? Niemals hätten wir so unvorsichtig sein dürfen!«
»Wir haben Gott geehrt«, sagte sie. »Das ist keine Sünde. Außerdem waren wir vorsichtig.«
»Und wie konnte uns dann dieser Idiot aufspüren? Ausgerechnet der Henkergörgl – ich fass es nicht!«
Mathieu begann so heftig in seinem Mörser zu rühren, dass es staubte. Er hatte eine Reihe Gefäße vor sich aufgebaut, aus feinstem Akazienholz, die er offenbar neu füllen wollte. Trotz ihrer Unruhe konnte Clara den Blick kaum davon lösen. Was hätte sie für diese Sammlung gegeben! Aber es blieb ihr nichts anderes übrig, als mit den Erzeugnissen aus dem eigenen Garten zufrieden zu sein.
»Das weiß ich auch nicht«, sagte sie. »Und es wird kaum aus ihm herauszubekommen sein. Görgl redet nur, wenn er will. Manchmal denke ich sogar, er stellt sich dümmer, als er ist. Benutzt die Dummheit wie einen Schutzschild. Weil er keinen anderen hat.«
»Umso schlimmer!« Schweißtropfen standen auf Mathieus hoher Stirn. »Was hat er vor? Ob er schon beim Consistorium war?«
Sie wandte sich ab. Mathieu packte Claras Arm und zwang sie, ihn anzusehen.
»Du hältst doch etwas zurück. Rede!«
»Wenn du es ganz genau wissen willst: Er hat versucht, mich zu erpressen.«
»Was will die Kreatur – Geld?«
»Nein. Görgl hat sich offenbar in meine Nichte verguckt. Er möchte Suzanne sehen.«
»Diese Teufelsbrut und das unschuldige Mädchen! Du wirst ihm doch nicht das Kind zuführen, damit er ...«
»Natürlich nicht«, sagte sie scharf. »Aber ich habe Angst, verstehst du? Was, wenn er ihr irgendwo auflauert? Ich kann wachsam sein, aber ich kann Suzanne nicht Tag und Nacht zu Hause einsperren. Was soll ich ihren Eltern sagen? Margarete würde auf der Stelle losheulen und sofort zu Jean rennen.«
Sie lockerte ihren engen Kragen. Allein der Gedanke war unerträglich. »Und Jean würde natürlich mir die Schuld zuschieben. Er lauert ja nur darauf, dass ich einen Fehler mache! Dieses Mal allerdings müsste ich ihm fast Recht geben. Ich hätte mich nicht darauf einlassen dürfen, dass Görgl für mich arbeitet.«
»Du musst die Bestie anzeigen«, sagte Mathieu. »Damit sie hinter Schloss und Riegel kommt.«
»Wie soll die Anklage lauten? Und was, lieber Freund, wird er dann wahrscheinlich erzählen?«