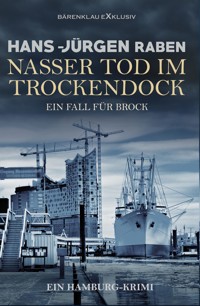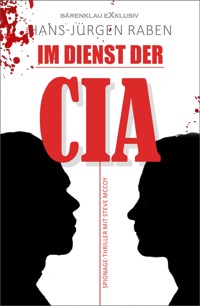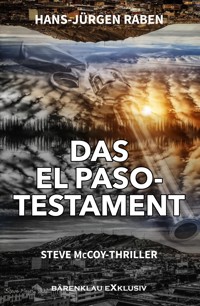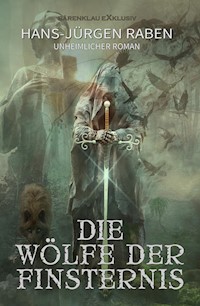3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Peter Maaß, Ingenieur aus Deutschland, kommt nach längerer Abwesenheit in den indischen Dschungel zurück, um an einem Bauprojekt als Verantwortlicher weiterzuarbeiten. Doch in der Zwischenzeit sind grausame Dinge geschehen. Ein Tiger treibt seit einigen Tagen sein Unwesen und macht Beute unter den Menschen im Camp. Peter verfolgt ihn, will ihn zu Strecke bringen – doch es gelingt ihm nicht.
Bei seiner Suche nach dem Raubtier stößt er auf die Sage vom Mantiger, einem Geschöpf, das in der Lage ist, seine Gestalt zwischen Tiger und Mensch zu wechseln, und schon in früheren Zeiten immer wieder auf grausame Weise reiche Beute unter der Bevölkerung gemacht hat. Als schließlich sogar seine eigene Familie angegriffen wird, sucht Maaß verbissen einen Weg, dieses Wesen unschädlich zu machen. Doch wenn es wirklich eine übernatürliche Kreatur ist, kann man sie dann überhaupt bekämpfen, denn überall wo diese Bestie auftaucht, da verbreitet sie Tod und Verderben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hans-Jürgen Raben
Die Stunde des Tigers
Horror-Roman
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Der Autor Hans-Jürgen Raben
Weitere Werke des Autors
Das Buch
Peter Maaß, Ingenieur aus Deutschland, kommt nach längerer Abwesenheit in den indischen Dschungel zurück, um an einem Bauprojekt als Verantwortlicher weiterzuarbeiten. Doch in der Zwischenzeit sind grausame Dinge geschehen. Ein Tiger treibt seit einigen Tagen sein Unwesen und macht Beute unter den Menschen im Camp. Peter verfolgt ihn, will ihn zu Strecke bringen – doch es gelingt ihm nicht.
Bei seiner Suche nach dem Raubtier stößt er auf die Sage vom Mantiger, einem Geschöpf, das in der Lage ist, seine Gestalt zwischen Tiger und Mensch zu wechseln, und schon in früheren Zeiten immer wieder auf grausame Weise reiche Beute unter der Bevölkerung gemacht hat. Als schließlich sogar seine eigene Familie angegriffen wird, sucht Maaß verbissen einen Weg, dieses Wesen unschädlich zu machen. Doch wenn es wirklich eine übernatürliche Kreatur ist, kann man sie dann überhaupt bekämpfen, denn überall wo diese Bestie auftaucht, da verbreitet sie Tod und Verderben …
***
1. Kapitel
Die Sonne verschwand als blutrote Scheibe hinter den Wipfeln der uralten Bäume. Die Dämmerung trat ein.
Einen Augenblick war Ruhe. Nur die lehmgelben Fluten des Hugli River plätscherten im stetigen Spiel gegen das sumpfige Ufer. Die Bäume waren so dicht an das Wasser herangewachsen, dass während des immer wiederkehrenden Monsuns die mutigsten und vorwitzigsten unter ihnen ihr keckes Treiben mit dem Leben bezahlen mussten. Von den Fluten unterspült, brachen sie zusammen und beendeten ihr Dasein dort, wo es sie hingezogen hatte – im Fluss.
Die Ruhe währte nur sekundenlang, dann begannen die anderen – diejenigen, die den ganzen Tag auf diese Sekunde mit ihrem Konzert gewartet hatten. Abschreckend und schön zugleich war es.
Ein grelles Schnarren, Keckern und Zetern zeugte von dem Treiben der Affen. Äste brachen, und gleichzeitig kündete ein dumpfes Grunzen und Schmatzen vom Nahen der Wildschweine.
Plötzlich brach das Rudel hervor. Zuerst trauten sich die ältesten, stärksten Tiere aus der schützenden Pflanzenwand, danach folgten, vom ganzen Rudel beschützt, die Jungen und die Jüngsten.
Nun gab es nichts mehr, was die schlanken, eleganten Axishirsche zurückhielt. Zwar war die Wachsamkeit ein Teil ihrer Natur und der Fluchtreflex ein angeborener Wesenszug, aber allmählich besiegten Durst und Hunger die Angst.
Mittlerweile war die Sonne ganz verschwunden, und die Schatten griffen immer gieriger nach der Landschaft. Dicht über der Wasserfläche funkelten die glühenden Augen der Gaviale und Krokodile. Auch sie waren hergekommen, um zu fressen, wenngleich auch ihre Nahrung anders aussah.
Unruhig strichen die torpedoartigen Leiber durch das Wasser, das im trügerischen Schein der Dämmerung nur durch jähes Schwanzausschlagen der Riesenreptilien hin und wieder Bewegung zeigte. Kleine Wellen breiteten sich kreisförmig dort aus, wo das Raubtier schon längst nicht mehr verharrte und glitten dann mit mattem Schlag gegen das Ufer.
Die Dunkelheit ergriff endgültig Besitz von dem Land.
Es war die Stunde des Tigers.
Wo der Hugli River einen verschilften Seitenarm bildete, der irgendwo zwischen den lianenüberwucherten Bäumen versickerte, da tat sich dem Wanderer eine Lichtung auf.
Hier stand verkrautet und überwuchert von Dornenranken und von dichtem Lianengeflecht fast erwürgt, ein alter Tempel.
Die Jahrzehnte hatten aus dem einstmals stolzen Gebäude eine Ruine gemacht, die mehr und mehr ein Opfer der wild wuchernden Vegetation wurde. Eine Mauer nach der anderen stürzte in sich zusammen. Was jetzt noch übrig war, stellte sich dem Betrachter nur noch als scheinbar harmlose Ruine dar.
Aber hier war das Haus des Tigers.
Die Katze öffnete die Augen und blinzelte. Noch wirkten die Augen schläfrig und trüb. Aber von Sekunde zu Sekunde trat mehr Leben in die grünen Lichter. Die kleinen, dreieckigen Ohren spielten nervös und lauschten in den Wind. Mit zunehmender Gier nahm der Tiger die Angst der anderen Geschöpfe auf. Oh, er konnte sie körperlich spüren, denn nicht umsonst nahm er laut ungeschriebenem Gesetz hier im Dschungel eine Stellung ein, die der eines Königs gleichkam.
Der Tiger gähnte und bleckte dabei die gewaltigen Fangzähne. Langsam erhob er sich, reckte den gewaltigen, geflammten Körper und begann sich mit hastigen Leckbewegungen zu putzen. Es war ein Ritual, dem er sich jeden Abend unterzog, wenn er spürte, dass seine Stunde kam.
Aber nicht die feige tierische Kreatur war es, der seine ganze Gier galt. Die Angst, die in ihm die Sucht zum Töten auslöste, war köstlich und berauschend.
Aber nur ein Geschöpf konnte diese Sucht in ihm auslösen. Es war der Mensch.
Der Tiger hatte seine Vorbereitungen beendet.
Mit spielerischer Leichtigkeit sprang er durch eine Mauerlücke, verharrte einen kurzen Moment geduckt und schleuderte dann den sehnigen Körper in einem plötzlichen, eleganten Kraftaufwand gegen einen alten Baum. Die Rinde stob in Fetzen auseinander. Die fingerlangen Krallen hatten tiefe Rillen in die Haut des Baumes gerissen.
Die Augen der Bestie funkelten jetzt unternehmungslustig. Gemächlich setzte sich der Tiger in Bewegung. Was kümmerte es ihn, dass rings um ihn herum die Tierwelt in angsterfüllter Stille verhielt? Natürlich sah er sie – all die erbärmlichen Kreaturen.
Allmählich wuchs der Hunger in der Bestie. Sie wusste, die nächste menschliche Ansiedlung würde sie erst in einer Stunde erreichen, wenn sie sich nicht beeilte. Sie beschloss, sich zu sputen.
Der Tiger wurde zu einem orangefarben geflammten Blitz und schoss gleichsam durch das Unterholz.
In seinem Geist manifestierte sich ein Begriff, der im Rhythmus des raschen Schrittes wie ein Stakkato hämmerte.
Töten, töten, töten!
2. Kapitel
Ein gottverlassenes Nest, dieses Bithur, dachte Steve nun zum soundsovielten Male. Zum Mitzählen war er ohnehin viel zu betrunken.
Aber etwas anderes als Trinken blieb einem hier ohnehin nicht. Whisky – goldgelb und wärmespendend, Lebenselixier und Gift in einem – wie oft hatte er ihn verflucht. Los kam er nicht davon. Schon mehrfach hatte er sich geschworen, Singas Kantine zu meiden.
Aber Singa, der kühl rechnende Malaie, hatte geschäftstüchtig die Hände gerieben und verständnisvoll genickt, denn am folgenden Abend saß Steve Corbett für gewöhnlich wieder am Tresen.
Es ging auf zehn Uhr, und Steve hatte bereits die höhere Meditationsstufe erreicht. Aber das war nichts Besonderes, denn etwas anderes als Schnaps konnte man bei Singa ohnehin nicht trinken. Zwar wies ein riesiges Schild auf »German Beer« hin, aber Singa hatte sich bisher noch nicht dazu durchringen können, eine Kühlanlage anzuschaffen.
Seine Kühlanlage war einfach, aber wirkungsvoll. In einem riesigen Holzbottich, den der Malaie mit Petroleum gefüllt hatte, standen Dutzende von Bierflaschen. In abwechselnden Schichten mussten Singas Kinder Luft in den Trog pumpen. Die so entstehende Verdunstung hatte zur Folge, dass die Flaschen stets annehmbar kühl waren und – der Inhalt stets einen leichten Benzingeschmack hatte.
Mit unsicherem Schritt taumelte Steve Corbett zur Tür, stieß die Flügel auseinander und wankte die kleine Treppe hinab, die aus ein paar provisorisch gezimmerten Holzbohlen bestand. Als er den rettenden Erdboden erreicht hatte, verhielt er einen Augenblick, um das Gleichgewicht wiederzufinden.
Die Bungalows der Weißen lagen am Ende der Straße, also etwa zweihundert Meter entfernt. Leise vor sich hin schimpfend klaubte Steve die knallrote Pall-Mall-Schachtel aus der Brusttasche seines Hemdes. Mit der Zigarette zwischen den Lippen blieb er unsicher stehen und durchwühlte seine Hosentaschen nach Streichhölzern.
Jäh setzte starker Wind ein, der einen nahen Regenguss ankündete. Die letzten Ausläufer des Monsuns ließen die Tropenlandschaft zuweilen noch in sintflutartigen Regenmassen ertrinken. Ehe Steve sich in Sicherheit bringen konnte, hatte der Regen bereits eingesetzt.
Binnen Sekunden war Steve bis auf die Haut durchnässt. Im gleichen Augenblick wurde er sich bewusst, dass die Zigarette zwischen seinen Lippen nur noch ein matschiger, pinselartiger Gegenstand war. Angewidert spuckte er die Überreste aus. Der Regen ernüchterte den Mann ein wenig, und so rührte der unsichere Schritt nur noch von der aufgeweichten, schlüpfrigen Fahrbahn her. Entschlossen stapfte er los.
Der Regen peitschte sein Gesicht und rann ihm in die Augen. Steve konnte nur noch mühsam sehen. Immer wieder fuhr sich der Mann über die Augen und blinzelte, um wenigstens die Richtung ausmachen zu können. Moment mal, da war etwas.
Mitten auf der schlüpfrigen Fahrbahn stand eine weiße Gestalt. So ein Quatsch! Es musste ein Mensch sein, der sich in blütenweißes Leinen gehüllt hatte. Steve riss ungläubig die Augen auf. Die paar Meter von der Kantine bis hierher hatten genügt, um ihn über und über mit Dreck zu besudeln. Steve wollte gerade etwas rufen, als die Gestalt plötzlich verschwand.
Steve schüttelte den Kopf. In seiner ganzen Laufbahn hatte es noch niemand geschafft, ihn unter den Tisch zu trinken. Über die anderen, die gelegentlich über Delirien, Halluzinationen oder den sogenannten Filmriss sprachen, konnte er nur lachen. Jetzt ergriffen allmählich leise Zweifel von Steve Besitz, ob er nicht doch das Saufen einstellen sollte.
Ein Instinkt, eine jähe Ahnung von der Gefahr, die hinter ihm heranschlich, ließ ihn herumschießen und löste die gleitende Bewegung mit der Hand zur Hüfte aus. Aber Steve bekam den Revolver nur halb heraus.
Aus der Dunkelheit war plötzlich ein riesiger Tiger aufgetaucht. Die gelbgrünen Augen funkelten höhnisch und ließen den Mann in starrem Entsetzen stillstehen. Der Revolver war vergessen.
Steve fuhr herum und versuchte das Unmögliche. Seine Unsicherheit war unwichtig. Die Füße hasteten und trampelten Schlamm verspritzend über die Fahrbahn. Nur fort, dachte er sich. Steve schaute weder nach links noch nach rechts. Am Ende der Straße tauchte sein Bungalow auf und verhieß ihm Rettung und Geborgenheit. Mühsam taumelte er die letzten Schritte zur Treppe und schickte sich an, die Stufen hoch zu hasten. Aber hier sollte für Steve die Endstation sein.
Wie zum Hohn hatte die gewaltige Katze auf der kleinen Veranda Platz genommen. Die Vorderläufe waren angewinkelt, und die Hinterläufe glichen Stahlfedern, die nur darauf warteten, den geschmeidigen Körper vorschnellen zu lassen, damit er Tod und Verderben verbreiten konnte.
Ein Schuss löste sich aus Steves Revolver, aber eine Wirkung war nicht festzustellen. Fauchend griff die Bestie an.
Der mörderische Schlag riss dem Mann die Waffe aus der Hand. Gleich darauf war das Tier über ihm. Entsetzt starrte Steve in die grünen Lichter.
Vier Fangzähne fuhren Steve mitten in das Leben. Zweimal schrie er noch gellend auf, dann erlöste ihn eine Ohnmacht.
Die Bestie war enttäuscht, denn Opfer, die sich so schnell aufgaben, passten nicht in ihr Beuteschema. Aber es war Leben, und das brauchte sie als Quelle für ihre fluchwürdige Existenz.
Steves Schreie waren nicht ungehört verhallt, und auch der Schuss war den Ohren der Männer in der Kantine keineswegs entgangen. Überrascht schauten sie sich an. Gesichter, aus denen Angst, Betroffenheit und Verwegenheit sprachen. Der erste sprang in wilder Entschlossenheit auf.
»Wir müssen nachsehen!«
Stühle wurden beim Hochfahren umgestoßen, landeten polternd auf dem schmutzigen Fußboden, und grobes Schuhwerk ließ die Holzdielen erdröhnen. Die Türflügel wurden aufgestoßen, und die Wasserfluten drangen ungehindert herein. Ein Mann nach dem anderen verschwand hinter der tosenden Regenfront.
Singa achtete nicht weiter auf das Geschehen. Er war damit beschäftigt, die Strichlisten, aus denen später die Rechnungen erstellt werden sollten, zu frisieren.
Unter den derben Stiefeln der Männer quatschte und gluckste der Matsch. Die Khakihosen waren bald verschmiert und besudelt. Aber es gab nichts, was die Männer zurückhalten konnte.
Reibereien, Zank und Eifersüchteleien waren vergessen. Steve war in Gefahr, und es galt, ihm zu helfen. Er war einer von ihnen, einer von dieser verschworenen Gemeinschaft von Männern, die sich am Ende der Welt zusammengefunden hatte, um ihren Job zu tun.
Die grauen Regenschauer lichteten sich ein wenig, und etwas Helles schob sich in den Vordergrund. Eine Gestalt war es.
Das weiße Leinen, in welches das Wesen gehüllt war, ließ die Gestalt unwirklich und gespenstisch erscheinen, denn kein Fleck, kein Schmutz verunstaltete die Erscheinung.
Die Männer erstarrten in ihrem Lauf und stierten wie gebannt auf das Wesen, dessen Gesichtszüge eindeutig weiblich geschnitten waren. Die Erscheinung streckte den Arm aus, drehte sich in den Hüften und deutete nach hinten.
»Ihr sucht euren Freund? Seht dort!«
Die Männer folgten mit den Blicken ihrem ausgestreckten Arm und erschauerten. Eine reglose Gestalt, von Blut überströmt, lag dort und rührte kein Glied, während der Regen herabrauschte.
Die Blicke, welche die Männer auf das in Leinen gehüllte Wesen richteten, waren anklagend und voller Fragen zugleich. Aber es gab kein Wesen mehr.
Die Gestalt hatte sich spurlos in Nichts aufgelöst.
Von diesem Abend an hielt das Grauen Einzug in Bithur.
3. Kapitel
Als die Boeing 707 auf dem Flughafen in Kalkutta aufsetzte, verlief die Landung wie jede andere. Lautes Quietschen und Rauchwolken entstanden beim Aufsetzen der Reifen. Von drinnen waren sie nicht zu spüren.
Peter Maaß war einer der Ersten, die an der Ausstiegsluke standen, nachdem der riesige Vogel aus Aluminium und Stahl ausgerollt war, und die Gangways von draußen herangeschoben wurden.
Er wusste, draußen warteten Regina und Kari. Regina war seine junge Frau, und Kari – mit Kari war das eine besondere Geschichte.
Kari war ein achtjähriger Junge, der, wie viele seiner gleichaltrigen Kameraden, die Plätze belagerte, die von den Fremden gern besucht wurden. Peter grinste.
»Gimmi Bakschisch, gimmi Bakschisch!«
Er erinnerte sich genau an die durchdringenden Stimmen der Jungen. Peter hatte versucht, die kleinen Bettler zu ignorieren. Aber Regina war auf einen kleinen Jungen aufmerksam geworden, der mit seiner zarten Figur und einem offensichtlich durch Kinderlähmung verkümmerten Bein von den anderen, kräftigen Jungen rücksichtslos beiseite gedrängt wurde und traurig dastand.
Regina war wie immer Siegerin geblieben, als sie erfahren hatte, dass der Junge keine Eltern mehr besaß. Sie hatte den Knaben kurzerhand zu sich genommen, und mit der Zeit war er auch für Peter unentbehrlich geworden. Regina war von Beruf Krankengymnastin, und so hatte sie mit sicherem Blick erkannt, dass es lediglich der richtigen Therapie und Pflege bedurfte, um den Knaben zu heilen.