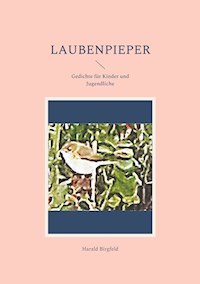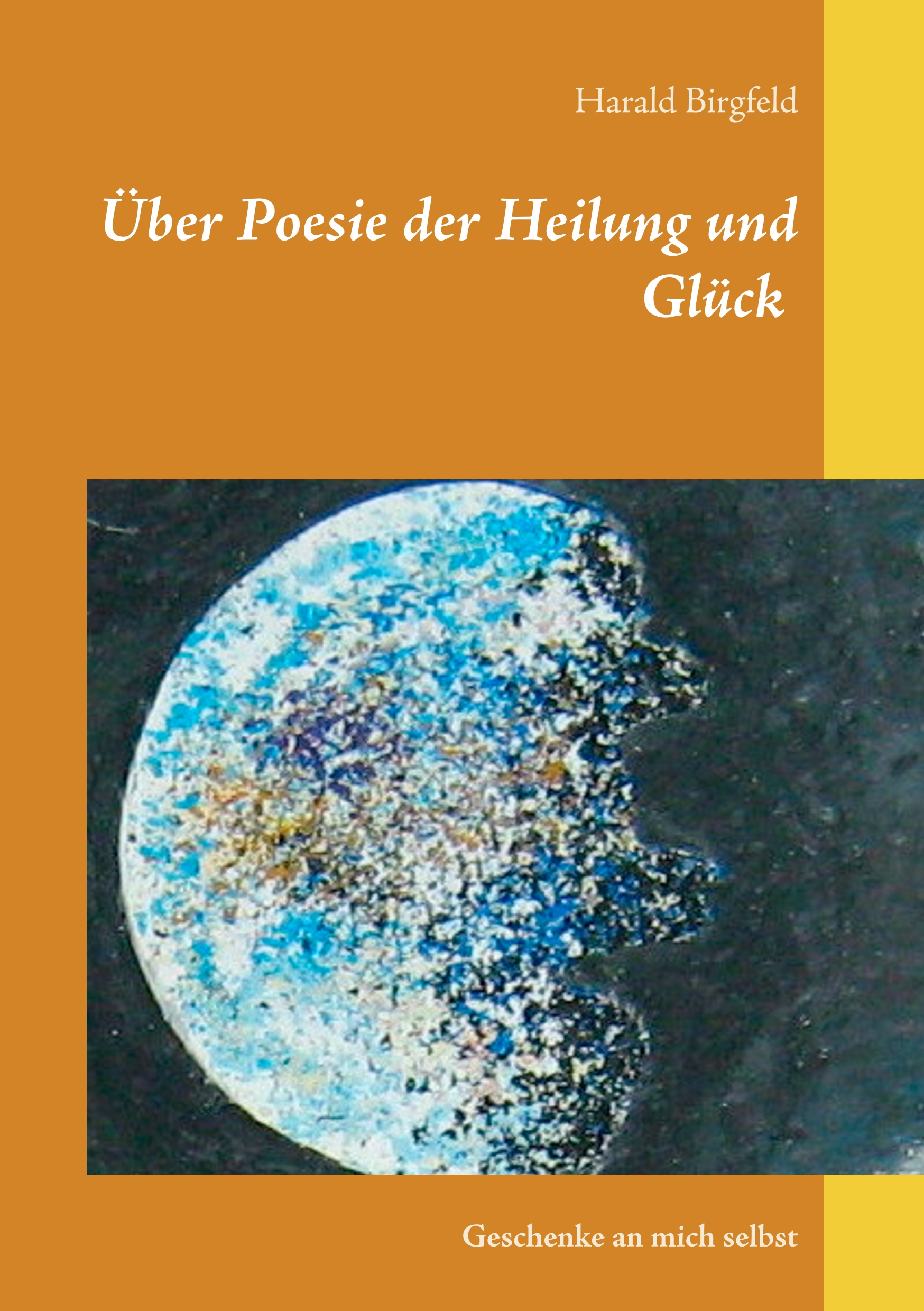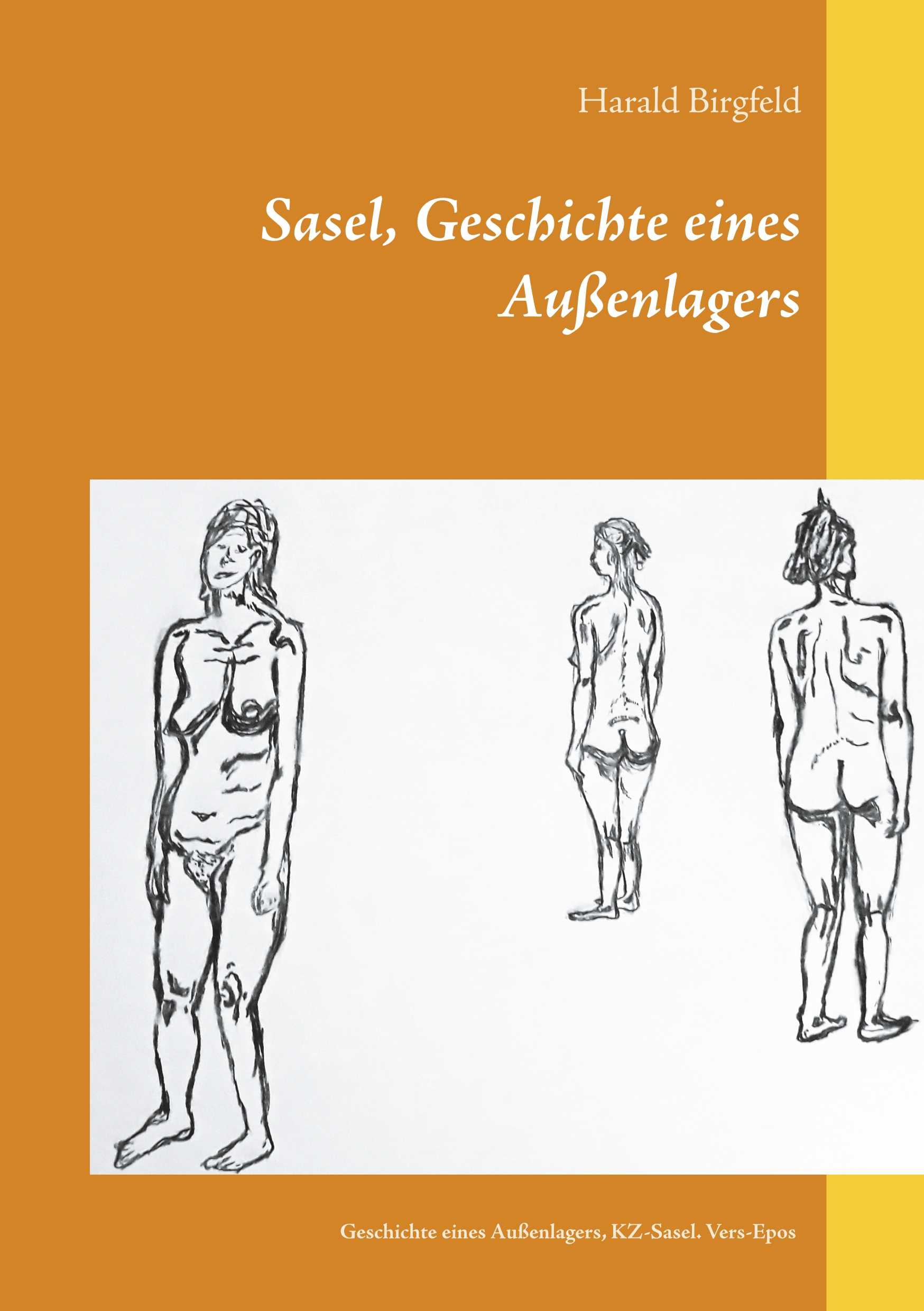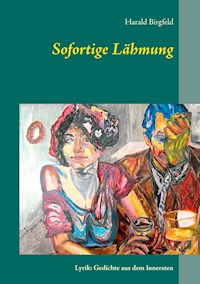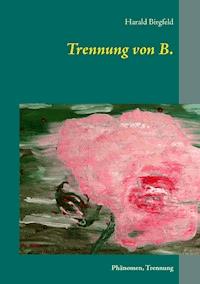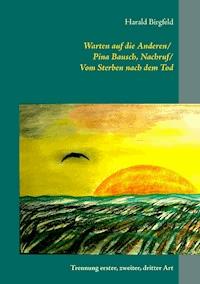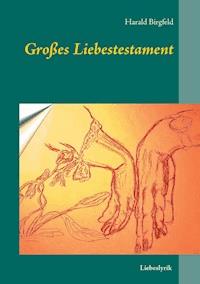Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Hat sie sich insgeheim mit der Einmaligkeit dieser Körpermalerei schön gemacht, um sich damit zu bestrafen? / Geschlossene Augen zu zeichnen oder zu malen ist sehr, sehr schwer./ So wie sie jetzt schaute, zog sie ein schauspielerisches Training ab./ Ich kann nicht sagen, wie lange ihr Anfall diesmal gedauert hat, aber wenn er vorüber ist, schnappt sie sich immer den Hund und heult in sein Fell. Ist das nicht rührend? Das ist doch süß, oder?/ Sie bewegte den ganzen Körper, wenn sie sprach./ 'Seit wann schenkt denn ein Mädchen einem Mann rote Rosen?' 'Warum denn nicht? Ich lieb' ihn, und das soll er wissen.'/ Was Tanja nicht wusste und was ihr immer verborgen bleiben würde, war die ungewöhnliche Ausstrahlung ihres Gesichtes, dieser Sonne, die sie mit sich herumtrug und die jeden berührte./ Ich sagte zu ihm: Streichel mich. Ich bekam einen Orgasmus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Mit meinem Bild
Mein Alltag
Die nächsten Tage
Tanjas Mutter
In den letzten Tagen
Am vorletzten Tag
Tanjas Mutter hatte
Am letzten Tag des
Es fing ganz harmlos damit an
In der folgenden Nacht
Wenn es um Gerüche geht
Tanja hatte eine Bleibe
Derzeit habe ich
Bei den Gedanken
Ein schöner neuer Tag
Mit dem Schweden
Die Tanja ist ein Schatz
I.
Mit meinem Bild, das ich Zuhause begonnen hatte, kam ich nicht voran. Ich war abgelenkt. Das kam von dem Aussehen eines Mädchens, an das ich immerzu denken musste. Es war ein erwachsenes Mädchen. Ich schätzte es auf achtzehn Jahre; naja, wahrscheinlich war es sehr viel jünger.
Als ich mir nämlich kürzlich, um die Mittagszeit, in der Kantine unserer Behörde einen Platz suchte, einen möglichst ungestörten Platz, fiel mein Blick auf dieses Mädchen. Es saß einer älteren Frau gegenüber, die ich kannte. Sie arbeitete in derselben Behörde wie ich und war in der Registratur tätig. Diese Frau erinnerte ich als angenehm gesprächig.
Sie hatte mir einmal erzählt, dass sie privat Bienen züchtete. Das hat mich interessiert. Eine Frau, die in der Behörde sitzt, in der Registratur, einem der verstaubtesten Plätzchen überhaupt und Zuhause Bienen züchte, das war doch etwas. Ich hatte sie dabei nach allem möglichen befragt, woraus sie sofort entnahm, dass ich von Bienenzucht nun wirklich keine Ahnung hatte. Das war nicht schwer zu erkennen. Was konnte ich schon von Bienenzucht wissen. Für meine Unwissenheit zeigte sie Verständnis und schilderte mir ausführlich, wie sie eine Königin machte.
Ihre Erzählung war für mich ein richtiges kleines Märchen mit allen Grausamkeiten, die dazu gehören.
Eine Königin machte sie, indem sie über einer ausgewählten Biene ein hauchdünnes, grobmaschig gewebtes Tuch so lange hin und her schob, bis von dem kleinen Tier beide Flügel durch die Maschen des Stoffes hindurch reichten. Die Biene durften dabei nicht verletzt werden. Das konnte ich verstehen. Ich verstand auch aus ihrer Schilderung, dass sie außerordentlich sorgfältig mit diesem kleinen lebenden Wesen umgehen musste, um es auf gar keinen Fall zu verletzen.
Wenn die Frau alles so hatte, wie sie es sich dachte, oder wie es sein musste, dann schnitt sie der Biene trotzdem einfach von außerhalb des Tuches die Flügel ab. Von nun an hatte das kleine Tier nur noch eine einzige Überlebenschance: es musste von seinem Volk als Königin angenommen werden.
Die Erzählung interessierte mich mit einer fast an Verwirrung grenzenden Erregung. Ich verspürte in mir eine beginnende Hitze, die sich nach außen ausbreitete und dort wieder verebbte. Die Menschen selbst, die so etwas erzählen, bleiben mir meistens unerschlossen, weil das, was sie erzählen, einerseits brutal und andererseits selbstverständlich ist.
Ich sollte das an einem anderen Beispiel deutlich machen.
Sehen Sie, in meinem Beruf komme ich sehr häufig in Schulen, um dort die Arbeitsplätze der Lehrerinnen und Lehrer zu besichtigen.
Ich habe es gelernt, für dieses Völkchen, Lehrer und Erzieher, eine uneigennützige Liebe zu entwickeln. Sie sind sozusagen meine Kinder, um die ich mich zu kümmern habe.
Einigen von ihnen sieht man an, dass sie auf verlorenem Posten stehen. Sie haben resigniert oder verbreiten unerschütterlichen Gleichmut. Andere aber, die in ihrem Beruf aufgehen, strahlen über das ganze Gesicht, und es macht Freude zuzuschauen, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Von allen gemeinsam aber wird der kleinste Eingriff von außen als Störung empfunden, und man tut gut daran, sich möglichst zurückzuhalten.
Eine ganz andere Gruppe hat sich in der täglichen Arbeit bereits so zerschlissen, wegen dauernder Überforderung und Überlastung, dass sie Mitleid erregen. Auch aus diesem Grund traut sich kein Außenstehender an sie heran oder dort irgendwie einzugreifen, und er tut auch hier gut daran.
Von einer solchen Gruppe nun, Lehrerinnen, eigentlich Erzieherinnen, soll mein Beispiel handeln.
Sechs oder acht dieser Frauen, hatten mehrfachschwerstbehinderte Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zu betreuen.
Sie erzählten mir von der Arbeit an den Kindern, von den Aufgaben, die sie sich mit diesen Kindern stellten. Das waren Aufgaben, die sie in drei Worten zusammenfassten: „Wir können keine erzieherischen Aufgaben mehr erfüllen. Verstehen Sie, wir machen täglich stundenlanges Esstraining und müssen zuschauen, wie die Kinder manchmal gar nichts von dem Essen bei sich behalten können.
Wir sind gezwungen, mit ihnen ebenso langatmig Toilettentraining zu machen, und von Erfolgen können wir dabei auch nicht reden. Als Fernziel, nach jahrelangem Bemühen, erhoffen wir uns, mit dem einen oder anderen Kind einen Körperkontakt aufnehmen zu können. Das bleibt wirklich nur ein Fernziel und wird bei den wenigsten Kindern erreicht. Die Behinderungen der Kinder sind dafür zu groß, für uns zu unüberwindlich“.
Ich fragte nach: „Wie groß sind denn die Gruppen der Kinder?“
Eine Erzieherin antwortete: „Normalerweise habe ich sechs, aber heute sind es nur vier“.
Und dann kam die Zusatzbemerkung, um deren Willen ich die ganze Geschichte erzähle: „Zwei sind wohl krank, ich glaube, die haben Schnupfen oder sind erkältet“.
So etwas rührt mich. Das beschert mir eine Gänsehaut. Diese wirklich kranken Kinder sind in den Augen der Erzieher also erst dann krank, wenn sie einen Schnupfen oder eine Erkältung haben. Das, finde ich, ist brutal und verständlich zugleich.
Ich musste dabei an die Bienenzüchterin denken. Die Biene durfte nicht verletzt werden, um Königin zu werden, und ihr wurden aus demselben Grund die Flügel abgeschnitten. Welch ein Wahnsinn und wie sinnvoll.
Ich empfinde diesen Widerspruch körperlich, als elektrisches Gefühl in meinem Magen, das von dort nach überall ausstrahlt. Ich bin erregt und denke, dass eine Auflösung, ein gutes Ende der Geschichte folgen muss. Das ist aber nicht der Fall. So ein Ende kann es gar nicht geben.
Ich selbst sage auch nichts dazu, ich horche nur nach innen, ob sich dort etwas tut. Dort schreit es. Es schreit so laut, dass ich denke, jeder in meiner Nähe müsste es hören. Er ist ein Stummschrei, den ich nicht unterdrücken kann. Es ist mein Stummschrei oder die Entdeckung meines inneren Raumes.
Mein Mund ist geöffnet, als wäre ich ein Kind zu Füßen eines Märchenerzählers.
Dem kann ich mich nicht entziehen.
Ich frage dann Einzelheiten nach und möchte die kleinsten Kleinigkeiten ganz genau wissen: „Was passiert mit den abgeschnittenen Flügeln. Zucken die noch? Werden die gesammelt? Warum macht man das so? Machen die Bienen das unter sich auch so?“ Die Frau konnte mir das nicht erklären: „Das wird nun 'mal so gemacht. Alle machen das so. Einer muss es doch tun, oder?“ Und dann noch: „Meistens funktioniert es ja auch“.
Ich fragte zurück: „Was heißt denn das: meistens“.
“Ja, meistens heißt, dass die Biene nicht eingeht, also nicht stirbt. Sie muss nur als Königin angenommen werden, sonst allerdings geht sie zugrunde“. Wieder so ein Märchenstück, das grausam endete.
Die Frau erkannte schnell, dass ich Phantasie und Wirklichkeit nicht immer auseinander hielt.
Sie sagte: „Ist nicht so schlimm, wenn eine stirbt. Man kann immer noch eine andere zur Königin machen“. Das alles fiel mir ein, als ich die Frau vor dem Mädchen am Tisch sitzen sah.
Das Mädchen hatte Tätowierungen auf den Armen.
Ich weiß nicht ob man das nachvollziehen kann, aber die Entdeckung der Tätowierungen, der Anblick der Frau und die Tatsache, dass es sich bei dem tätowierten Körper um den eines für mich blutjungen Mädchens handelte, waren die bildliche Darstellung dieses Märchens von der Bienenkönigin.
Die Frau brauchte das Mädchen gar nicht zu kennen. Es konnte ihr wildfremd sein und ihr durch einen Zufall gegenübersitzen. Für mich war sie aber die Biene, die, gestutzt durch die Tätowierungen, Königin werden sollte.
Nein, wie absurd, wie schön und wie unendlich zufällig.
Die Gedanken in meinem Kopf waren entsprechend märchenhaft: ,Wird sie angenommen als Königin oder muss sie zugrunde gehen'. Ohne Inhalt war dabei die Frage nach deren Bedeutung.
Ich fragte mich: ,Wie geht sie mit den Tätowierungen um, warum hat sie die. Sind sie der persönliche Ausdruck von Zerbrechen?' Den schlimmsten Gedanken wagte ich gar nicht zu Ende zu denken: ,Gibt sie mit den Tätowierungen bereits sichtbare Zeichen? Ist sie schon am Ende? Hat sie sich insgeheim mit der Einmaligkeit dieser Körpermalerei schön gemacht, um sich damit zu bestrafen? Stellte sie ihren Körper deswegen zur Schau? Betrieb sie eine besondere Art der Prostitution? Wollte das Mädchen nur auffallen, um sich selbst, einem Freund oder sonst jemandem etwas zu beweisen?' Diesen Drang, seinen verletzten Körper einerseits anzuprangern, andererseits aber die Tätowierungen Andere als Schönheit empfinden lassen zu wollen, löste in mir das Gefühl aus, dass es in dem Mädchen sehr, sehr schlimm aussehen musste.
Das Mädchen wollte sicher imponieren. Aber hätte es dafür nicht ganz andere und bessere Mittel gehabt? Mittel, die nicht so unwiderruflich für alle Zeiten waren?
Mit dem Essenstablett in der Hand ging ich auf die beiden zu. Sie saßen an einem großen Tisch, der für acht Personen vorgesehen war. Außer ihnen saß dort aber niemand.
Meine Neugier wuchs. Ich ging an den Tisch. Ich hätte mich einfach hinsetzen können. Ich hätte auch fragen können, ob noch Platz frei ist. Das ist in einer so großen Kantine aber unsinnig. Der Platz war ja frei. Wenn man aber fragt, ob noch frei ist, und man sich dabei an jemanden wendet, den man kennt, dann heißt das ganz klar, dass man eben wegen dieser bekannten Person und in der ganz entschiedenen Absicht, mit dieser Person zu reden, um den Platz bittet.
Die Antwort kann schroff sein, zum Beispiel: „Hm, was? Ach so, ja. Ist ja noch frei,“ und Schluss. Dann kommt man nicht ins Gespräch.
Sie kann aber auch lauten: „Ach Sie sind es. Nehmen Sie doch Platz“, usw. usw. Das ist dann gut.
Ich habe ehrlich gesagt nicht lange darüber nachgedacht, sondern gleich gefragt: „Darf ich mich setzen, ist noch frei?“ und mich auch schon niedergelassen.
Die beiden Frauen haben uninteressiert aufgeschaut, und nur die aus der Registratur schien mich wiederzuerkennen.
Sie sagte: „Ach, Sie, setzen Sie sich ruhig zu uns“.
Das klang sehr vertraut, fast so, als ob sie mich einbeziehen wollte in eine kleine Gemeinschaft.
Es gab etwas Gemeinsames zwischen den beiden, das war sicher. Mein Essen wurde unwichtig. Ich stocherte nur darin herum, aß wenig und schielte immer wieder auf die nackten Arme des Mädchens mit den Tätowierungen. Die befanden sich sogar noch auf den Schultern. Blaue Hautzeichnungen überall.
Nicht gerade eindrucksvoll als Zeichnungen, reichlich einfach und vordergründig sogar, aber als Tatsache machten sie mich betroffen.
Ich dachte angestrengt darüber nach, wie ich mit denen ins Gespräch kommen, wie ich diese Körpermalerei ins Gespräch bringen konnte. Ich entschloss mich, es über die Frau neben mir zu versuchen und sprach sie mit einer Lappalie an: „Arbeiten Sie eigentlich ganztags, Frau W.?“
Sie antwortete mit unendlichen Traurigkeit in ihrer Stimme: „Nein, schon lange nicht mehr. Ich gehe doch zweimal in der Woche noch in ein Altersheim. Hatte ich Ihnen das nicht 'mal erzählt? Wahrscheinlich nicht. Ist auch nicht so wichtig“.
Das Mädchen an der anderen Seite stocherte ebenfalls in seinem Essen herum. Wie es so am Tisch saß, erinnerte es mich an ein Tier, an einen Vogel. Ich dachte an die Bewegungen einer Taube, die das Köpfchen in die Federn steckt und hier und dort etwas zurecht zupft. Ich dachte an die Bewegungen eines Huhnes, das sich in eine Sandkuhle gelegt und die Flügel ganz unnatürlich von sich weggeschoben hat.
Es wäre leicht, ein solches Tier zu fangen.
Das Mädchen gab sich einer trägen Lustlosigkeit hin mit dem Ausdruck, dass ihm ziemlich alles egal war. Die Arme lagen so auf dem Tisch, dass sie eigentlich von der Tischkante hätten herunterrutschen müssen. Es war ihr offenbar viel zu schwierig und zu umständlich, sich bequem aufzulehnen. Die Arme stützten das Mädchen nicht ab. Sie bewahrten den Körper aber immerzu gerade noch vor dem sicheren Abrutschen.
Das Mädchen saß auch nicht aufrecht, wie es meistens junge Mädchen in dem Alter tun, um ihre Figur zu zeigen, oder weil es ihnen anerzogen ist: „Ein Mädchen sitzt gerade am Tisch und nicht krumm wie ein Fiedelbogen“.
Ihre Mundwinkel waren etwas nach unten gezogen, zeigten Geringschätzigkeit und gleichzeitig kindliche Unzufriedenheit. Das mochte gar nicht ihre Absicht sein, stand ihr aber gut.
Der Mund war schön geformt, so richtig zum Zeichnen. Die Schultern waren auch zeichnens- und auf jeden Fall zeigenswert. Darüber trug sie einen dünnen, ärmellosen, schwarzen Pullover. In Gedanken verfolgte ich mit den Augen die Konturen darunter, wie bei einem Aktmodell.
Schöne Schultern haben einen ganz besonderen Verlauf. Er beginnt nämlich schon am Hals und fällt ein ganz klein wenig nach außen ab. Er wandert als eine Erhebung über ein leicht fleischiges Schultergelenk, schwingt danach, dort wo der Oberarm beginnt, mit dem Hauch einer Empfindung nach außen und stürzt, weil es nun so sein muss, nach unten in den weiteren Verlauf des Armes. Schöne Schultern sind ein wunderbares Geschenk und ein Abenteuer für das Auge.
Die Haut spielt dabei eine ganz große Rolle. Trotzdem ist der Verlauf der Formen viel wichtiger. Schultern, die ein Knochengerüst zeigen, werden zum Kleiderständer. Die muss man ja nicht unbedingt allen zeigen oder zeichnen wollen.
Schöne Schultern haben leider nicht immer einen schönen Körper im Gepäck, auch wenn eigentlich jeder Körper irgendwo seinen unerwarteten Reiz hat. Das Auge eines Zeichners sucht ja nicht nur den Reiz des Schönen, sondern viel öfter den des Ausdrucksvollen, die Überraschung.
Reizlose Körper sind nicht von Hause aus reizlos sondern nur, weil sie so reizlos gezeigt werden.
Da wird der Zeichner mit seinen Augen zum Dieb. Seine Augen suchen und finden und stehlen den Reiz für seine egoistischen Zwecke.
Das ist ihm nicht verboten. Er darf sich aber bei diesem Beobachten nicht ertappen lassen, wie mir es schon passiert ist.
Zweimal hatte ich völlig selbstvergessen Frauen zugeschaut, die mir in der Bahn mit ihrem Strickzeug gegenübersaßen.
Einmal war es eine ältere und einmal eine sehr viel jüngere. Sie hatten beide die Blicke unter ihren niedergeschlagenen Augen auf die Arbeit in ihrem Schoß gerichtet. Beste Gelegenheit für mich zum genauen Betrachten.
Ich war dabei recht schamlos vorgegangen und schaute auf alles. Mir entging keines der kleinen Hautfältchen, keine Bewegung der Finger. Ich schaute genau in die Falten der Kleider und auf die Sonnenhärchen ihrer Wangen, der Oberlippen, des Kinns und unter den Ohren.
Jede der Frauen war aber plötzlich wortlos aufgestanden und, ohne mich eines einzigen Blickes zu würdigen, zu einem anderen, weit entfernten Platz gegangen und hatte sich dort hingesetzt. Dort haben sie mit den gleichen gesenkten Augenlidern ihre Handarbeit fortgesetzt.
Es waren die niedergeschlagenen Augen gewesen, die mich so sicher hatten werden lassen. Das hatte ich aber falsch eingeschätzt.
Auch dieses Mädchen in der Kantine, mir gegenüber, hatte den Blick gesenkt. Das Gesicht drückte Gleichgültigkeit aus. Vielleicht irrte ich mich und es war Traurigkeit, einfaches Nachdenken, trotziges Vorsichhinbrüten. Vielleicht war es Betroffenheit, eine persönliche Schwäche, Verlegenheit oder mädchenhafte Unsicherheit.
Geschlossene Augen zu zeichnen oder zu malen ist sehr, sehr schwer. Nicht nur, weil man die Gedanken hinter der Fassade nicht errät, sondern weil sie eigentlich für den Betrachter keine Aussage machen. Als Zeichner möchte ich mich damit nicht zufrieden geben. Nein, die geschlossenen Augen müssen blicken.
Um das zu erreichen, sind zwei Bedingungen zu erfüllen. In der Zeichnung müssen die geschlossenen Augen gewölbt erscheinen, um eine nicht vorhandene gemeinsame Blickrichtung vorzutäuschen. Das ist in Wirklichkeit zwar nicht der Fall, weil die Augen geschlossen sind. Das Auge des Betrachters aber verlangt das.
Nur so ist es für den Betrachter richtig.
Er würde auch sofort feststellen, wenn hier irgendetwas nicht stimmte. Die Augen im Bild würden ihm zu schielen scheinen. Das wäre furchtbar. Wenn alles stimmen soll, müssen die geschlossenen Augen also eine einzige Blickrichtung haben.
Das zweite wesentliche, das noch viel wichtiger ist als die Blickrichtung, ist etwas, das nur Kenner begeistert. Das wird nur von den Menschen richtig verstanden, die sich selbst schon einmal um die Lösung dieses Problems bemüht haben. Andere können es zwar nachempfinden, aber nicht begründen. Sie erkennen die Ursache nicht.
Das, von dem ich nun spreche, ist das Malen oder Zeichnen von geschlossenen Augen, die trotzdem gucken, schauen, die voll auf den Betrachter gerichtet sind. Das waren zum Beispiel die Augen der beiden Frauen aus der Bahn gewesen. Die haben auf mich geschaut, ohne mich angesehen zu haben. Die hatten mich durch ihre niedergeschlagenen Augenlider beobachtet. Zu zeichnen, wie die den Beobachter beobachten, und, dem Betrachter eines solchen Bildes, dieses Gefühl hautnah zu vermitteln, das ist das allerschwierigste.
Die Frauen an meinem Tisch kamen mit dem Essen genauso wenig voran wie ich.
Ich wagte einen neuen Vorstoß und wandte mich an die Jüngere. Ich blickte dabei unverwandt auf ihre Schultern, wo der Pullover eine der Tätowierungen etwas verdeckte. Der Pullover hatte zwar keine Ärmel, begann also direkt auf den Schultern, ließ aber noch ein Stückchen einer Tätowierung herausschauen. Ich hätte nicht sagen können, was ich sah, aber ich meinte, wenigstens zwei Farben unterscheiden zu können. Mir kam es auch nicht auf das ,Was' bei den Tätowierungen an, sondern auf die Tatsache, dass ich sie sah.
„Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie so einfach frage, aber mich interessiert es... Wissen Sie, ich kann mir das nicht anders erklären... Sagen Sie mir bitte, sind die Tätowierungen echt?“ Ich sah deutlich, dass es nicht die einzige Malerei auf ihrer Haut war, und meine Frage war mir selbst dumm und unangenehm genug. Es war ganz offensichtlich, dass es hier nichts Unechtes gab.
Das Mädchen sagte nur: „Stimmt. Sind echt“, und schaute dabei nicht hoch. Sie schämte sich nicht etwa, sondern sie war von meiner Frage gelangweilt.
Die Frau, ihr gegenüber gab bessere Auskunft: „Das ist meine Tochter. Die Tätowierungen sind unser größtes Problem. Meine Tochter wünscht sie sich alle wieder weg. Sie weiß nur nicht wie. Übrigens“, zu ihrer Tochter, „das ist ein Kollege, ist Ingenieur bei uns“.
Die Tochter schaute kurz hoch, mir in die Augen, und als ob sie dort etwas Erfreuliches gefunden hätte, sagte sie: „Wissen Sie, wenn ich mich irgendwo vorstelle, trage ich sonst ein kleines Jäckchen mit langen Ärmeln, damit man nichts sieht. Wenn ich dann den Job habe, muss ich den Kollegen langsam klarmachen, wie ich am Körper aussehe. Die meisten verstehen das ja nicht. Können sie auch nicht. Das geht noch. Aber sobald ein Chef etwas mitbekommt, denkt der nur noch an seine Kunden, die vielleicht mal ins Büro kommen können. Dann flieg' ich entweder gleich wieder 'raus, oder der kommt jeden Morgen und sieht nach, ob ich die Jacke mit hab'. Ich ertrag das alles bald nicht mehr“.
Die Mutter: „Das sind ihre Jugendsünden. Fragen Sie nicht, wie ich darunter gelitten habe. Das kann sich kein Mensch ausmalen. Und nun soll alles wieder runter“.
„Wie weit geht denn die Malerei. Ich meine setzt sie sich am ganzen Körper fort?“
Die Frauen sahen mich ein wenig fassungslos an. Ich schämte mich nun richtig. Das Mädchen hätte meine Tochter sein können, und ich stellte Fragen, scheinbar mit einer derartigen Begehrlichkeit, als wollte ich das Mädchen ausziehen und mir alles an ihr ansehen und das gleich, gleich hier am Tisch und beim Essen.
Ich warf ein: „Nein, nein. Es interessiert mich zwar, aber entschuldigen Sie bitte meine Neugier“.
„Sie glauben doch nicht, dass ich nur das bisschen habe, was Sie sehen, oder?“
Die Mutter stimmte zu: „Wenn es nur das wäre. Nein, nein, das geht schon weiter“.
Ich sagte: „Dann gibt es jedenfalls an Ihrem Körper viel zu entdecken“.
Beide lächelten müde.
Ich sagte: „Körpermalerei ist die älteste Kunstform, die man sich denken kann. Kinder lernen sie als erste, wenn sie ihren eigenen Körper mit Farbe verfremden dürfen“.
Das hatte ich nur aus Spaß gesagt, um die beiden aufzuheitern. Ganz offenbar hatten sie das aber noch niemals in ihrem Leben gehört und diesen naheliegenden Gedanken noch niemals gehabt. Sie waren völlig überrascht davon.
Die Tochter sagte sofort: „Stimmt das wirklich?“
Und die Mutter sagte: „Dann sind deine Tätowierungen vielleicht sogar noch Kunstwerke“.
Mir fiel auf, dass die beiden ungehemmt und in ganz normaler Lautstärke über die Bilder auf ihrem Körper sprachen. Kein Geheimnis, nichts Verborgenes lag in ihren Stimmen und dass ich mich mit ihnen darüber unterhalten konnte, war für mich ganz ungewöhnlich und mir neu.
„Früher hatte ich noch Hemmungen, die Tätos offen zu zeigen. Die durften nur meine Freunde sehen. Nur mit denen habe ich darüber gesprochen“, kam von der Tochter.
Die Gelassenheit, die das Mädchen jetzt an den Tag zu legen schien, kam mir unglaubwürdig vor. Für mich war es ein Kokettieren mit ihrer Schamhaftigkeit. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie sie hin und her pendelte zwischen braver Wohlerzogenheit, einem sich lieber einmal zu viel Artigbedanken, einem unterwürfigen Knicks beim Dankeschön sagen, und einer gewöhnlichen, verletzenden, Türen schmeißenden Ver- und Unerzogenheit. Beidem lag dieselbe Koketterie zugrunde.
Beides mochte ohne innere Beteiligung, als ein Spiel, als eine Laune über sie kommen, beides mochte sie als eine Art schauspielerisches Tun an sich ausprobieren.
Hier am Tisch probierte sie sich aus. Einmal legte sie einen umgänglichen Ton in ihre Stimme, während sie mit ihrer Körpersprache und Körperhaltung andere, beleidigende Töne anschlug.
Ich traute ihr zu, dass sie, ohne Ankündigung und ohne Grund aufstehen und uns den Tisch mit allem Essen und Trinken über den Schoß kippen konnte. Solche Gefühle kannte ich selbst, die waren mir geläufig.
Mit diesen Gedanken sah ich zu ihr hinüber. Sie blitzte in demselben Augenblick aus schmalen Augen so scharf und verletzend zurück, dass ich mich bestätigt fand. So wie sie jetzt schaute, zog sie ein schauspielerisches Training ab.
Die Übung hieß: ,Augenlider hoch, direkt anschauen, sehen, ob Verunsicherung möglich ist, Verführung ins Spiel bringen und, falls Gewinn in Aussicht, Gegner mit allen Mitteln, möglichst mit Blickwiederholung und dem gleichen Augenaufschlag, vollständig und gründlich vernichten'.
Die Übung hieß weiter: ,Bei Verführung: Sieg über den Gegner bis zu seiner Niederlage anstreben'. Das ist ein heißes Spiel, ein Spiel mit persönlichem Einsatz. Aus der Übung kann schnell Ernst werden, und wer sich darauf einlässt, muss bei eigener Unversehrtheit auf immer neue Angriffe gefasst sein, solange jedenfalls, bis das Interesse der anderen Seite nachlässt, in diesem Fall das nachlassende Interesse des Mädchens am Schauspielern selbstverständlich und nicht am zu vermutenden Interesse an seinem Gegenüber. Diese Vermutung meinerseits, dass das Mädchen nämlich ein Interesse an mir hätte haben können, wäre in ihren Augen schon der Sieg über mich gewesen. Hat sie bei ihrem Gegenüber erst einmal das Interesse an sich geweckt, dann ist das für sie natürlich die Bestätigung einer guten theatralischen Leistung. Ihr Interesse an der Person ist damit vorüber, abgekühlt und auf null. Schafft sie das alles aber nicht, sondern hält der Gegner ihren Angriffen stand, so wie ich, dann rettet er sich vielleicht auch ihr Interesse, mit der Aussicht, wirklich mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und das war meine Absicht.
Das wäre der Augenblick, an dem es für sie Ernst, für sie gefährlich werden könnte. Sie würde dann einem anderen, als ihrem schauspielerischen Interesse, ausgeliefert werden. Weil das aber nicht ihre Absicht war, kann es schnell zu Kurzschlusshandlungen führen. Ihr Blick war also als eine Drohung zu verstehen. Ich sollte mich nicht weiter für sie interessieren. Er war ein Befehl. Ich verstand ihn so und machte sie damit für einen winzigen Augenblick zu meiner Partnerin. Das mochte sie beruhigen, vielleicht aber auch verunsichern, vielleicht sogar dazu führen, dass sie sich erst recht angegriffen glaubte. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Ich wollte sie ja nur ein wenig befragen dürfen.
Mit der Aufmerksamkeit, mit der sie mich belauerte, ihrer Unrast, ihrer Sucht zu verletzen und Suche nach Verletzungen, erkannte sie, was ich vorhatte, und tat von nun an alles als für sie ohne jedes Interesse ab.
Von ihr war augenblicklich nichts mehr zu erfahren. Aus ihr war nichts mehr herauszubekommen.
Ihre Arme machten eine überflüssige Bewegung. Ihr Kinn war fast ganz in den Winkel des angezogenen rechten Oberarmes und des rechten Unterarmes, der auf dem Tisch lag, gesunken und drückte ihn langsam auseinander. Schlaffheit wurde demonstriert, Beobachten, Belauern, Wirkung und Auswirkung von Annähern an ein fremdes Tier, nämlich an mich, ausprobiert.
Ihre Augen signalisierten: ,Vielleicht kann ich dich doch noch irgendwie klein kriegen. Im Moment habe ich zwar keine Lust, aber wer weiß'.
Ihre ganze Schauspielerei war mir sehr willkommen. Sie steigerte mein Interesse. Ich hoffte nun auf eine Bemerkung der Mutter. Die kam aber nicht. Das vermisste ich sehr. Es hätte gut in meine Erwartungen gepasst.
Einmal nur noch stöhnte die Mutter plötzlich auf, als müsste sie einen schweren Gedanken beiseiteschieben.
Die Tochter sagte darauf zu ihr: „Lass das doch“. Nichts weiter. Ich verstand selbstverständlich nichts.
Die Mutter sah mich an, als ob sie mir etwas erklären wollte, ließ es aber bleiben und sah wieder zu ihrer Tochter hinüber. Die saß immer noch schlaff am Tisch und betrachtete ganz aufmerksam die kleinen Härchen an ihrem Arm.
Ich versuchte es noch einmal mit meinem Mittagessen. Es war ganz kalt geworden.
Ich hörte also auf, nahm mein Tablett, wünschte den beiden noch guten Appetit, sagte: „Mahlzeit“ und ging weg, um es auf ein Laufband zu stellen. Das war weit entfernt.
Von dort versuchte ich zurückzuschauen und hoffte, die beiden zu erkennen. Das war aber nicht möglich. Mein Herz schlug heftig und hart, was ich mir nicht erklären konnte. Früher hätte ich es hingenommen, als ein Gefühl von Erregtheit, im harmlosesten Fall von Aufgeregtheit. Jetzt war es aber wegen einer Unentschlossenheit, nein, eigentlich einer Angst.
Ich brauchte keine Angst zu haben, und doch hatte ich sie.
Ich dachte daran, welche Schwierigkeiten ich haben würde, um wieder mit dem Mädchen ins Gespräch zu kommen, etwas über es zu erfahren. Es war mir klar, dass sie nur heute und nur zufällig und sicher nur dieses eine Mal in der Kantine saß. Die Mutter hatte vielleicht etwas von ihr gewollt und sie eingeladen. Und selbst, wenn sie hier ein zweites Mal erscheinen würde, wäre es undenkbar, dass ich ihr gerade in der Zeit wieder begegnen würde.
Das war beklemmend. Wie sollte ich mehr über sie in Erfahrung bringen, viel mehr, alles, was es in Erfahrung zu bringen gab, wenn ich sie nicht sprechen, nicht fragen konnte.
Gewiss gab es die Mutter, die jederzeit von mir angesprochen werden konnte. Aber würde die mir letzten Endes sagen wollen und können, wie es in ihrer Tochter aussah? Das war doch kaum zu erwarten. Das ließ mir keine Ruhe, davor bekam ich Angst.
II.
Mein Alltag sah nun so aus: wenn ich arbeitete, konnte ich mir fremde Gedanken gut vom Leibe halten. Ich dachte nicht an meine begonnenen Bilder und nicht an dieses Mädchen. Ich war ganz bei der Sache, so sehr, dass man mich manchmal ansprach, ob ich denn wirklich meine Arbeit so sehr liebte, dass ich darin aufzugehen schien. Das machte mich stutzig, weil ich doch wusste, dass ich mich damit nur vor den anderen Gedanken, an meine Bilder und an das Mädchen rettete. Und das konnte nur klappen, wenn ich mich ausschließlich um meine Arbeit kümmerte. Näherte sich aber der Feierabend, so erfuhr ich meine innere Unruhe neu. Sie ließ mich wieder an meine begonnenen Bilder denken. Saß ich schließlich zu Hause am Brett, an einem Bild, einer Zeichnung, dann kam ich nicht voran, weil ich an dieses Mädchen denken musste. Vor den Gedanken an das Mädchen floh ich am nächsten Tag in die Arbeit, von dort am Abend wieder in meine Bilder, zu denen ich wegen meiner Gedanken an das Mädchen nicht kam und deswegen wieder an den nächsten Tag dachte und so weiter und so weiter.
Immer, wenn ich mir über diesen Kreislauf Klarheit verschafft hatte, kam das Herzklopfen dazu. Ich konnte es nicht verstehen. Eines war sicher, meine innere Enge wuchs, und ich musste den wohl unbequemeren Umweg über die Mutter gehen und versuchen, durch sie an das Mädchen heranzukommen.
Es vergingen etliche Wochen der Warterei, weil ich erfahren hatte, dass die Mutter sich im Urlaub befand. Gleich nach dem Urlaub wäre sie zwar für mich erreichbar gewesen, inzwischen hatte mich aber der Mut, sie zu fragen, wieder verlassen.
Eine kleine Aussicht hatte ich dennoch, nämlich ein bevorstehendes Weihnachtsfest sollte in den Räumen der Behörde stattfinden. Dort könnte ich sie ansprechen, dort könnte ich ihr auch erklären, dass mich an dem Mädchen so ungewollt viel beschäftigte, und dass ich voll unruhiger Neugier mit der Tochter in ein Gespräch kommen wollte. Diese Aussicht beruhigte mich ein wenig.
Die Feier rückte näher. Ich war immer noch sehr unentschlossen. Meiner Absichten war ich mir selbst immer noch nicht sicher, und es war unklar, wie ich sie der Mutter gegenüber formulieren sollte.
Eigentlich brauchte ich sie ja nur nach der Adresse des Mädchens zu fragen. Eine scheinbare Begründung musste reichen: ,Ich möchte Ihre Tochter nach den Tätowierungen befragen, nach den Gründen dafür, und so weiter, aus reiner Neugier. Ich möchte Sie im Grunde nur als meine Fürsprecherin gewinnen'. Ja, das hörte sich gut an, so könnte ich es machen.
Am späten Nachmittag fand die Feier statt. Die Mutter war mit Handreichungen und allem möglichen unentwegt beschäftigt, so dass ich sie in nichts verwickeln konnte. Plötzlich aber, als hätte sie ein Engel dahin geschoben, setzte sie sich völlig ermattet direkt neben mir auf einen Stuhl. Ich sah die erhoffte Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen und versuchte es auch sofort.
„Frau W., ich hatte schon seit längerer Zeit vor, sie noch ein wenig nach ihrer Tochter auszufragen. Sie wissen doch, dass ich so sehr neugierig auf die Gründe für die Tätowierungen bin“.
„Ach das sind doch ganz fürchterliche Geschichten. Ich wünschte zu oft, dass es die gar nicht gäbe“.
„Wissen Sie, wenn es meine Tochter wäre, würde ich sicher ganz genau so darüber denken wie Sie, aber so, als Außenstehender, finde ich das alles auch hoch interessant“.
„Das ist nicht interessant, sondern das ist für uns mit der Tatsache verbunden, dass wir uns bemühen müssen, dieses Kind langsam ernst zu nehmen“.
Das erstaunte mich sehr. Ich wäre doch nicht auf den Gedanken gekommen, dass die Eltern dieses Mädchen nicht ernst nehmen konnten. Die Mutter fuhr fort: „Und erst recht, wo sie doch nicht mehr bei uns wohnt“.
Ich sah meine Gelegenheit, sie nach der Wohnung des Mädchens zu befragen: „Meinen Sie, dass ich sie 'mal anrufen und vielleicht in ihrer Wohnung besuchen könnte, vielleicht sogar mit Ihnen?“
„Sie haben eine ganz falsche Vorstellung. Die hat keine Wohnung. Wir wissen nicht, wo sie sich aufhält. Wir wissen nur, dass sie mit einem verrückten Österreicher, so einem ,charmingboy' zusammenlebt. Der ist auch noch elegant und sehr freundlich. Den will sie heiraten. Also für uns ist das alles ganz, ganz schrecklich. Wir sind richtig unglücklich“.