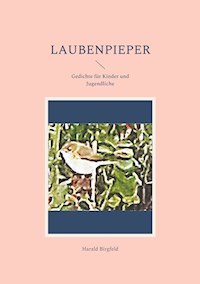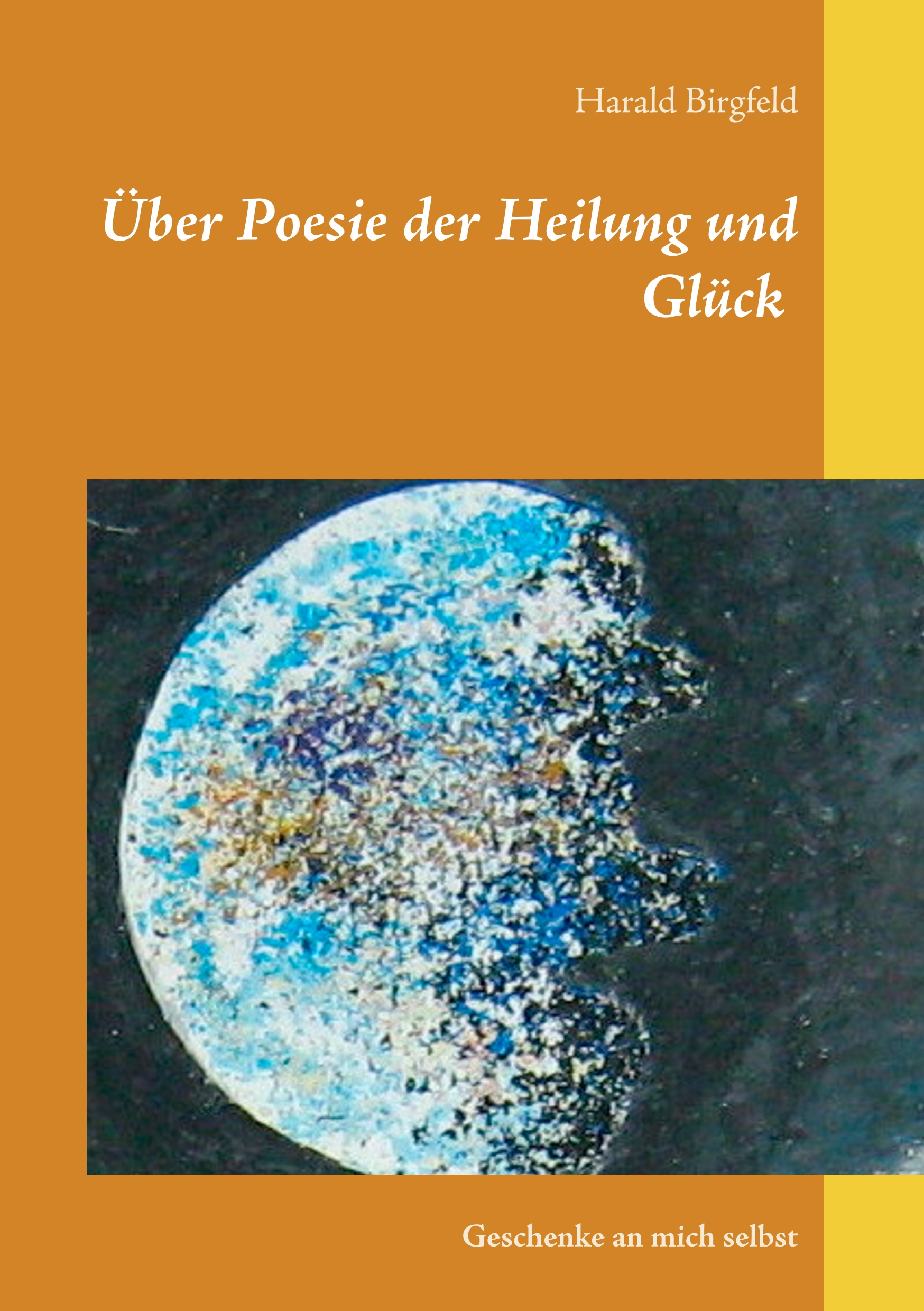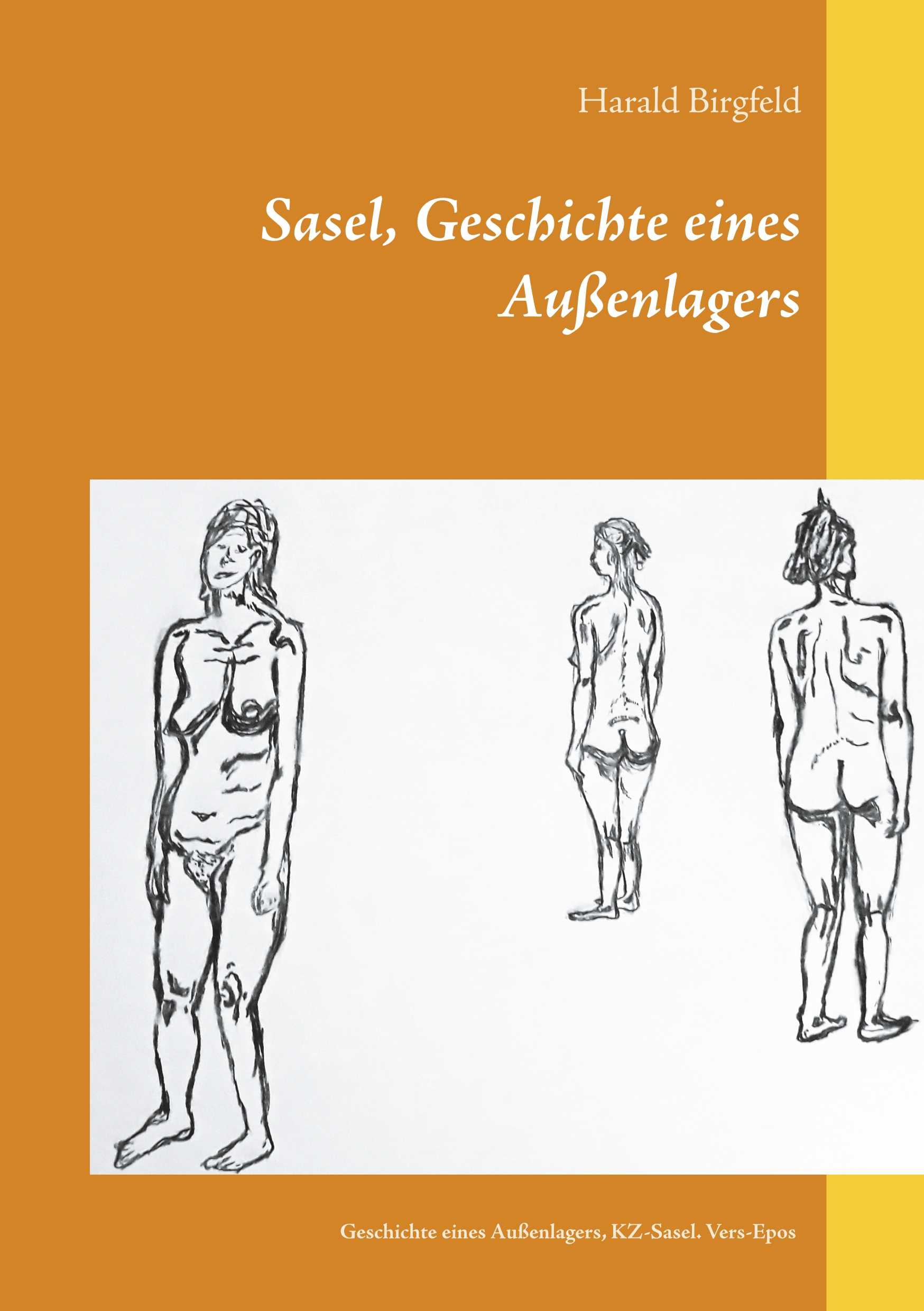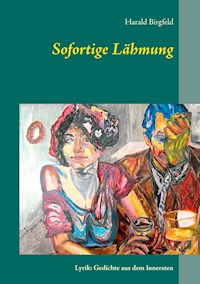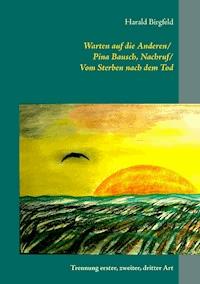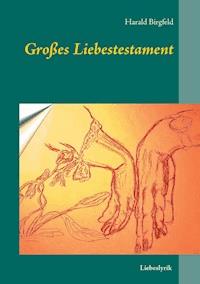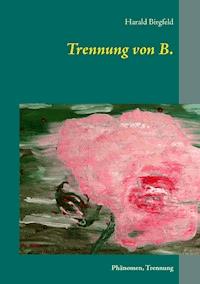
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Harald Birgfeld schrieb seine Geschichte der Trennung von B. überwiegend während der Fahrten in der Hamburger S-Bahn zur und von der Arbeit. Der Autor sieht sich einem neuen Phänomen, Trennung, in seinem ganz normalen Familienleben gegenübergestellt. Aus dem Gutachten, 1986, der an der Universität Freiburg tätigen Germanistin, Gabriele Blod: "Es lohnt sich, einmal einen heutigen Dichter kennen zu lernen, der mit der deutschen Sprache einen faszinierend fremden Weg betritt und trotzdem dem Leser Freiraum lässt für eigene Gedankengänge, ohne dass die Probleme in erhobener Zeigefingermanier zu zeitkritischen Trampelpfaden werden." Harald Birgfeld, geb. in Rostock, lebt seit 2001 in Heitersheim. Von Hause aus Ingenieur, befasst er sich seit 1980 hauptsächlich mit Lyrik. Von den 53 Büchern, die online veröffentlicht wurden, erschienen bisher 17 auch im Buchhandel. Alle Bände können, jedermann zugänglich, online gelesen werden. In mindestens 27 Anthologien ist Birgfeld vertreten. Harald Birgfeld schrieb seine Gedichte, inzwischen mehr als 12.000 Strophen, überwiegend während der Fahrten in der Hamburger S-Bahn zur und von der Arbeit. Aus der Presse: Das Hamburger Abendblatt und andere Zeitungen berichteten vielfach über Harald Birgfeld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
Ihrem Bruder und seiner Frau schrieb ich
Die im Ausland
In einem Punkt
Der Misserfolg
Ich hatte B. in guter Absicht
Ein Bekannter sagte
Wir hatten herrlich warmes Wetter
Ich ging weiter in meine
Wieder überkam mich große Sehnsucht
Das Straßenfest entpuppte sich
Über dem Land stand himmelhohe Hitze
Zuhause wurde es mir zu eng
Mein Gefühlshoch
Ich hatte keine Ideen mehr
Ich wurde sehr krank
Ich schrieb B.
B. auf einer Postkarte an mich
Deine Stummheit
Zwang mich zu lieben.
Deine Stummheit
Zwingt mich zu schreiben.
Deine Stummheit
Erreicht mich
Jeden Tag.
1
Ihrem Bruder und seiner Frau schrieb ich nach Afrika einen Brief. Ich wollte mich ihnen mitteilen. Ich selbst brachte den beiden zwar nicht übertrieben viel Vertrauen entgegen, wusste aber, dass B., Bruder und Schwägerin voll vertraute. Der Brief wurde ziemlich lang. Das lag daran, dass meine Schwägerin dort im Ausland mit sehnsuchtsvollen Augen auf Nachrichten aus der Heimat hoffte und extra, um ganz sicher zu gehen, täglich ihren ‚boy' zum post-office schickte. Es könnte ja sein... Nun, mein längerer Brief sollte sie freudig überraschen und vielleicht sogar ein wenig für mich einnehmen.
Ich schrieb in der Hauptsache, wie es zwischen mir und B. stand und wie ich in meiner Hin- und Hergerissenheit alles versuchte, die Wirklichkeit zu sehen und gleichzeitig alles Schlimme daran zu übersehen oder doch zum mindesten dessen Wahrnehmung zu verhindern. Es war eine Art va-Banque-Spiel. Ich setzte mit dem Brief alles auf eine Karte, mit der Gefahr, B. entweder ganz zu verlieren oder der Aussicht sie mit einer breitflächig angelegten Sympathiewelle und vermittelnden Worten der beiden aus dem Ausland für mich zurückzugewinnen.
Vieles von dem, was ich schrieb, betraf meine Familie, die Kinder und die Bekannten. Ich berichtete so gut ich konnte und so gut ich es wusste: „...B. geht es nach dem Besuch bei euch anscheinend doch nicht so gut obwohl sie sehr gerne zu euch gereist ist und sich wohl hauptsächlich durch das Beisammensein auch entspannt hat. Ich habe sie nämlich, nach ihrer Rückkehr und das erste Mal nach unserer Trennung, auf ein Glas Wein einladen können. Sie sagte mir Tage danach am Telefon, dass ihr Kreislauf usw. durch die Begegnung mit mir sehr belastet worden sei. Ihr Herz hätte wie verrückt geschlagen. Das machte mich traurig und ich habe zu ihr gesagt: ‚B. das war Herzklopfen’.
Sie: ‚Du meinst, dass ich Herzklopfen wegen der Begegnung mit dir hatte? Das glaub ich bestimmt nicht’.
Ich habe ihr gesagt, dass ich seit meinem sechzehnten Lebensjahr, seit sie mir das erste Mal über den Weg gelaufen war, dieses Herzklopfen kannte. Das war siebenunddreißig Jahre her und seit dem mein ständiger Begleiter, wenn ich nur an sie dachte oder sie sah. Für mich war das ganz normal. Siebenunddreißig Jahre lang. Im Brief fuhr ich fort:
„...Ich denke, dass es zurzeit das Wichtigste ist, ihr zu einer besseren Gesundheit zu verhelfen. Ich werde ein Gespräch mit ihrem Arzt führen und mich beraten lassen. Vielleicht kann ich dazu beitragen, dass sie sich wohler fühlt und sich unser Verhältnis sogar wieder bessert.
...Ich möchte alles tun, um sie gesund und fröhlich zu sehen, mit dem Ziel, ihre Liebe zurückzugewinnen. Ich möchte das nicht so einfach ausschließen. Wenn ich nur von der Situation ausgehe, dass dies für uns beide schlechte Zeiten sind, so habe ich doch irgendwann einmal versprochen, auch in solchen Zeiten zu ihr oder zu uns zu halten. B. tut sehr viel für die Schule. Das lenkt sie ab. Das ist gut für sie. Sie hat aber schon in den letzten Jahren viel zu viel an sich gearbeitet und enorme Schritte gewagt. Sicher wird sie dabei auf die vorprogrammierten Schwierigkeiten gestoßen sein: mangelnde Anerkennung durch die Kollegen, eigene Unsicherheit, und immer wieder an die eigenen Grenzen stoßen.
B. ist mutig und ich anerkenne alles, was sie macht. Ich bewundere auch ihre anmutige, freundliche Art und ihr liebes, weibliches Lächeln. Damit verzaubert sie viele. Dinge packt sie neuerdings aus eigenem Willen an. Natürlich hat sie unsere Trennung auch nur mit diesem Mut bewerkstelligen und bis jetzt durchstehen können. Das heißt nicht, dass sie alles richtig gemacht hat, aber sie handelt jetzt wenigstens, wenn sie überzeugt ist.
In den letzten Monaten, bis vor etwa vierzehn Tagen, habe ich, um mich von den vielen Tränen und Verzweiflungsanwandlungen abzulenken, an einem Buch gearbeitet. Das ist derzeit auf Reisen zu vier Verlagen. Es wäre nicht nur Glück, sondern auch Zufall, wenn es angenommen würde. Ich weiß, dass nur ein einziges von 100 eingesandten Manuskripten angenommen, gedruckt und veröffentlicht wird. Es schildert, unter dem scheinbaren Anlass von echten Tätowierungen an einem jungen Mädchen, die seelischen Tätowierungen, die es eigentlich erfährt und hat. Es ist viel von B. dabei und auch Selbsterfahrenes.
Ich habe durch das getrennte Wohnen lästige Alltagsprobleme, zum Beispiel, weil ich nicht selbst koche und in der Woche nur mit Kantinenessen versorgt werde.
Zu B. habe ich kürzlich am Telefon gesagt: ‚Ich muss hier meinen eigenen Fraß essen und du kochst für andere, die dir überhaupt nicht nahe stehen’. Das war auch ironisch gemeint, weil ich dabei an den ‚Hungerkünstler', H, und unseren ehemals gemeinsamen Freund, E, samt Tochter dachte. Die profitierten kräftig von B.'s Kochkünsten.
Das war aber Wasser auf ihre Mühle: ‚Das sagst du? Wo du so oft über mein Essen gemeckert hast...' usw. usw. Sie reagierte unerwartet heftig und ungewohnt grob.
Naja, sie hatte sicher recht, aber ich jetzt auch.
Wir hatten gestern 20 Grad bei uns und heute sind mindestens noch einmal 18 Grad. Das ist für diese Jahreszeit sommerlich warm. Morgen soll es wieder kühler werden. Wenn's nach dem Wetter geht, müssten sich alle pudelwohl fühlen. Für euch wäre das wohl schon wieder Rückbesinnung auf den Winter, oder?
H., du schreibst in deinem Brief, dass B. und ich ja noch jung genug wären, um unserem Leben eine andere Richtung zu geben.
Das ist für mich kaum denkbar. Ich glaube nicht, dass ich einfach, wenn Probleme und Schwierigkeiten in der Ehe auftreten, das Recht habe, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich denke, dass ich das auf gar keinen Fall machen soll. Unsere Probleme beginnen sich für mich zu konkretisieren und letzten Endes könnte sich herauszustellen, dass eine Schuld nicht richtig greifbar ist. Bei uns sieht das doch so aus:
B. geht es gesundheitlich und seelisch nicht gut. Sie ist offenbar richtig krank. In dieser Situation will ich sie auf keinen Fall sich selbst überlassen. Das andere ist, dass ich leidenschaftlich an ihr hänge. Ich war bis jetzt überzeugt, dass sie auch selbst von mir zurückerobert werden wollte. Das war aber gerade mein Besitzanspruch an sie, der sie ganz offenbar so krank gemacht hatte. Daraus ist auch meine dauernde Eifersucht entstanden. Hierüber bin ich mir, seit ich eine Therapie begonnen hatte, sehr schnell klar geworden. Darin sehe ich eine Möglichkeit, mein Verhalten zu verändern und uns letzten Endes die Aussicht für einen gemeinsamen Neuanfang zu schaffen. Ich habe diese Hoffnung, obwohl ich weiß, dass sich das noch alles in meinem Kopf abspielt und der Krake in meinem Bauch ein Umsetzen in die Tat mit allen körpereigenen Mitteln verhindert. Trotzdem spüre ich, wie sich dieses Geschwür, Eifersucht und Besitzanspruch, mit jedem klaren Gedanken sogar aus den Fingerspitzen und Zehen zu einem kleinen Häuflein zurück- und zusammenzieht. Eines Tages werde ich vielleicht damit umgehen können.
B. kann ich davon überhaupt nicht überzeugen. Das Gespräch mit ihrem Arzt soll nun helfen, möglichst das Richtige zu tun.
Vielleicht versteht ihr ein wenig, was ich meine, und dass mir die Lösung, ‚neue Wege', nicht gut genug zu sein scheint. Erst, wenn ich alles ausgeschöpft habe und mir später keinerlei Vorwürfe machen muss, will ich daran denken. Wie gesagt, heute bin ich noch voller Zuversicht. Übrigens würde ich wirklich gerne eure Einladung nach Frankreich annehmen und noch einmal Urlaub auf dem Hof machen, aber natürlich nur mit B., und ob das jemals etwas wird, hängt von so vielem ab. Ich hoffe immer noch auf einen Mittler, dem B. traut und glaubt.
Seid gegrüßt“, usw. usw.
Wie viele Briefe habe ich in der Zeit versandt, so oder ähnlich. Niemand traute sich in eine zerbrechende Ehe, die über mehr als drei Jahrzehnte geführt worden war, der drei erwachsene Kinder entsprungen waren, der einen oder anderen Seite Mut zuzusprechen.
2
Die im Ausland wollte ich nicht weiter auf dem Laufenden halten. So erfuhren sie nichts von meinem Besuch bei dem Arzt. Dort verlief es aber so:
Als ich in die Praxis kam, begrüßte mich eine freundliche Dame um die fünfunddreißig. Sie war mit dunkelblauen Stricksachen, Rock und Jacke gekleidet, und trug dazu eine weiße Bluse mit engem Kragen. Daran waren Spitzen. Sie hatte fast schwarze Strümpfe an. Der Rock hörte oberhalb der Knie auf. Sie sah B. sehr ähnlich. Das stimmte mich froh und traurig zugleich. Ihre Stimme und die wenigen Worte, die sie sagte, um meine Adresse zu erfahren, passten in die Ruhe des großen Flures. Dort stand ihr riesiger weißer Schreibtisch. Die Dinge auf dem Tisch und der ganze Eindruck, den ich hatte, ließen mich nicht an den Empfang in einer Arztpraxis denken, sondern eher an ein Büro in einer Vorstandsetage.
Ihr Luxussessel, auch ganz in Weiß, hätte besser dorthin gepasst, als an diesen Ort. Ihre Stimme war warm, weich, zart und sie flüsterte fast, als sie mich befragte. Ich antwortete normal, nicht zu laut, sah aber auch keinen Grund, leise zu sprechen. Anfangs waren wir beide allein, dann kam ein hemdsärmeliger Mann, so in meinem Alter, vielleicht ein wenig jünger, dazu. Er musterte mich mit huschenden Blicken. Eigentlich bemühte er sich, mich nicht wahrzunehmen, und wandte sich übertrieben der Dame zu, mit der er etwas zu klären zu haben schien. Er tauchte mit seinem Gesicht tief in ihre Haare und tuschelte ihr etwas ins Ohr. Dabei sah er mit schrägem Blick zu mir, grüßte, nickte halb und halb herüber und zog sich auf leisen Sohlen schnellstens wieder zurück in sein Zimmer. Er trug eine Lederweste über einem karierten Hemd. Dazu hatte er Jeans an. In seinem Gesicht wuchs ein grauer Backenbart. Der war auf dem Kinn ausrasiert. Es entstand so eine haarlose Schneise vom Hals bis zur Unterlippe in einer Breite von etwa zwei Zentimetern. Er erinnerte mich an einen Gartenzwerg. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er der Arzt sein sollte.
Ich nahm eine Lesemappe, setzte mich in einen flaumweichen Ledersessel und musste notgedrungen auf die vielen gemalten Bilder sehen, die an der Flurwand hingen.
Der Flur war gleichzeitig Wartezimmer. Alles hier war hell und in Weiß gehalten. Alle Bilder hatten etwas Schreckliches gemeinsam. Sie zeigten Menschen, die mit Doppelkörpern, Doppelgesichtern oder Doppelköpfen herumirrten. Sie irritierten mich, machten mich schon beim ersten Anschauen nervös und stifteten so Verwirrung. Die Gesichtszüge darin waren unfreundlich und die Blicke rücksichtslos vorwurfsvoll auf den Betrachter gerichtet; die Bilder primitiv, als hätten Kranke sie geschaffen. Sie schienen als abschreckende Beispiele hier zu hängen: ‚Seht, so kann es euch ergehen, wenn ihr nicht brav und gesund seid’.
Sie waren aufdringlich und bedrohlich. Ja, sie wollten mich einschüchtern. Der Arzt, wer immer er war, trieb ein brutales Spiel mit mir, seinem Patienten. Dagegen lehnte ich mich sofort auf.
Ich musste noch ein paar Minuten warten, dann kam der Mann erneut aus seinem Zimmer, ging wieder an mir vorbei zu seiner Empfangsdame, und eilte danach mit Karteikarte und Zettel bewaffnet, auf mich zu. Er war also doch der Arzt. Er begrüßte mich jetzt richtig und unerwartet freundlich und bat mich in sein Zimmer.
Dort drinnen war eine völlig andere Stimmung. Durch Bücherwände und eine geschickte Aufstellung von Gegenständen, machte er sich mit einem dunkelbraunen übergroßen Kippledersessel, der sich als ein Mantel um ihn legte und der hinter einem schweren ebenfalls dunkelbraunen Schreibtisch stand, zum Mittelpunkt des ganzen Raumes. Er saß im blendenden Licht vor dem Fenster, während ich dagegen anblinzeln musste. Das ärgerte mich zusätzlich.
Ich sollte mich setzen. Mein Sessel, genauso dunkelfarbig, hatte, außer Armlehnen, nicht solche Bequemlichkeiten wie seiner. Während er sprach, konnte er nämlich genüsslich in seinem Sessel hin und her schaukeln. Ich dagegen konnte nur auf dem glatten Ledersitz nach vorne rutschen und musste mich im übrigen an seiner Schreibtischkante abstützen, wenn ich ihm näher sein wollte oder um deutlicher erklären zu können.
Ich bekam den Eindruck, dass der Arzt nicht ehrlich war und es vor allen Dingen nicht sein wollte. Während des Gespräches vermied er anfangs jeden Blickkontakt mit mir und sah nur solange auf oder zu mir, wie es unumgänglich war, um eine Frage oder eine Antwort loszuwerden. Manche Frage stellte er, indem er auf seiner Karteikarte herumschrieb und überhaupt nicht aufschaute. Ich dachte, dass er wohl selbst Probleme hätte. Er bestätigte mir dann jedoch in sehr vernünftigen Worten und in einer mir verständlichen Sprache, dass B. bei ihm in therapeutischer Behandlung sei: „Ich führe dieses Gespräch mit Ihnen mit dem Einverständnis Ihrer Frau und ich werde ihr auch danach davon berichten“.
Ich trug ihm also mein Anliegen vor: „Ich möchte in Zukunft alles Erdenkliche tun, um meiner Frau bei der Gesundung zu helfen. Ich möchte wissen, was ich machen kann, damit durch mich nicht noch größere Fehler passieren, als sie vielleicht jetzt schon geschehen sind“.
Das hörte er sich sehr aufmerksam an: „Es ist sicher, dass das, was ihre Frau durchmacht, nicht mit einem Verschulden von Ihnen als Partner zusammenhängt oder so zugewiesen werden kann. Das Problem ist einzukreisen auf gewachsene Umstände, auf eine über Jahrzehnte geduldete, beidseitige Rollenaufteilung.
Jedem Mann an Ihrer Stelle wäre es genauso ergangen. Bei Ihrer Frau beginnt alles in der Kindheit. Das ging so weiter, bis sie Sie traf. Sie waren nur eine Fortsetzung des bestehenden Zustandes. Das ist so. Sie beide waren in der Ehe jeweils Kind gegenüber ihrem Partner und wiederum für jeden von Ihnen Elternersatz. Gleichzeitig strebten Sie die Zusammenführung der Rollen eines jeden von Ihnen in das eigentliche partnerschaftliche Verhältnis an. Jeder sollte darin dem anderen Vater, Mutter und Partner zugleich sein. Das musste zu Spannungen führen. Das konnte nicht ewig halten“.
Dann fragte er mich: „Kann es sein, dass bei Ihnen noch hinzukommt, dass Sie Schwierigkeiten haben, die Wünsche Ihrer Partnerin zu verstehen und sie zu berücksichtigen?"
Das war eine gute Frage. Die wollte ich ehrlich beantworten und sagte: „Das ist leider sehr wahrscheinlich. Ja, ziemlich sicher sogar“. Gleichzeitig dachte ich, dass es nicht nur eine geschickte Frage von ihm war, sondern zugleich ein Ablenkungsmanöver sein konnte. Er hatte mich nämlich in sein Wissen um seelische und andere Zustände meiner Frau so einfach mit einbezogen. Ich fand das unerhört. Er tat so, als wären meine Frau und ich eineiige Zwillinge, als hätten wir eine vergleichbare Kindheit erlebt, indem er von mir vermutete, was er nur von meiner Frau über mich hatte erfahren haben können. Als Arzt hätte er sich diese Blöße nicht geben dürfen. Es war eine unzulässige Unterstellung und eine maßlose Unterschätzung meiner Person. Das musste ihm im selben Augenblick schlagartig klargeworden sein. Vielleicht hatte er seinen Fehler auch an meinem Gesicht abgelesen und wollte ihn nun nicht mehr zugeben oder richtig stellen. Er machte mit dem, was er sagte, eine Art Flucht nach vorne und versuchte mich zu umzingeln. Ich konnte mich gegen die Einbeziehung so schnell nicht wehren. Das brachte mich in Wut und raubte den Rest des Vertrauens, dass ich zu ihm hatte, völlig. Ich war empört und enttäuscht; als er fortfuhr: „Bei Ihrer Frau ist der Bogen, nicht gehört und verstanden zu werden, überspannt. Er ist zerbrochen. Das ist auch so schnell nicht in Ordnung zu bringen. Das kann eins, zwei, drei Jahre dauern. Sie wollten ja einen Rat von mir haben. Deshalb kann ich Ihnen nur sagen, finden Sie sich damit ab. Sie sollten von nun an ganz für sich selbst sorgen. Denken Sie nur noch für sich selbst. Das muss auch Ihre Frau lernen. Am meisten Annäherung, wenn diese denn irgendwann und unter ganz anderen Umständen jemals möglich sein wird, erreichen Sie nur, wenn Sie ihre Frau völlig in Ruhe lassen“.
Ich antwortete enttäuscht: „Aber wir werden uns dann doch immer weiter voneinander entfernen, und wie sollen wir uns jemals wiederfinden“.
„Das müssen Sie abwarten und auf sich zukommen lassen können. Je mehr Sie nichts tun, desto mehr tun Sie für Ihre gemeinsame Sache, falls es denn jemals wieder eine geben wird“.
„Ich bin der Meinung, dass meine Frau seelisch und körperlich leidet, dass sie krank ist“. Darauf nickte er.
„Wenn meine Frau also krank ist, kann ich sie doch nicht sich selbst überlassen. Das halte ich einfach für unfair. Trotzdem werde ich mich nach dem richten, was Sie mir raten und sie so vollständig wie möglich in Ruhe lassen. Ich werde mich aber, solange sie krank ist, nicht völlig von ihr abwenden können, selbst wenn sie es von mir verlangen sollte“. Er sah mich zweifelnd an.
Ich fuhr fort: „Es gibt da noch so eine Sache mit den Begriffen. Meine Frau sagt zu mir, dass sie sich mit mir versöhnen möchte. Darunter versteht sie aber, dass sie mit mir in freundschaftlichem Verhältnis Umgang haben möchte. Auf keinen Fall will sie darunter die Wiederaufnahme unserer Ehe verstehen“.
Er: „Was sagt sie denn dazu?"
„Wozu? Zur Ehe?"
„Ja“.
„Sie sagt: ‚Ich möchte mich sehr gerne nach wie vor mit dir unterhalten mit dir reden können. Ich möchte aber nie, nie, niemals wieder eine Ehe mit dir führen. Unter keinen Umständen“.
Der Arzt: „Sie müssen es lernen, diesen Wunsch Ihrer Frau, so, wie sie ihn sagt, zu akzeptieren. Sie versteht unter Versöhnung also etwas anderes als Sie. Aber ich möchte ja in diesem Gespräch nicht Sie therapieren sondern Ihnen nur raten und Fragen, die Sie haben, beantworten. Sie sollten sich ganz darauf einstellen, dass Ihre Frau nicht zurückkehren wird. Und wenn es jemals für Sie beide eine gemeinsame Basis geben sollte, dann nur unter völlig anderen Vorzeichen, wie sie in jeder neuen Liebesbeziehung vorhanden sind. Das sagte ich ja schon. Das ist gewiss ein Schock für Sie. Damit sollten Sie aber umgehen lernen. Es ist deshalb für Sie ganz wichtig, dass Sie ebenfalls in einer Behandlung sind. Sie können sich nicht alleine helfen. Sie müssen in Ihrer Lage Hilfe von außen suchen und in eine Therapie gehen“.
Ich schwieg einige Sekunden, weil ich dem nicht zustimmen wollte. Erstens, dachte ich, spricht er über Dinge, die sich nur im Herzen von B. abspielen. Er mag ja recht haben, aber er kann sich dessen nicht so unbedingt sicher sein. Zweitens hat er den großen Fehler begangen und die vermeintlichen Probleme meiner Frau einfach auf mich übertragen, und drittens spricht er davon, dass ich in eine Therapie gehen müsste. Das finde ich nun auch nicht für jeden machbar. Wie viele Menschen müssen sich selbst helfen oder müssen ihren Kummer und ihr Leid ertragen, ohne Hilfe von außen bekommen zu können. Viele kämpfen vielleicht auch mit innerem Anstand darum, weil sie überzeugt sind, dass es schmerzhafte Erfahrungen geben muss, dass Leid und Freude, Liebe und Enttäuschung durchlebt werden sollen. Ich dachte an etwas, das mir in dem Augenblick einfiel. Eine Kollegin hatte gerade ihren Mann durch eine unheilbare Krankheit verloren. Nach Monaten der Trauer hatte sie zu ihrer Freundin gesagt: ‚Nun will ich nicht mehr wachsen’. Das hatte die wiederum mir erzählt. Ich verstand den Satz nicht, so dass die Freundin ihn mir erklären musste: ‚Man wächst doch mit dem Leid. Und nun will sie nicht mehr wachsen’. Da habe ich erst verstanden, was los war.
Zum Arzt sagte ich: „Es ist schon wieder ein Ostergruß von mir an meine Frau unterwegs. Kann sie den denn verkraften?"
Er: „Sie muss es lernen, damit umzugehen“.
Ich: „Meine Frau hat mir schon zweimal am Telefon gesagt, dass sie sehr unter dem leidet, was sie mir angetan hat, und ich will nicht so tun, als ob sie mir nichts angetan hätte. Immerhin hat sie mich aus der Wohnung geschmissen, und genießt mit den Kindern alles, was mir lieb und wert war, die Wohnung, das Daheim, auch den persönlichen Luxus. Meine Familie hat vier Autos und ich habe keines. Es ist mir aber das alles nicht wert, dass sie deswegen und zusätzlich Seelenqualen erfährt. So kann sie doch erst recht nicht gesund werden. Diese Qualen sind doch zusätzlich und neu!"
Ich fuhr fort und unterschlug dabei die Bitterkeit:
„Ich möchte, dass Sie meiner Frau sagen, dass sie mir letzten Endes nichts angetan hat. Ich komme ja ganz gut zurecht. Ich möchte Sie auch bitten, ihr zu sagen, dass ich keine Wut auf sie habe, dass ich ihr nicht böse bin und sie nicht hasse, höchstens dass ich darunter leide, nun auch noch hören zu müssen, dass sie sich unter neuen Gedanken quält. Vielleicht ist sie froh, das zu erfahren. Vielleicht erleichtert sie das. Können Sie ihr das so ausrichten?"
Der Arzt: „Darüber wurde in der Gruppe mit Ihrer Frau bereits gesprochen, aber Sie können ihr das nicht abnehmen. Sie muss da durch und ich sagte ja, dass ich mit Ihrer Frau über dieses Gespräch reden will“.
Im Laufe der letzten Sätze hatte er sich mir völlig zugewandt, so dass sich das Gefühl etwas verlor, unehrlich von ihm behandelt worden zu sein. Richtig munter und aufgekratzt wurde er aber erst, als er mich fragte: „Ich weiß noch nicht genau, ob ich dieses Gespräch bei Ihrer Frau mit unterbringen soll..."
Aha, er war schon bei der Abrechnung.
Ich fragte: „Wieso bei meiner Frau? Schicken Sie mir die Rechnung. Das ist dann in Ordnung“.
Er: „Sie sind doch in der Kasse, nicht wahr?"
Ich: „Ja“.
Aber er hatte schon weiter überlegt: „... also ... das machen wir dann ... ja, so geht es ... das reichen Sie dann bei Ihrer Kasse ein und dann bekommen Sie wenigstens zwei Drittel der Kosten ... nicht wahr ... Sie verstehen doch ... ja? Also, sie melden sich vielleicht in einem viertel Jahr wieder bei mir und wir könnten mit dem Einverständnis Ihrer Frau ein weiteres Gespräch führen“.
Damit schob er mich aus der Tür und ich stand im Flur.
Er kam nach mir heraus und zog vorbei zu seiner Dame. Der flüsterte er wieder intim ins Ohr. Dabei sah er flüchtig auf eine junge Frau, die meinen vorherigen Platz eingenommen hatte. Ihr sandte er die gleichen fahrigen Blicke wie anfangs mir zu. Dann ging er zurück in sein Zimmer. Von dort rief er die Frau auf, kam ihr aber gleichzeitig entgegen, und begrüßte sie freundlich und zuvorkommend.
3
In einem Punkt hatte der Arzt mit Sicherheit recht. Die Trennung von B. war ein schwerer Schock für mich. Es war ein Schock, den ich mit einem Erdbeben vergleichen musste. Es war ja nicht genug damit getan, dass alles für mich viel zu plötzlich gekommen war sondern dass ich den direkten Kontakt zu ihr von einer Minute zur anderen verloren hatte. Gespräche, Fragen, Rufe gingen ins Leere, ihre Nähe konnte ich nicht mehr spüren, ihr Dasein war verlorengegangen, alles was sie an Spuren überall hinterließ, konnte ich nicht mehr ausmachen. Mir fehlte ihr Körpergeruch, das Rauschen, Rascheln ihrer Kleider, ihre Kleidung, ihre Bewegung, ihre Stimme, ihre Sprache, ihr Lächeln, ihr Kommen und ihr Gehen. Mir fehlten ihre spontanen Einfälle zu meinen Bildern und meinen Gedichten, ihre Intuitionen, die sie für mich aus einer anderen Welt herübertrug, ohne sich darüber bewusst zu sein. Sie fehlte mir als Muse am allermeisten. Dazu muss man wissen, dass ich zwei Musen hatte. Erstens B. und zweitens eine ihrer Freundinnen, jedenfalls eine Kollegin, mit der sie sich des öfteren traf. Eine Muse zu haben ist für mich unerlässlich, eine Notwendigkeit. Wer die Abhängigkeit von ihr nicht kennt und nicht weiß, wie unersetzlich sie ist, dass neben ihr im besten Fall nur andere, schwächere Musen bestehen können, kann auch nicht wissen, wovon ich spreche. Seine Muse zu verlieren, heißt dem Tod begegnen. Jeder, der eine Muse hat, fürchtet diesen Augenblick.
Der Anblick der Freundin reichte aus, um mich mit den überraschendsten Einfällen zu versorgen. Alles in mir überschlug sich, wenn ich sie nur sah. Ihr Anblick war ein Sprung in aufgewühltes Wasser, aus welchem ich mich zugleich retten musste. Bei B. war es aber so, dass mich ein ungleich größeres Gefühl, ein viel farbenprächtigerer Gedankenreichtum überfiel, sobald ich sie irgendwo und irgendwie berührte. Ich lud mich an ihr auf, so direkt, wie die Berührung stattfand. Ihr Verlust war am allerschmerzlichsten, der verwundete mich am tiefsten, er beschädigte meine Seele. Es riss eine Nabelschnur, mit der ich an B. bis dahin getreulich gebunden war. Ich hatte sie als ein Geschenk empfunden, indem sie sich selbst an mich weitergegeben hatte, und nun passierte dies. Ich war bis zur Handlungsunfähigkeit getroffen. Ich erkannte keinen anderen Weg, als das zu tun, was sie von mir verlangte, und zog aus unserer gemeinsamen Wohnung aus. Im Laufe der nächsten Wochen aber erst stürzten die Gebäude meines bisherigen Lebens eines nach dem anderen richtig über mir zusammen. Unter jedem der Trümmer wurde ich begraben, neu verletzt, getötet und wieder zum Weiterleben gezwungen. Es fiel mir schwer, mich gegen Selbstmitleid zu schützen und vor Gedanken an Selbstmord zu bewahren.
Unrecht hatte der Arzt allerdings in der Meinung, dass er der Vermittler dieser Erkenntnis sei. Damit unterschätzte er mich als den Betroffenen. Besser wäre es gewesen, er hätte mich nachhaltig auf den Verdrängungsmechanismus hingewiesen, der sich dauernd in mir abspielte. Selbstverständlich wollte ich das Endgültige nicht wahrhaben. Die eigentliche Gefahr lag darin, mit dem Kopf etwas zu verstehen, und es mit dem Herzen nicht wahrhaben zu können.
Bis heute ist mir nicht klar, ob es richtiger ist, das mit dem Kopf Verstandene in die Tat umzusetzen oder dem Willen des Herzens und der ganzen Gefühlswelt zu folgen und ihr freien Lauf zu lassen. Wahrscheinlich verhielt ich mich in meinem Zwiespalt, meinem Aufbegehren, ganz normal.
In der ersten Zeit versuchte ich die Gründe, die zur Trennung geführt hatten, herauszufinden. Immer wieder fragte ich mich nach dem ‚Warum'. Bis ich endlich begriff, dass ich einen Gesprächspartner brauchte. Alleine konnte ich das nie herausfinden.
Ich begann also mich mit dem Gedanken zu befassen und hatte wenig später den mutigen Einfall, mich um eine neue Partnerin zu kümmern.
Dazu suchte ich aus der Zeitung geeignete Anzeigen heraus und stellte mich mit Antwortschreiben vor. Ich war dabei so ehrlich wie möglich und schrieb, dass ich zwar getrennt lebte aber eben noch nicht geschieden sei. Das war sicher der Grund für die Damen, nicht zu reagieren, denn ich bekam praktisch nur zwei Antworten. Gemessen an meinen vielen Schreiben, war das nichts.
Eine der Frauen, die geantwortet hatten, traf sich tatsächlich mit mir. Der Treffpunkt lag ganz in der Nähe meiner Wohnung. Zu der Zeit war mein Telefon nicht in Ordnung, so dass ich auf die Absprache mit ihr angewiesen war. Sie konnte den Termin aber nicht pünktlich einhalten. Ich wartete in lausiger Kälte über eine halbe Stunde lang umsonst. Als ich endlich gehen wollte, und ich war letzten Endes sogar froh, als alles ins Wasser gefallen zu sein schien, kam eine muntere Dame auf mich zu, stellte sich kurz vor und befragte mich sofort nach meinem Telefon, denn sie sagte:
„Ich hatte mehrfach versucht, Sie zu erreichen. Ich konnte nicht pünktlich sein“.
Sie war also die Erwartete. Sie machte deutlich, dass sie zu den Frauen gehörte, die gleich alles überblickten und sich ihrer Sache in allem sicher waren. Dagegen habe ich nichts, weil sie einem manchmal unbequeme Wege abnehmen können.
Der Nachteil solcher Menschen aber ist es, dass sie in ihrer Art zu bestimmen, über den Partner verfügen und immer sicher sind, das Richtige für beide zu wissen. Das bekam ich schnell und deutlich zu spüren. Wir gingen zunächst in ein Cafe und unterhielten uns sehr angeregt.
Sie erzählte mir von sich und ich erzählte ihr von mir, so dass sie von meinen Bildern erfuhr. Ich zeigte ihr auch Fotos davon.
Sie redete viel, und ich denke, dass auch ich viel sprach. Dann gegen sechs, als das Cafe schließen wollte, waren wir die letzten und mussten hinaus. Ich fand alles für den Anfang ganz gelungen und wollte mich nun verabschieden.
Sie: „Ich finde wir sollten noch einen Spaziergang machen. Finden Sie nicht auch?"
Wir zogen also entlang dem kleinen Flussufer durchs spärliche Grün. Es war leider für diese Jahreszeit viel zu kalt, und ich wurde unlustig. Das musste sie gemerkt haben, denn sie meinte, dass sie gesundheitlich angeschlagen sei: „Sein Sie bloß vorsichtig. Sie können sich an mir nur anstecken. Es sei denn, dass Ihnen das nichts ausmacht“.
Doch, das hätte mir etwas ausgemacht. Ich fragte also: „Was haben Sie denn?"
Sie: „Keine Leiden, ich bin nur dauernd erkältet“.
Ich: „Dann sollten wir lieber nicht so lange spazieren gehen. Wir sollten besser umkehren“.
Das sagte ich, weil sie mir leid tat und weil ich dachte, dass das sowieso für ein erstes Kennenlernen ausreichte.
Sie willigte ein.
Ich sah mir dann ihr Gesicht sehr kritisch an. Eine Schönheit war sie nicht. Das sollte grundsätzlich nicht viel bedeuten. Ihr Gesicht weckte aber auch nicht den Wunsch in mir, mich gerne und länger in ihrer Nähe aufzuhalten. Aus all diesen Gründen fand ich, dass wir ruhig umkehren konnten.
Als wir wieder bei ihrem Auto waren, kam sie auf eine Idee: „Ich bin jetzt richtig neugierig geworden auf Ihre Bilder. Sie wohnen doch nicht weit von hier. Wollen Sie mir die nicht zeigen?"
Ich fand das nett von ihr, denn meine Bilder zeigte ich gerne. Ich hatte aber zugleich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte: ‚Nun hast du ihr so viel von deinen blöden Bildern erzählt, dass sie sich verpflichtet fühlt, sich die anzusehen'. Das wollte ich ihr nicht unbedingt antun.
Deshalb sagte ich: „Sie sagen das jetzt nur aus Höflichkeit. Ich würde sie Ihnen auch gerne zeigen, aber ich denke, dass das zu aufwendig ist. Meine Bilder sind wie die von vielen anderen, da ist bestimmt nichts besonderes dran. Die zeige ich Ihnen lieber später mal, ok?"
„Nein, nicht ok. Ich finde wir sollten sie uns jetzt ruhig ansehen. Es sei denn, dass Sie das nicht wollen. Das wäre natürlich etwas anderes“. „Doch, doch. Das möchte ich schon. Ich denke nur, dass Sie sich vielleicht verpflichtet fühlen, sich die anzusehen, nur weil ich davon erzählt habe". Wir fuhren mit ihrem Wagen zu mir, parkten und gingen in die Wohnung. Die liegt in einem Hochhaus. Das war wirklich nicht weit entfernt.
Sie fühlte sich bei mir gleich wie Zuhause. Meine Nachbarin kam herüber, weil sie eine Nachricht für mich hatte. Der stellte sie sich selbst vor. Das fand ich stark. Das zeugte von Selbstbewusstsein, und es gefiel mir irgendwie. Dann waren wir wieder allein.
Ich holte etwas zu trinken und dann meine Mappen. Sie zeigte große Aufmerksamkeit, hatte gute Fragen und kannte sich bestens aus. Ihr Interesse war also ehrlich gewesen. Es war inzwischen so spät geworden, schon nach zehn, dass ich dachte, nun müsste sie von sich aus gehen wollen. Daran würde ich sie auch nicht hindern. Sie blieb aber und wollte die ganze Wohnung sehen. Ich zeigte ihr die wenigen Räume. Im Schlafzimmer blieb sie vor dem mit einem großen Bettlaken abgedeckten aber sonst richtig bezogenen zweiten Teil des Doppelbettes stehen: „Da hinein kommen dann die Neuerwerbungen, oder?"
Ich war so überrascht von ihrer Frage, dass ich verlegen lachen musste. Die Verlegenheit kam aus zwei Gründen. Erstens hatte ich das Bett zugedeckt, weil ich es nicht brauchte. Eine Partnerin war ja gerade das, was mir fehlte. Und zweitens unterstellte sie mir einen lockeren Umgang mit Bekanntschaften, in die sie sich auf diese Weise selbst einreihte. Darüber wurde ich ärgerlich, denn das zweite Bett war in meinem Herzen immer noch für B, reserviert und nur, wenn es alles, alles anders kommen sollte, konnte es für eine neue Herzensdame sein. Dieses Bett stand zwar in meinem Schlafzimmer, mir aber eigentlich nicht wirklich zur Verfügung. Ich sagte deshalb ganz ehrlich zu ihr: