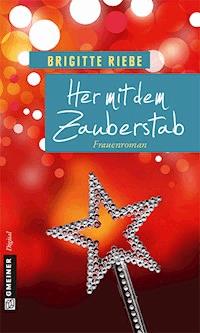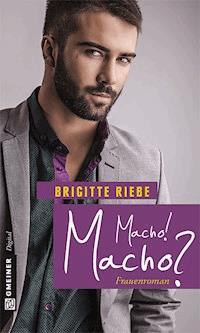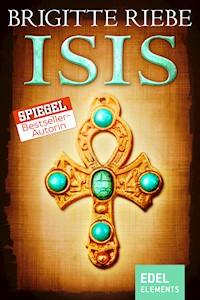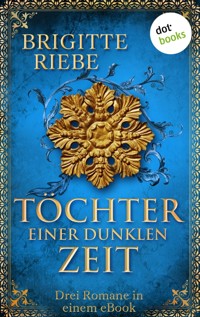Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: jumpbooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Geheimnis der Mondschwestern: "Die Töchter von Granada" von Brigitte Riebe jetzt als eBook bei jumpbooks. Granada, 1499: Nachdem die Katholischen Könige die Herrschaft in Spanien an sich gerissen haben, wird das Leben für die Freundinnen Nuri und Lucia immer gefährlicher. Die Katholikin und die Muslima erfahren am eigenen Leib, was die Verfolgung der Mauren für sie bedeutet. Durch ihre Gefühle für Nuris Bruder Rashid, der sich den Untergrundkämpfern anschließt, gerät Lucia in größte Gefahr. Als schließlich die Familien der Freundinnen in die Fänge der Inquisition geraten, sind die jungen Frauen auf sich allein gestellt. Fest entschlossen, ihre Unschuld zu beweisen, werden sie unwissend zu Marionetten der spanischen Befehlshaber … "Wer wissen will, wie lebendig Geschichte sein kann, der muss mit Brigitte Riebe reden." Brigitte woman Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Roman "Die Töchter von Granada" von Brigitte Riebe. Wer liest, hat mehr vom Leben: jumpbooks – der eBook-Verlag für junge Leser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Granada, 1499: Nachdem die Katholischen Könige die Herrschaft in Spanien an sich gerissen haben, wird das Leben für die Freundinnen Nuri und Lucia immer gefährlicher. Die Katholikin und die Muslima erfahren am eigenen Leib, was die Verfolgung der Mauren für sie bedeutet. Durch ihre Gefühle für Nuris Bruder Rashid, der sich den Untergrundkämpfern anschließt, gerät Lucia in größte Gefahr. Als schließlich die Familien der Freundinnen in die Fänge der Inquisition geraten, sind die jungen Frauen auf sich allein gestellt. Fest entschlossen, ihre Unschuld zu beweisen, werden sie unwissend zu Marionetten der spanischen Befehlshaber …
Über die Autorin:
Brigitte Riebe, geboren 1953 in München, ist promovierte Historikerin und arbeitete viele Jahre als Verlagslektorin. 1990 entschloss sie sichschließlich, selbst Bücher zu schreiben, und veröffentlichte seitdem über 30 historische Romane und Krimis. Brigitte Riebe lebt mit ihrem Mann in München.
Brigitte Riebe veröffentlicht bei jumpbooks auch das eBook Der Kuss des Anubis.
Bei dotbooks erscheinen ihre historischen Romane
Schwarze Frau vom Nil
Pforten der Nacht
Liebe ist ein Kleid aus Feuer
Die Website der Autorin: www.brigitteriebe.de
***
eBook-Neuausgabe Februar 2019
Dieses Buch erschien bereits 2010 unter dem Titel Die Nacht von Granada bei 2010 cbj Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2010 cbj Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München
Copyright © 2017 jumpbooks Verlag. jumpbooks ist ein Imprint der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Katharina Upit und eines Gemäldes von Samual Colman „The hill of the Alhambra Granada“
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96053-269-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass du dich für dieses eBook entschieden hast. Bitte beachte, dass du damit ausschließlich ein Leserecht erworben hast: Du darfst dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem du dich strafbar machst und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügst. Bei Fragen kannst du dich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des jumpbooks-Verlags
***
Damit der Lesespaß sofort weitergeht, empfehlen wir dir gern weitere Bücher aus unserem Programm. Schick einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Töchter von Granada an: [email protected] (Deine Daten werden nicht gespeichert.)
Besuch uns im Internet:
www.jumpbooks.de
www.facebook.com/jumpbooks
Brigitte Riebe
Die Töchter von Granada
Roman
jumpbooks
Mit einem Sternchen gekennzeichnete Wörter sind in einem Glossar am Ende des Buches kurz erklärt.
Für Anna von Spanien
Prolog
Granada, Oktober 1499
Woher kamen so plötzlich die Rotkappen? Wie ein aufgestörter Hornissenschwarm umkreisten sie die versammelten Männer, die gerade noch andächtig im Gebet vertieft waren, stießen sie mit Knüppeln grob zu Boden oder zwangen sie zum Aufstehen, indem sie sie mit ihren Morgensternen und Kurzschwertern bedrohten.
Manche der Betenden schienen vor Angst wie gelähmt, zogen die Köpfe ein, als könnten sie sich damit unsichtbar machen, andere erhoben gehorsam die Hände, um anzuzeigen, dass sie unbewaffnet waren. Luceros brutale Landsknechte wirkten beinahe enttäuscht, als hätten sie mit deutlich mehr Widerstand gerechnet, den es zu brechen galt. Im ersten Licht der Dämmerung wirkten sie in ihren grellen Fetzengewändern geradezu gespenstisch, ein wilder, zu allem entschlossener Haufen, wie direkt der Hölle entstiegen.
»Khaled?«, rief der Anführer, ein einäugiger Hüne mit einer gezackten Narbe, die ihm übel das Gesicht zerschnitt. Dass er kein Spanier sein konnte, war unübersehbar, und Arabisch, die heilige Sprache Allahs, nahm er erst gar nicht in den Mund. Doch auch sein Kastilisch klang, als zische eine verborgene Schlange tief aus seinem Rachen, ganz anders als der weiche andalusische Dialekt mit seinen halb verschluckten Endsilben, den die Christen hier sprachen. »Welcher von euch ist Khaled, jener gottverdammte Hurensohn, der unseren Herrn Jesus gemein verraten hat?«
Keiner wagte zu antworten.
Auf sein Nicken hin glitten die scharfen Waffen tiefer, hin zu Körperregionen, die zu verletzen äußerst gefährlich für einen Mann werden konnte.
Jetzt stank der ganze Raum nach Angst.
»Wenn nicht endlich einer von euch das Maul aufmacht, seid ihr alle dran«, dröhnte der Hüne. »Also? Wer von euch ist klug und möchte sein armseliges Leben wenigstens noch für ein Weilchen behalten?«
Einer der Versammelten machte eine winzige Bewegung, erstarrte dann aber, als hätte ihn erneut der Mut verlassen. Dem Hünen jedoch war nichts entgangen.
»Fasst ihn!«, schrie er. »Und bringt ihn her zu mir!«
Zwei der Landsknechte machten sich daran, seinen Befehl auszuführen. Ein junger Maure jedoch war schneller gewesen und hatte den Gesuchten mit einem kräftigen Rempler aus dem offenen Fenster gestoßen. Man hörte den fülligen Khaled draußen aufschlagen, dann einen unterdrückten Schrei, schließlich das Geräusch nackter Füße, die eiligst davonhumpelten.
»Du Hundsfott!«, schrie der Hüne und stürzte auf den jungen Mauren los. »Dich einem wie mir zu widersetzen – was bildest du dir ein?« Doch der Dolch, den der andere plötzlich in seiner Hand aufblitzen ließ, brachte den Angreifer mitten in der Bewegung zum Stehen.
»Das Leben ist wie eine Stunde, so steht es im Koran geschrieben«, rief der junge Maure und seine Lippen waren zu einem aufsässigen Lächeln verzogen. »Deshalb sorge dafür, dass Gott stets mit dir zufrieden ist.«
All seine Aufmerksamkeit war auf den Angreifer vor ihm gerichtet, deshalb bemerkte er den Schatten neben ihm nur aus den Augenwinkeln.
Zu spät, um noch rechtzeitig reagieren zu können.
Ein Schefflin, wie die Söldner ihre kurzen Wurfspieße nannten, bohrte sich in seinen Oberarm. Der Dolch entglitt seiner Hand, fiel klirrend zu Boden. Schmerzerfüllt schrie er auf, als er den Spieß herauszog und fallen ließ. Er wankte, rührte sich aber nicht von der Stelle.
Der rechte Ärmel seiner hellen Djellaba wurde dunkel von Blut.
»Worauf wartest du noch? Lauf zu, Junge, bring dich in Sicherheit!« Malik, der bullige Schächter, bückte sich, setzte seinen blanken Schädel wie einen Rammbock ein und stieß den Verletzten aus dem Fenster, als wiege er kaum mehr als ein Lumpenball.
Das war der letzte Dienst, den er dem bedrängten Freund noch hatte erweisen können. Dann drang die Schwertklinge des blonden Hünen in sein Herz und löschte sein Leben aus.
»Kein Taufbecken dieser Welt wird aus einem Mauren jemals einen wahrhaften Christen machen«, murmelte der Einäugige, nachdem er die blutige Klinge mit einem Lappen sorgfältig gesäubert hatte, und nun überwachte er, wie seine Landsknechte die Männer fesselten, um sie zum Verhör abzuführen. »Euer Blut bleibt unrein wie das der getauften Juden, was immer ihr auch schwören mögt. Wir kriegen euch. Alle. Schneller, als ihr euch in euren dunkelsten Albträumen ausmalen könnt. Treibt sie nach draußen – und dann legt alles hier in Schutt und Asche!«
Verzweifelte Blicke. Tiefes Seufzen. Jetzt ruhte alle Hoffnung der Versammelten auf den Schultern des Verletzten, dem Maliks tapferes Blutopfer die Flucht ermöglicht hatte.
Kapitel 1
Es war verboten, was sie vorhatten – aber hatten sie es seit frühesten Kindertagen nicht immer wieder getan?
Lucia war die Erste, die nach ihrem kleinen Streit die Sprache wiederfand.
»Mach schon«, drängelte sie. »Wir dürfen nicht den ganzen Vormittag wegbleiben, sonst werden sie noch misstrauisch.«
In dem niedrigen Schuppen am Flussufer, in den sie sich zurückgezogen hatten, war es dämmrig, denn es gab keinerlei Fenster, nur die unregelmäßigen Spalten zwischen den rohen Brettern, durch die hier und da ein Sonnenstrahl fiel.
»Und du bist wirklich ganz sicher?« Wenn Nuri aufgeregt war, begann sie manchmal zu lispeln, vor allem wenn sie ins Andalusische verfiel.
Wortlos schnürte Lucia ihr Mieder auf. Sie atmete aus, als der Druck an den Rippen nachließ, und streifte mit einer raschen Bewegung den Rock ab, den ein Band in der Taille zusammengehalten hatte. Jetzt trug sie nur noch das dünne Leinenhemd, das lose über ihren schmalen, hochgewachsenen Körper fiel.
Plötzlich empfand sie Verlegenheit, obwohl sie doch mit Nuri schon als Säugling in einer Wiege gelegen hatte.
Alles an ihr war noch immer staksig und mager, ganz anders als die weichen Rundungen der Freundin, die sie wie eine richtige Frau aussehen ließen.
»Ob dir meine Sachen überhaupt noch passen werden?«, hörte sie Nuri murmeln. »Du musst über den Sommer schon wieder gewachsen sein.«
Dass sie die meisten Mädchen überragte und daher wohl Schwierigkeiten haben würde, einen Mann zu finden, hatte Lucia in ihrem sechzehnjährigen Leben schon zu oft hören müssen, um noch darauf zu antworten. Stattdessen angelte sie ungeduldig nach Nuris weiten Beinkleidern und schlüpfte hinein. Danach zog sie sich das kurze Kleid über den Kopf, das nach dem Jasminöl der Freundin duftete, und schaute prüfend an sich hinunter.
Nuri hatte wieder einmal recht gehabt.
Das Überkleid endete tatsächlich ein ganzes Stück über dem Knie und oberhalb der Knöchel blitzte eine Handbreit heller Haut. Keine anständige Muslima* hätte sich so aus dem Haus gewagt, doch jetzt ließ sich nichts mehr daran ändern. Lucia bedeckte ihr lockiges Haar mit dem dicht gewebten Schleier, so ordentlich, wie es ohne Spiegel eben ging, verzichtete jedoch darauf, ihn auch über Nase und Mund zu ziehen, wie es besonders fromme Maurinnen taten.
Nuri war noch immer mit dem Verschnüren des ungewohnten Mieders beschäftigt.
»Wie haltet ihr Christinnen das auf Dauer nur aus?«, rief sie, als sie endlich damit fertig war. »Das fühlt sich ja an, als würde man in einem Schraubstock stecken!«
»Gewöhn dich besser schon daran! Erst neulich hat Djamila die dicke Fatima sagen hören, dass bald alle Mauren unsere Kleider tragen müssen, und die hat dieses Gerücht angeblich direkt aus der Alhambra*, wo ihre Nichte derzeit in der Hofküche aushilft. Da bekommt man so manches mit.«
Lucia bereute ihren Ausspruch, als sie das erschrockene Gesicht der Freundin bemerkte. Sie hatte Nuri keine Angst machen wollen, aber ihre Zunge war wieder einmal zu flink gewesen.
Ein Geräusch ließ die Mädchen zusammenfahren.
»Was war das?«, flüsterte Nuri in ihrer Muttersprache.
»Woher soll ich das wissen?« Lucia stand schon an der Tür und antwortete ebenso fließend auf Arabisch. »Ich werde nachsehen. Dann wissen wir Bescheid.«
»Du wirst doch jetzt nicht rausgehen wollen?« Im Dämmerlicht waren Nuris riesige Augen fast schwarz.
Knarzend sprang die Tür auf und ließ einen Schwall Licht herein. Die Sommerhitze, die die Tage glasig und schwül gemacht hatte, war zum Glück vorüber. Jetzt, Ende Oktober, roch die Luft nach Herbst, und es wehte ab und zu eine frische Brise, für die alle dankbar waren. Tagsüber war es sonnig und angenehm warm, wenngleich die Nächte merklich früher einsetzten und das Nahen der kühlen Jahreszeit ankündigten. Noch ragten die Gipfel der Sierra Nevada nackt in den blauen Himmel, ohne die schützende Schneehaube, die sie in einigen Wochen und bis weit hinein in den Frühling tragen würden.
»Da ist niemand.« Mit bloßen Füßen kam Lucia zurück. Sich in Nuris kleine Schuhe zu quetschen, die hinten offen waren, hatte sie erst gar nicht versucht. »Außer einem grasenden Maultier ist weit und breit niemand zu sehen. Außerdem sterbe ich halb vor Hunger.«
Sie packte den mitgebrachten Korb und trug ihn nach draußen. Nuri folgte ihr in einigem Abstand.
Weil sie so überstürzt von zu Hause aufgebrochen waren, um lästigen Fragen zu entgehen, hatten die Mädchen hineingestopft, was immer sie auf die Schnelle finden konnten: viereckige Küchlein, die nach Hanfsirup schmeckten, eine Handvoll kandierter Früchte, mehrere Zuckermandelstangen, winzige, dick mit Zucker überzogene Brezeln aus Honigpfannkuchenteig, aber auch gebratene Hühnerbeine, gefüllte Artischocken und vor allem einen kleinen Topf, gefüllt mit Djamilas berühmtem Mandelreis, von dem die Familie niemals genug bekommen konnte.
Während Lucia genüsslich zu kauen begann, beobachtete sie, wie die Freundin ruhig dasaß und lediglich den Kopf langsam drehte und wendete. Plötzlich begriff sie, was in ihr vorging. Es musste sich befreiend und beängstigend zugleich für Nuri anfühlen, endlich wieder einmal den Wind in den offenen Haaren zu spüren! Aber auch Lucia genoss den weichen Stoff der maurischen Kleidung, wo nichts eng war und einschnürte.
Als hätte sie Lucias Gedanken gespürt, senkte Nuri plötzlich den Blick. »Wir müssen verrückt geworden sein«, sagte sie leise. »Rashid würde mich umbringen, könnte er uns so sehen. Keine Ahnung, was ihn so aufstachelt, aber er gerät von Woche zu Woche immer schneller außer sich.«
Jetzt hätte Lucia sich beinahe verschluckt.
Rashid – musste Nuri ausgerechnet jetzt diesen Namen erwähnen? Tagsüber gelang es ihr einigermaßen, ihrer inneren Unruhe Herr zu werden. Doch wenn es dunkel wurde, war es damit vorbei. Sobald Rashids Name fiel, schien jeder Tropfen Blut, den Lucia besaß, ohne Umwege in ihr Herz zu strömen. Kein anderer in ganz Granada* hatte solch schlehenfarbene Augen, umrahmt von Wimpern, lang und dicht wie bei einem Mädchen. Ein schmales, stolzes Gesicht. Die Brauen so kräftig, dass sie über der leicht gekrümmten Nase fast zusammenstießen. Glattes, pechschwarzes Haar, das er immer wieder mit beiden Händen in einer ungeduldigen Geste nach hinten strich.
Jedes Mal wenn Nuris großer Bruder sie ansah, fühlte Lucia sich plötzlich hässlich und klein. Dabei kannte sie ihn, seitdem sie lebte, doch all die Jahre zuvor war er für sie nichts als ein Teil jener Familie gewesen, die untrennbar zu ihrer gehörte, und sie hatte sich nicht weiter den Kopf über ihn zerbrochen. Damals hatte er für sie mit seinen geschickten Händen kleine Tierfiguren aus Pappelholz geschnitzt, mit denen sie stundenlang spielen konnten. Irgendwo im Haus mussten in einer alten Kiste noch Reste davon übrig sein.
Doch in diesem Sommer war alles anders geworden, und sie hätte nicht einmal genau sagen können, weshalb. Plötzlich konnte Lucia nicht mehr aufhören, an Rashid zu denken. Wenn er nicht da war, sehnte sie sich mit allen Fasern ihres Körpers nach seiner Gegenwart, und sobald sie ihn wieder zu Gesicht bekam, brachte sie keinen anständigen Satz mehr heraus. Dass ihre Elternhäuser sich, wie die Bäuche zweier hochschwangerer Frauen, über der engen Gasse beinahe berührten, machte die Sache nur noch schlimmer.
Sie konnte ihm nicht aus dem Weg gehen.
Lucia war dazu verdammt, Rashid täglich zu begegnen. Auch wenn Nuris Bruder seit einiger Zeit so tief in Gedanken verstrickt schien, dass er sie kaum wahrnahm.
»Was ist los mir dir?« Nuris rundes Gesicht wirkte sorgenvoll. »Du bist ja auf einmal ganz blass geworden. Bekommen dir die Leckereien heute etwa nicht?«
Jetzt hatte Lucia plötzlich das Gefühl, als wäre ihr Mund mit zerstoßenem Glas gefüllt. Bislang hatte sie ihrer besten Freundin noch nichts über den Aufruhr in ihrem Herzen verraten. Doch wie lange würde sie ihr Geheimnis noch für sich behalten können?
Das Wiehern des Maulesels enthob sie einer Antwort, denn es klang auf einmal so nah, dass die Köpfe beider Mädchen herumfuhren.
»Haben wir euch gerade gestört? Dann vergebt uns bitte, edle Señoritas«, sagte eine fröhliche Männerstimme in reinstem Kastilisch. »Zu meinem Bedauern verfügt meine brave Rosita nicht immer über die allerbesten Manieren!«
Lucia und Nuri schauten misstrauisch an ihm hoch. Ein junger Mann, langbeinig und schlank, grinste zurück. Er trug ein weites Hemd, ein offenes Wams und seltsame Beinkleider aus unregelmäßigen, alles andere als kunstvoll zusammengenähten Lederstücken, die ein schmaler Gürtel zusammenhielt, an dem eine seltsame Ausbuchtung baumelte.
»Genau die richtige Aufmachung für unterwegs«, sagte er, als könne er ihre Gedanken lesen. »Rosita und ich waren ein paar Tage in den Bergen, da wäre feine Kleidung nur im Weg gewesen.« Er strich sich die braunen Locken aus der Stirn. »Und was ich dort alles gesehen habe! Terrassen voller uralter Olivenbäume, die das beste Öl liefern, weil sie einige Frostgrade aushalten können und trotzdem genug Sonne abbekommen. Ich hatte all diese Schönheiten beinahe vergessen, so lange war ich fort.«
Lucia starrte ihn noch immer schweigend an. Seine Hände waren rissig und voll grünlicher Spuren.
»Dann bist du also ein Bauer?«, entfuhr es ihr. »Der nach seinen Anpflanzungen gesehen hat?«
Er lachte vergnügt. »Weil ich überall noch Spuren von Oliven an mir habe? Nein, da muss ich dich leider enttäuschen, aber stell dir vor, ich wäre am liebsten einer! Jetzt will ich zurück in die Stadt, sonst wird mein Onkel noch unruhig. Es sei denn, die geschätzten Señoritas wollen mich vielleicht zuvor noch zu ihrem kleinen Festmahl einladen?«
Lucia und Nuri tauschten einen kurzen Blick.
Dieser Platz hier am Darro, wo viele Pappeln standen und der Fluss die fruchtbaren Felder durchschnitt, gehörte zu ihren liebsten Kindheitserinnerungen. In früheren Zeiten, damals, als das Banner der Katholischen Könige noch nicht von der Alhambra geweht hatte, waren sie manchmal mit ihren Familien hergekommen, um im Schatten alter Bäume gemeinsam zu tafeln. Gastfreundschaft gehörte zu dem Wichtigsten, was Antonio, der Christ, und Kamal, der Maure, ihren Töchtern beigebracht hatten, aber bezog sich das auch auf einen Fremden, der sich einfach dreist in ihre Gemeinschaft gedrängt hatte?
Der junge Mann hatte sich bereits auf dem Boden niedergelassen, noch immer sein freches Grinsen im Gesicht, und starrte auf den Korb mit all seinen Köstlichkeiten.
»Greif zu!«, sagte Nuri plötzlich auf Andalusisch, als hätte ihr der Kleidertausch auch neues Selbstbewusstsein gegeben. »Ich denke, das hier reicht auch für drei.«
Ohne Zögern folgte er der Aufforderung, nagte in Windeseile zwei Hühnerbeine ab, verdrückte Mandelreis und Hanfkuchen und wurde erst langsamer, als er schließlich bei den Zuckerstangen angelangt war.
»Welch ein Genuss!«, rief er. »Wer auch immer das zubereitet hat, ist eine Meisterin.« Das seltsame Ding an seinem Gürtel entpuppte sich als glucksender Ledersack, den er nun den Mädchen reichte. »So machen es die Leute im Norden. Darin hält sich der Wein nämlich lange frisch«, sagte er, verstummte aber plötzlich mit dem Blick auf Lucia abrupt.
Sie brauchte einen Augenblick, um zu begreifen. Natürlich – in Nuris Kleidern hielt er sie für eine Maurin, die keinen Wein trinken durfte, und hatte nun Angst, sie vor den Kopf gestoßen zu haben!
»Wir beide bleiben lieber bei Wasser«, entgegnete sie. »Vor allem, wenn wir nicht einmal wissen, mit wem wir da trinken und essen.«
Sein Gesicht färbte sich rot. »Ihr müsst mich für einen Tölpel halten«, murmelte er verlegen. »Miguel, so lautet mein Name. Und ihr beide ...«
»Ich bin Fatima«, erwiderte Lucia schnell, sprach absichtlich leicht gebrochen und musste sich auf die Zunge beißen, um nicht lauthals loszuprusten. Fatima, die dicke Schächterfrau, war der erste maurische Name, der ihr in den Sinn gekommen war! Dass er so gar nicht zu ihrer hellen, sommersprossigen Haut und den rötlichen Locken passte, die unter dem Schleier hervorlugten, war unübersehbar.
Miguels Blick glitt zu Nuri, deren Augen vor Vergnügen leuchteten.
»Und du?«, fragte er leise.
»Consuelo«, antwortete sie ernst. Der Name der übelsten Klatschbase im ganzen Viertel! Im Sonnenlicht schimmerten ihre Haare metallisch wie Rabenfedern, und plötzlich schien es ihr gar nichts mehr auszumachen, sie einem Fremden preiszugeben. »Wir sind übrigens Schwestern«, setzte sie hinzu.
Spürte er, dass sie ihr Spiel mit ihm trieben? Seine Miene hatte sich jedenfalls verfinstert und er wirkte auf einmal unsicher.
»Was ist das denn?« Lucia war so schnell aufgesprungen, dass ihr der Schleier vom Kopf rutschte und ihre unbändige Lockenpracht freigab. »Deine Satteltasche wackelt ja, als wäre ein böser Geist in sie gefahren!«
Doch dabei blieb es nicht. Ein struppiger rötlicher Katzenkopf schob sich heraus, übel zugerichtet. Das linke Ohr war blutverkrustet und eingerissen, das rechte ebenfalls von einem alten Biss verunstaltet.
Jetzt war auch Nuri nicht mehr zu halten. »Was macht denn das kranke Kätzchen in deiner Satteltasche?«, rief sie. »Was hast du mit ihm vor?«
Miguel zog die Schultern hoch. »In einem der Bergdörfer hatte sich der Kleine offenbar mit einem Stärkeren angelegt, der ihm ordentlich Respekt beigebracht hat. Ihn fiepend am Wegrand liegen lassen, das hab ich nicht übers Herz gebracht. Mal sehen, was mein Onkel zu ihm sagen wird! Verhungern wird er nicht bei uns, dafür werde ich schon sorgen.«
»Ein Kater? Wie heißt er?«, fragte Lucia, die ihre Hand nicht mehr von dem kleinen Kopf nehmen konnte: Der Kater schien die liebevolle Berührung zu genießen und schmiegte sich immer tiefer in die warme Mulde. Sie bildete sich sogar ein, ihn leise schnurren zu hören.
»Woher soll ich das wissen?«, erwiderte Miguel. »Warum eigentlich nicht Fuego? Immerhin ist er ja rot wie Feuer!«
»Fuego«, murmelte Lucia. »Ja, das passt gut zu dir, mein Kleiner!«
Jetzt näherte sich auch Miguels Hand dem Tier und streifte ihre dabei für einen winzigen Augenblick. Überrascht schaute sie hoch.
Aus der Nähe waren seine Augen beinahe golden. Wie der schwere Wein aus Jerez, den Papa im Winter manchmal trank, damit ihm wärmer wurde. Einmal hatte sie heimlich einen halben Becher davon stibitzt und sich anschließend ganz schwindelig und matt gefühlt.
Ganz ähnlich erging es ihr jetzt.
Jeden Morgen begann Goldschmied Antonio Álvarez mit seinem Ritual, bei dem er sich von nichts und niemandem stören ließ. Djamila hatte sich mehrfach erboten, an seiner Stelle die Werkstatt auszufegen, und sie hätte es gewiss mit Sorgfalt und Hingabe getan, wie all die anderen Arbeiten, die sie im Haushalt erledigte – und dennoch hatte er abgelehnt.
Die beiden Räume in Erdgeschoss des Hauses waren einzig und allein sein Reich, und sie eigenhändig von Staub und Straßenschmutz zu befreien, war Antonio ein tiefes Bedürfnis. Kaum hatte er den Besen beiseite gestellt, kam der Tisch an die Reihe, auf dem die Waage stand und all seine Werkzeuge lagen: Feilen, Zangen, Zirkel, Pinzetten, Hammer, Bretteisen und vieles mehr – jeder einzelne Gegenstand hatte seinen eigenen Platz, was langes Suchen unnötig machte.
Erst wenn alles penibel ausgerichtet war, nahm er auf dem Hocker Platz und begann, sich auf die anstehenden Arbeiten zu konzentrieren. So hatte er es schon gehalten, als er als junger Mann das Haus in der engsten Gasse des Albaycíns gekauft hatte, wo Lucia ihren ersten Schrei getan hatte, und nicht anders verfuhr er noch heute. Eines freilich hatte sich grundlegend verändert, und es verging kein Tag, an dem er es nicht aus ganzem Herzen bedauert hätte: Aus dem Nebenraum drangen schon viel zu lange weder der muntere Bass noch das leicht schleppende Geräusch der handbetriebenen Apparatur, auf der sein Freund Kamal bin Nabil wie kein anderer in der Stadt Edelsteine zum Leuchten bringen konnte. Das Ende der nasridischen* Herrschaft hatte für den begnadeten Steinschleifer auch das Ende der Aufträge bedeutet. Inzwischen verdienten Kamal und sein Sohn Rashid ihr Brot als Fliesenleger, eine schweißtreibende Tätigkeit, die zudem schlecht bezahlt war.
Aber auch für Antonio war nichts mehr wie früher.
Harte Jahre lagen hinter Granada, Zeiten von Belagerung, Eroberung und strenger Herrschaft unter christlichem Regime, eine Situation, in der die Menschen kaum noch Interesse an Schmuck oder kostbaren Gegenständen aus Silber oder Gold aufbringen konnten, weil ganz andere Nöte sie drückten. Viele seiner ehemaligen Handwerkskollegen in den Nachbarhäusern hatten die Stadt inzwischen verlassen oder waren in andere Berufe gewechselt, um ihre Familien durchzubringen. Und auch er hatte lernen müssen, sich mit einfachen Arbeiten zufriedenzugeben, Reparaturen, Umarbeitungen, meist mit minderen Materialien, über die er früher verächtlich die Schultern gezuckt hätte. Inzwischen war Antonio froh über jeden, der noch immer den Weg zu ihm fand und es ihm ermöglichte, weiterhin den Beruf auszuüben, den er so sehr liebte.
Heute musste der Goldschmied mit besonderer Sorgfalt vorgehen. Er hatte sogar Djamila untersagt, ihm den kleinen Imbiss in die Werkstatt zu bringen, mit dem sie ihn sonst am Vormittag verwöhnte. Das Gold hatte er bereits vor Tagen zwischen Lederhäuten hauchdünn geschlagen, in gleich große Blätter geschnitten und zwischen Papierheftchen gelegt. Jetzt stand der silberne Kelch vor ihm, auf den er sorgfältig die Grundierung aufgetragen hatte. Symbolisch gesehen, ein Mensch, der auf dem Erdboden steht und sich zugleich mit ausgebreiteten Armen nach oben öffnet, um sich vom Göttlichen erfüllen zu lassen – eine Vorstellung, die ihn froh machte, wenn er daran dachte.
Antonio nahm den Pinsel und rieb ihn kurz an seiner Stirn, um ihn statisch aufzuladen. Dann hielt er den Atem an. Nur so war gewährleistet, dass der Pinsel das zarte Goldblatt auch aufnehmen und exakt auf dem Metall platzieren würde – bis Antonio von der Ladentür her plötzlich einen starken Luftzug spürte, der all seine Vorsichtsmaßnahmen zunichtemachte. Verloren trudelte das Blattgold durch die Werkstatt und setzte sich schließlich am Fensterrahmen fest.
»Was willst du?« Missmutig starrte er den Mann an, der ihm so störend in die Quere gekommen war. Sie beide teilten ein altes Geheimnis, von dem nur noch eine dritte Person gewusst hatte, doch die war seit Langem tot. Antonio legte keinerlei Wert darauf, daran erinnert zu werden. Deshalb war er erfreut und erleichtert gewesen, dass der andere nach Toledo gezogen war, denn er hatte fest darauf gebaut, dass er damit für immer aus seinem Leben verschwunden sein würde.
»Begrüßt man so etwa einen alten Freund?«, rief der ungebetene Gast. »Jahrelang haben wir uns nicht mehr gesehen!«
»Wir waren niemals Freunde. Was willst du?«, wiederholte Antonio. »Und komm rasch zur Sache, denn ich habe zu tun, wie du siehst.«
»Allerdings.« Gaspars Lächeln geriet dünn. »Schade um die guten alten Zeiten, nicht wahr, Antonio? Damals, als du noch voller Hochmut warst, ein gefragter Meister unseres Handwerks, der dank seiner brillanten Kontakte bei den Heiden auf der roten Burg ein und aus gehen durfte. Niemals hättest du dich damit abgegeben, Silber in billigster Weise auf Gold zu trimmen. Und selbst jetzt haust du noch immer unter den Mauren, als ob nichts geschehen wäre. Muss ich mir ernsthaft Sorgen um dich machen?«
Antonios dichte Brauen schnellten nach oben. Die Worte hatten ihn getroffen, wenngleich er sich bemühte, es sich äußerlich nicht anmerken zu lassen. Hatte Gaspar etwa Djamila gesehen und Rückschlüsse auf ihre Beziehung gezogen? Unwahrscheinlich, denn sie war Fremden gegenüber ausgesprochen scheu und verließ das Haus nur, wenn es unbedingt notwendig war.
Er spürte, wie er ruhiger wurde.
Zudem half es, vor seinem inneren Auge die gütigen Züge von Padre Manolo heraufzubeschwören, Pfarrer von San Nicolás, der ihn gebeten hatte, dem alten Ziborium* ein wenig mehr Glanz zu verleihen. Dass er für seine Bemühungen ein geringes Entgelt erhalten würde, nahm Antonio dem frommen Priester nicht weiter krumm. Es gab niemanden im Viertel, der sich liebevoller um Arme und Kranke kümmerte als Padre Manolo, egal welchem Glauben sie anhingen.
»Antonio, Antonio ...« Gaspar zog sich das schwarze Barett vom Kopf, als wolle er sich häuslich einrichten. Nachdenklich wiegte er seinen kahlen Schädel, der breiter geworden war und mit den vollen roten Wangen und dem ausgeprägten Doppelkinn alles andere als magere Zeiten im Exil verriet. Einen Bauch hatte er auch bekommen, der sich prall über dem Gürtel wölbte und das enge Wams aus grünem Samt schier zu sprengen schien. »Du, der Meister der Feuervergoldung, ertappt bei solch einem Pfusch! Kein Jahr wird diese Beschichtung halten, das kann ich dir schon jetzt prophezeien. Da erscheint es ja geradezu wie eine Fügung Gottes, dass ich heute vor dir stehe.«
»Du bist aus Toledo zurück?«, sagte Antonio knapp und ärgerte sich, dass er überhaupt gefragt hatte.
»Gerade mal zwei Wochen und einen Tag! Jetzt, wo die maurischen Teufel für immer aus der Alhambra vertrieben sind und unsere christlichen Majestäten sorgsam über ihre Untertanen wachen, da kann auch ein Gaspar Ortíz endlich wieder die lang ersehnte Luft der Heimat schnuppern.«
»Und da kommst du ausgerechnet zu mir?«
»Zu euch, zu dir und deinem Mauren!« Gaspar legte ein Ledersäckchen auf den Tisch. »Mit gutem Grund. Mach auf, mein Freund, aber bitte mit allergrößter Vorsicht! Du wirst staunen.«
Antonio gehorchte zögernd. Scharf sog er die Luft zwischen die Zähne, als er sah, was da vor ihm lag.
»Hast du schon jemals zuvor solch einen schönen Hyazinth* gesehen?« In Gaspars Stimme schwang Stolz. »Schon bald wird er einen schweren Goldring zieren. Allerdings nicht in dieser antiquierten Form. Deshalb bin ich hier. Der Stein soll die neue, moderne Schliffart erhalten. Die, die das Blau des Himmels in vielerlei Facetten widerspiegelt.«
Der Goldschmied starrte auf den Saphir, der kornblumenblau war, makellos und ungewöhnlich groß.
»Was für ein edler Brocken! Das müssen ja mindestens fünfzehn Karat sein«, murmelte er.
»Das reicht nicht aus«, rief Gaspar und seine Hängebacken zitterten vor Erregung. »Es sind beinahe achtzehn!« Schon lag der Stein in einer der Waagschalen, und in die zweite ließ der Glatzkopf aus einer kleinen offenen Schale einige Samen des Affenbrotbaumes gleiten, die man benützte, um eine möglichst exakte Karatzahl zu bestimmen. »Siehst du? Achtzehn Samen, das bedeutet stolze achtzehn Karat. Genau, wie ich dir gesagt habe!«
»Solch eine Kostbarkeit gehört bestimmt nicht dir«, sagte Antonio. »Woher hast du den Stein?«
»Das kann ich leider nicht verraten.« Gaspar zuckte die Achseln. »Meine Anweisungen, du verstehst!«
Antonio spürte, wie seine Abwehr wuchs.
»Steck deinen Saphir ein und mach dich davon«, sagte er. »Ich kann dir nicht helfen, das weißt du. Und der, der es könnte, darf es nicht mehr. Kamal muss von morgens bis abends bei Ausbesserungsarbeiten auf der Alhambra buckeln. Dafür sind die Mauren in diesem neuen Granada gerade noch gut genug!«
»Das kann nicht dein Ernst sein!« Gaspar rührte sich nicht von der Stelle. »Mich so hängen zu lassen, passt doch gar nicht zu dir.«
Antonio schwieg eine ganze Weile.
»Für wen soll der Ring denn sein?«, sagte er schließlich. »Zumindest damit müsstest du schon herausrücken.«
Gaspars Hängebacken gerieten in zitternde Erregung. »Mit deinen unentwegten Fragen bringst du mich noch in Teufels Küche!« Er hob beschwörend die Hände. »Auch das obliegt natürlich allerstrengster Geheimhaltung ...«
Antonio hatte sich brüsk zur Seite gedreht und tat, als sei er wieder ganz mit seinem Kelch beschäftigt.
»Warte!«, rief Gaspar. »Ich werde dir Auskunft geben, obwohl es gefährlich für mich werden könnte ...« Er beugte sich über den Tisch. »Ein hoher Kirchendiener«, flüsterte er. »Verstehst du jetzt? Ein Auftrag von ganz oben.«
»Ein Ring für einen hohen Kirchendiener, geziert mit einem Saphir, den ausgerechnet ein elender Maure umgeschliffen hat?«, konterte Antonio. »Das kann nicht dein Ernst sein!«
»Natürlich darf das niemals herauskommen«, rief Gaspar. »Aber das muss es doch auch nicht! Was mich betrifft, so kann ich meine Zunge im Zaum halten, und ich wette, du und dein maurischer Freund, ihr seid ebenfalls in dieser Kunst geübt. Euer Schaden soll es übrigens nicht sein. Kamal schleift den Stein um und du fasst ihn anschließend in schweres Gold.« Er zog einen zweiten Beutel hervor. »Hier drin findest du alles, was du dazu brauchst.«
»Aber das wäre doch Betrug«, sagte Antonio. »Und wieso legst du nicht selbst Hand an?«
»Dieses hässliche Wort will ich niemals wieder aus deinem Mund hören! Weil ich dir entgegenkommen möchte, so einfach ist das. Ich biete euch beiden Möglichkeiten, wie ihr sie seit Jahren nicht mehr gehabt habt. Ihr müsst nur einschlagen.«
»Und wo ist der Haken?« Antonio hatte dem Glatzköpfigen schon damals nicht getraut, das er noch Haare hatte, und er tat es heute ebenso wenig. Nichts an diesem heimlichen Geschäft gefiel ihm. Und trotzdem gab es da diese winzige unvernünftige Hoffnung, die sich unversehens in sein Herz gestohlen hatte.
»Kein Haken, was denkst du bloß! Lediglich zwei alte Bekannte, die sich einen Gefallen tun und darüber im gegenseitigen Interesse Stillschweigen bewahren. Ich möchte meine Unkenntnis in diesem Bereich ...« Gaspar begann zu hüsteln, als wäre ihm die Kehle auf einmal zu eng geworden. »... nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Schließlich muss auch ich an die Zukunft denken. Übrigens nicht nur an meine Zukunft. Nach Lage der Dinge bin ich kinderlos geblieben, leider, während dich das Schicksal mit einer schönen Tochter beschenkt hat. Aber da ist der Sohn meiner Schwester, für den ich nach dem frühen Tod seiner Eltern zu sorgen habe. Außerdem hättet ihr das Geld doch dringend nötig, dein Maure und du, oder etwa nicht?«
Jetzt lag auf einmal ein drittes Säckchen auf dem Tisch, das Gaspar mit vielsagendem Blick öffnete. Dann zählte er die Goldmünzen auf den Tisch, die im Sonnenlicht aufleuchteten.
Vier Doblas*!
In Antonios Kopf überschlugen sich die Gedanken. Er könnte endlich das Dach reparieren lassen, das seit dem letzten Winter leckte und Regen und Schnee in die Schlafräume tropfen ließ. Lucia brauchte dringend einen Satz neuer Kleider, weil sie schon wieder aus allem herausgewachsen war. Djamila, die ihm jeden Wunsch von den Augen ablas, hatte seit Langem ein kleines Geschenk verdient, ein paar neue Silberreifen beispielsweise, die an ihren schlanken Gelenken klimperten. Und erst die strahlenden Augen von Kamal, der Mörtel und Hammer beiseitelegen könnte, um endlich wieder seine einzigartige Handkurbel zum Singen zu bringen ...
»Antonio?« Gaspars spröde Stimme schreckte ihn aus seinen Tagträumen auf. »Ich warte!«
»Wie sollte solch ein Schliff denn aussehen?«, hörte er sich zu einer eigenen Verblüffung fragen, wenngleich ihm die eigene Stimme spröde und fremd vorkam. »Der Hyazinth würde auf jeden Fall an Karat verlieren, so viel kann selbst ich dir sagen. Außerdem würde es dauern. Kamal kann nur am Sonntag arbeiten, weil er Tageslicht zum Schleifen braucht ...«
Gaspar schien plötzlich wie von innen zu strahlen. Die Münzen verschwanden wieder im Lederbeutel, den er sorgfältig einsteckte. Dem folgten noch hastiger die beiden anderen Beutel.
»Lasst euch ruhig Zeit«, versicherte er. »Der Ring muss erst zum Fest der Heiligen Drei Könige fertig sein. Und der Schliff? Wie eine Rose, an der das Licht sich bricht, als ob die Morgensonne ihre Blütenblätter küsst.« Er zog ein gefaltetes Stück Papier aus seinem Wams, schlug es auf und strich es glatt. »Ich hab alles Nötige aufgezeichnet.«
Antonio schob es unwillig zur Seite. »Der beste Steinschleifer Granadas ist Kamal, nicht ich. Komm am Sonntag wieder und zeig ihm den Stein. Erst danach können wir verhandeln.«
»Du hast noch einmal Glück gehabt.« Djamila klang angespannt. »Wenigstens sind die Wundränder einigermaßen glatt, da ...«
»Glück?«, unterbrach sie Rashid. »Unseren geheimen Gebetsraum haben sie aufgespürt, einen Freund in den Untergrund getrieben, einem anderen, der für mich einstehen wollte, die Schwertklinge ins Herz gestoßen, mich mit einem Speer verletzt – und das nennst du Glück?«
»Ein Gläubiger?«, rief Djamila und vergaß für einen Augenblick, die Stimme zu senken. »Einer von uns?«
»Ja, aber frag lieber nicht weiter. Ich möchte nicht, dass du in Gefahr gerätst – du oder andere.«
»Wovon redest du?«
»Was du nicht weißt, kannst du nicht verraten, sollten sie dich zu fassen bekommen. Verstanden?«
»Schon, aber dein Arm ...«
Sein wütender Schmerzenschrei ließ Djamila auf der Stelle verstummen.
Für Lucia, die sich unbemerkt zurück ins Haus hatte schleichen wollen, war es, als bohre sich bei diesem Schrei etwas Spitzes in ihre Brust. Rashid war verletzt – und offenbar erheblich! Aber warum ließ er sich nicht von seiner Mutter verbinden, sondern hatte Zuflucht im Nachbarhaus gesucht?
»Geht es nicht ein bisschen sanfter?«, hörte Lucia ihn schließlich in seiner Muttersprache murmeln. »Es sticht und brennt schon genug. Du musst mir dabei nicht noch die ganze Haut abreißen!«
»Die Wunde muss sauber sein, sonst kann sie sich entzünden«, erwiderte Djamila. »Wieso begibst du dich überhaupt in solche Gefahr?«
»Bist du vielleicht meine Mutter?«
»Nein, aber ...«
»Dann halte dich bitte aus diesen Dingen heraus und mach, worum ich dich gebeten habe. Damit hilfst du mir am meisten.«
Er hatte sie verärgert, das hörte Lucia an der spitzen Stimme, mit der Djamila ihm antwortete: »Dann verabreiche ich dir jetzt ein Pflaster mit Honig und Mehl, das wird fürs Erste helfen. Darauf kommt dann der Verband und du solltest den Arm unbedingt für ein paar Tage schonen ...«
»Kein Verband!«, widersprach Rashid so heftig, dass Lucia sich unwillkürlich enger an die Wand drückte. »Der würde mich ihnen doch ans Messer liefern, diesen verdammten Christenhunden, die uns Gläubige jagen, als besäßen sie alles Recht der Welt dazu.« Er hörte sich an wie ein gehetztes Tier, das die Falle bereits wittert.
»Ohne Verband geht es aber nicht!«, beharrte Djamila.
»Niemand aus der Familie darf erfahren, dass ich diese Wunde habe – niemand! Deshalb bin ich hier. Weil ich weiß, dass du schweigen kannst.«
Trotz der ernsten Lage verspürte Lucia etwas wie Erleichterung. Djamila sollte Rashid nur helfen – nicht mehr. Eben hatten die beiden in ihrem Streit noch so vertraut geklungen, dass alles in ihr sich zusammengekrampft hatte. Die Frau, die mit ihr seit einigen Jahren unter einem Dach lebte, war anmutig, die beste Köchin Granadas und keineswegs zu alt, um die Begierde eines jungen Mannes zu wecken. Außerdem befolgte Djamila gewissenhaft die Gebote Allahs, auch wenn Lucia sie erst neulich zu ihrem Vater hatte sagen hören, dass es derselbe Gott sei, zu dem Christen und Moslems beteten, auch wenn er verschiedene Namen habe.
»Wie willst du damit deine Arbeit verrichten?«, bohrte sie weiter. »Ist dir nicht klar, dass die Wunde täglich neu verbunden werden muss, wenn sie schnell heilen soll?«
»Das lass meine Sorge sein! Gib mir lieber eine saubere Djellaba*«, verlangte er. »Ich weiß, dass Antonio einen ganzen Vorrat davon hat und gerne unsere Kleidung trägt, sobald er mit dir allein ist.«
»Ich kann dir doch nicht ...«
»Doch, du kannst! Und mach schnell, damit ich endlich hinauf zur Alhambra kann. Unsere Schicht hat bereits angefangen. Ich muss mir ohnehin noch eine Ausrede einfallen lassen. Emilio, unser Vorarbeiter, der nichts kann außer Schnüffeln, Meckern und Befehlen, wartet doch nur auf den passenden Anlass, um mich rauszuwerfen.«
Lucia hörte, wie Djamila leichtfüßig den Raum verließ. Sollte sie die Gelegenheit nutzen, um sich Rashid zu zeigen?
Sie entschied sich dagegen.
Er hatte so ernst geklungen, so erwachsen – und so unendlich fremd. Diese verdammten Christenhunde ... Dazu gehörten auch ihr Vater und sie, auch wenn sie hundertmal ein tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl mit den muslimischen Nachbarn von gegenüber verband!
Das Klimpern der Silberreifen zeigte Djamilas Rückkehr an.
»Hier«, sagte sie leise. »Bring mir seine Djellaba unbedingt bis morgen wieder, sonst wirst du mich kennenlernen. Und jetzt sieh zu, dass du verschwindest. Antonio kann jeden Moment zum Essen kommen!«
Raschid musste so leise hinausgeschlichen sein, dass Lucia nicht einmal das vertraute Knarzen der Haustür gehört hatte. Wie ein Dieb auf leisen Sohlen, dachte sie unwillkürlich. Einer, der sich am liebsten unsichtbar gemacht hätte. Gehörte das etwa auch zu seinen neuen Fähigkeiten, von denen sie nichts wusste und die ihn immer nur noch weiter von ihr entfernten?
In Gedanken noch bei Rashid, schreckte sie zusammen, als plötzlich Djamila vor ihr stand.
»Was machst du hier?«, sagte sie barsch auf Arabisch. Ihr Blick flog zum Korb, in dem sich nur noch ein paar kümmerliche Essensreste befanden, dann musterte sie Lucias zerknittertes Kleid, das einige Grasflecke abbekommen hatte. »Du siehst ja aus wie eine Streunerin! Und wohin wart ihr eigentlich den ganzen Vormittag verschwunden?«
»Nuri und ich haben doch nur Tante Pilar besucht«, erwiderte Lucia ebenso fließend.
»Das kannst du jemand anderem erzählen! Denn zufällig war deine Tante Pilar vorhin hier. Also? Wer so frech lügt wie du, sollte wenigstens eine halbwegs stimmige Geschichte parat haben.«
Die Maurin, der sie längst über den Kopf gewachsen war, musste schräg zu ihr herauflinsen, um ihr in die Augen zu schauen, was Lucia plötzlich ein Gefühl der Überlegenheit gab. Eigentlich mochte sie Djamila, und es machte ihr auch nichts aus, dass ihr Vater viele Nächte mit ihr verbrachte, obwohl die beiden es zu verheimlichen versuchten und am Morgen aus verschiedenen Zimmern kamen, als wären sie bloß Herr und Dienerin. Doch was sie sich nun anmaßte, war eindeutig zu viel. Wenn Djamila sich das Recht herausnahm, Geheimnisse zu haben, konnte sie das auch.
»Halt dich raus aus meinen Angelegenheiten«, sagte Lucia schroff. »Ich bin kein Kind mehr und weiß schon, was ich tue ...«
Lautes Schreien und herzzerreißendes Weinen ließ beide zusammenfahren.
»Es kommt von der Gasse«, rief Lucia. »Schnell – es muss etwas Schreckliches geschehen sein.«
Sie lief nach draußen, Djamila ihr hinterher.
Ein seltsamer Zug kam ihnen schwankend entgegen, eine Gruppe heulender, aufgelöster Frauen, die eine provisorische Bahre schleppten. Auf ihr lag der Leichnam eines Mannes, halb verkohlt, eine große Wunde auf der Brust, das Gesicht eine vom Feuer grauenvoll verwüstete Fratze.
Unwillkürlich zog Djamila sich den Schleier vor das Gesicht. Auch Lucia wünschte sich plötzlich, sie steckte noch in Nuris Kleidern und könnte es ihr nachtun, denn der Geruch nach verbranntem Fleisch war kaum zu ertragen.
»Mein guter, guter Malik!«, schrie Fatima. »Der beste Schächter von ganz Granada – ihr alle habt ihn gekannt. Keinem Menschen hätte er jemals im Leben etwas antun können, das wisst ihr. Warum nur hat man ihn mir auf so grausame Weise genommen?«
Ihr Kleid war zerrissen, den Schleier hatte sie offenbar längst irgendwo unterwegs verloren, aber es schien sie nicht zu kümmern. Tränen liefen über ihre Wangen, doch Fatima schrie weiter, obwohl der Prophet angesichts des Todes doch Sammlung und stille Trauer geboten hatte.
Auch Antonio kam aus seiner Werkstatt gerannt. Aus dem Haus gegenüber liefen Nuri und ihre Mutter Saida auf die Gasse, blieben aber auf ihrer Seite stehen.
»Sie verbrennen Menschen«, rief eine Frau aus dem Zug. »Malik ist erst der Anfang. Irgendwann werden die Christen in ganz Granada ihre Scheiterhaufen aufrichten und uns alle im Feuer rösten. Nieder mit den Schweinefressern*! Verdammt sollen sie sein, bis in alle Ewigkeit!« In ohnmächtiger Wut ballte sie die Fäuste und hieb mit ihnen durch die Luft.
»Ja, nieder mit all den Schweinefressern!«, riefen nun auch die anderen Frauen. »Mörder, Mörder, Mörder!«
Unwillkürlich tastete Lucia nach Antonios Hand und war erleichtert, als sie seinen warmen, beruhigenden Druck spürte.
»Du musst keine Angst haben«, sagte er leise in seinem wohlklingenden Andalusisch, das sich wie Gesang anhörte, schaute dabei aber nach Djamila, die ein Stück entfernt stand und seinen Blick mied. »Sie sind wütend, traurig und ratlos, da sagen Menschen schon mal solche Dinge. Wenn sie erst wieder ruhiger geworden sind ...«
»Halt den Mund!« Eine aus dem Zug hatte ihn doch gehört – und alles verstanden. Aus ihrem Mund klang die Sprache der Christen hart und kalt. »Sonst schicken wir dir eines Nachts unsere Brüder und Söhne, damit ihr am eigenen Leib zu spüren bekommt, wie es ist, lebendig geröstet zu werden – du und deine gottlose Hure, die sich schon lange von Allah losgesagt hat!«
Bevor der Goldschmied noch etwas darauf erwidern konnte, hatte die Frau sich bereits wieder eingereiht und war mit den anderen weitergegangen. Lucia sah, dass das Gesicht ihres Vaters auf einmal kalkweiß geworden war.
Jetzt war sie es, die seine Hand fest drückte, und sie konnte nicht damit aufhören, selbst als der Trauerzug mit dem toten Schächter längst aus ihrem Blickfeld verschwunden war.
Am frühen Morgen weckten Lucia seltsame Geräusche. Die hölzernen Läden waren nur angelehnt; durch die vergitterten Fenster im maurischen Stil, die ihr Haus ebenso besaß wie die meisten Gebäude im Albaycín, drang klare, frische Herbstluft in ihr Zimmer.
Sie setzte sich auf, rieb sich den Schlaf aus den Augen.
Für ein paar Augenblicke war es ruhig, bis auf das unablässige Wassermurmeln im kleinen Becken des Innenhofs, dann hörte sie einen Hund bellen. Erleichtert wollte Lucia sich schon wieder hinlegen, überzeugt, es sei doch nur ein Traum gewesen, als die befremdlichen Geräusche erneut einsetzten.
Sie stand auf, schlang ein Tuch um sich und trat ans Fenster.
Zwei Männer in seltsam grellen, geschlitzten Gewändern, die Köpfe mit roten Kappen bedeckt, luden einen großen, oben abgeflachten Stein von einem Karren und schleppten ihn zum Nebenhaus. Dort warteten schon zwei weitere, ebenso bizarr gekleidet, die mit ihren Schaufeln eine Kuhle gegraben hatten, welche nun den unteren Teil des Steins aufnahm.
Neben ihnen schlotternd vor Angst und mit grauem Gesicht ihr Nachbar Amir, der ein paar Gassen weiter zusammen mit seinem Vetter eine kleine Schneiderei betrieb und angeblich vor wenigen Tagen die christliche Taufe empfangen hatte.
»Die Sau bringen wir später«, hörte sie einen der Männer in abgehaktem Kastilisch rufen. »Wir wollen doch dabei sein, wenn du sie eigenhändig abstichst. Und heute Abend lädst du uns dann alle zu Schweinebraten und frischer Blutwurst ein.«
Raues, lautes Gelächter.
Amir zog die Schultern noch ein Stück weiter nach oben und wirkte noch kleiner und verlorener.
Ihr war, als schaute er hilfesuchend zu ihr herauf.
Schnell trat Lucia einen Schritt zurück, in der Hoffnung, Amir habe sie nicht erkannt, und kniff die Augen zu. Doch was sie gesehen und gehört hatte, ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Sogar das Morgenlicht schien plötzlich grau geworden, grau wie der Tag, der vor ihr lag.
Kapitel 2
Schweigen schlug ihnen entgegen, eisiger als die dunkelste Januarnacht auf den Gipfeln der Sierra Nevada, als Lucia und ihr Vater am dritten Tag der Totenklage Maliks Witwe aufsuchten. Lucia hatte zunächst nicht mitkommen wollen, weil sie sich davor gefürchtet hatte, was sie dort erwarten würde, ihr Vater jedoch bestand auf ihrer Begleitung.
»Sich zu drücken, wäre feige«, hatte er noch auf dem Weg zu Fatimas Haus gemurmelt und dabei den schweren Korb vom einen zum anderen Arm gewechselt. »Nachbarn sind nun einmal Menschen, die uns etwas angehen, auch wenn wir uns sie nicht unbedingt ausgesucht haben. Man hält zusammen, in guten, erst recht aber in diesen schwierigen Zeiten.«
Jetzt allerdings schien seine Zuversicht zu wanken. Lucia sah mit Erschrecken, wie seine Schultern nach unten sackten, als er die in fleckiges Dunkelbau gehüllten Frauen erblickte, die sich als Trauergesellschaft im offenen Hof des einstöckigen Hauses versammelt hatten. Dann aber straffte er sich wieder. Der Vater würde sich nicht einschüchtern lassen, das wusste sie plötzlich und bewunderte ihn dafür.
»Malik fehlt uns allen«, begann er in fließendem Arabisch. »Der Mord an ihm war ein entsetzliches Verbrechen, das gesühnt werden muss. Wir trauern gemeinsam um ihn. Vielleicht wird die Erinnerung eines Tages ja den großen Verlust ...«
»Schweig!«, donnerte ihm jene Frau entgegen, die ihn bereits vor seiner Werkstatt beschimpft hatte, Rabia, wegen Schwatzsucht und Hinterhältigkeit verschrien. »Du bist nicht einmal würdig, seinen Namen in den Mund zu nehmen. Verschwinde, zusammen mit deiner verfluchten Christentochter! Mörder wie ihr haben hier nichts zu suchen.«
Einige andere Frauen schauten ähnlich finster drein, schüttelten den Kopf und ballten erneut die Fäuste. Fatima, tief verschleiert am Boden hockend, machte keinerlei Anstalten, den christlichen Nachbarn zu verteidigen, als plötzlich Saida aufsprang und Nuri mit sich zog.
»Habt ihr jetzt alle den Verstand verloren?« Ihre sonst so sanfte Stimme klang ungewohnt scharf »Besinnt euch gefälligst! Diese beiden gehören seit Langem zu uns und daran wird sich auch künftig nichts ändern. Lucia ist für mich die zweite Tochter, weil meine Milch sie am Leben erhalten konnte, nachdem ihre Mutter gestorben war. Und ihr Vater ist uns als Bruder und Freund lieb und teuer. Wer sich gegen sie wendet, wendet sich auch gegen uns!«
»Ja, sie hat ganz recht. Lucia ist meine Mondschwester«, rief Nuri lispelnd vor Aufregung. »Wir gehören für immer zusammen!«
Lucia spürte bei diesen Worten ein warmes Gefühl der Zuneigung in sich aufsteigen. Genauso empfand sie auch! Als Zeichen ihres Bündnisses schenkte sie Nuri ein Lächeln, das diese sofort erwiderte.
Jetzt ruhten die Augen aller auf Tochter und Mutter, doch Saida ließ sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Allein ihre zitternde Hand auf Nuris Arm verriet die innere Anspannung.
»Menschen gehen nach dem Tod über eine Brücke, die so scharf ist wie eine Messerschneide. Wer sich aber in seinem Leben als Gläubiger erwiesen hat, gelangt ins Paradies.« Sie vollführte eine kleine Drehung in Richtung Fatima. »Dein Malik gehört zu jenen Glücklichen, das wissen wir alle hier. Er hat sein Leben verloren, die ewige Seligkeit jedoch gewonnen.«
Ihre klugen Worte wirkten Wunder.
Die Gesichter der Frauen begannen sich zu entspannen und selbst Sinan, der picklige Sohn des Schächters, der immer wieder verstohlen zu Nuri gelinst hatte, verlor seinen verkrampften Ausdruck.
»Wir haben nur eine Kleinigkeit mitgebracht.« Sichtlich erleichtert stellte Antonio den prall gefüllten Korb vor der Witwe ab, der seine Worte Lügen strafte, genauso, wie der Brauch es gebot. »Doch Djamila wäre gerne bereit, zu eurer Trauerrunde zu stoßen und sie mit weiteren Speisen zu laben.«
»Etwa mit diesen ekelhaften Würsten und Schinken, die ihr Schweinefresser am liebsten vertilgt?« Rabia schien noch immer nicht genug zu haben. »Erst vor wenigen Tagen haben sie ganz in eurer Nähe wieder eine Sau ausgeweidet. Und ihr werdet nicht glauben, wer es dieses Mal war: Amir, der sich von Allah abgewandt und seine Beute bestimmt nur allzu gern mit seinem Nachbarn Antonio geteilt hat!«
Woher wusste Rabia das alles? Lucia bekam am ganzen Körper Gänsehaut.
Der kleine Schneider war tatsächlich mit einer Schüssel frischer Würste bei ihnen erschienen, während in seinem Rücken die Fetzenkerle betrunken gejohlt und jedes ihrer Worte belauscht hatten. Inzwischen hatte sie von ihrem Vater auch erfahren, wer sie waren: ein Haufen Söldner aus einem fremden Land, angeheuert von Diego Rodriguez Lucero, der die Inquisitionsverfahren* in Granada mit aller Macht vorantreiben sollte. Aus Mitleid mit Amir hatte die Familie des Goldschmieds das ungebetene Geschenk zwar angenommen, freilich alles danach sofort heimlich weggeworfen. Als fromme Muslima rührte Djamila kein Schweinefleisch an, aber auch Antonio und Lucia, seit Jahren an maurische Küche gewöhnt, ekelten sich vor dem süßlichen Geschmack.
»Amir ist redlich und fromm«, sagte Antonio. »Und er sorgt sich um seine Familie. Die Zeiten sind hart. Sollten wir uns da als Nachbarn nicht besser unterstützen, als uns gegenseitig zu bespitzeln?«
Vorsichtig lugte Lucia in die Runde. Manche Gesichter waren schon wieder ablehnend geworden, andere Frauen dagegen schauten offen, ja beinahe freundlich zurück.
»Ich dulde keinen Unfrieden in meinem Haus«, ergriff endlich Fatima das Wort, und es war unüberhörbar, wie erschöpft sie klang. »Schon gar nicht an diesen stillen Tagen der Trauer, die einzig und allein Malik gehören. Ich danke dir für deine freundliche Gabe, Goldschmied.« Sie rang sich die Spur eines Lächelns ab. »Und ja, richte Djamila aus, dass sie uns hier jederzeit willkommen ist und bleiben kann, solange sie möchte.«
Lucias Herz machte einen freudigen Sprung.
Das würde ihr die Gelegenheit geben, Rashid abzufangen, wenn er sich heimlich zum Verbinden ins Haus schleichen würde!
Den ganzen Heimweg über konnte sie an nichts anderes mehr denken, gab zerstreute Antworten, wenn Antonio sie etwas fragte, und verstummte schließlich ganz.
»Was ist eigentlich los mit dir?«, fragte er besorgt. »Du bist auf einmal so seltsam. Wirst du vielleicht krank?«
»Nein, nein«, sagte Lucia hastig und war froh, dass sie nicht mehr Arabisch reden musste. »Mir fehlt nichts. Ich muss nur die ganze Zeit an den Toten denken ...« Sie biss sich auf die Zunge und schämte sich für ihre Lüge. Aber hätte sie ihm denn verraten könnten, was ihr Herz bewegte?
Kopfschüttelnd zog er sich in seine Werkstatt zurück. Kurze Zeit später hörte Lucia, wie Djamila eilig das Haus verließ, als könne sie es kaum noch erwarten, endlich in die Trauergemeinschaft aufgenommen zu werden.
Jetzt musste Rashid bald von seiner Arbeit in der Albambra zurückkehren. Sie holte die Leinenbinden aus dem Versteck, zusammen mit dem Rosenwasser, mit dem Djamila die Wunde gesäubert hatte, entzündete zwei Öllampen, rührte die leise vor sich hinsiedende Suppe noch einmal um und vergewisserte sich, dass das Herdfeuer so schnell nicht ausgehen würde. Danach verzog sie sich in eine kleine Nische, schlang die Arme um sich und wartete.
Langsam senkte sich der Abend über die Stadt. Das Plätschern des Wassers im Innenhof machte sie schläfrig. Als Kind war sie nicht müde geworden, ihre Hände in das kühle Nass zu tauchen, doch der Reiz war längst verflogen.
Von Rashid noch immer keine Spur.
Wenn sie Pech hatte, würde der Vater bald zum Essen erscheinen – dann wäre der ganze schöne Plan dahin. Lucia war schon nahe daran, aufzugeben, als sie plötzlich das Knarzen der Haustür hörte.
»Djamila?«, hörte sie eine Männerstimme auf Arabisch flüstern. »Bist du das?«
Ihre Hände waren eisig. Das Herz schlug so stark gegen die Rippen, dass sie Angst hatte, er könnte es hören.
»Nein.« Lucia trat ein paar Schritte nach vorn. »Aber ich.« Trotz der Dämmerung sah sie das jäh aufblitzende Misstrauen in seinen Augen.
»Ich muss nach Hause«, murmelte Rashid und schaute zu Boden. »Sie werden schon auf mich warten.«
»Ohne frischen Verband?« Es war heraus, noch bevor sie lange nachgedacht hatte.
»Was weißt du davon?« Plötzlich war er ihr so nah wie in ihren kühnsten Träumen. Sie roch seinen Atem, sah jedes einzelne der dunklen Haare, die ihm auf Kinn und Wange sprossen und die vollen Lippen nur noch mehr betonten. Ließ er sich einen Bart wachsen, um sich unkenntlich zu machen und somit einfacher untertauchen zu können? Doch der Griff, mit dem er ihr Handgelenk umklammert hielt, war zu hart, um sich in weiteren Spekulationen zu verlieren.
»Nichts«, sagte sie schnell. »Gar nichts. Lass mich los. Du tust mir weh!«
»Rede gefälligst!«, forderte er. »Warum hast du uns belauscht?«
Jetzt blieb ihr nichts als die Wahrheit. »Ein dummer Zufall«, sagte sie. »Ich kam gerade nach Hause, da hab ich euch eben gehört.«
»Und hattest gewiss nichts Besseres zu tun, als auf der Stelle zu meiner Schwester zu rennen und ihr alles brühwarm zu erzählen! Was weiß Nuri?«
»Nichts – gar nichts! Und mein Vater ebenso wenig, falls du mich das auch noch fragen willst. Das ist die reine Wahrheit.«
Lucias Worte, vor allem aber ihre ernste Miene schienen ihn überzeugt zu haben, denn er gab sie abrupt frei.
Sie rieb sich das schmerzende Gelenk.
»Früher warst du nie so grob«, sagte sie.
»Früher waren auch andere Zeiten.« Nun klang es fast, als tue es ihm leid.
»Soll ich dir jetzt helfen oder nicht?«, fragte Lucia leise.
»Wo steckt denn Djamila?«, kam prompt die Gegenfrage.
»Sie trauert mit Fatima und den anderen Frauen. Kann sein, dass es spät wird.«
»Dann haben sie ihr also verziehen, dass sie mit einem Christen lebt?«
Lucia musterte ihn schweigend. Wenn seine Lippen sich höhnisch verzerrten, gefielen sie ihr sehr viel weniger als sonst.
»Hat das zwischen deiner und meiner Familie jemals eine Rolle gespielt?«, sagte sie schließlich.
Mit einem Mal sichtlich verlegen, strich Rashid sich die Haare aus dem Gesicht und zuckte dabei schmerzerfüllt zusammen. Jetzt erinnerte er sie wieder an den temperamentvollen Jungen von nebenan, der oft Blessuren davongetragen hatte, weil er sein Temperament nur schwer zügeln konnte.
»Mach deinen Arm frei!«, verlangte sie resolut und fühlte sich plötzlich überlegen. »Wir sollten uns beeilen. Vater kann jeden Moment zurück sein.«
Überraschend gehorchte er ihr. Lucia verbarg ihr Erstaunen, wie muskulös er geworden war. War das nur die harte Arbeit auf der Alhambra, die aus dem schlaksigen Jungen einen durchtrainierten Mann gemacht hatte? Sie wickelte die Leinenbinde ab und war froh, dass ihre Hände einigermaßen ruhig waren. Dann griff sie nach einem Öllicht und untersuchte die Verletzung.
»Scheint ganz gut zu heilen«, sagte sie und säuberte die Wundränder mit Rosenwasser. »Nur in der Mitte hat es sich noch nicht vollständig geschlossen. Ich denke, du hast noch einmal Glück gehabt. Und jetzt halt die Lampe ruhig, damit ich dich neu verbinden kann!«
Die Abendglocken, die den Sonntag einläuteten, setzten ein, die dünnen, hellen von Sankt Nicolás als Erstes, gefolgt von den tieferen Stimmen anderer Glocken, bis es ein voll tönender Klangteppich geworden war, der jede Unterhaltung unmöglich machte. Auf Anordnung der Katholischen Majestäten wurden Jahr für Jahr immer noch mehr christliche Gotteshäuser errichtet, während eine Moschee nach der anderen abgerissen wurde und der Ruf des Muezzins* zu den täglichen Gebetszeiten für immer verstummt war.
»Glück?« Plötzlich war seine Stimme rau. »Weißt du, was du da sagst? Alles wollen sie uns rauben – unsere Stadt, unsere Berufe, sogar unseren Glauben. Doch unseren Stolz, den werden sie uns niemals nehmen!«
Plötzlich war sie sich ganz sicher, zu wissen, was geschehen war, und die Worte strömten geradezu auf ihre Zunge. »Du warst dabei, als sie Malik getötet haben«, sagte Lucia, während sie die beiden Enden der Binde geschickt verknotete. Der Verband war flach. Unter den weiten Ärmeln einer Djellaba würde keiner ihn bemerken. »Genauso war es doch! Deshalb darf auch niemand deine Wunde sehen. Weil sie dich sonst holen und bestrafen würden.«
Unter seinem Bart war Rashid mit einem Mal aschfahl.
»Wenn du das auch nur einem einzigen Menschen erzählst, muss ich ...«
»Ich bin schon lange kein Kind mehr, das Gefallen an Holzspielzeug findet«, fiel sie ihm ins Wort. »Falls dir das noch nicht aufgefallen sein sollte. Ich bin fast erwachsen und kann sehr wohl schweigen.«
Er musterte sie überrascht, als sähe er sie zum allerersten Mal. Dann drehte Rashid sich wortlos um und verschwand nach draußen.
Kaum war er fort, setzte ihr Zittern erneut ein.
Sie hatte seine glatte, warme Haut berührt! Und sie war seine Mitwisserin. Natürlich wäre Lucia jetzt am liebsten zu Nuri gelaufen, um der' Freundin ihr übervolles Herz auszuschütten, aber die war ja noch immer Teil von Fatimas Trauergesellschaft. Doch selbst wenn Nuri oder wenigstens Saida zu Hause gewesen wären – das Geheimnis, das Lucia mit Rashid teilte, hatte eine unsichtbare Schranke errichtet.
Auch dem Vater konnte sie nichts davon erzählen. Und Tante Pilar, im Lauf ihrer Witwenschaft immer spröder und frömmelnder geworden, würde nur wieder mit einem Beispiel aus der Bibel ankommen, um zu beweisen, in welche Abgründe die Liebe ein unschuldiges junges Mädchen führen konnte.
Warum nur hatte sie keine Mutter mehr, in deren tröstende Arme sie hätte flüchten können?
Seit Langem hatte Lucia sich nicht mehr so allein gefühlt.
»Du hast dich umsonst hierher bemüht.« Kamal legte den Saphir wieder zurück in die Waagschale. »Geh nach Hause. Ich kann dir nicht helfen.« Sein Kastilisch klang hölzern.
»Aber warum denn nicht?« Jegliche Zuversicht war aus Gaspars Gesicht verschwunden. »Es gibt doch in ganz Granada keinen Besseren als dich!«
»Das war einmal. Es liegt Jahre zurück, dass ich meine Kunst unter Beweis stellen konnte.« Der Maure streckte seine Hände aus, die der ständige Umgang mit Mörtel und Erde derb und rissig gemacht hatte. »So sehen die Pranken eines Fliesenlegers aus – aber nicht die geschmeidigen Finger eines Steinschleifers!«
»Und dein Sohn?« Der Glatzkopf, der sich gleich beim Eintreten das Barett heruntergerissen hatte, schien entschieden, nicht aufzugeben. »Man sagt doch, du hättest ihn selbst unterwiesen. Vielleicht könnte ja er ...«
»Lass Rashid aus dem Spiel!« Sein Sohn ging den neugierigen Christen nichts an, und dennoch fühlte Kamal sich plötzlich unwohl, als hätte Gaspar ihn bei etwas Verbotenem ertappt. »Er war noch ein halbes Kind, als die königlichen Truppen die Rote Burg* gestürmt haben. Danach gab es kaum noch Gelegenheit, unser Handwerk auszuüben. Ein Steinschleifer aber braucht vor allem Routine, wenn er etwas Ordentliches zustande bringen soll, sonst rührt er seine Kurbel am besten erst gar nicht erst an.«
Antonio Álvarez hatte bislang schweigend zugehört. Jetzt aber wandte er sich dem Freund zu.
»Wenn du ablehnen willst, bin ich natürlich einverstanden«, sagte er zögernd. »Ich dachte nur ...«