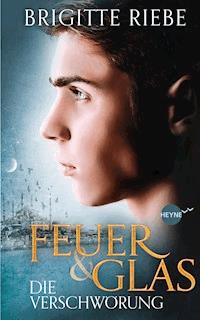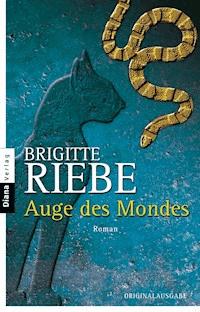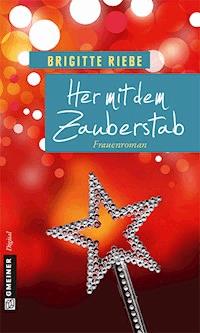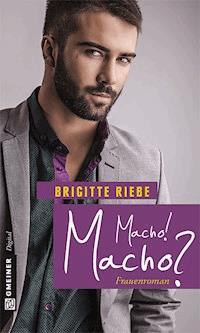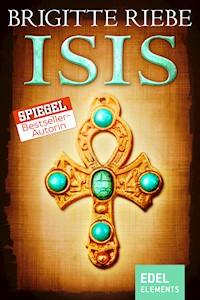9,99 €
Mehr erfahren.
Ein ruchloser Kardinal, eine verschmähte Geliebte und eine Seuche, vor der alle gleich sind
Mainz 1542: Nach der Flucht aus dem pestverseuchten Köln finden der unkonventionelle Arzt Vincent de Vries und seine Pestmagd Johanna in Mainz eine neue Heimat. Sie folgen damit dem Ruf von Kardinal Albrecht, doch Johanna traut diesem nicht und hat dunkle Vorahnungen. Und tatsächlich: Eines Tages ist ihre kleine Tochter spurlos verschwunden. Halb wahnsinnig vor Angst irren sie und Vincent durch die Stadt, in der erste Fälle von Schwarzen Blattern aufgetreten sind – die Pockenform, die innerhalb von 48 Stunden den Tod bringt …
Brigitte Riebe erzählt hoch spannend von Zeiten voller Angst und Schrecken
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mainz 1542: Der Kurfürst von Mainz, Kardinal Albrecht von Brandenburg, bekannt für sein verschwenderisches und allzu weltliches Hofleben, bestellt den unkonventionellen Mediziner Vincent de Vries als neuen Hofarzt nach Mainz. Ein Ruf, dem Vincent gern folgt, er wünscht sich nach den dramatischen Jahren im pestverseuchten Köln nichts sehnlicher als einen Ort, wo er seiner Wissenschaft in Ruhe nachgehen kann. Johanna, seine große Liebe und damals Pestmagd in Köln, hofft, dass Vincent mit seiner Heilkunst endlich die Familie ernähren kann, doch Mainz ist ihr nicht geheuer. Ihre Vorahnungen werden wahr, als die Schwarzen Blattern ausbrechen und kurz darauf die gemeinsame Tochter entführt wird. Können Johanna und Vincent trotz ihrer Sorge um die kleine Barbara die tödliche Gefahr für die Stadt und sich selbst bannen?
Brigitte Riebe ist promovierte Historikerin und arbeitete zunächst als Verlagslektorin. Sie hat zahlreiche erfolgreiche historische Romane geschrieben, in denen sie die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte wieder lebendig werden lässt. Zum Beispiel erzählt sie in Die Braut von Assisi vom Leben des heiligen Franziskus oder in Die Pestmagd vom verheerenden Peststerben in Köln um 1540. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in München.
BRIGITTE RIEBE
DIE VERSUCHUNG
DERPESTMAGD
ROMAN
Für Edith, meine Bücher-Tante
Fleuch pald,
fleuch ferr,
kum wieder spot,
das sind drei Krewter in der Not.*
Merkspruch bei Seuchen
Es gibt überall einen Platz,
an dem ein Engel landen kann.
Volksweisheit
* Flieh bald, flieh weit weg, komm spät zurück,
das sind drei Kräuter in der Not.
PROLOG
Larven schwirren aus im Schutz der Dunkelheit, laufen mit leuchtenden Laternen durch die engen Gassen. Ein Trommeln und Trillern, dazu Schreien, Knurren, Fauchen und Krächzen, als wären zweibeinige Wölfe, Füchse und Luchse unterwegs oder Raubvögel, unheimliche Wesen, die die Nacht gebiert. Kaum einer in der Stadt findet heute Schlaf, denn die alten Winterbräuche sind zwar seit Jahren strengstens verboten, aber dennoch so lebendig wie nie zuvor. Vergesst die alte katholische Pfaffenfasnacht, der keiner eine Träne nachweint! Es lebe die neue, die tolle, die wahnwitzige Burenfasnacht, die vor nichts und niemandem Respekt hat!
Sie steht am Fenster, so nah, dass sie den Geruch des alten Holzes in der Nase hat, und starrt durch die gewölbten Glasscheiben nach draußen. Neben ihr im Weidenkorb liegt das schlafende Kind. Ihre Hände sind klamm, obwohl das Feuer im Ofen prasselt. Ausgerechnet in dieser Nacht ist sie allein. Ihr Mann wacht bei einem Sterbenden, und den wilden Jungen hat sie längst an die dunkle Schar verloren, das weiß sie, seit er sich irgendwann heimlich aus der Tür gestohlen hat.
Ein schutzloses Haus voller Weiber: die Alte mit dem löchrigen Gedächtnis, die unter dem Dach wohnt, weil sie dem Himmel ganz nah sein will; das Mädchen an der Schwelle zur Frau, das sie wie eine Tochter liebt; das Sonnenkind mit dem lichten Flaum, das noch an ihrer Brust trinkt – und sie selbst, die Frau mit dem silbernen Halsband, das die alten Narben verbirgt.
Doch was ist mit jenen auf ihrer Seele?
Sie zuckt zusammen, als sie eine zarte Berührung am Knöchel spürt, und muss im gleichen Augenblick über ihre Schreckhaftigkeit schmunzeln. Dann bückt sie sich und fährt mit der Hand über das knisternde Fell. Die Weiße ist eine Katze und vervollständigt somit die Frauengesellschaft.
Abermals schaut sie angespannt hinaus. »Im St.-Alban-Tal mit seinen verschlungenen Bachläufen sind wir geschützt.« Das hat er ihr versichert, als sie zögerte, sich abermals in der Stadt ihrer Kindheit anzusiedeln. »Du wirst dich fühlen wie auf einer Burg, von der ein Wassergraben jeden Feind abhält.« Doch trifft das auch zu für diese Nacht, wo alle außer Rand und Band zu sein scheinen?
Das Pfeifen, Knurren und Trillern wird immer lauter. So nah also sind sie schon – viel zu nah für ihren Geschmack! Einen Moment lang ist sie drauf und dran, nach oben zu laufen und die Alte und das Mädchen aus dem Schlaf zu reißen, um bloß nicht länger allein zu sein, doch am Fuß der steilen Treppe angelangt, zögert sie. Was würde es schon bringen, in vier weitere ängstliche Augen zu schauen? Die beiden waren nicht von hier und könnten nicht erfassen, wozu die Narren der Fasnacht fähig sind.
Du schaffst es, spricht sie sich selbst Mut zu. Die Mauern des Hauses sind stark. Keiner kann uns etwas tun.
Aber was ist mit der Wasserseite?
Die Hintertür führt direkt auf die kleine Holzbrücke, gerade hoch genug gewölbt, damit ein Kahn darunterpasst. Wie konnte sie nur diesen Zugang zum Haus vergessen? Und wo ist der Schlüssel, um das Versäumte schnellstens nachzuholen?
Ihre Hände fliegen, als sie zu suchen beginnt. Aber sie findet den Schlüssel nirgendwo, nicht am Haken, an den sie ihn für gewöhnlich hängt, nicht auf dem Kaminsims und auch nicht auf der Truhe.
Ob ihr Mann ihn aus Versehen mitgenommen hat?
Unsinn! Er braucht nur einen Umhang, um sich vor der Kälte zu schützen, und seine abgeschabte Tasche mit den Instrumenten und Arzneien. Außerdem hat er sein Leben riskiert, um ihres zu retten. Niemals würde er etwas tun, das sie in Gefahr bringen könnte.
Trotzdem klopft ihr Herz nun überlaut. Draußen auf der Brücke hört sie schwere Tritte, dann etwas, das für sie wie das Schlagen riesiger Flügel klingt. Ja, es ist Fasnacht – aber manch nächtlicher Schabernack der Masken fällt so roh und derb aus, dass Menschen durchaus Schaden nehmen können. Wieso hat sie sich nur überreden lassen? Weshalb den Fuß ausgerechnet wieder in diese Stadt gesetzt, in der sie sich schon einmal so abgrundtief verlassen gefühlt hat?
Wenn du vor der Gefahr nicht fliehen kannst, musst du ihr ins Auge schauen. Auf diese Weise ist sie schon einmal dem sicheren Tod entkommen, auch wenn es sie allergrößte Überwindung gekostet hat. Sie strafft sich, wischt sich kurz über die Augen. Dann packt sie ein dickes Holzscheit und reißt mit der anderen Hand entschlossen die hintere Tür auf. Im ersten Moment sieht sie nichts als Federn, fast so dunkel wie die mondlose Nacht. Das große Wesen vor ihr bleibt zunächst stumm.
Sie braucht ein paar Augenblicke, um die Larve zu erkennen – den Krähen-Joggi, den hinterhältigsten aller Nachtmahre, dessen scharfer Schnabel unschuldige Seelen zerhackt. Etwas Kaltes greift nach ihrem Herzen. Unwillkürlich macht sie einen Schritt zurück, als ein wüstes, rostiges Krächzen erklingt, das ihr durch und durch geht.
Sie hebt den Arm mit dem Scheit. Wenn nötig, wird sie zuschlagen, so fest sie nur kann, das weiß sie plötzlich. Über diese Schwelle kommt keiner, der ihre Schützlinge gefährden könnte, selbst wenn es nur ein Streich sein sollte!
Hat sie ihm Angst gemacht? Mit einem Mal kommt Bewegung in das seltsame Federtier.
Sie ahnt die Hand mehr, die nun die Larve herunterreißt, als sie wirklich zu sehen, so schnell geht jetzt alles auf einmal. Die grünen Augen allerdings, die ihr entgegenblitzen, sind ihr bestens vertraut, ebenso wie der Mund in dem rußigen Gesicht, der sich jetzt zu einem übermütigen Lachen verzieht: Es ist Jakob, ihr Sohn, den sie einst jahrelang für tot gehalten hat.
Erleichterung breitet sich in ihr aus. Doch ein Rest von Fremdheit, ja sogar Furcht hält sich trotz allem hartnäckig.
ERSTES BUCH
VERGEHEN
EINS
Basel, Frühling 1542
Sobald der Regen einsetzte, begann die Stadt zu stinken. Nele behauptete steif und fest, es nicht zu riechen, doch Sabeth bewegte bei Johannas Worten zustimmend den silbrigen Kopf.
»Das sind die heimatlosen Seelen«, sagte sie. »Jene, die keine Ruhe gefunden haben. Sie wohnen im Fluss, in den Kanälen, in alten Gemäuern. Da sie nicht ins Licht gehen können, bleiben sie gebunden – und vermodern.«
Johanna musterte sie erstaunt. Seit ihrer überstürzten Flucht aus Köln hatte der Zustand der alten Magd sich auf erstaunliche Weise verbessert. Nach wie vor brachte sie vieles durcheinander oder rang vergeblich nach verlorenen Worten, doch wenn sie die Kleine brabbeln hörte, wirkte sie so klar wie seit Jahren nicht mehr. Barbara war Sabeths auserkorener Liebling, ihr Barbelchen, wie sie sie zu nennen pflegte. Sie wachte über sie, wann immer sie konnte. In Sabeths Armen war offenbar sogar das schmerzhafte Zahnen leichter, und das Kind belohnte die liebevolle Fürsorge mit entzücktem Lachen, sobald es Sabeths faltiges Gesicht erblickte.
So hat sie jetzt nicht nur Mutter und Vater, dachte Johanna, wenn sie die beiden so einträchtig zusammen sah, sondern sogar eine Großmutter. Vincents Eltern waren schon vor Jahren im fernen Amsterdam verstorben; ihren eigenen Vater hatte sie niemals gekannt, die Mutter viel zu früh verloren, und was sie später bei ihrem Oheim hatte erleben müssen, verdiente den Namen Familie nicht.
Wie der große Bruder tatsächlich zu seiner kleinen Schwester stand, wusste Johanna allerdings nicht genau. Manchmal fand sie Jakob nachdenklich vor der Wiege, versonnen auf das schlafende Kind starrend; dann wieder packte er Barbelchen, tanzte mit ihr im Kreis herum oder warf sie hoch, bis sie vor Vergnügen juchzte. Er hatte ihr ein Paar winzige Schuhe aus weichem, rotem Leder gemacht, in denen sie in nicht allzu langer Zeit wohl auch die ersten Schritte machen würde. Aber es gab durchaus auch jene kurzen, scharfen Blicke, die Johanna jedes Mal erstarren ließen, weil sie in ihnen seine alte Wut wiederfand: Wut wegen einer verpfuschten Kindheit, in der er wie ein Stück Vieh an einen Bettler verkauft worden war, der mit dem Jungen von Ort zu Ort zog, ihn brutal verprügelte und zum Stehlen zwang. Wut, weil es Jakob trotz seiner wiedergefundenen Familie noch immer so unendlich schwerfiel, anderen Menschen zu trauen. Wut vielleicht auch deswegen, weil er es immer wieder fertigbrachte, im letzten Moment alles bisher Erreichte durch unbedachte Worte oder Taten zu verderben.
Wahrhaft sesshaft geworden war er bis heute nicht. Zu tief steckten die rastlosen Vagabundenjahre in ihm. Mehrstöckige Häuser raubten ihm den Atem; größere Menschenansammlungen verabscheute er aus tiefstem Herzen. Er war ein Einzelgänger geblieben und brauchte freien, weiten Himmel über sich, um sich wirklich lebendig zu fühlen. Das hatte Johanna ihn einmal zu Nele sagen hören, die daraufhin in Tränen ausgebrochen war, weil sie Angst bekam, Jakob würde schon bald wieder fortlaufen.
Nele – das war die nächste Sorge, die ihr schon mehr als eine schlaflose Nacht bereitet hatte. Das Mädchen war liebenswert und half ohne Murren im Haushalt, und natürlich war es keine Frage gewesen, die verlassene Waise auf der Flucht aus Köln mitzunehmen, nachdem sie dank Vincents Heilkunst die Pest überlebt hatte. Zwischen Jakob und ihr knisterte es heftig, das war unübersehbar. Nele vergötterte ihn, und auch Jakob hing innig an ihr – aber die beiden waren noch zu jung, um sich schon für immer aneinander zu binden. Das Mädchen, dem Johanna beizeiten ins Gewissen geredet hatte, war offenbar vernünftig genug, um das einzusehen. Jakob dagegen rebellierte und ließ sich nicht in die Karten schauen, wie weit sie schon miteinander gegangen waren.
»Dann heirate ich sie eben auf der Stelle«, rief er wütend. »Und dann hast du uns gar nichts mehr zu sagen.«
»Sie ist erst sechzehn, Jakob. Und du bist gerade mal neunzehn. Lasst euch doch noch ein bisschen Zeit!«
»Du warst auch nicht viel älter, als du mit mir schwanger wurdest«, konterte er. »Und wir sind trotzdem nicht verhungert.«
»Aber ich musste mich als Bademagd verdingen, um uns durchzubringen. Dabei hab ich mich mit der Pest infiziert. Nur deshalb habe ich dich damals in Itas Obhut gegeben. Und wir wissen, wie gemein und hinterhältig sie das ausgenutzt hat.«
»Dieses rote Teufelsweib soll bis zum Jüngsten Tag in der Hölle schmoren.« Jakobs Gesicht war auf einmal hart. »Aber muss das auch bedeuten, dass ich wie ein Mönch zu leben habe?«
Davon konnte keine Rede sein. Jakob hatte ganz offenkundig bereits in sehr jungen Jahren begonnen, mit Frauen zu verkehren, und sein anziehendes Äußeres hatte es ihm dabei leicht gemacht. Er schien einen ausgeprägten Hang zu Hübschlerinnen zu haben, das hatte sie sich aus gewissen Andeutungen zusammengereimt, und manchmal befürchtete sie, dass er auch in Basel nicht von seinen früheren Gewohnheiten ließ. Offiziell waren die Hurenhäuser geschlossen, seit die Reformation die Stadt erfasst hatte. Doch im Verborgenen blühte die käufliche Liebe munter weiter. Erst vor wenigen Wochen hatte Vincent zwei junge Frauen behandelt, die an der Lustseuche erkrankt waren und schätzungsweise Dutzende von Freiern damit infiziert hatten. Seit Jahren beschäftigte er sich intensiv mit dieser Krankheit, hatte dazu Hunderte von Seiten in seiner peniblen Schrift verfasst. Doch entscheidend weitergekommen war er nicht. Bislang gab es keine Heilung, sobald Amors vergifteter Pfeil ins Schwarze getroffen hatte, allenfalls Linderung für eine gewisse Zeit. Und wenn Jakob sich bei einer dieser Frauen ansteckte? Ein Gedanke, den Johanna jedes Mal rasch wieder fortschob, sobald er sie streifte.
»Du brauchst Geld, wenn du eine Familie ernähren willst.« Sie wusste, wie sehr Jakob dieses Argument hasste, und gerade deshalb brachte sie es als letzten Trumpf. »Ehrlich verdientes Geld. Also ergreif jede Gelegenheit, die dein Vater dir bietet! Je schneller du vorankommst, desto eher kann Nele deine Braut werden.«
Jakob senkte den Kopf und zog sich schweigend in seine Kammer zurück. Nach außen hin hätte sie es beinahe für einen Sieg halten können.
Doch genauer besehen lief es ganz und gar nicht so, wie Vincent und sie es sich für ihren Großen ausgemalt hatten. Das spürte sie, wenn die beiden von Visiten zurück nach Hause kehrten oder Kranke den weit gereisten Medicus im St.-Alban-Tal aufsuchten und Jakob dabei assistieren sollte. Vincent de Vries war ein hochgebildeter Mann, der nicht müde wurde, in Theorie und Praxis gegen Seuchen und Gebrechen anzugehen. Als Junge hatte er eine Lateinschule besucht, später an berühmten europäischen Universitäten studiert und war daher im Lateinischen und Griechischen ebenso bewandert wie im Niederländischen, Deutschen und Italienischen. Jahre der Heilkunst in verschiedenen Städten hatten seine Diagnosen geschärft, auch wenn er dabei oftmals die engen Grenzen der ihm gesteckten Möglichkeiten verfluchte. Den Kampf gegen die Pest hatte er furchtlos aufgenommen und dabei zu Methoden gegriffen, die andere Ärzte als zu »neumodisch« und »unchristlich« verwarfen.
Wie jämmerlich musste sich daneben ein Sohn vorkommen, der lediglich den Gaunerjargon Rotwelsch fließend beherrschte und es bislang allenfalls im Beutelschlitzen oder Falschspiel zur Meisterschaft gebracht hatte! Dabei waren Jakobs Hände geschickt, und er konnte Dinge behalten, die er lediglich im Vorbeigehen aufgeschnappt hatte. Er liebte alles, was grünte und blühte, und merkte sich auf Anhieb, wozu Heilpflanzen und Kräuter geeignet waren. Jedoch fehlte ihm jegliches Sitzfleisch, und Lesen und Schreiben, das Nele ihm mit wahrer Engelsgeduld erst richtig beigebracht hatte, zählten noch immer nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.
Was sollte nur aus ihm werden in dieser Stadt, die so streng und bigott geworden war, seit Johannes Oekolampad und seine Anhänger die Reformation eingeführt und den Bischof nach Freiburg vertrieben hatten? Ihre Herrschaft war zwar nicht ganz so strikt, wie es die Zwingli’sche Kirchenordnung in Zürich vorschrieb, doch das früher so weltoffene, allen Vergnügungen zugewandte Basel war längst kein Ort mehr, an dem es sich unbeschwert leben ließ. Es gab keine übermütigen Hochzeiten mehr, kein traditionelles Totengedenken, keinen Gottesdienst alten Stils. Die Heiligen, die man jahrhundertelang um Beistand angefleht hatte, waren abgeschafft, die Kirchen gestürmt und aller Bilder sowie jeglichen Schmucks beraubt. Klöster hatte man ausnahmslos geschlossen. Etliche Nonnen und Mönche, die zu alt oder zu entrückt waren, um wieder in der Welt Fuß zu fassen, lungerten als jämmerliche Lumpengestalten bettelnd herum.
Sogar das Straßenbild hatte sich gegenüber Johannas Jugendtagen entscheidend verändert. Ihr fiel es nicht das erste Mal auf, als sie zum Markt ging, um etwas Frisches für das Abendessen zu kaufen, weil sie das vergorene Kraut, die Rüsselkäfer im Mehl und den Mäusekot in den Nüssen von Herzen leid war. Natürlich hätte sie ebenso gut Nele damit beauftragen können, die sich am Herd geschickt anstellte und eine gute Köchin zu werden versprach, aber ihr Bedürfnis nach frischer Luft war so groß gewesen, dass sie sich lieber selbst auf den Weg gemacht hatte, allerdings züchtig verhüllt. Ihren weizenblonden Zopf, der seine alte Länge noch nicht wieder ganz erreicht hatte, wagte sie hier nicht offen zu zeigen, um nicht als schamlos zu gelten.
Jeder Blick verriet ihr, wie richtig diese Entscheidung gewesen war. Die Frauen, die ihr mit vollen Körben entgegenkamen, hatten keine leuchtenden Kleider an wie in ihrer Erinnerung, sondern trugen allesamt gedeckte Farben, die sie wie kleine Rebhühner aussehen ließen. Nicht einmal die Hauben waren hell, wie sie es von Köln her kannte, wo auf manch einem Frauenkopf geradezu abenteuerliche Gebilde in Weiß oder Creme geschwankt hatten. Hier trug man jetzt eng anliegende Kappen, meist aus braunem oder grünem Stoff gefertigt. Nirgendwo strahlendes Blau, erst recht kein freches Rot. Es war, als hätte ein schwermütiger Maler alles mit feiner Asche überpinselt, um jede Freude, allen Übermut auszulöschen. Sogar der Himmel fügte sich heute nahtlos in dieses triste Bild: Dunkle Wolken jagten sich, und der nächste Guss von oben würde sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Johanna ging schneller weiter. Die Marktstände unter dem Münsterhügel waren schon ziemlich geplündert, so spät war sie dran, aber es gelang ihr dennoch, bei einer runzeligen Bäuerin ein paar letzte Bündel Gundelrebe sowie Kresse, Bärlauch und Sauerampfer zu ergattern, Grundlage für eine schmackhafte Suppe, die allen im Haus guttun würde. Nebenan kaufte sie noch Eier, die Jakob mit Vorliebe gleich halbdutzendweise verschlang, als sei er noch mitten im Wachstum. Dann fiel ihr ein ordentliches Stück Bauchspeck ins Auge, das alle satt machen würde. Aber Johanna zögerte, weil ja noch immer Fastenzeit war, die sie als Katholiken einhielten, während die Reformierten ringsherum nichts mehr darum gaben. Schließlich entschied sie sich stattdessen für geräucherte Forellen von einem jungen Händler, die gegen keinerlei kirchliches Gebot verstießen.
Lautes Wiehern riss sie aus ihren Gedanken.
Heute war Pferdemarkt, das hatte sie bei ihrem Aufbruch ganz vergessen. Unwillkürlich richtete sie ihre Schritte jetzt zur Nordseite des Marktes. Rosa, das Pferd, das sie von Köln nach Basel getragen hatte, gehörte ebenso zum Haushalt wie die weiße Katze Mieze. Johanna hing sehr an der lebhaften Stute, mit der sie eine wechselvolle Geschichte verband, und hatte seitdem eine Schwäche für schöne Rösser entwickelt.
Auch am Pferdemarkt neigte sich der Betrieb offenbar dem Ende zu; die meisten Tiere hatten bereits neue Besitzer gefunden. Ein junger brauner Wallach zerrte an den Stricken, die ihn hielten, bis ein Mann in einem langen dunklen Mantel zu ihm trat und mit leiser Stimme auf ihn einredete. Etwas an seinem Gang und der Art, wie er den Kopf hielt, kam Johanna bekannt vor, doch erst, als das Tier ruhiger geworden war und der Mann seinen spitzen Hut aufsetzte, erkannte sie ihn wieder.
»Mendel!«, rief sie und rannte auf ihn zu. »Mendel ben Baruch aus Köln – ich glaub es nicht! Was in aller Welt habt Ihr hier in Basel zu schaffen?«
»Die Witwe Arnheim!« Ein breites, fröhliches Lachen. »Oder sollte ich jetzt besser Frau de Vries sagen?«
»Johanna genügt«, erwiderte sie rasch. »Ich weiß von meinem Mann, wie sehr Ihr ihm geholfen habt, und dafür danke ich Euch. Aber wolltet Ihr nicht mit Eurer Frau nach Aachen, um Euch dort anzusiedeln?«
Mendels schmales Gesicht mit dem dunklen Bart wirkte auf einmal bedrückt. »Wir sind leider nicht überall willkommen, wohin es uns zieht«, antwortete er. »In Aachen mussten wir feststellen, dass die Schikanen gegen die jüdische Gemeinde von Monat zu Monat zunehmen. Und als Miriam dann endlich schwanger wurde nach all den vielen Jahren, in denen wir uns vergeblich ein Kind gewünscht hatten …«
»Ich hab auch erst vor Kurzem eine kleine Tochter geboren«, unterbrach sie ihn lebhaft. »Barbara. Gerade ist sie neun Monate geworden.«
»Unser Augenstern heißt Lea und ist ein halbes Jahr alt. Mir war wichtig, dass sie in Frieden aufwachsen kann. Deshalb haben wir Aachen schweren Herzens wieder verlassen und leben nun in Mainz, wo ein mächtiger Fürst mit starker Hand regiert. Ich hoffe, dieses Mal bleibt das Schicksal uns mehr gewogen.«
»Und Ihr handelt inzwischen mit Pferden? Habt Ihr Euer Stoffgeschäft ganz aufgegeben?«
Er wiegte den Kopf. »Das ist eine lange, ziemlich verwickelte Geschichte, von der ich das meiste für mich behalten muss. Nur so viel: Ich bin hier im Auftrag eines großen geistlichen Herrn, der sich etwas Spezielles in den Kopf gesetzt hat. Bislang allerdings waren meine Bemühungen leider vergebens. Und wenn ich nicht bald auftreiben kann, wonach es ihn gelüstet, muss ich mit leeren Händen zurückkehren, was ihm gar nicht gefallen wird.«
»Aber zuvor solltet Ihr unbedingt zu uns kommen«, sagte Johanna. »Vincent, Jakob, Nele, Sabeth – sie alle werden sich so sehr darüber freuen!«
»Ich kann Euch doch nicht zur Last fallen …«
»Aber das tut Ihr nicht, lieber Mendel, ganz im Gegenteil! Ihr seid ein Freund, jemand, der uns in Zeiten der Not mutig beigestanden hat, das werden wir Euch niemals vergessen. Vincent wäre außer sich, Euch in Basel zu wissen und nicht in unserem Haus bewirten zu können. Bitte sagt Ja – Ihr müsst es tun. Heute noch!«
Er senkte seinen Kopf, und als er ihn wieder hob, schimmerten seine Augen.
»Ich will ja gern kommen«, sagte er. »Aber wir haben seit vielen Jahrhunderten andere Gebräuche als ihr. Zum Beispiel ist es uns nur erlaubt, bestimmte Speisen zu uns zu nehmen, die zudem noch nach speziellen Vorschriften zubereitet werden müssen. Für Christen mag das reichlich kompliziert klingen, aber für uns ist es ganz alltäglich. Ich möchte euch nicht kränken, wenn ich Gast an eurem Tisch bin und dann alles verweigern muss, was ihr mir auftischt.«
»Wie wäre es dann mit Brot, den ersten Radieschen, einer Kräutersuppe und geräucherten Forellen? Dazu ein Becher Wein – dürftet Ihr das essen und trinken?«
Jetzt lächelte er. »Ja, das könnte gehen. Bis auf den Wein. Aber ich wäre auch mit Wasser oder Bier ganz zufrieden.«
»Dann kommt heute beim Abendläuten! Wir wohnen im St.- Alban-Tal, ganz in der Nähe der großen Kirche. Ein blauer Fisch an der Tür zeigt Euch, dass Ihr richtig seid.«
»Keine weißen Lilien mehr?« Seine Stimme war sanft.
Johanna schüttelte den Kopf und konnte ihn plötzlich nicht mehr anschauen.
»Das ist Vergangenheit«, sagte sie leise. »Jetzt blicken wir gemeinsam in die Zukunft.«
*
Inzwischen suchte die Krähe ihn jede Nacht heim. War es schon auf der Flucht gewesen, als er erneut ihre scharfen Krallen gespürt hatte, oder erst, nachdem sie in Basel angelangt waren? Jakob hätte es nicht mit Gewissheit sagen können. Jedenfalls quälte sie ihn, ein Albtraum unter anderen, von denen er eigentlich geglaubt hatte, dass sie für immer Vergangenheit seien.
Kaum war er wach, fuhr er hoch, schob sein Hemd nach oben und betastete seine glatte bräunliche Haut. Da war nichts zu sehen oder zu spüren – außer den alten Narben, die ihm jahrelang seinen Spitznamen eingebracht hatten. Doch nun war er nicht länger die Krähe, wie damals in Gaunerkreisen, sondern Jakob, Jakob de Vries, wie er sich manchmal halblaut vorsagte, obwohl es ihm noch immer so entsetzlich schwer über die Lippen ging. Die Leute behaupteten, er ähnle seinem Vater verblüffend, bis auf die grünen Augen, die er von seiner Mutter hatte. Aber wie konnte ein Nichtsnutz wie er einem rechtschaffenen Medicus aus dem Gesicht geschnitten sein, vor dessen Kunst sich alle verneigten?
Es gab nichts, was ihn mit diesem Vater verband – keinerlei gemeinsame Geschichte, denn seine Mutter hatte ihn die ersten Jahre allein großgezogen, bis sie an der Pest erkrankte und ihn in die Obhut einer anderen Frau geben musste, die ihn schließlich für ein paar Silberstücke verkaufte. Während Vincent de Vries nicht einmal geahnt hatte, dass er einen Sohn besaß, und Johanna tränenreich dessen Tod betrauert hatte, den Ita nur vorgetäuscht hatte, war für Jakob eine lange, bittere Leidenszeit angebrochen. Geschlagen, missbraucht, gedemütigt hatte ihn dieser Bettler, dessen Eigentum er plötzlich geworden war, bis er endlich kräftig genug war, sich für all das Erlittene zu rächen. Doch bis heute verfolgten ihn die gebrochenen Augen seines Peinigers, und manchmal hatte er Angst, sie besäßen die Macht, die alten Narben auf seiner Brust erneut zum Bluten zu bringen.
Dann hielt es ihn nicht länger im Haus. Dann konnte Jakob auch Neles fragende Blicke nicht mehr ertragen, so lieb und wichtig sie ihm sonst auch war. Dann zog es ihn mit Macht zurück – zu den Vagabunden, Bettlern und Huren, den Ehrlosen, die nach eigenen Gesetzen außerhalb der Gesellschaft lebten. In solchen Augenblicken, wenn er jemand nobel Gekleidetem auf der Straße begegnete, begannen seine Hände zu zucken. Er musste einfach hinterher und ausspähen, wie sich am besten Beute machen ließe. Schon einige Male hatte er sich unversehens am anderen Ende der Stadt wiedergefunden, ohne genau sagen zu können, wie er eigentlich dorthin gelangt war. Es konnte Stunden dauern, bis er wieder zur Besinnung kam. Danach fand er nur mühsam in sein neues Leben zurück. Die alte Sabeth sah es ihm als Einzige an, wie schwer das für ihn war, und zeichnete ihm verstohlen ein Kreuz auf Stirn, Mund und Brust.
»Leg die dunklen Flügel ab, Jakob!«, sagte sie. »Die brauchst du nicht mehr. Ab jetzt trägt dich die Liebe deiner Eltern. Du musst dich nur noch darauf verlassen.«
Wie gern hätte er ihr geglaubt! Doch jeder neue Tag nahm ihn erneut in die Pflicht und bewies ihm, wie schwierig sein Leben war. Überall lauerten Gefahren wie zum Beispiel im Haus des reichen Braumeisters an der Freien Straße, in das man sie gerufen hatte. Dessen kleine Söhne, beide unter zehn Jahren, klagten über Übelkeit und Schluckbeschwerden, jammerten, der Bauch tue ihnen weh, und sie fieberten stark. Die Mutter ging umher wie ein Geist, so bleich war sie, während der Vater seine Wut auf das Schicksal kaum noch im Zaum halten konnte.
»Rettet sie!«, schrie er, während der Medicus, dessen untere Gesichtshälfte ein Tuch verbarg, die Kleinen mit sanfter Stimme dazu brachte, den Mund zu öffnen. Er zuckte leicht zurück, als ihm ein faulig süßlicher Geruch entgegenschlug.
»Siehst du das, Jakob?«, sagte er halblaut. »Jenen gelblich weißen Belag? Und riechst du vor allem, was ich rieche?«
Jakob nickte. Plötzlich war er froh um das Tuch vor dem Mund, zu dem der Vater ihn genötigt hatte.
»Sie sind unruhig und wollen kaum essen, richtig?« Diese Frage war an die Mutter der kranken Kinder gerichtet.
»Ja, und ständig läuft ihnen die Nase. Der Schleim, der herausrinnt, ist gelblich, manchmal sogar mit Blut versetzt. Und sie müssen immer wieder bellend husten, was mir jedes Mal durch Mark und Bein geht …«
Vincent erhob sich langsam. »Ich denke, es ist die Halsbräune, die sie quält«, sagte er. »Viele Kinder erkranken daran, aber sie kann durchaus auch Erwachsene treffen. Könnt Ihr Euch erinnern, dass sie Euch befallen hatte, als Ihr klein wart?«
Einträchtig schüttelte das Ehepaar den Kopf. Jetzt schimmerte auch die Haut des Vaters grünlich vor Angst.
»Dann müsst Ihr umso vorsichtiger sein«, sagte Vincent. »Bindet Euch ein Tuch vor den Mund, so wie mein Sohn und ich es getan haben, wenn Ihr ihnen nahe kommt. Und wascht Eure Hände, bevor und nachdem Ihr sie berührt habt.«
»Aber sie sind doch unsere Kinder!«, begehrte der Braumeister auf. »Unser eigen Fleisch und Blut. Von ihnen kann nichts Böses auf uns kommen!«
»Manchmal eben doch.« Vincents Stimme war streng. »Was würde es ihnen nützen, wenn Ihr auch noch krank würdet?«
»Dann ist das Böse in der Luft?«, flüsterte die Mutter. »Es fliegt umher, auch wenn man es nicht sehen kann?«
Der Medicus zuckte die Achseln. »Wenn wir das genauer wüssten, dann wären wir Mediziner sicherlich einen großen Schritt weiter, aber es könnte durchaus sein. Sich zu schützen kann jedenfalls nicht schaden. Das habe ich in Zeiten der Pest gelernt.« Er wandte sich nach links. »Hol die getrocknete Braunelle aus meiner Tasche, Jakob! Geh mit der Hausfrau in die Küche und bereitet dort einen Tee davon zu. Lasst ihn ein wenig abkühlen, aber warm sollte er schon noch sein. Dieses Gebräu müsst Ihr ihnen dann einflößen. Viele Male am Tag. Wenn möglich, sollten sie zusätzlich damit gurgeln.«
Die blonde Frau vor ihm stolperte beim Gehen über ihren Saum, so aufgeregt war sie. Auf dem Herd stand ein Kupferkessel.
»Das Wasser muss erst richtig aufkochen«, sagte Jakob. »Nur so kann die Medizin sich entfalten.«
Sie schob Holz in den Ofen, derart ungeschickt, dass sie ihm auf einmal leidtat. Ganz offensichtlich war sie mit der Küchenarbeit nicht sonderlich vertraut.
»Habt Ihr denn keine Magd, die Euch zur Hand gehen könnte?«, fragte er.
»Wir hatten sogar zwei.« Jetzt klang sie bitter. »Doch sobald die Kinder krank wurden, sind sie weggelaufen.«
Er hörte ihr plötzlich kaum noch zu, denn er hatte den Ring entdeckt, der neben einem Teller lag. Der geschliffene rote Stein, gebettet in einen schmalen goldenen Reif, funkelte, als wollte er Jakobs Aufmerksamkeit wecken, doch der konnte ohnehin keinen Blick mehr von dem Schmuckstück wenden. Wie edel es an Neles zierlichem Finger wirken würde, die längst schon einen Ring verdient hätte! Doch mit dem wenigen, das er für seine Hilfsdienste bekam, würden sie beide wohl alt und grau werden, bevor sie sich solch ein Juwel leisten konnten.
Blitzschnell griff er zu. Vor seinen Augen wurde es gleißend hell. Dann war es, als wäre es niemals geschehen.
Die Hausfrau goss den Tee auf, konzentriert, weil sie offenbar Angst hatte, sich die Hände zu verbrühen. Jakob pfiff vor sich hin und schaute angestrengt aus dem Fenster.
»Der Medicus wird meine Söhne doch wieder gesund machen, meinst du nicht auch?« Ihre Augen waren rund und braun wie polierte Kastanien.
»Er versteht seine Kunst«, sagte Jakob knapp, weil er sich ärgerte, dass sie ihn auf einmal duzte, und weil der rote Stein in seiner Hosentasche brannte, als bestünde er aus flüssigem Feuer. »Aber seine Anordnungen sind genauestens zu befolgen.«
»Das werde ich tun.« Sie schluchzte plötzlich auf. »Roland hat mich nur zur Frau genommen, damit ich ihm viele Söhne gebäre. Wenn sie nun sterben …«
Jakob legte ihr für einen Moment die Hand auf den geraden Scheitel. »Ihr dürft die Hoffnung nicht verlieren«, sagte er sanft. »Niemals!«
*
Wie blass die beiden waren, als sie nach Hause kamen! Jetzt tat es Johanna auf einmal leid, dass sie Mendel ben Baruch schon heute zum Essen eingeladen hatte. Aber zu einer Änderung war es nun zu spät, denn sie wusste ja nicht einmal, wo sie ihn erreichen konnte. Außerdem hatte sie sich trotz der Fastenzeit große Mühe gegeben, ein anständiges Abendessen zuzubereiten, das allen schmecken würde.
Vincent verschwand sofort in der kleinen Kammer neben der Küche, wo neben einer Holzwanne zwei Waschschüsseln auf einem Gestell standen. Da Johanna die alte Magd nicht mehr gern ans Feuer ließ, hatte sie in der Küche zwei Wassertröge auf dem Herd erhitzt, die sie jetzt mit Neles Hilfe nach nebenan schleppte. Das Mädchen zog sich sofort zurück, weil Vincent schon sein Hemd abgestreift hatte, um sich ausführlich zu reinigen. Johanna jedoch blieb neben ihm stehen und beobachtete ihn ruhig.
Wie sehr sie seinen Körper liebte! Die breiten Schultern, die zarten Schlüsselbeine, die glatte Brust, den Bauch, der immer noch flach und muskulös war wie bei einem jungen Mann, auch wenn das Silber in seinen dunklen Haaren von Jahr zu Jahr mehr wurde.
»Ist irgendetwas passiert?«, fragte sie, nachdem er sich sorgfältig trocken gerieben hatte.
»Ich fürchte, ja. Und hoffe gleichzeitig inständig, dass ich mich irre.« Den Willkommenskuss war er ihr bislang schuldig geblieben. Johanna kannte ihn inzwischen gut genug, um zu wissen, was das bedeutete.
»Dann sag es mir!«
Er fuhr zu ihr herum, und für einen Moment wirkte sein Gesicht verletzlich. »Die Halsbräune«, sagte er leise. »Es gab schon letzte Woche zwei verdächtige Fälle, aber da war ich mir noch nicht ganz sicher. Doch nun sind auch die Söhne von Braumeister Hilty erkrankt – und ich kann so wenig dagegen unternehmen. Deshalb wasche ich mich sorgfältig, wenn ich von den Kranken komme. Das habe ich mir von den Juden abgeschaut, die Wasser weitaus öfter und verschwenderischer verwenden als wir. Obwohl ich nicht die geringste Ahnung habe, ob das gegen Krankheiten irgendetwas ausrichten kann.«
»Braunelle«, sagte sie. »Als Tee gebraut. Hast du das schon versucht? Damit ist unser Sohn wieder gesund geworden, als er kaum ein Jahr alt war.«
»Jakob hat die Halsbräune gehabt?« Vincent klang plötzlich um Jahre älter. »Nicht einmal das weiß ich von ihm.«
»Ihr beide werdet Zeit haben, das alles nachzuholen«, sagte Johanna. »Und was die Ungeduld betrifft, so hat dein Sohn sie eindeutig von dir geerbt. Außerdem habe ich eine schöne Überraschung für dich: Wir bekommen Besuch. Jemanden, mit dem du sicherlich nicht gerechnet hast.«
Er schenkte ihr ein winziges Lächeln.
»Wenn sich bei Jakob auch noch die Klugheit seiner Mutter dazugesellt, will ich ganz zufrieden sein«, sagte er und zog sie fest an sich. Johanna schmiegte sich an seine Brust. Sein Mund berührte ihren Scheitel, ihre Stirn, schließlich ihre Lippen.
Sie küssten sich innig und leidenschaftlich.
»Früher kannte ich die Angst nicht, alles zu verlieren, weil ich nur so wenig besaß«, sagte Vincent, als sie sich wieder voneinander gelöst hatten. »Mein Pferd. Meine Bücher und Instrumente – was brauchte ich mehr? Der Rest war allein in meinem Kopf und in meinen Händen. Jetzt aber habe ich auf einmal eine Frau, zwei Kinder, dazu eine Ziehtochter und die alte Sabeth, die alle unter meiner Obhut stehen …«
»Du hast noch Mieze und Rosa vergessen«, unterbrach sie ihn lächelnd. Dann wurde sie wieder ernst. »Sollte Jakob sich nicht auch gründlich reinigen, wenn du es schon für so wichtig befindest?«
»Wenn du es ihm behutsam sagst, macht er es vielleicht sogar«, erwiderte er. »Auf dich hört er eher als auf mich. Und wer ist nun dieser geheimnisvolle Besuch?«
Doch Johanna behielt es für sich, bis sie zusammen am Tisch saßen und die Glocken von St. Alban erst viermal und gleich danach siebenmal hintereinander schlugen. Draußen war es bereits dunkel, obwohl deutlich zu spüren war, wie das Licht langsam zurückkehrte und die Tage allmählich länger wurden.
Der Winter ist endgültig vorüber, dachte sie, als sie ein lautes Klopfen an der Tür hörte. Sie stand auf, um zu öffnen. Jetzt bricht die Jahreszeit an, die ich am meisten liebe.
Sie lächelte, als sie Mendel erblickte, der einen Sack in der Rechten hielt, den er ihr zur Begrüßung entgegenstreckte.
»Das ist für Euch«, sagte er. »Die Hülle mag unscheinbar sein. Der Inhalt aber ist es, wie ich hoffe, nicht.« Sie bat ihn herein – und freute sich, weil Jakob ungestüm aufsprang, als er ihn erkannte. Auch Vincent erhob sich, drückte ihm die Hand und bestand darauf, dass er neben ihm Platz nahm. Ohne lange zu fragen, stellte Johanna Mendel einen Krug Bier hin.
»Stärkt Euch erst einmal!«, sagte sie. »Dann redet es sich einfacher.«
Er trank in großen, durstigen Zügen, während sie den Sack öffnete und begeistert das feine blaue Leinen begutachtete, das er ihr mitgebracht hatte. Von großem Dank wollte der Gast nichts wissen, sondern tat alles mit einer Geste ab.
»Schöne Frauen brauchen schöne Kleider«, sagte er. »So und nicht anders verstehe ich mein Geschäft.«
»Und jetzt will ich alles wissen«, sagte Vincent ungeduldig. »Was führt Euch nach Basel?«
Während Mendel zu erzählen begann, füllte Nele die Näpfe mit Suppe, und Johanna schnitt das helle Brot auf.
»Aachen war kein guter Ort für uns«, sagte er. »Die dort ansässigen Juden leben so gebückt und unterwürfig, dass ich kaum noch atmen konnte. Miriam ging es ganz ähnlich; doch zuerst hat sie nichts gesagt, weil sie mir das Leben nicht noch schwerer machen wollte. Zum Glück hat sie sich mir nach einiger Zeit dann doch anvertraut. Dabei liefen die Geschäfte gar nicht übel an – aber was nützt das schon, wenn das Herz dabei immer traurig ist?«
Er lobte die Suppe, das Brot und die Forellen, die auch den anderen am Tisch mundeten. Sogar Barbelchen, die auf Sabeths Schoß saß, streckte die kleine Hand aus und wollte davon kosten. Die Alte formte ein winziges Kügelchen und steckte es ihr in den Mund. Zuerst runzelte die Kleine die Stirn und wirkte misstrauisch, schließlich jedoch begann sie zu strahlen und zeigte dabei vier weiße Zähne.
Mendels Augen begannen bei diesem Anblick zu leuchten.
»Sie sind das Salz der Welt«, sagte er. »Unsere Liebe. Unsere Zukunft. Endlich dürfen auch meine Miriam und ich dieses Glück erleben.« Eine tiefe Falte erschien zwischen seinen Brauen. »Aber es macht einen auch ängstlich, dieses Glück«, sagte er leise. »Weil man stets befürchtet, es könnte zerbrechen.«
»Ich weiß genau, wovon Ihr redet«, sagte Vincent, und Johanna nickte zustimmend. »Die Last ist süß, aber sie wiegt auch schwer. Und dennoch tragen wir sie, ohne uns zu beklagen.«
»So habt Ihr Euch in Basel gut eingelebt?« Mendel war inzwischen beim zweiten Krug Bier angelangt.
»Ich kann die Stadt nicht leiden«, brach es aus Jakob heraus, der bislang auffallend still gewesen war.
»Und weshalb?«, fragte Mendel.
»Eng ist es hier. Und dunkel. Nein, damit meine ich nicht den Fluss, der hier viel wilder fließt, auch wenn er schmäler ist. Den mag ich gern, ich meine die Menschen. Kaum jemand lacht. Alle sind immer nur ernst. Und so vieles ist hier verboten. In Köln, da war es anders, obwohl die Pest gewütet hat, irgendwie heller. Offener. Dorthin möchte ich am liebsten wieder zurück.«
Johanna schüttelte den Kopf.
»Was redest du da, Jakob? Man würde dich sofort aufhängen, oder hast du schon vergessen, dass man dich für den Mord am Ratsherrn Neuhaus bestrafen will? Nur die Klugheit und Kaltblütigkeit deines Vaters haben dich vor dem Galgen gerettet.«
»Es war kein Mord, sondern Notwehr, aber den Tod, den hat er verdient – tausendmal!« Jakobs Kiefer mahlten. »Nele wollte er aus Grausamkeit und Heimtücke umbringen. Er hat sie gezwungen, die widerlichen Pestlappen anzuziehen …«
Das Mädchen stand auf, lief zu ihm und berührte seine Wange. »Aber ich lebe, Jakob«, sagte sie. »Allein das zählt. Was auch immer er vorhatte – es ist ihm nicht gelungen.«
»Köln schlag dir für immer aus dem Kopf!«, sagte Vincent. »Solange Hermann von Wied dort regiert, kommt es für uns nicht infrage. Und selbst wenn eines Tages ein Nachfolger als neuer Erzbischof antritt, ist es weiterhin ratsam, uns von dort fernzuhalten.« Er schob seinen Teller beiseite. »Basel kenne ich schon aus Jugendjahren. Hier hab ich schließlich deine Mutter gefunden. Ja, und es hat sich tatsächlich verändert, seit die Reformierten das Sagen haben. Sogar die Universität, einst das Aushängeschild der Stadt, hat an Ansehen verloren, weil gute Leute abgewandert sind.«
»Du weißt, ich wollte eigentlich nie mehr hierher.« Johanna sah ihn zwingend an. »Nur deinetwegen hab ich mich schließlich doch überreden lassen. Aber wohl fühle ich mich hier deshalb noch lange nicht. Das solltest du wissen.« Ihr Blick flog zu ihrem Sohn. »Ich kann durchaus verstehen, was du sagst, Jakob. Aber wir sollten vernünftig sein. Wir sind doch gerade erst angekommen. Und noch immer dabei, heimisch zu werden. Vielleicht müssen wir ja nicht für immer hier bleiben.«
Mendel ben Baruch sah sie aufmerksam an. »Eine andere Stadt? Was hieltet Ihr beispielsweise von Mainz?«
»Wieso Mainz?«, fragte Johanna.
»Nun, weil ich zufällig weiß, dass Kurfürst Albrecht von Brandenburg händeringend einen neuen Leibarzt sucht.«
»Mich als Leibarzt eines Kurfürsten verdingen?« Vincents Lächeln war schmerzlich. »Das hatten wir bereits. Und es ist uns allen nicht gerade gut bekommen!«
»Kardinal Albrecht von Brandenburg ist stärker und entschlussfreudiger als der schwache Erzbischof von Köln«, sagte Mendel. »Er liebt und fördert die Künste, hat wichtige Gelehrte an seinem Hof versammelt, ist Essen und Trinken nicht abgeneigt. Seit einiger Zeit plagen ihn allerdings gesundheitliche Probleme, das weiß ich aus sicherer Quelle. Er würde Eure Heilkunst gewiss fürstlich entlohnen, denn ein Pfennigfuchser ist er sicherlich nicht.«
»Um dann bei nächster Gelegenheit Hermann von Wied mitzuteilen, wer ihm bei seinen Malaisen hilft?« Vincents Stimme war scharf geworden. »Vergesst es!«
»Die beiden sind sich spinnefeind. Und seit bekannt wurde, dass von Wied heimlich mit den Lutheranern liebäugelt, herrscht blankes Eis zwischen den beiden Fürsten. Albrecht von Brandenburg hasst die Protestanten, die ihn aus seinem geliebten Halle vertrieben haben. Er will sein reiches Mainz unbedingt katholisch halten.«
»Vergebt mir die Frage, werter Freund«, sagte Vincent, »aber wieso kennt ausgerechnet Ihr Euch in diesen heiklen Belangen so gut aus?«
»Ihr meint, ausgerechnet ich, ein Jude?« Mendels Mundwinkel kräuselten sich leicht. »Ein Jude, der an einem geistlichen Hof überleben möchte, muss das Gras wachsen hören, lieber Medicus. Nichts anderes tue ich.« Er wandte sich zu Johanna. »Außerdem sind die Verbindungen meines Volkes weitverzweigt. Und sie betreffen nicht nur edle Rösser oder feines Tuch.«
Einen Augenblick war es ganz still an der Tafel.
Dann grapschte die kleine Barbara nach einem Löffel, packte ihn fest und haute damit in den Suppentopf, der vor ihr stand. Ein hoher grünlicher Schwall spritzte über den Tisch.
Alle lachten. Die Spannung hatte sich aufgelöst.
»Das Salz der Erde?«, sagte Johanna lachend, während sie den Topf geschwind vor neuen Attacken in Sicherheit brachte. »Ein Salz jedenfalls, das einem bisweilen sehr viel Arbeit machen kann.«
*
»Hast du das wirklich so gemeint vorhin?«, fragte Vincent, als sie nebeneinander in der Stille der nächtlichen Bettstatt lagen. »Dass du dich hier nicht wohlfühlst?«
»Ich versuche es ja«, sagte Johanna nach einer Weile sehr leise, weil neben ihr die kleine Barbara in ihrer Wiege schlief.
»Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ich spüre doch schon länger, dass dir etwas auf der Seele liegt.«
Sie überlegte, bevor sie erneut zu reden begann. »Ich dachte, das mit dem Oheim und dem Büßerkloster, in das er mich gesteckt hat, wäre Vergangenheit. Aber ich muss nur in die Nähe von St. Leonhard kommen – und alles ist wieder so lebendig wie damals: meine Angst, meine Not, die Ungewissheit, was aus mir und dem Ungeborenen werden soll. Ich weiß, es ist für immer vorbei. Aber so fühlt es sich für mich nicht an.«
»Ich habe schon einmal in Mainz gelebt«, sagte Vincent. »Kurz nachdem dein Onkel uns durch seine Intrigen auseinandergebracht hat. Ich war nur ein gutes Jahr dort, dann bin ich weiter nach Straßburg gezogen.«
»Davon weiß ich ja gar nichts …« Sie wandte sich zu ihm, und er nahm sie in die Arme.
»Es gibt so einiges, das du noch nicht von mir weißt«, sagte er, nachdem sie sich geküsst hatten. »Irgendetwas muss ich dir ja noch zu erzählen haben, während wir beide zusammen alt werden.«
Johanna lachte leise und genoss seine Wärme.
»Ich kannte in Mainz einen Apotheker, mit dem ich damals eng zusammengearbeitet habe«, fuhr er fort. »Auberlin Sixt, so lautet sein Name. Er wäre genau der Richtige, um Jakob in eine Art Lehre zu nehmen. Ich kenne niemanden, der mehr über Heilpflanzen und Kräuter weiß als dieser Mann. Und er besäße zudem die notwendige Autorität, um unseren stolzen, störrischen Sohn zu zähmen.«
»Bist du diesem Auberlin denn noch einmal begegnet?«
Vincent schüttelte den Kopf. »Nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Aber man hat mir immer wieder von ihm erzählt. Sein Ruf ist bis nach Straßburg gedrungen. Wenn er noch am Leben wäre und gesund dazu …« Er verstummte.
»Mainz liegt nicht gerade weit weg von Köln«, sagte sie. »Sofern ich Mendel ben Baruch richtig verstanden habe. Das gefällt mir nicht daran.«
»Ein paar Tagesritte, wenn man ein schnelles Ross hat«, sagte Vincent. »Aber man muss ja nicht unbedingt nach Köln reiten. Und wenn die beiden Stadtherren einander so feind sind …«
»Soll das heißen, dass Mendel dich bereits zum Überlegen gebracht hat?«, unterbrach sie ihn.
»Unser jüdischer Freund wird nach seiner Rückkehr beim Kurfürsten meinen Namen ins Spiel bringen, falls sich dazu eine passende Gelegenheit ergibt. Nicht mehr und nicht weniger. Dann werden wir sehen, was weiter geschieht.«
Johanna spürte, wie ihr Herz schneller zu schlagen begann.
»Du würdest es für uns tun«, sagte sie. »Für Jakob und mich. Und dafür liebe ich dich umso mehr.«
»Ihr seid mein Leben, Johanna. Du, Jakob und Barbara. Für euch würde ich alles tun. Alles.«
ZWEI
Inzwischen waren es nicht mehr nur Kinder, die stark fieberten, das Essen verweigerten und mit dickem Hals pfeifende Geräusche von sich gaben, sondern auch immer mehr Erwachsene, die über Schmerzen im ganzen Körper klagten und aus Schwäche ihr Lager nicht mehr verlassen konnten. Außer Vincent de Vries gab es noch einen weiteren Medicus in der Stadt, den alten Raess, dazu die beiden Bader Gisler und Wältin. Sie gaben sich Mühe, die Patienten untereinander aufzuteilen, um keinen unversorgt zu lassen. Doch Braunelle als traditionelles Heilmittel erwies sich immer öfter als machtlos.
»Die Halsbräune führt uns an der Nase herum«, sagte Vincent verzweifelt, der immer öfter bis spät in die Nacht über seinen Büchern brütete, um herauszufinden, ob er nicht doch etwas übersehen hatte, was die Krankheit bannen könnte. »Mir kommt es vor wie ein teuflisches Spiel: Je mehr wir uns anstrengen, desto schneller schreitet sie voran. Was, wenn es so weitergeht? Dann wären Hunderte in Lebensgefahr.«
Schließlich entdeckte er in einer alten Handschrift die Empfehlung eines italienischen Alchimisten: ein Gurgelwasser aus Salpeter und Schwefel, das er exakt nach dessen Angaben zusammenbraute und seinen Kranken zu verabreichen versuchte. Doch die Mischung roch derart widerlich, dass die Kinder bereits bitterlich zu weinen begannen, sobald er damit in ihre Nähe kam. Lediglich einige wenige Hartgesottene unterzogen sich freiwillig dieser Prozedur – ohne jedoch davon gesund zu werden.
Es machte Johanna ganz elend, ihn so zu sehen, erst recht, weil sie spürte, dass die angespannte Lage Vater und Sohn weiter entzweite. Nach ein paar Ausflüchten weigerte Jakob sich eines Morgens, die Häuser Infizierter zu betreten, und weder die väterlichen Ermahnungen noch der mütterliche Appell an sein Mitgefühl konnten seine Haltung ändern.
»Was hilft es den Leuten, wenn ich auch noch krank werde?«, sagte er aufsässig. »Ich bin doch lediglich ein Wasserträger, den jeder andere ersetzen kann.«
»Dann lässt du deinen Vater in dieser schwierigen Situation allein?« Es fiel Johanna schwer, Jakob nicht anzuschreien. »Das musst du mit Gott, dem Allmächtigen, ausmachen!«
»Hat nicht Gott uns diese Prüfung geschickt?« Wie klug er zu argumentieren wusste, wenn er sich Mühe gab! Beinahe, als sei er kein ehemaliger Vagabund, sondern ein Gelehrter. »Wenn das zutrifft, hat er sicherlich auch seine Gründe dafür. Gott wird retten, wen er retten will – sofern es in seinen ewigen Plan passt.«
Nach diesen Worten lief Jakob aus dem Haus, wohin, das wusste Johanna nicht. Erst spätabends trudelte er wortkarg und mürrisch wieder ein. War er gerade dabei, erneut in schlechte Gesellschaft abzurutschen? Nach außen hin gab Basel sich so sauber, so fromm, doch kaum war man am Kohlenberg angelangt, wo auch der Henker wohnte, traf man sehr wohl auf ehrloses Gesindel.
Vincent dagegen kämpfte unbeirrt weiter, obwohl er immer öfter gegen die Krankheit verlor. Der Jüngste des Braumeisters, der fünfjährige Reto, verschied japsend, und die Trauer der Eltern zerriss ihm schier das Herz.
»Jetzt müsst Ihr wenigstens unseren Großen retten!«, bettelte Bethli, die Mutter, in Tränen aufgelöst, während der zweite Sohn hilflos nach Luft rang. »Sonst stürze ich mich in den Rhein. Ohne meine Kinder will ich auch nicht mehr leben.«
Erschöpft erhob sich Vincent. Zu seiner Überraschung war Jakob heute wieder dabei, obwohl es ihn sichtlich Überwindung gekostet hatte, das Haus des Braumeisters zu betreten.
»Tonis Hals ist fast zugeschwollen«, sagte Vincent, nachdem er die Eltern beiseitegenommen hatte. »Und sein Herz wird immer schwächer. Wenn er weiterhin so wenig trinkt, sind auch noch die Nieren gefährdet. Ich kann Euch leider keine großen Hoffnungen machen, so gern ich das auch täte. Setzt das Gurgeln fort, flößt ihm an Flüssigkeit ein, was immer Ihr in ihn hineinbekommt, und betet zu Jesus Christus, zur Jungfrau Maria oder zum heiligen Rochus! Das ist das Beste, was Ihr derzeit tun könnt.«
Zornig funkelte der Braumeister ihn an.
»Dann seid Ihr also gar kein rechtschaffen Reformierter, der nach den Lehren der Heiligen Schrift lebt! Dem alten Glauben hängt Ihr an und wollt durch Zauberwerk und Götzendienst unser Kind verderben. Hinaus mit Euch – auf der Stelle! Einen unserer Söhne habt Ihr ja bereits auf dem Gewissen …«
Toni bäumte sich auf, die Augen übergroß im roten, unförmig geschwollenen Gesicht, als wollten sie aus den Höhlen quellen. Sprechen konnte er nicht mehr, er gab nur noch hohe Pfeifgeräusche von sich.
»So unternehmt doch etwas!« Bethli klammerte sich an den Medicus. »Helft unserem Kind in Gottes Namen!«
»Ich kenne nur eine einzige Methode, die ihm Erleichterung bringen könnte«, sagte Vincent. »Doch dazu müsste ich ihm den Hals aufschneiden …«
»Wenn du die Hand an mein Fleisch und Blut legst, bring ich dich um!«, keuchte der Braumeister.
»Lass ihn, Roland!« Bethlis Stimme klang entschlossen. »Zeigt Eure Kunst, Medicus de Vries – ich vertraue Euch!«
»Es gibt keinerlei Garantie.« Vincents Blick hielt sie fest. »Das müsst Ihr wissen. Er könnte dabei auch sterben.«
»Versucht es!« Sie wirkte plötzlich größer. »Wenn wir nichts riskieren, verlieren wir ihn auf jeden Fall, richtig?«
Vincent nickte.
»Nun denn: Was müssen wir tun?«, fragte sie.
»Erhitzt Wein.« Die Anweisungen des Medicus waren nun sehr knapp. »Und bringt mir einen sauberen Schwamm!« Bethli nickte und lief los. »Außerdem brauche ich Tinte oder Ruß.« Das war an Hilty gerichtet, der ebenfalls hinausrannte.
Vincent sah Jakob an. »Du wirst mir assistieren. Dein Griff ist ebenso wichtig wie mein Schnitt.«
Sehr schnell stand auf einem Stuhl neben dem Krankenlager, wonach er verlangt hatte, dazu ein Schilfröhrchen, das er aus seiner Tasche geholt hatte. Er brachte Toni behutsam in eine sitzende Stellung und bat Bethli, ihren Sohn von hinten mit ihrem Körper zu stützen. Das durchgeschwitzte Nachtgewand hatten sie ihm schon zuvor abgestreift.
Zitternd vor Fieber und Angst saß der kleine Junge da.
Mit Asche zog Vincent eine gerade Linie vom unteren Rand des Schildknorpels bis zum oberen Rand des Brustbeins. Dann stellte er sich rechts neben das Bett, während er Jakob an die linke Seite beorderte.
»Zieh die Haut am Hals fest auseinander!«, befahl er. »Genauso, wie ich es tue.«
Schließlich setzte er sein Skalpell an. Hilty stieß einen Klagelaut aus, als die Haut des Jungen aufklaffte und helles Blut austrat, Vincent jedoch ließ sich nicht davon beirren. Er tastete in die blutende Wunde, um den Übergang vom Ringknorpel, der direkt unter dem Schildknorpel lag, zum ersten Knorpelring der Luftröhre zu identifizieren. Nachdem er die Stelle gefunden hatte, durchschnitt er mit einem stichartigen Schnitt diesen Ring und schuf auf diese Weise einen Zugang zur Luftröhre, der groß genug war, um das Schilfröhrchen ohne Widerstand mit ausreichender Abdichtung durch das umgebende Gewebe einzuführen.
»Das Röhrchen!«, verlangte Vincent. »Schnell!«
Jakob reichte es ihm, und der Medicus versenkte es in der Wunde.
Toni begann heftigst zu husten; Blut und Schleim schossen aus seiner Nase, dann jedoch wurde seine Atmung ruhiger. Vincent benetzte den Schwamm mit heißem Wein und legte ihn auf die äußere Öffnung des Röhrchens.
Nach und nach verschwand die ungesunde Röte aus dem Kindergesicht. Die Brust hob und senkte sich gleichmäßig.
»Er lebt«, rief Bethli weinend. »Er kann wieder atmen! Ihr habt ihn uns zurückgegeben!«
»Ja, aber er ist noch lange nicht über den Berg«, sagte Vincent mahnend. »Wiederholt das mit dem Wein, hüllt ihn warm ein, betupft seine Lippen. Gebt ihm zu trinken und lasst ihn vor allem spüren, dass er nicht allein ist. Ich komme später wieder, um nach ihm zu schauen.«
»Ihr wollt ihn so zurücklassen?«, fragte Hilty fassungslos. »Mit einem Loch im Hals? Habt Ihr vollständig den Verstand verloren?«
»Im Augenblick kann ich nichts weiter für ihn tun. Bedeckt die Wunde mit einem Leinentuch. Nach ein paar Tagen werde ich sie zunähen. Wenn Toni Glück hat, erinnert ihn später nur noch eine verblassende Narbe an diesen Tag.«
Der Braumeister packte Vincent am Arm, um ihn am Verlassen der Stube zu hindern, doch der Medicus machte sich frei.
»Wir müssen jetzt weiter. Komm, Jakob! Andere Kranke in großer Not warten bereits sehnsüchtig auf uns.«
*
Am dritten Tag nach der Operation konnte Vincent das Röhrchen behutsam herauslösen, und er vernähte die Wunde mit einem Seidenfaden, was der Junge ohne zu weinen tapfer ertrug. Toni war noch schwach und mager, er hatte aber kein Fieber mehr und war wieder in der Lage, selbstständig zu atmen und fast ohne Schmerzen zu schlucken.
Bethli drängte Vincent zwei große Bierfässer auf, die ihm an die Haustür geliefert werden sollten, und sie wollte ihren Mann dazu bringen, dem Medicus doppelt so viel zu bezahlen, wie er verlangte.
»Für immer stehen wir in Eurer Schuld«, rief sie bewegt. »Ihr habt ein Wunder vollbracht. Bei der ganzen Aufregung hab ich auch noch meinen Trauring verlegt, aber was schert mich das? Hauptsache, unser Kind lebt!«
»Mir wäre es lieber, Ihr würdet davon kein so großes Aufheben machen.« Vincent nahm an Geld nur, was ihm zustand. »Dieser Eingriff kann stets nur ein Schritt in allergrößter Not sein. Toni hat großes Glück gehabt. Wir alle haben Glück gehabt. Beim Nächsten kann es ganz anders ausgehen.«
Doch die Kunde von der Rettung des Jungen verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. In jedem Haus, in das Vincent und Jakob kamen, wurde er nun darauf angesprochen, und ging es einem Kranken besonders schlecht, erwarteten die Angehörigen, dass der Medicus auch hier den rettenden Schnitt setzte. Es half wenig, geduldig zu erklären, dass Tonis Operation die absolute Ausnahme gewesen war. Manche begannen zornig zu werden und wollten nicht länger zuhören. Andere unterstellten Vincent, er ziere sich lediglich, um sie zu noch höheren Zahlungen zu bewegen. Wiederum andere kramten alles hervor, was sie besaßen, und boten es ihm an, wenn er nur ihre Kinder rettete.
»Ich weiß bald nicht mehr, was ich tun soll«, vertraute Vincent sich Johanna an. »Ich kann doch nicht täglich gewaltsam Luftröhren öffnen – wie stellen die Leute sich das eigentlich vor?«
»Sie sind verzweifelt, Liebster«, sagte sie und umarmte ihn fest. »Wie ich es damals war, als Jakob so krank war. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auch noch unsere Kleine zu keuchen beginnt …«
»Und siehst du, nicht einmal das kann ich dir versprechen.« Er sprang auf und begann unruhig in der Stube auf und ab zu gehen. »Das, was wir die Lehre von der Medizin nennen, ist lediglich ein mühsames Stochern im Nebel. Wie verbreitet sich diese Krankheit? Woher kommt sie? Und wieso befällt sie den einen, während der neben ihm gesund bleibt? Diese Fragen treiben mich noch in den Wahnsinn.«
»Ich liebe dich dafür, dass du niemals aufgibst.« Johanna umfing ihn von hinten und spürte, wie er nach und nach weicher in ihren Armen wurde. »Du bist ein Vorbild, Vincent. Mach weiter so! Vielleicht steckst du damit auch andere an.«
Er wandte sich halb zu ihr um, in seinen dunklen Augen unübersehbare Skepsis.
»Leider aber machen sich die meisten Menschen nur wenig aus Vorbildern, meine Jo«, sagte er. »Weil diese ihnen nämlich die eigene Erbärmlichkeit nur umso drastischer vor Augen führen. Gesellen sich dann Eifersucht und Neid dazu, wird es noch übler. Deshalb habe ich dieses Getratsche noch nie leiden können.«
Sie versuchte, seine bedrückte Stimmung wegzuküssen, aber es misslang. Vincent wurde erst ruhiger, nachdem er erneut sein allabendliches Studium aufgenommen hatte.
Ein paar Tage später trat Johanna den Weg an, den sie seit ihrer Rückkehr nach Basel bislang aufgeschoben hatte. Die kleine Barbara wusste sie unter Neles und Sabeths Obhut wohlversorgt, so machte sie sich daran, die Tür ins Gestern noch einmal aufzustoßen. Das Haus ihres Oheims hatte zum Sprengel von St. Leonhard gehört. Daher war diese Kirche auch stets ihre Zuflucht gewesen.
Ihre Beine wurden schwer, als sie den alten Stadtkern hinter sich gelassen hatte und die vielen Stufen zum Leonhardsberg hinaufstieg. Als Kind hatte sie das dreischiffige Gotteshaus mit dem Sterngewölbe geliebt und sich dort stets sicher und geborgen gefühlt. Vor allem die kleine Marienkapelle mit einer schlichten Holzstatue der Gottesmutter im blauen Mantel hatte es ihr angetan, vielleicht, weil sie ihr all die Sorgen anvertrauen konnte, für die sie eigentlich eine Mutter aus Fleisch und Blut gebraucht hätte.
Doch als Johanna nun das Portal öffnete, erkannte sie die Kirche kaum wieder. Die Wände waren nackt und weiß gekalkt; nirgendwo mehr fand sie Bilder oder Statuen. Sogar das prächtige dreiflügelige Altargemälde, das Jüngste Gericht darstellend, hatte man entfernt. Nur seitlich brannten ein paar Kerzen in eisernen Halterungen und warfen seltsame Schatten. Und es roch so anders – keine Spur mehr von dem schweren Weihrauchduft, der früher alles durchdrungen hatte.
Beim Hereinkommen fiel ihr auf, dass sogar das Weihwasserbecken fehlte. Wie eine Wunde klaffte die Wand auf, an der es einst gehangen hatte. Sie ging weiter und kniete sich schließlich in eine der vorderen Bänke. Sie faltete die Hände und versuchte zu beten, doch ihre Gedanken stoben davon wie ein Schwarm aufgescheuchter Vögel.
Um sich besser zu sammeln, schloss sie die Augen.
Plötzlich glaubte sie, wütende Stimmen zu hören und das Getrampel vieler Füße, die hereinstürmten. Sie roch Feuer und sah, wie Leitern aufgestellt, Bilder grob von den Wänden gerissen und mit Äxten zerschlagen wurden, bis die ganze Kirche aussah wie ein Schlachtfeld. Die Reformierten behaupteten, nur in der Kargheit lasse Gott sich finden, alles andere sei sündiger Tand, der vom Wesentlichen ablenke. Für Johanna jedoch war es anders. Die frühere Schönheit und Fülle des Gotteshauses hatten ihr Herz berührt und geöffnet. Im Gebet hatte sie den harten Alltag draußen vergessen können. In diesem kalten, nüchternen Raum jedoch wollte ihr das nicht gelingen.
Sie floh regelrecht ins Freie und lockerte dabei das warme Wolltuch, das sie sich um die Schultern geschlungen hatte, weil sie sich mit einem Mal wie kurz vor dem Ersticken fühlte. Schließlich riss sie sich sogar die Haube vom Kopf und lief barhäuptig durch die Lindenallee, an der erste zartgrüne Blätter sprossen, weiter zum Friedhof. Ein sanfter Wind sang in den Zweigen, als wollte er ihr Mut machen. Dem alten grauen Beinhaus, vor dem sie sich als Kind stets gegruselt hatte, gönnte sie nur einen kurzen Blick und konzentrierte sich dann ganz auf die Grabsteine.
Und wenn er gar nicht irgendwo hier lag, sondern noch immer am Leben war – ein gichtiger Greis, voll von Hass und alten Rachegelüsten?
Trotz der warmen Frühlingssonne und des wolkenlosen blauen Tages fröstelte Johanna auf einmal. Sie brauchte endlich Gewissheit, musste mit eigenen Augen das Grab des Oheims sehen, um ganz und gar mit der Vergangenheit abschließen zu können. Doch ihr Vorhaben erwies sich als unerwartet schwierig. Schon eine ganze Weile irrte sie zwischen den Gräbern ohne Erfolg umher. Der Friedhof erschien ihr in denkbar schlechtem Zustand; viele Kreuze waren in Schieflage geraten, die Grabsteine verwittert oder von Moos überwachsen. Als sie schon kurz vor dem Aufgeben war, entdeckte sie plötzlich, wonach sie gesucht hatte.
BASIL SUTER
*1463 † 1530
Johanna musste schlucken und spürte, wie ihre Knie weich wurden. Er war tot, das stand hier in Blei getrieben auf hellem Sandstein, jener Mann, der ihr das Leben zur Hölle gemacht hatte, als sie zum ersten Mal unsterblich verliebt gewesen war. Doch die erwartete Erleichterung blieb aus. Stattdessen war es auf einmal, als öffnete sich ein großes Tor – und Bilder und Szenen aus der Vergangenheit überfielen sie: Jakobs Geburt, die Arbeit im Badehaus, die Pest in Freiburg, die Trauer über den vermeintlichen Tod des Sohnes, die Begegnung mit Severin, ihre Ehe in Köln, sein qualvolles Sterben, die Intrigen des Schwagers, Kerkerhaft und Pesthaus und endlich die Wiedervereinigung mit Vincent. All das war in nicht einmal zwanzig Jahren geschehen und hätte doch eigentlich für mindestens drei pralle Leben gereicht …
Sie spürte ein unangenehmes Ziepen am Haar und fuhr herum.
»Die schöne Johanna!«, sagte die Frau mit schiefem Lächeln. »Ich hab dich am Zopf gezogen wie früher. Sieh einmal her – hast du dich endlich wieder deines armen, verlassenen Oheims entsonnen?« Johanna brauchte ein paar