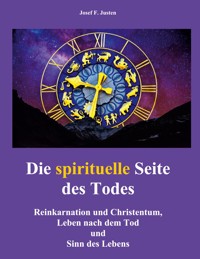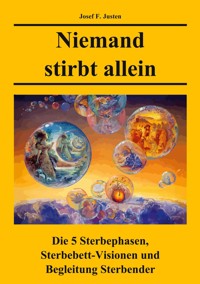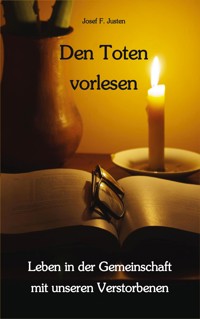Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unser gesamtes Leben erscheint uns wie eine lineare Folge von Ereignissen bzw. Erlebnissen. Alle diese Ereignisse sind deshalb eingetreten, weil wir an bestimmten Scheidewegen unseres Lebens ganz bestimmte Entscheidungen getroffen haben oder weil in diesen Augenblicken ganz bestimmte Begebenheiten an uns herangetreten sind. Tag für Tag müssen wir Entscheidungen treffen. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, werden wir in eine bestimmte Wirklichkeit geführt. In den weitaus meisten Fällen sind die Wirklichkeiten, die wir dann erleben, nicht sehr viel anders, als diejenigen, die wir erfahren hätten, wenn wir uns anders entschieden hätten. Diese bleiben in der Sphäre der Möglichkeiten verschleiert. Es gibt allerdings auch gewisse Scheidewege oder Knotenpunkte in unserem Leben, an denen wir vor einer besonders wichtigen Entscheidung stehen, wobei uns die Wichtigkeit dieser Entscheidungen meistens gar nicht bewusst ist, weil wir die Folgen nicht zu überblicken vermögen. Die Wirklichkeiten, die wir nun in Abhängigkeit von unserer Entscheidung erleben, können nun durchaus völlig - vielleicht sogar dramatisch - anders sein. Das Spektrum der wirklich eingetretenen Ereignisse ist geradezu armselig gegenüber dem derjenigen, die möglich gewesen wären. Jeder Mensch könnte unsagbar viel mehr erleben, als er wirklich erlebt. Auch der katholische Priester Peter Bröske, der Hauptprotagonist der folgenden Erzählung, stand einige Male in seinem Leben an einem Scheideweg, an dem er eine folgenschwere Entscheidung treffen musste. Es wird zunächst geschildert, wie sein Leben aufgrund seiner tatsächlich getroffenen Entscheidungen verlaufen ist. Dann wird erzählt, wie sein Leben sich gestaltet hätte, wenn er sich an diesen Knotenpunkten seiner Biografie anders entschieden hätte. Peter Bröske musste aus einer karmischen Notwendigkeit heraus in seinem Leben mit ganz bestimmten Menschen zusammenkommen. Das Schicksal hat ihn - sogar weitgehend unabhängig von den meisten Entscheidungen, die er traf - früher oder später, auf diese oder jene Weise zu ihnen geführt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An den Scheidewegen des Lebens
stehen keine Wegweiser.
Charlie Chaplin
Wirklichkeit und Möglichkeit,
wie die zwei Seiten
einer und derselben Münze
bedingen sie einander;
beide zusammen allein
sind die Münze.
Albert von Trentini
Alle Personen sowie die gesamte Handlung der folgenden Erzählung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden bzw. verstorbenen Personen wären rein zufällig und keinesfalls beabsichtigt. Auch die Namen der Orte sind willkürlich gewählt und zum Teil frei erfunden.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Der 1. Scheideweg (1963)
Der 2. Scheideweg (1968)
Der 3. Scheideweg (1975)
Der 4. Scheideweg (1995)
Die vierte andere Entscheidung (1995)
Die zweite andere Entscheidung (1968)
Die erste andere Entscheidung (1963)
Einleitung
Unser gesamtes Leben erscheint uns wie eine lineare Folge von Ereignissen bzw. Erlebnissen. Alle diese Ereignisse sind deshalb eingetreten, weil wir an bestimmten Scheidewegen unseres Lebens ganz bestimmte Entscheidungen getroffen haben oder weil in diesen Augenblicken ganz bestimmte Begebenheiten an uns herangetreten sind.
Tag für Tag müssen wir Entscheidungen treffen. Je nachdem, wie wir uns entscheiden, werden wir in eine bestimmte Wirklichkeit geführt. In den weitaus meisten Fällen sind die Wirklichkeiten, die wir dann erleben, nicht sehr viel anders, als diejenigen, die wir erfahren hätten, wenn wir uns anders entschieden hätten. Diese bleiben in der Sphäre der Möglichkeiten verschleiert.
Es gibt allerdings auch gewisse Scheidewege oder Knotenpunkte in unserem Leben, an denen wir vor einer besonders wichtigen Entscheidung stehen, wobei uns die Wichtigkeit dieser Entscheidungen meistens gar nicht bewusst ist, weil wir die Folgen nicht zu überblicken vermögen. Die Wirklichkeiten, die wir nun in Abhängigkeit von unserer Entscheidung erleben, können nun durchaus völlig – vielleicht sogar dramatisch – anders sein.
Das Spektrum der wirklich eingetretenen Ereignisse ist geradezu armselig gegenüber dem derjenigen, die möglich gewesen wären. Jeder Mensch könnte unsagbar viel mehr erleben, als er wirklich erlebt.
Auch der katholische Priester Peter Bröske, der Hauptprotagonist der folgenden Erzählung, stand einige Male in seinem Leben an einem Scheideweg, an dem er eine folgenschwere Entscheidung treffen musste. Es wird zunächst geschildert, wie sein Leben aufgrund seiner tatsächlich getroffenen Entscheidungen verlaufen ist.
Dann wird erzählt, wie sein Leben sich gestaltet hätte, wenn er sich an diesen Knotenpunkten seiner Biografie anders entschieden hätte.
Peter Bröske musste aus einer karmischen Notwendigkeit heraus in seinem Leben mit ganz bestimmten Menschen zusammenkommen. Das Schicksal hat ihn – sogar weitgehend unabhängig von den meisten Entscheidungen, die er traf – früher oder später, auf diese oder jene Weise zu ihnen geführt.
Wir sollten uns des Öfteren fragen und darüber nachsinnen:
Was könnte uns Tag für Tag alles geschehen, wenn wir irgendetwas geringfügig anders gemacht hätten, als wir es dann letztlich tatsächlich gemacht haben?
Welche Folgen hätten andere Entscheidungen als die, die wir tatsächlich getroffen haben, nach sich ziehen können?
Dadurch können wir im Laufe der Zeit ein ganz konkretes Gespür dafür gewinnen, wie das Karma wirkt und waltet.
Zu mancher richtigen Entscheidung kam es nur,
weil der Weg zur falschen gerade nicht frei war.
Hans Krailsheimer
Am ersten Advendssonntag des Jahres 1948 kam Peter Bröske in einem Essener Krankenhaus zur Welt. Er wurde, wie man damals zu sagen pflegte, auf Kohle geboren.
In der Tat gab es in dieser Zeit im gesamten Ruhrgebiet zahlreiche Kohlebergwerke. Auch der Stadtteil Katernberg, in dem die Bröskes wohnten, war noch stark vom Bergbau geprägt. Viele Menschen lebten von der Tätigkeit auf der dortigen Zeche Zollverein oder der Kokerei. Peters Großvater war selbst noch unter Tage beschäftigt.
Dessen ganzer Stolz war es, dass er seinem Sohn, Peters Vater, ein Studium finanzieren konnte, was in der damaligen Zeit für einen Arbeiter alles andere als selbstverständlich war.
Peters Vater wurde Lehrer und zwei Jahre vor Peters Geburt zum Rektor der Katernberger Volksschule befördert. Frau Bröske war wie die meisten Frauen in der Nachkriegszeit nicht berufstätig. Ihr oblag es, sich um den Haushalt sowie ihre knapp zweijährige Tochter Marlies und nun auch um ihren Sohn, mit dessen Geburt die Familie komplettiert wurde, zu kümmern.
Peter verlebte eine recht schöne und weitgehend unbeschwerte Kindheit. Auch wenn er sich mit seiner Schwester bestens verstand, so bevorzugte er es doch, mit den Jungen der Nachbarschaft auf einer der vielen Rasenflächen, die in der Wohnsiedlung angelegt waren, Fußball zu spielen. Es galt geradezu als unschicklich, dass Jungen draußen mit Mädchen spielten – und schon gar nicht Fußball. Auch die Mädchen waren lieber unter sich.
Peter war bei seinen Freunden und auch bei den Nachbarn sehr beliebt. Schon, als er noch im Vorschulalter war, zeichnete er sich durch eine außergewöhnliche Empathie aus. Wann immer ein Kind sich beim Spielen wehgetan hatte, empfand er es fast wie seinen eigenen Schmerz und setzte alles daran, seinen Spielgefährten zu trösten.
Dieses Mitgefühl nahm auch in den folgenden Jahren nicht ab. Peters Mutter war psychisch nicht allzu stabil und litt des Öfteren an depressiven Verstimmungen. Auch wenn sie sich noch so sehr bemühte, ihre Anwandlungen ihrem Mann und ihren Kindern gegenüber zu verbergen, bemerkte es Peter sehr wohl. Er setzte dann alles daran, sie aufzuheitern oder sie mit irgendetwas zu erfreuen, was ihm auch meistens gelang. Er war seiner Mutter immer ein großer Trost und eine wichtige Stütze.
Darüber hinaus war Peter äußerst tierlieb. Oftmals hat er einen verletzten Vogel mit nach Hause genommen und ihn gesund gepflegt. Es war für ihn immer ganz schlimm, wenn er mitbekam, dass ein Nachbar ein Huhn oder einen Hasen schlachtete. Wenn es zu Hause Fleisch zu Mittag gab, so war ihm schon mit acht, neun Jahren klar, dass dazu ein Tier geschlachtet werden musste. Seine ersten Versuche, eine Fleischmahlzeit zu verweigern, schmetterte sein Vater mit der Bemerkung »Gegessen wird, was auf den Tisch kommt!« ab. Peter aß es dann nur höchst widerwillig und mit einer gewissen Abscheu. Da er sich anschließend oftmals übergeben musste, verzichtete sein Vater letztlich darauf, ihn zum Fleischverzehr zu zwingen. So wurde er schon sehr früh zum Vegetarier, was in dieser Zeit noch sehr ungewöhnlich war.
Obwohl seine Eltern keine allzu frommen Leute waren und nicht regelmäßig in die Kirche gingen, liebte Peter die katholischen Gottesdienste sehr. Er ließ kaum eine Gelegenheit aus, die Heilige Messe oder auch mal eine nachmittägliche Andacht zu besuchen. Er war stets mit ganzem Herzen dabei. Der Kultus mit den bunten Gewändern des Priesters und der Ministranten, dem Altarschmuck, den vielen brennenden Kerzen sowie die feierliche und geheimnisvolle Stimmung haben seine kindliche Seele stets stark ergriffen. Anschließend stellte er häufig daheim die Messfeier mit spielerischem Ernst nach. Der Küchentisch wurde zum Altar umfunktioniert, ein Weinglas diente als Kelch, Oblaten als Hostien, ein kleiner Teller als Patene und eine Schürze seiner Mutter als Messgewand. Peters Mutter und seine Schwester Marlies mussten ihm dabei assistieren. Im Rahmen dieses Spiels hielt er sogar hin und wieder eine kurze Predigt, deren Inhalte für einen Knirps, wie er noch einer war, bemerkenswert waren und seine Mutter erstaunten.
Kurz nachdem Peter in seinem neunten Lebensjahr die Erstkommunion empfangen hatte, meldete er sich beim Pfarrer der Gemeinde und fragte, ob er zu den Ministranten kommen dürfe. Dieser freute sich sehr über sein Interesse.
So besuchte er schon ab der folgenden Woche einen Einführungskurs für neue Messdiener, wie die Ministranten in dieser Zeit im Ruhrgebiet genannt wurden, den der Gemeindepfarrer hielt. An diesem Kursus nahm Peter mit großer Begeisterung teil. Anschließend durfte er erstmals dem Pfarrer beim Zelebrieren der Heiligen Messe ministrieren, was ihn mit großem Stolz erfüllte.
Auch in den folgenden Jahren gehörte seine Ministrantentätigkeit zu den Aufgaben, die er stets mit besonderer Freude wahrnahm. Mindestens einmal in der Woche verrichtete er seinen Dienst am Altar.
In seinem elften Lebensjahr endeten die vier Jahre seiner Zeit auf der Volksschule. Für Peters Vater stand von Anfang an fest, dass er seinen Sohn auf ein Gymnasium schicken wird. Er meldete Peter auf der gleichen Schule an, auf der er selbst vor knapp 30 Jahren das Abitur gemacht hatte. Es war ein Gymnasium mit naturwissenschaftlicher und neusprachlicher Ausrichtung. Herr Bröske vertrat die nachvollziehbare Meinung: »Die Technik ist immer mehr im Kommen. Da bietet dir eine Schule mit diesen Schwerpunktfächern die richtige Basis, damit du später vielleicht einmal ein entsprechendes Studium absolvieren kannst.«
Peter war es eigentlich egal, auf welche Art von höherer Schule er gehen sollte. Mit der Wahl seines Vaters war er aber durchaus einverstanden, zumal die Schule nicht weit entfernt und somit zu Fuß zu erreichen war und einige seiner gleichaltrigen Freunde auf dieselbe wechselten.
Peter war auf der Volksschule ein außerordentlich fleißiger und guter Schüler. Das sollte auch auf dem Gymnasium für einige Zeit so bleiben. Ohne viel dafür tun zu müssen, brachte er in allen Fächern stets gute Noten mit nach Hause.
Doch das änderte sich schleichend, als er mit vierzehn Jahren in die Untertertia – das war früher die Bezeichnung für die vierte Klasse eines Gymnasiums – versetzt wurde. Jetzt in der sogenannten Mittelstufe kam es zu einem Lehrerwechsel. Die Klasse, in der Peter war, bekam einen anderen Lehrer, der sie in den Fächern Mathematik und Physik unterrichtete. Dieser Oberstudienrat Linneborn war schon ein älterer Herr, dem man deutlich anmerken konnte, dass ihm sein Beruf längst keinen Spaß mehr bereitete. Es fiel ihm schwer, zumindest den Anschein eines motivierten Lehrers zu erwecken. Häufig saß er nur am Pult und ließ die Schüler sich den Unterrichtsstoff selbst aus den Büchern erarbeiten. Auf Fragen reagierte er oftmals sehr ungehalten.
Es gab in dieser Zeit durchaus eine ganze Reihe von Pädagogen, die ihre Tätigkeit nur noch recht widerwillig ausübten. Viele von ihnen hatten ihre nationalsozialistische Gesinnung nicht abgelegt und waren immer noch fürchterlich enttäuscht, dass die Nazi-Herrschaft vorüber war. Allerdings ließen nicht alle ihren Frust so deutlich an ihren Schülern aus, wie das bei Herrn Linneborn der Fall war. Trotz seines geringen Engagements war er sehr streng und konnte ganz fürchterlich ausrasten, wenn ein Schüler nicht parierte. Schon bei den kleinsten Vergehen prügelte er auf ihn ein, was selbst in dieser Zeit nicht mehr der Normalfall war. Besonderen Spaß schien es ihm zu machen, einen Schüler, den er nicht mochte, vorzuführen und lächerlich zu machen. Peter verlor langsam das Interesse an diesen Fächern. Entsprechend wurden seine Leistungen allmählich immer schlechter.
Anfangs gehörte Peter noch nicht zu denjenigen Schülern, die Herr Linneborn auf dem Kieker hatte. Aufgrund seines Gerechtigkeitsgefühls und seines empathischen Charakters versuchte er stets, die seiner Meinung nach völlig zu unrecht bestraften Mitschüler zu verteidigen und zu trösten. Das brachte seinen Lehrer so auf die Palme, dass er sich jetzt mehr und mehr auf Peter einschoss.
Da Peters Interesse an diesen Fächern immer mehr abnahm und seine Leistungen folglich schwächer und schwächer wurden, hatte Oberstudienrat Linneborn jetzt einen konkreten Grund, ihn immer wieder als Versager vor der Klasse bloßzustellen. Seinen Schulfrust konnte Peter nur durchs Fußballspielen und durch sein Engagement als Ministrant kompensieren. Beides tat er nach wie vor leidenschaftlich gern.
Eines Abends machte Peter seinem Vater gegenüber einige Andeutungen über die entsetzliche Lage, in der er war. Sein Vater sagte: »Na ja, dein Lehrer wird schon seine Gründe haben, warum er sich so verhält! Heutzutage sind ja viele Schüler rotzfrech, so dass man ihnen als Lehrer die Grenzen aufzeigen muss. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass du dich unflätig verhältst! Also, ich werde Herrn Linneborn in seiner nächsten Sprechstunde einmal aufsuchen und mit ihm von Kollege zu Kollege reden. Dann wird sich gewiss alles aufklären.«
Dann kam es zu der Unterredung, die Peters Vater als zielführend und erfreulich empfand. Peter war etwas beruhigt, traute dem Braten aber noch nicht. Und das mit Recht!
Schon in der nächsten Stunde bei Oberstudienrat Linneborn wurde deutlich, dass der Schuss nach hinten losgegangen war. Der Lehrer empfand Herrn Bröskes Intervention als Affront. Richtete sich Herrn Linneborns Antipathie bisher auf nahezu alle Schüler, so hatte er jetzt im Grunde nur noch eine Zielscheibe – und das war Peter! Die Stunden bei diesem Möchtegern-Pädagogen waren für ihn von nun an die reinste Hölle.
Ein paar Wochen hielt Peter noch durch und ließ sich die vielen Ungerechtigkeiten und Unverschämtheiten gefallen. Dann sagte er seinem Vater: »Ich kann nicht mehr! Seitdem du mit Herrn Oberstudienrat Linneborn gesprochen hast, ist alles noch viel schlimmer geworden. Ich will nicht mehr auf der Schule bleiben.«
Sein Vater glaubte ihm, meinte aber: »Willst du es nicht noch einmal versuchen, dich an ihn zu gewöhnen. Vielleicht solltest du dich durchbeißen. Hier gibt es weit und breit kein zweites naturwissenschaftliches Gymnasium. In vertretbarer Nähe gibt es lediglich eines mit humanistisch-altsprachlicher Ausrichtung.« Peter schwieg eine Weile. Dann sagte er: »Ich habe kein Problem, auf ein humanistisches Gymnasium zu gehen.« Herr Bröske fuhr fort: »Ich denke, du bist mit deinen fast fünfzehn Jahren jetzt alt genug, solche Entscheidungen selbst zu treffen. Schließlich geht es um dein Leben!«
Der1. Scheideweg (1963)
Peter Bröske musste nun zum ersten Mal in seinem noch jungen Leben eine wichtige und wegweisende Entscheidung treffen. Er stand gewissermaßen an einem Scheideweg, an einem Schicksalspunkt seines Lebens. Es ging für ihn darum, ob er trotz aller Misslichkeiten an seiner alten Schule bleiben oder ob er sie verlassen und stattdessen auf ein humanistisches Gymnasium wechseln sollte.
Freilich konnte er nicht ahnen, wie ganz anders sein weiteres Leben verlaufen würde, wie ganz anders sein Schicksal sich gestalten würde, je nachdem, für welche der beiden Möglichkeiten er sich entscheiden wird.
Peter hatte nach kurzer Bedenkzeit seine Entscheidung gefällt. Er wollte sich nicht mehr länger von seinem Lehrer so drangsalieren und demütigen lassen und bat seinen Vater, ihn auf dem humanistischen Gymnasium anzumelden. Schweren Herzens nahm er in Kauf, dass er dann einige Schulkameraden, die er sehr mochte, nicht mehr wiedersehen werde.
Wie völlig anders Peters weiteres Leben und auch die der Menschen aus seinem Umfeld verlaufen wären, wenn er auf dem naturwissenschaftlichen Gymnasium geblieben wäre, werden wir später schildern ( S.
→
bis
→
). Dieser
mögliche
weitere Verlauf seines Lebens ist nicht in den Bereich der Wirklichkeiten eingetreten, sondern blieb in der
Sphäre der Möglichkeiten
verschleiert, hatte aber in gewissem Sinne dennoch eine Realität.
Schon am nächsten Tag meldete Herr Bröske seinen Sohn auf dem humanistischen Gymnasium an. Da diese Schule knapp zehn Kilometer entfernt war, fuhr Peter jeden Tag mit der Straßenbahn hin und auch wieder zurück.
Einer der Schwerpunkte auf dem neuen Gymnasium lag auf den Fächern Latein und Alt-Griechisch. Auf der bisherigen Schule hatte Peter erst ein wenig Latein gelernt, und Griechisch wurde dort im Grunde gar nicht unterrichtet. Man konnte es allenfalls in der Oberstufe als Wahlfach belegen. Daher wurde er eine Klasse zurückgestuft, um so leichter das Versäumte aufholen zu können. Mit sehr viel Fleiß gelang es ihm, das Jahr zu nutzen und in den altsprachlichen Fächern auf das Niveau seiner Mitschüler zu gelangen. Bereits im zweiten Jahr war er Klassenbester und blieb es bis zur Oberprima, der letzten Klasse.
Peter wurde von seinen Lehrern und Klassenkameraden aufgrund seiner freundlichen Art und seiner Hilfsbereitschaft schon bald sehr geschätzt. Irgendwie wusste er meistens Rat, wenn seine Mitschüler sich mit ihren Problemen und Problemchen an ihn wandten.
Als eine besondere Gunst empfand Peter, dass das Fach Religion in seiner Klasse von einem noch jungen Geistlichen unterrichtet wurde. Dieser – sein Name war Bernhard Hoffs – wirkte als Vikar in der Nachbarpfarrei der Bröskes. Er war nur gut zehn Jahre älter als seine Schüler. Während Peter den Religionsunterricht auf seiner alten Schule meistens als langweilig, ja als Zeitverschwendung empfunden hatte, wurde er jetzt von der lebendigen und inspirierenden Art, wie der junge Vikar den Unterricht gestaltete, ganz in den Bann gezogen.
Da Peter seinen neuen Religionslehrer so sehr schätzte, besuchte er von nun an immer die Gottesdienste in der Nachbarpfarrei, in der Herr Hoffs als Vikar tätig war. Die Art, wie dieser die Heilige Messe zelebrierte, und insbesondere seine Predigten begeisterten Peter sehr. Schon bald wurde er in die Gruppe der dortigen Ministranten aufgenommen.
Vikar Hoffs war ein recht fortschrittlich denkender Mann. Gegen den anfänglichen Widerstand des Gemeindepfarrers, also seines Vorgesetzten, erwirkte er, dass auch Mädchen das Ministrantenamt in der Pfarrei versehen durften. Das war ein geradezu revolutionärer Schritt. Es war in dieser Zeit noch völlig unüblich, dass Mädchen bei der Messe am Altar dienen durften.
Bei den Jugendlichen war der junge Vikar außerordentlich beliebt. Das lag zum einen daran, dass er selbst noch relativ jung war und somit die Sprache und Bedürfnisse der Heranwachsenden noch verstehen konnte. Der andere Grund war, dass er sich viel mit den jungen Leuten befasste und ihnen zahlreiche Angebote machte, die Peter aus seiner Heimatpfarrei nicht kannte. So veranstaltete Vikar Hoffs regelmäßig Gesprächskreise, in denen es nicht nur um Themen aus dem Neuen Testament, sondern auch um vieles andere ging, was junge Menschen bewegte. An manchen Wochenenden unternahm er mit den Messdienern Ausflüge an den Baldeneysee oder ins nahe Sauerland. Genau wie Peter war auch er sehr naturverbunden und tierlieb. Er zeigte und erklärte den Jugendlichen seltene Pflanzen und erzählte viel über die Tiere, die sie bei ihren Wanderungen zu sehen bekamen.
In den Sommerferien veranstaltete Herr Hoffs mit einer Gruppe von Ministranten ein zweiwöchiges Ferienlager. Mal ging es ins Münsterland, mal ins Siegerland, mal in den Teutoburger Wald, mal an die Nordsee. Es wurde gewandert, gespielt und geredet. Abends saß man am Lagerfeuer, wo gesungen, erzählt und über Gott und die Welt gesprochen wurde.
Als Peter sechzehn Jahre alt war, wurde er Oberministrant, was ihn sehr stolz machte. Neben ihm gab es noch drei andere Oberministranten. Erstaunlicherweise wurde sogar ein Mädchen in diesen Kreis berufen. Als solcher hatte Peter jetzt vielfältige Aufgaben. So teilte er die Ministranten für die jeweiligen Gottesdienste ein, schulte die neu hinzugekommenen Messdiener, plante zusammen mit Herrn Hoffs Ausflüge und Ferienlager.
Des Weiteren veranstaltete er gemeinsam mit den drei anderen Oberministranten Spielnachmittage für die Schar der Messdiener. Im wöchentlichen Wechsel dachte sich jeder der Oberministranten eines oder mehrere Spiele aus, durch welche die Phantasie der zumeist noch jungen Messdiener angeregt werden sollte. An einem dieser Nachmittage wartete die Oberministrantin, die an diesem Tag die Spielleitung übernahm, mit einem besonders interessanten Spielvorschlag auf, der von allen mit Begeisterung aufgenommen wurde. Sie nannte es: »Was würdest du dir wünschen, wenn du noch einmal auf die Welt kommen würdest?« Jeder der Anwesenden wurde aufgefordert, einen oder mehrere Wünsche auf einem Zettel zu notieren. Dann wurden die Zettel eingesammelt und das, was darauf stand, vorgelesen.
Die am häufigsten genannten Wünsche lauteten: »Ich wünsche, in einem Land geboren zu werden, in dem immer die Sonne scheint.«
»Ich wünsche, die gleichen Eltern zu bekommen, die ich heute habe.«
»Ich möchte nicht, dass mein Bruder in einem anderen Leben wieder mein Bruder wird.«
»Ich möchte in einem Land geboren werden, in dem es keine Schulen gibt.«
»Ich wünsche, dass ich dann alle meine Verwandten und Freunde wiedertreffen werde.«
»Ich möchte auf einem Bauernhof aufwachsen, auf dem viele Kühe und Pferde sind.«
»Ich wünsche, dass man keine Mathematik mehr lernen muss. Am besten wäre es, wenn man gar nicht mehr zur Schule müsste.«
»Ich möchte wieder Ministrant werden.«
Etwas später durfte Peter beim Unterricht für die Kinder, deren Erstkommunion anstand, mitwirken. Hin und wieder hielt er sogar kurze Vorträge über religiöse Themen, die bisweilen sogar von Erwachsenen gehört wurden. Schnell wurde offenbar, dass Peter ein natürliches Talent zum Reden hatte. Alle diese Aufgaben erfüllten Peter sehr. Fürs Fußballspielen blieb jetzt kaum noch Zeit.
Peter nahm seine Pflichten sehr ernst und übte sie höchst gewissenhaft aus. Nachdem er häufig während der Heiligen Messe feststellen musste, dass viele Messdiener recht unkonzentriert wirkten und nicht ruhig stehen konnten, nahm er diese bei der nächsten Zusammenkunft der Ministranten ins Gebet. Mit freundlichem, aber bestimmtem Ton sagte er der Gruppe: »Ich finde es nicht gut, dass ihr am Altar oft unaufmerksam und zappelig seid. Macht euch vor jedem Gottesdienst immer ganz bewusst, dass ihr einer heiligen Handlung beiwohnt, bei der auch unser auferstandener Herr Jesus Christus anwesend ist.«
Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht.
Dann kam alles, wie es eigentlich kommen musste. Peter war von Vikar Hoffs, der längst sein großes Vorbild war, derart fasziniert, dass er auch Priester werden wollte. Herr Hoffs, mit dem er immer wieder über seinen Berufswunsch sprach, bestärkte ihn in seinem Vorhaben. Seinen Eltern wollte es Peter noch nicht anvertrauen, da er fürchtete, dass sein Vater damit nicht einverstanden sein würde.
Nachdem Peter im Alter von neunzehn Jahren sein Abitur mit Glanz bestanden hatte, suchte er das Gespräch mit seinen Eltern: »Auf eure Frage, ob ich schon wisse, was ich studieren möchte, habe ich bisher immer recht ausweichend geantwortet. Jetzt weiß ich es! Ich möchte Priester werden!«
Seine Mutter schien gar nicht einmal sonderlich erstaunt zu sein und meinte: »Da du dich seit Jahren so sehr in der Nachbarpfarrei engagiert hast, habe ich mir so etwas schon gedacht. Ich denke, eine Seelsorgertätigkeit passt sehr gut zu dir. Ich glaube, das ist sogar deine Berufung!«
Herr Bröske legte seine Stirn in Falten und sprach: »Überlege dir das gut, mein Junge! Deine Mutter und ich sind nicht die einzigen, die mit der Kirche nicht mehr viel verbinden können. Die Pfaffen haben in den letzten Jahrzehnten mit ihren Drohbotschaften viel Kredit verspielt. Auch gelingt es den meisten nicht, die christlichen Wahrheiten verständlich zu lehren. Im Dritten Reich hat sich die katholische Kirche ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. Schließlich halte ich es für geradezu widernatürlich, dass die Priester zölibatär leben müssen. Du wirst also niemals eine Frau lieben dürfen. Überlege es dir also gut!«
Peter ließ sich nicht beirren und beharrte auf seinem Vorhaben. Allerdings war ihm bewusst, dass es nicht leicht sein würde, zeitlebens keine Frau haben zu dürfen. Er hatte nämlich mit der Liebe zum anderen Geschlecht schon Erfahrungen gesammelt. Wie bereits erwähnt gehörte zu den Oberministranten ein Mädchen. Sie hieß Ursula Jansen und war ein paar Monate jünger als er. Es war diejenige, die seinerzeit das Spiel »Was würdest du dir wünschen, wenn du noch einmal auf die Welt kommen würdest?« vorgeschlagen hatte. Die beiden waren sich von Anfang an sehr sympathisch und fühlten sich zueinander hingezogen. Sie sahen sich regelmäßig bei den verschiedenen Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde. Des Öfteren gingen sie auch gemeinsam spazieren oder ins Kino. Peter empfand das hübsche Mädchen mit ihren kastanienbraunen, leicht gelockten Haaren und ihren rehbraunen Augen äußerst anziehend. Das, was zwischen ihnen waltete, war ungleich mehr als eine jugendliche Schwärmerei oder Liebelei. Da in ihm allerdings schon der Wunsch lebte, Priester zu werden, beließ er die körperliche Nähe bei Umarmungen und einigen Küssen. Es fiel beiden allerdings unsagbar schwer, diesen Punkt nicht zu überschreiten. Dass die Liebe, die beide füreinander empfanden, wohl unerfüllt bleiben müsste, war beiden bewusst. So entwickelte sich zwischen ihnen eine mehr platonische Freundschaft. Die tiefe Zuneigung, die sie verband, machte es ihnen allerdings unmöglich, den anderen jemals zu vergessen.
Peter war klar, dass er noch den obligatorischen 18-monatigen Wehrdienst bei der Bundeswehr ableisten musste, bevor er sich zum Studium einschreiben konnte. Davor graute ihm gewaltig! Es war für diesen friedliebenden und mitfühlenden jungen Mann eine geradezu fürchterliche Vorstellung, zum Kriegsdienst an der Waffe ausgebildet zu werden und womöglich einmal in den Krieg ziehen zu müssen.
Er hatte schon in Erwägung gezogen, den Wehrdienst zu verweigern und stattdessen einen Wehrersatzdienst abzuleisten. In dieser Zeit des Kalten Krieges, in der schon ein geringer Anlass einen dritten Weltkrieg auslösen konnte, war es äußerst schwierig, als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu werden. Peter hatte auch mitbekommen, dass fast alle Mitschüler und Freunde, die einen Antrag gestellt hatten, in der anschließenden mündlichen Anhörung abgeschmettert wurden, weil sie keine hinreichenden Gründe hätten. So hielt er es im Grunde für nahezu aussichtslos, einen Antrag zu stellen. Sein Vater war ganz entsetzt, als er hörte, dass Peter mit dem Gedanken spielte, den Wehrdienst zu verweigern. »Natürlich sind das im Grunde achtzehn verlorene Monate. Aber es gehört zu den staatsbürgerlichen Pflichten eines jeden gesunden jungen Mannes, im Kriegsfall sein Land zu verteidigen! Und genau dazu dient der Wehrdienst. Ich fände es verwerflich, wenn du dich dem entziehen würdest.«
Der2. Scheideweg (1968)
In Peter arbeitete es. Die Argumente seines Vaters überzeugten ihn nicht. Allerdings rechnete er sich wenig Chancen aus, dem Wehrdienst zu entkommen.
Er stand nun vor der zweiten wichtigen Entscheidung in seinem Leben. Wie sollte er verfahren? Sollte er den Wehrdienst über sich ergehen lassen und hoffen, dass es später nicht zum Krieg kommt, oder sollte er doch einen Antrag auf Wehrdienstverweigerung stellen, wenngleich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser anerkannt würde, gering war?
In der folgenden Nacht hatte Peter einen Traum, der ihn schweißgebadet aus dem Schlaf riss. Er sah sich in diesem Traum inmitten von grausamen Kriegshandlungen, bei denen er schließlich von einem umgestürzten Militärfahrzeug zerquetscht wurde.
Jetzt stand sein Entschluss fest! Er stellte einen schriftlichen Antrag auf Wehrdienstverweigerung, den er mit Hilfe von Vikar Hoffs sehr ausführlich und eindringlich begründete.
Natürlich konnte er auch dieses Mal nicht ahnen, wie ganz anders sein Schicksal sich gestaltet hätte, wenn er den Antrag
nicht
gestellt hätte. Wie radikal, ja dramatisch anders sein weiteres Leben von diesem Zeitpunkt an verlaufen wäre und wie das Leben einiger Menschen aus seinem Schicksalskreis sich gestaltet hätte, wenn er den Wehrdienst abgeleistet hätte, soll an späterer Stelle geschildert werden ( S.
→
bis
→
).
Drei Wochen später kam es zu einer mündlichen Anhörung. Peter konnte in dieser selbst die provokativsten Fragen der Kommission plausibel beantworten. Da er ein ausgezeichneter Rhetoriker war, kamen seine Argumente gut rüber.
Wenige Tage später erhielt er zu seiner großen Freude die offizielle Nachricht, dass sein Antrag positiv beschieden wurde. Seine Mutter und insbesondere seine pazifistisch gesinnte Schwester waren ganz stolz auf Peter, weil er den Wehrdienst und somit auch einen späteren möglichen Kriegsdienst verweigerte.
Wenn jemand so wie Peter als Wehrdienstverweigerer anerkannt war, musste er stattdessen einen Wehrersatz- bzw. Zivildienst leisten. Bis zu einem gewissen Grad konnte man sich eine geeignete Einrichtung, bei der man diesen Dienst verrichten wollte, selbst suchen.
Peter fragte bei einigen Krankenhäusern an, ob er dort seinen Zivildienst machen könnte. Schließlich bekam er von einem, das in der Nachbarstadt Gelsenkirchen lag, eine Zusage.
Hier wurde er nach einer mehrtägigen Unterweisung als Hilfskrankenpfleger beschäftigt. In erster Linie oblag es ihm, die Mahlzeiten an die Patienten auszuteilen, sie morgens zu waschen und ihre Notdurft zu entsorgen. Im Grunde machte er alles, wozu die professionellen Krankenschwestern und Krankenpfleger weder Zeit hatten noch Lust verspürten. Er nahm seine Aufgabe, die nicht immer ganz leicht war, aus Liebe und Mitleid mit den Kranken wahr. Wann immer er die Zeit fand, suchte er das Gespräch mit den Patienten, bei denen er sich nach ihren Wünschen, Hoffnungen und Sorgen erkundigte. Viele empfanden sein Engagement als großen Trost. Insbesondere wenn er Nachtdienst hatte, nutzte er die Gelegenheit, sich mit denjenigen Patienten zu unterhalten, die nicht schlafen konnten. Er ließ sie aus ihrem Leben erzählen oder las ihnen etwas vor. Die älteren Patienten schätzten es sehr, wenn er ihnen aus der Bibel vorlas. Oftmals dachte er: »Wenn ich mich nicht schon fest entschlossen hätte, den Priesterberuf zu ergreifen, könnte ich mir auch eine Tätigkeit als Pfleger oder Arzt vorstellen. Auch in einem solchen Beruf kann man etwas für andere Menschen tun.«
Einige Male stand er Patienten in deren Sterbestunde bei.
In seiner Freizeit engagierte er sich weiter in der Pfarrgemeinde. Als Ministrant war er eigentlich schon zu alt. Im Regelfall wurden diese, wenn sie so sechzehn, siebzehn Jahre alt waren, von ihrer Aufgabe entbunden. Bei Peter machte Vikar Hoffs eine Ausnahme. Da er zum einen zu den Oberministranten der Pfarrei gehörte und da er zum anderen Priester werden wollte, durfte er nach wie vor bei den sonntäglichen Hochämtern ministrieren. Auch seine anderen Aufgaben, die er in der Gemeinde übernommen hatte, übte er nach wie vor gewissenhaft aus, soweit es seine Zeit erlaubte. Mit Ausnahme von Ursula Jansen waren auch die anderen Oberministranten noch als solche aktiv. Ursula war jedoch wie von der Bildfläche verschwunden, ohne dass die beiden sich voneinander verabschiedet hätten.
Mit Vikar Hoffs hatte sich Peter mittlerweile richtig angefreundet. Dieser hatte ihm sogar das Du angeboten.
Ein halbes Jahr vor Abschluss seines Zivildienstes meldete sich Peter im Jahre 1970 zur Priesterausbildung an. Ihm wurde ein Studienplatz an einem Priesterseminar im Sauerland angeboten, wo er sich unverzüglich einschreiben ließ. Als dann das Studium begann, bezog er ein Zimmer in dem Konvikt, das dem Priesterseminar angegliedert war und das mit einem Studentenwohnheim an einer Universität zu vergleichen ist.
Das Studium dauerte insgesamt sechs Jahre. In den ersten Semestern musste Peter insbesondere Vorlesungen und Seminare über katholische Theologie und Kirchengeschichte belegen. Auch wenn ihm die dargebotenen Inhalte als etwas trocken erschienen, ließ er es an Fleiß nie vermissen. Als viel interessanter empfand er das, was in den letzten Semestern vermittelt wurde. Hier ging es unter anderem um pastorale Themen sowie die Liturgie der Messfeier.
Peter wurde von seinen Lehrern und Mitstudenten sehr geschätzt. Nur einmal legte er sich mit einem Dozenten an. Dieser forderte die Studenten auf, in ihrer späteren Ausübung des Priesteramtes die Gläubigen immer wieder zu ermahnen, ein anständiges und gottgefälliges Leben zu führen, damit sie nach ihrem Tod nicht ewige Qualen in der Hölle erleiden müssen. Daraufhin ergriff Peter das Wort: »Ich kann nicht glauben, dass es wirklich eine Hölle gibt, in der die bösen Menschen leiden müssen und aus der es kein Entrinnen gibt. Wie könnte man das mit der Liebe und Güte Gottes in Einklang bringen?« Einige seiner Mitstudenten nickten. Der Dozent antwortete in scharfem Ton: »Was Sie glauben, ist nicht von Belang! Entscheidend ist, was die heilige römisch-katholische Kirche lehrt! Das, was sie sagt, ist Gottes Wort! Im Katechismus heißt es ganz unmissverständlich, dass es eine Hölle gibt, in der die Menschen, die sich von Gott getrennt haben, ewig leiden werden! Basta!« Peter war klar, dass es keinen Sinn macht, mit diesem verbohrten Kirchenlehrer weiter zu diskutieren. An so etwas wie das Fegefeuer, in dem sich die wohl meisten Menschen erst von ihren Schwächen, Begierden und Trieben reinigen müssen, bevor sie reif sind, in den Himmel aufgenommen zu werden, glaubte er sehr wohl. Aber die Vorstellung ewiger Höllenqualen passte nicht in sein Weltbild.
An den Wochenenden fuhr Peter meistens heim zu seinen Eltern und seiner Schwester. Mittlerweile hatte er sich einen alten VW-Käfer zugelegt, so dass er nicht auf die schlechte Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln angewiesen war. Mit dem Auto dauerte es nur knapp zwei Stunden, bis er Essen erreichte.
Selbstverständlich besuchte er sonntags die Messe in der Kirche, in der er einige Jahre seine Aufgaben als Ministrant und später als Oberministrant wahrgenommen hatte. Auch jetzt ministrierte er noch bisweilen. Anschließend traf er sich meistens mit seinem Freund Bernhard Hoffs. Wenn dieser Zeit hatte, verbrachten sie den restlichen Tag miteinander. Peter berichtete Vikar Hoffs von den Fortschritten seines Studiums und ließ sich viele Ratschläge für die weitere Ausbildung sowie für sein späteres priesterliches Wirken geben.
Im letzten Jahr der Ausbildung wurde den Studenten empfohlen, sich selbst zu prüfen, ob sie sich zum Priesteramt wirklich